|
Schweizer Märchen Sagen und Fenggengeschichten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illustrationen von Marianne Spälty
© 1984 by Zbinden Druck und Verlag AG, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Switzerland by Zbinden Druck und Verlag AG, Basel
ISBN 3-85989-050-6 |
Wie der Band zustande kam
Curt Englert hatte vorgesehen, zu den «Schweizermärchen» eine zweite Folge zu veröffentlichen.
Noch im Jahre 1944 schrieb er an den Herausgeber: «der zweite Band der Märchen ist fertig. Er ist noch schöner als der erste.»
Er sandte - laut Mitteilungen von Englert das Manuskript zur Beurteilung an seinen verehrten Lehrer Karl Meuli in Basel. Nachforschungen nach dem Hinscheiden Englerts (1945) bei Karl Meuli und später im Nachlaß Meulis, sowie bei den Verlagen, die hierfür in Frage kamen, blieben ergebnislos. Man muß annehmen, daß er das Manuskript nie erhalten hat, daß es in den Kriegswirren verschollen ist.
Ein Doppel war nicht vorhanden; ebensowenig ein Verzeichnis der Texte, die er an Professor Meuli gesandt hatte. Englert ließ, seiner Gewohnheit gemäß, bis zum letzten Moment alles offen, um fortzu ändern und umstellen zu können, alle neuen Gesichtspunkte berücksichtigend, die sich ihm aus dem Leben mit diesen Texten ergaben.
So blieb die Aufgabe, zu versuchen, aus dem vorhandenen umfangreichen Nachlaßmaterial einen Band zusammenzustellen.
Es galt zunächst diejenigen Texte herauszusuchen, die von Englert für Herausgaben bearbeitet worden sind. Das konnte insofern mit Sicherheit festgestellt werden, als man sich stützen konnte auf die gewissenhafte Sekretärsarbeit, die Frau Anita Tuggener jahrelang für ihn geleistet hatte. Man kann drei Arbeitsphasen unterscheiden: Abschriften, teils unbearbeitet, die zu seiner Sammlung von Märchenund Sagenmotiven gehören. Von diesen Abschriften hat er eine ganze Reihe bearbeitet und die Bearbeitung jeweils zur Reinschrift nach Zürich gesandt. Einige Abschriften wurden dann nach Oslo gesandt und von Englert erneut korrigiert. Ein Exemplar ging jeweils an Frau Tuggener zurück und sie
übertrug die Korrekturen in ihr Reinexemplar und schrieb darüber: «von E. revidiert». Aufgrund dieser Arbeitsweise konnten eine große Anzahl von Märchen- und Sagentexten sicher ermittelt werden, die von Englert durchgearbeitet und zur Drucklegung vorgesehen waren.Während der Sichtung der Texte ergab sich von selbst eine natürliche Gliederung des Bandes in die Unterabteilungen: Märchen, Fabeln, Sagen, Fenggengeschichten und Schwänke, wenngleich die Gattungen nicht eindeutig zu bestimmen sind, sondern fließende Übergänge aufweisen. So faßt dieser Band die besten, noch ungedruckten Texte aller Gebiete zusammen, auf denen Englert gearbeitet hat.
Aufgefundene Verzeichnisse konnten wichtige Fingerzeige geben: so lag eines vor für eine Neuauflage des Buches «Vo chlyne Lüte», in das er vierundzwanzig neue Texte einfügen wollte. Das Fenggenbuch wurde 1965 unverändert wieder aufgelegt, und so findet nun dieses Bündel Fenggengeschichten fast gesamthaft in diesem Band Aufnahme.
Ein weiteres umfangreiches Verzeichnis von Märchenund Sagentexten hatte er der Illustratorin, Berta Tappolet gesandt. Aus diesem entnahm er die erste Folge des Schweizer Märchenbuches. Aus dem ungedruckten Restbestand ließ sich seine Intention eines Folgebandes erahnen, man ersah, welche Motive ihm wichtig waren und suchte die Texte im Nachlaßmaterial.
In diesem Verzeichnis waren Märchen aufgeführt («Die Schöne mit den goldenen Zöpfen», «Der dumme Peter»), die dann in der «Gschichtetrucke» Aufnahme gefunden hatten; sie wurden als charakteristische Motive des Folgebandes in die vorliegende Sammlung übernommen.
Wiederum hatte er eine Motivgruppe gereiht um die Sage vom «erleuteten Senn». Diese Gruppe wurde ebenfalls als Einheit übernommen, obwohl die Geschichte vom erleuchteten Senn bereits in den Alpensagen gedruckt ist. Zu zwei weiteren Sagen, die er in der Mundartfassung vorgesehen
hatte, wurde die schriftdeutsche Fassung aus den «Alpensagen» übernommen, einerseits um dem Leser den Genuß des «Chuereihens» im Haslitalerdialekt zu erleichtern - man wird staunen über die Vollkommenheit der Überlieferung dieser Sage; andrerseits kann der Leser an diesen Beispielen Einblick gewinnen in das «Wie» der sprachlichen Gestaltung Englerts. Darüber schreibt er in einem Brief:Nicht alle von Englert bearbeiteten Märchen und Sagen wurden in den Band aufgenommen, er wäre sonst zu umfangreich und von den Motiven her in ein Ungleichgewicht gekommen.
Um eine Vielseitigkeit der Motive zu wahren, wie sie den anderen Bänden Englerts eigen sind, mußten sogar zur Ergänzung einige Stücke aus den Quellen ausgewählt werden, aus denen Englert schöpfte, und vom Herausgeber redigiert werden.
An manchen Bearbeitungen Englerts mußten da und dort auch Retouchen vorgenommen werden, wenn ihm etwa ein unbildlich chlichéhafter Ausdruck entgangen war, den er spätestens in der Korrektur durch ein träfes Wort ersetzt hätte.
So ist die Herausgabe besorgt worden mit der Verantwortung, als handle es sich um ein eigenes Buch, in ständiger innerer Zwiesprache mit den Intentionen des Freundes
und in dem Geist der Zusammenarbeit. wie sie der Herausgeber hatte zu Lebzeiten Curt Englerts erfahren dürfen.Wie dieser zweite Band geworden wäre, können wir nicht wissen. Es oblag uns, mit behutsamer Hand die vorhandenen Edelsteine zu sammeln: es hat Perlen und leuchtende Steine darunter, dann auch solche mit unscheinbaren Farben. Freilich, die Meisterhand, sie zu einem Geschmeide zu ordnen, wodurch ein jeder erst zu seiner Geltung, zu Glanz und Wirksamkeit kommt, sie fehlt.
H. R. Niederhäuser
MÄRCHEN
Die Schöne mit den goldenen Zöpfen
Es lebten einmal ein König und eine Königin, die hatten drei Söhne, und der älteste hieß Sepp. Den hatten sie in ein fernes Land auf die hohe Schule geschickt, damit er da alle Weisheit und Kunst lerne, deren ein König bedarf, denn Sepp sollte dereinst das Reich zu Erb und Eigen bekommen und König werden. Und als er nun nach vielen Jahren zurück kam, da ward zu seinen Ehren ein großes Fest gefeiert, und das ganze Volk war auf den Beinen, um ihn gehörig zu empfangen.
Da drängte sich auch ein uraltes buckliges Hutzelweiblein durch die Menge, die bei Hofe sich versammelt hatte. Über die schiefe Schulter trug es ein Säcklein voller Brotbrocken, die von des Königs Tafel gefallen waren. Aber so klein und krumm war die arme Alte, daß kaum einer in der Menge sie wahrnahm, und unversehens wurde sie umgestoßen. Das Säcklein fiel auf den Boden, der Knoten ging auf und die Brotbrocken rollten aufs Pflaster. Da schnitt die Alte ein so jämmerliches Gesicht, daß Prinz Sepp, der eben dazukam. das Lachen nicht verhalten konnte. Erbost kehrte die Alte sich dem Jüngling zu, schüttelte ihre dürren Fäuste und schrie: «Du sollst nicht Rast noch Ruh mehr haben, bis du die Schöne mit den goldenen Zöpfen gefunden hast!»
Der Königssohn und die andern Leute hörten ihre Worte wohl, aber niemand kümmerte sich im Trubel des Festes weiter darum. Aber seit jener Stunde fand Sepp weder
Freude noch Frieden mehr und ward trauriger und trübseliger mit jedem Tage. Schließlich ging er zum König und sagte: «Lieber Vater, gib mir dein schnellstes Pferd, denn ich will ausziehn, um die Schöne mit den goldenen Zöpfen zu suchen.» Der Vater schüttelte den Kopf und sagte: «Mein Sohn, das schlag dir aus dem Sinn. Die Schöne mit den goldenen Zöpfen hat noch keiner gefunden. Und keiner, der auszog, ist wiedergekommen!» Aber Sepp bat und bettelte und ließ nicht ab. bis er ihm zuletzt seinen Willen tat; er gab ihm sein schnellstes Pferd und hieß ihn ziehen.So ging denn Sepp von Hause fort und ohne Aufenthalt ritt er mitten durch große Wälder, Baum an Baum, über Berg und Tal und durch weite Einöden. Endlich sah er eines Abends, als es schon finster geworden war, in der Ferne einen Lichtschein schimmern. Er ritt drauf zu und kam nach einer Weile zu einer Hütte aus rohen Baumstämmen. Er pochte an die Tür, und ein alter Mann, dem ein milchweißer Bart bis an den Gürtel ging, trat heraus und hieß ihn freundlich willkommen und führte ihn hinein. Dort bot er ihm einen Stuhl zu seiner Seite und stellte ihm ein Nachtmahl auf. «Heut nacht», sprach er, «schläfst du hier bei mir in dieser Hütte und ruhest dich gut aus, denn du bist recht müde. deucht mich.» «Von Herzen dank ich Euch, frommer Vater, für euer Anerbieten», antwortete Sepp «und gerne will ich diese Nacht bei euch bleiben. Aber da ich nun einmal hier bin, so will ich euch fragen, ob ihr vielleicht wißt, wo die Schöne mit den goldenen Zöpfen wohnt. Da sagte der Alte: «Ich bin schon alt, aber von der Schönen mit den goldenen Zöpfen hab ich noch nie etwas gehört. Doch habe ich einen Bruder, der ist älter als ich. Aber er wohnt weit weg von hier, hinter den sieben Bergen. Vielleicht, daß er es weiß!»
Am andern Morgen früh bei Tag machte Sepp sich auf und ging in der Richtung, die ihm der gute Klausner gewiesen. Als er eine Weile fortgegangen war, begegnete ihm ein
altes Hutzeiweiblein. Das kicherte: «Ei, ei, mein schöner Prinz, ihr kennt mich wohl nicht wieder!» Da sah Sepp, daß es jene Alte war, die dazumal die Verwünschung gegen ihn ausgesprochen hatte. Aber jetzt ritt sie auf einem flotten feurigen Renner, und vom Satteiknauf hing ein prächtiges Schwert. «Kommt nur her, mein schöner Prinz, und gebt mir euer Pferd und euren Degen», sprach die Alte weiter, «so geb ich euch mein Pferd und mein Schwert. Merkt auf. wen immer ihr mit diesem Schwert berührt, der fällt auf der Stelle tot zur Erde. Und wen ihr alsdann zum zweiten Mal berührt, der wird auf der Stelle wieder lebendig aufstehen. Und dieses Pferd hier, das rennt so schnell wie der Wind.» Vor Staunen brachte der jüngling kein Wort hervor, er nickte bloß mit dem Kopf zum Zeichen, daß er willens sei, den Tausch zu machen. Und da war die Alte auch schon verschwunden.Sepp gab dem Rosse einen Hieb mit der Peitsche, und es sprengte davon wie der Blitz; und fort gings in sausendem Ritt über die sieben Berge, so daß ihm die Locken im Winde flogen, und schon war er zu der Hütte des anderen Klausners gekommen. Er hielt an und pochte an die Tür. Ein altehrwürdiger Mann trat heraus, dem der schneeweiße Bart bis an die Knie ging. Der hieß ihn freundlich eintreten und Vorlieb nehmen mit dem, was er zu Essen habe. Dann fragte er ihn nach seinem Begehr. «Ach, guter Vater», antwortete der Königssohn, könntet ihr mir nicht sagen, wo die Schöne mit den goldenen Zöpfen wohnt?» «Ja wahrlich, ich bin alt, sehr alt», erwiderte der Klausner, «und doch hab ich noch nie von der Schönen mit den goldenen Zöpfen reden hören. Doch habe ich einen Bruder, der ist noch älter als ich. Aber der wohnt weit weg von hier, dort hinter den sieben Bergen. Vielleicht, daß er es weiß.»
Sepp dankte dem Alten, bestieg alsbald wieder sein Pferd und sprengte in Windeseile davon, und im Handkehrum war er bei der Klause des dritten Waldbruders angelangt.
Er pochte an die Türe und alsbald schaute ein uralter Mann heraus; sein Bart, weißer als Kirschenblust, hing ihm bis zu dem Füßen herab. «Was wollt ihr hier, schöner Jüngling?» fragte er freundlich. Und jener antwortete: «Ehrwürdiger Vater, ich bin gekommen, um euch zu fragen, ob ihr wißt, wo die Schöne mit den goldenen Zöpfen wohnt.» «Ich bin zwar alt, uralt, aber noch nie habe ich von der Schönen mit den goldenen Zöpfen reden hören», sagte der Alte.
«Doch habe ich einen Sohn. der heißt der Wind, und der ist weitum befahren in der Welt. Vielleicht, daß der sie wo gesehen hat. Gedulde dich ein Weilchen, er wird bald kommen.» Sepp setzte sich hin, um den Wind zu erwarten. Und siehe da brauste und sauste es aufs Malin den Bäumen, so daß alles Laub rauschte, und wie auf Adlers Flügeln kam ein schöner Jüngling geflogen. «Hast du wohl auf deiner Wanderung in der weiten Welt die Schöne mit den goldenen Zöpfen gesehen?» fragte Sepp. «Ja», erwiderte der Wind, «und morgen gehe ich just wieder einmal zu ihr, um ihr die Wäsche zu trocknen. Aber merkt wohl: früh vor Tag stehe ich auf und dreimal rufe ich, dann reise ich, auch wenn ihr's nicht hört, von diesem Orte fort!»
Sepp tat die Nacht schier kein Auge zu, um ja nicht die Zeit des Aufbruchs zu verschlafen, und am Morgen in aller Frühe folgte er dem Wind, und sein Renner mußte mächtig ausgreifen, um mit dem Winde Schritt zu halten. Und kaum aufgebrochen, standen sie schon vor dem Schloß der Schönen mit den goldenen Zöpfen. Der Königssohn lief ringsum das ganze Gebäude herum, aber nirgends waren Türen oder Fenster zu sehen. In dem großen grünen Garten standen da und dort weiße Marmorbilder in allerlei Stellungen und Gebärden. Als er an einem dieser Steinbilder vorüberstreifte, ward es von der Spitze seines Schwertes berührt. Und -siehe da: ein schöner Jüngling stand vor ihm. Der erzählte Sepp, daß auch er ein Königssohn sei, und alle jene Steinbilder, die im Garten stünden, seien gleichfalls mutige Jünglinge, die vordem hieher gekommen wären, um die Schöne mit den goldenen Zöpfen zu freien. Aber das böse Zauberweib, welches sie hüte, habe sie alle in Stein verwandelt, so wie ein jeder gerade gestanden oder gegangen sei. Da berührte Sepp auch alle die andern Steinbilder und gab ihnen ihre wahre Gestalt wieder. Die Erlösten zeigten ihm einen schmalen Spalt in der Mauer. «Dies ist der Eingang in das Schloß der Schönen mit den goldenen Zöpfen!»
sagten sie. «Doch bitten wir dich, geh nicht hinein, denn hinter der Mauer stehen zwei gewaltige Riesen, die lassen niemand durch. «Sepp aber hörte nicht auf ihre Worte und ging hinein. Und wie die beiden Riesen auf ihn los stürzten, da berührte er sie mit der Spitze seines Schwertes, und auf der Stelle fielen sie tot zu Boden.Dann ging er ins Schloß hinauf und schritt von Saal zu Saal, und der eine war prächtiger als der andere - bis er in eine große Halle kam, die ganz von Gold und Edelsteinen strahlte. Da saß die Schöne mit den goldenen Zöpfen auf einem goldenen Thron. Wie sie den Jüngling erblickte, sprach sie: «Wie in aller Welt bist du hierhergekommen? Seit vielen, vielen Jahren bist du der erste, dem es gelungen ist. Aber komm schnell, daß ich dich verberge, ehe das Zauberweib kommt, denn wenn sie dich hier erblickt, ist es um dich und mich geschehen. Sie verschlingt dich, wie ein hungriger Hund seinen Fraß.» Und kaum hatte sie Sepp in einer Nische hinter einem Umhang versteckt, als schon die Zauberin kam. Sie muffelte und schnüffelte, rümpfte die Nase und kreischte: «Ich schmeck, ich schmeck einen Christenmenschen! HoI ihn nur hervor aus seinem Versteck, Schätzlein! Der soll mir munden!» Die Schöne mit den goldenen Zöpfen schlug vor Angst die Arme vor dem Gesicht zusammen und weinte, daß ihr Prachtsgewand ganz von Tränen naß ward. «He nun, he nun, Schätzlein», rief da die Alte, «hör und merke wohl, was ich dir sage. Wenn du vermagst, den Tisch also zu decken, daß er den Boden nicht berührt, und die Schüsseln, Teller und Becher das Tischtuch nicht berühren, und doch nichts dazwischen ist, dann will ich den schönen Jungen dahinten verschonen; sonst verzehr ich ihn, so wie er ist als Leckerbissen zum Abendessen!» Damit humpelte sie mummelnd und brummelnd davon.
Die Schöne mit den goldenen Zöpfen holte Sepp gleich aus seinem Versteck hervor und sagte: «Weißt du, was wir tun müssen? Komm, wir wollen fliehen, so schnell wir können!»
und sie nahm drei Dinge: einen Stein, eine Blume und eine Wasserflasche. Und dann eilten die beiden davon, so schnell ihre Füße sie trugen. Nach einer Weile, als sie glaubten nun wären sie weit genug gekommen, hielten sie an und setzten sich unter einen Baum in den Schatten, um ein wenig auszuruhen.Unterdessen war die böse Zauberin zurückgekommen, um nachzusehen, ob der Tisch so gedeckt sei, wie sie befohlen. Aber, als sie niemand mehr fand, da kreischte und stampfte sie vor Wut und gebot zweien von ihren Knechten, den Flüchtlingen ungesäumt nachzusetzen. Die Knechte machten sich stehenden Fußes auf den Weg, und unlang, so hatten sie die beiden schier eingeholt. Wie die Schöne mit den goldenen Zöpfen sie kommen sah, da sagte sie: «Jetzt werf' ich diesen Stein dorthin, und mache mich zu einer Kirche. und du wirst der Küster!» Sie schleuderte den Stein hinter sich auf den Weg, und siehe, da erhob sich auf der Stelle eine schöne Kirche mitsamt dem Glockenturm, und Sepp stellte sich als Sigrist an die Türe, und tat, als erwarte er das Kirchenvolk. Die Knechte kamen eiligst herangelaufen und fragten: «Sagt, guter Mann, habt ihr hier einen Jüngling und ein Mädchen vorübergehen sehen?» «Ich hab's schon gesagt, ich habe bereits das erste Mal zur Messe geläutet, und jetzt geh ich eben und tu's zum andern Mal. Möchten die Herren vielleicht die Messe hören?» «Troll dich fort, du Tölpel, mitsamt deinen Messen!» riefen die Knechte ärgerlich, kehrten um und gingen heim.
Die Zauberin rollte die Augen und fletschte die Zähne vor Zorn, und schickte gleich zwei andere Knechte aus. Sepp aber und die Schöne mit den goldenen Zöpfen hatten sich derweilen längst wieder in ihre wahre Gestalt zurückverwandelt und waren weitergelaufen. Kaum aber hatten sie sich auf einen grasigen Bühl gesetzt, um ein wenig auszuruhen, als sie die beiden Knechte auch schon kommen sahen. Da sagte die Schöne mit den goldenen Zöpfen: «Jetzt
werf' ich diese Blume dorthin und mache mich zum Garten und du wirst der Gärtner.» Und wie gesagt, so getan. Als nun die Knechte gelaufen kamen, fragten sie den Gärtner, der eben am Gatter stand: «Sag, guter Bursche, hast du hier einen Jüngling und ein Mädchen vorübergehen sehen?» «Ich hab's schon gesagt», erwiderte er, «jetzt werden dann der Salat und die Zwiebeln bald groß sein, und heut säe ich noch Petersilie an. Möchten die Herren vielleicht meinen Garten beschauen?» «Scher dich zum Teufel samt deinen Kohlköpfen und Krautstengeln!» riefen die Knechte ärgerlich, kehrten um und gingen heim.Die Zauberin spie Gift und Galle in gelber Wut und kreischte: «Ihr Tölpel, saht ihr denn nicht, daß die Jungfer der Garten und der Bursche der Gärtner war!» Und damit machte sie sich selber auf die Socken. um sie zurückzuholen, ehe sie ihrer Reichweite entrückt wären. Sepp und die Schöne mit den goldenen Zöpfen liefen noch immer zu, als sie aufs Mal inne wurden, daß die Hexe ihnen auf den Fersen war. Da warf die Schöne mit den goldenen Zöpfen die Wasserflasche hinter sich auf den Boden. und auf der Stelle war da ein See, und in dem See tummelte sich ein Aal. Die Hexe versuchte ihn mit ihren Krallen zu greifen. Aber jedesmal, wenn sie ihn schon zu halten glaubte, glitt er ihr durch die Finger, und sie konnte ihn nicht fassen, wie sehr sie sich mühte. Schließlich ließ sie ab und schrie am ganzen Leibe lottelnd vor Wut: «So lauft denn! Aber noch habt ihr einander nicht. Es braucht ihn bloß einer küssen, wenn er heimkommt, dann wird er dich für immer vergessen!» und damit humpelte die Hexe keifend und kybend davon.
Sepp aber und die Schöne mit den goldenen Zöpfen gewannen wieder ihre Gestalt und machten sich wieder auf den Weg. Und bald gelangten sie in eine Stadt, von der es nicht mehr weit war zu des Königs Schloß. Da brachte Sepp die Schöne mit den goldenen Zöpfen in eine Herberge, wo sie warten sollte, bis er wieder käme, um sie als seine Braut
in der Staatskarosse seines Vaters heimzuholen. Als Sepp heimkam, konnten sie ihn schier nicht wiedererkennen. denn sein Prinzenkleid war auf der weiten Reise ganz zerschlissen und zerrissen. Er bat alle, Vater und Mutter und Brüder, daß sie ihn ja nicht umarmten und küßten, und dann ging er in sein Schlafgemach, um von allen Mühen gehörig auszuruhen. Aber als er in tiefem Schlafe lag, kam einer seiner beiden Brüder in die Kammer und des Gebotes vergessend, küßte er ihn vor Freude darüber, daß er wieder da wäre, mitten auf den Mund.Als Sepp darnach erwachte, da hatte er alles, was ihm begegnet war, vergessen, und die Schöne mit den goldenen Zöpfen auch. Sie aber saß in der Herberge in jener Stadt und wartete vergeblich auf seine Rückkehr. Und als Tag um Tag verging und er noch immer nicht gekommen war, da ging sie hin und tat eine Schenke auf, und bald sprach man weit und breit von der schönen Schankwirtin. Einmal kehrte auch der eine von Sepps Brüdern in jener Schenke ein, und erstaunte über die Schönheit der Wirtin. Auch sie schien Gefallen an dem Jüngling zu finden, aber als er abends in ihre Kammer trat, da sagte sie: «Zieh doch die Stiefel aus, daß du mir nicht den Teppich beschmutzest.» Aber während er den einen Stiefel auszog, hatte er den andern schon wieder am Fuß. Und so ging's die ganze Nacht durch bis an den Morgen, indes die Schöne mit den goldenen Zöpfen in ihrem Bette schlief. Also behielt der Prinz seine Stiefel an und ging ärgerlich nach Hause. Er sagte aber niemandem, was ihm begegnet war.
Am andern Tage kehrte der andere Bruder von ungefähr in der Schenke der Schönen Wirtin ein. Und auch er ward von ihrer Schönheit ganz bezaubert und bezeigte ihr seine Liebe. Die schöne Wirtin erwies ihm gleichermaßen ihr Wohlgefallen. Aber als der Prinz am Abend in ihre Kammer kam, da sagte sie: «Schließ doch die Läden!» Aber während er den einen Laden zutat, tat der andere sich wieder
auf. Und so ging es die ganze Nacht fort, bis es tagte, indes die Schöne mit den goldenen Zöpfen in ihrem Bette schlief. Also ließ der Prinz die Läden sein und ging ärgerlich nach Hause. Er sagte aber niemandem, was er erlebt hatte.Den dritten Tag aber begab es sich, daß Prinz Sepp ebenfalls in jener Schenke einkehrte. Vor lauter Staunen ließ er seinen Wein stehen und konnte kein Auge von der schönen Wirtin wenden, und als er seine Zeche zahlen sollte, da gab er ihr vor lauter Freude alle Kostbarkeiten, die er auf sich trug. Und sie lächelte ihm freundlich zu. Aber als er am Abend in ihre Kammer kam, da sagte sie: «Lösch doch die Lichter!» Auf dem Tische standen zwei Leuchter mit brennenden Kerzenstöcken. Aber allemal wenn er die eine Kerze auslöschte, zündete die andere sich wieder von selber an. Und so ging es die ganze Nacht hindurch, bis der Morgen graute, indes die Schöne mit den goldenen Zöpfen in ihrem Bette schlummerte. Also ließ Sepp die Kerzen stehen und ging traurig nach Hause und erzählte seinen Brüdern, was ihm begegnet war. Die schauten einander verwundert an, und dann berichteten sie, wie es ihnen ergangen war.
Der alte König meinte, die Zeit sei gekommen, daß sein ältester Sohn sich vermähle, und er hatte ihm derweil eine Prinzessin aus einem fernen Lande ausgesucht, die seine Frau werden sollte. Und unlang, so war der Tag gekommen, wo die Hochzeit gefeiert werden sollte. Zu dem Festmahl, das bei dieser Gelegenheit allem Volke gegeben ward, war auch die schöne Schankwirtin geladen. Sie kam und allen, die sie kannten, schien sie noch schöner als zuvor. Als nun die Gäste sich erhoben, um ihre Gläser auf des Brautpaars Wohl zu leeren, da wandte sich die schöne Wirtin an den Bräutigam und sprach mit heller Stimme. «Hast du vergessen der Schönen mit den goldenen Zöpfen, die du aus dem Zauberschloß vom Bann der bösen Hexe erlöst? Hast du vergessen deines Versprechens, in deines Vaters Kutsche sie
heimzuholen als deine Braut?» Da blickte der Königssohn auf und schaute ihr in die Augen - und da wars ihm, als wiche ein Nebel vor seinem Blick, und er erkannte die Schöne mit den goldenen Zöpfen wieder. Er sprang auf und unter Tränen umarmte und küßte er sie vor aller Augen. Dann sprach er zu dem alten König: «Vater, was deucht dich recht getan? — Es hatte einer einen kostbaren Schatz zu eigen, in einer Truhe wohl verwahrt. Da verlor er den Schlüssel, der zu dem Schrein gehörte. Und er ließ sich einen andern Schlüssel machen. Da aber fand sich aufs Mal der alte wieder. Welchen Schlüssel soll er hinfort brauchen, den alten oder den neuen?» Der König bedachte sich eine Weile, dann sprach er: «Den alten, das deucht uns recht und billig!» Und da ward denn die Braut, die er dem Sohne ausgesucht, in ihre Heimat zurückgeschickt, und Sepp hielt am selben Tag noch Hochzeit mit der Schönen mit den goldenen Zöpfen.Und ich, ich habe ihnen die Suppe aufgetragen und mit einer goldenen Kelle in die Teller geschöpft, dann aber haben sie mir einen Fußtritt gegeben, daß ich bis hierher geflogen bin.
Die verfluchte Prinzessin
Es war einmal ein junger König, der lebte mit seiner Königin in Herrlichkeit und Freuden. denn sie hatten alles, was ihr Herz begehren mochte, nur eines nicht, sie hatten keine Kinder, und so saßen sie oft traurig beieinander, weinend vor Herzeleid, denn wer keine Kinder hat, weiß nicht warum er lebt, und je mehr Kinder, je größer das Glück.
Tag für Tag betete die Königin, daß Gott ihr ein Kind bescheren möge. Aber der Himmel erhörte ihr Flehen nicht.
Als sie wieder einmal in ihrem Gemach inbrünstig auf den Knien lag, da kam ihr Gemahl mißmutig von der Jagd nach Hause und rief, als er sie so liegen sah: «Was hattet uns all dein Beten! Wir werden in Gottes Namen nur mit dem Teufel ein Kind bekommen». Ob dieser Rede erschrak die Königin in tiefster Seele, aber wie sehr sie ihn bat, er blieb dabei und nahm das böse Wort nicht zurück.Aber siehe da, unlang so fühlte sich die Königin guter Hoffnung, und als die Zeit um war, gebar sie ein Mägdlein, ein Kind so schön wie ein Engelein. Und das war ihr ganzes Glück und alle ihre Freude. An seinem ersten Geburtstag trug der König es auf seinem Arm und ging mit ihm in der Stube auf und ab, von ungefähr zu eben der Stunde, da es geboren war. Da tat es plötzlich den Mund auf und hub zu reden an: «Vater», sagte es. «Was willst du mein Kind?» antwortete der König zu Tode erschrocken, denn frühweise Kinder leben nicht lange. «Vater», sagte es wieder, «ich muß sterben; denn du hast mich verflucht, noch bevor ich geboren war. Laßt mir einen Sarg von Eisen machen, legt mich darein und stellt ihn auf in der Gruft vor dem Altar im Münster. Alle Abend aber stellt einen Soldaten als Wache an meinem Grabe auf. Sonst bringe ich Unglück auf Unglück über dich und dein Reich.» Voller Angst versprach der König alles. Und am selben Abend noch starb das Kind.
Die armen Eltern waren untröstlich. Es war ihnen, als wäre die Sonne für immer erloschen. Der König aber tat, wie er versprochen. Er ließ das tote Prinzeßlein in einem eisernen Sarge in der Gruft vor dem Altar im Münster beisetzen, und ein Soldat erhielt am Abend den Befehl, die Nacht über bei dem Grabe Wache zu stehen. Am Morgen aber, als der Mesmer kam, um zur Messe zu läuten, da fand er den Mann tot am Boden liegen. Die nächste Nacht trat ein anderer an, am anderen Morgen fand man auch ihn erwürgt. Und so ging das fort Tag und Tag durch zwanzig Jahre, jede Nacht kostete einem wackeren Soldaten das Leben.
Die ganze Stadt, das ganze Land waren von Schrecken und Trauer geschlagen. Das Volk murrte, und die Soldaten begannen nachgerade den Gehorsam zu verweigern und verließen den Posten. Sie seien bestellt gegen Feinde zu kämpfen, nicht gegen Teufel, und es sei besser von Menschen erschlagen zu werden, als erwürgt von Geistern. Und der König wußte nicht mehr, was er tun sollte, um das große Unheil abzuwenden, das ihm angedroht war.Da kam eines Tages ein junger Soldat aus der Fremde an den Hof, ein kecker Bursche, dem die Feder hoch am Hut stak, und bot dem König seine Dienste an. Der stellte ihn gleich ein und sagte, er müsse jede Nacht das Grab seiner Tochter bewachen. Tags über aber sei er von jeglichem Dienste befreit, und an reichlichem Sold solle es ihm überdies nicht fehlen. Das deuchte den Soldaten ein kommlicher Dienst, und er schlug auf der Stelle ein. Als die Sonne untergegangen war, führte ihn der König selber auf seinen Posten und verschloß die Kirchentür und versiegelte das Schloß noch mit seinem Ring. Aber als die Finsternis herein brach, da fing es den Burschen doch zu grauen an, er wußte nicht warum, denn er hatte schon manche Nacht an böseren Orten Wache gehalten. «Nein, da mag lieber ein anderer Wache stehen», dachte er bei sich, aber so mir nichts dir nichts davonlaufen, das wollte er auch nicht. Schließlich aber packte ihn eine solche Angst, daß er zu einem offenen Fenster hinausschlüpfte. Aber da stand ein graues Mandli davor, mit einem langen, weißen Bart und einer großen Warze auf der Nase, das hielt den Finger erhoben und sagte:
«Hans halt ein! Dein Glück soll's sein. |
Geh getrost auf deinen Posten zurück und verbirg dich ein Viertel vor zwölf Uhr auf der Kanzel oben. Dann wird dir nichts geschehen.» Da kehrte der Soldat um und tat nach dem Rat und duckte sich oben hinter der Kanzel nieder.
Schlag zwölf aber krachte und dröhnte es mit solcher Gewalt, daß der ganz Dom wankte und schwankte. Der Deckel des Sarges sprang ab und fiel mit Donnergepolter auf den Boden. Die Prinzessin stieg aus der Gruft empor schwarz wie die Nacht und übermenschengroß. Sie fuhr tobend in der Kirche herum und suchte den wachthabenden Soldaten. Und als sie im Schiff niemand fand, warf sie alle Bänke und Stühle übereinander. Dann suchte sie den Chor ab und zuletzt stieg sie zur Kanzel hinauf. Aber als sie eben den Hans gewahr wurde und nach ihm langen wollte, da schlug die Uhr eins, und die Prinzessin entwich in die Gruft. Der Sarg schloß sich von selber wieder über ihr. Und Bänke und Stühle standen wieder, wie sie zuvor gestanden. Und so still war's, der Hans hörte sich selber schnaufen. Dann stand er mit bloßem Säbel die Nacht über Wache. Als der König am andern Morgen kam, da wunderte er sich nicht wenig, seinen Soldaten gesund und munter anzutreffen, und lobte ihn über die Maßen für seinen Mut. Der Hans aber dachte: «Ja, ja, schon recht, der redet auch, wie er Verstand hat. Nein, heut Nacht, steh ich nicht mehr Wache.»Und als er gegen Abend wieder auf seinem Posten stand, und der König fortgegangen war, da schlüpfte er in der Dämmerung wieder zum Fenster hinaus, um gleich das Weite zu suchen. Da stand aber selbig Mandli wieder da, hob seinen Finger auf und sprach:
«Hans halt ein! Dein Glück soll's sein. |
Geh auf deinen Posten zurück, und versteck dich ein Viertel vor zwölf unten in der Gruft hinter dem Sarg. Dann wird dir nichts geschehen.» Und der Hans gehorchte noch einmal, und kauerte hinter dem Sarg. Schlag zwölf kam die Prinzessin wieder aus der Gruft, und ein solcher Lärm war, es sprengte dem Hans schier die Ohren. Und wieder begann die Prinzessin nach dem Soldaten zu suchen, und zwar zu-

Aber wie er sich am Abend durchs Fenster ließ, da stand das Mandli wieder da und sprach:
«Hans. halt ein! Dein Glück soll's sein.» |
«Nein, beim Eid», sagte da der Soldat, «heut mag Wache stehen, wer will, ich geh nicht, sag mir was du willst!» «Hans. sei kein Tor, bleib auf deinem Posten und du hast dein Glück für immer gemacht. Stell dich ein Viertel vor zwölf mit bloßem Säbel auf den Altar, und wenn die schwarze Prinzessin kommt, so bleib stehen und weiche keinen Schritt, wie schrecklich der Scheuel sich auch gebärden mag, dann wird dir nichts geschehen.» Da faßte der Soldat wieder Mut und ging in die Kirche zurück und stellte sich auf dem Altar auf. Schlag zwölfe kam die Prinzessin aus der Gruft hervor, und diesmal krachte und dröhnte es, als berste die Hölle selber, und die Prinzessin fuhr in der Kirche herum und wütete, als wollte sie alles in Trümmer schlagen. Der Soldat stand unbeweglich auf dem Altar, den bloßen Säbel in der Hand. Jetzt gewahrte sie ihn und fuhr mit entsetzlichem Gebrüll auf ihn los. Doch der Hans stand fest und rührte kein Glied. Da blieb sie stehen und schrie:
«Stich mir dreimal ins Herz. um der drei Wunden Christi willen!» Der Soldat zückte den Säbel und stach zu, und siehe, da stand eine Jungfrau vor ihm, licht und schön wie ein Engel. Sie winkte ihn mit ihrer lilienweißen Hand zu sich herab und sprach: «Hans, komm zu mir, daß ich dir danke, du hast mich erlöst.» Der Soldat zögerte zuerst ein wenig; denn ihm war noch ganz sturm im Kopf von all dem Lärm und Getümmel, grad wie nach einer großen Schlacht, dann aber stieß er seinen Säbel in die Scheide und trat zu ihr. Sie aber nahm ihn bei der Hand. und sie küßten und herzten einander. Dann knieten sie beide vor dem Altar nieder und beteten die ganze Nacht.Als der König am andern Morgen in die Kirche kam, umarmte er beide, die Prinzessin und den Hans, als seine Kinder, und führte sie gleich zu der Königin. Den Hans erhob er in den Adelsstand und machte ihn zum General. Und bald danach ward die Hochzeit gefeiert, und als der König starb, ist der Hans König geworden.
Das Märchen vom Schuster und vom Schneider
In einem Städtlein -wo's gelegen ist, weiß ich nicht mehr - wohnten einmal ein Schuster und ein Schneider. Die hatten ihre Werkstatt im gleichen Haus und waren einander gute Gesellen. wenn auch der Schuster ein schwarzes Herz hatte und voller Tücke war, denn Schuster, sagt man, gehen gern in bösen Schuhen. Der Schneider dagegen war gutmütig und leichtsinnig, wie Schneider meist sind; denn was ein rechter Schneider ist, sagt allemal: «Es schad't nicht», wenn er die Hosen verschnitten hat, «nur neu Tuch her!»
Eines Tages sagte der muntere Schneider zu dem griesgrämigen Schuster: «Weist du was, Bruder, wir machen unsere
Bude zu, gehen fort von hier und wandern in die weite Welt und machen unser Glück anderswo. Hier in diesem Nest ist kein Fortkommen und überdies so ist mir's schon lange verleidet. Unser Werkzeug nehmen wir mit und Brot für drei Tage, damit haben wir zu essen genug.» «Nein», sagte der Schuster, «jeder nimmt sieben Brote mit, das reicht dann grad für eine Woche, und bis dahin bekommen wir schon irgendwo Arbeit.» Darauf ging er in seine Stube, packte sein Werkzeug zusammen und legte sieben Brote dazu. Der Schneider aber packte nur drei in seinen Ranzen, denn er dachte: «drei Brote wiegen minder als sieben, und Nadel und Elle sind auch nicht schwer.» Und so machten sie sich denn miteinander auf den Weg, der Schneider und der Schuster.Am ersten Tage aß jeder ein Brot, am zweiten Tage wiederum, und ebenso am dritten Tage. Am vierten Tage aber hatte der Schneider nichts mehr. Da sagte er zum Schuster: «Ich bitte dich, Bruder, gib mir die Hälfte von deinem Brote, ich habe nichts mehr.» Der Schuster war zwar zornig, weil jener seinen Rat nicht befolgt hatte, aber er teilte doch sein Brot mit ihm, und ebenso auch am nächsten und am übernächsten Tag. Damit aber waren alle Brote verzehrt, und sie hatten nichts mehr zu essen - und weit und breit war nur Wald und Wilde. Erschöpft sank der Schneider ins Moos. «Ach», stöhnte er, «jetzt werden wir elend Hungers sterben. Ach, wären wir nur daheim geblieben.» Der Schuster aber war fuchsteufelswild und stampfte vor Zorn, warf seinen Werkzeugkasten an die Erde, daß es klapperte und klirrte. «Ja, und alles», schrie er, «ist nur deine Schuld. Warum hast du nur drei Brote mitgenommen und nicht sieben? Jetzt will ich dir dafür tun! Du sollst mich nicht ungestraft zu Tode gebracht haben.»
Und er nahm seinen Schusterkneif und stach dem Schneider beide Augen aus und ging fluchend weiter.
Der Schneider wand sich wie ein Wurm wimmernd am Boden und schrie nach Hilfe. Schließlich aber rappelte er
sich auf und tappte des Weges weiter den ganzen Tag. Gegen Abend, als es kühl wurde, kroch er todmatt unter einen Baum und lehnte sich an den Stamm. Eben wollte er einschlafen, da hörte er, wie sich Vögel in die Zweige setzten, und einer sagte zum andern: «Heut ist eine heilige Nacht, da fällt Himmelstau auf Gras und Kraut. Wer blind ist und mit dem Tau sich die Augen wäscht, der wird wieder sehend werden.» «Und selbst wenn er keine Augäpfel mehr hätte»,
Neugestärkt ging der Schneider weiter, daß er nach etwas Eßbarem suche, was immer es sei, womit er seinen Hunger stille. Unlang kam er zu einem Bienenstock. «Ei, da hat's Honig!», dachte er und schleckte sich mit spitzer Zunge die Mundwinkel. Und schon wollte er mit der Hand hineinlangen, um eine Wabe herauszunehmen, aber da flog die Bienenkönigin auf seinen Stecken und sprach: «Laß uns unsere Waben und störe uns nicht. Es soll dein Schade nicht sein! Wir werden es dir reichlich lohnen.» Da zog der Schneider seine Hand zurück und ging weiter, indes der Hunger ihm in den Kutteln knurrte. Unlang kam er zu einem Roß, das friedlich auf einer Waldmatte weidete. Er zog das Messer. «Das will ich schlachten», sprach er zu sich selber, «und mich satt essen an seinem Fleisch.» Da aber begann das Pferd zu reden und sagte: «Laß mich leben. Es soll dein Schade nicht sein. Ich werde es dir reichlich lohnen.» Da schoppte der Schneider sein Messer wieder in den Sack und schleppte sich weiter, ob er auch, ganz hohl vor Hunger, kaum noch einen Fuß vor den andern setzen mochte.
Es war nun der neunte Tag der Wanderschaft und seit drei Tagen hatte er keinen Bissen mehr gegessen. Aber nach einer Weile stund plötzlich ein hochgebautes Schloß vor ihm mit Mauern, Wall und Graben. Die Sonne ging zur Rüste und der Pförtner wollte eben das Tor schließen. «Haltet ein, guter Mann», rief flehentlich der Schneider, «und gebt mir ein Stück Brot, sonst sterb ich auf dem Flecke
Hungers!» Der Pförtner, der ein gutes Herz hatte, brachte ihm ein Brot und einen Becher Weines dazu. Als der Schneider den ganzen Laib verzehrt hatte bis auf das letzte Bröcklein, da fragte er, ob sie im Schloß keine Arbeit für ihn hätten. Er sei ein wandernder Handwerksmann, seines Zeichens ein Schneider. Der Pförtner antwortete, er wisse es nicht, er wolle aber hineingehen und den Herrn fragen, er solle derweil hier warten. Bald kam er zurück und brachte den Bescheid, der Herr lasse sagen, wenn er ein guter Schneider sei, so gäbe es hier Arbeit genug für ihn. Der Graf wolle sich ein neues Staatskleid nähen lassen. Und so blieb denn der Schneider auf dem Schloß.Nach einigen Tagen, siehe da kam der Schuster von ungefähr auch vor das Schloß. Und auch er erhielt Arbeit. Er sollte dem Grafen ein Paar neue Jagdstiefel anfertigen. Aber wie sperrte der Schuster Maul und Augen auf, als er den Gevatter Schneider mit heilen Augen hier bei der Arbeit erblickte. Er wagte aber nicht, ihn darüber zu befragen, und so tat er. als sei zwischen ihnen alles beim Alten. Der Schneider, der sagte auch nichts, sondern nähte, ohne groß aufzuschauen, eifrig an des Grafen Rock fort, indes der Schuster sich ungesäumt hinter die Stiefel machte.
Der Graf war mit ihrer Arbeit gar wohl zufrieden; er belobte beide, den Schneider für das Kleid, den Schuster für die Stiefel, und sagte: «Ihr sollt bei mir bleiben und weitere Aufträge erhalten. In einigen Wochen werde ich Hochzeit machen, und da braucht meine Braut ein Hochzeitskleid und ein Paar neue feine Ballschuhe. Der Schuster, der noch immer einen Haß auf den Schneider hatte, wäre ihn gern losgewesen. Und da hing er heimlich zum Grafen. «Mit Verlaub, gnädiger Herr», sagte er, «hütet euch vor dem Schneider. er ist ein Bösewicht, der hexen und zaubern kann.» Da beschied der Graf den Schneider vor sich und sagte: «So, was muß ich hören! —Du bist ein Zauberer und Hexenmeister. Für Leute solchen Schlages ist hier kein Platz. Pack auf
der Stelle dein Bündel und mach, daß du fortkommst!» Da gehub der arme Schneider sich übel und fing zu jammern und zu bitten an, bis der Graf sich bewegen ließ. «Nun wohl», sagte er, wenn du den versiegten Brunnen im Hof drunten wieder zum fließen bringst, dann darfst du bleiben, und der Schuster muß fort.» Der Schneider dachte: «Ach, wie soll ich wohl einen versiegten Brunnen wieder zum Fließen bringen! Es ist wohl das Beste, ich gehe meiner Wege.» Aber wie er vors Tor hinaus kam, stand da ein munteres Roß, das sprach: «Sitz auf, und ich trage dich dreimal ohne Halt um die Ringmauer, dann wird der Brunnen fließen.» Der Schneider saß auf - und hin flog der Fuchs geschwind wie der Wind dreimal mit ihm ums ganze Schloß, und siehe da, ein Strahl hoch wie der höchste Baum sprang auf. Der Schneider klopfte dem Roß dankbar den Hals. Da sprach es: «Du hast mir das Leben geschenkt, als du in Not warst, drum hab ich dir heute geholfen.»Jetzt durfte der Schneider im Schlosse bleiben und das Brautkleid nähen. Aber auch der Schuster blieb, denn er hatte die neuen Ballschuhe noch nicht fertig. Und wie zu erwarten, gefiel dem Grafen und seiner Braut das Hochzeitsgewand und die feinen Schühlein so gut, daß Schneider und Schuster alle beide zum Hochzeitsfest geladen wurden. Aber den argen Schuster stach wiederum der Böse, daß er vor den Grafen trat und sprach: «Gnädiger Herr, der Schneider ist ein abgefeimter Schurke und hat Böses wider euch im Sinn. Jagt ihn auf der Stelle fort, ehe er es ins Werk setzen kann.» Der Schneider aber beteuerte seine Unschuld bei Gott und allen Heiligen und bat und bettelte, bis der Graf schließlich sagte: «Nun wohl, so höre: mein Oberkoch und Zuckerbeck sagt mir eben, daß er für den Hochzeitskuchen frisch geschwungenen Honigs bedürfe. Hinten im Garten stehen neun leere Bienenbörbe. Wenn du mir die bis morgen Abend, ehe die Sonne vergeht, mit vollen Waben füllen kannst, dann darfst du bleiben, und dann muß
der Schuster fort. Denn, ich merk es wohl, einer von euch beiden ist ein Spitzbub.»Traurig stand der Schneider am nächsten Morgen auf und ging in den Garten. Der war so groß und weit, daß man gar nicht sehen konnte, wo er zu Ende war. Baum stand an Baum, und weiß wie Schnee schimmerte der Blust. «Ach». seufzte der Schneider und staunte stur in all die Pracht. «ach, wie soll ich den Honig sammeln aus den tausend und tausend Blüten!» Da summte und surrte es, und ein Bienlein saß ihm auf den Ärmel und sprach: «Ei, guter Freund, laß den Kopf nicht hängen, sitz unter den Apfelbaum dort und lausch den Vöglein, die vor Lust und Freude jubilieren. Indes wollen wir deine Arbeit tun.» Und im selben kam ein ganzer Immenschwarm angebraust - es war, wie wenn eine Orgel tönte - und machte sich emsig ans Werk. Und ehe es vom Schloßturm Vesper läutete, waren alle neun Körbe voll duftender Waben. Der Schneider dankte den Bienen und machte einen tiefen Knix vor der Königin, wie die Schneider vor vornehmen Leuten zu tun pflegen, denn sie haben gar ein großes Geschick zu solchen Sachen. Diese aber sprach: «Du hast unsern Honig geschont, als du in Not warst, drum hat mein Volk dir heute geholfen.» Und fort flog der ganze Schwarm, daß es sauste und brauste.
Als der Graf in den Garten kam und die vollen Körbe sah, sagte er: «Ich sehe, daß die guten Geister dir zur Hand gehen. Du bist ein guter Mensch und kannst deine Kunst. Du sollst bei mir im Schlosse bleiben zeit deines Lebens und wenn Gott will, dereinst auch meinen Kindern ihre Kleider nähen. Den Schuster aber, den Schurken, den jag ich jetzt zum Teufel, denn dort, wo dieser Meister ist, gehört jener hin.» Und was er sagte, das tat er auch.
Die drei Raben
Es war einmal ein Mägdlein, das war lieblich wie ein Blümlein auf der Matte und munter wie ein Vögelein, aber solange es denken mochte, hatte es seinen Vater immer nur traurig gesehen. Das drückte ihm schier sein Herzlein ab und eines Tages sprach es zu ihm: «Sag, Vater, warum bist du auch immer so traurig?» «Ach, mein liebes Kind», antwortete dieser, «das ist eine traurige Geschicht», und er erzählte ihm, daß es drei Brüder gehabt. Die habe er, als es geboren worden, zum Brunnen geschickt nach Wasser, damit er es taufen könne, denn es sei gar klein und schwächlich gewesen, und er habe gefürchtet, es sterbe ungetauft. Den Buben aber sei der Krug auf dem Weg zerbrochen, und da hätten sie sich nicht heim getraut. Und wie sie nicht hätten kommen wollen, da habe er sie in bösem Zorne in Raben verwünschen. Und der Fluch habe auf der Stelle sich erfüllt und könne nicht zurückgerufen werden.»
Von dem Tage an fand das Mägdlein daheim keine Ruhe mehr, denn es meinte, es sei schuld an dem Unglück seiner Brüder. «Ich will alles tun, um sie zu erlösen, und sollte ich mein Leben darüber verlieren», sprach es zu sich selber. Und eines Tages, als die Eltern beide ausgegangen waren, machte es sich heimlich auf den Weg, um seine Brüder zu suchen. Es ging den ganzen langen Tag ohne Unterlaß. Gen Abend kam es in einen Wald. Auf einer Lichtung unter einem großmächtigen Eichbaum erblickte es eine Laubhütte. Im selben trat eine wunderholde Frau hervor, die winkte das Mägdlein zu sich und sprach: «Komm gutes Kind, und fürchte dich nicht. Ich weiß schon, warum du hierher gekommen bist. Ich will dir helfen deine Brüder zu finden. Aber jetzt hast du deine Füßlein müde gelaufen, bleib du bei mir über Nacht.» Die Frau aber war eine gute Fee, die dem Mägdlein schon lange gewogen war. Des anderen Morgens
früh, als alle Vöglein zwitscherten, führte die Fee das Kind an den Rand des Waldes und sprach:«Gradus über's Feld, und z'mitts im Feld.
Do stöhnd die drei schönste Linde-n-uf der Welt».
und dann hieß sie es getrost weiter gehen. Als es nun wohl
den halben Tag so zu gegangen war, und die Sonne am
höchsten stand, da kam es auf ein weites Feld. Und mitten
auf dem Felde, da standen drei uralte Lindenbäume. und
auf jeglichem saß ein kohlschwarzer Rabe. Wie das Mägdlein
näher kam, flogen die Raben von den Linden herab,
setzten sich ihm auf Schultern und Hand und buben also zu
sprechen an: «Ei, sieh da unser herzliebes Schwesterlein ist
gekommen, uns zu erlösen!» «Ach Gott», sagte das Mägdlein,
«welch ein Glück, daß ich euch gefunden habe. Aber
sagt mir doch nur, was soll ich tun, damit ihr erlöst werdet?»
«Ja, wahrlich, das ist ein schweres Stück», antworteten die
Raben, «drei Jahre lang darfst du kein Menschenwort reden,
sondern mußt stumm bleiben wie ein Stein, was immer geschehen
mag. Und versiehst du dich nur ein einziges Mal,
dann müssen wir als Raben fliegen unser Leben lang.» So
sprachen die Raben und flogen eilig fort. «Oh, für euch will
ich gerne alles leiden was Not tut!» rief ihnen das Mägdlein
nach und machte sich alsbald auf den Heimweg. |
Aber wie es wieder in jenen Wald kam, wo die gute Fee wohnte, da stand an der Stelle der Laubhütte, wo es über Nacht gewesen war, ein prächtiges Schloß, und ehe es vor Staunen wieder zu Sinn gekommen, sprengte ein lauter Zug von lustigen Jägern aus dem Tor hervor, und einer blies das Hifthorn, daß es im ganzen Walde hallte und schallte. Voraus aber ritt auf einem milchweißen Roß der junge Graf, dem das Schloß und der Wald und alles Land im Rund gehörte. Wie der das liebliche Kind erblickte, das da ganz allein durch den dunklen Forst daherkam, da hielt er sein Roß an und fragte freundlich: «Woher des Landes, schönes
Kind, und was willst du hier?» Aber das Mägdlein gab keine Antwort, sondern blieb stumm und verneigte sich bloß mit Anmut. Der Graf betrachtete die holdselige Gestalt und konnte die Augen nicht mehr abwenden von ihr, so lieb hatte er sie beim ersten Blick gewonnen. «Nun, wenn Gott dir die Rede versagt hat», sprach er, «so hat er dich mit Schönheit gesegnet und dir edle Zucht und Sitte mitgegeben. Wenn du mir auf mein Schloß folgen willst, so soll es dich nicht gereuen.» Das Mägdlein nickte stumm mit dem Haupte, da setzte der Graf es vor sich auf sein Roß und brachte es alsbald ins Schloß zu seiner Mutter. Und wieder verneigte die Jungfrau sich mit Anmut, aber kein Wort kam aus ihrem Munde. «Wo hast du diese Dirne aufgelesen?» fragte die alte Gräfin hässig, «es scheint, sie hat eine schwere Zunge. Und was soll sie hier im Schloß?» «Meine Gemahlin soll sie werden», erwiderte der Graf. «Schau sie nur an, ist sie nicht holdselig und gut. Und mag ihr auch die Sprache versagt sein, so ist sonst weder Fehl noch Makel an ihr zu finden.» Auf diese Rede ihres Sohnes schwieg die alte Gräfin und sagte nichts mehr, aber heimlich behielt sie einen argen Groll in ihrem Herzen. Am andern Tag schon feierte der Graf in lauter Freuden sein Hochzeitsfest. Seine Mutter aber saß derweilen mürrisch in ihren Gemächern und sann darüber nach, wie sie die unerwünschte Sohnsfrau loswerden möchte.Kaum waren die Festtage verflogen, da kam ein Gewaltsbote vom Kaiser, der bot alle Mannen im ganzen Reich zu einer Heerfahrt auf. Und da mußte auch der Graf ohne Verzug sich rüsten und Abschied nehmen von seinem jungen Weibe. Nun hatte er unter seinem Gesinde einen Diener, den hielt er für den getreuesten von allen. Dem gab er seine Gemahlin in Obhut und empfahl sie seiner Sorge. Der Diener versprach, seine Herrin zu hüten wie seinen Augenstern.
Aber kaum war der Graf aus dem Hause, so hub die alte
Gräfin alsbald an, ihren Haß an der jungen Frau auszulassen. Sie bestach den Diener und machte sich ihn willfährig. Sie nahmen der jungen Gräfin alle die schönen Kleider weg, die ihr der Graf geschenkt, ließen ihr bloß ein altes Hudelschluttli und stießen sie aus dem Schloß und hießen sie wie eine Magd in Stall und Hof alle harte Arbeit tun. Und als die arme Gräfin übers Jahr ein wunderliebliches Knäblein zur Welt brachte, da nahm es ihr die böse Alte fort und übergab es dem falschen Diener, daß er es in den Wald trüge, damit die wilden Tiere es auffräßen.Bald danach aber kam der Graf nach Hause. um nach den Seinen zu schauen. Da sagte die Alte: «Dein stummes Weib ist ein Zauberweib. Sie hat dir ein totes Kind geboren. Das ist die Strafe des Himmels, daß du auf meine Warnung nicht hast hören wollen.» Und der Diener, der dabei stand, sagte: «Ja, gnädiger Herr, draußen im Walde liegt's, da hab ich's begraben.» Der Graf aber mochte von seiner Frau nichts Böses glauben und nahm sie wieder zu sich. Bald ritt er wieder in den Krieg.
Wieder verging ein Jahr, und der Graf kam abermals heim, um nach den Seinen zu schauen. Unterweilen aber hatte seine Gemahlin abermals einem Knäblein das Leben gegeben. Das hatte der Diener wieder in den Wald hinaus tragen müssen auf der Alten Geheiß. Und die Alte sagte als der Graf heimkehrte: «Dein stummes Weib ist des Teufels Buhle. Sie hat kein Kind geboren, sondern ein haariges Tier.» Und der Diener stand dabei und sagte: «Ja, gnädiger Herr, ein schwarzes Hündlein ist's gewesen, draußen im Walde hab' ich's verscharrt.» Aber auch diesmal wollte der Graf den bösen Reden keinen Glauben schenken und nahm seine Gemahlin wieder zu sich, bis er wieder verreisen mußte.
Und wieder verstrich ein Jahr, da aber war der Krieg zu Ende, und der Graf kehrte in sein Schloß zurück, hoch geehrt und reich belohnt vom Kaiser für seine kühnen
Taten. Derweilen aber hatte seine Gemahlin einen dritten Knaben geboren. Den hatte der Diener auch in den Wald hinaus getragen. Und die Alte sagte zum Grafen: «Dein stummes Weib ist eine Hexe und hat den Tod verdient. Das dritte Kind war ein garstiges Ungetüm.» Und der Diener stand dabei und sagte: «Ja, gnädiger Herr, es ist gleich durch das Fenster nach dem Wald geflogen.» Da ergrimmte der Graf und konnte nicht anders, er ließ seine Gemahlin in den Turm werfen, und das Gericht verurteilte sie, daß sie bei lebendigem Leib verbrannt werden sollte.Als der Holzstoß im Schloßhof aufgeschichtet war, wurde die junge Gräfin hinausgeführt und an den Pfahl festgebunden, und alle Richter waren gegenwärtig und standen da in ihren schwarzen Mänteln. Dann trat der Herold vor und kündigte der jungen Gräfin den Tod an. Danach wandte er sich lauten Rufes nach allen Richtungen des Himmels und fragte, ob jemand willens und bereit sei, die Angeklagte zu verteidigen und ihre Unschuld zu erweisen. Aber alles schwieg, und so still war's, man hörte keinen Atemzug. Eben sollte das Feuer angezündet werden, da erscholl aufs Mal fernher ein Hornstoß und mit Sturmeseile jagten drei stolze Reiter daher in silberblinkenden Rüstungen auf rabenschwarzen Rossen, und alle drei führten einen Raben im Schild, und ein jeder hielt ein wunderliebliches Knäblein im Arm. Und ehe der ruchlose Diener, der eben die brennende Fackel erhob, sich dessen versah, hatte der vorderste von den Jünglingen ihn mit seinem Speere durchstoßen. Alle drei aber riefen eines Mundes: «Hier sind wir, liebste Schwester, und hier bringen wir dir deine drei Kinder wieder. Die gute Fee im Walde hat sie dir gehütet und aufgezogen.» Und sie holten die junge Gräfin von dem Scheiterhaufen herab und herzten und küßten sie. Und nun trat sie vor ihren Gatten und erzählte ihm alles der Reihe nach, was sich zugetragen. Da war denn Jubel und Freude ohne Ende, könnt ihr euch denken. Aber jetzt wurde die
tückische Alte auf den Holzstoß gebracht und zu Asche verbrannt. Die drei Brüder aber kehrten heim zu ihren Eltern. und der Graf und seine Gemahlin lebten mit ihren Kindern in treuer Liebe bis an ihr Ende.
Das Mägdlein ohne Hände
In einem baufälligen Häuslein draußen vor dem Dorfe lebten ein Mann und eine Frau. Die waren bettelarm und vermochten kaum, sich selber und ihr einziges Kind zu ernähren. Und als nun gar einmal das karge Äckerlein nichts eintrug und ihnen dazu noch das einzige magere Kühlem verendete, da ward der Mangel zur Not und der Hunger kam zu Gast. «Ach», seufzte der Mann, «Gott habe ich vergeblich angerufen, woher soll uns da noch Hilfe kommen!» Da trat plötzlich ein fremder Herr in einem grasgrünen Rock in die Stube, grüßte freundlich und sprach: «Guter Mann, ich weiß wohl, wie's um euch steht, und ich komme um euch zu helfen, wenn ihr meine Hilfe annehmen wollt. Hört, ich will für euch und euer Kind aufs beste sorgen, wenn ihr es mir nach zwölf Jahren, von heute ab gerechnet, zu eigen geben wollt an Vaters statt.» Und damit stellte er einen prallen Beutel voller Goldstücke auf den Tisch. «Dieser Beutel ist dein, und er wird nie leer werden, sondern stets von selber sich wieder füllen. Nun bedenkt euch wohl, denn ein solches Anerbieten wird euch nimmermehr zu Teil.» Der arme Mann griff ohne Bedenken zu und schlug ein, und dankte dem fremden Herrn gar sehr für seine Güte. Aber wie jener die Stube verließ, gewahrte er mit Grauen, daß er an einem Bein statt des Fußes einen Roßhuf hatte. Da wußte er, daß er sein Töchterlein dem Teufel verkauft hatte.
Das Mägdlein aber gedieh gar prächtig und wuchs fröhlich
heran in Unschuld und ohne Sünde, und wurde mit den Jahren zu einer schönen Jungfrau. Und als nun die Zeit um war und der böse Tag herankam, da trat der Teufel ein und forderte seine Beute. Aber das fromme Kind hatte sich, wie's der Brauch war, mit lauterem Wasser rein gewaschen und das Zeichen des Kreuzes an sich gemacht. Da konnte der Böse ihm nichts anhaben. Zornig sprach er zum Vater: «Schlag ihr beide Hände ab, ehe sie sich wieder wäscht und bekreuzt. und binde sie an einen Baum im Walde! Tust du nicht, wie ich sage, so soll es dir übel ergehen.» Der Vater voller Furcht sagte es ihm zu. Am andern Morgen aber stand die Tochter noch vor Sonnenaufgang auf und wusch und bekreuzte sich. Da kam ihr Vater und hieb ihr mit der Baumaxt die beiden Hände ab, führte sie in den Wald und band sie allda an einem Baum fest, und ging fort. Als bald darauf der Teufel kam, da hatte er doch wieder keine Gewalt über sie und mußte weichen.Die Jungfrau aber hätte elendiglich verschmachten müssen, wäre nicht von ungefähr ein Königssohn mit seinen Weidgesellen durch den Wald daher geritten. Der sah das schöne Kind und erbarmte sich seiner und löste ihm seine Bande. Er setzte sie auf sein Roß und brachte sie in das Schloß seines Vaters. Und weil sie ebenso fromm und gut war, als schön, so gewann die Jungfrau auch des alten Königs Herz, so daß er seinem Sohn den Segen gab, als er vor ihn trat und das Mädchen ohne Hände zur Frau begehrte. Und bald ward die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert, und das junge Paar lebte in lauter Glück und Freude.
Aber nicht lange darnach mußte der Königssohn in den Krieg ziehen. Er empfahl seine Gemahlin der Obhut seines Vaters und bat, daß man ihm oft Nachricht von ihr sende, denn sie war guter Hoffnung. Der junge König blieb lange aus, und unterdessen genas die Fürstin eines Zwillingspaares. Der alte König sandte alsbald einen Boten an seinen Sohn mit der frohen Märe und der Bitte, er möge doch
recht bald nach Hause kommen. Unterwegs aber rastete der Bote in einem Walde und schlief ein. Da kam eine Hexe. die war des Teufels Magd, und nahm ihm den Brief weg und legte ihm einen anderen unter, darin stand geschrieben, die Fürstin habe zwei Katzen zur Welt gebracht. Wie der Prinz diese Nachricht erhielt, erschrak und betrübte er sich über die Maßen. schrieb aber einen Brief an seinen Vater. man solle einstweilen nichts tun, sondern warten, bis er heimkomme, und seine Gemahlin aufs beste pflegen. Der Bote rastete auf dem Heimweg wieder in demselben Wald. Da kam wieder die Hexe und schob ihm abermals einen anderen Brief unter. Darin stand geschrieben, man solle die Frau mit samt den Geschöpfen, die sie geboren, in den Wald hinausstoßen, damit sie dort elendiglich verderbe.Als der alte König diesen Bescheid erhielt, weinte er bitterlich, so leid tat ihm die unschuldige Frau, aber niemand wagte eine Einrede. Sie banden ihr die beiden Kindlein an, das eine vor die Brust, das andere auf den Rücken, und so ward die Ärmste hilflos in die Wildnis hinausgestoßen.
Lange irrte sie weinend umher und wußte nicht, wohin sie sich wenden sollte. Da kam sie im tiefsten Waldesgrunde zu einem Brunnen, der entsprang vor einer Rosenhecke. Sie ging hinzu, um ihren Durst zu löschen. Aber als sie sich bückte, um zu trinken, da entglitt ihr das eine Kind und fiel ins Wasser. Die Mutter fuhr ihm mit den Armstumpen nach, um es zu fassen, und siehe da, sie ergriff es. Die Hände waren ihr wieder gewachsen, denn der Brunnen war ein Zauberquell heilkräftigen Wassers. Voller Inbrunst blickte sie zum Himmel auf und dankte Gott für seine Gnade. Aber wie sie die Augen wieder zur Erde wandte, da erblickte sie, wo eben noch die Rosenhecke gestanden, ein vielzinniges Schloß mit hundert Türmen und Toren und tausend hellglänzenden Fenstern: Sie trat, die Kinder auf den Armen, in die hohen Hallen und weiten Gemächer, und fand alles, was das Herz begehren kann für die Notdurft des
Leibes. Aber nirgends war ein Mensch zu sehen, und unsichtbare Diener bedienten sie zu jeder Stunde, wie es einer Königin geziemt. In diesem Schlosses lebte sie nun sieben Jahre lang, täglich das Gemahles harrend.Als der Krieg zu Ende war und der Königssohn heimkam, um seine Gemahlin zu umarmen, da stand seines Vaters Schloß schmuck und schön wie zuvor, aber wie er nach seinem Weibe fragte, da fing der alte König zu weinen an, und wies ihm den Brief vor, und da kam es an den Tag, daß die beiden Schreiben verfälscht worden waren. Als der

Vom Röseli u vom Reseli
Es isch einisch e Muetter gsi, die hat gäng Rüggeweh gha. Du het sie zu ihrne zwöi Meiteli, zum Röseli u zum Reseli gseit: «Göht zäme i Wald use u suechet Farechrut für uf my chranke Rügge; aber sit de liebi zäme ungerwägs!»
S'Röseli u s'Reseli hei's versproche u si abzöttelet; aber es isch nit lang gange, het s'Reseli nümme nachemöge. Äs het drum e Chnubel am lingge Fueß gha, e Chnubel so groß wie nes Pfünderli.
Wo s'Reseli so isch dehingerblibe, isch s'Röseli toube worde u het gseit: «Da ha-n-i jetzt wieder e Metti mit dir. La gseh, pessier, oder i loufe dervo!»
S'Reseli isch ghumplet u ghumplet, was es nume het möge, aber na me ne Cherli het es müeße abhocke vor Müedi. S'Röseli hat afa stämpferle u het trümpft: «So hoch mira da, so lang de witt, du Zaaggibase!» u isch em Schwöschterli abgschobe. Äs isch i Wald me gschuenet u het sich nüt drum kümmeret, wo-n-ihm s'Reseli het grüeft u agha, äs söll ihm doch warte.
S'Röseli isch dür e Tannewald us u het dänkt: «Da äne mueß i jetzt zume Bächli cho, und änet em Bächli isch e große Farechrutblätz», aber wie-n-äs o isch gloffe-n-u gloffe. isch äs eifach zu keim Bächli cho. Wo süsch Heitistude si gstande, si jetzt Tintebeeri gwachse, u wo früecher d'Tanne wie Cherze is Blaue ufe gluegt hei, si jetzt verchropfeti Grotze gsi mit Bärt u Haxebase. Es het s'Röseli schier afe tschudere i der Hürschete-n-inne. Ufs'Mal isch es du heiterer worde u as isch uf enes Waldmätteli cho. Dert isch es chlys Hüsli gstande mit erne Gärtli drum urne. Us em Chemi het's grouchnet u d'Fänschter si offe gsi. Het s'Röseli dänkt: «Da isch ömel öper daheim, da cha-n-i frage, wo-n-i bi!»
S'Röseli het süferli a d'Tür topplet; aber da isch es erschlüpft, es het ganz hohl tönt; am liebschte wär es grad furtgschprunge; aber vor Angscht si-n-ihm d'Bei schwär gsi. Na me ne Cherli isch en ahi, chrummi, chrydewyßi Frou usecho. Sie het s'Röseli lang, lang agluegt, es het's tüecht, äs chönnti derwyle ga Basel ache u wieder zrügg. Derna hat sie du gseit: «So! so! — bisch du jetzt s'Röseli? So! so! so! Muesch s'Warte lehre. muesch lehre Geduld ha. weiß es guets guets Mitteli!»
Sie het s'Röseli by der Hand gno u isch mit ihm Garten-use, mitts-y-nes Grasmätteli. Dert isch sie drümal umihns umegloffe u het gseit:
«Tue der Lyb verchürze, mach derfür e Würze!» |
S'Röseli het ufs Mal syni Füeß nümme chönne lüpfe. Äs hat chönne chnorze-n-u porze, wie-nes het wölle, äs het am glyche Fläck müeße blybe. — U du si-n-ihm us de Füeß use Würze gwachse u si i Härd abegschloffe. U sy Lyb isch ganz dünn worde. u d'Ärmli o. u-n-es si Dörn u Blettli us ihm usegwachse; sy Chopf aber isch e Rosechnopf worde, wo grad het wölle-n-ufblüeie.
Derwayle-n-isch s'Reseli dür e Wald us ghumplet u het s'Röseli gsuecht. Äntlige het äs das Waldmätteli o gfunden-u het dänkt: «Da isch es Hüsli, da ga-n-i ga frage. ob öppe die Lüt, wo hie wohne, s'Röseli beige gseh.»
Äs het toppelet, u wie bym Röseli isch o jetzt die ahi Frou usecho. Ganz früntlig het sie s'Reseli agluegt u het gseit: «Gäll, du suechsch dys Schwöschterli. Chum, i will dir cho zeige, wo-n-es isch!»
Sie het's Reseli by'r Hand gno u het's i Garte-n-use gfüert. Vor em Rosestöckli isch sie mit ihm bube stab u het gseit: «Was seisch zu däm Röseli?»
Z'Reseli het das Stöckli läng agluegt, u-n-ufs Mal het es grüseli afa briegge u het gseit: «Was mueß i mache, daß es wieder mys Schwöschterli cha wärde?»
Die chrydewyßi Frou het der Chopf gschüttlet, u derna het sie gseit:
«Dy Fueß isch z'schwär, dy Fueß isch z'schwär, du humplisch wie-ne-n-alte Bär.» |
Da her die chrummi Frou no einisch der Chopf gschüttlet u het gseit:
«Dy Fueß isch z'schwär, dy Fueß isch z'schwär, du humplisch wie ne-n-alte Bär.» |
Aber s'Reseli het ere agha bis sie het gseit: «Du muesch dert über e höchschte Bärg übere. Uf der angere Syte-n-isch es silberigs Seeli. Dert drus muesch du-n-es Chrüegli voll Wasser ga reiche u dermit z'Rosestöckli bschütte. De wird es wieder es Meiteli aberwie chöntsch au. mit däm Chnubel a dym Fueß!»
S'Reseli het sich kei Ougeblick bsunne. As het der Frou es Chrüegli gheusche u-n-isch uf de Wäg. Die spitzige Steine hei-n-ihm d'Füeß gritzet, u hundertmal het es müeße-nabhocke u verschnuppe u het gmeint, jetzt göis nümme; aber de het äs a sys Schwöschterli dänkt u het wieder en Alouf gno.
Wo d'Sunne-n-abe-n-isch, ischt es äntlige z'oberscht uf em Bärg gsi u het chönne hinde-n-aber luege. U du het es es silberigs Seeli gseh, gar nit töifunde. Mit der letschte Chraft isch äs zu däm Seeli gloffe. Je necher es zum Wasser isch cho, je meh hei-n-ihns d'Füeß brönnt; es het's tüecht, sy chrank Fueß syg eis Für. Und es het blanget, für ne-n-y's chalte Wasser chönne z'tünkle.
U wo-n-es äntlige bym Seeli isch gsy, isch es a's Börteli kneulet u het sys Chrüegli gfüllt. Derno het's i däm silbrige Wasser syni Füeß badet. Es het ihns tüecht, das chalt Wasser sygi Balsam.
Wo-n-es name Wyli sy Hogerfueß het usezoge ai, ai! S'Reseli het syne-n-Ouge nid trouet: Es fyns, hechts,
schlanks Füeßli het es gha. S'Reseli isch mit der Hand drübergstriche, u syni Ouge hei glüchtet wie d'Morgesunne. Derna isch es ufgstande-n-u het probiert, ob as das Füeßli chönni bruche. O ja! es isch guet gange. S'Reseli isch ufern Seebörtli umegfäcklet wie nes Summervögeli.Ungereinisch isch ihm du wieder z'Röseli i Sinn cho. Do isch's j allem Mondschyn über Stock u Stet zrügg, hecht u flingg wie nes Rehli.

Am Morge, ebb d'Sunne-n-uf isch, isch es bym Rosestöckli gsi u het ihm das silberige Wasser agschprützt. —Da si dam Pflänzli d'Bletter, Dörn ud Würze-n-abtrohlet, und uf's Mal isch z'Schwöschterli dagstande. Die zwöi Meiteli hei enand a-n-es Ärfeli gno, u derna hei sie enangere d'Hand gä u si heizue. Ungerwägs hei sie e große, große Arfel Farechrut gfunde für d'Muetter.
s'Merli vom Funtechächeli
Es ist erna! en arms arms Chindli gsi, de Vatter und d'Mueter sind cm gstorbe-n-und do hät's müese bymene Vetter und by-n-ere Bäsi si, und di händ em wenig z'Ässe ge, und de ganz Tag hett's söle-n-uf sym Chämmerli spinne. Do isches e Mal ganz trurig i sym Chämmerli gsässe und hät' gschroue! «Ach, wänn nu au myn liebe Vatter un my liebi Mueter na

Do ist das Fraueli wider furtgange, und das Chind ist ganz eleinig bube. Do häts tankt: «Wän ich nu au de Name nüd vergisse!» Und das' s ne nüd vergässi, hät's de ganz Tag aliwyl vorem ane gseit: «Funtechächeli, Funtechächeli.» Z'letst isch es müed worde-n-und ist ygschlaffe. Und wo's erwachet morndeß und ufstaht, so hät's de Name ganz vergässe gha und hate gar nüme chöne säge. Es hät si schier z'tod bsinet, und der ander Tag au, und z'letst isch es erschröckli trurig worde-n-und hät agfange schreie, wil es nüme gwüßt hät, wie das Fraueli heißt.
Jez am dritte Tag sitzed's zimbis bym Asse-n-und chömed d'Chnächt hei usem Holz, und do händ die Chnächt erzelt und gseit zum Meister und zur Meistere: «Wänir au wüßted, was mir gseh händ!» Do säged's: «He, was wetted er gseh ha?» Do säged die Chnächt: «He nu: Z'mitzt im Holz uße ischt e runds, grüens Wisli, und i dem Wisli had z'mitzine es Fürli b'brännt und es Häfeli deby, das hät gsotte-n-und deby zue ist e schrökli schöns Fraueli gstande — er chöned gar nüd glaube, was für e schöns, chlyses chlyses Fraueli das gsi ist -do hät's e Chele gna und hät i dem Häfeli grüehrt, und dann isch es alewyl z'ringelum gange-nund hät gsunge:
«Süd. süd Häfeli, süd! schweiß. schweiß, Häfeli schweiß, Wyl mys Chindeli nümme weiß, das j Funtechächeli heiß.» |
Meied ir, do hät das chind gloset, wo's das ghört hät vo dene Chnächte. Jez hät's ja uf einmal wider gwüßt, wie das Fraueli heißt. Es hät si aber ganz still gha und hät keim Möntsche nüd gseit, und ist wider i svs Chämerli gange go spinne. Do zabig chunt das herzig Fraueli und seit: «So, wie isch es jez, weist jez na, wie-n-i heiße?» Do seit's: «Ja fryli weiß i's. wie-n-er heißed: Funtechächeli heißed er!» Do seit das Fraueli, «Ja ja, du häsches guet b'halte, wie-n-i heiße, und jez bringi der das Redli» und git em do es guldigs Spinnredli, wo vume sälber hät chöne spinne-n-und seit: «Bhüetigott, und blyb mer nu aliwyl e guet's und e bravs Chind.»
Do hät das Chind es Redli gha, das hät so e schöns Garn gmachet, wie kei einzigi Frau im ganze Dorf hät chönne. Es ist aber e bravs, flyßigs Chind blibe-n-und hät syner Läbtig as Funtechächeli tänkt.
Vom goldenen Liirlüüserli*
Es waren einmal eine Mutter und ein Vater, die hatten zwei Kinder, ein Mädchen und einen Bub. Das Mädchen war der Mutter eigenes Kind, dem Knaben aber war sie Stiefmutter; die rechte Mutter war ihm gestorben. Das Mädchen hatte sie gern, aber das Bübchen plagte sie und behandelte es wie einen Fremden.
An einem Tag, mitten im Winter, war der Vater ins Holz gegangen. Da sagte die Mutter zu den Kindern, sie könnten ihre Hutten nehmen und im Wald Holz holen. Das, welches zuerst zurück sei und die größere Bürde heimbringe, dürfe dann im Kasten auf der Laube einen Apfel holen.
Da gingen die beiden Kinder in den Wald und fingen an, Holz zu sammeln. Der Bub merkte bald, daß das Mädchen mehr Holz zusammenbrachte. Darum band er das Mädchen mit seinen Flechten an einen Baum. Derweil sammelte er eifrig Holz, nahm seine Bürde und machte sich auf den Heimweg. Bald kam ihm das Mädchen nach. Der Knabe hatte aber die größere Bürde beisammen und das Mädchen die geringere.
Nun ging der Bub auf die Laube, um sich einen Apfel zu holen. Aber die Mutter war enttäuscht und unleidig; sie mißgönnte dem Knaben den Apfel, denn sie hatte das Mädchen lieber.
Leise schlich sie dem Knaben nach, die Laubentreppe hinauf und durch die Laube. Und wie der Knabe den Kastendeckel öffnete, sich mühsam über den Kasten krümmte, um einen Apfel zu nehmen, da schlug sie den Deckel zu und hieb dem Knaben das Haupt ab. Eine solch nichtsnutzige, schlechte Mutter ist das gewesen.
Danach nahm sie den Knaben, tat ihn in den großen kupfernen Kochkessel und hing diesen an der eisernen Kette über das Feuer und kochte den Knaben. Das Haupt verbarg sie in einem hohlen Baumstamm. Danach mußte das Mädchen dem Vater das Essen bringen, weit, weit in den Wald hinauf. In einem Tuch eingewickelt trug es das Essen, in einem Handbränntli das Trinken. Der Vater setzte sich unter einen Baum, knüpfte das Tuch auf und begann zu essen. Wenn er ein Knöchlein abgenagt hatte, warf er es in einen hohlen Weidenstrunk. Das Mädchen machte sich mit dem leeren Tuch auf den Heimweg. Es war seither traurig und
ganz verstört und suchte und rief immer nach seinem Bruder.Es wurde Frühling. Als der Schnee geschmolzen war, erhob sich aus dem hohlen Baumstrunk ein Vögelein, flog auf den Hausfirst und begann zu singen, so schön, so schön:
Hühü. hühü,
D'Muetter het mi erschlage,
D's Meiteli het mi trage,
Der Ätti het mi gnaget.
Guguß, gugüßeli,
J bin es guldigs Liirlüüserli.
Hühü. hühü,
Meiteli. chumm eis use!
Das Mädchen hörte den seltsamen Ruf und sprang hinaus
vors Haus. Da warf ihm das Vögelein ein goldenes Spinnrädli
hinunter. |
Danach sang es wiederum wie vordem und rief:
Der Bueb mit em ysige Spazierstäcke
Es isch emol en Zimberma gsi, dä isch in Wald gange, go holze, und do het em d'Frau z'Mittag s'Ässe welle go bringe. Aber do händ Räuber die Frau ufern Wäg gstohle-n-und
händ sie in ihn Höhli gschleikt, und do hät sie ne müeße choche-n-und wäsche-n-und d'Ornig mache.Aber noch emejohr chunt die Frau es Chind über, en feste, stramme Bueb. Und wie dä Büebli fangs hät chönne chlei rede, so hät er zue eim vo däne Räubere, wo-n-em der liebst gsi isch, Vatter gseit. Das hät du aber die andere Räuber grüsii möge, denn sie sind nydisch worde, ass er nit ihne Vatter sägi. Und das isch langi Zyt eso gange.
Wie dä Büebli vierzähjährig gsi isch, so händ sie do zämme-n-usgmacht, sie welle ne töde, wenn er eim no einisch sägi, und händ em das gseit und em wüest dräut.
Do sind die Räuber wieder einisch uszoge, und der Bueb hät der Mueter ghulfe-n-ufrume-n-i der Höhlt, und do findt er en ysige Hammer, und dä schoppt er in Tschope. Wie jetz der erst vo däne Räubere hei chunt, so seit der Bueb: «Dihr sid au lang us gsi, Vatter!» «So, jetz isch dänn fertig mit dir!» brüeiet der Räuber en a und nickt über ne här für ne-n-ab z'schloh. Aber oha lätz! — der Bueb zieht waidli de Hammer us der Täsche, und schloht dem Räuber a d'Schlöfi, dä hät nit bu no bä meh gmacht und isch mustod umgfalie.
So chunt eine um der ander hei, und jede frogt ne, was da gange seig. Aber der Bueb seit zue jedwedem, mer heb ne welle töde, und da seig er Meister worde. So will ne-neine no-n-cm andere-n-ergryfe. Der Bueb förcht sie aber nit, und schloht eme jede sy Hammer a Chopf, bis ahi siebe tod do gläge sind.
Jetz isch aber der Bueb und sy Mueter i d'Höhli und händ vo däm Gäld und däne Chostberkeite gno, was sie händ möge träge, und sind mitenander is Dorf gange, wo die Frau deheime gsi isch, und sie göhnd an ihres Hus anen-und händ aklopfet. Do chunt der Ma use go luege, wär ächt zue-n-em weil, und d'Frau frogt ne, wo-n-er au sy Frau häig. Do seit der Ma, d'Chind deheime hebed cm scho vor füfzähe Johre einisch, wo-n-er z'obed vom Holze heicho
seig, verzeih, aß d'Mueter gange seig, ihm's Ässe in Wald use träge, und sider seig sie niemeh heicho. Do hät sech ihm d'Frau z'bchenne gä, und ahi sind uf d'Chneu gfalle-n-und händ vor luter Freude briegget, aß d'Mueter wieder hei cho isch, und d'Frau hät em Ma alles veruellt, wie's ere gange-n-isch die Zyt här, und hät em's Gäld gä, wo sie us der Räuberhöhli mitbrocht hät, und grad Wy b uftische und anden guete Sache.Dernoch sind sie in säller Nacht no zämme-n-in die Räuberhöhli gange, d'Frau und der Bueb und der Ma und d'Chind, und händ no meh Gäld heigholt, und soviel hät's gha, siebe Nächt händ sie müeße fahre-n-und füehre mit ihrem Chare, und's Roß hät's schier nit möge zieh, soviel händs albe glade gha. Sie händ aber doch no nes Hüfli b ligge, und dänn sind's gange-n-und händ's em Gricht azeigt.
Der Bueb hät aber jetz nit lenger welle deheime blybe, er hät in die wyt Wält welle wandere und seit zum Vatter: «Los, Ätti, i bi jetz groß gnueg und möcht öppis rächts lehre, und jetzt gang j in d'Wält und mache mys Glück!» «Jä, was wettisch dänn du für nes Hampferch lehre?» frogt ne der Vatter. «Schmid möcht i gä!» seit der Bueb. Des isch der Vatter z'fride gsi, und er goht mit dem Bueb is nöchste Stettli und git en bymene Schmid in d'Lehr. Der Bueb stoht an Ambos. nimmt de Hammer und schloht's Yse-nabenand und der Ambos in Ärdbode-n-yne. Der Meister hät cm es Wyli zueglueget, dernoh seit er: «Nei waeger, en settige Lehrbuch chan i nit bruche! Du miechisch mer die ganz Schmidte z'underobsi! Weisch was, s'best isch, du suechst der en andere Meister!» «Mira», seit der Bueb, «aber eb i gang, so sid so guet und mached mer es zähzänterigs Spazierstöckli us Yse!» Do hät der Meister Schmid glachet - es isch cm zuvor ehnder chlei gschmuech gsi - und seit, jo fryli, fryli, er weil cm en settige Stäcke vergäbes mache, wenn er ne lüpfe mög. Uf das hät der Bueb nüt meh gseit,
und er hängt dem Schmid sy Ambos und alles Schiff und Gschirr us der Wärchstatt ane Droht, nimmt's a chlyne Finger und springt dermit ums Stettli urne. Do hät's der Schmid verspillt gha und hät dem Bueb das Spazierstöckli müeße halber vergäbes mache, halber hät er em's zahlt.Dernoh isch der Bueb mit sym ysige Stäcke dervo greiset, und unlang, so trifft er imene Steibruch en Steihauer a, won-e grüslige Stei, so groß wie-n-e Heustadel, umenandertrohlet hät, grad wie der Beck es Batzebrötli. «Seh, wenn du so starch bisch», seit der Bueb zue-n-em, «so chumm du mit mir! Mir wändt mitenand am glyche Seili zieh.» Und do sind sie zämme wyters gange. Unlang, so chöme sie in Wald yne, und z'mitts inne, wo d'Bäum am höchste gsi sind, gsehnd sie ne Ma, wo uf eme-n Ast vo-n-ere-n-Eiche sitzt und die Eiche mitsamt de Würze zum Bode-n-use dräjet, grad wie-n-e Chorber es Wyderüetli. Do händ die zwee dä Ma au beredt, er seil mit ene cho. Und do sind ahi drei zämme wyters greiset. Noch eme Wyli chömme si zue-mene große schöne Hus, und göhnd ye, und s'isch gar niemer in der Stube gsi, aber z'mitts in der Stube stoht e Tisch, fertig deckt mit Brot und Chäs und Wy und aller gattig für Spyse. Do händ sie gässe-n-und trunke, und dernoh sind sie go schlofe, und am andere Morge sind sie in ahi Zimmer gange go luege, händ aber niemer gfunde. «He, do blybe mer einstwyle», händ sie zämme gseit und händ alli Tag Hälmli zoge, und dä, wo albe 's hengst gha hät, isch deheime bube und hät's Hus gaumet, kochet und gwäsche, und die zwee andere sind in Wald gange go jage.
'S erst Mol isch der Steihauer deheime bube. und wo-ner an der beste-n-Arbeit isch, do stoht ufsmol en alts Mandli unter der Türe, es Gsicht hät's gha, schrumpflig wie-n-e türri Zwätschge, und Auge hät's gmacht wie-n-e ramlige Räuel, und Bei hät's gha, nit fester a's en Bäsestiel und chrumm wie-n-e Sichele. Das het gar schühi to und gjomeret, es heb eso Hunger, und heuscht öppis z'Mittag. Der Steihauer hät
cm gä, aß es hett chönne gnueg ha. Das Mandli hät aber no meh welle ha, und wyl die zwee andere, wo-n-im Wald gsi sind, au no händ welle-n-ässe, so hät ihm diese nüt meh welle gä. Do springt cm das alt Mandli fürigtaub an Chopf und verchratzt und verchräblet ems Gsicht, und isch druf furt gsprunge gschwind wie der Biswind.Wo die zwee andere heicho sind, hät ene der Steihauer verzeih wie's ihm ergange-syg, und do seit der Eichedräjer, er weil der ander Tag deheime blybe, und däm Mandli dann der Meister zeige, wenn's öppe wieder chöm. Aber dem Eichedräjer isch es der ander Tag grad glych gange wien-em Steihauer. Er hät dem Mandli no meh z'Asse gä weder diße, aber er hät ne grad glych verchratzet und verchräblet, e Gsicht hat er gha wie ne Bruchacher.
Der dritt Tag aber isch der Bueb mit dem ysige Stäcke deheime bube, und das alt Mandli isch zum dritte Mol cho go Ässe heusche. Der Bueb hät cm aber nume-n-öppis wenigs gä, und wo das Mandli hät afo Stämpeneie mache, hät er churzi Mutti gmacht, nimt sy Stäcke und längt em eis - und da Höck isch wie-n-es gstupft's Wäspi zur Tür us gsurret und dervo pfurret. Der Bueb isch cm no grennt, was syni Bei händ möge, für z'luege, wo-n-es ane göi, und hät grad no gseh, wie-n-es blitzgschwind en große Stei abdeckt vo mene Sodbrunne-n-und sich is Loch abc lobt.
Wo die zwee andere heicho sind, händ sie gässe, und händ dernoh nes Chessi us der Chuchi gno und nes Seil dro bunde, und sind alli drei a das Ort gange, wo das Mandli in säll Brunneloch abe-n-isch. Do isch der Bueb mit sym ysige Stäcke in das Chessi gsässe, und die beede-n-andere händ en abc gb. Er hät e Schnuer mit cm abc gno, und die händ die dobe-n-anere Stude-n-agmacht, und a dere-n-isch es Glöggli gsi zum Lüte. Und wenn ihm dunde-n-öppis widerfahri, so seil er dann nume schälle.
Dunde chunt der Bueb vor es ysigs Tor. Das isch bschbosse gsi. Do sind drü Butälli dervor gstande, und uf
däne-n-isch gschribe gsi: wär drus trinki, dä wärd no drümol stercher a's vorane. Der Bueb hät drus trunke. Und by däne Butälli isch es Schwärt gläge, und das hät er i d' 'Händ gno und hät mit ern Griff a die Tür klopfet. Do ghört er e fyni Stimm a's wie vorne Wybervolch. Die seit, sie dörf em nit uftue, si heb en Drach uf der Schoß mit drei Chöpfe, dä tödi en jede wo yne chöm. Am Tag schlof er albe, wyl er z'Nacht uf Raub us göi. Do nimmt der Bueb syn ysige Stäcke und schloht d'Türe-n-y - der Drach verwachet ab däm Chrach, und wie-n-er uf de Bueb los gumpet, haut ihm diße mit eim Streich ahi drei Chöpf ab. Do hät die Jumpfere d'Händ zämme gschiage vor Freud - sie hät's schier nit möge glaube, aß sie erlöst gsi isch, und verzeiht dem Bueb, aß sie ne Prinzässi seig. Vor viele johre heb se-nöpper gstohle vo-n-ihrem Schloß ewägg und verwünsche, dä dreichöpfig Drach uf der Schoß z'hüete, bis en Ritter chöm und ne tödi. Und jetz seig sie erlöst. Aber no tiefer inne-nin däre Höhli seige no zwo anden Prinzässine, ihn zwo Schwestere, däne seig's glych ergange wie-n-ihre, und die eint müeß en Drach mit sächs Chöpfe hüete, und die ander eine mit nün Chöpfe. Derno hät die Prinzässi dem Bueb ne guldigi Uhr gä, wo Sunne-n-und Mond druf gsi isch und gseit, er seil dänn guet derzue luege, er wärd se bald einisch bruche chönne. Der Bueb seit, jo, jo, sie seil em einsrwyie Numine do warte, er chöm gly wieder urne, und goht tiefer in d'Höhli yne. Do chunt er zu-n-ere zweute Tür, die isch ganz vo Silber gsi, und do stöhnd sächs Butälli dervor, und druf isch gschribe gsi: wär drus trinki, wärd no sächs moi stercher a's vorane. Do het er sy Schwärt abgstehlt und hät se-n-ustrunke, und nimmt das ander Schwärt, wo derby gläge-n-isch, und schloht die zweut Tür mit sym Stäcke-nuf-und do lit en Drach mit sächs Chöpfe-n-ere-n-andere Jumpfere-n-uf der Schoß, und die isch no schöner gsi weder die erst. Jetz juckt der Drach uf und fahrt ufe Bueb los und ringelet mit cm Schwanz. Dä haut ihm aber mit eim Streich ahi sächs Chöpf ab, und do isch au die zweut Prinzässi erlöst gsi. Und die hät em do au welle die ganz Gschicht verzelle, aber der Bueb seit, er heb jetz währli nit der Zyt, z'lose. Do het sie ihm en guldige Ring gä und gseit, er seil en dänn jo nit verliere. Nei, nei, seit der Bueb, sie söll uni jetz nume-n-einstwyle do warte, er chöm grad wieder urne, und goht wyter. Do chunt er an e dritti Tür, und die isch ganz vo Guld gsi. Und do dervor sind nün Butälhi gstande, und druf isch gschrieb gsi: wär se-n-us trinki, dä wärd nün mol stercher as vorane. Und wider lit es Schwärt derby. Er leit's ander Schwärt ab und trinkt au die nün Fuit ,tl li us, und nimmt das dritt Schwärt in d'Hand, schloht die dritt Tür mit sym Stäcke-n-y und goht ye. Do sitzt ejumpfere derhinder, no viel schöner als die beede-nandere, und hät en Drach mit nun Chöpfe-n-uf der Schoß. Dä pfuset und küttet und springt de Bueb a und wott en grad z'Hudle-n-und z'Fätze verryße wie ne's Chabishäuptii. Aber dä Bueb schwingt svs Schwärt und haut ihm mit eim Streich ahi nün Chöpf ab. Do isch au die dritt Prinzässi erlöst gsi, und sie git ihm zum Dank ihres Bild mit eme Rahme-n-us Edelstei drum und seit, das seil er bhalte und Sorg ha derzue, aß er's dänn chönn vorwyse by-n-ihre deheim, wenn er chöm go sie hole, denn ihn und kei andere weil sie hürote, und dänn wüß sie, aß er der Rächt seig, wo sie erlöst häig. Fryhi, fryhi, das weil er gärn, hät do der Bueb gseit und het ahi drei mit cm füre gno an's Chessi.Jetz chunt cm ufsmol das alt Mandli in Sinn, und er frogt die Prinzässine, wo au dä Pföder seig. Do git em die dritt Prinzässi es Pfyfli und seit, er seil druf pfyfe. Do hät der Bueb pfiffe, und do staht das Mandii scho vorem. Der Bueb seit, so, jetz weil er cm derfür tue, fürs Chratze-nund Chräble. Das Mandli hät aber bittet und hättet, er mög en doch ho si; er häig albe müeß-n-ässe für die drei Prinzässine-n-und die drei Drache, nit Numine für ihn. «Jä so», seit do der Bueb, «wenn's däwäg isch» —und hät ihm do nüt to.

Druf sind die drei Prinzässine-n-in das Chessi ye gsässe, und der Buch hät am Schnüerli zoge-n-und glütet. Do händ die zwee andere dobe. der Steihauer und der Eichedräher, sie handli ufezoge. Vor jetz aber der Bueb is Chessi sitzt, rücht's em uf, er weil die Purschte-n-au probiere, ob sie ehrlig gäge-n-ihn gsinnet seige, und leit syn ysige Stäcke in das Chessi und lütet wider. Und was mueß i säge! — Do händ die Hergottssappermänter der Sräcke halber ufezoge und ne dernoh mit samt em Chessi b gheie, aß es nur so tschädderet hät. Sie händ drum gmeint, der Bueb seig drin und dernoh sind's mit däne Prinzässine-n-uf und furt.
Die händ geusset und gschraue-n-und briegget und glamentiert. aber was händ sie welle mache! Die Kärline händ ne dräut, wänn sie nit stille seige, und eini öppis säg, so ward s ne-n-übel ergoh. Und so sind's mit ene - heim in ihres Schloß und händ dört gseit, sie hebe die Drache tödtet und die Jumpfere-n-us der Höhli erlöst. Do hät der alt Chönig gseit, die Eltist müeß der Steihauer hürote und die Nöchsteltist der Eichedräjer. Die aber säge, es seig ne nit grad eso drum, sie seige-n-eso müed vo der Reis; si welle no drei Tag warte-n-und erst no chlei usruebe. Die Jüngst aber hät sich ybsch!osse-n-in ihrer Chammere und het hättet, aß ihre rächt Erlöser chöm.
Der Bueb, wo-n-er gmerkt hät, was do gange-n-isch, nimmt sys Pfyfli füre-n-und hät dem Mandli pfiffe. Und wie-n-es chunt, so frogt er's, ob's ihm jetz hälfe chönni und chlagt em sy Not. Do seit das Mandli: «Wo!, wyl d 'mi nit tödet hesch, so chan i der hälfe», nimmt ne-n-ufd'Achse und hät en über ne höchi, höchi Mur ufe treit. Das Mandli het aber au gwüßt, wo die Prinzässine deheime gsi sind, und hät's em Bueb gseit. Dä isch gschwind a das Ort
gange und isch zumene-n-Uhremacher und seit, sie sellen-em es eiges Zimmer gä, er chönn Uhre mache, aß Sunnen-und Mond druf seig, und guldigi Ring und Bilderrähmli vo Edelstei und susch no settig Sache meh. Das hät cm aber niemer welle glaube. Aber na dem er es zytli in dem Zimmer gsi isch, chunt er füre-n-und hat die Uhr mit Sunne-nund Mond drufvorgwise und dä Ring und das Bild mit dem Rahme-n-us Edelstei. Do händ halt alli nur so müeße stune, und der Urmacher seit, er seig afe-n-en alte Ma, wo wyt in der Wält urne cho seig, aber e settigi Uhr heb er no nie keini gseh, und en derige Ring und Bilderrahme au nit. Die müeß er cm Chönig zeige, dann wärd er svs Glück mache. Wie der Bueb is Schloß chunt, und vore Chönig und die drei Prinzässine gfüehrt wird und sy Chrom het welle füre mache, so händ alli drei ne grad CR henni, eb er nume d'Uhr und der Ring und das Bild het möge vorwyse, und säge, das seig jetz der Rächt, wo sie erlöst häig.Der Steihauer und der Eicheträjer aber sind tu und grichtet worde. Und der Bueb het mit der jüngste Prinzässi Hochzyt gmacht. Und wo der alt Chönig gstorbe-n-isch, so hät der Bueb s' Rych übercho, und er hät no lang gregiert in Glanz, Ehr und Rychtum.
Das Märchen von den drei Winden
Es ist lange, lange her, so lang, daß man's gar nicht ausdenken kann, da lebten in einem einsamen Tale hoch oben im Bündnerland ein Mann und eine Frau. Die waren gar arm und brachten sich nur hart und kümmerlich durch. Armut aber stiehlt frohen Mut. Und da konnte es denn nicht fehlen, daß das freudlose Leben die guten Leute mitunter verdroß. so daß sie mit Gott und der Welt haderten, weil ihnen
nicht ein besseres Dasein beschieden sei, wo doch so viele andere vollauf zu Leben hätten, die nicht besser wären als sie. Denn wer leidet, der neidet. Vor allem sehnte sich das junge Weib nach besseren Tagen. Aber armer Leute Reden gehen viel in einen Sack, und Arg wird davon nicht besser.Eines Abends nun, als die Frau wieder einmal auf dem Bänklein vor der Türe saß, um ein Fürtuch voll Holzkohlen zu verlesen, und sich schier gar scheel sah an dem stattlichen Hause des reichen Nachbarn, da trat plötzlich im Zwielicht ein fremder Mann vor sie hin. Der war grasgrün gekleidet, und eine rote Feder stak an seinem spitzigen Hute. Aus Augen, die wie glühende Kohlen funkelten, blickte er sie so scharf an, daß ihr ein Schauder über den ganzen Leib fuhr. «Hört, gute Frau», sprach der Fremde mit heiserer Stimme, «ich weiß, wo euch der Schuh drückt, und wenn ihr nur wollt, so könnte ich euch helfen aus eurer Not. Gebt mir das, was ihr im Schoße tragt, und ihr sollt alle Tage einen runden Golddukaten haben.» «Ei», dachte die Frau. obwohl ihr das Herz bis in den Hals hinauf schlug, denn die Menschen sehen das Gold lieber als die Sonne, und sein Glanz macht sie blind. — «Ei, blanke Dukaten für ein paar handvoll schwarzer Kohlen ist ein Gewinn, der nicht alle Tage sich bietet, also greif zu!» Und sie schlug ein. Da warf ihr der Fremde einen prallen Beutel in den Schoß und sagte, was ihm gebühre, werde er sich später holen. Und damit war er verschwunden, wie er gekommen.
Als die Frau abends im Schlafgaden das seltsame Begegnis ihrem Manne erzählte, lachte der hell auf ob dem närrischen Fremden, der sein gutes Geld dergestalt wegwerfe. «Ja», sagte er, «es ist ein altes Wort: Man soll mit Weisen weise und mit Dummen dumm sein!» Und es war eitel Freude in dem Haus bis spät in die Nacht.
Nach einigen Monden genas die Frau eines gesunden Knäbleins. Ein alter ehrwürdiger Waldbruder, der in der Wilde hauste, und die Edelfrau des Schlosses, zu dem das
Dorf gehörte, standen Pate bei der Taufe im Kirchlein. Am Abend desselben Tages pochte es beim Zunachten an die Türe der Hütte, und der grüne Herr trat ohne Gruß herein, warf einen großen Beutel auf den Tisch, so daß die Goldstücke über die Tischplatte auf den Boden rollten und sagte mit heiserer Stimme: «So, das wird euch einstweilen langen! Heute in vierzehn Jahren werde ich euren Knaben holen, denn er gehört rechtens mir unserem Handel zufolge.» Und damit war er verschwunden. Jetzt erst verstand die Frau, was die Worte, die der Fremde an jenem Abend zu ihr gesprochen, zu bedeuten hatten, und beide, sie und ihr Mann, weinten vor Leid und wußten sich nicht zu lassen und zu fassen.In ihrer Not gingen sie zu dem alten Einsiedler, denn, wenn wer auf der Welt, so werde der vielleicht Rat wissen. Sie fanden ihn mitten im Walde, wie er in tiefem Nachdenken vor seiner Hütte stand. Und sie erzählten ihm alles, was sich zugetragen hatte. Der Alte schüttelte zwar bedenklich das Haupt, hieß sie aber doch gutes Mutes sein und auf Gott vertrauen. Sie sollten ihren Knaben nur recht erziehen, und, wenn er sein siebentes Jahr vollendet habe, ihm übergeben.
Die Eltern taten also, und der Knabe gedieh und wuchs schlank und rank wie ein Tännlein. Und als er das siebente Jahr vollendet hatte, wurde er in den Wald gebracht zu dem alten Einsiedler. Dieser lehrte ihn fremde Sprachen und in einem uralten Buche mit ganz vergilbten Blättern lesen.
Als der vierzehnte Jahrestag herankam, befahl der Waldbruder dem Knaben sich auf einem Kreuzweg aufzustellen und in dem alten Buche zu lesen und nicht aufzublicken, weder nach rechts noch nach links, was immer geschehen möge. Der Knabe tat, wie ihm geheißen, und las mitten im Kreuzweg stehend, ruhig in seinem Buche. Da aber klang und sang es aufs Mal um ihn herum so wunderbar, es war grad, als musizierten alle Engel. Wie im Traum
verloren lauschte er den Tönen und wähnte sich im Himmel. Aber, ehe er sich's versah, stieß ein gewaltiger Adler, grau wie blankes Eisen, mit rauschenden Schwingen herab, ergriff ihn mit seinen Fängen und trug ihn hoch empor über alle Wipfel und Gipfel. Aber unentwegt las der Knabe im Buche des Einsiedlers fort, und da mußte der Adler die Krallen öffnen und ihn fallen lassen.Der Knabe fiel sanft auf den höchsten Grat des Julierberges

Dort lebte der Knabe fortan in lauter Herrlichkeit und Freuden, und die Jahre schwanden, als wären es Stunden. Als nun der erste Flaum ihm Kinn und Wangen deckte, entbrannte er in heißer Liebe zu der jüngsten der drei Schwestern, die deuchte ihn die Schönste von allen, und er begehrte sie zur Frau. Denn die Liebe ist wie der Tau, sie fällt auf Rosen und Disteln und füllet die Welt und mehrt den Himmel. Und die holde Jungfrau, die auch im geheimen längst schon Gefallen an dem schmucken Jüngling gefunden hatte, gab ihm ihre Hand und ihr Wort. Aber wie's so geht auf der Welt: Lieb ist Leides Anfang. Als der Tag der Hochzeit festgesetzt war, erbat der Jüngling sich Urlaub bei seiner Braut. um Eltern und Paten zu besuchen, daß sie auch Teil hätten an seinem Glück. In der letzten Stunde streifte ihm die Jungfrau einen goldenen Ring mit einem funkelnden Edelstein an den Finger und sprach: «Drehst du diesen Ring in der Richtung des Julierberges, dann muß ich auf der Stelle vor dir erscheinen, wo immer du sein magst. Aber hüte dich, die Kraft des Ringes zu mißbrauchen!» Der Jüngling gelobte hoch und teuer, das Kleinod heilig zu halten und nahm weinend Abschied.
Ehe er sich's versah, stand er auf der Schwelle des Vaterhauses, und nachdem er seine Eltern, die ihn kaum wieder erkannten, umarmt hatte, ging er zur Burg seiner Patin. Die Edelfrau mußte nur staunen ob des Jünglings Schönheit und sie beschloß, ihn mit ihrer Tochter, einem bildschönen Mädchen, zu vermählen. Aber da stach den Jüngling der Übermut, denn wen das Glück zärtet, den verdirbt es. Er lachte bloß über den Antrag und rief: «Ei, ich brauche deine
Tochter nicht, habe ich doch schon die schönste Braut der Welt! Da schau sie mit eigenen Augen, wenn du's nicht glauben magst!» Mit diesen Worten drehte er den Ring an seinem Finger, und vor ihm Stand liliengleich die Jungfrau vom Julierberg. Aber aller Glanz und alles Glück war von ihr gewichen. Traurig schaute sie ihn aus ihren Sternenaugen an, nahm ihn bei der Hand, und indem sie ihm den Ring vom Finger zog, sprach sie, doch ihre silberhelle Stimme war ohne Klang: «Du hast dein Wort gebrochen und die Kraft des Ringes mißbraucht! Nur bin ich dir auf ewig verloren.» Und ehe der Jüngling wußte, wie ihm geschah, da war die Jungfrau verschwunden. Er wäre vor Scham und Schmerz schier vergangen.Trostlos in seinem Jammer lief er in die weite Welt, um nach seiner Braut zu suchen. Allüberall fragte und forschte er nach der lilienweißen Jungfrau mit dem goldenen Ring aus dem kristallenen Schlosse auf dem Julierberg. Aber die Leute lachten und spotteten, als wäre er nicht recht bei Sinnen. Er aber schweifte Tag und Nacht durch die Wälder und Weiden in den Schlüften und Klüften und suchte und suchte.
Also ging er eines Abends durch einen finsteren Forst von schwarzen Tannen. Und wie er ganz erschöpft auf einem Steine saß und sein Schicksal bejammerte, da kam aufs Mal ein uralter Mann von großmächtigem Wuchs, mit schlohweißem Haar und Bart des Weges gegangen und fragte ihn, was sein Herz bedrücke. «Ach», erwiderte der Jüngling, «ich suche den Julierberg und die drei lilienweißen Jungfrauen in dem kristallenen Schloß und kann sie nicht finden.» «So, so», sagte der Alte, und strich sich den Bart, «das ist nicht leicht, aber ich will dir helfen.» Und er gab dem Jüngling ein paar Filzschuhe. Das waren aber nicht gewöhnliche Schuhe wie sie jedermann trägt, sondern diese Schuhe brachten den, der sie an den Füßen hatte, bei jedem Schritte drei Meilen weit. «Wisse», sagte der Greis weiter,
«ich bin der Nordwind.» —Und er blies, und der Jüngling ward auf den Flügeln des Oberwindes sieben Meilen tiefer in den Wald getragen. Dort stand vor einer Höhle wieder ein alter Mann, der hatte grauen Bart und graues Haar. «Ich weiß», sprach er, «warum du kommst, und ich will dir helfen. Ich bin der Südwind. Hier nimm diesen Hut, der hat die Eigenschaft, daß er den unsichtbar macht, der ihn auf dem Kopfe hat.» Sprach's und blies, und der Unterwind trug den Jüngling abermals sieben Meilen tiefer in den Wald. Da aber stand wieder ein Greis vor dem Jüngling, von riesenhafter Gestalt, wild und struppig mit funkelnden Augen, und sein Rust war wie rollender Donner. «Was du suchst», rief er, «liegt über jenen Bergen, über die dich weder Oberwind noch Unterwind zu tragen vermögen. Ich, ich bin der Föhn, und mir ist alle Macht eigen in den höchsten Bergen. Nimm hier diesen Stab, schwing ihn hoch in die Lüfte, und du wirst dein Ziel erreichen!» Der Jüngling warf den Stock in die Höhe, und vom heißen Hauch des Föhns emporgetragen, sah er alsbald den kristallenen Palast weit, weit unten in der Sonne gleißen, so hell, daß seine Augen den Glanz kaum ertrugen. Mit eins stand er vor dem Tore und trat in die schimmernden Hallen. Da schlug der Lärm eines fröhlichen Festes an sein Ohr. Und wie er in den Saal trat, sah er, daß da eine Hochzeit gefeiert wurde. Und seine Braut war es, die an der Seite eines fremden Mannes beim Mahle saß. Ihm war es, als müßte er vor Weh vergehen. Er setzte den Hut aufs Haupt und war unsichtbar. Aber als es am lautesten zuging, trat er hinter die Braut und nahm ihr unversehens die Speisen weg, die vor ihr lagen. Erschrocken sprang sie von ihrem Sitze auf und eilte in ihr Schlafgemach. Er ging ihr nach, zog den Hut ab und stand leibhaft vor ihr. Da fielen sie einander um den Hals und zusammen gingen sie in den Saal zurück. Erstaunt schauten die Gäste auf. Da fragte die Braut: «Sagt mir, ihr Freunde, was täter ihr wohl, wenn euch der Schlüssel zu einem Schrein verloren gegangen war, und ihr hattet einen neuen machen lassen, fandet aber den alten plötzlich wieder?» Eines Mundes hieß es, es sei der alte zu gebrauchen und nicht der neue. Da nahm die Jungfrau den Jüngling lächelnd bei der Hand, steckte ihm den Goldring an den Finger und sprach: «Nun wohl, so wisset, daß dieser mein wahrer Bräutigam ist, der mir zum Manne bestimmt war. Drum fahret fort, das Fest zu feiern und seid fröhlich und guter Dinge!»
Der dumme Hans
In Kandersteg wohnten in einem braunen Holzhaus hinten im Grachen ein Mann mit seiner Frau und drei Buben, und der jüngste hieß Hans. Den mochten aber die beiden älteren Brüder nicht leiden, weil er einfältig und fromm war, und sie nannten ihn bloß den dummen Hänsel und deuchten sich selber gar klug und immer klüger. Aber den Eltern waren alle drei gleich lieb.
Mit den Jahren wuchsen die Buben heran und waren nachgerade junge Burschen geworden, die anfingen, den Mädchen nachzugehen. Aber das Gütlein war klein und karg, und da nicht alle drei sich davon würden nähren können. so werweißten die Alten am Abend in der Schlafkammer oft miteinander, wem sie es einmal übergeben sollten. Eines Tages sprach der Vater: «So, Buben, jetzt wär's dann etwa an der Zeit, daß ihr weiben ginget. Aber alle drei könnt ihr nicht hier bleiben. Einer kann die Wirtschaft haben und alles was dazu gehört, und die anderen müssen halt in die Welt hinaus wandern, und sich ein Auskommen suchen. Aber wem von euch soll das Haus gehören?» Die Mutter aber, die eine kluge Frau war, dachte: «Ich weiß schon, wie ich das angattigen soll», und sie ging und holte
drei Büschel Flachs und gab einem jeden eines davon in die Hand und sagte: «Wißt ihr was, geht jetzt damit zu euren Mädchen und laßt sie die Büschel spinnen. Wer mir das schönste Garn heimbringt, der bekommt zur Frau auch Haus und Hof.Die beiden älteren Brüder dachten: «Ha, ich werd's schon b'reichen, denn mein Schatz spinnt am besten!» Und gingen schnurstracks zu ihren Mädchen. Der arme Hans aber, ja, der hatte halt keinen Schatz und wußte nicht, zu wem er gehen sollte. So schoppte er den Flachsbüschel in den Hosensack und lief durch das Ried dem Wald zu. Da hörte er aufs Mal eine Stimme aus dem Grase, die rief: «Hans, wo willst du hin?» Er schaute sich um, sah aber niemand. Das ist gewiß ein Vogel gewesen, dachte er und ging weiter. Da rief es zum zweiten Male: «Hans, wo willst du hin?» Da er aber wieder niemand gewahrte, dachte er: Schrei du nur zu - und ging weiter. Als es aber zum dritten Male rief: «Hans, wo willst du hin?» so laut und deutlich, als wär's beim Ohr zu, da blieb er stehen und schaute in die Nähe und in die Weite, und ging bedächtig einige Schritte zurück. Da sah er, daß es eine Kröte war, die unter Blatt und HaIm am Bachrand saß und ihn ausfragte. «Diesen Flachs gab mir die Mutter», sagte er und zog den Büschel aus dem Sack, «und eine Spinnerin soll ich suchen, die mir Garn daraus spinnt. Und wenn es schöner wird, als das der Brüder, dann bekomme ich den Hof. Aber ich werde keine finden, denn ich hab keinen Schatz.» «Gib mir den Flachs!» rief da die Kröte, «ich will ihn dir spinnen, und in drei Tagen kannst du wiederkommen und dir das Garn holen.» Da sagte der Hansel: «Ach, was willst auch du mit dem Flachs machen, du arme Kröte, aber nimm den Büschel immerhin, er wird mir doch nicht gesponnen», und er warf ihn ins Wasser. Plitschplatsch, da nahm die Kröte den Büschel und schon war sie damit fortgeschwommen. Der Hansel aber hat keinem Menschen ein Wörtlein davon gesagt, was ihm
begegnet war, die Brüder mochten ihn fatzen und tratzen, so viel sie wollten.Am dritten Tage danach gingen die Brüder ihr Garn holen. «Du magst derweilen dein Bündel schnüren, du «Löl», riefen sie dem Hansel auf der Schwelle zu, «denn du bekommst den Hof auf keinen Fall!» Hans aber schwieg fein still und sagte nichts dawider. Ich will doch gehen und sehen, dachte er bei sich, wie's um mein Garn bestellt sein mag. Wer weiß, vielleicht hat die Kröte ihr Wort wahr gemacht. —Und richtig, da hing ein Strang Garn im Gestäude am Bach, und war so rein und fein gesponnen, es schimmerte wie schiere Seide an der Sonne. Aber wie er es in die Hand nahm, da kam die Kröte angeschwommen. «Ja, Hans, bring das Garn deiner Mutter! Den Hof wirst du bekommen und das Geld im Bettkasten dazu. Dann aber geh zum Pfarrer und laß dich mit mir am Sonntag verkünden. Und wenn er nicht will, so laß nicht ab, sondern besteh darauf. Kauf dann für dich und mich ein Hochzeitskleid, und hänge meines in der Sakristei auf. Dann setze den Tag der Trauung fest. Ich werde zur rechten Stunde kommen. Zweifle nicht daran und sei nicht ungeduldig, auch wenn ich etwa ein Weilchen säumen sollte. Glaube meinem Wort und barre aus! Es soll dich nicht gereuen.» Der dumme Hans versprach der Kröte alles und brachte das Garn seiner Mutter. Da waren die Brüder schon da, jeder mit seinem Strang, und stritten miteinander um den Vorrang, denn jeder sagte, sein Garn sei das schönere, und ihm gebühre füglich der Hof. Die Mutter prüfte die drei Stränge sorgsam. «Meiner See!», sagte sie, «Hansel, deins ist das schönste, und du bekommst Haus und Hof! Und jetzt geh und laß dich mit deinem Schatz verkünden.» Da maulten und murrten die Brüder, aber was wollten sie machen! Voller Zorn und Neid warfen sie ihr Garn auf den Boden, zerstampften es und gingen denselben Tag noch davon, und haben Vater und Mutter nicht einmal Lebewohl gesagt.
Der Hans aber ging derweil zum Pfarrer und bat ihn, am Sonntag auf der Kanzel dem Kirchenvolk seine Verkündung anzuzeigen. «Gut und wohl», sagte der Pfarrer, «aber, Hans, sag mir auch, wie heißt denn deine Braut?» «Eh, das weiß ich nicht», sagte Hans «es ist eine Kröte im Moosgrund.» Es ist kein Narr, der einem eine Narrheit zumutet, es ist ein Narr, der es tut, dachte der Pfarrer bei sich, und mit Narren muß man Geduld haben, denn ein Narr läßt sich nicht raten. «Hör, Hansel», sprach er, «mit ernsthaften Dingen darf man nicht spaßen, und würdige Leute soll man nicht zum Narren halten wollen. Ich bin gern ein Narr, aber der Narren Narr mag ich nicht sein. Die mögen sich selber zum Tanze pfeifen.» Hans aber sagte: «Gott behüte, daß ich scherze, Herr Pfarrer, es ist mir heiliger Ernst, am Sonntag über eine Woche soll die Hochzeit sein.» Als der Pfarrer den Hansel so ernsthaft reden hörte, da dachte er bei sich: Narrenspiel will Raum haben, denn dem Narren hilft weder Chrisam noch Taufe. Zwar reden Narren. was ihnen einfällt, aber Narren sagen auch etwa wahr, und haben mitunter mehr Fug als andere Leute. Und zum Hansel sprach er: «Nun so sei es denn in Gottes Namen!» Dann ging der Hansel geradewegs zum Meister Erny, dem Schneider, um für sich und seine Braut je ein Hochzeitskleid zu bestellen. Der Schneider fädelte eben eine Nadel ein, als Hans in die Werkstatt trat und sein Anliegen vorbrachte. Vor Staunen fielen ihm Nadel und Faden aus den Fingern. «Ei, Hanse!», rief er, «was soll das noch werden! Bist du ganz aus Saum und Naht!» Der aber sagte nur: «Meister, tu nur ungesäumt, was ich dir sage, damit alles zur rechten Zeit noch fertig wird, und hier hast du einstweilen ein Angeld. Und den Rest bekommst du, wenn ich die Kleider holen komme. Also spute dich und spar unnütze Worte!» «Schon recht, schon recht, du sollst mit mir zufrieden sein und nichts für ungut», sagte der Schneider, beschaute das Geld und machte sich kopfschüttelnd an die Arbeit.
Am Sonntag nach dem Kirchgang standen die Leute zu Hauf auf dem Weg und vor den Häusern. «Habt ihr das gehört! Der Hanse! ist ganz hinterfür geworden», sagten sie. «Das wird eine rechte Gugelfuhr geben, wenn der Hochzeit macht. Was mag der für eine Frau aufgelesen haben!» Und am Sonntag drauf war die Kirche gestoßen voll. Hans saß in seinem neuen Festgewand im Stuhl. Das Brautkleid hing in der Sakristei. Und ein Genuschel und Getuschel war in der Kirche, ein Flüstern und Wispern, ein Kichern und Lachen, denn die Leute glaubten, das werde einen kapitalen Spaß geben. Jetzt aber trat der Hansel vor den Altar, damit der Pfarrer anfange. Da kam aufs Mal die Kröte durch das Chor gehopst und hüpfte in die Sakristei. Nach einem Weilchen - siehe da - neben dem Hans stand aufs Mal -niemand hat sagen können, wie's geschah - eine wunderhübsche Jungfrau, die ihn bei der Hand nahm und holdselig anschaute. Der Pfarrer gab sie zusammen und segnete sie ein. Die Leute aber machten große Augen und manch einer sprach diesen Tag auf dem Heimweg von der Kirche: «Die Dummen haben doch manchmal mehr Glück als unsereiner, aber wer weiß, vielleicht ist mancher gescheiter, als man meint.»
Das Fröschlein mit dem roten Halsband
Es war einmal eine arme Frau. die war lahm und immer krank. Sie hatte nur einen einzigen Knaben, der wäre um alles in der Welt gerne in die Stadt zur Schule gegangen, aber der Lehrer, der ein braver Mann war, hatte der Mutter gesagt: «Gute Frau, wie würde es euch auch ergehen ohne euren Knaben? Ihr bedürfet seiner, daß er euch helfe euer Brot verdienen.»
Sie bewohnten eine kleine Hütte in der Nähe eines Wäldchens,
und unfern floß ein Bächlein vorüber. Der arme Knabe ging täglich in den Wald, und sorgte, daß seine Mutter zu leben hatte. Das Reisig legte er für ihren eigenen Bedarf zur Seite, das gute schöne Holz aber verkaufte er in der Stadt. Im Bächlein fischte er schöne Fische, die brachte er in die Stadt auf den Markt.Allemal aber, wenn er in den Wald kam, begegnete ihm ein schönes grasgrünes Fröschlein mit einem roten Halsreif. Es sah ihn mit großen Augen an und hüpfte munter um ihn herum, dieweil er Holz suchte, und im Nu hatte er die schönste Burde beisammen. Wenn er fischen ging, war das Fröschlein auch dort, tauchte vor ihm ins Wasser vor Freude, hüpfte leicht und lustig von einem Ort zum andern. Und die Fische bissen ihm an, ruck zuck, einer feister als der andere.
Aber eines schönen Tages, als er wieder an den Bach kam, um zu fischen, was sah er da? Hinter einen Schilfband kauerte das Fröschlein und angstvoll pochte ihm das Herzlein unter seiner dünnen Haut. Der Knabe schaute auf und erblickte einen großen Vogel mit hohen dünnen Beinen und einem langen, spitzen Schnabel. Rasch nahm er das Fröschlein auf, barg es im Busen und trug es nach Haus. Als ihn seine Mutter kommen sah, sagte sie: «Was fällt dir ein, diesen Frosch heimzubringen, es hat deren ja so schon mehr als genug auf der Wiese?» —«Oh, glaub mir nur, Mutter, das ist kein Fröschlein wie die anderen.» Dann erzählte er ihr, wie das Fröschlein ihn immer begleitet hätte, wenn er im Walde Holz suchen oder am Bächlein fischen ging. «Nun denn halt, meinetwegen», sagte darauf die Mutter, «behalten wir es bei uns. Bring es in den Garten und schau gut zu ihm.»
Als die Frau am selben Nachmittag in einer alten Truhe nach Stoffresten suchte, kam ihr von ungefähr eine gestickte Geldbörse unter die Hände, die sie nie zuvor gesehen hatte. Voller Staunen brachte sie sie ihrem Knaben und sagte:
«Wenn ich nur wüßte, wie dies Geld in die Truhe gekommen ist!»Nachdem sie hin und her gewerweißt hatten, sprach sie: «Mein Gott, diese Dukaten sind unser, wir haben sie ja nicht gestohlen. Weißt du was, nimm du die Hälfte und geh in die Stadt zur Schule und lerne das, wonach dir schon lange der Sinn steht. Mir bleibt genug zu leben, bis du wiederkommst. Da nahm der Knabe Abshied von seiner Mutter und begab sich auf eine Reise durch Frankreich. Derweilen aber hatte die Mutter immer gut Sorge zu dem Fröschlein. Mittags und Abends, wenn sie aß, setzte sich das Fröschlein immer neben sie auf den alten Ledersessel.
Als der Sohn alles Geld aufgebraucht hatte, schrieb er der Mutter, daß er heimkommen werde. Und eines schönen Tages, an einem Morgen, trat er zur Türe herein. Da hub das Fröschlein an zu springen und zu hüpfen, als sei es ganz von Sinnen vor Freude über seine Rückkehr.

Nach einiger Zeit erhielten sie eines Tages einen Brief aus der Stadt, darin stand geschrieben, sie sollten eine Erbschaft antreten, von der sie auf der weiten Welt nichts gewußt und geahnt hatten. Die Mutter sagte: «Das Fröschlein hat uns Glück gebracht! Du hast wahrgesagt, es ist ein besonderes Fröschlein.»
Nachdem sie die Erbschaft abgeholt hatten, sagte der Sohn zu seiner Mutter: «Laß mich reisen, Mutter, daß ich meine Lehrzeit vollende. Diesmal möchte ich gerne auch die deutsche Sprache lernen. «Nun denn», sagte sie, «so tue nach deinem Willen, mein Sohn. Fahre, wenn es dich deucht. es sei zu deinem Besten.» Und der Knabe nahm abermals Abschied. Aber die ganze Zeit über, da er in der Fremde weilte, versäumte er es nie, seiner Mutter fleißig Briefe zu senden. Man hätte schwören mögen, daß es das Fröschlein fühlte, wenn ein solcher Brief unterwegs war, denn dann sprang und tanzte und hüpfte es allemal wie toll.
Eines schönen Tages kam der Knabe wieder heim. «Guten Tag, Mutter», sagte er, jetzt werde ich dich nicht mehr verlassen. Nun habe ich genug gelernt, um dir deine alten Tage erheitern zu können. Überglücklich sagte die Mutter: «Nun da muß ich heute wohl eine besonders gute Suppe kochen, um deine Rückkunft zu feiern.» Sie deckte den Tisch in der Stube und versäumte nicht, auch den Lederstuhl für das Fröschlein an den Tisch zu rücken.
Aber während sie inder Küche die Suppe schöpfte, siehe da verwandelte sich das Fröschlein aufs Malin das schönste Mädchen der Welt, so schön, ein schöneres hätte man nicht einmal im Traume zu sehen bekommen. Dieses Mädchen sagte darauf zu dem Sohn der lahmen Mutter: «Ich war die Königin der Frösche, und ich habe wohl bemerkt, daß du ein wackerer Bursche bist und das Herz auf dem rechten Fleck hast, denn du bist gut, vor allem weil du deiner Mutter Gutes tust. Und drum frage ich dich jetzt, ob du mich zur Frau nehmen willst.» Ihr könnt euch denken, wie
erstaunt der Jüngling war. Die Rede blieb ihm im Halse stecken. Zuletzt aber antwortete er: «Wahrlich, ich weiß nicht, was ich euch darauf sagen soll! Denn seht, ich bin arm und besitze keinen Heller mehr; der letzte Batzen ist für meine Lehrzeit verbraucht worden. Die Jungfrau aber lächelte und sprach: «Oh! wenn's weiter nichts ist, ich bin reich genug!»Nun wurde der Tag der Heirat festgesetzt. Aber wie sie von der Kirche zurückkamen, da stand da an Stelle der ärmlichen Hütte ein prächtiges Schloß — und die Lakeien und Zofen eilten geschäftig durch alle Säle und von den Zimmern in die Küche, um das Hochzeitsmahl aufzutragen. Die gute alte Mutter war ganz in Spitzen und Seide gekleidet. Man aß und trank während dreier Tage. Und ich, ich stand am Herde und bereitete die Saucen zu, ich kam, als ich mich bückte, dem Feuer zu nahe, da fing meine Schürze Flammen. Und die andern wurden zornig und schlugen mich mit der Schöpfkelle, dann jagten sie mich mit Schimpf und Schande davon, bis hierhin, und da sitze ich jetzt matt und müd auf diesem Stuhl, um euch dieses Märchen zu erzählen.
Das Katzenschloß
Es ist viele Jahre her, da ritt an einem Sommerabend ein junger Rittersmann durch einen Wald, und je länger er ritt, desto dichter wurde der Wald, so daß das Licht der Sonne nur schwachen Schimmers noch durch Baum und Laub drang. Im tiefsten Dickicht stieg er vom Pferde, um an einer rauschenden Quelle ein Weilchen zu rasten, da umstand ihn plötzlich ein ganzer Schwarm von grauen Katzen. Die rauhen und jaulten, schnurrten und knurrten und gebärde-

Mitten in der Nacht aber zupfte etwas an seiner seidenen Decke, und als er verwundert die Augen aufschlug, da stand die schwarze Katze mit einem silbernen Kerzenstock vor seinem Bett und sprach mit menschlicher Stimme: «Wackerer Ritter. vernehmt meine Geschichte: Ich bin König über ein großes Reich, und die weiße Katze ist meine einzige Tochter; die grauen Katzen sind mein Hofstaat und Gesinde. Ein böser Zauberer warf seinen Haß auf mich, weil ich ihm meine Tochter nicht zur Frau geben wollte, und hat uns alle in Katzengestalt verwünschen. Ihr, edler Ritter, könnt uns erlösen, wenn ihr den Mut habt, diese Nacht noch den Berg zu ersteigen, wo die drei goldenen Kreuze leuchten. Am Fuße des mittleren Kreuzes ist eine Zauberwurzel gewachsen. Vermögt ihr die zu erlangen und berührt ihr damit mich und meine Tochter und unser Gesinde, dann werden wir alle wieder Menschen werden. Und ihr sollt meine Tochter zur Frau bekommen und König werden an meiner Statt.» Der Ritter besann sich nicht lange, sprang ungesäumt von seinem Lager auf, wappnete sich, und schritt, das bloße Schwert in der Hand, bergwärts in die Nacht hinaus. Und finster war es, man sah nicht die Hand vor dem Gesicht.
Wie er den Berg zu ersteigen begann, da hub ein Heulen an, ein Tosen und Dröhnen, als stünden alle Tore der Hölle offen. Blitze schlugen ringsum nieder, der Donner grollte und krachte. Die Erde erbebte in ihren Tiefen. Es war, als wollte die Welt vergehen. Es sauste und brauste, fauchte, kreischte und zischte in den Lüften. Durch den Wald hin krachte und kroste es, und knarrte und quarrte, es prasselte, girrte und ächzte. Stämme splitterten, Aste brachen, Laub und Reiser wirbelten. Wasserstürze ergossen sich rauschend über Felsen und FLühe und rissen tiefe Runsen und Rinnen. Feuerlohe schlug auf aus Spalten und Klüften, allenthalben züngelten Flammen und Funken sprühten wie Feuerregen. Aus allen Schlünden und Gründen des Berges
stiegen Schrecknisse auf, gräßliche Scheue! und Greuel, Gespenster und Ungeheuer und drohten dem Ritter. Der bekreuzte sich und hielt sie mit dem Schwert sich vom Leibe. bis sie wichen, und furchtlos klomm er fort von Wand zu Wand, bis er auf dem KuIm stand, wo die drei goldenen Kreuze leuchteten. Er grub die Zauberwurzel aus dem Boden am Fuße des mittleren Stammes, und als er zu Tal stieg, da war alles stille und am heiteren Himmel blinkten die Sterne. In der großen Halle des Schlosses waren die Katzen allzumal versammelt und harrten ihres Erlösers. Der Ritter berührte sie alsbald der Reihe nach mit der Wurzel. Da flutete mit eins ein Meer von Licht durch den Palast, so daß der Ritter geblendet die Augen schloß. Als er wieder sehend war, da saß auf dem Throne ein würdiger Greis, die Krone auf dem Haupt, das Szepter in der Hand, und neben ihm die anmutigste Prinzessin, und rundum im Kreise standen Ritter und Edelfrauen in vollem Schmuck und Putz. und Diener und Lakeien, Zofen und Mägde. Der alte König winkte den Ritter zu sich, legte die Hand der Prinzessin in die seine, und dann ward desselbigen Tages das Hochzeitsfest gefeiert in Herrlichkeit und Freuden.
Nedeibriet
Gen Abend trieb ein Hirtenbüblein seine Geißen ein. Wie er sie überzählte, fehlte ein weißes Geißli, das einem rohen Bauern gehörte. «Wart, du Nichtsnutz, dich schlag ich krumm und krüpplig», schrie der Mann, «wenn du mir die Geiß nicht heut noch heimbringst!» Und was wollte da der Bub anders machen, er mußte in den Wald zurück und das Tier suchen.
Es dunkelte schon, und da brach zu allem noch ein Unwetter
los, und es wurde mit einem Schlage stockfinstere Nacht, und der Regen schlug nieder wie Geißelschnüre. Dem armen Büblein wurde himmelangst so allein im dunkeln Wald, wo er weder Steg noch Weg mehr sah, und er lief, was er konnte, um heim in Schermen zu kommen, aber er geriet nur immer tiefer in den Wald. Aufs Mal sah er vor sich in der Ferne ein Lichtlein schimmern. Er lief darauf zu und kam vor eine Hütte. Er klopfte an die Türe. Eine alte bucklige Frau tat ihm auf. Die hatte eine Nase, die hing ihr bis über den Gürtel herab, und Ohren hatte sie, so groß wie Suppenteller. «Eh, sieh das Bürschlein!» krächzte sie, «du kommst uns gerade recht.» Und sie packte ihn am Kragen und sperrte ihn in das Ställi nebenzu. Da saß er nun am Trockenen.Am andern Morgen brachten ihm die beiden Töchter der Alten zu essen. — und die waren nicht schöner als die Mutter -, lauter Leckerbissen, mehrmals am Tage, denn das magere Büblein sollte groß und feist werden, damit sie ihn dann schlachteten und brieten, wenn es so weit wäre. Das ging so drei Wochen, und das Büblein ward alsgemach rund und ründer. Da kam die Alte und krächzte:
«Büebli, Büebli chly und fy Zeig mer au dys Fingerli!» |
Der Bub streckte ihr ein Hölzlein heraus. «Nein, du bist noch zu mager», sagte sie, und die Mädchen mußten ihm noch mehr gute Sachen zum Essen bringen. Als wieder drei Wochen vergangen waren, kam die Alte wieder und sprach:
«Büebli, Büebli chly und fy Zeig mer au dys Fingerli!» |
Der Bub streckte wieder ein Hölzlein heraus, und noch immer war er nicht fett genug.
Weitere drei Wochen vergingen, da kam die Hexe wieder und sprach:
Büebli, Büebli chly und fy Zeig mer au dys Fingerli!» |
Da streckte der Bub den Finger heraus, denn nun war es ihm verleidet, immer in dem finstern Stall eingesperrt zu sein. Der Finger deuchte die Hexe fett genug. Sie ging hin und hing den großen Kassel übers Feuer und rüstete alles zur Mezgete. Die Töchter aber schickte sie in den Wald nach Holz. Dann holte sie den Buben aus dem Stall, und der war groß und stark geworden. Sie ging mit ihm zum Kessel. Jetzt wollte sie nachsehen, ob das Wasser schon siede, und beugte sich über den Rand des Kessels. Da aber hatte sie der Bub schon bei den Füßen gepackt und kopfüber in das brodelnde Wasser gestürzt. Als die Töchter mit ihren Reiswellen aus dem Walde zurückkamen, lag die Mutter tot in der Brühe, und der Bub war fort. Da liefen sie heulend in den Wald zurück und schrien in einem fort: «Nedelbriet! Nedeibriet!» Aber sie haben ihn nicht mehr gefunden. Und der Bub? —Ja, der war längstens wieder daheim, aber ohne das verlorene Geißlein.
Der blaue Vogel
Es war einmal ein armer Mann, der machte Vogelbauer. Aber bei dem Gewerbe verdient man grad soviel, daß man nicht ganz verhungert. Eines Tages kehrte er vom Jahrmarkt in Pruntrut zurück und hatte wieder kein Stück verkauft, und doch hatte er so schöne Käfige feil. «Nein», sprach er unterwegs zu sich selber, «jetzt sitz ich ein wenig ab und
ruhe mich aus von dem Weg, den ich vergeblich gemacht habe und auf der nächsten Waldblöße saß er unter einer alten Buche ab und beschaute betrübt seinen leeren Geldbeutel und fing vor Kummer zu klöhnen und zu stöhnen an; denn er wußte nicht, was er anfangen sollte. Da kam plötzlich ein winzigkleines Männlein auf ihn zu, nicht viel größer als ein Tannenzapfen, und sagte: «Tu doch einen Vogel in deinen Käfig, dann kannst du ihn sicher verkaufen!» «Ja, das ist schon gut und recht», antwortete der Mann, «ich hab aber keinen und weiß auch nicht, wie ich einen bekommen soll». und stöhnte weiter. Da pfiff das Männlein, und ein schöner blauer Vogel kam herbeigeflogen. Er fing ihn und steckte ihn in den Käfig des armen Mannes und sagte: «Schau her, guter Mann, man sieht's den Federn an, was für ein Vogel das ist. Hör zu: Wenn dir irgend etwas fehlt, so brauchst du bloß zu sagen:» «Blauer Vogel, tu, was du sollst!» Aber allemal, wenn er dir verschafft, was du begehrst, dann vergiß nicht zu sagen: «Heiliger Espontin, von Herzen danke ich dir!» Und damit war das Männlein verschwunden. Der blaue Vogel in dem Käfig aber sang so schön, daß es den Mann deuchte. so schön hab er noch keinen singen hören, und es war ihm ganz warm ums Herz.Aber da er heftigen Hunger hatte, wollte er gleich erproben, was der seltene Vogel könne, und er sprach: «Blauer Vogel, tu, was du sollst!» Und siehe, da stand auf der Stelle ein reich gedeckter Tisch vor ihm mit den leckersten Speisen und feinsten Weinen. Er aß zuerst die Suppe und das Gesottene samt der Zukost und trank einen guten Schluck dazu. Dann sagte er: «Heiliger Espontin, von Herzen danke ich dir!» Dann machte er sich an den Braten und das Gemüse und trank wieder einen guten Schluck dazu. Dann sagte er wieder: «Heiliger Espontin, ich danke dir von Herzen!» Zuletzt verzehrte er den Nachtisch, köstliche Früchte und süßen Kuchen. Und wie er nun die ganze Mahlzeit beendet
hatte, da rief er zum dritten Mal hocherfreut: «Heiliger Espontin, von Herzen danke ich dir!» Dann hängte er den Käfig mit dem Vogel an seinen Stock über die Schulter und nahm den Weg wieder unter die Füße, und bald kam er in das nächste Dorf. Da ging alles drunter und drüber. Alle Leute liefen in ihren Sonntagskleidern hin und her; es war ein Gewimmel wie in einem Ameisenberg. Der Mann stand still und stellte seinen Käfig ab und schaute dem Treiben eine Weile zu. Dann fragte er eine Frau, ob hier Kilbi sei. «Nein», sagte die Frau, «du kommst wohl auch von auswärts, daß du nicht weißt, daß wir hier heute das Maifest feiern. Da wird allemal das schönste Mädchen vom Dorf als Maienkönigin im Umzug durch's ganze Dorf geführt. Nun aber finden wir kein Kleid, das dem Mädchen paßt, und drum läuft alles von Haus zu Haus, um eines zu suchen.» «Hm», dachte der Mann bei sich, «mein Vogel wird ja da wohl helfen können!» —und er sagte: «Blauer Vogel, tu, was du sollst!» Und im gleichen Augenblick lag das schönste Kleid der Welt da, wie es jeder Prinzessin recht gewesen wäre. So prächtig war noch nie eine Maikönigin angetan gewesen. Das ganze Dorf war hocherfreut, und die Leute wußten nicht, wie sie dem Manne danken sollten, und sie bewirteten ihn aufs beste.Als er weiter wanderte, kam er nach einer Weile in ein Schloß. Der Herr des Schlosses, ein junger Graf, wollte eben seine Braut heimführen, die schönste Jungfrau weit und breit. Aber es war alles wie verhext: sie konnte ihre Kleider nicht finden: das eine Mal fehlte die Bluse, das andere Mal der Rock, und als sie endlich die Strümpfe an hatte, so mußte sie die Schuhe noch lange suchen. Das ganze Schloß war z'underobsi, die Lakeien und Zofen rannten treppauf, treppab durch alle Räume von Keller bis zum Estrich. Aber es half alles nichts. Da dachte der Käfigmacher wieder: «Den Leuten ist bald geholfen!» und er sagte: «Blauer Vogel, tu, was du sollst!» Und kaum gesagt, war alles beieinander
und die Braut stand bereit in vollem Putz und Staat. Aber nun fand der Bräuter, seine Braut sei viel schöner gekleidet als er, und der blaue Vogel mußte auch ihm erst noch ein prächtiges Gewand schaffen von Samt und Seide und mit köstlichen Spitzen dran. Jetzt konnten die Brautleute zur Kirche fahren. Der Mann aber wurde zur Hochzeit eingeladen.Nach dem Hochzeitsmahl wollte er weitergehen. Doch der Graf hielt ihn zurück und fragte ihn, ob ihm sein blauer Vogel nicht feil sei, und er bot ihm eine große Summe Geldes. Zuerst wollte der Mann nichts von dem Handel wissen. denn einen solchen Vogel bekomme er niemals wieder. Doch als der Graf ihm alle seine Güter und sein ganzes Geld dafür bot, da sagte er, er wolle es sich bis zum Abend überlegen und ihm dann Antwort geben. Aber der Schlaukopf wußte schon wie er's machen wolle. «Laß mir den Vogel und behalt du die Federn,» dachte er bei sich und ging in den Wald hinaus und sagte: «Blauer Vogel, tu, was du sollst!» Und siehe, da kam ein anderer blauer Vogel herbeigeflogen, der dem ersten ganz gleich sah. Den nahm er und tat ihn in den Käfig und den rechten verbarg er in seinem Sack. Dann ging er aufs Schloß zurück und sagte dem Grafen, ja, er könne den Vogel haben, doch müsse er ihm, um den Preis vollzumachen, zu allem andern auch noch seine junge Frau dafür geben. Das deuchte den Grafen denn doch zuviel geheischen. Aber, dachte er bei sich, hab ich erst den Vogel, dann kann ich mir meine Frau und Gut und Geld ja gleich wieder zurückwünschen. Und so gab er alles für den blauen Vogel im Bauer, alle seine Güter, sein ganzes Geld und seine Frau dazu. Und damit ging der Käfigmacher fort.
Aber sooft der Graf auch sagte: «Blauer Vogel, tu was du sollst!» — es half nichts, denn er hatte ja nicht den rechten blauen Vogel. Und wie er seine Frau nicht wiederbekam, da härmte er sich so, daß er noch in derselben Nacht starb
vor Gram. Der Narr, warum hat er auch sein Liebstes weggegeben!Und nun wurde der arme Käfigmacher ein reicher Schloßherr und nahm die junge Gräfin zur Frau, und sie haben noch lange Jahre glücklich und in Freuden miteinander gelebt.
Der dumme Peter
Es war einmal ein junger munterer Bursche mit hellen Augen und starken Armen. Der träumte den lieben langen Tag und dachte an nichts. Drum hielten ihn alle Leute daheim für einfältig und nannten ihn nur den dummen Peter. Eines tages ging der Peter, weil ihm nichts anderes einfiel, über Land. Da kam er von ungefähr an einen Bach, der war von Regengüssen so hoch angeschwollen, daß er das ganze Tobel schier bis zum Rande füllte. Da das Wildwasser auch die Brücke fortgerissen hatte, so machte sich Peter daran, hinüberzuschwimmen. Da stand aber aufs Mal ein winzig kleines Mandli vor ihm und sprach: «Ach, sei so gut und nimm mich doch mit hinüber.» «Komm her!» antwortete Peter. setzte den Höck auf seine linke Hand und ruderte mit der rechten ans andere Ufer.
Als sie wohl auf dem Trockenen waren, sagte das Mandli: «Jetzt sollst du auch deinen Lohn haben. Was hättest du gern?» «Ei, was kannst du mir wohl geben, du kleiner Pfüder?» antwortete Peter und lachte. «Wünschest du dir einen klugen Kopf?» «Nein, davor bewahr mich der Himmel! Allzuklug macht närrisch; und wer alles wissen will, weiß gewöhnlich nichts. Und überdies: was hilft alles Wissen, wenn man nicht danach tut.» «Wünschest du dir geschickte Hände und flinke Finger?» «Nein, das brauche ich nicht, denn arheiten
ist nicht meine Gewohnheit» «Willst du den Knüppel im Sack?» «Ja, das läßt sich eher hören», sagte Peter, «dann kann ich die Hunde verscheuchen, die mich immer anbellen und mir in die Beine fahren, wenn ich durchs Dorf gehe.» Da holte das Mandli aus seinem Hosensack einen winzig kleinen Beutel hervor, nicht länger als ein Finger; aber wie er ihn dem Peter reichte, wurde er als länger und länger, bis er so groß geworden war wie ein Kornsack, und darin steckte ein eichiger Prügel. Peter dankte dem Mandli, und dann nahmen sie Abschied voneinander. Das Mandli tappelte in die Stauden, und der Peter wanderte mit seinem Sack weiter einem großen Walde zu.Kaum war er in den Schatten der ersten Tannen gekommen, da stürzte ein grimmiger Unhold auf ihn los, groß und fest wie ein Riese, «Geld oder Blut!» brüllte er und schwang ein blutiges Messer. «Da bist du gewiß am Falschen», antwortete der Peter unerschrocken, «ich hab keinen roten Rappen, und auch sonst ist nichts bei mir zu holen.» Da entriß jener ihm den Sack und schaute begierig hinein.
Als er nichts als den Knüttel darin sah, ward er fuchsteufelswild, und schlug mit beiden Fäusten auf Peter los. Der ließ die Püffe und Knüffe eine Weile ruhig über sich ergehen, dann aber ward's ihm doch zu arg, und er rief: «Knüppel aus dem Sack!» Da sprang der Knüppel heraus und gerbte dem Riesen so kräftig das Fell, daß er laut aufheulte und bald jämmerlich um Gnade bat. «Wünsche dir was du willst, ich will dir's geben», rief er, «nur soll dein Knüppel aufhören mich zu prügeln.» «Laß hören, was du zu geben hast», sagte der Peter. «Willst du so stark werden wie ich?» «Nein, denn sag, was hat all deine Stärke dir jetzt geholfen? Es ist keiner so stark, er findet einen Stärkeren. Willst du stark sein, so überwinde dich selbst.» «Willst du gelenkige Glieder und flinke Beine?» «Nein, das brauche ich nicht, denn ich mag nicht pressieren. Wer zu sehr eilt, wird langsam fertig und kommt zu spät heim.» «Willst du das Tischleindeckdich?» «Ja, das läßt sich hören, da habe ich wenigstens stets zu essen und zu trinken, so lang ich lebe.» Da langte der Riese mit seiner haarigen Hand in einen hohlen Baum, zog das Tischleindeckdich hervor und gab es dem Peter und dann sprang er mit gewaltigen Sätzen davon, daß es nur so krachte und knackte im Holz. Der Peter aber befahl den Knüppel wieder in den Sack, nahm das Tischchen auf die Achsel und wanderte weiter.Nachdem Peter eine gute Stunde fortgegangen war, kam er an eine grüne Matte. Da saß ein lahmer Mann, ganz verhudelt und zerlumpt, und der Hunger schaute ihm zu den Augen raus. Peter setzte sich zu ihm, stellte das Tischlein vor sich hin, und siehe, da war schon aufgetragen, was das Herz begehren und den Gaumen letzten mochte. Der Peter ließ sich's schmecken und schob dem Bettler Braten und Wein zu und hieß ihn wacker zugreifen. Als sie gegessen hatten, sprach der Bettler: «Wie soll ich dir's vergelten, daß du mich davor bewahrt hast, Hungers zu sterben? Wünschest du dir Glück?» — «Nein, das brauche ich nicht, denn des
Glückes kann sich niemand erwehren, es kommt über Nacht und liegt auf der Straße, und man stürchelt darüber, aber es behalten, das ist die Kunst. Und überdies: Das Glück hilft dem nicht, der sich nicht selber hilft. Freilich. wem das Glück pfeift, der tanzet wohl, aber wem das Glück die Hand bietet, dem schlägt's gern ein Bein unter, denn Glück und Unglück tragen einander auf dem Rücken und wandern auf einem Steig.» «Wünschest du dir vielleicht Ruhm?» «Sei kein Tor, was sollte ich auch damit anfangen. Wer Ruhm erlangen will, muß viel schnaufen, und am Ende bringt der Ruhm zu Fall.» «Willst du das Wunschhütlein?» «Ei, das läßt sich hören, das fehlt mir grad noch, denn dann brauch ich mir die Schuhe nicht mehr ablaufen, wenn ich wohin will.» Da zog der Mann aus seinem löchrigen Ranzen ein graues Hütlein hervor, gab es dem Peter und humpelte an seinen Krücken davon.Peter aber blieb gemächlich im Grase sitzen und dachte: «Hei, du möchtest schon lange auch einmal eine große Stadt sehen!» Und schon hatte er sich das Hütlein aufgesetzt und sich nach der Hauptstadt des Königreichs gewünscht. Und da stand er auch schon vor dem Schlosse, das war gar prächtig zu schauen mit seinen weiten Toren, hohen Türmen und schimmernden Fenstern, dahinter zahlreiche Diener in goldbetreßten Feckenröcken hin und wider liefen. Der Peter schaute und staunte. «Eh», dachte er, «dumm bin ich gewesen, daß ich mir nicht gewünscht habe, selber König zu sein.» Im selben trat die Königstochter mit ihren Zofen aus dem Schloß, um einen Spaziergang im Park zu machen. Der Peter meinte nichts anderes, als, es wäre ein Engel vom Himmel. der da an ihm vorüberwandle. so schön war die Prinzessin. Und er dachte bei sich: «Ja, wär' ich jetzt ein Prinz, dann könnte ich die schöne Königstochter grad zur Frau bekommen. Daß ich die drei dummen Wünsche tat! Aber so ist's, man ist immer gescheiter hintendrein. Aber ist das Glück auch verspielt, so brauche ich drum den Mut
nicht verlieren. Bin ich auch kein Prinz, so bin ich doch der Peter, und fragen steht frei.» Und damit ging er geradewegs in das Schloß hinein, und ließ sich von einem Lakeien den großen Saal zeigen, wo der König inmitten seines Hofstaats auf dem Throne saß und eben regierte. Lange stand der Peter da und schaute ihm zu. Dann trat er unverzagt vor den König und sagte: «Herr König, ich bin der dumme Peter und komme Euch zu fragen, ob Ihr mir Eure Tochter zur Frau geben wollt oder nicht.» Da lachte der König, daß ihm der Bauch wackelte, und sagte: «Ei ei, mein lieber Peter warum nicht gar? Aber wer freien will, und zumal um eine Königstochter, der darf nicht mit leeren Händen kommen. Alles in der Welt hat seinen Wert und Gegenwert. Was hast du denn zu bieten?» «He nun, da ist für's erste das Tischleindeckdich», sagte der Peter, stellte es auf den Marmorboden und ließ auf der Stelle Speise und Trank kommen. Der König kostete Braten und Wein, und siehe, alles deuchte ihm besser, als Koch und Kellermeister im Schlosse es ihm alle Tage beschafften, und er sagte gnädig: «Gut, dein Tischlein nehme ich an. Aber die Gabe ist doch zu klein. Hast du nicht noch mehr zu bieten?» «Ja, nun denn, so nehmt halt auch noch das Wunschhütlein!» antwortete der Peter und reichte ihm den grauen Filz. Der König setzte es auf und probierte es gleich aus, indem er sich nach Wunsch an verschiedene Orte seines Landes versetzte. Als er aber wieder auf dem Throne saß, da sagte er: «Gut, ich nehme auch dein Hütlein an. Peter. meine Tochter aber kann ich dir nicht geben, da du kein Prinz bist.»Jetzt aber wurde der Peter ganz furibund, daß der König ihn so zum Narren halte, wo er ihm doch vorhin die Prinzessin so gut wie versprochen habe. Da wurde auch der König zornig. «Jetzt aber ist's genug», schnarzte er und gebot seinen Wachen, sie sollten den frechen Burschen hinauswerfen. Aber, o heie, da kamen sie übel an, denn der Peter rief mit schallender Stimme wie ein General: «Knüppel
aus dem Sack!» und da tanzte der Knüppel schon aus dem Sack hervor und schlug tätsch prätsch auf die Soldaten ein. Und mitunter bekam auch der König einen Hieb oder zwei ab. wenn er zu nahe trat, um die weichenden Gardisten anzufeuern. Es half aber nichts: bald waren alle hinausgelaufen, und jetzt machte der Knüppel sich an den König. Der aber fing gleich an zu bitten und sah aus, als wenn er nichts mehr zu befehlen hätte und versprach dem Peter hoch und teuer, daß er die Prinzessin sicher und gewiß zur Frau bekommen solle. Da kommandierte der Peter den Knüppel wieder in den Sack, und rief selber die Wachen wieder auf ihren Posten. Der König aber ließ seinen Hofschneider prächtige Kleider herbeibringen aus Sammet und Seide, Gold und Brokat, wie nur Könige, Fürsten und Grafen sie tragen, und als Peter sie angelegt hatte, und neben dem König auf einem goldenen Sessel saß, da glaubte der König selber schier gar, er wäre ein geborener Prinz, so stattlich sah er aus.Jetzt kehrte die Königstochter von ihrem Spaziergang zurück, und als sie zu ihrem Vater trat und ihn begrüßte, indes ihre Zofen zierlich knixten, da sagte er: «Unverhofft kommt oft, mein Kind. Du kommst just zu guter Stunde: Hier, dieser junge Herr, ist dein Bräutigam, man sagt ihm nur der dumme Peter.» Die Prinzessin wurde rot wie eine Hagebutte im Spätsommer; denn der schmucke Jüngling hatte es ihr auf den ersten Blick angetan, wenn ihr auch der Name nicht eben sonderlich gefiel, und sie sagte nicht nein, als ihr der Peter einen Kuß gab mitten auf den Mund. Als sie aber mit ihm allein war, sprach sie: «Hör, Peter, wenn ich deine Frau werden soll und du mein Mann, denn darfst du nicht mehr der dumme Peter heißen. Du hast mehr Witz als alle andern miteinander hier im Schloß, das hab ich schon gemerkt. Aber du bist nur eben so viel gesalzen, daß du nicht faulst und hättest gern einen Herrn, der dir sieben Feiertage auf die Woche gibt. Aber, bedenk, die
Faulen kehren sich lange im Bett und wenden dem Teufel den Braten.» Das hörte der Peter zwar nicht eben gern. Aber die Königstochter zur Frau haben, das wollte er, und so versprach er ihr, den Faulpelz auszuklopfen, ehe die Schaben ihn fräßen. Und er hat redlich Wort gehalten. Und unlang, so war der Peter wie aus der Haut geschloffen: busper, regsam und schaffig vom Morgen bis zum Abend; denn er mußte dem alten König mit den Staatssachen helfen, und das gibt gar viel zu tun. Und jetzt erst zeigte sich sein Witz so recht, und bald galt er als der klügste Prinz weit und breit.Nachdem die Zeit des Brautstandes vorüber war, ward die Hochzeit mit aller Pracht gefeiert. Am Abend des Hochzeitstages aber schenkte der Peter dem alten König auch den Knüppel im Sack; denn der fürchtete immer, sein Tochtermann möchte sich einmal im Zorn vergessen und ihm den Knüppel wieder auf den Leib schicken; er hatte für immer genug von dem einen Mal. Der Peter aber lebte mit seiner Frau in lauter Glück und Wohlergehen. Sie bekamen zwei Buben und ein Mädchen. Und als der alte König starb, setzte Peter sich die Krone auf, nahm das Szepter in die Hand und hat Land und Leute so trefflich regiert, daß man ihn Peter den Weisen nannte. Und als er hochbetagt sein Leben endigte, da errichtete ihm das Volk ein prächtiges Grabmal. Auf seinen Wunsch begrub man ihn mit dem Knüppel im Sack, dem Tischleindeckdich und dem Wunschhütlein.
Hans und Urschel
Im Bündnerland war einmal ein Mann, der war arm. aber stark und stämmig wie ein Baum, und einen schöneren Burschen fand man nirgends, weder zu Berg, noch zu Tal; an
jedem Finger seiner beiden Hände hätte der Hans ein Maitschi haben können, aber er sah auf Geld und Gut und nicht auf Art und Tugend, denn Geld, meinte er, sei die beste Ware, die gelte Sommer und Winter, an der Fastnacht und an Ostern gleich viel - und so nahm er die Urschel, eine reiche Tochter, aber eine enge Schere und ein schmaler Kratten. Doch wer um Geld freit, der verkauft seine Freiheit, und so waren Geld und Weib sein Meister wie sieben Hunde eines Hasen, denn wer ein Weib nimmt um des Geldes willen, bekommt den Sack gewiß; wie es mit dem Geld steht, wird sich finden. Und so war's auch hier. Nun war der Hans auf Geld erpicht, nicht um viel zu haben, sondern um viel brauchen zu können; denn er war mildherzig und gebig, die Urschel aber, seine Frau war klebig und hebig und klemmte die Batzen so hart, um zu sparen, daß sie dem Hans kaum den Käs aufs Brot gönnte. Nie konnte er ihr zu viel arbeiten und zu wenig essen, ja die Nachbarsfrauen machten's ihren Hunden besser, als die Urschel dem Hans, denn der Geiz muß Hunger leiden, weil der Teufel den Schlüssel zum Geldkasten verloren hat. Sich selber aber ließ die Urschel nichts abgehen. Kein Wunder daß Kraft und Schönheit dem Hans entschwanden, wie welkes Laub von den Bäumen im Spätherbst, und die Urschel aufging rund und knusprig wie ein Ofenküchlein. Der Hans sah aus schier wie der Tod selber, man konnte ihm alle Knochen zählen, und trübselig war er wie ein Schatten vor Harm und Herzweh über sein böses Weib.Eines Tages schleppte sich der Hans wieder einmal ungegessen in den Wald, um Holz zu schlagen für den Winter. «Ich bring dir dann z'Marend hinaus, wenn du geschafft hast», hatte die Urschel gesagt und ihn zur Tür hinausgestoßen. Und wacker hatte der Hans mit seinen schwachen Kräften viele Stunden geholzt und nicht aufgeschaut, um Hunger und Kummer zu vergessen. Endlich, als die Sonne schon hoch am Himmel stand, kam die Urschel munter daher und
brachte ihm sein z'Marend, einen verschimmelten Brotranft und eine vertrocknete Käsrinde, eingewickelt in einen schmierigen zerrissenen Lappen. Sie warf ihm das Bündel vor die Füße, schaute mit bösen Augen rundherum und schnarzte: «Ist das alles, was du heute geschafft hast? Das zahlt mir nicht einmal dein Essen.» Der Hans schwieg still, was hätte es ihm auch geholfen zu widerreden; denn er wußte nur zu wohl, daß es leichter streiten ist wider den Teufel als wider ein böses Weib. Aber eine Träne so groß wie eine Haselnuß rollte ihm über die Wange auf die knochige Hand. Die Urschel aber lachte - es war grad als kläffe ein Hund -, kehrte ihm den Rücken und wackelte schwerfällig wie eine Mastgans nach Hause.Der Hans nahm seufzend seinen z'Mittag von der Erde auf, setzte sich an den nahen Bach und erweichte den verschimmelten Brotranft und die steinharte Käsrinde. um besser kauen zu können; denn die Zähne waren ihm lose geworden im Mund. Da flog ein Rabe über ihm hin durch die Luft und heiser schrie er: rock rock kon. «Oh Urschel». rief da der Hans, «möchtest du nur für ein einzig Jahr in einen solchen Raben verwandelt werden, daß du erführest. was Hunger und Frost ist!» Kaum waren ihm diese Worte über die Lippen, als ein uraltes Weiblein vor ihm stand, ganz verschrumpfelt wie ein alter Tabaksbeutel. «Dein Wunsch, Hans, ist bereits erfüllt», sprach es freundlich, «sieh dort den Raben fliegen, der war dein Weib, das dich so quälte durch Zank und Hunger!» Der Hans blickte auf und hörte deutlich die Stimme der Urschel «Hans, ach Hans, vergib, vergib!» Das Weiblein aber blickte den Hans mit ihren Äuglein an - die waren so schwarz wie Heidelbeeren - und sagte: «Ein volles Jahr muß sie Rabe bleiben und Hunger und Frost erdulden. Aber wehe dir, wenn du weich würdest und sie einließest und ihr Nahrung gäbest, dann wäre sie erlöst, und du müßtest statt ihrer ein Jahr lang als Rabe fliegen im Wald.» Und damit verschwand das Weiblein.

Bald kam der Winter von den Bergen herab. Stein und Bein gefror, Fluß und Ried waren fußdick mit Eis bedeckt. Die Vögel schwirrten um die Häuser und Hütten und suchten vergeblich ein Körnlein oder Brosamlein zu erhaschen. Da setzte sich auch ein großer hungriger Rabe auf Hansens Fenstersims und gebärdete sich gar jämmerlich. Da bewegte Mitleid sein Herz, und der Warnung des Weibleins vergessend, öffnete er dem Vogel das Fenster. Im selben Augenblick flog er selber als Rabe in die kalte Schneeluft hinaus, und die Urschel saß wieder leibhaftig in der warmen Stube. Und wie der Rabe draußen auch bat und bettelte. krächzte und klagte und mit den Flügeln schlug, die Urschel tat ihm nicht auf, und er mußte seine Zeit als Rabe bleiben.
Aber nachdem das Jahr verstrichen war, kam auch der Hans in seiner vorigen Gestalt wieder heim. Da aber ward's der Urschel denn doch warm ums Herz und sie tat hinfort ihrem Hans alles zu Liebe, was sie ihm nur an den Augen ablesen

Ma und Frau im Essigkrueg
Es isch emol e Ma gsi und e Frau. Die hann lang lang mitenander im ene-n-Essigkrueg gwohnt. Z'letscht am änd aber isch's ne verleidet, und der Ma het zur Frau gsait: «Du bisch schuld dra, daß mer in däm suure-n-Essigkrueg Eibe miend; wäre mer nur nit do!»
Derno hänn si agfange mitenander händle-n-und wies<. lii tue und sind enander in däm Essigkrueg als nochegloffe. Do isch uff eimol e goldig Vegeli an dä Essigkrueg ko z'fliege, das het gseit: «Was händle-n-er denn eso mitenander?» «He!» sait d'Frau, 's Essigkriegli isch is verleidet und mer mechte-n-au emol wohne wie ander Lyt; derno wämmer zfriede si!»
Do het sie' s goldig Vegeli us dam Essigkrueg use gb. het sie an e nagelnei Hysli gfiehrt, wo hinde dra e zierlig Gärtli gha het, und sait zuenene: «Das isch eier! Labet jetz einig und zfriede, und wenn er mi bruche, so derfe-n-er nur dreimol in d'Händ klatsche und riefe:
«Goldvegeli im Sunnestrahl! Goldvegeli im Demantsaal! Goldvegeli iberal!» |
Wie sie aber e paar Wuche in däm Hysli gwohnt sind, und emol in der Nochberschaft umme kemme. hänn sie do e großmächtige Buurehof gseh, mit große Ställ, Gärte-n-und Äcker und Gsind. Jetzt het's e ne scho wider nimme gfalle in ihrem munzige Hysli, und s'isch ene ganz verleidet gsi,
und arne scheene Morge hänn sie heidi fascht zue glycher Zyt in d'Händ klatscht und hänn gruefe:«Goldvegeli im Sunnestrahl! Goldvegeli im Demantsaal! Goldvegeli iberal!» |
Und in eim Witsch isch's goldig Vegeli zuem Fänschter yne ko z'fliege-n-und het sie gfrogt, was sie welle. «Ach», hänn sie gsait, «das Hysli isch doch au gar z'klai! Wemmer nur au sone große prächtige Buurehof hätte, derno wette mer z'friede si!» s'Goldig Vegeli het mit syne-n-Aigli e weneli blinzlet, het aber nit gsait, und fiehrt sie ane große prächtige Buurehof, wo viel Äcker dra gsi sind und Ställ mit Vieh und Knächt und Mägd, und het ene-n-alles gschänkt.
Der Ma und d'Frau sind vor Fraide-n-in d'Hechi gumpt und hänn sich fascht nid kennt. Jetz sind sie e ganz Johr lang froh und zfriede gsi und hänn sich gar nit Bessers kenne dänke. Aber lenger het's au nid duuret, denn wie sie jetze-n-als mängmol in d'Stadt gfahre sinn, hänn sie do die prächtige große Hyser und die feine putzte Heere und scheene Dame gseh in de Stroße schpaziere goh; do hänn sie dänkt: In der Stadt muaß es aber herrlig zuegoh, und me bruucht do nit eso viel z'schaffe; und d'Frau het sich gar nid kenne satt seh an däm Staat und däm Wohiläbe und het zue ihrem Ma gsait: «Mer wänn au in d'Stadt! Rief du dän goldige Vegeli! Mer sind jetze scho lang gnueg uf däm Hof!» Der Ma het aber gsait: «Frau, rief du-n-em!» Änntlig het d'Frau dreimol in d'Händ klatscht und het gruefe:
«Goldvegeli im Sunnestrahl! Goldvegeli im Demantsaal! Goldvegeli iberal!» |
Do isch's goldig Vegeli wieder zuem Fänschter yne ko z'fliege und het gfrogt: «Was wänner vommer?!» — «Ach», het d'Frau gsait, «'s Buureläb-n-isch is verlaidet, mer mechte-n
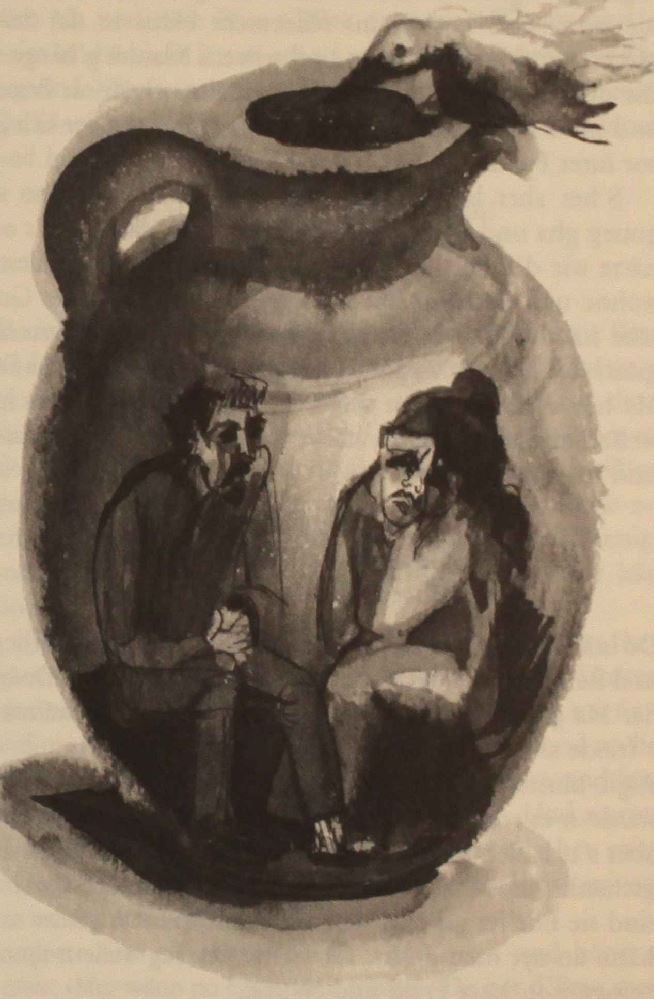
S'het aber laider wieder nit lang duuret, so hänn sie gnueg gha und hänn zue-n-enander gsait: «Wemmer's nur hätte wie d'Edellyt, wo in große Paläschte-n-und Schlesser wohne und Bedienti mit goldige Borte binde uf der Gutsche hänn! Das wär erscht eppis Rächts!» Und d'Frau het gsait: «Ma, jetz isch's an dir, em goldige Vegeli z'riefe.» Der Ma het wieder lang nit welle, äntlig, so d'Frau gar nit het welle noh b mit Miede, het er dreimol in d'Händ klatscht und het gruefe:
«Goldvegeli im Sunnestrahl! Goldvegeli im Demantsaal! Goldvegeli iberal!» |
Do isch's goldig Vegeli wieder zuem Fenschter yne ko z'fliege und het gfrogt: «Was wänner scho wieder vommer?» Do het der Ma gsait: «Mer mechte gärn Edellyt si, derno wämmer z'friede si!» Do het aber 's goldig Vegeli gar arg mit de-n-Aigu blinzlet und het gsait: «Ihr unzfriedene Lit! Wenn wärde-n-er emol gnueg ha? I will eich au zue Edellyt mache, aber s'isch eich nit guet!» Und s'het ene gly e scheen Schloß gschänkt, Gutsche-n-und Resser und e Huufe Dienste. Jetz sind sie Edellyt gsi und sind alli Tag schpaziere gfahre und hänn an nyt meh dänkt, als wie sie der Tag welle-n-umme bringe-n-in luter Fraid und Nyttue.
Emol sind sie in d'Hauptstadt gfahre fir e groß Fescht z'gseh; do isch der Keenig und d'Keenigin in-ere ganz vergoldete Gutsche gsässe in goldgschtickte Klaider, und vornen-und
hinde-n-und uf beide Syte sind Marschall, Hoflyt, Page-mund Soldate gritte, und ahi Lyt hänn d'Hiet und Nastiecher gschwänkt, wo sie vorb gfahre sind. Wie het do däm Ma und däre Frau s'Härz pepperlet! Kuum sind sie haim ko, hänn sie zue-n-anand gsait: «Jetz wämmer no Keefig und Keenigin wärde! Derno wämmer aber uffliecre!» Do hänn sie wider ahi beide mitenander in d'Händ klatscht und hänn gruefe, so luut a's nur hän kenne:«Goldvegeli im Sunnestrahl! Goldvegeli im Demantsaal! Goldvegeli iberal!» |
Do isch's goldig Vegeli wider zum Fänschter sue ko z'fliege und het gfrogt: «Was wanner jetze vommer?» Do hann sie gsait: «Mer mechte gärn Keenig und Keenigin si, derno wämmer z'friede si!» Do het aber s'goldig Vegeli gar arg mit de-n-Aigu blinzlet, d'Fäderli gsträibt und mit de Fligeli gschlage und het gsait: «Ihr wieschte Lyt! Wenn wärde-n-er emol gnueg ha! i will eich nu no zue Keenig und Keenigin mache, aber derby wird's doch nit blybe, denn ihr hann doch nie gnueg!»
Jetz sinn sie Keenig und Keenigin gsi und hann her's ganz Land z'bifähle gha und hänn sich e große Hofstaat ghalte, und ihn Minischter und Hoflyt hann als mieße uf d'Knei falle, wenn sie eins von-ene gseh hänn, und nodino hänn sie ahi Biamte im ganze Land zu sich IL) ko und händ ene vo ihrem Thron abe schträngi Bifähl gä. Und was nur Tirs und Prächtigs in alle Länder gsi isch, das het mieße häregschafft wärde, daß es e Glanz und e Rychtum gsi isch, es isch nit zum sage.
Jetze sind sie aber doch nit z'friede gsi und hänn als gsait: «Mer wänn no eppis meh wärde!» Do het d'Frau gsait: «Wärde mer Kaiser und Kaisere!» «Nai!» het der Ma gsait, «mer wänn Pabscht wärde!» «Das isch alles nit gnue», «het d'Frau in ihrem Yfer gruefe, «mer wänn lieber Herrgott si!»
Kuum aber het sie das Wort gsait gha, so isch e mächtige Sturmwind ko z'bruuse und e große schwarze Vogel mit funklige-n-Auge, wo wie Firreder grollt sind, isch zuem Fänschter yne ko z'fliege und het gruefe, daß alles zitteret het: «Versuuren ihr numme-n-im Essigkrueg!» Und derno isch die ganzi Herrligkait verschwunde gsi, und der Ma isch wieder mit syner Frau im Essigkrueg gsäße. Und jetz kenne sie au drinn sitze blybe.
FABELN
Demut adelt
Es lebte einst vor vielen hundert Jahren ein alter Burgvogt, der wünschte nichts sehnlicher, als daß sein einziger junger Sohn, der vor kurzem mündig geworden, sich recht bald ein Weib nehme, damit er es noch erlebe, einen Enkel auf den Knien zu schaukeln; denn dann bliebe auch die Vogtschaft bei seinem Geschlechte. Auf einen Tag lud er alle Verwandten ein, gab ihnen ein prächtiges Mahl und hielt eine Rede und sagte: «Ich bin schon alt, und der Tod kann mich täglich abberufen. Darum will ich mein Haus bestellen und möchte ich dich, mein Sohn, im Stande der Ehe sehen.» Der Sohn antwortete: «Vater, gern will ich euch zu Gefallen ein Weib heimführen, aber ein Weib nach meiner Wahl. und du mögest sie als deine Tochter begrüßen, ob sie edeln Geblütes sei oder von gemeinen Leuten, ob sie reich sei oder arm, wenn ich sie nur liebe.» Und der Vater sagte es ihm zu. Darauf sattelte der Jüngling sein Roß und ritt im ganzen Lande umher, von Burg zu Burg, von Dorf zu Dorf und hielt überall Einkehr und Umschau. Aber keine von den vornehmen Ritterstöchtern und adligen Fräuleins wollte ihm gefallen und keine von den reichen Meisterstöchtern auf den großen Höfen. Und so ritt er unverrichteter Dinge wieder heimzu.
Da kam er unterwegs in einem Dorf an einem Brunnen vorbei. Er hielt an, um sein Roß zu tränken und den eigenen Durst zu stillen. Da kam aus einem Haus ein einfaches
Mädchen um Wasser zu holen. Ein so holdseliges Kind hatte der junge Graf noch nie gesehen, anmutig war es, wie eines Engels Bild. «Bei Gott, wenn eine auf der Welt, so soll dieses Mädchen mein Weib werden», sprach er zu sich selber und ritt davon.Daheim ließ er eine Schneiderin kommen und hieß sie einer Magd im Schlosse, die an Gestalt und Wuchs jenem Mädchen etwa gleichkommen mochte, ein Kleid anmessen aus Samt und Seide, wie es für eine Edelfrau sich ziemt. Und bei einem Goldschmied in der Stadt besorgte er Gürtel, Kette, Spangen und Ringe. Als das Kleid fertig war, ließ er die Kutsche einspannen und fuhr in das Dorf zu dem Hause des Mädchens. Er stieg aus und trat in die Stube und fand Mutter und Tochter zu Hause. Er bat die Mutter um die Hand des Mädchens, er habe es vor kurzem am Brunnen gesehen und begehre kein anderes zur Frau. «Ach, nein, edler Herr». antwortete die Mutter. «das kann euer Ernst nicht sein. Wir sind arme Leute, und ich habe meiner Tochter nichts in die Ehe zu geben, als was sie am Leibe trägt. Gott verzeihe euch den Scherz, Herr.» Der Jüngling aber erwiderte: «Frau, bei meiner Ritterehre schwöre ich euch, daß ich eure Tochter von ganzem Herzen liebe und ohne sie nicht leben will.» Da sprach die Mutter: «Nun wohl, ist es euer beider Wille. so nehmt sie in Gottes Namen und der Herr segne euch!» Da nahm er das Mädchen bei der Hand und fragte es, ob es seine Frau werden wolle. Die Tochter sprach: «Ja, Herr, ich will euer eigen sein.» «Nun, so versprich mir auch», sagte der Jüngling, «in allen Stücken mir gehorsam zu sein, wie es dem Weibe gebührt, daß es dem Manne sei.» Sie versprach es ihm mit Herz und Hand. Da überreichte er ihr das Kleid und allen Schmuck. Sie zog es an, und es paßte ihr aufs beste. Dann führte er sie zum Wagen, und sie fuhren aufs Schloß und hielten Hochzeit, und es war ein Fest, als wäre die Braut eine Herzogin oder Fürstentochter gewesen.
Die junge Frau und der Graf lebten glücklich miteinander, und niemand hätte vermutet, daß sie niedriger Herkunft war; es war, als hätte sie mit den Kleidern Gesittung und Leben gewechselt, als sie ihre Hütte mit dem Schloß vertauscht: denn sie benahm sich in allen Stücken so einnehmend und gewandt wie die vornehmste Edelfrau, so daß es alle wunder nahm, die sie zuvor gekannt, und vergaß doch nie, daß sie einfacher Leute Kind war: denn so freundlich und leutselig war sie zu jedermann, daß alle sich glücklich priesen, eine solche Herrin erhalten zu haben, und für sie beteten. Und um das Glück voll zu machen, gebar die Gräfin nach zwei Jahren zu ihrer beider höchsten Freude ein Töchterchen.
Da aber kam es den Grafen an. Gehorsam und Willfährigkeit seiner Gattin auf die Probe zu stellen. Als das Kindlein zwei Jahre alt war, trat er vor sie und sprach: «Du hast mir vor der Ehe versprochen, in allen Stücken stets mir gehorsam zu sein. Das Volk murrt, weil das Erstgeborene nicht ein Knabe ist. Drum ist es besser, es wird fortgeschafft. Frage nicht, wohin.» Die Frau neigte ihr Haupt und antwortete: «Was ich gelobt, ist mir heilig. Dein Wille geschehe, wenn es nicht anders sein kann.» Sie küßte ihr Kind, segnete es und gab es hin. Nach aber zwei Jahren gebar die Gräfin ein Söhnlein, und wieder war die Freude groß. Aber als das Kindlein zwei Jahre alt war, trat der Graf wieder vor seine Gemahlin und sprach: «Das Volk murrt und sie schelten deinen Sohn einen Bankert, weil du niedriger Geburt bist. Drum ist es besser, er wird fortgeschafft.» Die Frau neigte weinend ihr Haupt und sprach: «Tu, was du nicht lassen kannst», küßte das Kind, segnete es und gab es hin. Und wieder vergingen einige Jahre, da trat der Graf vor seine Gemahlin und sprach: «Das Volk murrt gegen mich, weil ich dich zur Ehe genommen habe. Ich will aber Frieden haben, wir müssen uns trennen. Geh du also zu deiner Mutter zurück, und ich will mich nach einer andern Frau umsehen,
die meines Standes ist. Dann wird das Volk zufrieden sein.» Die Frau neigte ihr Haupt und sprach: «Nun wohl, wenn es deiner Ruhe gut und deiner Ehre förderlich ist, so will ich gehen, wie ich gekommen bin. Mein niedriger Stand schickt sich nicht für euren Adel. Lebe wohl und Gott schütze dich!» Dann ging sie hin und suchte aus der Truhe ihre alten Bauernkleider hervor, zog ihr schönes Kleid aus und legte das alte an. Dann ging sie stille zu Fuß nach ihrem Dorf. Und alle, die sie sahen, weinten. Als sie zu ihrer Mutter in die Stube trat, da seufzte diese und sagte: «Was hab ich gesagt? Es geht so lang, bis du ihm verleidet bist.»Wieder verflossen einige Jahre. Da eines Tages ließ der Graf seine verstoßene Frau aufs Schloß entbieten und hieß sie das ganze Schloß kehren und fegen, denn er gedenke sich in Bälde mit einer vornehmen jungen Edeldame zu vermählen, und da müsse alles sauber sein und in bestem Stande, und niemand wisse besser Bescheid im Schloß als sie. Die Frau kam und kehrte und fegte das ganze Schloß von oben bis unten. Als sie damit fertig war, sprach der Graf: «So jetzt richte auch alles zur Hochzeitsfeier her, wie es sich gehört, und zum Lohn sollst du mir selber beim Mahle aufwarten.» Sie ordnete und bereitete alles aufs beste, und war besorgt, daß ja nichts fehle, ja sie schmückte am Vorabend noch alle Gemächer aufs schönste mit Tannengrün und Blumen aus.
Am Hochzeitstage saß dem Grafen zur Rechten ein blutjunges Kind, schön und unschuldsvoll wie ein Engel, und ihm zur Linken ihr Bruder, ein ebenso anmutiger Jüngling. Da fragte der Graf die Frau, die hinter seinem Stuhle stand, wie ihr seine Braut gefalle. «Ach Herr», sprach sie, «sie gefällt mir so wohl, daß ich wünsche, sie möchte euch glücklich machen bis an euer Ende. Aber um eines bitte ich für sie von ganzem Herzen: Tut ihr nicht an, was ihr mir angetan habt.» Da schloß der Graf die Frau weinend in seine Arme. «O du mein treues, heißgeliebtes Weib, wahrlich du
hast die Prüfung der Duldsamkeit bestanden. Welcher andere Mann kann sich einer solchen Gattin rühmen! Sie hier unsere Tochter und unsern Sohn, die ich dir fortgenommen, um dich zu prüfen. Fortan bleiben wir vereint bis an den Tod.» Also sprach der Graf und die Hochzeitsfeier ward zum Fest des Wiedersehens und alles Leid hatte ein Ende.
Von der Verkehrtheit der Welt
Ein Engel wies einst einem heiligen Manne drei Gestalten, die litten an dreifacher Torheit. Der erste Mann machte ein Bündel Holz zurecht, und da er es. weil es zu schwer war, nicht tragen konnte, band er immer mehr auf. Der zweite schöpfte mit vieler Mühe aus einem tiefen Brunnen mit einem Gefäß, das war löcherig, wie ein Sieb, und ruhte doch nicht, es vollzufüllen. Der dritte fuhr einen Balken auf einem Wagen und wollte in eine Hofstatt hinein, deren Tor so eng und niedrig war, daß er durchaus nicht durchkommen konnte, und doch hörte er nicht auf, das Pferd zu schlagen und stacheln, bis es scheute und mit der ganzen Fuhre in einen tiefen Graben stürzte. Da sprach der Engel zu dem heiligen Manne: In dem ersten, den du gesehen hast, schautest du das Bild der Menschen, welche Sünden begehen und von Tag zu Tag bis an ihr Ende meinen, daß sie dieselben noch ertragen können, und darum fügen sie täglich mehrere und immer mehrere hinzu, die sie durchaus nicht mehr fortbringen können, bis der Tod sie plötzlich überkommt und ihre Seele zur ewigen Pein entführt und in den Höllenpfuhl taucht. Bei dem zweiten, den du sahest Wasser aus einem tiefen Brunnen schöpfen mit einem Siebe, stelle die dir vor, die gute Werke tun, und dennoch kein Verdienst davon sich erwerben, weil sie voller Löcher, das
heißt Sünden sind, und was sie Gutes getan haben, durch ihre Sündhaftigkeit wiederum zerstören. Durch den dritten. der den Balken fuhr, werden die Machthaber der Erde bezeichnet, welche glauben, sie können mit weltlicher Hoffart und Pracht in die Pforte des Himmelreichs kommen, aber sie werden behindert und verfallen der Hölle.
Wer Gott am nächsten ist
Einmal waren ihrer drei beisammen, ein Bauer. ein Priester und ein Bettler, die stritten miteinander, wer Gott am nächsten sei: «Ich muß Gott am liebsten sein, denn armselig wandere ich durch die Welt und lebe von anderer Leute Almosen!» sagte der Bettler. Der Priester sprach: «Ich bringe Tag für Tag das heilige Meßopfer dar und bete täglich für euch alle. Drum muß ich Gott am liebsten sein!» «Und ich», sagte der Bauer, «werke und schaffe meiner Lebetage zur Ehre Gottes und opfere meiner Hände Arbeit dem Herrn; das ist so gut als beten.»
So stritten sie lange und konnten nicht einig werden, denn jeder beharrte auf seinen Worten. Zu guter Letzt gingen sie alle drei zu einem weisen Manne, der gab ihnen diesen Rat: «Wandert alle drei eine Tagereise weit, ein jeder für sich, und da. wo ihr hinkommt, wenn die Sonne zu Gold geht, da bleibet und bringet die Nacht zu; dann kommt wieder zurück und erzählt mir, wie es euch ergangen ist!» Die drei befolgten den Rat des weisen Mannes und machten sich früh am Morgen auf den Weg. Als die Nacht einbrach, war der Bettler zu einem Graben gekommen. Dort legte er sich zum Schlafe nieder. Die ganze Nacht war es ihm, wie wenn Steine getröhlt würden. Der Priester kam bis zu einem großen Rosenbusch, der in vollem Blust stand. Am Morgen
aber trug er nur noch eine Rose. Der Bauer kam zu einem schönen Hause. Er ging hinein, auf dem Tische stand ein köstliches Mahl bereit. Das mundete ihm herrlich. Dann ging er zu Bett und schlief so weich und gut, daß er erst aufwachte, als die Sonne hoch am Himmel stand.Des andern Tages kamen sie alle drei zu dem Ratgeber zurück und erzählten ihm, was sie erlebt hatten. Jener aber sprach zu dem Bettler: «So mancher Stein im Graben gerollt wurde, so manche Speise hast du erbettelt und nie verbetet!» Zum Priester: «So manche Messe hast du gelesen als Rosen am Strauch blühten, aber nur eine einzige war gut.» Und zum Bauer: «Du bist am nächsten bei Gott, denn dir ist es am besten ergangen.»
Des Kaisers Stein
Ein Kaiser hatte einen edeln Stein. dem wohnte eine wunderbare Kraft inne, denn er war schwerer als Blei oder irgendein anderes Erz der Erde. Wenn man ihn auf die Waage legte, und es mochte groß und lang und breit sein, was gegen ihn gewogen wurde, das hob der Stein in einem Zuge gar behende auf ohne alles Schwanken und Schwingen. Da war keine Schwere, die ihm widerstanden hätte. Ward aber der selbe Stein mit Asche bedeckt, da verlor er auf der Stelle all seine eigene Kraft und Schwere.
Nun nahm es den Kaiser und alle anderen Leute, die von dem Steine wußten, gewaltig Wunder, wie es mit diesem Steine bewandt wäre. Da sprach ein hochweiser Meister, der sich eben bei Hofe aufhielt, daß er dem Kaiser in den Sternen lese: «Dieser Stein, o Herr, ist in allen Stücken dir selber gleich. Denn über alle Königreiche der Welt gehet deine Macht und Gewalt. Groß und mannigfaltig ist
deine Mündigkeit. Und solange du das Leben behalten magst, so kann dir niemand widerstehen. Da bist du schwer als wie der Stein. und alle Welt ist klein und schwach vor dir. Wenn aber du darniederfällst, dann kommt dir deine Kraft nicht mehr zurück. Sobald dein hohes Haupt mit Erde wird bedeckt, so zergehet deine Macht. Darum, o Herr, sollst du stets gedenken, daß du hinfällig und vergänglich bist, und allstund sollst du dich richten auf die Fahrt. die unwandelbar der letzte Gang des Menschen ist.Wenn der Gewaltig niderfallt, So ist erloschen syn Gewalt. Alls, das vom Wybe je geboren wart, Muos komen uf des Todes Fahrt. Er sy jung, alt, arm oder rych, Sie müesen sterben alle glych. |
Der dankbare Löwe
Der Hunger trieb einst einen Löwen, daß er auf die Weide lief, um ein Rind zu rauben. Da trat er in einen Dorn. und sein Bein schwoll an und der Fuß schwärte. Und große Schmerzen litt der Löwe, denn der Dorn stak tief in seinem Fuße und tat ihm weh. Er mochte nicht mehr laufen und bald konnte er kaum noch gehen; und sich selber helfen konnte er nicht. In seiner Not schleppte er sich zu einem Hirten hin. Der erschrak und glaubte nichts anderes, als daß der Löwe ihn zerreißen werde. Gerne hätte er dem Löwen all seine Schafe gelassen, wenn er nur seiner schonte. Der Löwe aber gebärdete sich gar sanft und tat so artig, daß es den Hirten ein Wunder deuchte: er reichte ihm seine kranke Pranke dar, so daß er die Wunde gewahrte. Er sah den Dorn
in dem Fuß, der dem Löwen solches Ungemach schuf. Und geschickt zog er ihn heraus mit seiner Hand. Da genas der Löwe alsbald von seinen Schmerzen, er schaute seinen Arzt an, streckte und reckte sich, schlug mit seinem Wedel und brummte sanft. Dann ging er fröhlich von dannen.Nicht lange darnach fiel der Löwe in eine Fallgrube, welche die Jäger des Königs gegraben hatten. Da war er gefangen und wurde nach Rom gebracht in ein großes Haus und allda zu anderen wilden Tieren gesperrt, die in einem Zwinger gefangen gehalten wurden. Denen warf man bei großen Festen Menschen vor, die zum Tode verurteilt waren: denn die Römer kannten zu selben Zeiten kein schöner Schauspiel als wilde Tierhetzen und blutige Menschenkämpfe. In einem Kriege war nun auch jener Hirt, der einst dem Löwen den Dorn aus dem Fuß gezogen hatte, gefangen genommen und als Sklave nach Rom verkauft worden, daß er mit den wilden Tieren um sein Leben kämpfe. Als der Löwe den Mann gewahrte, da lief er sanft zu ihm hin, stellte sich schmeichelnd mit dem Schweife wedelnd vor ihn und trieb die anderen Tiere dräuend von ihm weg. Wie aber der Kaiser der Römer dies Schauspiel sah, da wunderte er sich sehr, was es sein möchte, daß solches sich begebe, und er ließ den Hirten alsbald vor sich kommen und sprach: «Sage mir, wie geht das zu, daß dir der Löwe nichts getan hat?» Der Hirt antwortete: «Herr, einst zog ich fern in meiner Heimat auf der Weide diesem Löwen einen Dorn aus dem Fuß und heilte seine Wunde. Drum hat er jetzt meiner geschont.» Das deuchte den Kaiser ein seltener Lebenstreff zu sein, ein wahrer Fingerzeig des Himmels, und er sprach: «Dieweil der Löwe dir kein Leid getan, der Herr der Wälder und der Tiere König, so will auch ich, des Erdenrunds Gebieter, deiner schonen. Geh in Frieden und zieh in deine Heimat. und der Löwe folge dir.»
Das dankbare Mäuslein
Einmal erging ein Löwe sich in einem Walde und spähte nach Beute. Da fing er eine Maus, die wollte er fressen. Sie aber sprach: «Herr Löwe, laßt mich gehen, denn es geziemt sich nicht für eure Biederkeit und euren Edelmut, daß ihr mich tötet. Ihr hättet wahrlich wenig Lob und Ehre davon, und keinen Gewinn, denn von meiner Kleinheit würdet ihr schwerlich satt. Also lasset mich gehen. Wer weiß, ob ich euch nicht noch einmal von Nutzen sein kann, so klein und gering ich auch bin.» Der großmächtige Löwe hörte die Rede des klugen Mäusleins, schüttelte seine Mähne und ließ es frei. «Ich will's euch nicht vergessen», sagte das Mäuslein und fort war's.
Bald danach ward derselbe Löwe in einem starken Netz gefangen. Und je mehr er das Netz mit Gewalt zu zerreißen sich mühte, je enger zog es sich zu, und zuletzt konnte der Löwe kein Glied mehr rühren und lag hilflos gefesselt. Wie er also gefangen lag, siehe da kam unverhofft die Maus daher getrippelt, ehe der Tag aufging, und lief zu dem Löwen hin. «Gott grüß euch, Herr!», sprach sie, «was klaget ihr? Was ist euch not?» Der Löwe sprach: «Ich bin gefangen auf den Tod, und komme nimmermehr davon.» «Ei, nur getrost, Herr», sprach das Mäuslein, «ihr kommt wohl heraus. Ich werde euch helfen.» Und ungesäumt begann es mit seinen scharfen Zähnlein das Netz zu zernagen und zu zerreißen, bis es ein großes Loch zuweg gebracht, so daß der Löwe herausschlüpfen konnte. Er dankte der Maus und entlief alsbald. Das Mäuslein aber rief ihm nach: «Ich hab's gern getan!»
Wer hängt der Katz die Schelle an?
In einem alten Hause waren viele Mäuse, ein ganzes großes Volk. Die tanzten auf Tischen und Schäften und ließen sich's wohl sein in Kammer und Keller. Ihr Treiben aber ward den guten Leuten, die das Haus bewohnten, nachgerade lästig, und eines Tages taten sie einen großen schwarzen Räuel zu. Und von Stund an war der Mäuse Herrlichkeit zu Ende, und sie kamen in groß und größere Not, denn die Katze schonte weder groß noch klein. Da hielten die Mäuse Versammlung, um Rat zu schlagen, was gegen die Gefahr zu tun wäre. Und lange ward hin und her beraten. Zuletzt am End kam man einhellig überein, ihrer eine sollte dem Untier eine Schelle anhängen, dann wären sie alle künftig wohl bewahrt. Da aber nahm eine alte graue Maus das Wort und sprach: «Der Rat ist gut und wird, will Gott, uns allen auf ewige Zeiten zum Heile gereichen. Aber machet jetzt auch aus, wer von uns es unternehmen soll, der Katze die Schelle anzuhängen.» Darüber aber war zu keinem Schluß zu kommen, denn keiner wollte sich des Wagestückes unterstehen mit Gefahr von Leib und Leben. «Ich nicht, nicht ich», so miefte eine nach der anderen, und alle verschloffen sich schleunigst, und eine jede pfiff weiter aus ihrem sichern Loch. Der böse Räuel aber spielte den armen Mäusen weiter übel mit.
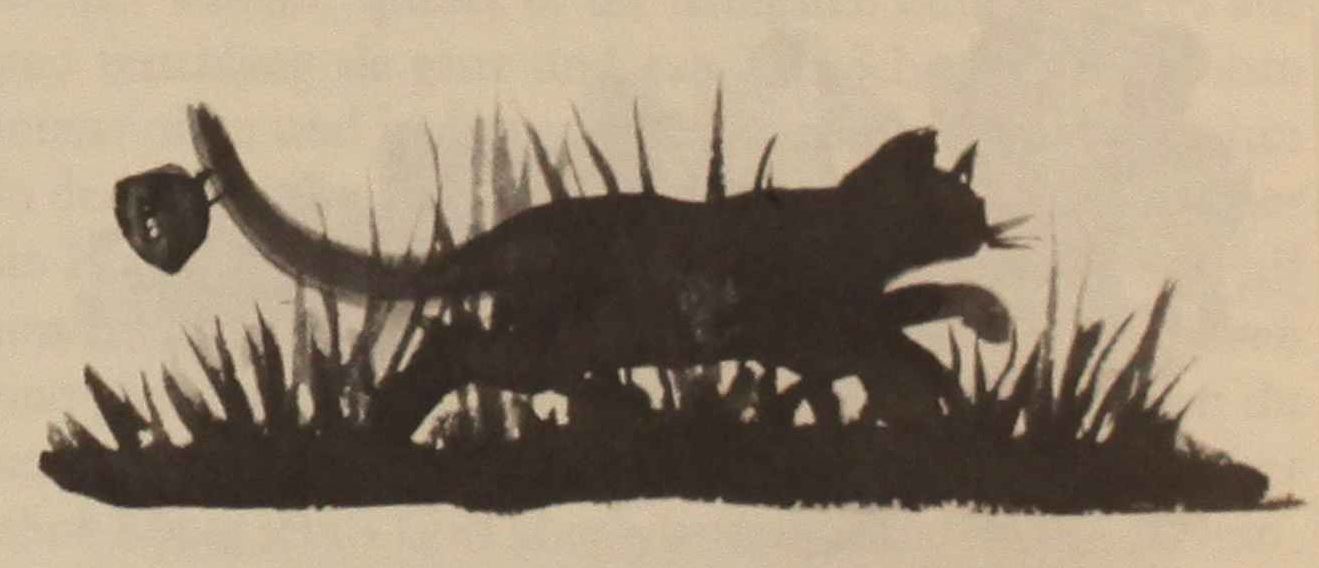
Der Fröschenkönig
Es war ein Weiher von Fröschen voll, und die ließen sich's gar wohl sein im Wasser und außer dem Wasser, wie es der Frösche Art ist. Ein jeder war sein eigener Herr und tat den lieben langen Tag, was ihm behagte, plantschte mit gespreizten Schenkeln im Feuchten und quakte aus vollem Halse auf dem Trockenen. Sie hatten keinen Herrn über sich, der sie regiert und gezüchtigt hätte. Freiheit war ihr Los, aber ihr Sinn stand nicht danach. Denn auf die Dauer verleidete ihnen das schöne Leben, denn nichts ist schwerer zu ertragen, als eine Reihe von guten Tagen, sagt man, und das ist wahr. Item, so buben die Frösche denn alsgemach zu grochzen und zu maulen an: sie möchten nun nicht länger ohne Herrschaft und Regiment leben, alle andern Tiere hätten auch einen Herrn, Gott möge ihnen gleichfalls einen König geben. Da lachte Gott und schwieg. Aber da fingen sie lauthals ihr Lied von vorne an und lagen ihm in den Ohren

Wie ein Frosch eine Maus schwimmen lehrte
Ein Frosch, der -wipp wapp - durchs grüne Gras hüpfte, traf eine Maus an, die eben desselben Weges getappelt kam. «Gott grüß dich, guter Freund. Wir wollen uns zusammen tun und miteinander unsere Straße weiter wandern. und in allen Fährnissen zu Wasser und zu Lande treu zusammenhalten, wie es guten Gesellen geziemt.» Das gefiel der guten Maus nicht übel, denn der Meister Hopschel deuchte sie ein munterer Kumpan. Und sie gingen einträchtiglich ihres Weges fürbaß.
Unlang aber, so kamen sie an einen großen Bach. «Bei meinem Eid», sprach da der Frosch, «ich will dir hinüberhelfen. auf daß du wohlbehalten heimkommest in dein Haus.» Was wollte die Maus anders sagen, als ja; denn nirgends war eine Brücke, und hinüber mußten sie. Und so band der Frosch die Maus mit einem Stücke Bast an seinem Fuße fest. «Hei, jetzt will ich dich meine Kunst lehren», sprach er, «folge mir nur getrost ins Wasser, und du sollst sehen, bald schwimmst du ebenso gut wie ich.» «Wohlan denn und Gott befohlen», sagte die Maus, ob ihr gleich das Herz unterm Pelzlein bibberte. Plitsch-platsch - da sprang der Frosch ins Wasser und ihm nach die Maus.
Der Frosch aber war ein arger und hatte es bös im Sinn. Wie sie in die Mitte des Baches gekommen waren, da tauchte der Frosch plötzlich unter und zog das Mäuslein nach sich. Der Frosch auf dem Grunde riß sie nach unten, die Maus oben aber strebte aus Leibeskräften aufwärts, daß sie nicht unters Wasser komme. So kämpften sie eine Weile auf und ab. der Frosch und die Maus. Das aber ersah hoch oben aus der Luft ein hungriger Weih. Wie der Blitz stieß er nieder und packte die Maus mit seinen Klauen. Der Frosch aber hing an dem Baste fest, den er selber um sein Bein geknüpft. Der Weih ließ beide ins Gras fallen und fraß alsbald den Frosch auf. Da ward der Bast los, und die Maus entwischte
geschwind in ein Loch und kam so mit dem Schrecken davon.Ja, so kann's gehen: Wer der Untreu vertraut, der kommt ins Unglück, aber oftmals schlägt Untreu auch den eigenen Herrn.
Der schlaue Fuchs und der eitle Rabe
Ein hungriger Fuchs schlich mit hängendem Schwanz durch den Wald. Da kam er auf eine Lichtung unter einen hohen Baum. Auf den kam ein kohlschwarzer Rabe geflogen, der hielt einen feisten gelben Käse im Schnabel, den er aus einem Speicher gestohlen hatte. Der Fuchs ward über die Maßen froh, wie er den Raben sah. Er tat gar schön, wischte mit seinem Schwanz das Gras und sprach mit freundlicher Stimme: «Gott grüß euch, mein edler Herr! Ich bin euer Gnaden ergebener Diener für und für, denn ihr seid so hochgeboren und reich, daß kein anderer Vogel euch gleichkommt in allen Königreichen der Erde. Sperber, Faik, Habicht, ja selbst der kaiserliche Pfau in all seinem Farbenglanze muß euch weichen. Aber wie süß ist erst eurer edlen Kehle Schall, allenthalben im Walde hört man eure herrliche Stimme erklingen, wenn ihr zu singen anhebt. Und oftmals hab ich euren unvergleichlichen Tönen gelauscht.» Der Rabe hörte diese Rede des Fuchses und reckte den Kopf hoch und sprach: «Wahr ist, guter Freund, was du sagst, und du bist der erste, der so zu mir spricht, und du sollst meiner Gnade jederzeit gewärtig sein.» «Nun, Herr», sprach der Fuchs, «wenn ihr mir eine Gnade gewähren wollt, so geruhet, ein Lied zu singen!» Da sprach der Rabe: «Die Bitte soll dir gewährt sein.» Und er tat seinen Schnabel weit auf, ließ seine Stimme aus und sang, daß es durch den Wald
scholl. Da aber entfiel ihm der Käse. Der Fuchs hat ihn gleitig weggeschnappt, und sich damit in die Büsche geschlagen, der dumme Rabe aber hat das Nachsehen gehabt.
Der betrogene Doktor
Ein hungriger Wolf kam auf seinem Lauf nach Raub über eine magere Geiß und zerriß sie. Und so gefräßig biß er drein. daß ihm ein Bein in der Kehle stecken blieb. Wie er sich auch anstellte, er brachte es weder hinunter noch heraus. Er kam in solche Not, daß er glaubte, es sei sein Tod, und er schleppte sich jappend und röchelnd fort, um einen Arzt aufzusuchen. Endlich kam er zu einem Storch und sprach: «Ach, Herr Doktor, ihr seid ein geschickter Mann, helft mir von dem Übel, und ich will euch zum Lohne geben, was immer ihr fordern wollt.» Der Storch sagte: «Herr Wolf. tut euren Mund auf, so weit ihr könnt und streckt die Zunge flach. Ich will euch alsbald kurieren.» Und er steckte Kopf und Schnabel tief in des Wolfes Rachen und zog das Bein mit einem Ruck heraus. Wer war da froher als der Wolf! Da sprach der Storch: «Nun, Herr Wolf, alldieweil ihr mir euer Leben zu danken habt, so sollt ihr mir zum Lohne geben, was ihr mir gelobt habt, als ihr krank herkamt.» Der Wolf antwortete darauf: «Ei, mein guter Freund, was soll ich dir noch weiteres geben, hab ich dir doch soeben dein Leben geschenkt, denn das stand eine Weile ganz bei mir. Wie leicht hätte ich dir den Kopf abbeißen können. Aber des Dienstes wegen, den du mir leistetest, hab ich dir das Leben gelassen. Diese Gabe mag dir genug sein.» Sprachs und zottelte davon. Der Storch aber stand lange auf einem Beine stille mit offenem Schnabel da und schaute dem Wolfe nach.
Fuchs und Wolf
Einstmals kam ein Fuchs daher und fand einen Ziehbrunnen. Er lugte lange voll Gwunder hinab und dachte, was mag das sein? Zwei Eimer hingen in den Schacht hinab, die gingen auf und nieder. Da sprang der Fuchs in den einen, und der ging mit ihm nieder, der andere fuhr über ihn empor. Nun ward's dem Fuchs übel zumute; denn er dachte: wie will ich nur von hier wieder fortkommen? Da kam von ungefähr ein Wolf dazu gelaufen. Der schaute auch in den Brunnen und erblickte den Fuchs. «Wuff, wuff», sprach er, «es nimmt mich doch Wunder, daß du in dem tiefen Loche liegst, und dir doch nichts gebricht.» Wie der Fuchs den Wolf erblickte, sprach er gar höflich: «Lieber Wolf, so wohl, wie hier unten, ist's mir all meiner Tage noch nie gewesen.» «Lieber Freund», sagte da der Wolf, «hilf mir, daß ich auch zu dir hinunterkommen kann.» «Beim Eid», sagte der Fuchs, «das soll geschehen, denn du bist mein bester Freund. Tritt nur in den Eimer, da kommst du gleich zu mir herab.» Das ließ sich der Wolf nicht zweimal sagen: er saß in den andern Eimer und zog den Fuchs empor, indes er selber hinabfuhr. Also kam der Fuchs wieder heraus. «Gehab dich wohl, guter Freund, und laß es dir wohl sein da unten», rief er hinab, «ich komme nicht so bald wieder.» Und so mußte der Wolf im Brunnen bleiben.
Die listige Krähe und der arme Schnegg
Ein Schnegg hatte sich in sein Haus zurückgezogen. Da kam ein Aar geflogen, der ergriff das Haus mit seinen Klauen und trug's davon. Das sah eine hässige Krähe, und sie sprach: «Hör, diese Schale enthält einen fetten Bissen, der
wird dir munden, wenn du meinem Rate folgst. Flieg auf und schwing dein Gefieder und laß den Schneggen niederfallen auf einen Stein. Dann wird dir, was darinnen ist zuteil.» So lehrte die Krähe den Adler. Und der arme Schnegg, der hörte ungern, was die Krähe sprach. Der Adler aber tat nach dem Rat und ließ den Schneggen fallen. Der fiel auf einen Stein, und die Schale zerbrach. Da aber fuhr die Krähe, die auf dem nächsten Baume saß, hurtig zu und fraß den Schneggen selber auf.
's dankbar Heggeißli
Es ist arno! a seeleguata Ma gsi, der's nia über d's Herz het bringa könna, Arna Tierli eppas z'tua ohni Ursach. Bsunders gära het er aber d' Gägaxli gha, und as het am ordeli weh tue ywendig, wem-m so-n-as uschuldigs Gschöpfli wo aso keim Mensch nüt z'Leid tuat, fürsetzli gmarteret het. Jetz arno! schloft derselb Ma ufam Feld under-ama ticka Bomm y. Do kunt a Schlanga härakrocha über de Weg, g'sieht-na schlofa und will-na umbringa. Sie rupft mit-am Mu! a füfplettrigs Kleeplatt us-am Gras, leit em's döt ana, wo svs Zeiha d's Herz lyt, krücht uf a Bomm und will döt aba schüssa ufd's Kleeblatt und dä guat Ma töda. Jetz düslet a Gägäxli weidli us am Busch füra, nümt's Kleeplatt, leit's danebed uf a Stei und springt widerum furt, so guat, a's es ka. D'Schlanga kunt derwyl ufa Bomm, kehrt si um und suecht uf am Ma das grüa Plettli, merkt aber kei Zeiheli, daß 's Kleeplatt ufam Stei und nid uf am Ma lyt, schüßt mit aller Gwalt druf aba und verschmetteret-si grusam der Kopf.
SAGEN
Ritter Georg und der Drache
Im Egelsee auf dem Tegerfeld hauste voreinst ein greulicher Lindwurm. Der kam zuzeiten aus dem Wasser herauf und was er fand, es wäre Mensch oder Tier, das fraß er alles. Und wenn er hungerte und nichts mehr auf dem Feld fand, da ging er zur Burg, da mußte man ihm zu fressen geben. Wenn er dann genug hatte, so zog er sich wieder in den See zurück, bis ihn abermals hungerte. Auf der Burg aber saß ein König. Alle Wege über Land waren sehr begangen, und so konnte man die Gegend nicht veröden lassen. Da nun niemand sich getraute, mit dem Untier zu kämpfen, so kam das Volk um seiner Sicherheit willen überein, daß man dem Wurm alle Tage zwei Schafe geben sollte. Die brachte man ihm an den See. Und dieweil sie das taten, kam der Drache nicht mehr nach der Burg und ließ die Menschen in Frieden. Mit der Zeit aber hatte der Drache soviel Vieh gefressen, daß schier keines mehr im Lande war, und da begann er wieder unter den Menschen zu wüten. Da wurden die Bürger rätig, man solle das Los werfen, und wen es träfe, arm oder reich, Mann oder Weib, den solle man dem Drachen geben desselbigen Tages und dazu ein Schaf.
Da fiel das Los einmal auch auf des Königs Tochter, sein einziges Kind. Und der König weinte und jammerte und bat die Leute, sie möchten sich seiner erbarmen und ihn seine Tochter behalten lassen, er wolle ihnen Silbers und Goldes geben, so viel sie nur begehrten. Da aber ergrimmte das
Volk, und sie sprachen: «Auch wir haben unsere Nächsten verloren, drum mußt du deiner Tochter auch entsagen. Also gib sie heraus, oder du mußt mit ihr sterben.» Das war dem König bitter leid und er sprach: «O weh, du armes Kind, wozu bist du geboren worden, daß dein Leib so jung verderben muß.» Und er ließ sie ihre königlichen Kleider anlegen und sich bereit machen. Da sprach die Jungfrau: «Was anderen widerfahren ist, das ist nur recht und billig, daß es auch mir geschehe!» Und sie ging allein mit dem Schaf an den See und saß am Ram und wartete, bis der Wurm käme. und weinte bitterlich.Da aber kam zum guten Glück ein schöner, junger Rittersmann des Weges geritten, Jörg mit Namen geheißen. Weiß war sein Roß und silbern die Rüstung, und golden flogen ihm die Locken im Winde. Wie der die Jungfrau auf dem Bühl sitzen und weinen sah, da sprang er vom Pferde und trat zu ihr hin. Und wie er ihre Schönheit gewahrte und die reiche Zier ihrer Kleider, da ward ihm leid um sie, und er fragte, warum sie so betrübt wäre. Da antwortete sie und sprach: «Herr sitzet auf euer Roß und entreitet alsbald von diesem Ort, sonst werdet ihr mit mir sterben.» Da sprach der Ritter Jörg: «Edle Jungfrau, sagt mir erst, was euch sei.» Da erzählte sie ihm, daß sie hierher gekommen sei dem Drachen zum Fraß. Da sprach Jörg: «Seid getrost schöne Jungfrau, und fürchtet euch nicht. Ich will euch helfen im Namen Gottes.» Kaum hatte er das Wort gesagt, da wand sich der Wurm aus dem Wasser und fuhr zu. Die Jungfrau erschrak, daß sie verblich wie eine Lilie. Wie aber Ritter Jörg den Drachen ersah, schwang er sich auf sein Roß, machte das Zeichen des Kreuzes vor sich und sprengte mit eingelegter Lanze dem Wurm entgegen. Der spie Gift und Geifer aus seinem Rachen und schnappte nach dem Speer. Jörg stach ihm den Speer durch den Schlund. Da fiel der Wurm nieder und verendete. Dann hob der Ritter Jörg die Jungfrau vor sich aufs Roß und brachte sie heim in ihres Vaters
Schloß. Und der König gab seine Tochter dem kühnen Ritter, der sie und das ganze Land erlöst, zur Frau und das Reich zu Erb und eigen.
Tann huser
Es war einmal ein kühner Rittersmann, Tannhuser geheißen. Des Sinn stand allstund nach Gefahr und Abenteuern. wie es einem rechten Ritter geziemt, und viele Länder hatte er befahren mit Schwertschlag und mit Harfenklang. Oftmals ritt er auch in den wilden Wald hinaus, nicht auf Waidwerk bloß, den stolzen Hirsch zu pirschen und die grimme Wildsau zu hetzen, sondern der Wunder gewärtig, die allda zu schauen wären. Eines Tages nun, als er auch wieder ausgeritten war, da begab es sich, daß er mitten im finstern Forst aufs Malin tiefes Sinnen versank, und als wäre er vom Schlaf benommen, ließ er seinem Roß die Zügel, so daß es ohne Weisung pfadlos durch den dichten Tann drang. Und so kam er von ungefähr an einen hohen Berg. Das aber war der Berg der Frau Vrene, der schönsten Huldin, die vieler Wunder mächtig und mancher Zauberwerke kundig war. Auf dem blumigen Bühl schwangen und drehten sich drei wunderholde Mädchen in Ring und Reigen, Blütenkränze im lichten Haar, in bunten, goldbehangenen Gewändern. Das waren der Frau Vrene liebliche Töchter, die sie allemal aussandte. um Menschenkinder, die sich auf ihren Berg verirrten, mit Gaukelspiel und Blendwerk zu betören. Und so leicht traten sie auf leisen Sohlen den Tanz, daß ihr Fuß kein Hälmlein im Grase brach und kein Blümlein knickte. Tannhuser stand still und staunte, und staunte, und konnte sich nicht satt sehen an dem zierlichen Spiel. Und als die Jungfrauen ihn nach sich winkend entschwebten,
da meinte Tannhuser, eine Stunde wäre vorüber, aber da war ein ganzes Jahr vergangen. Und ehe er wußte, wie ihm geschah, war er ihnen nachgeeilt an die Stelle, wo sie verschwunden waren. Da war ein Törlein im Gefels mit einem Guckfensterlein drin. Er schaute hinein, und siehe, da strahlte und funkelte innen alles von gleißendem Golde und schimmerdem Edelgestein wie Sonnenglanz und Sternenschein, so daß er schier die Augen abwenden mußte, so hell war der Glanz. Und voller Drang und Sehnsucht pochte er mit dem Knauf seines Schwertes an die Pforte und sprach:«Frau Vrene, tüend mir uf die Tür! Ein Ritter guet stoht derfür: Tannhuser heißt der edel Mann. Will halte-n-Eue Bott und Bann.» |
Frau Vrene antwortete mit viellieblicher Stimme und sprach:
«Tannhuser, lieber Tannhuser myn, Witt du by üs verblybe, Ich will dir die jüngsti Tochter gä Zue eime ehliche Wybe.» |
Tannhuser schwur ihr's zu mit einem Eid. Und alsbald tat das Tor sich auf und der Ritter schritt geschwind hinein, sein Roß am Zügel führend. Frau Vrene aber stand auf der Schwelle, ein wunderherrliches Weib. und lachte ihn an mit ihrem roten Mund, nahm ihn lind bei der Hand und geleitete ihn in ihr weites Reich unter der Erde, tief, tief innen im Berge. Und fortan wohnte Tannhuser auf Frau Vrenes Zauberschloß und lebte in Herrlichkeit und Freuden mit der Herrin und ihren schönen Töchtern, deren jüngste ihm, wie versprochen, zur Gattin gegeben ward.
So gingen sieben lange Jahre hin wie im Fluge. Aber
allemal am Samstag abend schlossen die Jungfrauen sich in eine geheime Kammer ein und hielten sich den ganzen Sonntag über verborgen und waren nicht zu sehen. Das deuchte Tannhuser ein seltsames Gebaren, und es nahm ihn je länger, je mehr Wunder, was seine Gemahlin und ihre Schwestern den Tag allemal täten oder ließen. Und wieder einmal eines Samstagabends da hielt er sich wach bis Mitternacht und dann ging er sachte zu jenem Gemach, worein Frau Vrenes Töchter sich einzuschließen pflegten und zog sein Schwert aus der Scheide und suchte, wo er ein Löchlein finden könnte, um hineinzusehen. Also bohrte er ein Loch und blickte dadurch. Aber oh Graus! — da gewahrte er im Scheine einer taghellen Ampel die Jungfrauen über dem Gürtel schön und lieblich wie sonst zu schauen, aber unterwärts hatte ihr Leib Schlangengestalt, ein blauschuppiget silberschillernder Schwanz schleifte am Boden.Dem Ritter verschlug der Schreck schier den Atem und vor Angst rann ihm der Schweiß über Stirn und Nacken, und er entwich unverweilt in den Zaubergarten, der das hochgebaute Schloß der Frau Vrene umgab, daß er von dem gräßlichen Anblick sich verweile und heile. Unter einem alten Feigenbaum saß er ins Gras, und wie er da saß und in Sorgen sann, entschlummerte er sanft. Da träumte ihm, daß er große Sünde vor Gott begangen habe, dieweil er Frau Vrenes Berg betreten, und er solle Beicht und Buße tun, solange noch Zeit sei, sonst sei seine Seele auf ewig verloren.
Am andern Morgen, wie es Tag geworden war, trat Tannhuser vor Frau Vrene und sprach:
«Dyner Gspilinne darf ich nüt. Gott het's mir hoch verbotte. Sie sind obam Gürtel Milch und Bluet Und drunter wie Schlange-n-und Chrotte.» |
Frau Vrene antwortete:

«Tannhuser, Tannhuser, was hesch du gseit? Daran sölist du gedenke: Du hesch mir gschwore-n-einen Eid, Du wellisch nit vommer wenke.» |
Tannhuser sprach:
«Dy jüngsti Tochter, die will ich nit, Si treit der Tüfel in ire. Ich gseh's an ire bruun Auge-n-a, Wie-n-er in ire tuet brinne.» |
Da ward Frau Vrene zornig, daß ihre Augen wie von Feuer erglühten, und sie rief!
«Tannhuser, Tannhuser, das ischt arg! Du sollist üs nit schelte. Und bischt du cho in diesen Berg, So muescht du es etgelte!» |
Tannhuser aber kehrte sich nicht an ihre Worte. «Gib mir Urlaub, Fraue, und Gott wird mir zum Rechten helfen!» sagte er, und da mußte sie ihn scheiden lassen. Er legte seine Rüstung an, gürtete sein Schwert um und sattelte sein rasches Roß. Dann verließ er den Zauberberg auf demselben Wege, auf dem er einst hereingekommen war, und ritt weinend durch den Wald. Bald kam er zu einem einsamen Wildkirchlein. Das war an eine hohe Fluh gebaut und beschattet von einem alten Lindenbaum. Dort trat Tannhuser in Jammer und Reue ein und begehrte den Priester. Er kniete nieder und beichtete zerknirschten Sinnes seine Sünden und bis aufs Kinn tropften ihm die Tränen aus den Augen. «Herr», sagte er, «es sind sieben Jahre, daß ich in Frau Vrenes Berg war, und Gott nicht liebte noch an ihn glaubte und völlig der Macht der Frau Vrene erlag.» Der Priester
aber schüttelte ernst das Haupt und strengen Mundes sprach er:«Die Sünde. die nimm ich dir nit ab. Zum Papst muescht du go wandre. Gang und kehr dynen Pilgerstab Nach Rom wie viii andre!» |
Betrübten Herzens stand Tannhuser auf, legte Schwert und Schild und alle andere Ritterzierde ab. und in eines Büßers rauhem Kleide wallte er barfuß als armer Pilgersmann romwärts. Als er nach vielen Wochen mühseliger Wanderschaft nach Rom kam und durch das höchste Tor schritt, fragte er nach dem obersten Priester der Christenheit. Man wies ihm den Weg, und als er in die Kirche trat, da warf er sich vor dem Papst auf die Knie und sprach:
«Gott grüeß ech Eure heilige Papst! Vor Euch tue-n-Ich mich gneige, Myni Sünde will ich Euch azeige.» |
Und der Papst saß auf seinem Hochsitz, den Hirtenstab mit dem Doppelkreuz in der Hand, und hörte Tannhusers Beichte an. Dann stieß er den Stab gegen die Erde und sprach:
«Lueg da, dä Stab in myner Hand, Vor Dürri tuet er spalte. So wenig das Stäbli noch Läubli treit, So wenig channst Gnad du erhalte!» |
Da kniete Tannhuser weinend vor den Kreuzaltar und breitete die Arme aus und rief:
«Ich bitte dich, Herr Jesus Christ, Der du der Herr im Himmel bist. |
Du wellist dich myner erbarme Mir Ellende-n-und Arme!» |
Dann hob er sich auf und ging zur Kirche hinaus ganz verzagt und betrübt in seinem Herzen, und sprach zu sich selber:
«Gott ist mir allzyt gnädig gsi, Ich mueß en große Sünder si, Daß ich von ihm söll lasse Und fahre frömdi Straße.» |
Aber wie er vor das Portal hinauskam. da stand aufs Mal ein wundersames Frauenbild vor ihm, in einem Mantel angetan, so blau wie der Himmel, und auf dem Haupte trug sie eine Sternenkrone. Das war die Muttergottes. Tannhuser senkte sein Haupt zur Erde und sprach:
«Bhüet dich Gott, du reini Magd, Maria Mueter. üsi lieb Fraue. Dich darf ich nümme-n-anschaue.» |
Dann schritt er davon und nahm den weiten Weg nach der Heimat wieder unter die Füße.
Aber oh Wunder! — drei Tage nachdem Tannhuser von Rom geschieden war, da hub aufs Mal der Stab zu grünen an, trieb Sprossen, Blätter und Knospen, und als der Papst zur Vesper ging, siehe, da waren an dem dürren Holz drei wundersame rote Rosen erblüht. Der Papst erschrak in seinem Herzen und schickte gleich seine Boten aus über Berg und Tal in alle Länder. Aber sie konnten Tannhuser nirgends mehr finden, und niemand wußte zu sagen, was aus ihm geworden war. Er hatte derweilen sein Schicksal erkoren und war in den Berg der Frau Vrene zurückgekehrt. Ehe er eintrat, wandte er sich um und sprach: «Gott segne Euch,
Sonne und Mond und ahi lieben Freunde.» Frau Vrene aber stand freudvoll auf der Schwelle und sprach:«Wihlkumme, Tannhuser, by Eid und Ehr! Ich han dich lang entbore. Willkumme, Tannhuser, my liebe Her, Dich han ich userkore.» |
«Tannhuser söll do uße cho! Syni Sünde syge-n-ihm erloh.» Tannhuser aber antwortete und sprach: |
«Zue-n-ech uße cho, das chann ich nit. Do mueß ich blybe-n-inne. Mueß blybe bis an jüngste Tag, Und mir der Himmel gwinne.» |
Und seit jenem Tage sitzt er tief, tief innen im Bergesschacht an einem steinernen Tisch, und der wallende Bart wächst ihm lang und länger, und wenn er dreimal rund um den Tisch herumgewachsen ist, dann wird der jüngste Tag bald kommen, und damit die Stunde seiner Erlösung, da Gott ihn anderswo hinweisen wird. Und alle Freitag abend spät in der Nacht nickt er als wie im Traume und blinzt mit halboffenen Augen und fragt Frau Vrene, ob der Bart jetzt dreimal um den Tisch reiche und der jüngste Tag bald komme.
Der Papst aber, der Tannhuser trotz Beichte und Buße dazumal Vergebung und Gnade geweigert, der ist nach einem halben Jahr gestorben und muß nun selber verdorben und verdammt sein auf immer und ewig.
«Drum söll kein Papst, kein Kardinal Kein arme Sünder verdamme. Der Sünder mag sin, so groß er will, Kann Gottes Gnad erlange. |
Rabiusa
Im Tal Domleschg in Rhätien lebte vor bald tausend Jahren ein Ritter, Rudolf von Rotenbrunn genannt. Er hauste in einem festen Schloß hoch auf einem Felsklotz. zu dessen Füßen der junge Rhein schon seit ewigen Zeiten rauschte. Ringsum im breiten Tal, auf Höhen und Felsköpfen reckten noch andere Burgen trotzig ihre Mauern in die Höhe und drüberhin glänzten die Silberkronen der Alpen.
Der Rotenbrunner war ein rauher und trotziger Ritter. Von seiner hohen Burg aus unternahm er Streifzüge in die benachbarten Täler und überfiel unversehens seine Nachbarn mit Fehde und Raub oder plünderte reiche Kaufleute, die nach Welschland zogen oder mit Waren beladen von dorther kamen. Und wenn ein Angegriffener sich zur Wehr setzte, schlug oder stach er ihn zu Tode. Wegen seines Gebarens war er im ganzen Tal und weitherum im Land gefürchtet. Man mied es, mit ihm in Berührung zu kommen und hütete sich, ihn gar zu reizen.
Zu jener Zeit war aber schon längst das Licht des Christentums selbst in die dunklen Täler der Rheinquellen gedrungen. Aus freiem Willen hatten sich schon vor Jahrhunderten fromme Männer und Ritter aus Irland für die Verbreitung der göttlichen Lehre schwere Entsagungen und Prüfungen auferlegt. In wilden Gegenden bis weit hinein in die Alpentäler hatten sie Kapellen und Klöster gestiftet, welche in jenen Zeiten die einzigen Mittelpunkte und Pflanzstätten der christlichen Kultur waren. Und wo mancherorts früher kein Mensch sich hingewagt. war nun der finstere Wald gelichtet und ein sicherer Zufluchtsort bot Herberge und Schutz.
In der alten Stadt Chur sorgte ein Bischof für Heil und Wohl der Talleute ringsherum und schützte sie sogar nach Kräften vor den Angriffen des räuberischen Adels. Solches gefiel aber dem Rotenbrunner übel, denn er war ein Heide
geblieben und verachtete den neuen Glauben und das einfache Leben seiner Lehrer und Bekenner. Desto mehr hing er an den Freuden des Lebens und liebte es, in Gesellschaft junger Ritter und Damen in den weiten Wäldern zu jagen oder auf seiner Burg lärmende Feste zu feiern.Einst ritt er allein durch den großen Wald hinten im Tal, da fand er eine Jungfrau schlafend im Grase liegen, bei deren Anblick ihn Bewunderung und Staunen erfaßte. Ihre schlanke Gestalt lehnte auf einer Böschung, die wohl ehemals den heidnischen Vätern beim Opferdienst als Altar gedient haben mochte. Das von einer Fülle schwarzer Haare umrahmte Haupt von bräunlicher Hautfarbe ruhte auf einem Kissen von weichem Moos. Der Ritter stieg vom Pferd, band es an einen nahestehenden Baum und betrachtete die Schlafende. Noch nie hatte ein Wesen solchen Eindruck auf ihn gemacht. Er wagte nicht, die Jungfrau zu wecken, sondern wartete und schaute sie staunend an. Endlich schlug sie die schwarzen Augen auf, richtete sich empor und schaute um sich. Der Ritter grüßte sie freundlich und bat sie, mit ihm auf sein Schloß zu kommen, denn er hatte Wohlgefallen gefunden an ihr. Die Jungfrau aber sagte zu ihm: «Ich kann dir nicht folgen, ehe meine Feindin besiegt ist, welche in einem Tal jenseits dieser Berge wohnt und auf meine Schönheit. mein heiteres Wesen und meine Art zu leben böse zu sprechen ist. Sie macht mir meine Herrschaft streitig, obwohl diese älteren Ursprungs ist als die ihre.»
Als der Ritter diese Worte vernahm, erklärte er sich sofort bereit, auszuziehen und die Feindin der Schönen gefangen zu nehmen und herzuführen. Die dunkeläugige Waldestochter aber sagte: «Bedenke es wohl, denn es ist schwer zu ihr zu gelangen. Sie hat selbst über die Tiere der Berge Gewalt und es bewachen ihrer drei den Zugang zu ihrer Wohnung. Wenn du jedoch Mut hast, gegen Rabiusa, meine Feindin zu kämpfen, so gebe ich dir drei Mittel dazu. Und solltest du in dringender Gefahr meine Hilfe benötigen,
so rufe mich bei meinem Namen. Ich heiße Hulda.»Bei diesen Worten überreichte sie dem Ritter drei vergoldete Pfeile. Sie riet ihm, sich noch eine Weile zur Ruhe zu legen. Während er sich neben sein Pferd ins Moos streckte und entschlief, nahm sie einen Frosch und legte ihn auf die Stirne des Entschlummerten. Die Jungfrau war nämlich zauberkundig, und der Frosch sollte bewirken, daß der Ritter nur an sie denken mußte, und alle Verführungskünste anderer bei ihm fruchtlos blieben. Sodann weckte sie den Schläfer und sagte zu ihm: «Beeile dich nun, damit du zum Ende des Sommers wieder hier bist: denn danach muß ich wieder auf den Julberg zur Feier des Julfestes und es dauert Menschenalter, ehe ich wieder unter Menschen erscheinen darf.»
Der Ritter verabschiedete sich und machte sich auf den Weg. Er folgte dem Rheinstrom und suchte das Tal, in dem Rabiusa wohnte. Oftmals war er dem Lauf frischer Bergströme gefolgt, die aus hundert Tälern sich rechts und links in den Rhein ergießen. Aber immer wieder fand er sich von Felsen und wilden Wäldern eingeschlossen, so daß er unverrichteter Dinge umkehren mußte. Er konnte Tal und Berg, wo Rabiusa wohnen sollte, nicht finden und dachte, seine schöne Waldfee habe ihn getäuscht und ihm einen Possen gespielt. Schon war er im Begriffe, nach seiner Burg zurückzukehren, als ihm einfiel, ihren Namen zu rufen, um die Wahrheit ihres Versprechens zu erproben. Und siehe, kaum hatte er gerufen, so flog ein kleiner geflügelter Drache durch die Luft und wies ihm den Weg ins Tal. Weit in der Ferne erblickte er die hohen Häupter der Berge, welche das Tal umschlossen, und es schien ihm, als leuchte aus dem bläulichen Dunst einer mächtigen, schneebedeckten Fluh deutlich die Gestalt eines Kreuzes hervor. Er ritt noch so weit ins Tal hinein, bis der Abend einbrach. Dann stieg er vom Pferd, ließ es frei weiden und legte sich ins Gras zu Füßen eines gewaltigen Ahornbaumes, der wohl seit Anfang
der Welt hier gestanden haben mochte. Von dem anstrengenden Ritt ermüdet, fiel er bald in einen tiefen Schlaf.Der junge Tag säumte kaum die Spitzen der Berge mit seinem Gold, als der Ritter erwachte und sich anschickte, tiefer in das Tal zu dringen. Aber bald schreckte ein fürchterliches Gebrumm sein Pferd, so daß es sich aufbäumte und den Ritter zu Boden warf. Wie er sich wieder aufrichtete, war das Pferd verschwunden, und einige Schritte vor ihm stand ein mächtiger Bär. Zähnefletschend erhob sich dieser und trottete ihm wild brummend entgegen. Rasch entschlossen ergriff der Ritter die Armbrust, legte einen der vergoldeten Pfeile auf und schoß. Ein Hohngelächter erscholl als Antwort. Der Bär war verschwunden, und der Ritter sah den Pfeil im Stamm eine Ahorns zittern. Aber er vermochte nicht, ihn herauszuziehen, und so mußte er den Weg um sein Pferd und einen Pfeil ärmer zu Fuß fortsetzen.
Der Pfad führte ihn jetzt allmählich bergan durch Matten voll herrlich duftender Alpenkräuter und murmelnder Quellen und Bäche, die sich unten im Talgrund in den tosenden Bergstrom ergossen. Immer höher stieg er. Die taufrischen Bergwiesen lagen bald unter ihm, und er kam in Geröllhalden und ins kahle Felsgestein. Die Sonne brannte ihm so heiß auf den Rücken, daß er viel gegeben hätte für einen Trunk aus den klaren Bächen, deren Rauschen von Zeit zu Zeit aus der Tiefe zu ihm hinauf drang.
Während er noch nach einem Trunk lechzte, zeigte sich über ihm auf einem Felskopf eine Gemse, die ihn mit klugen Augen unverwandt anschaute und Anstalten machte, sich auf ihn zu stürzen. Wieder griff er zu Bogen und Köcher und schoß seinen zweiten Pfeil ab; doch das edle Tier setzte in kühnen Sprüngen haldan dem Grat entlang und verschwand. Der Ritter war verzweifelt ob seines Mißgeschicks. denn nun blieb ihm nur noch ein Pfeil, und die Gemse war über alle Berge davon. Allein, er konnte nicht
anders, er mußte dem Weg folgen, den die Gemse in wenigen Augenblicken zurückgelegt hatte. Mühsam erreichte er endlich die Stelle, wo sie übergesetzt hatte, und da öffnete sich vor ihm ein saftig grüner Talkessel. Eine hohe steile Felswand erhob sich im Hintergrund. Hier führte kein Weg weiter, kein Laut war vernehmbar. Wie er die Wand empor schaute, sah er einen mächtigen Bergadler, der seine weiten Schwingen ausbreitete und sich langsam zur Tiefe senkte. Aus dem Horst hörte er die Schreie des hungrigen Jungen. Der Ritter schoß seinen letzten Pfeil ab. aber auch der verfehlte das Tier und blieb im Felsen stecken. Jetzt wiegte der Adler drohend seine Flügel und spreizte seine Krallen über ihn aus, den Frevler anzugreifen. In dieser Not rief der Ritter den Namen Hulda, der Adler entwich. und es war ihm. als öffne sich vor ihm die Felswand. Auf einer sonnenbeschienenen Alp sah er eine einfache Hütte. Daneben stand ein Kreuz.Verwundert staunte er über die Verwandlung. Da trat eine liebliche Gestalt aus der Hütte. Blaue Augen voll Engelsmilde blickten aus einem feinen Gesicht und goldblondes Haar fiel ihr auf die Schultern. Die Herrliche schaute ihn an und rief mit einer Stimme, so rein wie Glockenklang: «Ritter, du rufst umsonst nach deiner Zauberin; denn hier hat ihre Macht ein Ende. Nicht freche Sinnenlust, nicht Zauberkünste noch frevles Wesen sollen hier in unserem freien Tal herrschen, sondern Glaube. Liebe und Hoffnung, die drei Tugenden der christlichen Botschaft. Von diesen heiligen Drei prallen alle Künste der Welt ab, wie deine Pfeile von meinen Tieren.»
Als Rabiusa, denn das war sie, mit sanft mahnender Stimme zu ihm sprach, fühlte er die Erinnerung an Hulda verblassen. Sanfte Stimmen, die aus dem Gebirge erklangen, weckten in ihm bisher nie geahnte Empfindungen.
Die Jungfrau in ihrem einfachen Gewand erschien ihm als Engel des Himmels; es däuchte ihn, ihr Haupt sei von
einem Strahlenkranz umgeben. Sein Leben erschien ihm wie ein wüster Traum, aus dem er jetzt erwacht war. Als nun gar der Bär, die Gemse und der Adler traulich sich der Jungfrau näherten, reute ihn, auf ihre Tiere geschossen zu haben.Rabiusa bemerkte seine Regungen und sagte: «Ich wußte es wohl, Ritter, daß du noch zu etwas Besserem erkoren bist. als in Unglauben und bösem Tun zu leben. Und da nun dein Herz umgewandelt ist, wirst du auch gutem Rat Gehör geben.» Als der Ritter bejahend nickte, fuhr sie fort: «Zieh denn hin zum Grab des Erlösers, tue dort durch mutige Rittertaten Buße und flehe um Vergebung deiner Sünden. Und kehrst du alsdann zurück, so wirst du in diesem Tal ein neues Leben beginnen. Tue also und Gott wird mit dir sein.»
Nach diesen Worten schloß sich ihm die Felswand und alles war wie zuvor. Der Ritter kam zu sich und ging sinnend von dannen. Nach seiner Burg zurückgekehrt, rüstete er zur Fahrt nach dem Heiligen Land. Er gewann einige seiner früheren Gesellen, daß sie sich ebenfalls entschlossen, von ihrem bisherigen Treiben zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Sie zogen mit ihm fort.
Lange weilten sie im Heiligen Land und kämpften mutig und siegreich gegen die Sarazenen. Danach kehrten sie zurück und begaben sich ins Tal, in welchem Rabiusa wohnte. Die Jungfrau war inzwischen gestorben, aber ihr Andenken lebte in den Herzen vieler Bewohner dieser Gebirgsgegend. Nicht nur hatte sie durch ihr Beispiel und ihren Rat gar viele Menschen auf den rechten Pfad geleitet, Kranke gepflegt und geheilt, sondern auch viele barmherzige Stiftungen zum Wohl der Armen nach Kräften unterstützt.
Der Ritter von Rotenbrunn und seine Gesellen zogen in die Wildnis jenes Tales und siedelten sich dort an. Tag für Tag arbeiteten sie, um die Wildnis zu roden und zu lichten. Zum Gedächtnis Rabiusas errichteten sie eine Kapelle. Mit ihren Schwertern schützten sie fortan die Reisenden. welche auf Saumpfaden nach Italien zogen, und die Hirten und
Herden vor Räubern und Raubtieren. Den wildschäumenden Bergstrom aber, der das Tal niederstürzt, nannten sie zur Erinnerung an die edle Jungfrau Rabiusa, und so heißt er heute noch.Aus der Wildnis, in der Rabiusa gewohnt, blühte nach Jahren ein Dorf nach dem andern auf, und das ganze Tal ward nach und nach zum gesegneten Wohnsitz friedlicher und arbeitsamer Menschen.
Vom Himmelreich und ewiger Seligkeit
Es waren einmal zwei fromme Ritter. die waren einander gute Gesellen. Der eine sprach zu dem anderen: «Auf diesen Tag da ich Hochzeit habe, bitte ich dich, du wollest zu mir kommen und mir helfen zu Tische dienen.» Jener sprach: «Mit dem Beding, daß auch du auf den Tag bei mir seiest, wo ich Hochzeit haben will, und mir auch helfest zu Tische dienen.»
Es fügte sich aber so, daß der eine starb, und der andere hatte Hochzeit, und der Tote kam und diente ihm zu Tische. Da nun das Mahl zu Ende war, da sprach der Tote zu seinem Gesellen: «Ich habe dir gehalten, was ich dir zugesagt habe, und auf den siebenten Tag will ich Hochzeit halten, und da sollst du mir auch zu Tische dienen.» Der andere sprach: «Wie kann ich dir dienen, wo du tot bist?» Der Tote sprach: «Nächsten Sonntag, wenn du aus der Kirche gehst, so wirst du vor der Kirche ein weißes Pferd stehen finden, das ist gesattelt. Darauf sitze und zwei weiße Hunde werden dir den Weg weisen, doch sollst du zuvor eine lautere Beichte tun.» Der Ritter fand alles, wie sein Gesell gesagt hatte, und er saß auf das Pferd. Die Kirchenleute aber sprachen: «Herr, wohin wollet Ihr? Wann kommet Ihr wieder?»
Er antwortete: «Ich fahre, wo Gott will, und komme wieder, wann Gott will.» Die Hunde liefen vor ihm her, und das Pferd ihnen nach, und sie liefen so schnell über das Feld wie der Wind und kamen bald in einen Wald zu eines Priesters Haus. Der war ein Waldbruder. Da stunden die Hunde still, der Ritter stieg ab von dem Pferd. Er hatte etwas vergessen zu beichten. Er beichtet es, und stieg wieder auf das Pferd.Und unlang, so kamen sie an eine Burg. Da stieg er ab und sein Gesell kam ihm entgegen und sprach zu ihm: «Wie bist du so lang ausgeblieben? Man hat schier gegessen, nur eine Tracht noch hat man zu essen, zu der mußt du dienen.» Und er führte ihn hinein. Da sah er viel Volkes, schön geschmückt, und Freude ohne Ende. Da man gegessen hatte, da sprach der Tote: «Wohlauf, mein guter Gesell, du mußt wieder heim.» Jener aber sprach: «Laß mich noch länger weilen, noch bin ich kaum eine Stunde hier gewesen.» Der Tote sprach: «Du bist länger hier gewesen, als du meinst.» Als der Ritter hinauskam, da fand er das weiße Pferd und die zwei Hunde wieder. Und er saß auf das Pferd und kam in den Wald, wo er gebeichtet hatte. Da sah er den Bühl wohl, das Haus des Waldbruders aber war hinweg. Da verwunderte er sich. Als er nun in seine Herrschaft kam, da waren die Wälder abgehauen und das ganze Land war verändert. Wo sein Schloß stehen sollte, da war das Kloster einer Abtei. Er saß ab, und die Hunde und das Pferd fuhren ihres Weges. Er ging an das Kloster und fragte, wie das dahin gekommen wäre in einer Stunde. Der Pförtner sprach, das Kloster stehe wohl zweihundert Jahre schon da. Der Abt und der ganze Konvent kamen und redeten von der Sache. Da war ein alter Mönch, der erzählte, wie er von seinem Großvater gehört habe, es wäre ein Herr dieses Landes vor vielen, vielen Jahren eines Tages auf einem weißen Pferd hinweggeritten, der habe gesagt, er reite wo Gott wolle, und würde wieder kommen, wann Gott wolle.
Das Kind in der Hostie
Es war einmal ein frommer Priester, der diente Gott dem Herrn alle Tage ohne Falsch und war von solcher Herzenseinfalt, daß alle andern ihn für einen Dümmling hielten. Und doch bewirkte er eben durch diese Einfalt ein Wunder, davon der Ruf weithin erscholl. Nie geschah es, daß er bei seinem Amte etwas versäumte, nie bei seinem Dienste am heiligen Meßopfer. Nur einen Zweifel hegte er in seinem Herzen: er glaubte nicht, daß Wein und Brot bei des Priesters Worten verwandelt würden in den wahren Leib und das wahre Blut unseres Herrn Jesu Christi. Also nahm er einmal Hostie und Wein von der Messe zur Probe mit heim und verschloß beides in einem Schreine, um zu schauen, ob hier die Wandlung sich erwahren werde. Als er am Abend des ersten Tages das Schränklein auf tat, gewahrte er, daß die Stücklein der Hostie, die im Kelche lagen, sich rot gerändert hatten. Dies rühre wohl vom Kelchwein her, dachter er bei sich und schloß einstweilen alles wieder ein; allein am Morgen drauf war alles rot wie Blut geworden. Am zweiten Tage ward es gar geronnen Blut, dann mehr und mehr zu Fleisch und Gliedmaßen und am dritten Tage endlich, siehe da nahm es wirklich eines Kindleins Gestalt an. das bis zum Abend sich in allen Teilen vollkommen ausgeformt. Erschauernd ob dem Ungeheuren, was geschehen und ratlos vor seiner Tat und was daraus noch werden solle, trat der Priester vor seinen Bischof. fiel ihm zu Füßen und bekannte ihm unter heißen Tränen der Reue seine frevelhafte Neugier. Allein der Kirchenfürst. der vordem oftmals schon an dem törichten Menschen Ärgernis gehabt, gab diesmal kein Gehör, sondern schob ihn barsch zur Türe hinaus.
Doch das war allzu jäh und hart getan, und eine höhere Mündigkeit begann zu walten: «Warum», so fragte den Bischof des Nachts im Traume eine Stimme, die nicht von der Erde war, «warum hast du die Reuebeichte jenes Einfältigen
nicht einmal anhören wollen, und ich, ich habe es nicht verschmäht, so ungeheuerliche Sünde von ihm zu dulden!» In Demut erkannte der Bischof seine Geistespflicht und früh bei Tag schon ließ er gleich den Priester zu sich rufen und hörte seine Rede an. Und alsdann ging's im heiligen Aufzug mit Kreuz und Heiligtümern dem Pfarrhaus zu. Hier fand man in dem Kelche das ausgestaltete Kindlein und trug es gleich in höchster Andacht und Verehrung in die Kirche der Franziskaner.Da wird es noch heutigen Tages, in Kristall gefaßt, den Gläubigen vorgewiesen. Und alle erblicken wirklich das Knäblein, doch schier ein jeder auf andere Weise: die einen sehen es am Kreuze hangen, die andern schauen den Gegeißelten, einige den Kreuztragenden und einige den Auferstandenen.
Der erleuchtete Senn
Der Heer in Leuk hatte lange schon bemerkt, daß der Senn von der Hungerlialp, der im Rufe stand, ein gar braver, frommer Mann zu sein, samt seinem Hausstand nie zur Messe kam, weder am Sonntag, noch an gebotenen Feiertagen, ja selbst zu Weihnachten und an Ostern nicht. Er sage allemal, so erzählten sich die Leute, er diene Gott auf seine Weise und habe täglich seine eigene Messe. Das aber durfte der Heer kraft seines Amtes dem Manne nicht so hingehen lassen, und er ließ ihm drum ausrichten, er habe seine Kirchenpflichten wie alle anderen zu erfüllen. Mehrmals war der Mann also schon gemahnt worden, aber vergebens. Zuletzt am End entschloß sich der Heer, selber hinaufzusteigen und den Mann zur Rede zu stellen.
Als er zu den Alphütten kam, fand er nur die Kinder zu
Hause. Er fragte sie, wo denn die Eltern wären. —«Zur Messe!» antworteten sie und wiesen gegen den Wald hin. — «Was, zur Messe? Im Walde? Wo weder Kapelle noch Kirche steht», dachte der Heer bei sich. Nach einer Weile kamen die Eltern zurück. «Woher kommt ihr jetzt?» fragte sie der Heer, «und wisset ihr denn nicht, was das zweite Kirchengebot verordnet? Und warum hört ihr die Messe nicht? Empfanget ihr nie die heilige Kommunion?» — «Damit hat es keine Not», antwortete der Mann, «alltag gehe ich zu einem Felsen im Walde, ein Engel verrichtet dort das heilige Meßopfer; dem diene ich zur Messe und von ihm erhalte ich die heilige Kommunion. Und eben jetzt kommen wir vom Amte.» Der Heer schüttelte den Kopf zu den sonderbaren Worten der Leute. Dann ging man zu Tische. Und da schien es dem Heer, sie hätten nur wenig gekocht. Aber ob auch alle mit großer Eßlust aßen, wurden sie doch satt, und zuletzt blieb obendrein noch mehr als genug übrig.Nach dem Essen nahm der Senn den Heer bei der Hand: jetzt werde er ihn zur Messe führen. Nach kurzem Gang kamen sie zur einsamen Stätte. Auf freiem Platze ragte ein großer Felsen. In dessen Mitte war eine Mulde ausgehöhlt. Die war mit Weihwasser gefüllt. Noch heute heißt der Fels der «Weihwasserstein» oder die «Meßfluo». Nun sagte der Senn zum Heer: «Stelle dich auf den linken Fuß und lug mir über die rechte Schulter!» Der Heer tat es und er blickte in den Himmel hinein. In blauer Höhe schaute er einen lichten Altar, umgeben von Scharen der Engel, die das heilige Meßopfer darbrachten. «Nun stelle dich auf den rechten Fuß und lug mir über die linke Achsel!» sagte weiter der Senn. Wieder tat der Heer, wie er geheißen, und er blickte in die Hölle und schaute die Pein der gefolterten Seelen. Da hegte der Heer keinen Zweifel mehr an der Frommheit der seltsamen Bergler.
Gen Abend nahm der Senn ein Handmälterlein, das die Frau mit dem feinsten Nidel gefüllt hatte als Bhaltis für den
Gast, und geleitete den Heer durchs Tal hinaus nach Leuk, wo er am andern Tage der Messe beiwohnte. Der Heer ließ ihn während der Handlung und der Predigt strenge überwachen, um zu sehen, wie er sich betrage. «Nun», sagte der Pfarrer nach dem Amt, «wie hat der Mann sich während des Gottesdienstes verhalten?» — «Ohne Tadel», sagte der Aufpasser, «nur sahen wir, daß er einmal weinte und einmal lachte, und als ihr die Monstranz emporhobt, da hat er gerufen: «Halt ihn! Halt ihn!»Da ging der Heer und bat den Mann, ihm in die Sakristei zu folgen, er habe noch etwas mit ihm zu reden. Wie sie nun miteinander das schmale Weglein zwischen den Gräbern durch über den Kirchhof gingen, da sah der Mann bei jedem Schritt und Tritt ängstlich vor und neben sich, als ob er fürchte, seinen Fuß geradezu auf den Boden zu setzen. «Was ist im Wege, daß du so kurios gehst?» fragte der Heer ein wenig unwirsch. «Sehet Ihr denn nicht die armen Seelen, die allenthaben aus dem Boden herausragen, wo ihre Leiber begraben sind», antwortete der Mann. Und wie sie die Sakristei betraten und der Heer ihm einen Stuhl bot. sagte er: «Mit Verlaub, erst häng ich meinen Hut auf.» Die Sonne, die durch das Fenster in den feinen Dunst schien. der in der Luft lag, warf einen hellen Strahl durch den Raum. An diesen Lichtstrang hängte der Mann Hut und Mantel auf, und diese blieben daran hängen. Wie der Heer das sah, da getraute er sich kaum noch, seinen Gast zu fragen, welche Bewandtnis es habe mit seinem Gebaren während des Gottesdienstes. —«Ja, sehet, Hochwürden», antwortete jener lächelnd, «ich sah in der Kirche von dem Platz aus, wo ich saß, den Teufel auf dem Fenstersims hocken. Der hatte gar viel zu tun, alle sündhaften Gedanken und Verfehlungen des Kirchenvolks aufzuschreiben, eine ganze Kuhhaut voll. Ob solcher Schlechtigkeit mußte ich weinen. Dann aber sah ich, wie der Teufel die Kuhhaut mit den Zähnen auseinanderzerren wollte, damit sie sich dehne und
er noch mehr darauf bringe. Aber er zerrte so stark, daß die Haut plötzlich zerriß, und von dem Ruck zerschlug sich der Teufel die Hörner an der Kirchenmauer. Da hab' ich halt lachen müssen. Und dann habt ihr den Heiland so spitzig gehalten, daß mir Angst ward, er falle zu Boden.»Erstaunt, daß dieser Senn Dinge sehen und vollbringen konnte, die sonst nur Heilige zu schauen vermögen und zu tun pflegen, bedeutete ihm der Heer, daß er nicht zur Kirche kommen brauche. Er solle es nur weiterhin so halten, wie bisher, und ehrerbietig ließ er ihn ziehen. Der Mann nahm Hut und Mantel, um zu gehen. Aber auf der Schwelle wandte er sich nochmals um und sprach: «Hochwürden, eine Bitte hätt' ich, gebt mir doch auch so ein hochgesegnetes

Der Betbühl
Auf dem Waldbühl bei Ulrichen stund voreinst ein geheimmsvoller Baum. Der barg in einer Mulde ein seltsames Bild von unserer lieben Frau: das war nicht von Menschenhand gemacht, sondern es ist, wie man sagt, von selber aus dem Stamm herausgewachsen. Mitten in der Nacht konnte man von dorther hell die Glocken läuten hören: dazu erscholl der Gesang der Priester und ertönte Orgelklang. Nicht anders war es, als wenn vor versammeltem Volke feierliches Hochamt gehalten werde. Und deutlich sah man, wie Lichter hell leuchtend in die Nacht hinaus zündeten. Die Leute vermuteten, es seien die Engel des Himmels, die auf den Hügel herniederstiegen und dort Gottesdienst hielten. Ehrfürchtend schaute das Volk zu diesem Hügel hinauf und gerne zog es dahin.
Die Pfarrgeistlichkeit aber sah in dem allem nur einen gefährlichen Aberglauben und in dem Ort eine Stätte des Lasters; der Betbühl wurde zuerst zum Plederbühl. hernach gar zum Schletterbühl. Eine Kapelle, die dort errichtet werden sollte, wurde nicht gebaut, der Bischof verbot es. Aber gleichwohl hörte das Treiben nicht auf. Eines Abends aber stiegen zwei rüstige Diener der Kirche mit frischgeschliffenen Äxten hinauf auf den Hügel und fällten binnen kurzer

Die sonderbaren Tierlein
In einer einsamen Hütte im hintersten Grachen des Tales wohnten einmal ein Mann und eine Frau. Eines Tages starb die Mutter, und der Vater blieb mit dem einzigen Kinde, einem Büblein, allein. Er hütete es wie seinen Augenstern, nie kam ihm der Knabe aus den Augen, und so wuchs er zu einem schönen Jüngling heran und hatte nie einen anderen Menschen gesehn als seinen Vater. Als nun der Bube über zwanzig Sommer zählte, sagte er eines Tages zum Vater, er möchte doch auch gern einmal zur Messe geben. Der Vater bedachte sich eine Weile, war dann aber willig, den Wunsch zu erfüllen, und so machten sie sich am nächsten Sonntag miteinander auf den Weg. Ehe sie in die Kirche traten, gebot der Alte dem Sohne, daß er sich nicht unterstehe, auf die linke Seite zu schauen: dort sitzen nach altem Brauch die Frauen - denn er besorgte, den Buben möchte nach einem Weibe verlangen. Der Sohn versprach es. Aber seine Neugier war rege geworden, und so konnte er sich nicht enthalten, während der Messe die Augen nach links zu wenden, wo er sonderbare Wesen sitzen sah; denn dieselben waren so ganz anders anzuschauen als sein Vater. Als nun der Priester die Hostie emporhielt, hub der Bub bald zu weinen an und bald zu lachen.
Als sie selbander nach der Messe heimzu stapften, fragte der Vater seinen Sohn, warum er geweint und gelacht habe. Der Bub erwiderte: «Der Meßbub hat dem Heer halt ein Blech in die Höhe gehalten und dann geschellt, und der
Heer hat ein Büblein in die Luft gestreckt und so spitzig hat er's gehalten mit dem Finger, daß ich gemeint hab, es falle gar schier zu Boden. —Und, Vater, sag, was sind denn das auch für Tierlein, die links von uns gesessen sind?»Da verstand der Alte gar wohl, daß der Bub ein Mann geworden sei und sagte: «Ja, ja, die nächste Woche darfst du wieder hinunter und dir eins zutun!»
Der Balmenmann auf Blatten
Balmen heißt ein überhängender Felsblock bei Blatten. Vor Zeiten lebte darunter ein braver, frommer Bauer. Der war aber auch sonderbar und tat nicht wie andere Leute. Dort. wo er wohnte, stand eine gnadenreiche Kapelle der Muttergottes. Im Winter kam er nie zur Kirche, sondern er diente Gott auf seine Weise; er habe täglich seine eigene Messe, sagte er. Der Heer aber wollte das dem Manne nicht so hingehen lassen, daß er nie zu den heiligen Sakramenten kam, selbst an Ostern nicht. Er ließ ihm drum ausrichten, er habe seine Kirchenpflichten wie die andern zu erfüllen. Mehrmals wurde er vergeblich gemahnt, endlich erschien er eines schönen Morgens in der Kirche und trat in die Sakristei zum Pfarrer und sprach: «Ich komme, weil Ihr es so haben wollt; —doch mit Verlaub, hänge ich erst meinen Hut auf.» Nun schien die Sonne durch das Fenster der Sakristei grad auf die gegenüberliegende Wand. An diesen Sonnenstrahl hing der Bauer seinen Hut und setzte sich.
Da erkannte der Heer, daß ob dem frommen Manne ein höherer Geist walte; er stand auf und ließ ihn ziehen.
Der ungläubige Bauer
Allemal in der heiligen Nacht, da Christ als Kind allen Menschen zum Heil geboren ward, ist durch Gottes Gnade auch den sprachlosen Tieren die Gabe der menschlichen Rede ein Weilchen verliehen.
Nun war da ein Bauer, der meinte, er wisse alle Dinge besser, und wollte das durchaus nicht glauben; er glaube halt nur, was er selber sehe und höre, pflegte er zu sagen. Und so beschloß er denn, am Christabend unbemerkt in den Stall zu gehen, um zu belauschen, was seine Kühe da miteinander reden würden.
Er schlich sich also zu der Zeit auf die Heubühne an die Luke, durch die den Winter über das duftige Sommerheu in die Barren hinunter gestoßen wird, und guckte auf sein behaglich wiederkäuendes Vieh herunter. Und in der Tat, als um Mitternacht die letzten Töne des Glockengeläutes verklungen waren, und in der nahen Kirche die Feier der Christmesse begann, da fingen die Tiere miteinander zu reden an, und es sprach die erste Kuh: «Wo mag denn heute der Meister sein?» «O der, der hockt auf der Drüschchi oben», antwortete die andere. «Ja, ja, der weiß auch nicht, was für eine Arbeit ich diese Woche noch tun muß», sagte der große Zugstier. «Wie ist auch das möglich?» erwiderte eine andere Kuh, «der Herbst ist doch vorbei, und es gibt nichts mehr zu pflügen und zu eggen, auch das Holz ist schon aus dem Walde eingefahren.» Da sagte der Ochse: «Ja, es ist wie ich sage: in drei Tagen muß ich unsern Meister auf den Friedhof hinüber führen.» Als der Bauer das hörte, ließ er einen Schrei los und fiel in Ohnmacht.
Am andern Morgen früh fanden ihn die Knechte, als sie kamen, um das Vieh zu füttern. Sie schafften ihn zu Bett, und man holte gleich den Doktor. Aber nach drei Tagen lag er kalt und steif auf der Bahre.
Die weißen Vögel vom Arpsee
Ein armer Geißbub trieb alle Tage seine Geißenherde zum Arpsee hinauf. Als er einst zur Mittagszeit sein schwarzes Ledertäschlein öffnete und seinen Imbiß hervornahm. da flogen aufs Mal drei Vögel herab auf den See, dergleichen der Bub noch nie zuvor gesehen. Ihr Gefieder war weißer als Schnee, die Hälse lang und schlank und golden die Schnäbel. Sie schwammen hurtig zu ihm her und schienen sich nicht vor ihm zu fürchten. Die schönen Vögel gefielen den, Buben über die Maßen, und er hätte gern einen davon gehabt. Da las er Steine auf, daß er den einen oder anderen tot werfe. Er traf aber nicht. Und die Vögel flüchteten nicht, sondern schwammen immer näher ans Ufer heran. Da trat der Bube ans Wasser, packte den Vogel, der ihm zunächst war, am Hals und zerrte ihn ans Land. Aber er ließ ihn gleitig wieder fahren, und der Chlupf fuhr ihm durch alle Glieder, wie noch nie in seinem Leben, als der Vogel plötzlich mit menschlicher Stimme zu reden anhub: «Ach, warum fassest du so hart mich an? Ich bin nur der geringste
der drei Vögel: Wisse wir sind gar keine Vögel, sondern verwunschene Jungfrauen. Der schöne Schwan mit dem goldenen Schnabel ist eine Königstochter aus den Lande der Radamanten. Wir anderen zwei sind ihre Zofen. Und alle drei sind wir von einem Hexenmeister in Schwäne verwandelt worden, weil die Prinzessin ihn nicht zum Manne haben wollte. Jetzt müssen wir solange Vögel bleiben, bis wir drei Kräuter erhalten, die nur in diesen Bergen gedeihen. Und wenn du uns die verschaffen kannst, dann werden wir erlöst werden und bald wiederkommen.» So sprach der Vogel, indes der Bub mit offenem Munde staunte. «Nennt mir die drei Pflanzen», sagte er, «ich will sie euch suchen.» «Naterkraut, Baldrian und Nachtschatten müssen es sein.» «Die kenne ich nicht», sagte der Hirt, «aber meine Mutter, die sammelt Kräuter, die wird auch diese kennen.» «So geh und komme bald wieder», sagte der Schwan und schwamm zu seinen Gesellen zurück. Dann flogen sie alle drei auf und verschwanden hinter dem Berge.Als die Sonne sank, trieb der Bub seine Herde heim und erzählte der Mutter, was ihm heute auf der Weide begegnet sei. «Nun, wenn weiter nichts fehlt», sagte die Mutter, «dann ist den Jungfrauen bald geholfen. Die Kräutlein kenne ich gar wohl, die wachsen hier in der Nähe.» Und noch denselben Abend sammelte sie die Pflänzlein und legte sie zu dem Imbiß in das schwarze Hirtentäschchen.
Am anderen Morgen zog der Bub mit seinen Geißen wieder hinauf zum See. Da kamen auch schon die Vögel geflogen, und ließen sich auf dem See nieder und schwammen eilig herbei. Der Bub zog die Kräutlein hervor und steckte jedem eines in den Schnabel. Da hub der eine wieder zu reden an und sprach: «Hab Dank, du lieber Bub, für den Dienst, den du uns getan. Wir fliegen jetzt wieder zurück in das Land der Radamanten und mit Hilfe der Kräuter werden wir unsere Menschengestalt wiedergewinnen. Der böse Zauberer aber muß sterben. Wenn du willst, nehmen wir
dich mit, du brauchst dich nur an zweien von uns festzuhalten, und dann tragen wir dich auf und davon, und ehe die Sonne sinkt, sind wir zu Hause, und du kannst König im Reich der Radamanten werden.» Der Hirte sperrte wieder Mund und Augen auf vor Staunen. Dann aber sagte er: «Ich danke euch schön, ihr Vögel, nein, ich bleib doch lieber Geißbub im Walliserland.» Da flogen die Vögel auf und verschwanden hinter dem Berg.Aber dem Buben glückte fortan, was er auch unternahm.
Dreierlei Milch
Vor Zeiten hütete alle Sommer auf der Bahlisalp im Hasli ein Senn sein Vieh. Res hat er geheißen. Allabend aber, wann die Sonne zu Gold ging, zaurte und jauchzte er durch die Volle, daß es rundum in den Felsen und Flühen schallte und hallte. Aber rauh war sein Gesang und ungefüge, und schrill und gell sein Ton, denn noch war dazumal die schöne Jodlerweise nicht in den Bergen erklungen.
So ging der Res eines Abends, als die Sonne hinter den Gräten versunken war, nach seinem Juhen und Huien auch wieder einmal zum Staffel ein, stieß den Saren vor, räbbelte auf die Gaschterren hinauf und streckte sich auf die Lischen. Müde von des langen Tages harter Arbeit war er bald friedlich eingeschlafen und lag in tiefem Schlummer; aber nicht für lange. Mitten in der Nacht weckte ihn aufs Mal ein Geräusch. Es war ihm, als höre er drunten im Hüttenraum das Feuer sprazzeln. Er rieb sich die Augen und schnellte gleitig von seinem Gliger auf - und geschaut! Aber ebenso jäh fuhr er, starr vor Staunen, wieder zurück. Herr Jent, Herr Jent, was mußte er sehen! Stehen da, bei Gott, drei fremde
Mannen, die eben angefeuert haben und dabei sind, den großen Käskessel an den Turner zu hängen und über das hell lodernde Feuer in der Wellgrube zu rücken, um die Milch zu erwellen und doch war die Tür fest mit dem Riegel verrammelt. «Was habt ihr fremden Bursche da zu schaffen?» wollte der Res gerade rufen -denn der erste Chlupf war dem Zorn gewichen -, da sah er erst, was das für Gesellen waren. Der eine war ein großer, fester Mann, bäumig wie ein Riese, mit einem Bart, struppig wie ein Tannengrotz und zündfeuerrot, und hatte ein Hirtenhernd an wie ein Küher. Der stand am Herd und richtete den Kessel. Der zweite trug Wasser und Holz zu, schob Scheiter ins Feuer und schürte es von Zeit zu Zeit, daß Flammen und Funken flogen. Der war ein hoher, hagerer Mann mit schwarzem Haar und einem großen Schnauzbart, und trug ein grünes Wams wie ein Jäger, und über die Achsel ab hing ihm eine Weidtasche. Der dritte, ein feiner, blasser Knabe mit schneeweißem Gesicht und falbem Haar und Augen, so blau wie der Himmel, half dem Großen alles rüsten, trug aus dem Gaden die Gebsen voll blanker Milch herbei und leerte sie in das Kessi. bis es voll war. Dann drehte der Rote den gyrenden Turner übers Feuer, daß es kroste und krachte, als wollte das Dach einstürzen. Da aber kroch dem Res, wenn er auch sonst nicht grad klupfig war, der kalte Schauder den Rücken ab, und der Schopf stand ihm vom Scheitel gradauf, steif wie Föhrennadeln: wie's nämlich Zeit war, die Milch dick zu legen, winkte der Große dem Hageren, und der nahm seine breite, bauchige Gutter hervor und fleußte - der Donner schieß! — ganz blutrotes Käslab drein, und der große Küher rührte mit dem Brecher aus Leibeskräften um, daß die Hütte bebte.Unterweilen aber schritt der Blasse zur Tür hinaus -die tat sich von selber lautlos vor ihm auf - und trat hinaus vor den Staffel. Und alsbald hörte der Res Töne und Weisen, Singen, Jauchzen, Juhen und Johlen, wie er es sein Lebtag

Dann kam der Helle wieder herein. Er ergriff ein langes, geschwungenes Horn, von Weiden und Wurzeln umwunden, das er da in einer Ecke hatte stehen gehabt. Das nahm er und stellte sich damit noch einmal vor die Hütte und ließ nochmals die gleiche Weise langsam in die sternenhelle Nacht ergehen, aber diesmal durch das Horn. Das tönte und schallte, sang und klang und jauchzte und juhte, ich kann's nicht sagen, wie seltsam und schön. Das eine Mal hat's gedröhnt und gebebt und gezittert, wie wenn der Föhnluft durch die Schindeln saust und die Balken biegt, dann wieder, wie wenn der Bergwind durch die rauschenden Wipfel des Hochwalds streicht, und dann wieder war's, als wenn im Frühling alle Quellen springen und klingen, und Wässer und Bäche sprudeln und rauschen, oder wie tosender Wassersturz von hoher Fluh. Das andere Mal, als ob's zur Kirche läute, oder wie wenn eine ganze Herde lober Kühe mit Glocken und Treicheln beieinander wäre und stille weidete. — Und abermals hörte er das Senntum nah und näher zum Staffel kommen, und wie die Tiere stille standen, um zu losen. Da ergriff es ihn, als wollt es ihm das Herz zersprengen. Und die Tränen rannen ihm über die Wangen ab vor Wonne und süßem Schmerz.
Derweilen war der Große mit seinem Geschäft fertig geworden. Er schöpfte und schüttete die Schotte in drei
bereitstehende Gebsen. Aber, o Wunder, da war die Milch in der einen rot wie Blut, in der andern grün wie Gras, und in der dritten weiß wie Schnee. Aber im selben lugte der Riese ob sich und rief dem Res mit rauhem Rust: «Gleitig, Bub. komm herab und wähl. was du willst, dir und uns zum Heil!» Dem Res fuhr's durch Mark und Bein, und das Blut gefror ihm schier in den Adern. Aber da trat eben der Weiße mit seinem Horn wieder in die Hütte und blickte ihn hellen Auges an. So nahm denn der Res sein Herz in beide Hände und glitt von seinem Lager hinab auf den Boden zu den drei unheimlichen Gesellen. «Aus einer von diesen Mutten mußt du trinken, aus welcher du willst. Bedenk dich wohl und wähle gut!» sprach der Rote mit einem Laut wie Donnerklang. «Hier, sieh, die rote, trinkst du davon, so wirst du stark all deine Tage und mutig dazu, daß keiner dir widerstehen kann. Allen magst du Meister, die auf Erden sind, und nimmst dir mit Gewalt, was du willst, und keiner kann dir dawider sein und dir's wehren. Dein Wille allein wird Herr sein und Richter. Und obendrein geb ich dir noch hundert lobe, rote Kühe -morgen schon weiden sie auf deiner eigenen Alp - und blanke, braune Rosse, und im Tal einen großen schönen Hof mit Acker und Wiesland, Wald und Obstgarten. Nun wähle, und dann greif zu!» Dem Res ruckte und zuckte es in allen Gliedern bei diesen Worten. Da trat der Grüne mit dem Schnauzbart vor und sprach - und seine Stimme tönte wie ein Harsthorn: «Trink aus der grünen Gebse! Bist du nicht so schon stark genug und legst im Hosenlupf die stärksten Schwinger auf den Rücken! Und was wolltest du auch mit den hundert Kühen machen, wird dir erst eine bresthaft, so gehst du bald mit der letzten zum Markt! Ich biete dir bleibendes Gut. Ich gebe dir, daß du alles grad kaufen kannst und haben, wonach dich gelüstet. Und der Reichste sollst du sein im Land, und dazu geehrt wie keiner. Und der beste Schütze sollst du werden weitherum in den Tälern und ein gefürchteter, ruhmreicher Krieger in fernen Ländern; fremde Fürsten werden buhlen um deine Gunst. Die ganze Welt ist dein. Da schau nur her und hör, wie's tut!» Und damit leerte der Grüne seinen Sack aus: lauter rote, funkelnde Goldstücke und harte. blanke Silbertaler klangen durcheinander, daß dem Res ganz irr und wirr wurde in Augen und Ohren. Und es zog ihn an allen Haaren.Der Blonde hatte derweil im Dunkel gestanden, auf sein Horn gelehnt, als wie im Traum verloren. Jetzt hub er die Augen auf und sprach mit einem Laut so rein und voll wie silberheller Glockenton - und seine Wangen röteten sich wie die Alpenrosen an der Fluh und seine Augen leuchteten: «Trinkst du aus der weißen Gebse, so gebe ich dir meine Stimme, meinen Gesang und mein Horn. Und morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, wirst du den Kuhreihen so schön singen, jodeln und blasen können, wie du es zuvor von mir vernommen. Und wer dich wird singen und spielen hören, dem wird das Herz von den Klängen und Tönen also erfreut, daß er es nimmer vergißt, solange er lebt. Du aber wirst Gott und allen Menschen lieb sein!» —«Der wyße bin i mi gwennt», sagte der Res, hub die Mutte leicht an den Mund; frische, würzige Milch war's, was er trank. «Du hast gut gewählt», sprach der Helle, «hättest du anders getan, du wärest des Todes gewesen. Hundert und aber hundert Jahre wären vergangen, ehe ich meine Gabe den Menschen wiederum hätte darreichen dürfen. Gott ist mit dir gewesen und hat dein Herz beseelt.»
Und da waren die Dreie auf einen Schlag verschwunden. Das Feuer in der Wellgrube erlosch, und unversehens lag der Res wieder auf der Lischen und schlief, wie wenn nichts gewesen wäre. Als aber die Sterne erblichen und die Vögel zwitscherten und pfiffen und die Sonne kam, da erwachte er und meinte, das alles habe ihm bloß geträumt. Aber da lag das Horn, das ihm der Weiße nächten gegeben hatte. Und flugs ging der Res hinaus vor die Hütte, stellte sich
mitten auf die Alpmatte, wo das Vieh weidete, und hub an aus voller Brust zu singen und zu jodeln und zu blasen. Aber da liefen alle Kühe von selber herzu und reihten sich in Ordnung ein und die wildeste wurde zahm und ließ sich melken. Und wie er's auch versuchte, ob leis oder laut, er konnte singen und jodeln und blasen, wie nächten der Blauäugige. Und von Berg zu Tal scholl sein Gesang, so wundersam rauschend wie Quellen und Bäche, sausend wie in den Wäldern der Wind. brausend wie tosende Wasserstürze in Kluft und Schluft der Berge, so daß die Menschen, die den Klang vernahmen, es nimmer vergaßen.Also hat sich der Kuhreihen vererbt von Geschlecht zu Geschlecht bis auf den heutigen Tag, und die Sennen haben die Weise, das Jauchzen und Spielen nimmer verlernt.
Ds Chöörejes Ursprung
Gib die großi Triichien har und die chliinni Schällen, Scheender teend in Üüsteg niid, Als es luschtigs Chejergliit |
Und en Chejergällen.
Vor Ziiten ischd uf Balisalp im hindren Schtaafel en Hirt z'Alp gsiin, me hed im dr Schlupf-Menk gseid. Gägenuber, änet dr Chöömad, an Mägisalp, wa-n-es teifs Tal drzwischen ischd, hed sus Reesi galped, e flotti, gäbegi Haslibärgere, wa-n-im fin ordli ischd bibi gsiin. Wen den am Aben d'Sunnen under gangen ischd, und ds Reesi Suner Geis gmolchen hed, ischd den Menk ufd'Chöömad gangen und hed em Reesi dir nen Folien no en Gröös uberchi griefd und drzöö ghoired und zlescht griefd: «Choischd nid o eso?» Sun Gsang ischd zwar rüch und grobhelzige gsiin, wil me döözmal
no niid vun dr scheenen Jodlerwiis gwißt hed. Aber är hed deichd, em Reesi gfallis gliich, we's schon e chliin es hoffärtigs Meitli siigi. Döö geid är Döö na siim Gjüüz und Gsang zr Hitten zrugg, tööd d'Schopftiren zöö und räbled ufd'Buni üüfi und leid si i-g-Gaschterren. In Gedanken an sus Reesi schlafd är bald riewwig in. Aber nid fir lang. Undereis gheerd är Döö ds Fur schprätzlen; er schteid gschwind üüf ga g-guggen, was da siigi. Herr Jeses, was möös är da gsehn? Schtähn da bigoschd drii Burschten um d'Fiirgrööben und fään an chääsen. «Was heid ier da z'gwirben?» seid er und wil afan üüfbigären. Döö gsed är erschd, was das fir Kärlige sun. En große, schwarze Man, faschd wie ne Ris und aggleid wie ne Chejer. Dar treid drii groß Mutti volle Milch inhe. «Mid dam was troges z'schwingen», deichd Menk bie-n-im sälber.E chliindre, bleiche, mid schneewiißem Gsicht und faalwen Haaren und himelblawen Oigen hilfd im fläät ds Chessi fillen und de Turner über ds Fur träjen, das chroosed und chrached, wie wen d'Hitten mießti laan. Dr Dritt, in em griennen Schlufi, mid enerjegertäschen und mid enem großen Schnüüz, hocked uf enem 'Driibein, g-gugged ids Fur und tööd e sie eis es Schiit nachi.
Menk ischd suschd nid grad chlipfige gsiin. Aber da isch-sch im doch afen eis dir March und Bein üsgfahren und im schier ibel worden, wa-n-är gsed, das da nid alls mid rächten Dingen zöögeid.
Was Zut ischd gsiin, d'Milch z'dicken z'legen, nirnd Döö dr Grienrock e g-Guttren firche und schnitted bim Tufel schieß ganz blöödrots Chaasleb i d'Milch, und dr Groß faad se an mid dr Chääsbrächen schteerren. Drwiil geid Döö dr Bleich gägen d'Tiren -die tööd si vo-rre sälber üüf- und är geid üüsi i-Schopf.
Bald gheerd Döö Menk gar scheen Teen und Wusi und en Gsang und es Gjüüz, wie-n-ärs sii-l-Läbtag no gar nie gheerd hed und o nid gloibd hätti, daß mugli wän. Holio
hu, holioho, teends vun dn Fliehnen, bald reif, bald hej, bald hibschelli, bald schtarch und lüüt, daß wut vum Bärg widerhalld, und me g-gloibd hätti, es wän irer cdi menge, wa da singen. Flux anhi chund dr Wiiß emmumhi inhe, ergriifd es gwundes Hooren, wan-är in em Schrooten ghäben hed, geid üüsi näb d'Hitten und laad no eis die gliich Wiis dir ds Hooren ergan. Da jooleds und jüüzeds und machds, me chan nid sägen wie liebli und scheen.Ds erder Mal heds taan und zittred, wie wen dr Fehn dir d'Schindli täti süüsen. Ds andermal isch gsiin, wie wes täti zäme-l-liiten, old wie wen da es ganzes Sentem Veh mid Gloggen und Triichlen binenanderen wän. Jetz faad ds Veh an zööche gägen d'Hitten löifen. Da ergriifts Menken, als welteme ds Harz im Liib zerschpringen. Im rinnen Träni über d'Wangi abhe und är seid zöö-n-im sälber: «Jetz heer den bald eis üüf, old i möös gwiß no Grunen.»
Drwiil hed si dr Leng gräched, hed dn Chääs üüse taan in es Jäärb und d'Sirten in drii Mutti gschepfd. Da wird d'Milch in einere blöödroti, in dr andren grasgrienni und in dr dritten schneewiißi. Dma g-gugged är üüfi und rieft Menken: «Chun fläät abba und säg was d'welltischd!» Menken isch es Döö schier unheimli worden. Da chund aber grad dr Bleich inhe und verzwingged me frindli, und är ischd Döö emmumhi bhärzte worden.
«Us einere vun disen Mutten mööschd dü triichen old aber dir dän Schweifel schliifen. Wolltischd vun dr roten, so wirschd dü schtarche fir Dun Läbtag, das di e keine mag. Dü magschd all und nimschd mid Gwaald was d'willt und niemen chan dr eppis drfir töön und druberinhi uberschüüschd no hundert rot Chie.» — «Das wän afen eppis», deichd use Menk, «aber lan gsehn! was ischd mid dar griennen Mutten?» Döö seid dr Schnüüzbärtig: «Bischd dü nid schon schtarche gnöög? und was wolltischt dü mid hundert Chienen? Wurdi eini bräschtig, su choischd den bald mid dr leschten z'Märt! I giben dr, daß dü-rre no meh choischd
aschaffen und dr Riichschd sollt sun im ganzen Glend. Gschou! da nun Silber und Gold sovil as d'willt.» Und drmid leest är e Sack volle üüs. Das hed Menken griisli verzennd und hed nen schier an allen Haaren gschrissen. «Das wän nadischt nid ds mindscht», deichd er, «da wellti miim Reesi es Hüüs buwen und e Schur dran, wa nid grad eis eso wän.» Bin eim Haar hätti är grad e Schluck trüüchen, da <hund im aber grad z'Sin, was im ächt dr Dritt weliti gän. Dar schteid mid siim Alphooren bin dr Fiirgrööben, wie wen er tröimti. Wa Menk nen fräägd, wärden im d'Wangi zintrote und wie Droslenblöömi buchten im d'Oigen. Midere Schtimm wie-n-es Gleggli seid er: «Was i-n-dr chan gän, schund gar e chliini Gab. Es ischd wäder Chrafd no Riichtum und Glanz. I han dr niid, als was dü gheerd heschd: min Schtimm, Mun (.;sang und mus Hooren. Aber das machd dr ds Härz bschtendig zfriden und gööten Mööds. Dü bes<. lid geng gnöög und bigärschd süschd niid. Wär di gheerd singen und schpilen, dän frewds. Dü wirschd Gott und allen Lii tun loibe su n.Da lied si Menk nid lang bsunnen was är wellti. «Mus Reesi lied bishar eso griisli zimpfer taan, niid cha me ds Härz erweichen wie eso e Gsang. Den wird's mus Wiib. — I will die dritt Mutten.» Flingg triichd är drüüs. Uf dsmal sun die Drii wider verschwunden. Menk schlafd umhi bis am Morgen. Aber wa d'Sunnen <hund und d'Vegel pflifen, ischd är angääns üüsi nid siim Hooren, fit z'losen ob's lüüt old hibschli gangi. Da chan är uf däm Alphooren blasen prezis wie dr Blaweigig hed <.hennen. Dir Bärg und Tal und bsunders gägen Mägisalp gheerd me die prächtige-w-Wiisi. Menk und Reesi hei-se bald zämen zweischtimmig blasen und gsungen, und ds Glut vum Veh hed gar liebli drzöö tuend.
So ischd dr Chöörejen entschtanden. Siithar jüüzen und singen d'Sennen die Wusi no geng und hei-se nid verlehrd.
Die Kristallhöhle
Eines Tages im Herbst kurz vor der Abfahrt von der Alp stieg Jaggi, der Zusenn, den Schafen nach, um sie bei der Hand zu haben, wenn es galt mit der großen Ware talaus zu ziehen. Er folgte dem Lauf des Baches das Hinterbirgtälchen hinauf. Aber keinen Schwanz bekam er zu Gesicht. er mochte lauthals sein «Bänz häl häl häl» rufen, so viel er wollte. Nur der Widerhall von den hohen grauen Flühen kam ihm zurück. So ging er Stunde um Stunde. Keine Spur von den Schafen. Und schon war's spät am Nachmittag. Auf einmal, der Jaggi wäre fast hintenübergefallen vor Chlupf, ging dicht vor ihm der Felsen auseinander, und er sah in eine große Höhle hinein. Ganz sturm und stur blieb er vor dem Loch stehen und staunte: denn da drinnen gleißte und glänzte es wie von tausend Spiegeln, in die die Sonne scheint. In tausendfältigen Farben glitzerten und blinkten von den Höhlenwänden die schönsten Kristalle, große und kleine, und alle zusammen leuchteten in einem Zauberglanz ohne gleichen. Vergessen waren die Schafe, vergessen die Tageszeit, er stand und schaute und staunte mundoffen mit großen Augen in die niegesehene Pracht. Als er sich endlich selber wieder spürte, faßte er sich ein Herz, die Höhle zu betreten. Aber um zu prüfen, ob es Blendwerk oder Wahrheit sei, was er da sehe, schlug er mit seinem Bergstock an die nächsten Kristalle. Da erklang in der Höhle hell ein Widerhall, als klirrten alle Fensterscheiben der Welt. Ihm aber schlug der Schreck in den Leib; er rannte davon, aber nach wenigen Sätzen blieb er stehen und kehrte sich um. Der Anblick hatte es ihm angetan. Und er merkte sich genau die Umgebung der Höhle, besonders an einem großen gelben Stein, der im Bächlein lag. Aber jetzt weiter den Schafen nach! Noch vor Abend hatte er sie gefunden.
Gleich am andern Morgen machte er sich neuerdings auf
nach dem Hinterberg, kam an das Bächlein, fand richtig den gelben Stein. Die Höhle aber hat er nicht wiedergefunden.
Der Schatzgräber
Im a Wald ist a Kista gsi mit Arna kostbara Schatz dry. D'Lüt händ zwor dervo gwüßt, wyl ma-n-aber albig gseit het, es hocki a fürchtigi Krott uf am Teckel, und wer de Schatz weil kriaga, müeß dia Krott dreimol abaschlaga, das erst- und d's zweitmol werd sie wider uffihoppa, und ma werdi derbei Saha g'seha-n-und g'höra, daß's eim gwüß vergengi, das drittmol au noch z'schlaga: so het's Sina ieda der Muot gno, und ieda het liaber syn Guida ruehig im Sack gha, as villicht sy Läba gwoget an a Kista voll - i weiß nid was.
Jetz amol g hort denn a jungs Pürschtli, aber an woghalsiga Kärli, au vo der Kista-n-und Krott im Wald und seit: «Bygott! i Bola der Schatz, j fürchte mi nit vor Blendwerk!» Richtig nümt er d's Herz i Heid Hend und got mitama Stecka dem Wald zua, und wia-er zwüschet de Tanna furtchlenderet, g'hört er ufeimol an wunderliapliha Gsang us der Höhi; er seit aber zua-nam selber: «I lose nit, bis i der Schatz han», und lauft wyter und findet noh-ama Wyli d'Schatzkista-n-und a fürchtigi Krott uf am Teckel. Er bsinnt si nid lang, tuet weidli a Streich und schlagt das grusig Tier aba vom Lid. Derwyle-n-aber singt's noh liebliher a's früeher in der Höhi, und d'Krott hoppet wider uffi uf d'Kista. Doch my Pürschtli nit fui und schlagt zum zweita-mol, und d'Krott hoppet noch amol uffi. Uf das nümt aber der Gsang Wysa-n-a, daß's dem Pürschtli tüf in syni jung Seel yue gryft, und er's unmögli meh verheba ka und
halt über si luaget. Do g'sieht er grad über sym Kopf a schös Maitli im a schneewyßa Röckli ufama Nebeli sitza und a Mühlistei am-a Grashalm heba. Stuhableich vor Schrecka tuckt er si weidli und lauft, was er laufa mag, durdä Wald ußi. Hett er us G'wunderfitz nit in d'Höhi gluaget und muotig noch amol gschlaga, so wär er wo! steirych worda.
Das Kind und die Krönliotter
In ein altes Haus im Steig waren vor Zeiten fremde Leute zugezogen, die bei Bauern im Taglohn schafften. Sie hatten ein munteres rotbackiges Kind. Vreneli hat's geheißen. Als das Mädchen drei Jahre alt war, gaben ihm die Eltern abends, wenn sie ihre eigenen Wiesen und Äcker bestellen mußten, ein Chacheli Milch und eine Scheibe Brot. Dann setzte sich das Kind vor die Haustüre. bröckelte sein Brot in die Milch und löffelte sie aus und vertörlete sich, bis es dunkelte und die Eltern heimkamen.
An einem solchen Sommerabend, als es schon zu dämmern anfing, kroch eine große Schlange aus dem nahen Krebsbach herauf, kugelte sich vor der Schwelle, auf der das Kind saß, richtete sich dann bolzgrad auf und nickte mit dem Kopf, gleich wie die Stadtleute es tun, wenn sie einander die Zeit wünschen. Die Otter trug ein glitzerndes Goldkrönlein auf dem Kopf. Das Mädchen staunte und wunderte sich ob dem Kleinod. Da es das Tier nicht kannte. sagte es zu ihm: Se, Busle, willst auch Milch? und hielt ihm ohne Scheu das Beckeli hin. Aber das Tier war wählerisch. schnupperte und schlapperte mit dem Maul im Beckeli herum, tappte aber nur die Milch und ließ das Brot liegen. Derweil sie trank, streichelte das Mädchen die Schlange, liebkoste sie und tändelte mit dem glitzerigen Krönlein.
Nachdem die Otter das letzte Tröpflein ausgeleckt hatte, machte sie wieder ein Nickerchen, als würde sie sich bedanken und huschte unversehens zum Bach hinab.Von da an kam die Otter jeden Abend zum Kind, lappte Milch, und Vreneli spielte und plauderte mit ihr und liebkoste sie. Immer wieder erzählte es der Mutter von einer schönen langen Katze, die zu ihm komme, mit der es spiele und die ihn« schlecke und küsse.
Die Mutter dachte, was ist das wohl mit dieser langen Katze, da scheint mir etwas nicht geheuer. Auch der Vater meinte, als sie ihm davon erzählte, da stecke sicher etwas Ungutes dahinter. Zuletzt wurden sie rätig, man müsse der Sache nachspüren.
Am Abend drauf blieb die Mutter unbemerkt daheim, nahm einen Haufen Heu, hockte damit hinter die Haustüre und lauerte im Versteck. Bald darauf kam die Otter daher und fing an Milch zu lappen. Das Kind spielte mit ihr wie jeden Abend. Als die Mutter gewahrte, wie das Mädchen die Schlange gar aus dem Löffel lappen ließ und dann den Rest selber ausschlürfte, erschrak sie und meinte schon, ihr Kind sei verloren. «Ei so verdirb, du garstiger Erdenklumpen» schrie sie und schlug der Otter das Krönlein vom Kopf. Das plumpste gerade ins Milchbeckeli. Die Otter richtete sich auf, zischte und züngelte und machte Flackeraugen, aber im Handkehrum entwischte sie zum Bach. Schnell riß die Mutter dem erschrockenen Kind das Chacheli aus den Händen und warf es in einem Schwung der Otter nach. Die Schlange sah man nie wieder.
Seit diesem Abend duldeten die Eltern nicht mehr, daß Vreneli allein vors Haus hinunter sitze. Es mußte fortan in der Küche bleiben. Lange trauerte es seinem Gespielen nach.
Später kam es in die Schule und Jahre danach erblühte es zu einer schönen Jungfrau.
An einem Sonntagmorgen war alles zur Kirche, nur
Vreneli war zu Hause geblieben. Es wird wohl derweil in der Bibel gelesen haben, denke ich. Unterdes schleicht ein Nichtsnutz übers Läubli, das von der oberen Straße zum Haus führt, und durchsucht und durchstöbert das Haus vom Estrich bis zum Keller. Vreneli hört's und schließt schnell seine Kammertüre. Nicht lange geht's, da steht der Nichtsnutz vor der Tür und fängt an, am Schloß herumzunäggeln. Vreneli verdatterte schier vor Angst. Als das Türschloß nicht nachgab, stieß der Unflat mit den Füßen an die Türe, daß es nur so polterte. Vreneli in seiner Angst schrie um Hilfe. Aber weil niemand zugegen war, konnte ihm niemand helfen. Da, als die Türe krachend durchbricht, fängt es in der Kammer an zu sausen, pfeifen, chroslen und wispern. Aus allen Löchern und Fugen schießen Ottern hervor, grad wie wenn sie kübelweis hereingetragen worden wären. Darob erschrak der Eindringling, daß ihm windelweich wurde, und als die Schlangen gar auf ihn zufuhren, zischten und gegen ihn züngelten, nahm er reißaus, als ritte ihn der Teufel.Ehe Vreneli aus seinem Schreck wieder zu sich gekommen war und erlöst aufatmete, waren die Ottern verschwunden.
Seit dieser Zeit heißt das Haus im Steig das Otterngut, und so ist es bis auf den heutigen Tag genannt.
Die seltsame Spinnerin
Auf den Spinnstubeten an den langen Winterabenden, wo das Weibervolk mit Kunkel und Rädli, die Mannsleute mit ihren Tabakspfeifen sich einfanden, um zu plaudern und zu scherzen, kam allabendlich auch ein altes Mütterchen. das niemand zu bemerken schien. Stille setzte es sich mit
seinem Rocken in die hinterste Ecke, wo es fleißig spann, bis die anderen spät in der Nacht sich auf den Heimweg machten. Nie sprach das Mütterlein ein Wort, mochte noch so viel erzählt, gelacht und gescherzt werden.Unter den Mannsleuten war auch ein junger Bursche, der Kopf und Herz auf dem rechten Fleck hatte. Während die anderen jungen Leute mit den Mädchen schäkerten, mußte er immer wieder zu der alten Frau hinsehen, er wußte nicht warum. Das ging so drei Winter lang. Da war wieder einmal alles des Abends in der Stube beisammen, und wieder schaute der Bursche ganz versonnen der alten Spinnerin zu. Da ward er aufs Mal inne, daß sie das Spinnrad verkehrt drehte. Er rückte näher und näher zu, setzte sich neben sie, schaute ihr lange zu und sagte dann: «Immer links herum, Mutterli?» Da fuhr ein heller Strahl wie ein Sonnenblick über das verwitterte Gesicht der Alten. Sie stand auf und winkte dem Burschen heimlich mit der Hand, daß er sie begleite. Schweigend wanderten die beiden miteinander in die Nacht hinaus. Das Mutterli schritt bald vom Wege ab über Äcker und Wiesen bis an ein einsames Gehölz. Da blieb sie stehen und sprach: «Undenkliche Jahre hab ich gesponnen, stets links herum. Du bist der erste, der es endlich bemerkt hat zu meinem Heil. Ein reicher Lohn soll dir werden. Grabe Morgen hier an dieser Stelle. Was du findest, gehört dir.» Mit diesen Worten war sie verschwunden, wie ein Nebelstreif im Wind.
Am nächsten Morgen ging der Bursche mit Hacke und Schaufel an den Ort, grub auf und hob einen großen Hafen voller Gold- und Silbertaler aus der Erde. Der brachte ihm Glück und Segen. Er ist hoch betagt gestorben als der reichste Bauer des Dorfes, betrauert von den Armen der Gemeinde.

Frau Ude
In jener uralten Zeit, in der in den Tälern des Berner Oberlandes noch die Sitte herrschte, daß sich die Jungfrauen von allen Jünglingen streng zurückzogen, kam zu jedem sich folgenden Menschengeschlechte aus dem wildesten Hochgebirg eine steinalte, graue, von den Jahren gebeugte Frau, die Frau Ude, die Gute hieß. Seit Menschen jenes Gelände bewohnten, hatte sie daselbst gehaust. Aber niemand kannte das Obdach, wo sich die Alte während der Zeit ihres Fernseins aufhielt. Frau Ude die Gute sah scharf und war an seltenen Künsten reich. Geschäftig trippelte sie von Hütte zu Hütte, lud alles Hausvolk an die Tür, griff den Mädchen an's Kinn, sah sie mit blinzelnden Luchsaugen an und endigte jedesmal mit dem Reimen:
Du, du, du, ja du! Diesmal wieder Ruh! - Hätt' ich keine funden mehr. Litt ich siebenmal so schwer. |
Dann nahm sie lächelnd das Mädchen bei der Hand. zu dem sie den Spruch gesagt, und trippelte weiter, und allemal ohne zu fragen, ohne zu zaudern geradehin nach dem Hause des reichsten und besten und schönsten der Junggesellen im Tal, und dem legte sie die Hand des Mädchens in die Rechte, sah ihn nickend an. und hinterließ im Herzen des Junggesellen eine innige Liebe zu dem Mädchen, das sie dergestalt ihm vorgeführt hatte. Und allemal war eine glückliche Ehe zwischen den beiden; das gesamte Talvolk jubelte. Jedermann lud sich zur Hochzeit ein, und niemals hat irgendein Vater, irgendeine Mutter die Wahl der Frau Ude für Sohn oder Tochter abgelehnt, denn jedesmal war das Mädchen als die Reinste unter den Reinen im ganzen Talgelände erfunden, der Jüngling als der Beste von den Besten.
Der Milchriemen
Vor alten Zeiten lebte im Grund eine Frau. die konnte am Riemen ziehen. Das geschah so. Sie ging in den Stall, zog zwei Lederriemen durch die Barrenlöcher und nannte die Kühe ihrer Nachbarn bei dem Namen und sagte:
«Herrengut und Sennenzoll, Von jeder Kuh zwei Löffel voll.» |
Dann stellte sie eine Melchter unter die Riemen und tat als ob sie Kühe melke. Bald füllte sich die Melchter mit herrlicher Milch. Die Nachbarn merkten aber nicht das mindeste, daß ihre Kühe weniger Milch gaben. Die Frau verteilte die Milch an die armen Leute des Dorfes und namentlich an kleine Kinder und war so eine geliebte Wohltäterin.
Da stach der G'wunder einen Nachbar, wie die Frau zu so viel Milch komme, da sie doch nur eine einzige Kuh halte. Er schlich sich heimlich in den Stall und versteckte sich darin. Bald kam auch die Frau und stellte die Melchter unter die Riemen, machte mit der Hand ein paar Zeichen, sagte den angeführten Spruch und fing an zu melken. Sofort füllte sich die Melchter mit Milch, worauf die Alte den Stall verließ.
Der Nachbar hatte sich den Spruch wohl gemerkt und die Zeichen und lief voller Freude nach Hause, um das einträgliche Stücklein zu probieren. Aber mit zwei Löffel voll war er nicht zufrieden und sagte:
«Herrengut und Sennenzoll, Von jeder Kuh zwei Kübel voll.» |
Da floß nun die Milch in Strömen, daß bald der Stall und das ganze Haus davon voll war und er gar elendiglich ertrinken
mußte. Das hörte die alte Frau. Sie wurde darüber so entrüstet, daß sie ausrief:«Das tut mir keiner mehr nach!» und den Zauber verwünschte. |
Das geschah in der guten alten Zeit. Seither ist diese Kunst verloren.
Das Stollen-Hauri
Von der Bahlisaip fließt der Lauibach ins Tal. In alten Zeiten nannte man denselben die «Gynlauine». Er floß untenher dem Alpwald durch den sogenannten Bärengraben nach Unterfluh und dann in seinen jetzigen Lauf. Oben am Stollen hatte der Stollen-Hans ein kleines Häuschen, wo er mit seinen Ziegen das ganze Jahr zwar einsam und bescheiden, aber mit Wenigem zufrieden und vergnügt lebte. Einmal kam der Bärengaden-Bauer und der Melk im T'wing zu ihm und versprachen ihm eine hübsche Ziege, wenn er der «Gynlauine zweghelfe», daß sie einen andern Lauf bekomme. Eine schöne Ziege mehr, das war für den Stollen-Hans ein großes Vermögen. In einer düstern Nacht hackte er das ganze Port durch und ehe es Morgen war, stürzte der wilde Bergbach nach dem Hohfluhdorf hinunter. Vielen verschüttete er die Äcker und manch Häuslein und Scheuerlein liegen unter seinen Trümmern.
Nun ging alles hin und wollte den Bach wieder in seinen alten Lauf bringen, aber es gelang nicht mehr. Der Bach hatte schon eine so tiefe Runse eingefressen, daß menschliche Arbeit keinen so großen Damm aufzuführen vermochte. Nun wurde der Jammer und das Herzeleid der armen
Leute noch größer. Eine arme Witwe, welcher der Bach das Häuschen mit allem was sie hatte weggeschwemmt, verwünschte den Bach. Dem Stollen-Hans, der dies Unglück sah, wurde es schwer ums Herz. Seine Freude war dahin. Er hatte weder Ruhe noch Rast und zog in fremde Lande. Man hat nie mehr etwas von ihm gesehen und gehört und weiß nicht, was aus ihm geworden.Aber wenn am Giebel Nebel schleichen und aufsteigen und der Hochstollen eine graue Haube anzieht, so tönt's und ruft's schaurig im Lauigraben und am Stollen: «Hojo, hoho, Bojo!» Dann ruft die Mutter die Buben herein, weil das Stollen-Hauri vor dem schwarzen Wildwasser warnt. Die «Gynlauine» schwillt dann kurz darauf an und prasselt Verderben drohend ins Tal.
«Der Bach chunt, der Bach chunt: Sind mini Bueben ahi g'sund? Ja-Ja-Ja. Der Bach ist da, der Bach ist nah', Sind mini Bueben alli da? Ja, Ja, Ja.» |
Der Chnab ufern Fluß
Es ischt emol en Chnab im e Schiffli me gsässe-n-und gfahre-n-ufeme Fluß, wo vil breiter gsy ischt weder d'Töß. Er hät welle-n-überdure zu syre Liebschte, eme gstaats Mäitli, wie's wyt und breit ekeis meh gha hät. Wo-n-er i d'Mitti use cho ischt, so hät er öppis ghört rüefe, wie wänn öpper am Vertrinke wer. Er lueget urne und gseht en ahi Frau zable, wo's Wasser am tüüfschten ischt. Er git aber nüt drum und ficht, se vil er mag, das er bald überänne seig. Die
Stimm rüeft äisig no, aber vil lysiger und schwecher. Underdesse schwimmt die alt Frau hert am Schiffli durre-n-und durab, und's Rüefe nimmt en And.Aber äismols, chuum e paar Chiofter vom Schiffli ewäg, stygt öppis usem Wasser uf, wie-n-e wyßes Näbeli. 's ischt e Wyb, aber kä b'rumpfeni Alti, näi: 's schönscht Mäitli, wo me hett chönne gseh, no vil, vii schöner, als syni Liebschti, wo scho dänne bym Wuer gschtande-n-ischt und gwunken-und planget hät. De Chnab achtet's aber erscht, wo das Mäitli uf cm Wasser rüeft: «Fahr alliwyl, fahr zue in Ebigkeit!» Wo-n-er umelueget, se gseht er, wie die schöni wyßi Frau langsam durabschwimmt, wie-n-en Schwan. Und im wird's öd und bang um's Herz, s'ischt nid zum säge; e gränzelosi Sehnsucht chunnt über ne no dem frömde wyße Mäitli; und er vergißt sy Liebschti däne-n-am andere Bort und ruederet der Frömde nohe, wo äisig glychwyt von im ewäg vorusschwimmt und nüd loset, wie-n-er jez rüeft und ahalt. sie seil cm warte. Nu dann und wann chehrt si ihres Gsicht. 's helischt wo me hett chönne gseh, gäge-n-im zue - aber nüd früntli, sondern gar ernscht und bös.
Und dewäg isch dänn de Chnab durabgfahre Tag, Wuchen und John lang; aber das frönd wyß Mäitli hät er nie mögen erlange, und eso ischt er gfahre svs ganz Labe dur bis i d'Ebigkeit je.
Der wild Jeger
I der Nächi vo Aarwange isch es Guet, Moosberg heißt es; dört het vor alte Zyte-n-e Freiherr gläbt. De het nid chönne sy und läbe, ohne uf d'Jagd z'ga, und het doch nie öppis schieße chönne. Er het gjagt, syg Sundi gsi oder Wärchti, und mit sym Jagdgfolg isch er dür die schönschte Chornfälder
gsprängt, und het mit bösem Übermuet zerstört, was syni Pure mit Müe und schwärer Arbeit pflanzt hei. «Lueg», het im sy Frou mängisch gseit, «du versündigescht die a de Mönsche und gege Gott!» Aber er het nid welle lose, und mängischt sy die arme Pure cho und sy uf in Chneu nidergfalle und unger Träne hei si-n-e bäte, er möcht ne doch in Saate schone; aber alls het nüt ghulfe. Svs Härz isch halt hert gsi wie-n-e Stei.Einischt, wo-n-er wider het wölle-n-uf d'Jagd, het-n-e d'Frou wider ermahnt, deheim z'blybe, si wüssi wohl, daß er aber nüt hei bring und d'Fälder träge so schöns Chorn, und's wär doch schad, wenn er das jez alls mit syne Rosse vertrampi. Do het de Ritter agfange-n-ufbegäre-n-und flueche und seit: «Vo der Frou b-n-i mer nit befäle und jez wott i uf d'Jagd, und's Donnerwötter söll mi erschlo, schieße-n-i hüt nüt!» Das Wort isch gsproche gsy und der Himmel het's ghört.
Der Tag über isch grüsli heiß gsy; der Himmel im Wätterloch het sich überzoge mit schwarze Wulke und es gfürchigs Gwitter isch cho. D'Chnächte händ de Freiherr gmahnt und zu-n-im gseit, er möcht doch hei go, es chöm es böses Wärter. Aber er het si nüt dra gchehrt. Es het im numme-no me gfalle, wenn's so rächt gchrachet und tschätteret het und isch halt wyter gritte. Aber o weh! — wo-n-er grad uf ene Hirsch wort aschlo, do chlepft's, wie no nie so, und tot nidergstreckt vom Blitz erschlage isch er am Bode gläge.
Syder ghört me no jez gäng, wenn's anger Wötter wott gä, im nämlige Wald jage; dütli ghört me, wie d'Hüng bälle-n-und d'Jagdhörner rüefe.
Zwiesprache mit dem toten Bräutigam
Ein Bursche und ein Mädchen aus Platten hatten sich lieb. mußten sich aber noch verdingen, ehe an eine Heirat zu denken war. Als sie voneinandergingen, machten sie aus, wer in der Zeit zuerst sterbe, solle sich dem andern bei der Kapelle von Platten offenbaren. Der Bursche starb, dieweil das Mädchen in Sitten als Magd diente. Nachdem es vom Tode seines Liebsten vernommen, spürte es immer wieder, wie etwas an seiner Schürze zupfe. Die Jungfrau ahnte, was das bedeutete, wagte aber nicht, nach Platten zu gehen. Vor Kummer und Leid ward sie schwermütig. Schließlich klagte sie einem Priester ihre Not. Der riet ihr, ohne Verzug ins Heimattal zu gehen und den Toten, der sie erwarte, anzureden.
Betend nahte sie der Kapelle und gewahrte in der Abenddämmerung ihren Liebsten am vereinbarten Ort. Lange sprachen sie miteinander. Was das Mädchen vernommen, bewahrte es in seinem Herzen. Nie hat jemand ein Wörtchen davon erfahren.
Fortan ward die Jungfrau noch ernster und stiller und erzählte nur, der Geist habe ihr gesagt, es sei gut gewesen, daß sie gekommen sei, denn er habe schon lange auf sie gewartet, sonst hätte er sie umbringen müssen.
Das Büblein und das Vögelein
Es ist nun schon manches Jahr her, da kehrte eines Tages zur Mittagszeit der Bub von wackern Schnitzlerleuten aus der Schule heim. Er mochte wohl dreizehn Jahre und darüber sein. Als er das Hofstettli neben dem Hause betrat, hörte er aufs Mal einen Vogel so seltsam singen, daß er still stand
und staunte und lauschte. Das Vögelein sang so schön, so schön. Das mußte die Mutter auch hören, eh ja! Und er lief zu ihr in die Küche: «Mutter, Mutter, komm! Oh wie singt im Hofstettli ein Vögelein, so schön! so schön!» Aber die Mutter hatte gerade die Suppe aufgesetzt und keine Zeit zuzuhören, wie die Vögel pfeifen.Da lief der Bub weiter zum Vater, der in der Laube vor der Wohnstube schnitzelte. «Oh Am. Ätti, hör doch, wie das Vögelein singt! Eh singt das jetzt schön, so schön!» Der Vater kam dem Bub zulieb herunter, und beide gingen in die Hofstatt. Da stand der Bub still und staunte und lauschte, und die Wangen wurden ihm glühend heiß. «Hörst du's Ätti, hörst du's?» Nein, der Ätti hörte es nicht. Ein Schild vogel pfiff oben auf dem Dachfirst sein altvertrautes tägliches Liedlein: «Zied, zied, zied, cheust mi nid fahn!» Aber um dem Buben die Freunde nicht zu verderben, tat der Vater, als höre er den wundersamen Gesang auch. Zu innerst inne in sich aber war er tief erschrocken. Mit rechten Dingen, deuchte ihn, konnte das nicht zugehn.
Wenige Tage darnach wurde der Bube krank, ach so krank! Da hat kein Doktor mehr helfen können. Und eh die Sonne das dritte Mal zu Gold ging, war er tot.
Der tote Hirte und die Kuh
Einst zogen drei Jäger ins Turtmanntal auf die Jagd. Als es nachtete, suchten sie einen Unterschlupf und legten sich schlafen. Bald erwachte einer weil ihn fröstelte. Da hörte er kollern und poltern und bald darauf einen dumpfen Schlag. Er spähte scharf hinaus, vermochte aber in der Dunkelheit nichts zu unterscheiden. Weil ihm unheimlich ward, weckte er seine Kameraden. Eben brach der Mond durchs Gewölk.
Da gewahrten sie auf dem andern Talhang oben über einer Felswand einen Mann, der eine große Last hinunterwarf. Sogleich stieg er eilig haldab, so daß Grus und Grien ins Rollen kamen und schleppte die Bürde auf seinem Rücken keuchend wieder bergauf. Sagte einer der Jäger: «Wir sind zu dritt und brauchen uns nicht zu fürchten. Wir wollen einmal hinübergehen und den Mann stellen und fragen, was er treibt.» Sie spürten, wie sich ihnen die Haare sträubten, als ihnen der Geist antwortete: «Ich bin vor vier Jahren Hirte gewesen oben auf der Alp und habe diese Kuh über den Felsen hinuntergestürzt, weil ich dem Sennen gram war wegen eines Mädchens. Auf dem Todbett hab ich's der Mutter gebeichtet und sie gebeten, den Schaden wieder gutzumachen und den Sennen zu entgelten. Bis die Kuh bezahlt ist, muß ich sie Nacht für Nacht über den Felsen stürzen und wieder hinauftragen bis der Morgen graut. Ich bitt Euch, sorgt doch dafür, daß der Eigner entschädigt wird.» Die Jäger versprachen es zu tun. Als sie ins Tal kamen, suchten sie die Eltern des Verstorbenen auf und gaben Bericht. Der Vater wollte zuerst nichts damit zu tun haben, schließlich aber bezahlte er auf Bitten der Mutter dem Sennen die Kuh. Von da an war der Geist erlöst.
Die Tennenbozen bei Wyler
In Tenn hatten sich ein Bursche und ein Mädchen lieb und trafen sich öfter heimlich in einem abgelegenen Stadel. Als das Mädchen ein Kind gebar, warfen sie es in die Schlucht des Tennbachs, der tosend neben der Hütte zu Tal stürzte. Nicht erbarmte sie, daß das Kind schrie und flehte. im Rauschen des Baches ging das Schreien unter.
Der Frevel blieb verborgen und fand keinen Richter.
Doch nach Jahr und Tag, nachdem die beiden Personen gestorben waren, mußten sie zur Strafe umgehen. Wenn die Hirten am Stade! vorbeigingen, sahen sie in Vollmondnächten zwei altväterisch gekleidete Personen aus dem Stade! treten, unter Wehklagen zum Bach gehen und sich ins Wasser stürzen. Nach einer Weile kehrten die beiden schlotternd zurück und verschwanden unter Klagen und Seufzen im Stall. Der Besitzer des Stadels fand dann des Morgens immer zwei Kühe an einer Kette zusammengebunden.Das ging so lange Jahre. Schließlich erbarmte sich ein Hirt der beiden Büßer und holte einen Pfarrer, der die Kraft besaß, umgehende Geister zu bannen. Von da an kamen die beiden zur Ruhe, kein Mensch hat sie je wieder gesehen.
Seltsame Begegnungen
In Gestelen im Lötschental hirtete ein hablicher Bauer jeden Winter eine zeitlang sein Vieh im Stall auf dem Maiensäß. Als er einst die Schafe hinauftrieb. schlich ein Wolf daher und fletschte gierig die Zähne. Der Bauer dachte: Besser ist, freiwillig einen kleinen Schaden leiden als Ungewisses zu wagen, und warf das kleinste Schaf über die Felsen. Der Wolf sprang ihm nach und fraß es auf.
Im Herbst drauf unternahm der Bauer eine Wallfahrt zur Mutter Gottes nach Einsiedeln. Der Wirt. bei dem er einkehrte um zu nächtigen, behandelte ihn mit auffallender Höflichkeit. Als der Bauer am Morgen die Rechnung verlangte, sagte der Wirt, er sei ihm nichts schuldig, die Rechnung sei beglichen. Der Bauer wehrte ab, er begehre keinen Almosen, er vermöge wohl zu zahlen. «Nun denn», sagte der Wirt, «ich will dir erklären, warum ich nichts von dir verlange. Erinnerst du dich? Letzten Vorwinter hast du
die Schafe zum Füttern auf die Alp getrieben und einem hungrigen Wolf eins zum Fressen hingeworfen. Der Wolfdas bin ich gewesen. Wir hatten auf Schattenhaib eine Hexenzusammenkunft und danach hat sich jeder nach Belieben in ein Tier verwandelt. In der Gegend unbekannt, verirrte ich mich. Hätte ich nicht eins deiner Schafe zu fressen bekommen, ich wäre vor Hunger umgekommen. Das nahm ich als Warnung; seitdem gehe ich nie mehr zu solchen Zusammenkünften.)>
Der Ritt auf dem Teufel
Ein Bauer aus Naters ging an einem Sonntag auf Sitten. Bei der großen Brücke traf er den Pfarrer Schluns an: «Gott zum Gruß», sagte der Mann, «Ihr seid auch hier, dann gehen wir miteinander nach Hause!» Der Pfarrer erwiderte: «Ja, aber ich hab's eilig, jetzt ist schon Mittag, und ich muß heut Abend in Naters noch Vesper halten!» «Ja, wie in aller Welt wollt Ihr denn das anstellen, das ist ja eine gute Tagereise!» «Das wirst du dann schon sehen», sagte der Pfarrer, «wir reisen ja zusammen!»
Als der Bauer seine Geschäfte besorgt hatte, ging er vom Leukertor zum Plattenstutz, wo der Pfarrer schon auf ihn wartete. Da stand ein schönes, glänzig schwarzes Pferd. Der Pfarrer sagte: «Jetzt sitze ich in den Sattel, und du kannst dich hinten auf die Kruppe setzen. Du darfst dir aber während des Rittes weder Gutes noch Böses denken, sonst geht es nicht gut!» Der Bauer dachte, das werde sich schon machen lassen, und saß hinten auf. Der Pfarrer zog die Bügel an, und der Gaul stob staubvomboden davon. Das ging wie der Wind und sauste und brauste dem Bauer um die Ohren. daß ihm schier sturm wurde. Da dachte er bei sich:
«Jesses, Jesses, wie geht das!» Da lag er schon am Boden, und als er wieder zu Sinn und Gesicht kam, fand er sich auf dem Glisersand zwischen Gus und Vispach liegen. Er war also schon fast gar am Ort.Zu Naters ging er zum Pfarrer. Der hatte seine Vesper schon gehalten. Der Bauer sagte: «So wie Euer Gaul heut gelaufen ist, hab ich noch keinen traben sehen!» «Was hast du gedacht?» fragte der Pfarrer. «Jesses! Jesses, wie geht das!» hab ich gedacht, —da lag ich auf dem Glisersand!» Da sagte der Pfarrer: «Mit dem Gaul bin ich schon oft gefahren, und damit fahre ich noch lange.»

Der Geißbub auf der Martinswand
Vor Zeiten dingten die Bauern im Wartau alle Jahre einen Buben aus den Triesnerbergen, damit er ihnen sommersüber am St. Martinsberg die Geißen hüte. Mehrere Jahre nacheinander hatten sie den Wisi, den Sohn einer Witwe, zum Geißler gewählt, denn er verstand sich vortrefflich auf die Tiere.
Einmal nun, um den ersten Maientag war's, da zog der Wisi mit seiner schellenden Schar äsend haldan über Weiden und Schrunde und kam unversehens bis auf die Höhe über die Martinswand. Es ging gegen Mittag, die Geißen hatten genug gefressen, jede suchte unter Steinen und Felsen ein kühles Plätzchen und legte sich hin, gemächlich wiederkäuend. Nur die Gitzi waren noch munter. Die sprangen und hüpften auf Felsköpfe, putschten gegeneinander oder zupften da und dort noch ein Gräslein ab an Stellen, wo sie kaum hinlangten. Von Zeit zu Zeit, wenn etwa eine Stechfliege oder eine Bremse kam, schüttelten die Geißen den Grind, und da erklangen Schellen und Glöcklein. sonst war es stille und feierlich wie in einer Kirche.
Jetzt stellte sich der Geißler zu äußerst auf die Wand hinaus, schwenkte sein Wetterhütchen und jauchzte. Am gegenüberliegenden Berg tut ihm von der Kuppe ein Mädchen kund. Er jauchzt noch einmal hinüber und von der Kuppe jauchzt's zurück. Das wird nur der Widerhall sein, dachte er, legte sich ab und äugte scharf gegen die Kuppe; aber es zeigte sich niemand, weder Bub noch Mädchen. Während er so lagernd ins Land schaute, entschlief er.
Im Traum kam ihm vor, als träte ein Mädchen vor ihn hin in einem Röcklein aus schneeweißer Seide mit feuerroten Flatterbändern dran. Auf dem Kopf trug es ein Strohhütchen. Das sagte zu ihm, heute sei Chilbi weit fort in einem prächtigen Schloß bei reichen Herren und vornehmen Damen. Es suche nur noch einen Tänzer. «Du wärest mir
grad recht. Komm mit mir.» Juhui, jauchzte es, grad wie's von der Kuppe getönt. Aber der Wisi lachte und sagte: «Du Häxenärrli, was denkst du auch? Ich, mit meinen plätzeten Hosen, den ausgefransten Hemdsärmeln, dem verblichenen Hütlein und ohne Strümpf und Schuh? Zu vornehmen Herren und bildhübschen Damen hast du gesagt? Ha, ha, da könntest du dich meinen mit mir!» «Bah, bah, ich staffiere dich schon aus, das ist das mindeste. Du wirst staunen: alle haben die gleiche Montur!» «Aber meine Geißen, meine Geißen. Die Geißvögtin kann toben wie das Unwetter!» «Oh, das geht sauber und glatt. Ich schicke meinen Knecht in deinen Hösli und deinem Hütchen, die kannst du in der Zeit entbehren, und ich wette soviel du willst, sie merken nichts. Aber eins sei dir gesagt: es mag geben, was es will, kein Wörtchen darfst du sagen, kein Wörtchen. Sonst bhüetis -ist's aus mit der Chilbi. Hast du mich verstanden?» «Ja, ja», antwortete der Wisi, «wenn's nur an dem liegt, komme ich schon mit. Mich dünkt, du werdest mich nicht fressen und schweigen kann ich.»Jetzt nimmt das Mädchen ein Nastuch hervor, ein schwarzes, spreitet's im Gras aus und sagt zum Wisi: «So, jetzt sitz drauf.» Er folgt ihm und es streicht mit einem Haselrütchen um ihn herum und brümmelt dazu. Dann sitzt es dem Wisi auf die Hosen und schlingt die Arme um seinen Hals. Dem Geißbub ist's, als bekäme das Nastüchlein Flügel. Im Flug geht es über Vilnas, übers Rheintal, den Bodensee, über Dörfer und Städte, über Felder und Wälder. Bei einem schneeweißen Schloß setzt sie der Fazenettlidrache ab. Von allen Seiten rücken Gäste heran, auf schwarzen Böcken trabten sie daher auf alten Geißen oder ritten auf Besenstielen und Ofengabeln durch die Luft. Andere kamen als schwarze Katzen, rote Hunde, Füchse oder weiße Hasen. Im Saal oben ertönte schon die Musik. toller und lauter als an einer Hochzeit. Das Mädchen packt den Wisi am Arm und hui, springt's treppauf in den Saal, daß
es nicht zu spät komme. Wie es so schräg vor ihm hinaufeilt, sieht er, daß das Mädchen nichts mehr an sich hat als das Strohhütchen.Wie sie in den Saal treten und er das nackte Volk sieht, schaut er beschämt an sich hinunter und erschrickt: ja, ja, alle haben sie die gleiche Montur.
Mitten im Saal war eine Art Bühne. etwa zwei Fuß hoch. Darauf stand ein Tisch mit einem großen goldbeschlagenen Buch. Darin mußten sich alle neuen Gäste einschreiben mit ihrem Blut. Ein großmächtiger Herr in einem schwarzen Mantel und einem riesigen Schlapphut schaute, daß alle es recht machten. Konnte einer nicht schreiben, kratzte er mit der Hühnerfeder das Zeichen eines Hahnenfußes und der Große schrieb daneben seinen Namen.
In einer Ecke spielten vier Musikanten auf. Eine solche Weise hatte der Wisi noch nie gehört, es hat ihn grad gelüpft und mitgerissen. Um die Bühne herum wirbelte und tanzte das wilde Volk, Arme und Beine verschlungen wie außer sich und lachte und jauchzte wie lätz.
Den Wänden entlang standen Tische mit köstlichen Speisen und kühlen Trünken. Der Wisi war hungrig und hätte gern zugegriffen, aber anständig wie er war, wollte er sich erst in dem großen Buch einschreiben. Aber das Mädchen ließ ihn nicht fort, das pressiere nicht halb so, man könne es immer noch machen. «Komm nur, komm, jetzt wollen wir tanzen.» Wie in einer Trülle dreht es ihn wieder in den Ring, sie springen und fliegen im Wirbel wie die andern alle bis der Wisi nicht mehr weiß, wo er ist. Nach einem Kehr führt ihn das Meitschi aus dem Ring zu den Tischen und reicht ihm selber das Beste dar. Aber statt Salz streut es ihm «Lauf-mer-nach» drauf, eine tüchtige Messerspitze voll und statt Brot reicht's ihm «Bischgrad-mi». Es schenkte ihm auch ein, alipott und grad wieder, aber keinen Wein, sondern Paradiesapfelsaft. Der Wisi hat gegessen und getrunken und bekam je länger desto mehr Hunger
und Glust. Er schaute und staunte. Dieses Getümmel und diese Pracht! Und sein Mädchen, wie die liebe Sonne. Wenn er auch hätte reden dürfen, er hätte kein Wort hervorgebracht vor Staunen und Schauen.Nachdem sie gegessen hatten, springt das Mädchen auf wie ein Blitz: «Komm, komm. Jetzt wollen wir wieder einen Tanz drehen, aber ganz einen tollen Kehr, bis wir nichts mehr wissen von uns und die Welt im Nebel verschwimmt!» Kaum begonnen, muß das Mädchen niesen. Treuherzig sagt der Wisi, wie seine Mutter daheim, wenn er selber niesen muß: «Helf dir Gott!» Da - ein Donnerschlag - alles ist wie weggeblasen. Still ist es, wie in einem Grab, und der Wisi erwacht mühsam unter der Martinswand, erfaßt noch grad, wie er durch die Äste der mächtigen Tannen auf den Waldboden purzelt. Aber merkwürdig! Das Gesicht hat's ihm ungehörig verkratzt und den Haarschopf verstrubbelt, sonst ist kein Knöchli gebrochen. Kein Schranz in der Haut. Nur die Hösli sind verrissen.
So saß er im Moos und mußte sich besinnen, wie er dahin gekommen und was ihm geträumt. Alles drehte sich ihm noch ringsum, als säße er in einer Trülle. Aber wie auf der Wand oben ein Gitzi zuäußerst am Bord steht, den Hals streckt und meckert, als riefe es der Mutter, da tagete es ihm: «Ja, ja, von dort herunter kam ich, drei Kirchtürme hoch!» Es schauderte ihn. Als hätte er Blei in den Knochen, steigt er durch die holprige Gaß hinauf, zurück auf den Martinsberg zu seiner Geißenherde.
Von seinem Traum und seiner Fahrt ins Tal sagte er keinem Menschen ein Wörtlein. Aber wie er im Herbst in die Triesnerberge zu seiner Mutter heim kam, da hat er ihr alles haargenau gebeichtet. «Herr Jesses, Herr Jesses! Du hast Glück gehabt, ein unerhörtes Glück. Dem Tod entronnen bist du und dem leibhaftigen Teufel auch noch. Dafür solltest du wallfahrten zur Mutter Gottes nach Einsiedeln, in jedem Winter, deiner Lebtag, das wäre sicher nicht zuviel!»
Aber wie es so geht, die Mutter konnte nicht schweigen. Dieser und jener Base erzählte sie es in strengem Vertrauen. Für die einen war der Bub ein Meerwunder. die anderen sagten, es habe ihm alles nur geträumt, die Tüfelschilbi samt der Fahrt über die Martinswand. Über diese Wand hinaus sei er und sei nicht z'Hudle und z'Fätze? Man schaue nur hinüber, das möge glauben wer wolle.
Das Gerede verdroß den Wisi. Er hatte nie gelogen oder irgend etwas größer gemacht als es gewesen ist. Drum wurmte es ihn, als ihm ein hablicher Bauer sagte, wenn das wahr sei, so solle er's beweisen und noch einmal über die Wand hinaus. Komme er heil davon, gebe er ihm das schöne rote Chueli. — Der Wisi nahm an.
Am Sonntag drauf gingen sie ins Wartauische hinüber auf den St. Martinsberg. Als sie über der Wand standen, hielt ihn der Bauer mit verkrampften Fingern zurück und rief: «Nein, tu's nicht, das ist Gott versucht, da muß einer erfallen!» Der Wisi lachte und sagte: «Du hast scheint es Angst um dein Chueli», reißt sich los und springt in die Tiefe.
Aber dieses Mal haben ihn die Äste nicht gehalten und getragen, hinunter sauste er wie das Wasser im Rhein. Im Wald unten ein Schrei, und ein Widerhall hoch oben in der Kuppe.
Der betrogene Teufel
Zu Peist im Schanfigg saß einst noch spät in der Nacht in einem Hause eine Knabenschaft zur Dorfete beisammen und alles war fröhlich und guter Dinge bei Spiel und Scherz. Da trat plötzlich ein Fremder ein, der fragte um Herberge und einen Nachttrunk, und tat gar freundlich und vertraut mit
den lustigen Burschen. Die luden den Mann ein, nur zuzusitzen und wacker mitzuhalten beim Bechern und Kärteln, und immer leutseliger tat der Fremde. Auf seinen Wink wurden die Gläser immer wieder und wieder gefüllt und zuletztamend erbot er sich gar, unterm lauten Jubel der munteren Runde, die ganze Zeche zu zahlen, wenn der unter ihnen, der zuletzt durch die Türe gehe, ihm fürderhin mit Leib und Seele dienen wolle. Und überdies wolle er jedem noch einen Beutel voll Gold zum Andenken verehren, daß er auf lang und längst genug zu leben habe.Wie die Burschen das hörten, da wurden sie aufs Mal wieder ganz nüchtern und schauten einander erschrocken an, denn nun merkten sie endlich, mit wem sie's da zu tun hatten, und aller Mutwille verstummte. Der Teufel macht anfangs stark und hinterdrein verzagt, und man bittet ihn nicht ungestraft zu Gaste; denn er ist leicht einzuladen, aber schwer los zu bekommen. Und nun war guter Rat teuer; denn den Teufel herbergen kostet einen klugen Wirt.
Es war aber einer unter ihnen, der hieß nur der kleine Peterli, der war nicht auf den Kopf gefallen, und was er sagte, hatte Hand und Fuß, und was er tat, geriet ihm allemal wohl. «Traun, wer mit dem Teufel essen will, muß einen langen Löffel haben», dachte er bei sich. «Aber wir wollen erst noch sehen, wer den längeren hat.» Und lauthals tiefer: «Abgemacht, guter Herr, es soll gelten. Aber gebt acht, daß ihr bei dem Handel nicht zu Schaden kommt, sonst braucht ihr für den Spott nicht zu sorgen. Also vorwärts, Knaben! Getrost das Licht gelöscht! Und der Letzte, der die Stube verläßt, geht mit dem Herrn!» Die Lichter wurden gelöscht und der Böse stellte sich an die Türe, daß er den Letzten packe. Der Mond schien hell und heiter weit in die Stube herein, und doch graute den Burschen, daß sich ihnen das Haar auf dem Kopfe sträubte. Der Peterli aber machte, daß er der Letzte in der Reihe war. Bereits standen alle die andern schon draußen im Freien, und eben wollte der Böse
sich auf ihn stürzen. Aber der Peterli war nicht link: er zeigte auf seinen Schatten an der Wand und sagte ganz ruhig: «Nu gmach, döt chunnt my Hinderma!» Der Teufel ließ ihn los und wollte sich über den Hintermann hermachen. Im Schwick war der Peterli über der Schwelle. Der Satan aber fuhr mit einem wüsten Stank davon. Mit den Peistern hat er seither nichts mehr zu schaffen haben wollen.
FENGGENGESCHICHTEN
Der Zwergenprinz und die Müllerstochter
Es war einmal - aber das ist schon lange lange her - ein Zwergenkönig namens Pizzipazzi. Der sprach eines Tages zu seinem Sohn. dem Prinzen Zwitzizwätzi: «Du wirst nun bald die Krone erben. darum ist es an der Zeit, daß du auch das Reich kennen lernst, das du regieren sollst. Drum zieh aus in alle Gegenden unseres Landes und schau nach unseren Völkern. Der Prinz tat nach des Vaters Geheiß und durchzog mit großem Gefolge und vielen Schätzen das ganze weite Reich. Zuletzt stieg er über den Berg Ben und kam auch ins Wallis, wo seit alters an Halden und Hängen, in Tobeln und Tälern scharenweise die Zwerge hausten.
In Blummatt wohnte ein Müller, der hatte ein wunderliebliches Töchterlein, Eveli geheißen. Als der Zwergenprinz sie eines Tages auf der Matte die Wäsche zur Bleiche auslegen sah, da beschloß er alsbald dieses Mädchen zu seiner Königin zu machen. Und er befahl, drei geräumige Höhlen zu graben, eine für sein Gefolge, eine für sich und eine für Eveli. Ihm aber, dem Mädchen, gefiel der garstige Zwerg nicht, ob es auch der Königssohn selber war, denn er war kaum spannenlang und braun und bärtig im Gesicht wie Tannenrinde und hatte die Füße hinterwärts gekehrt und überdies hatte Eveli sein Herz längst vergeben: ein hübscher Jungknab der Gegend, ein Jägergesell, war ihr Liebster. Aber der Zwerg kam gleichwohl zur Mühle und warb um sie; «Gist ihr, sie git sich dir», dachte er und brachte
ihr die kostbarsten Kleinodien zum Geschenk. und wollte ihr gar ein Ringlein mit einem funkelnden Edelstein dran ans Fingerlein stecken und ein wunderfein geschmiedetes Goldkrönlein aufs Haupt setzen. Aber Ring und Krone, beides war Eveli viel zu klein. Doch tat der zierliche Kram es dem Maitli an; sie konnte schier die Augen nicht davon wenden und oft nahm sie die Dinge heimlich hervor und spielte damit. Auch sah sie wohl, wie so gar lieb das Zwerglein sie hatte, denn wer einem Lieb erzeigt, der bereitet einem Sorge.In derselben Gegend wohnte auch eine weise Frau, der sagte man nur die Waldelster, weil sie in einer moosbedeckten Hütte oben im Walde hauste. Die kam oft in die Mühle und konnte es gut mit den Müllersleuten. Als diese das nächste Mal wieder kam, erzählte ihr Eveli. was sich mit ihr und dem Zwerge zugetragen. Da sagte die Alte: «Mein liebes Kind, wenn es weiter nichts ist, was dir Sorge macht, dann ist leicht geholfen. Gib mir drei Haare von deinem Haupt und einen abgetragenen Schuh von deinem linken Fuß, dann werde ich dir raten. Und sobald der Zwerg wieder zu dir kommt, so hole mich her.» Eveli gab ihr das Verlangte und versprach, sie zu rufen, wenn der Zwerg komme.
Schon den andern Tag kam er wieder mit seinem ganzen Gefolge. Das Völklein sprang allerlei Tänze und schlug Purzelbäume Eveli zur Kurzweil, just als wollte es ihr huldigen als ihrer künftigen Königin, so daß sie ganz vernarrt ward in die zierlichen Wichte - doch die Frau eines Zwerges werden, davor graute ihr. Aber sie hatte seine Geschenke angenommen, und wer weiß, meinte sie, das ist vielleicht so gut wie versprochen, denn Gaben verpflichten. Und sie zurückgeben, das gehe auch nicht wohl an, ohne den Zwerg zu kränken. Als sie so sann, kam aufs Mal die Waldelster: «Eh, sei nicht so dumm!» sagte sie, «ich werde dir schon aus der Klemme helfen.» Und sie sprach zu dem Zwerge: «Dein Krönlein und dein Ringlein sind viel zu klein für Eveli.
Sende das Geschmeide nach Venedig, wo sie die schwarze Kunst verstehen. Da wird das Gold gehämmert und da schleift man die Edelsteine, und laß ihr eine größere Krone machen und einen weiteren Ring. Du aber mußt derweil eine Probe bestehen, wenn du Eveli gewinnen willst. Komm morgen früh beim ersten Hahnenschrei her und zeig, daß ihr mehr vermögt, als die Menschenkinder.»Bei Tagesanbruch war der Prinz mit seinem Gefolge zur Stelle, dein einem Holder ist nichts zu schwer. Die Alte sagte: «Der Müllerbursche hat aus Versehen einen Sack voll Korn in den Bach geleert. Sammle alle Körner, und Eveli wird deine Frau werden, aber kein einziges darf fehlen.» Husch, husch - da wuselten und gramselten die Zwerge im Bach herum, daß es spritzte und pflotschte und die Tropfen in der Sonne funkelten, und unlang brachten sie den Sack prall voller Korn zur Mühle. Aber da war die Waldelster auch schon wieder da und sagte: «Oh, Zwerglein, wie bist du betrogen. Es fehlen noch drei Körnlein in dem Sack!» «Wie denn das? Wie denn das?» fragte der Prinz. «Drei Fischlein haben die drei Körner weggeschnappt und sind fortgeschwommen ins große Meer. Und dort hat sie ein großer Fisch verschlungen, und kein Netz von Seide und kein Angelhaken von Gold vermag diesen Fisch zu fangen.»
Da ward der Zwerg über die Maßen traurig, die hellen Tränen rannen ihm aus den Augen über die Wangen und sickerten in seinen Bart. Und er verschloff sich auf dem Grund seiner Höhle und trauerte acht Tage lang. Denn: «Lieb han und myden ist ein bitter Lyden.» Da dachte er: ich will doch hinauf an den Tag gehn und das Eveli noch einmal sehen. Und er ging zur Mühle. Da aber war die Waldelster auch schon wieder da. «Tröste dich», sagte sie, «du kannst noch eine zweite Probe bestehen. Gelingt sie dir, hast du Eveli gewonnen.»
Am andern Morgen beim ersten Tagesschein stand der Prinz mit seinem Gefolge vor der Mühle. «Ach», sagte die
Waldelster, «da hat die Magd Evelis Kopfkissen in die Luft geschüttelt, und aller Flaum ist mit dem Winde fortgeflogen. Wenn du vor Abend alle Fläumlein sammeln kannst und nicht eines fehlt, dann ist das Mädchen den Tag noch dein.» Und wieder wimmelte und krimmelte das kleine Volk wie ein Immenschwarm allerorten, und unlang brachten sie das plustrig volle Kissen zur Mühle. Aber da war die Waldelster auch schon wieder da und sagte: «Oh Zwerglein, wie bist du betrogen. Es fehlen noch drei Fläumlein in dem Kissen!» «Wie denn das? Wie denn das?» fragte der Prinz. «Drei Raben haben die drei Federlein weggetragen in ihre Nester zu ihren Jungen. Und der eine hockt auf einem hohen Baum. Wenn du da hinaufkletterst, hackt er dir die Augen aus. Der andere haust in einer gähen Felsenklamm. Wenn du da hinaufklimmst, fällst du zu Tode. Der dritte nistet auf der Spitze eines alten Kirchturms. Wenn du da hinaufsteigst, wird er dich in die Tiefe stürzen.»Da ward es dem Zwerg abermals gar weh im Herzen und jammernd ging er in seine Höhle zurück und weinte und wimmerte acht Tage lang. Da war seine Sehnsucht so groß, daß er wieder nach der Mühle ging, um Eveli zu sehen. Da aber war die Waldelster auch schon wieder da. «Sei guten Mutes», sagte sie, «noch eine dritte Probe kannst du bestehen. Glückt's dir diesmal, führst du die Braut doch noch heim. Sei morgen vor Tau und Tag wieder hier.»
Am andern Morgen sagte die Waldelster: «Gestern hat der Knecht im Vergeß Linsen statt Erbsen im Garten gesät. Klaubst du sie alle wieder heraus, und nicht eine fehlt, dann wird heute noch Hochzeit gemacht.» Da durchnühlten und durchwühlten die Zwerge den ganzen Acker und sammelten alle Linsen zu Hauf. Und unlang so brachten sie die Schüssel gehäuft voll ins Haus. Aber da war die Waldelster auch schon wieder da und sagte: «Oh Zwerglein, wie bist du betrogen. Es fehlen drei Linsen in der Schüssel!» «Wie denn das? Wie denn das?» fragte der Prinz. «Drei
Mäuse haben die drei Linsen gefressen und haben sich tief unterm Boden in ihre Löcher verschloffen. Wie willst du sie da finden und fangen? So klein du bist, du kannst nicht hinein, die Löchlein sind zu eng und die Gänglein zu schmal.»Da wurde das Zwerglein noch viel viel trauriger als zuvor und es schloff in seine Höhle und schluchzte und gruchzte vor Kummer und Leid. Aber schön Eveli war ihm so lieb. daß er ohne sie nicht sein konnte, und so harrte er einen Tag um den andern, Woche nach Woche, und wollte das Land nicht verlassen und heimkehren in seines Vaters Reich. Unter der Zeit aber war Evelis Liebster, wie gewohnt, auf die Jagd gegangen. Aber eines Tages kam er nicht nach Hause und blieb aus. Nach Tagen fand man blutige Fetzen im Walde und seine Armbrust. Er war von Wölfen zerrissen worden.
Da brach Eveli das Herz. Sie weinte Tag und Nacht, mochte keinen Bissen mehr essen und keinen Tropfen mehr trinken. Und bald bald ist sie gestorben. Die ganze Talschaft folgte ihr zu Grabe, denn alle Leute hatten sie gern gehabt. Auch Zwitzizwätzi, der Zwergenprinz, mit seinem ganzen Gefolge kam aus der Höhle hervor und ging im Leichenzug mit. Auf das Grab legte er das goldene Krönlein nieder und pflanzte drei Lilien darein, die wunderbar erblühten. Aber der Sommer verging und der kalte Nordwind kam und mit ihm der Winter. Die Blumen welkten und verdorrten. Da sagte der Zwerg:
«Die Blüemli sind verdorbe s'Eveli ist gstorbe. Oh weh, oh Weh! Hie blyb ich nimmemeh!» |
Und er zog mit seinem Gefolge und dem ganzen Zwergenvolk davon, und seither hat man im Wallis keine Zwerge mehr gesehen.
Das Zwerglein auf der Spiezer Fluh
Unweit von Einigen am Thunersee hauste vor langen Jahren im Walde ein Zwerglein. Allemal zur Sommerszeit pflegte es sich auf die Spiezer Fluh zu setzen, die steil in den See abfällt, um sich dort zu sonnen und über die blaue Flut hinzustaunen. Die guten Leute von Spiez mochten den Wicht gar wohl leiden und brachten ihm oftmals Gaben hinaus,
einen Mumpf Brot, ein Kacheli Milch, Käse und Äpfel. Das Männlein dankte gar artig und nannte den Gebern zuweilen eine Glückszahl. War es etwa die Sieben, dann konnte der sie erhalten darauf zählen, daß ihm nach sieben Stunden, sieben Tagen, Wochen oder Monaten oder auch erst nach sieben Jahren ein unverhofftes Glück zufiel. Die Zahl aber war allemal gar sinnvoll in einem Sprüchlein versteckt, das ein jeder in seiner Weise deuten mochte.Einst kam auch ein armes Bäuerlein zu ihm hinauf und bat ihn um ein Sprüchlein mit einer guten Zahl darin. Da sprach das Zwerglein:
«Nimm Liecht und Füür wol in acht
und hüet dys Huus by Tag und Nacht
denn wo Füür ist by dem Stroh
da brennts angends liechterloh.»
Der Mann fand keine Zahl in dem Spruche und ging unwirsch
heim. Denn auf Feuer und Licht gebe er wahrlich
auch ohnedies gebührend acht, meinte er. |
Acht Tage später brannte sein Haus ab. Als er aber acht Monate danach den Grund zu einem neuen Haus ausgrub, da stieß er plötzlich auf einen irdenen Topf voller Goldstücke, und nun war er mit einem Schlag ein hablicher Mann geworden, der nach keiner Glückszahl mehr zu fragen brauchte.
Das Feuerzeug
Einem braven Mägdlein zu Escholzmatt war ein Erdmännlein von Kind auf hold und wünschte, daß es ihm im Leben dereinst in allen Stücken wohl ergehen möchte. Aber wie es so geht auf der Welt, als das gute Kind zu einer schönen
Jungfrau herangewachsen war, da freite ein Bursche um sie, und schon wollte sie ihm ihr Jawort geben. Aber da kam das Männlein und sprach: «Glaub mir, Vreneli, dieser Jüngling wird dich nicht glücklich machen. Er ist nicht in Wahrheit so, wie du deinen Mann dir wünschen möchtest. Ihm mag ich nicht die Gabe anvertrauen, die schon lange für den bereit liegt, der dich einmal als sein Weib heimführen wird.» Das Mädchen tat nach dem Rate des Männleins, wie hart es ihm auch ward, und stand von der Heirat ab. Nachmals aber reichte es seine Hand einem anderen Burschen, der zwar arm an Gut und Geld war, aber er hatte das Herz auf dem rechten Fleck und ein paar schaffige Hände. Und da meinten sie, könne es nicht fehlen.Am Hochzeitstage kam abends, ehe die Brautleute zur Kammer gingen, das Männlein und nahm den Bräutigam beiseite und was meint ihr, hat er ihm gebracht? Eine Truhe voll Gold und Edelsteinen? Oh nein, nur ein Feuerzeug mit Stahl und Stein und Zunder: Der Jüngling nahm's und drehte es in den Händen und wußte nicht, was er sagen sollte. «Siehe», sprach da das Männlein, «das ist kein gewöhnliches Feuerzeug. Hab Sorg dazu, wie zum größten Schatz. Aber hüte dich wohl, es anders als in der höchsten Not zu brauchen. Dann aber, wenn du Feuer schlägst, wird's allemal auf der Stelle hinter dir fragen: Was willst? Sage alsdann deinen Wunsch - aber schau dich ja nicht um - und alsbald wird er dir erfüllt sein. Behalte dies alles wohl bei dir und sage niemand davon, auch deinem Weibe nicht.» Mit diesen Worten war das Männlein - husch -verschwunden.
Übers Jahr im andern Sommer, als der Mann einem ausbrüchigen Rind nachging, erspähte er hoch in den Flühen auf einem Absatz die schönsten Flühblumen. «Ei», dachte er, «davon bring ich der Vrene ein Sträußlein heim, und er kletterte zu dem überhängenden Felsenband hinauf. Da bröckelte unter ihm der Fels ab und die Brocken rollten polternd zu Tal. Er griff nach einer Staude, die nur lose im Gestein
wurzelte, um sich festzuhalten. Nur wenige Atemzüge und sie gab nach, und er drohte in die Tiefe zu stürzen. «Allmächtiger Gott, das Feuerzeug!» Mit der freien Hand bringt er's aus dem Sack, klemmt Stein und Zunder zwischen zwei Finger der andern Hand, mit der er die Staude umklammert hält und schlägt Feuer. Da fragt's hinter ihm: «Was willst?» — «O hilf mir fort!» rief er, und wohlbehalten stand er unten an der Fluh auf der Weide, das Büscheli Flühblumen, das er gepflückt, in der Hand.Manches Jahr ruhte nun das wundersame Feuerzeug und ward schier vergessen. Da einmal erkrankte die Frau. Das Erdmännlejn kam und brachte Arzneien. Aber der Mann traute dem Tränklein nicht recht und gab es der Frau nicht ein, da wurde das Übel stündlich schlimmer. Schon lag sie in den letzten Zügen. Der Mann schluchzte und schrie: «Ist denn auch gar kein Kräutlein auf Gottes Erdboden gewachsen, das hilft!» O du Narr, das Feuerzeug! Wie konnt ich das vergessen! Und er langt in den Sack - aber o weh, da ist kein Feuerzeug mehr! Da kam's ihm, er möchte das Erdmännlein durch sein Mißtrauen erzürnt haben. «O hilf nur dies eine Mal noch!» rief er laut. Da fühlte er das Feuerzeug in seiner Hand. Er schlägt Feuer und spricht seinen Wunsch aus, und das Heilmittel ist da, und alsbald ist die Frau genesen.
Und wieder ging manches Jahr ins Land, und die beiden Leutlein wurden alsgemach älter. Da gerieten sie in bittere Not. Kein Batzen war mehr im Beute!, kein Brot im Haus. «Ach», sagte der Mann, «will denn auch gar kein Stern mehr zünden in dieser Finsternis!» und er verfluchte sein Schicksal und haderte mit Gott. «Ei, das Feuerzeug!» Hättest sehen sollen, wie seine Hand in den Sack fuhr, und wie ein Wetterleuchten huschte die Freude über sein Gesicht. — Aber o weh, das Feuerzeug ist wieder fort. Und vergeblich ist all sein Bitten und Betteln. Ob wohl das Erdmännlein die Bitten der Frau erhören würde? Der Mann vertraut ihr
das Geheimnis an. Und in der Tat ihren Bitten gab das Erdmännlein Gehör. Das Feuerzeug kehrte in den Sack des Mannes zurück. Er schärfte der Frau gar sehr ein, daß sie sich ja nicht umschauen solle, wenn sie die Stimme hinter sich höre: sonst sei alles verloren. Aber, was es nun sein mochte, wie es drauf und dran kam, da hatte sie das Gebot vergessen, oder der Gwunder stach sie -sie wollte schon den Kopf kehren. Aber der Mann sah's und packte sie eben noch am Ribel und hielt ihr den Kopf fest. Da stand ein großes silbernes Becken voller Kronentaler vor ihnen auf dem Tisch. Damit war nicht nur der Not im Augenblick abgeholfen, sondern jetzt waren sie auf einen Schlag reiche Leute geworden und lebten fortan in Glück und Wohlergehen bis an ihr selig Ende. Ihr fragt, was aus dem Feuerzeug geworden sei? Das hat das Erdmännlein wieder an sich genommen. Aber wer brav ist und seine Huld gewinnt, der bekommt's vielleicht von ihm geschenkt.
Das Wunderfläschlein
Es war einmal ein armer Mann, der hatte einen Tschuppen Kinder. Ich glaube, es waren deren zehn oder zwölf, so daß er nicht mehr wußte, wie er die vielen hungrigen Mäuler stopfen sollte; denn zu dem kargen Äckerlein besaß er nur ein mageres Kühlem. Und zuletzt am End mußte er auch das verkaufen, so arm war er dran.
Auf dem halben Wege zum nächsten Marktflecken begegnete ihm ein munzig kleines, buckliges Mandli, das beugte sich zitternd über seinen Knotenstock und fragte ihn: «Wohin gehst du, armer Mann?» Der antwortete: «Ich habe nichts mehr, das ich meinen Kindern zu essen geben
könnte, nun gehe ich meine einzige Kuh verkaufen.» «Oh! Nein, du mußt sie nicht verkaufen. Du erbarmst mich, ich will dir aus der Not helfen. Nimm hier dieses Fläschlein. und wenn du nach Hause kommst, so stell es auf den Tisch und sprich; <Fläschlein, Fläschlein, tu' deinen Dienst!> Deine Kuh aber gib nicht aus der Hand. Es sei denn du seist in äußerster Not.» Also sprach das Mandli und humpelte an seinem Stock davon. Als der Mann nach Hause kam, sagte seine Frau: «Was, du hast die Kuh nicht verkauft! Mein Gott, was sollen jetzt unsere Kinder essen?» «Oh! Warte nur, ich habe etwas weit besseres als Geld!» versetzte der Mann. Dann trat er ins Zimmer, stellte die Flasche auf den Tisch, versammelte Frau und Kinder um sich und sagte: «Fläschlein, Fläschlein, tu' deinen Dienst!» Und da - ihr könnt's euch wohl denken -da kam sogleich das beste Essen von der Welt auf den Tisch! und die Kinder mußten nicht mehr hungern. Was immer der arme Mann verlangen mochte, nie versagte das Fläschlein seinen Dienst.Nun hatte aber der Arme einen reichen Nachbar. den stach der Gwunder und der Neid, als er sah, wie gut es auf einmal den armen Leuten ging. Und eines Tages fragte er ihn, wie er denn zu solchem Wohlstand gekommen sei. Der erwiderte: «Ich hab ein Fläschlein, das gibt mir alles, was ich von ihm verlange.» Da lud ihn der Nachbar zum Essen ein und bat ihn arglistig, sein Fläschlein mitzubringen. Sie stellten es auf den Tisch. Da versuchte der Reiche den Armen zu beschwatzen: «Ich will dir alles geben, was du nur willst, wenn du mir dein Fläschlein überlässest!» Zuerst wollte der Arme nichts von dem Tausche wissen. Aber der Reiche bot ihm Haus und Hof und alles Land, das er besaß. Da meinte der Arme, er sei dann reich genug, so daß er auf das Wunderfläschlein verzichten könne, und schlug ein. Aber ihr könnt euch gewißlich denken, wie es weiter gegangen ist. Bald war er wieder so arm wie zuvor, und sah sich gezwungen mit seinem Kühlem zu Markte zu gehen. Als er
an dieselbe Stelle kam, da stand wieder das kleine bucklige Mandli am Wege, das empfing ihn mit den Worten:«So, so, bist du schon wieder unterwegs! Was fehlt dir denn jetzt?» Nun erzählte der Verarmte wie es ihm ergangen war: «Ich habe mich von meinem Nachbarn beschwatzen lassen, er hat mir das Fläschlein abgelistet, und jetzt habe ich nichts mehr!» «Wohl, wohl», erwiderte das Mandli. «Hier hast du ein anderes Fläschlein. Es ist größer als das erste. Dieses wird jenes auffressen. Hab Sorg dazu und gib acht, daß es dir nicht noch einmal ergeht wie vordem. Es ist das letzte Mal, daß ich dir helfen kann.» Und damit humpelte das Mandli an seinem Stocke davon.
Überglücklich begab sich der Mann nach Hause und lud seinen Nachbar ein. Sie stellten beide Flaschen auf den Tisch. Da sagte der Arme zu seiner Flasche: «Fläschlein, Fläschlein. tu' deinen Dienst!»
Da verschlang die große Flasche die kleine, und der Arme kehrte wieder in sein altes Haus zurück, wo er glücklich lebte bis an seinen Tod.
Das Dingweiblein
In einem baufälligen Häuslein hinter den Hildern bei Marbach im Entlebuch lebte einst eine arme Witwe mit einem Schärlein Kinder. Es herbstelte bereits und die gute Frau war in banger Sorge, wie sie ihre Kinder über den Winter durchbringen könnte. Sie hatte eine einzige Kuh im Ställi und nur einen spärlichen Heustock oben auf der Bühne.
Eines Abends nun, beim Zunachten, als die Frau kummervoll eben den Kindern die Milch wärmte, lag ihr die Sorge steinschwer auf dem Herzen, und die hellen Tränen rannen ihr über das verhärmte Gesicht. Da träppelte aufs
Mal ein munzig kleines Weiblein herein und fragte die Frau, was ihr fehle, daß sie so traurig sei. Da klagte jene dem Weiblein ihre Not. «Ei», sprach da das Fraueli, «dem ist bald geholfen! Weißt du was, gib mir deine Kuh zu hirten, und du sollst Milch genug haben für dich und deine Kinder. Schau aber unter der Zeit beileibe nicht nach dem Heustock!» Das alles deuchte die Frau zwar seltsam, aber sie nahm das Anerbieten doch dankbar an. und das Weiblein blieb von Stund an im Hause.Das magere Kuehli gedieh prächtig in seiner Obhut und ward kugelrund und spiegelglatt und gab einen so fuhrigen Schapf Milch, wie nie zuvor - es war nicht zum glauben - und alle Not hatte ein Ende.
Als nun der Lanzig nahte, da nahm es die Witwe denn doch wunder, ob noch Heu auf der Bühne sei, und als das Weiblein einmal ausgegangen war, stieg sie hinauf und schaute nach. Und siehe, da war der Heustock unversehrt.
Am Abend kam das Weiblein heim, trat gleich in den Stall, schnupperte in der Luft und sagte zornig: «So jetzt wirst du dein Heu brauchen müssen», sprachs und lief aus dem Hause fort. Und fortan gab die Kuh nurmehr das frühere Maß Milch und der Heustock nahm zusehends ab.
Das Wildmannli im Val Davos
Im Val Davos hatte ein Mann, Pardill genannt, ein Maiensäß. Wenn er nicht füttern und melken mußte, machte er Schuhe und hängte sie jeweils an einem Nagel an der Wand auf.
Allemal bei schlechtem Wetter kam ein wildes Mannli z'Schermen in den Stall. Pardill hätte es gar zu gerne gefangen. Einmal verbarg er sich, als er es kommen sah. Das

Er führte es nun gebunden nach Jenatz. Die Dorfleute sammelten sich auf einer Matte und umstanden den raren Fang in einem Kreise, um ihn so recht zu beschauen. Und der eine sagte dies und der andere das. Ein Schmied sagte:
«D'Schmida hand au a Kunst erdacht,
Sie hand Stahl und Ise zemebracht.»
Darauf rief das wilde Mannli: «Den heians au Sand derzuagworfa!»
Nun erst merkte der Schmied, was sie zu tun hätten,
um aus Eisen Stahl zu machen. |
Unterweilen aber war das Mannli aus den Schuhen herausgekommen. Wie eine Gemse sprang es über zwei Männer hinweg und lief davon, indem es rief:
«Pardill. Pardill. der ist a Man Der hat mi gfanga und nit la gahn. Die andara, die sind nur Schyßman!» |
D's Bärgmändli
Z' Peist hed schi lang as wilds Mändli oufghaltä und hed dä Peistar vil Jahr die Geis ghüät. In ds Dorf ist är abär niä ohon, sondärä nu bis ob d'Esch im Sagätobäl. Dört hemd sch' mä denn ds Assä hingstellt. Duä hed 's ämal än grousig leida, chaltä Summar gän. D' Löüt hemd schi däm arina Mandli ärbarmäd und hei mä äs Paar Holtschä und äs Häs la macha und hei mä 's näbäd die Bulschä gleid. Am Morgäd chunnd denn ds Mändli und gsiet die Waar da, setzt d'Holtschä ouf dä Chopf und schlöüft mit dä Beinä in dä Huät, will umärlaufä, gheid um und würd zornig drab, würft alls äwäg und lauft sovil als ä die Bein tragä mögänd über Munt ouf und rüeft zruck:
Wie watt äso än Wildäli Man Mit Peistär Geißäli z'Bärgäli gan! |
Die wilden Mannli von Selun
Auf der Alp Selun haben vor Zeiten zwei wilde Mannli den Sennen Handbubendienste getan. Wenn er mit Käse oder Anken oder sonst eines Geschäftes halber zu Tale steigen mußte, so trieben sie ihm gegen Sonnenuntergang das Vieh aus dem Stall auf die Weide und misteten und schotten. Der Senn, der die guten Dienste der unsichtbaren Gehilfen gar wohl zu schätzen wußte, stellte ihnen allemal eine Schüssel voll Milch und einen Laib Brot auf den Tisch. Kam er zurück, so war beides verzehrt bis aufs letzte Tröpflein und Bröselein, die Schüssel aber stand fein sauber am Platz. Die Mannli aber waren nirgends mehr zu sehen.
Einmal aber stach der Wunderfitz den Sennen und es gelüstete ihn, den Wichten bei der Arbeit zuzusehen. Wie
gewohnt stellte er ihnen Milch und Brot auf und jedem ein Paar Hosen. Er selber aber legte sich auf das Stalldach und sah nun den beiden Bolden durch eine Lücke zu, wie sie das Vieh austrieben und dann den Stall kehrten und zuletzt ihre Milch und ihr Brot verzehrten. Dann erst gewahrten sie die Hosen und musterten sie lange argwöhnisch. Schließlich schlüpften sie hinein, hielten sie hinten, wo sie ausgeschnitten waren, mit der linken Hand zusammen, mit der rechten knellten sie, schritten feierlich durch den Stall und riefen: «Der bind's oder bind's nüd!»Darob mußte der Senn laut herauslachen. Da aber stoben die Mannli über die Weiden davon und verschwanden und haben sich seither niemals mehr sehen lassen.

Das Crestamannli als Aiphirt
Vor Zeiten hatten die Alpgenossen von Schaan eine rechte Not. Schon manchen Sommer verfolgte sie leidig Ungfell auf der Alp: manche Kuh stürzte ab trotz Zäunen, das Jungvieh bekam die Blag oder sonst ein Gebresten und viele Kühe trugen nicht aus und kamen ohne Kälber von der Alp. Der Senn hatte es leicht, denn es gab wenig zu melken, aber der Hirt hatte ein Leben, keinem Hund hätte man es so gegönnt; an allem Ungfell und Lätzen war immer er schuld, nie das Wetter, behüte gar der Senn oder der Zusenn. Drum wollte im Frühling keiner sich dingen lassen und auf der Alp hirten, auch nicht um einen wackeren Lohn.
Am Abend vor der Alpauffahrt trug sich ein fremdes, munziges Mannli an, er wolle es übernehmen und probieren, Geld begehre er keins, aber recht zu essen, ein festes Dach und ein gutes Lager und im Herbst ein Mäntelchen, wie er jetzt eins trage. Freilich, wenn der Föhn einfalle, dann müsse man ihm einen Gehilfen schicken, sonst gefahre er, irgendwo über eine Fluh hinaus geworfen zu werden. Der Alpvogt beschaute den Wicht: «Keine Schuhe? und auf der Alp hirten? Dir sollte man zuerst ein Paar Schuhe geben und nicht erst im Herbst ein Mäntelchen. Überfordert hast du wahrlich nicht. Wir wollen dich nehmen. Wenn du aber aus irgendeinem Grund nicht bleiben magst, dann berichte beizeiten. Dann kann man sich richten.» Das Mannli versprach es.
Als man tags darauf zur Alp fuhr, brachte das Mannli einen großen Sack voll Farnkräuter für sein Lager und einen Haselstecken mit. Alles lachte über den Knirps, der werde nicht lang hirten, so barfuß. Besonders der Senn hatte ihn auf der Latte und stichelte und hänselte, aber das Hirtli kehrte sich nicht danach, tat, als würde es nichts hören und machte seine Sache. Der Aufstieg lief wie am Schnürchen,
aber nicht wie sonst mit Fluchen, Prügeln und Stüpfen, nein mit der Salztasche, mit Locken, Pfeifen und Flattieren. Auf der Alp oben nahm der Vogt das Hirtli zur Seite und sagte ihm, worauf es ankomme: wo man zuerst weide, wo zuletzt, wo am Morgen und wo am Abend; wo man das Vieh tränken dürfe und wo nicht, was man zu tun habe, wenn Schnee in die Alp falle oder bei Blitz- und Hagelwetter. Das Hirtli zeigte durch Fragen und Antworten, daß es etwas von der Sache verstand. Das hätte der Alpvogt nicht erwartet. Zuletzt sagte er: «Wenn du etwas merkst oder siehst, was nicht stimmt, dann berichtest du!» «Ja», antwortete das Mannli, «sagt man das nicht zuerst dem Senn? Der sollte wissen, was man tun muß.» «Ja, ja, eigentlich schon; aber bericht du nur grad mir, es ist besser, man kann nicht wissen.Das Hirtli hatte das Vieh gut beieinander. Die ersten Tage besichtigte es die Alp von zuunterst bis zuoberst: wo's Wasser habe, wo der Schnee zuletzt verschwinde, wo die saftigsten Alpenkräuter wachsen, der Zipriu, Muttern und Ritz, wo's giftige Eiben habe und gelben Enzian. Die Gatter, Zäune und Wehren an gefährlichen Stellen untersuchte es, flickte und verbesserte dies und jenes, aber die ganze Sache gefiel ihm nicht.
Der Senn begehrte auf wie eine Elster: das Vieh gehöre nicht auf den Staffel, sondern auf die Alp hinaus. Er wolle Hirt sein und hocke mit dem Vieh allzeit nur um die Hütte wie eine Kröte auf dem Wasserkännel. Das Mannli gab nichts zurück. hirtete wie bis anhin. zuerst nidsi, dann höher hinauf, immer dem frischen Gras nach. Kamen sie zu abschüssigen Stellen, wo das Vieh gefahrte zu Tode zu stürzen, stand das Mannli hin und wehrte und wies. —Alles war zufrieden mit ihm, nur der Senn nicht: der tobte und futterte wegen nichts und wieder nichts.
Als drei Wochen um waren, kam der Alpvogt, um zu schauen, wie es gehe. Er fragte den Senn, wie es sich mache mit dem Hirtli aus der Fremde. Jetzt leerte der den Chratten:
ein unverschämtes Chrottenmannli sei es. Alles wisse es besser, nie käme es fragen, was zu tun sei. Wenn er schimpfe, tue es, wie wenn's nichts höre. Es komme rechtzeitig zum Essen, wische den Löffel ab und gehe wieder. «Grüezi, guten Abend, gut Nacht», damit hat's es. «Man kann mit ihm nicht gesprächlen abends, es hört nur zu und erwidert kein Wort. Nur mit dem Vieh. da kann es reden, da ist es gsprächig. Neben dem senne ich nur diesen Sommer, dann habe ich genug Ärger geschluckt und Verdruß. Die Galle könnte einem ins Blut überlaufen. Mich nimmt nur wunder, wie das Chrottenmannli heißt und wo es herkommt. Da ist etwas nicht geheuer!» «Ho, ho», erwiderte der Vogt, «wohl möglich, aber es ist alles in bester Ordnung. Dies Jahr gibt's doch wieder Milch und Käse, da kann man sich drauf freuen. Du solltest ihm seine Eigenheiten übersehen und dich freuen, daß alles so gut geht.» «Dafür hat man viel Arbeit, mehr als je, der Lohn aber bleibt, der ist abgemacht.» Das stach den Alpvogt in die Nase. Er ging und suchte das Hirt ii auf und fand es an einer gefährlichen Stelle. Schon von weitem rief das Mannli: «Ihr kommt grad zur rechten Zeit. Lueget diesen Zaun und das Mäuerchen da, die stehen verkehrt, die muß man versetzen. Jetzt würde ein Häuptli, das da oben ausschlipft, durchbrechen und über die Felsen da abstürzen. Mich nimmt nur wunder, warum die vielen Rindenstücke da oben in den Weidweglein liegen. Das Holz hat man jedenfalls nicht hier geschält!» Der Vogt gab ihm recht und fragte ihn, wie er zufrieden sei und wie es ihm da oben gefalle. Ihm gefalle es gut. Nur die Gatter würde es besser vermachen und das Wasser, wo das Vieh nicht tränken darf, besser einzäunen.» «Und sonst? Wie ist's mit dem Essen?» «Alles recht, wacker und gut.» «Und wie ist's mit dem Senn und dem Knecht? Könnt ihr es gut miteinander?» «Mit dem Knecht bin ich zufrieden, man hilft einander ungefragt. Aber der Senn ist ein eigensinniger verknorzter Nörgler. Gestern beim Abendessen hat er nichts als die ganze Zeit aufbegehrt, man habe zuviel Milch, man werde nie fertig mit der Arbeit und müsse das Hungerlöhnli bis in alle Nacht doppelt und dreifach verdienen. Wenn es nicht bessere, müsse man gar noch am Mittag melken. Auch gehe er nachts oft weg.» Jetzt wußte der Alpvogt genug und sagte: «Sobald wir das Heu unter Dach haben, wollen wir kommen und zäunen. Bis dahin mußt du Geduld haben.» Darauf ging er.Mit der Zeit mußten sie richtig dreimal des Tages melken. Der Knecht wie der Senn hatten zu hantieren wie lätz. Am Abend, statt den Alpsegen zu sprechen, verfluchten sie einhellig die besten Alpenkräuter:
«Der Tüfel heli Zipriu, Muttern und Ritz vom Rhy bis uff all Grät und Spitz!» |
Das hörte das Mannli mit Schaudern und rief die Alp hinauf so laut wie es vermochte:
«B'hüet mer der Liebgott Muttern und Ritz vom Rhy bis hinauf auf alle Grat und Spitz!» |
In der Not hatte es vergessen, den Zipriu in den Widerfluch hineinzunehmen, drum sind seither seine Stengel hohl, die früher von Milch strotzten. Dem allem zum Trotz mußten der Senn und der Knecht noch zuviel melken.
An einem gewitterschwülen brütigen Nachmittag, die Bremen taten wild wie lätz, sammelte sich das Vieh und gefahrte auszubrechen und blindwütig über die AIp zu stürmen. Der Senn war hinter dem Vieh her, schrie, fluchte und schlug mit dem Stecken drein, aber das Hirtli lockte und pfiff und tätschelte die Leitkuh. Nicht viel hätte gefehlt, so wäre das Vieh durchgebrannt. Als in der Nacht darauf die Herde. von einer dämonischen Gewalt besessen, ruggen wollte, da ging das Hirtli hinaus, nahm sein Haselstecklein
und umkreiste Hütte und Senntum, bis alles Vieh wieder ruhig war. Jetzt merkte der Senn, daß ihm das Hirtli überlegen war und sagte nichts mehr, tobte und kybte nicht mehr, dafür aber bebte es um seine Mundwinkel und blitzte in den Augen.Einmal in der Nacht hörte das Hirtli, wie der Senn aufstand, im Holzschopf eine Axt holte und fortging. Erst vor Tagesgrauen kehrte er zurück. Das Hirtli stand auf und ging hinaus an den abschüssigen Abhang. Da sah er, wie in den Kuhweglein oberhalb des Felsenabsturzes viele frischgeschälte Tannenrinden lagen, die glatte Seite nach oben gekehrt. Das Mannli besann sich nicht lange, häufte die Rindenriemen zusammen und suchte nach der geschälten Tanne. Es fand sie bald; im Wald unten lag sie, hellglänzend, keinen halben Tag alt. «Jetzt muß ich dem Vogt berichten», dachte das Hirtli, «da ist etwas nicht in Ordnung.»
Am Abend, als es dunkelte, kam ein Bettler zur Hütte. Er hätte gerne etwas zu essen gehabt und bat um ein Lager für die Nacht. Aber der Senn fuhr ihn drohend an und fluchte über diese Vagabunden, alle seien sie faule Hunde. «Mach daß du fortkommst, oder ich bringe dich um», wirft ihm einen Holzschuh an den Kopf und handgroße Steine dem Flüchtenden nach.
Am Morgen fehlte der Senn. Sein Bett war leer. Er kam auch nicht zum Melken zurück. Das Hirtli ging weg und suchte ihn um und um. Zuoberst im Girakrachen fand es seine Haut an einer Legföhre hangen.
Wie das Hirtli zum Staffel zurückkam, war der Alpvogt schon da mit ein paar Mannen, um die Zäune zu flicken und das giftige Wasser einzuzäunen. Stumm haben sie das Hirtli angeschaut und gestaunt über seinen Bericht. Was machen? Einander helfen, melken, käsen und dann die Zäune richten.
Anderntags meldete sich ein neuer zum Sennen, ein grader, wackerer Mann. Der fand noch allerhand, das der vorige
für sich selber auf die Seite geschafft hatte als Zustupf zu seinem Lohn: vier Ballen Butter und zwei Käse waren unter einem alten Trog im Holzschopf gut versteckt. —Jetzt aber redete das Hirtli nicht nur mit dem Vieh, man hörte es pfeifen und gar jauchzen.Im Handkehrum war es Herbst. Die Älpler waren stolz, als sie am Abend der Abfahrt im Wirtshaus zu Schaan zusammensaßen: nicht ein einziges Häuptli war abgestürzt, weder Krankheit noch Gebresten hatte es gegeben und keine Kuh hatte verworfen. Ein Jeder kam zu seinem Anteil, wie's Brauch ist, und war zufrieden. Das Hirtli bekam ein Mänteli, nicht nur aus Drilch, aus gutem Wollstoff war es. Das Mannli freute sich und strahlte wie ein Graf. Doch dem Vogt war dieses Löhnli nicht recht. «So geschafft und gesorgt und nur dieses Mänteli zum Entgelt - man müßte sich schämen.» Er schenkte dem Hirtli vom besten Wein ein und tat ihm Bescheid. Aber das Hirtli wehrte ab: «Nenei. den kann ich nicht trinken, der stiege mir in den Kopf und lähmte die Beine.» «Ja, was möchtest du denn trinken?» «Wenn ich bitten darf, so gebt mir ein halbes Maß Schottenmilch.» Die Tochter vom Alpvogt holte sie, lachte das Mannli an, als sie einschenkte und dankte ihm wie einem hohen Herrn. Im Lauf des Abends fragte ihn der Vogt: «Und nun, was hast du im Sinn? Wo gehst du jetzt hin?» «Halt heim», antwortete das Hirtli. «Ja, wo bist du zuhause und wie heißest du?» «Das darf ich nicht sagen. Hier bin ich Alphirt und damit fertig.» «Jä — und das nächste Jahr - möchtest du wieder dingen?» Das Mannli besann sich und sagte dann: «Wenn ich lebe und gesund bin, komme ich im Frühjahr wieder.» «Und als Lohn?» «Jo, das nächste Jahr habe ich es nicht halb so streng wie heuer. Ein neues Wetterhütchen hätte ich gern, dies da hält nicht mehr lang.» Der Alpvogt versprach: «Das sollst du haben und ein schönes Trinkgeld dazu, wenn alles so gut geht.» «Ich will kein Trinkgeld, ein solches Wetterhütchen möchte ich und da-
mit hat's es: ich markte nicht.» «Aber heute abend bleibst du hier über Nacht», antwortete der Alpvogt besänftigend. «Ja, das geht nicht gut; alle Guttaten in Ehren. Aber wenn ich genug gesehen habe und mich gefreut am Tanz der Jungen, dann packe ich zusammen und gehe. Vielen Dank für euer Gutmeinen.»Im Frühjahr drauf kam das Hirtli ungerufen am Abend vor der Auffahrt. Der Sommer ging vorbei wie im Flug. Und als man reich beladen zu Tal kam und abends zusammensaß, setzte der Alpvogt dem Hirtli das neue Wetterhütchen auf. Sein Meit li brachte ein gesticktes Sennengewändli, denn es hatte wohl bemerkt, wie des Mannlis Hemd und Höschen fadenscheinig waren, legte es vor ihn auf den Tisch und ein Paar Schuhe daneben. «So recht, ganz recht», ruft's durcheinander und alles klatscht und jauchzt. Darob erschrak das Hirtli, fuhr auf und in jähem Zorn wirft es Gwändli und Schuhe auf den Boden und stampft blindwütig drauf herum. Dann springt's in einem Satz auf's offene Fenster, kehrt sich halbwegs und ruft mit erhobener Faust in den Saal: «Oh, ihr elände Tröpf. Jetz isch's us!», springt hinaus und auf und davon. Alles verstummt. Nach einer Weile meint der Alpvogt: «Der ist auf Cresta oben zuhause, man konnte es schon lange merken.»
Die verlorenen Kühe
Es war vor vielen, vielen Jahren. Da hirtete ein Senn mit einem Bub auf einer großen Allmendalp zwölf eigene Kühe.
Die Zeit rückte zur Abfahrt; die Tage wurden kürzer, auf den Bergen blieb der Schnee liegen. Im Umsehen war der Tag da, wo die Älpler zu Tal mußten. Am Morgen trieben die Buben das Vieh zu den Hütten, alles war bereit, ein Zug nach dem andern verließ die Allmend.
Der Älpler mit den zwölf Kühen war auch bereit zur Abfahrt, aber der Bub kam und kam nicht mit dem Vieh. Endlich sah er ihn kommen, doch ohne die Ware; er weinte und schnupfte, er finde die Kühe nirgends.
Jetzt machte sich auch der Älpler auf die Suche; sie gingen miteinander bis zuhinterst in die Alp, dann kehrten sie um, suchten in den Krachen oben und in den Abgründen unten, sie riefen und lockten -nichts und niemand gab Bescheid; sie blieben stehen und horchten, aber keine Schelle. nicht ein Glöckchen war zu hören.
Zuletzt am End mußten sie ohne Kühe heim. Tage darauf stiegen noch andere auf die Alp und suchten: kein Bein haben sie gefunden.
Der Herbst verstrich, in den Bergen fiel der Winter ein. Aber auch jetzt vernahm man nirgends etwas von den Kühen. Es schneite vollends ein und der Winter lag im Tal. Aber der Älpler gab's nicht auf, immer dachte er an die verlorenen Kühe.
Der Ustag kam, in den Bergen donnerten die Lawinen nieder, von den Dächern tropften die Eiszapfen. Der Bauer setzte sich oft vors Haus an die Sonne und schaute in die Berge.
Als er einst so saß, kam ein kleines Hudelmannli. Der Bauer meinte, es sei ein Bettler und sagte ihm, wenn er etwas begehre, so solle er zur Frau. Das Mannli folgte dem Rat und fragte die Frau, was dem Bauer fehle, er sei so wortkarg und gebe nur räßen Bescheid. Die Frau erzählte dem Mannli, wie das alles gekommen sei, sie fürchte gar, er hintersinne sich noch.
Da antwortete das Mannli, da sei zu helfen. Der Bauer solle mit dem Buben zur Alp fahren wie sonst und tun, wie wenn die Kühe da wären. Der Bauer wollte zuerst nichts davon wissen, schließlich ließ er sich doch überreden.
Im Maien fuhren sie z'Alp, er und der Bub. Sie betraten die Hütte und fachten Feuer an, danach holten sie aus dem
Gaden die Alpgeräte hervor, die Mutten und Bremen, den Brecher und Rührer, wuschen alles im Brunnen und stellten die ausgetrockneten Behälter in den Trog. Zuletzt nahmen sie das Chäschessi, schütteten etwas Asche hinein und reinigten es mit einem Grasbüschel. Aufs Mal war dem Älpler. er höre etwas: «Los, ich höre unsere Treichlen.» Aber es war bloß der Widerhall der Glocken von den weidenden Kühen aus den Flühen.Sie traten in die Hütte und bereiteten das Nachtmahl. Nun ertönten Glocken und Schellen und der Klang kam immer näher zur Hütte; es waren die eigenen. Bald klopfte

All die folgenden Jahre verlor der Älpler kein Stück mehr und keins seiner Tiere verfiel oder wurde krank. Er wurde ein hablicher Mann und stak besser in den Hosen als je einer weitherum.
D' Schalmeipfyfli
Das ischt vom Groß- und Klyhirt. Der Groß het uf der Alp am Herbst by der Abfahrt mit Flyß a Kueh deheina gloh und schickt am andera Morgat de Klyna z weg. die Kueh ga Bola. Der Groß het drum eba de Klyhirt nit lyda könna und het si denkt: «Wenn der kly Nütnutz so mueterseelan alleinig in d'Alp kunnt, so würd ne wol der Butz in d'Fingere neh.»
Der Kly goht und .kunnt in d'Alp zer Hütta und findet d'Kueh grad am Stafel ligga und grameila. Er setzt si dua au an Stafel und packt sy Schnappsack us und foht a e Hitz marenda. Über a Wyli se kunnt richtig der Alpabutz, hocket zuenem und haltet manierli mit. Bym Goh git er dua am Klyhirt noch a Schalmeipfyfli as Krom mit in de Sack. Wia dua am Obed der Kly mit der Kueh und mit dem Schalmeipfyfli heimkunnt, se schaut der Großhirt verstunet dry und denkt si bei-em seib: «Der Butz mueß nit so lätz si, wia d'Lüt meinen, und so a Pfyfli möcht i au.» Richtig goht er au allei der Alp zue, aber vom Großhirt ist nüt meh z'rückkoh.
Bestrafter Fürwitz
A Burameitli ist arno! bym-a Fenkawybli Pflegen gsi, und dua het denn ds Mandli vo der Kindbetteri a Gang uf d'Oberwelt z'maha gha, und vor's uf da Weg ist, seits zum Burameitli: «Understand di nit und gang mer in de Küehstall, derwyl furt bi», und das seit drüber: «Nei, bilyb!» Wo aber ds Mandli furt ist gsi, so ist am der Wunderfitz ko, und es ist ganga und het d'Stalltür hofeli ufftue und in de Stall yhigüggelet, und dua het's denn a Hab vom schönsta \eli gseha, ahi Stückli vom klyna Kälbli bis zer Schellakuah so schö lybig, daß ma kei Beili hetti gryfa könna. Es luaget und luaget, aber uf eimol g'sieht's zwüschat da Küeh a Mensch abunda an der Sou! stoh, und krydawyß vor Schrecka schloht's d'Stalltür wider zua und springt dervo. Am Obed kunnt ds Fenkamandli wider heim und goht in de Stall, go d'Küeh melka, d'Küeh hend aber roti Milch ge, und do drus het's gmerkt, daß d'Pflegeni im Stall ist gsi, und het si dieselb Nacht no furtgjagt.
A bsundara Lob
Es het arno! a Magd im a Korenacker gjättet und wia si so der Wüest zwüschet da grüena Hälemli usryßt, kunnt a glaraugnati tickbuhigi Krotta zua-n-ara häregwadlet. D'Jäteri gruset si ab dem leida Tier und stupft's furt und seit: «Gang, ich will der go pflega ko, wenn d' in d's Bett kunnst», und druf ist d'Krotta dur' dan Acker wyter ghupft.
A Wuche-n-oder zwo nohär kunnt denn a Fenk zur Magd in d's Hus und seit: «Gelt, du weischt noch, was seib mol im Korenacker zue-n-ara Krotta gseit best: <Gang, ich will der go pflega ko, wenn i d's Bett kunnst.> Du muescht
wüssa, diaseib Krotta-n-ist my Wybli gsi, und jetz isch's denn so wyt, jetz brucht's grad a Pflegen, es ist in d's Bett ko, und der Santiklaus het-am a prächtigs Büebli brocht.» So seit der Fenk zur Magd, ryßt sie bym Tschopa-n-ärmel, schleipft sie z'weg, und sie mueß bygotts mit, 's sei ara lieb oder leid.Dur grusig Töbel und Wälder füert sie der Fenk bis zuen-ara großa Höli, und das ist ds Fenka Hus gsi. D'Magd schickt si dry, was het sie au sus sölla tua, foht a pflega, und pflegt a par Wucha; het's derbei wyters nit schlecht, het z'essa-n-und z'trinka, wia-n-a Gröfi. Wia d'Pflegeta-n-um ist, git - ara d'Fenki a par Kohla in d'Schoß: «Se, do best au eppas für d's Pflega.» D'Magd denkt: «Nu, Kohla hett-i daheimet au». verbyßt aber de Zora-n-und goht mit da Kohla i der Schoß wyter.
Wia sie a Stückli vom Fenkahus gsi ist, luaget sie zruck, ob-ara d'Fenki nit eppa noha luagi, und wia sie niemet g'sieht, würft sie d'Kohla gauflawys furt; aber d'Fenki güggelet heimli bym-a Löchli ussa, luaget-ara zua und rüeft: «Wia meh aß-da verzetterist, um so minder host!» Uf des bhaltet d'Magd noch drei Kohla in der Schoß und treit sie heimetzua. Wia sie daheimet über ds Läubli uffigoht, merkt sie neisa n-eppas klingla, und wia sie in d'Schoß yhiluaget, sind für d'Kohla drei roti Goldklümpli dry. Do goht sie fryli weidli wider zruck go die verworfna Kohla sueha, findt aber keini meh.
Das stumme Weiblein
Ein Alpknecht ging am Berg und suchte eine Kuh, die sich verlaufen hatte. Da war's ihm, als bewege sich etwas unter einem Tschuppen. Er lief hin und sah nach - da war's ein
kleines verhutzeltes Weiblein. «Das ist sicher ein Holzweiblein oder ein wildes Fräuli!» dachte er bei sich und ging eilends weiter. Doch bald ward er inne, daß ihm das kleine Geschöpf Schritt auf Tritt folgte. Da redete er es endlich an und sagte: «Nun, nun, Mutterli, wer bist und wohin willst?» Doch das Weiblein gab ihm keine Antwort, folgte aber dem Sennen unentwegt wie ein Hundli bis zum Staffel. Da deutete es mit dem Finger zum Munde und sah bittend zu ihm auf. Da verstand der Mann, daß es Hunger habe, und er reichte ihm einen Schnifel Brot und ein Kacheli mit Milch. Das Weiblein aß, ohne zu danken oder sonst einen Laut über die Lippen zu bringen. Dann deutete es rings im Gemache umher. Die Sennen verstanden jedoch diese Sprache nicht, gaben ihm aber ein Bündel Heu, damit es sich ein Lager zurecht mache. Dann legten auch sie sich zur Ruhe.Am andern Morgen war das Fräuli noch in der Hütte, und so gut schien es ihm zu gefallen, daß es diesen und den Tag danach auch noch dablieb. Am dritten Tage aber begannen die Sennen zu murren, weil es nur aß und nicht arbeitete. «Die möchte wohl im Winter auch nur schlafen und im Sommer an Schatten liegen und am heiteren Tag in die Sterne gucken!» Und sie wurden rätig, den seltsamen Gast in der Gemeinde aufs Amt zu führen, um zu erfahren. wohin er gehöre. Da aber war es mit eins verschwunden und ward nicht wieder gesehen.
Der Schneider von Isenfluh
Bei Zweilütschinen teilen sich die Täler von Grindelwald und Lauterbrunnen. Hinter dem Dörflein, linker Hand von der weißen Lütschine, sieht man eine hohe Fluh aus den Tannenspitzen herausragen, Oben drauf liegt eine große
Matte. Da drauf haben sie vorjahr und Tag das Dörfchen Isenfluh gebaut. Es ist nicht groß, aber heimelig. Schaut man von Wengen hinunter, liegt's da, grad wie auf einer Erdscholle.Es wird erzählt, daß früher in diesem Dörfchen Zwerge gehaust haben, wie es der Schneider von Isenfluh elebte. Der hatte eine große Schar hungriger Buben und Mädchen und ein Mätteli, das nur für zwei Geißen reichte. Vom Morgenstern bis zum Abendstern schnitt und stichelte er unentwegt. Zum Glück fehlte es ihm nie an Arbeit, denn die Vornehmen im Tal schätzten ihn und seine Zuverlässigkeit.
Einmal hatte er auf den folgenden Tag dringende Arbeit, aber wie er sich auch rührte und schickte bis tief in die Nacht hinein, sie wurde nicht fertig. Todmüde legte er sich schlafen.
Als er am Morgen in sein kleines Nähstübli kam, lag das Kleid genäht, gebügelt und gebürstet fixfertig auf dem Tisch. Er konnte nicht begreifen, wie das zu und hergegangen.
Das kam nun manchmal vor, wenn er abends trotz Eifer und Fleiß nicht fertig geworden war, daß die Arbeit am Morgen fein säuberlich ausgefertigt da lag. Er sann und sann, wie das wohl zugehen möge, und fing nun an aufzupassen, wer ihm die Arbeit mache.
Einst, als es schon dunkel geworden war, bemerkte er ungewollt, daß ein paar kleine Männchen ins Nebenstübchen kamen. Durch eine Ritze äugte er und sah, wie sie sich auf den Tisch setzten und sich an die Näharbeit machten. Stich für Stich nähten sie, einer wärmte das Glätteisen, dann bürsteten und bügelten sie den Anzug und legten ihn steif gefaltet auf den Tisch. Dann, hui, machten sie sich auf und davon. Der Schneider hatte seine helle Freude, wie er ihnen zuschaute. Nun sann er nach, womit er den Zwergen danken könne. Seinem Schneiderblick war es nicht entgangen, daß die Kleider der Wichte gar fadenscheinig und ab-
getragen waren. So schneiderte er, als er bei Zeit und Gelegenheit etwas Schnauf hatte, Höschen und Wämschen für sie und legte sie als Dank für ihre Mühe den Helfern auf den Nähtisch.Am Abend kamen sie wieder, sahen die Bescherung und wurden inne, daß auf sie gemerkt worden war. Mißtrauisch äugten sie herum und machten sich voll Zorn davon. Von da an halfen sie keinen Stupf noch Stich mehr und kehrten dem Schneiderhäuschen auf Isenfluh für immer den Buckel zu.
Ein Zwerglein warnt vor dem Bergsturz
Zwischen den Weilern Falcheren und Löögen im Haslital lag vor vielen hundert Jahren schattenhalb noch ein Dörfchen.
Eines Tages kam ein Zwerglein gesprungen und keuchte außer Atem: «Flieht, flieht und räumt. Laßt alles im Stich! Noch ein paar Tage und dann stürzt die Fluh herunter.»
Die Leute werweißten nicht lange, sondern packten eilends zu: ein paar Tage später hatten sie Hausrat und Habe, Ziegen und alles Vieh gezügelt. Viele zogen nach Falcheren, andere fanden anderswo Unterschlupf.
Bald geschah der Abbruch, und der Felssturz deckte das ganze Dörfchen zu. Leute kamen dabei keine um.
In Hohfluh auf der anderen Bergseite hing Wäsche, als der Sturz geschah; die sei ganz schwarz geworden vom Dreck und Staub, den er aufgewirbelt habe.
Drei Tage danach, als alles zur Ruhe gekommen war, hörte man unter den Steinen, wo das Dörfchen gelegen, noch einen Hahn krähen.
Der Marcher
In Wengen lag sonnenhalb ein großes schönes Stück Land. Und allemal im Vorfrühling, wenn alle andern Hänge und Halden noch fahl dalagen, wenn der letzte Schnee gewichen war, so sproß dort schon das erste frische Grün hervor. Mitten hindurch floß munter sprudelnd ein silberhelles Bächlein, der Riebibach geheißen. Das hatte das allerbeste Trinkwasser weit und breit, und selbst im strengsten Winter setzte sich kein Eisschorf an seinem Rande an. und im heißesten Sommer, wenn alle andern Bäche vor Dürre versiegten, strömte das kühle Naß in vollem Fluß und Guß. Der Bach trieb eine Sägemühle und rieb den Bauern außerdem Roggen und Gerste zu Mehl.
Die fetten Gründe zweier Bauerngüter stießen an dies Bächlein an, und ihre Eigentümer lebten eben darum in Streit und Hader miteinander, denn jeder meinte, das Bächlein gehöre ihm allein. Und da sie beide arge Hebrechte waren, die an ihrem Vorteil hingen, wie Zwecken am Wollenpelz und beiderseits stets gähes Pulver auf der Pfanne lag, so zündete des Teufels böser Funke leicht, und sie werkten einander nach Kräften zuleide. Und so ging es denn mit ihnen, wie's eben geht, wenn sibe hebe und der acht nit wott la gab: bis sie merkten, daß wer rechtet, meist mehr um Schalen, Hülsen und Kleien streitet als um Kern oder Frucht. Und so wurden sie zuletzt am End rätig, ein uraltes hageres Chudermänndi als Richter anzurufen, das von Zeit zu Zeit in Wengen sich einfand. Niemand wußte, woher es kam und wer es war, aber alle Leute sagten, es wisse und könne mehr als andere. Als dies Männdi nun das nächste Mal wieder erschien, brachten die beiden Setzköpfe ihm ihre Sache vor und baten es um des Herrgottswillen, es solle ihnen doch marchen. Das Männdi sprach: «Ja, schon recht, ihr Haderbälge, das ist jetzt noch keine Notsach, an jedem beliebigen Tag kann ich
das nicht machen, ich komme aber in Ustagen wieder, wenn die rechte Zeit inne ist.»Als der Föhn in gähen Stößen talaus fuhr und Eis und Schnee auf Fels und Fluh unter seinem heißen Atem vergingen, da warteten beide auf den Richter. Er kam aber erst mit Gugger und Schwalbe und hatte nichts bei sich als ein haselnes Zwieselstecklein. Mit dem fuhr er dreimal durch das Wasser des Riebibächleins und rief mit einer hohen Stimme, die tönte wie der Ruf des Herrenvogels:«Ich für mein Teil, ich behalt mir Leib und Seel vor, aber ihr, ihr Sackershagel, ihr Muderköpf und Surrumurri, euch will ich jetzt marchen, daß für alle Zeiten gemarchet ist. Morgen noch, ehe es tagt, soll die March gezogen sein!» Sprach's und machte sich auf und fort, ehe noch wer ja oder bah hat sagen können, und kein Mensch im Tal hat es seit diesem Tage je wieder gesehen.
Zur Stunde aber hub das Wetter an stößig zu werden: große, pechschwarze Wolken stauten sich an Gipfeln und Gräten, und um Mitternacht brach ein Unwetter los, wie es noch zu keines Menschen Lebtag in diesem Tal geschehen. Der Regen peitschte wie Geißelschnüre hernieder, es stürmte und chutete, und das ganze Tal fing an zu beben, zu brausen und zu rauschen von Windes und Wassers Gewalt. Ein Donnerklapf schlug in den andern, der Widerhall rollte in den Felsen, fahl zuckte Blitz auf Blitz, und es war ein Ruch von nasser aufgewühlter Erde, Holz und Schwefel. Die Menschen standen zitternd vor ihren Häusern und Hütten und glaubten, der jüngste Tag wäre angebrochen.
Als am andern Morgen Wind und Wasser ausgetobt hatten und die beiden Bauern wie gewohnt an dem Bächlein Wasser holen wollten, da - potz Strahlwetter und Donnerschieß! -da war auf alle Zeiten gemarchet: das lustige Bächlein schoß als ein mächtiges Wildwasser durch eine tiefe und breite Runse. Es heißt heute der Chnewgraben und trennt den Weiler Schiltwalt vom übrigen Wengen.
Der Jäger Ueli und der Rothäubler
Einmal ging der ~lte•Ueli Haidi spät im Herbst oder eher früh im Winter auf die Jagd. Den ganzen Tag durchstöberte er Gräte und Gründe, aber kein Schwanz kam ihm in Schußweite; die Murmeli waren schon schlafen gegangen. die Hasen hatten sich in das Tal verzogen und die Gemsen, denen er eigentlich nachging, entwichen ihm den ganzen Tag.
Als der Abend dunkelte, kam der Ueli todmüd und in böser Laune ins Rottal. An einem wohlbekannten Plätzlein unter einem überhängenden Felsen machte er sich ein Feuerlein an aus seinen dürren Bengeln, die er den ganzen Tag auf dem Rücken nachgetragen hatte, er weilte seine Geißmilch. aß wacker dazu und rauchte dann noch ein Pfeiflein voll. Dann chrugelte er sich in einen Winkel hart an den Felsen an, empfahl sich in Gedanken der Obhut aller guten Geister im Rottal und schlief ein.
Am andern Morgen früh erwachte der Ueli frisch und munter, trotz des Frostes. Mit dem letzten Scheitlein und den Gluten vom Abend machte er wiederum ein Feuerlein an, laute das Restlein Milch, das ihm geblieben war und aß dazu den letzten Murgg Käs.
Als der Tag lauterte, kam der Ueli an den Katzengraben und klomm dadurch hinauf gegen den Wildgrat zu, und auf der anderen Seite hinab gegen das Seelein, und von da wieder hinauf zur Wasserscheide und dann wieder hinab dem Jffig-Känel zu. Endlich sah er am Litzen Niesenhorn einen Tschuppen Gemsen weiden. Müdigkeit, Hunger und Durst waren alsbald vergessen; in anderthalb Stunden hatte er sie angeschlichen und war auf Schußweite zu einer prächtigen Geiß gekommen. Zielen, Schießen, Treffen war eins. Die Geiß fiel kopfüber über einen Felsen und bewegte kein Bein mehr. Beim Ausweiden lief dem Ueli das Wasser im Munde zusammen, als er das saftige Fleisch sah.
Als der Ueli durch die Stiglen hinaus war, um nach dem Hengstensprung und Stierendungel zu gelangen, da dämmerte es bereits und bald war's brandschwarze Nacht. Mit den Füßen spürte er, daß da hinab alles eine Eisfläche war, und er getraute sich nicht hinunter. Ein Stücklein weiter rechts wußte er, war ein Grachen, durch den man auch hinunter kommt, nur ist er stotzig wie eine Wand, dafür aber gefüttert von eingewehtem Schnee. Der Ueli ließ seine Gemse vor sich her da hinunter gleiten und rutschte selber Ruck für Ruck auf den Absätzen und auf dem Hosenboden sachte nach. Aufs Mal entgingen dem Ueli Stand und Griff und er schoß zuerst ein Stück auf dem Hosenboden und dann Totz über Totz durch den Grachen hinur seiner Gemse nach. Wie er endlich wieder auf seiner Füßen stand. mußte er sich zuerst ein Weilchen besinnen, welchen Teil seines zerschlagenen Leibes er zum Sitzen, welchen zum Denken brauche. Auf den Knien tappte er nach seiner Gemse, er konnte sie aber nicht finden. Er setzte sich in eine Doole, maßleidig und verdrossen, wie seit langem nicht mehr: Daheim, die Frau, eine Stube voll Kinder und wenig Brot in der Küche, und er hier in stockfinsterer Nacht, mit sturmem Kopf und bluttem Hintern, mit hungrigen Kutteln oben am Seebühl auf dem Stierendungel! Ja, wenn nur der Rothäubler für etwas Rechtes wäre, so käme der ihm zu Hilfe.
Kaum hatte der Ueli das gedacht, da kam ein blendend helles Licht vom Seebühl herauf auf ihn zu, und eins - zwei - drei, stand ein kleines bärtiges Männlein in einer zündfeuerroten Haube vor ihm, in der einen Hand das helle Licht, und in der andern einen groben Stecken. «Was ist jetzt mit dem Ueli Haldi?» fragte das Männlein. Der Ueli berichtete ihm, so gut er konnte, wie's ihm ergangen wäre, und sagte nebenbei, es solle ihm doch zünden, damit er seine Gemse suchen könnte. «Und», schloß er. «was bist dänn du für es Unghüürli?» «Sooo, ech es Unghüür! Sä, fer
dys unverschant Gfrääs!» Und damit holte er mit seinem groben Stecken aus und versetzte dem Ueli einen solchen Streich auf den Kopf, daß er ohnmächtig hinstürzte. —Wie der Ueli wieder zu sich selber kam, war's heiter heller Tag, und er lag dicht neben seiner Gemse.Kein Wunder daß der Ueli Haldi fortan auf den Rothäubler nicht eben gut zu sprechen war.
Als er den Morgen auf der «Fluh» vorbei gegangen kam, fragte ihn der Jaggi Giereth: «Umts Hierre Wille, was hät's met dier gä, Ueli? Dir greut eis Bluet, und hinderna glusset der Hömlischild dir under der Gämsche fürha?» — «Hrn. d'Hose han i em Stigelchrache zerschrisse, u der Grind hät mer der Stieredungtüfel zerschlage!» schnarzte der Ueli bissig und ist eilig weiter heimzu gegangen.
Der Zwerg am Karren
In Täuffelen war der Sattler Franz daheim. Er fuhr oft in den Jura auf den Markt, denn er war Gemüsehändler. Wenn er über die Seekette ging, mußte er auch an einer Stelle vorüber, wo links der Straße eine gäbe Fluh senkrecht in ein tiefes Tobel abfällt. Auf der andern Seite ging es ebenen Weges in einen finsteren Wald. Darinnen hausten Zwerge. Dem Franz aber gramselte es allemal in der Herzgrube, und wenn er vorbeikam, klepfte er -klitsch klatsch - mit der Geißel und pfiff, so laut er konnte, um sich die Angst zu vertreiben.
Für den steilen Stutz hatte er immer drei Pferde vorgespannt. Als sie mit der schweren Fuhre wieder einmal bergauf keuchten, daß die Stränge schier rissen, hing sich beim letzten Schub ein Zwerglein am Karren hintenan. «Wart du Donnerschätzer, dir will ich!» murmelte der Franz ärgerlich
zwischen den Zähnen, griff zur Geißel und zwickte dem Mannli eins. Er traf es aber so hart, daß es vom Wagen fiel und tot auf der Straße liegen blieb. Da rief's aus dem Wald:«Eber Beber lauf. Der Muggistutz isch gstorbe!» Der Sattler Franz aber hörte nicht weiter darauf, sondern zog erschrocken die Zügel an und fuhr so schnell wie möglich weiter, gottfroh, daß er bald heil aus dem Wald heraus war. |
Aber als er nun das nächste Mal wieder an derselben Stelle vorbeikam - da schnaubte das Leitroß. sträubte sich stampfend im Geschirr, bolzte steil auf und setzte mit einem gewaltigen Gump über die Fluh ab in das Tal hinunter, die beiden andern Rosse samt dem Wagen mit sich reißend.
Und noch heute, wenn einer dort vorbeigeht, hört er zuweilen den Sattler Franz pfeifen und mit der Geißel klepfen.
Vom Viertelseeli
Auf dem Viertel in Krattigen, wo jetzt ein trüber Sumpf ist, da war vor Zeiten ein liebliches Seelein. Klarlauter bis auf den Grund war das Wasser, man konnte die Steinchen zählen, die am Boden lagen, der blaue Himmel und die bärtigen Tannen spiegelten sich auf seiner Fläche.
Warum ist das Wasser jetzt so trübe? In der Höhle über dem Seeli hausten vormals Zwerge, eine ganze Haushaltung mit einem Kind, einem lieblichen Mädchen. Das ging jeden Morgen zu den Kühern auf dem Viertel und holte Milch.
Einer von den Küherburschen hätte das anmutige Kind gar gerne zur Frau genommen. Aber da er grob und unflätig war, begehrte ihn das Zwergenkind nicht. In seinem Zorn ging er und entfachte vor der Zwergenhöhle ein mächtiges Feuer, damit die Zwerge drinnen erstickten.
Von dem Tag an kam das Mädchen nicht mehr in die Hütte Milch holen. Aber durch die Luft dem Berg entlang hörte man die Zwerge rufen: «Einmal und niemals mehr.»
Bald darauf rannte der Stier des ungattlichen Kühers in wildem Übermut ins Wasser, versank und ertrank.
Seither ist das Seeli auf dem Viertel eine trübe Pfütze voller Schlamm. Von den Zwergen aber sah niemand mehr auch nur ein Barthaar.
Batzibitzili
Unweit Menzingen im Zugerland lag einst ein einsamer Hof, abseits der Landstraße. Darauf lebten Bruder und Schwester, die früh die Eltern verloren, arm und kümmerlich, aber glücklich und zufrieden mit dem Wenigen, das sie hatten, bis ihre einzige Kuh, ihr liebes Bruneli eines Tages krank wurde. Da stand das arme Tier ganz still im Stall, sah die beiden allemal mit traurigen Augen an, wenn sie es besorgen kamen, und litt stumm große Schmerzen. Das Mädchen ging auf die Matten hinaus und den Hang hinauf dem Walde zu, um ein Heilkraut zu suchen. Da stand aufs Mal, wie aus dem Boden geschossen, ein Härdmandli vor ihm, nicht größer als ein dreijähriges Kind, und hatte ein Wämslein an von Hasenfellen und ein spitzig Hütlein auf dem Kopf, grün wie Moos. Sein Gesicht war braun und
schrundig wie Baumrinde und sein Bart struppig wie Tannenchris. Freundlich äugte es mit seinen beerenschwarzen Äuglein zu dem Mädchen hinauf und sagte: «Ja gelt, ich weiß schon, was du suchst, aber du wirst das Rechte nicht finden. Ich will dir aber helfen.» Und damit zog es ein Bündel ausgesuchter Heilkräuter aus dem Sack und reichte es dem Mädchen. «Gib deinem Kuehli jeden Tag ein Zweiglein davon, dann wird es bald gesunden.» Das Mädchen war so erschrocken, daß es gar schier vergessen hätte, dem Mandli zu danken. Dann sprang es eilends heim und rief schon von weitem: «Hoho, Brunch, hier sind Kräutli vom Härdmandli. Jetzt kann's nicht mehr fehlen!» Und die gute Kuh wandte den Kopf und muhte. Nach drei Tagen war das Tier zur Freude der Geschwister wieder gesund und munter.Seit jenem Tag aber, wenn abends das Mädchen Wasser vom Brunnen im Hofe holen ging, saß jetzt immer das Mandli da, und sie plauderten miteinander, das Mandli und das Mädchen, und wurden bald vertraute Freunde. Um den Haushalt der Geschwister aber war es karg bestellt, und manchen Tag mußten sie sich abends hungrig zu Bett legen. Das merkte das Härdmandli, und eines Abends sprach es zu dem Mädchen: «Versprich mir, mich immer lieb zu haben, und ich will dir etwas schenken, daß ihr künftig nie keinen Hunger mehr leidet.» Das versprach das Mädchen gern, denn der lustige Wicht gefiel ihm gut. Da nahm das Mandli aus seinem Sack ein rundes goldgelbes Käslein. «Dies Käslein esset allemal nur zu drei Vierteln auf. Dann wird es niemals zu Ende gehen. Aber nur ihr selber dürft davon essen und niemand sonst etwas davon geben noch davon sagen! »Ja, das war nun ein Käslein, sag ich euch, ein Käslein, so zart und fein, wie Nidel, es verging einem grad auf der Zunge, und schmecken tat's, dergleichen hatten die Geschwister ihrer Lebtag noch nie gekostet. Und alle Morgen war es wieder voll und rund. Das war nun alles gut und
recht und ging so eine Zeit, bis der Bruder einmal im Vergeß einem Gast das Wunderkäslein rühmte und ihm dann zu kosten gab. Da ging es mit diesem Käslein, wie mit allem Käs, man schnitt davon ab, und schließlich war er weg.Nun aber kam das Gut der Geschwister bis übers Dach in Schulden, die mußten bezahlt werden, und die Gläubiger drängten. Aber es war kein voriger Batzen im Haus, und da sollte der Hof samt dem Bruneli, der Geiß und den Hühnern und allem Hausrat und Gschirr vergantet werden. Am Abend vorher sagte das Mädchen traurig zu dem Härdmandli, das es wie gewohnt am Brunnen erwartete: «Heut ist's wohl das letzte Mal, daß wir einander sehen. Morgen wird unser Hof verkauft, und ich muß nun in der Stadt einen Dienst suchen, und der josi geht sich als Knecht verdingen.» «Nur gemach, liebe Jungfer», sprach da das Mandli, «wenn du nur willst, könnt ihr den Hof behalten, und du brauchst nicht in die Stadt gehen als Magd: Wird meine Frau, dann sollst du so viel Geld bekommen, daß dein Bruder die Schulden bezahlen kann.» Dem guten Mädchen ward bei diesen Worten heiß und kalt, und ohne sich zu bedenken sagte es, ja, und willigte ein, denn Verstand und Nachgedank kommt nicht vor den Jahren. Das Mandli schaffte alsbald einen großen Sack voll Geld zur Stelle, und alle Not war behoben. Die Geschwister wußten sich vor Freude nicht zu fassen und zu lassen. Das Mandli aber sagte: «Nun, Dorli, halt dich bereit, in drei Wochen soll die Hochzeit sein!» Aber versprechen ist eins und halten ein anderes. Wie nun aber ein Tag um den andern verging und der Hochzeitstag näher rückte, da ward dem Mädchen nachgerade denn doch bang und hänger, und es fiel ihm bleischwer aufs Herz. Wohl war es dem Mandli von Herzen dankbar, und es mochte es recht gut leiden, aber es hatte nicht bedacht, daß es mit ihm gehen müsse und in einer Erdhöhle wohnen. Auch fiel ihm ein, wie andere Mädchen mit schönen stattlichen Burschen Hochzeit machten, und
sie sollte die Frau dieses kleinen knorzigen Pföders werden! Nein, das deuchte es nun doch noch ärger, als von Haus und Hof gehen und bei fremden Leuten als Magd das Brot verdienen. Aber was tun? Es war dem Mandli versprochen. Da beschloß es, ihm zu sagen, wie es ihm uns Herz wäre, denn gezwungene Eh - des Herzens Weh. Und am nächsten Abend tat sie's. Das Mandli aber wollte ihr das Wort nicht zurückgeben, denn es freute sich schon lange darauf, wenn das schöne Menschenkind erst ganz bei ihm im Hause wäre und ihm kochen und es liebkosen würde. Aber wie es sah, daß ihm die Tränen kamen und es nur immer heftiger bat, es doch bei seinem Bruder zu lassen, da sprach es: «Dein Wort kann ich dir so wenig zurückgeben, als das Wasser im Bach wieder bergauf fließt. Aber wenn du noch vor der Hochzeit meinen Namen errätst, dann sollst du frei sein.» Nun riet das Mädchen hin und her: Heißest du Gickigäcki? oder Gragörli? oder Zwitzizwätzi? oder Muggistutz? Aber das Mandli lachte nur und schüttelte sich, daß die Hasenfelichen flogen: «Nein, so heiß ich nicht, nein so heiß ich nicht!» Und so blieb es bei der Abrede. Das Mädchen lief nach Hause und besann sich auf alle Namen, die es je gehört, so daß es die ganze Nacht nicht schlafen konnte, und ganz wirr wurde im Kopf, und am andern Morgen ging es ganz verzweifelt zu seiner Gotte. Die wohnte weit oben am Berg, und war schon uralt und über alles klug. Alle alten Frauen sind klug, aber die war so klug, wie ihrer zehne zusammen. Sie riet dem Mädchen, es solle dem Mandli nachschleichen in seine Behausung und es dort belauschen, dann werde es seinen Namen gewiß erfahren.Am Abend vor dem Hochzeitstage huschte das Mädchen dem Mandli auf leisen Sohlen nach in den Wald. Plötzlich schlüpfte der Höck unter einen Tannengrotz und durch eine Spalte in den Berg. Das Mädchen ihm nach. Das Mandli tat eine Tür auf und machte sie hinter sich zu. Das Mädchen kauerte draußen nieder und schaute durch's
Schlüsselloch. Da blickte es in eine munzig kleine saubere Küche mit einem kleinen Herd samt Pfannen und Töpfen und Geräten, alles blitzblank geputzt, und es sah wohl: statt aus Kupfer und verzinnt war alles von Gold und versilbert. Das Mandli machte ein Feuer an, tat Butter in ein Pfännlein und begann zu kochen. Dabei sprach und hüpfte es wie närrisch vor dem Herde hin und her, klatschte in die Hände und sang:«Hüt choch i no mys Müesli allei Morn chunt mer d'Brut is Hüsli hei. O wie guet, aß sie nit weiß, Daß ich Batzibitzili heiß!» |
Da hatte das Mädchen genug gehört, und es sprang heim, so geschwind wie der Wind. Und als am andern Morgen das Mandli im Hochzeitsstaat erschien, um die Braut heimzuholen, da sah sie zum Fenster heraus und rief:
«Gang hei, gang hei, liebs Mandli, Schlüf gschwind, gschwind hinder's Tandli, Koch der dys Müesli nur allei, D'Brut chunt der nit is Hüsli hei. Vor dir in gueter Rueh ich bi, Du heißisch Batzibitzili!» |
Ja, da war nun die Hochzeit aus, ehe sie angefangen. Das Härdmandli aber ward so böse, daß es auf dem Fuß kehrt machte und geradeswegs in den Wald lief, ohne ein Wort zu sagen. Und kein Mensch hat es je wieder gesehen, das könnt ihr gewißlich glauben.
Der Zwergenkönig
An einem kalten Wintertag, da Stein und Bein gefroren war, stieg ein junger Bursche aus Guttannen, haldan dem Walde zu, um Holz zu fällen. Dieser Bursche, Hans geheißen, war ein kühner Gemsjäger, ein tüchtiger Älpler und geschickter Bildschnitzer, aber so arm, daß ihm nicht mehr gehörte als das Hemd, das er auf dem Leibe trug, und sein Arbeitsgerät. Und dabei war er dem Mareili höldig, dem anmutigsten Mädchen des Dorfes, und auch sie hing von ganzem Herzen an ihrem Hans. Aber ihrem Vater, dem hablichsten Bauer der ganzen Talschaft, einem argen Cholderer, war ein solcher Schwiegersohn ganz und gar nicht willkommen, denn, wem der Geldsäcke! dicker, dem trüber der Geiz und blühet der Hochmut. Bei Mareilis Vater galt allemal bei allem, was er tat und ließ der Spruch:
«Hast du Geld. so tritt herfür,
hast du keins, blyb hinter der Tür!»
«Hans», sagte er zu ihm, als er gekommen war, um anzuhalten
um die Hand der Tochter, «daraus wird nichts. Merk dir
ein für allemal: Du bekommst das Mareili nur, wenn du
gleich viel Geld blank und bar auf die Tischplatte zählen
kannst, als sie aus meiner Truhe mit in die Ehe bekommt.
Und überdies: vom Frühling ab muß das Geschleik ein
Ende nehmen. Also mach voran!» Hans merkte wohl, daß
der Alte ihn mit diesem Bescheid überhaupt abschlüsseln
wollte, denn, wie hätte er bis zur Schneeschmelze sich eine
so große Summe sollen redlich erwerben können, wo er alle
Mühe hatte, als Holzfäller ein notdürftiges Auskommen zu
verdienen. Aber so leer sein Beutel war, so voll war sein
Herz. Geld tut viel, aber Liebe tut mehr. Und wer die Liebe
verbieten will, der gürtet ihr erst rechte Sporen an. Auch
weiß Liebe verborgene Wege und zwingt alles. So konnte es |
Mißmutig stapfte Hans durch den tiefen Schnee. Nur die dunklen Tannen ragten aus der weißen Decke hervor. Firste und Giebel der Häuser waren eingeebnet, und die Aare gluckste und gurgelte wie ein zahmes Bächlein unter der dicken Brücke von Eis und Schnee. Wie Hans an den Waldrand kam, hörte er miteins ein wehes Wimmern wie von einem Kinde, und ein unheimliches Fauchen und Zischen, ein Rauschen, Rascheln und Knistern. so daß ihm ganz angst ward. Jetzt, hörte er es wieder, ganz nah: ja, es war ein menschlicher Laut, ganz deutlich die Stimme eines Kindes! Er sprang mit einem Satz auf die Stelle zu woher die Stimme kam. Unter einer alten Wettertanne. deren dichtverschränkte Zweige den Schnee abgehalten hatten, erblickte er am Boden zwischen den Wurzeln eine greuliche Schlange, einen Stollenwurm. Mit seinem Schweife hielt er ein winzig kleines bärtiges Mandli umschlungen, das hatte ein zündfeuerrotes Gewändlein an und ein goldenes Krönlein auf dem Haupt. Der Zwerg wimmerte nur noch schwach und röchelte schon. —Huissst - sauste Hansens Axt durch die Luft und spaltete dem Untier den Kopf, so daß die pfeilförmige Zunge ellenlang ihm zum Maule herauslampte. Ein zweiter Streich trennte den Ringelschwanz vom Rumpf ab. Dann nahm er den Bold behutsam auf und rieb ihm die Schläfen mit Schnee. Alsbald schlug er die Äuglein auf und -wipps -sprang er auf seine Füßlein. «Hans», rief er, «du kamst eben noch recht, sonst wär's um mich geschehn! Der Wurm da hat mich angefallen, als ich eben auf dem Wege war zu meiner Braut, die dort drüben unter jener Balm wohnt. Hans, ich schulde dir mein Leben und mein Glück, und zu seiner Zeit soll dir auch mein Dank zuteil werden. Fürs erste lade ich dich samt dem Mareili zu
meiner Hochzeit ein in acht Tagen von heute ab auf dem Räterichsboden. Willkommen, willkommen! Es soll dein Glück sein Hans!» Und damit war das Mandli verschwunden, als wie ins Meer versunken.Lange stand der Hans mit offenem Munde da. Vor Staunen war ihm gar die Axt entfallen. Wäre nicht der tote Wurm vor ihm am Boden gelegen, er hätte fast geglaubt, alles wäre bloß ein Traum. Zwar hatten ihm als Kind die Alten daheim und im Dorf oftmals von kleinen Leuten erzählt, die da in den Klüften und Schlüften der Berge hausten, sich aber nur mehr ganz selten sehen ließen. Aber er und seine Gespanen hatten dergleichen immer nur für eitel Märchen gehalten. — Und dann, woher kannte ihn der Wicht so gut, daß er ihn bei Namen nannte, und wie konnte er gar vom Mareili wissen! — Ob wohl Mareili mit ihm kommen würde den weiten Weg mitten im Winter auf den Räterichsboden zur Hochzeit des Zwerges? «Nun, ich werde auf alle Fälle gehen und sehen, wie sich's damit verhält. Ob's Wahrheit ist oder Blendwerk», dachte der Hans, und machte sich frisch an die Arbeit.
Am anderen Tag schon sah er das Mareili. «Weißt du was, Hans», sagte es gleich, «ich hab einen kuriosen Traum gehabt: es deuchte mich, es sei Sommer, und überall blühten die Blumen. aber viel viel schönere als sonst. Auf einer grünen Matte, die sah ganz dem Räterichsboden gleich, begegnete ich einem winzigkleinen bärtigen Mandli, in zündfeuerrotem Gewändlein, ein goldenes Krönlein auf dem Haupt. Der grüßte gar manierlich und reichte mir einen prächtigen Maien, einen so schönen habe ich meiner Lebtag noch nie gesehen. <Gelt, Mareili>, sprach es, mit einem silberfeinen Stimmlein, <du kommst doch von heute ab in acht Tagen mit dem Hans zusammen hierher an meine Hochzeit?> Und ehe ich ein Wort sagen konnte, war das Mandli verschwunden. Ich habe den Traum der alten Lina erzählt. Der wurde katzbang? Wem der Zwerg erscheine,
dem tue er Böses! Aber das glaube ich nicht, denn das Mandli hat's sicher nur gut mit mir gemeint. Und überdies: alles war ja nur ein Traum!» Jetzt war die Reihe an Hans, zu erzählen, und er berichtete dem Mareili, was er unter den Wettertannen erlebt, von Anfang bis zu Ende. Sie wurden tätig, miteinander an die Hochzeit zu gehen. Aber keinem Menschen wollten sie ein Sterbenswörtlein davon sagen.Am achten Tage erwachten die Leute von Guttannen früher als sonst, denn bald nach Mitternacht war der Föhn eingebrochen und chutete von der Grimsel herab. Miteins war aller Schnee verschwunden. Matten und Weiden lagen aper bis hoch hinauf. Der Himmel war blau wie mitten im Sommer. Die Luft wehte warm und gegen den Räterichsboden zu schien es, als blühten die Alpenrosen an Gand und Wand. Die Aare rauschte und toste im vollen Schwall, und von der Handeck her toste dumpf der Sturz der Fälle. Die Leute staunten ob dem Wunder und werweißten hin und her, wie das auch so habe kommen können. Hans und Mareili aber stiegen unbemerkt selbander zu Berg. Ein bunter Regenbogen wölbte sich über der schäumenden Gischt der Schlucht, durch die die Aare brauste. Hell schimmerten im Widerschein der Sonne die Scheiben der Sennte. die ob der Schlucht unter den alten Tannen stand. Wie sie nahten, öffnete die Türe sich, und über die Schwelle trat ein Zug von kleinen Männlein in braunen goldgestickten Gewändlein, und ein jedes führte ein festlichgeputztes eben so winziges Fraueli an der Hand, in schneeweißen Kleidlein, geschmückt mit wasserhellen Kristallen, die wie Tautropfen in der Sonne glänzten. Der Anführer der Schar, der die Schwungfeder eines Schneehuhns an der Kappe trug, blieb vor Hans und Mareili stehen, verbeugte sich ehrerbietig zum Gruß und sprach: «Unser König schickt uns zu eurem Empfang. Wir werden euch zum Festplatz geleiten, und, damit wir mit euch gleichen Schritt halten mögen, so erlaubt uns, unsere Pferde zu besteigen.» Sprach's und wink-
te, da kamen kleine flinke Knechtlein hurtig mit zierlich aufgezäumten Gemsen herbei, das Geschirr über und über mit silbernen Glöcklein behangen. Und Männlein und Weiblein schwangen sich in den Sattel, und, Hans und Mareili in die Mitte nehmend, zog das kleine Volk unter hellen Jubelrufen bergan. Allenthalben von Nossen und Tossen herab tönte das Spiel von kleinen Musikanten - es war, als sängen die Engel im Himmel - und aus allen Büschen und Bäumen. Felsen und Flühen kamen neue Scharen festlich gewandeter Wichte auf Gemsen und auf Murmeltieren geritten, oder auf Schneehühnern und Bergdohlen von Zinnen und Zacken geflogen und mehrten den Zug.Auf dem Räterichsboden blühten die Alpenrosen und allethalben leuchteten blaue Enziane und der würzige Duft der Bränderli erfüllte rings die Luft. Weit und breit standen zierliche Laubhütten und Zelte. Dazwischen schmurzelte und briet es lustig an den kleinen Feuerlein. An langen Tischen schmauste zahllos das kleine Volk. In der Mitte ragte das königliche Zelt empor, aus seidenweißem Asbest gewoben, mit der goldenen Krone auf der Spitze. In einem prächtigen Gefährt, von stolzen Steinböcken gezogen, kam das königliche Paar den Gästen entgegen gefahren. Es war der Zwerg, den Hans aus dem Rachen des Stollenwurms gerettet hatte. «Willkommen zum Fest!» sprach der König, «schau hier, das ist meine Braut! Und es freut mich, auch deine Verlobte kennen zu lernen.» «Oh, so weit ist's mit uns noch nicht», antwortete Hans. «Ja, ich weiß schon, weiß schon», sagte das Mandli wieder, «aber, ehe der Monat um ist, werdet ihr Eheleute sein! — Doch nun kommt und seit unsere Gäste für die Dauer des Festes!»
Drei Tage lang schien in Guttannen die Sonne warm wie im Sommer. Hans und Mareili waren ausgeblieben seit jenem ersten Tag, und die Dörfler vermuteten schon, sie hätten sich aus Kummer ein Leides getan; denn alle wußten, wie es um sie bestellt war. Mareilis Vater war trostlos. Jetzt
reute ihn, daß er so hart gegen sein eigen Kind gewesen und er schwur hoch und heilig, wenn die beiden noch am Leben wären, wolle er alles wieder gutmachen. Man fragte, man werweißte, man suchte. Aber niemand wußte Auskunft.Hans und Mareili hatten sich derweil an dem Fest nach Herzenslust vertan. Tanz, Spiel und Schmaus drängten einander, und unversehens waren ihnen die Tage vergangen, grad als wären's bloß ebenso viele Stunden. Am Abend des dritten Tages geleiteten der König und die Königin sie durch das Gewimmel des feiernden Völkleins, und unvermerkt kamen sie an das Brücklein, welches den Räterichsboden von dem wüsten Geröllfeld trennt, das zwischen dieser Stelle und der Handeck sich erstreckt. «Unsere Lustbarkeit ist zu Ende», sprach da der König. «Wir müssen für diesmal scheiden. Ich muß zurück in mein Reich unter der Erde und das Feuer schüren, das in Ustagen die Blumen und Blätter allenthalben aus dem Boden treibt, und mein Fraueli, das sorgt für die Quellen und Bäche, so daß sie springen und sprudeln und alles tränken, was da sprießt und sproßt. —So lebt denn wohl! Und vergeßt nicht, uns dann auch rechtzeitig zu eurer Hochzeit zu laden. Hier», sagte er zu Hans gewandt, indem er drei runde glänzende Quarzkiesel vom Boden aufhob, «hier nimm diese Steine und hab Sorg dazu. Bedarfst du meiner, so wirf nur immer einen dieser Steine in die Aare und nenne Tag und Stunde und die Sache, der es gilt, und ich werde pünktlich erscheinen.» Die kleine Königin aber löste den Maien von Enzianen und Alpenrosen, den sie an der Brust trug, und reichte ihn Mareili. «Nimm diese Blumen zum Angedenken», sagte das allerliebste Wesen, «sie verwelken nie, und sollte einst eines deiner Kinder erkranken, so lege ein Blättlein aus dem Strauß in die Wiege, und es wird alsbald genesen.» Noch ehe Hans und Mareili recht wußten, was ihnen geschah, war aufs Mal alles verschwunden: Blust und Wust, der König mitsamt dem unzähligen Völklein.
Die Sonne ging eben zu Gold, als Hans und Mareili ins Dorf zurückkamen. Niemand wollte ihnen glauben, als sie ihre Erlebnisse erzählten. Mareilis Vater, den die Angst um sein Kind zuvor weich und gefügig gemacht hatte, tobte, fluchte und schalt, daß schier die Sterne vom Himmel fielen, und verbot der Tochter jeden weiteren Umgang mit Hans. dem er als einem Lotterbuben das Haus verbot.
Voller Zorn und Verzweiflung irrte Hans nun in den verschneiten Fluren umher. Denn mit dem vierten Tage war der Zaubersommer zerronnen, so wie er gekommen, und tiefer Schnee deckte wieder Berg und Tal. Und zu Eis erstarrt waren die Aare und alle Bäche. Trübsinnig stand der Hans unvermerkt wieder unter der alten Wettertanne. wo er den Stollenwurm erschlagen hatte. Da zupfte ihn plötzlich etwas am Rock. Es war das Zwergenmandli. «Nun, Hans, dein Schwiegervater will scheints hart gegerbt sein, ehe er die Haare läßt. Doch sei guten Mutes! Es soll dir noch alles nach Wunsch gehen.» «Ach», antwortete Hans mißmutig, «ich weiß nicht, wie das zugehen sollte. Gerne möchte ich ja euerm Worte glauben. Aber vielleicht kommt alles nur noch ärger durch eure Dazwischenkunft. Denn seit dem Besuche bei euch, darf ich Mareili nicht einmal mehr sehen.» «Ach was, Hans, sei nicht so stiegelsinnig! Geh jetzt heim und leg dich beizeiten auf den Laubsack, sonst möchtest du heute Nacht vielleicht nicht erwachen.» Sprach's und war verschwunden.
Der Hans ging kopfschüttelnd heim, wenig fehlte, er hätte mit sich selber geredet, und tat, wie er geheißen war. Um Mitternacht weckte ihn plötzlich ein greller Schein, der die Nacht taghell erheiterte. Mareilis Haus stand in lichter Lohe. Geschwind wie der Wind rannte Hans hinzu. Das ganze Dorf lag im tiefen Schlaf, und auch in dem brennenden Haus regte sich niemand. Schon schlugen die Flammen an den Dachsparren hinauf. Durchs Feuer sprangen Zwerge und warfen Pechkränze in die Glut. Hans rief, so laut er
vermochte, fürio! um die Dörfler zu wecken. Da verschwanden die Zwerge. Am Fenster aber zeigte sich Mareili, die Hände ringend. Die Balken barsten, die Treppe stürzte ein. Hans schlug eine Leiter an und kletterte hinauf, so geschwind, wie ein Eichhorn an einer Tanne hinauf fährt. Er sprang durchs Fenster in die brennende Kammer. Die Flammen schienen vor ihm zu weichen. Aber da war er schon wieder und stieg behend die Leiter herunter, Mareili ohnmächtig auf den Armen tragend. Er setzte sie ab und schon war er wieder die Stiegen hinauf und brachte auch ihren Vater glücklich aus dem brennenden Haus heraus.«Hans», sagte der Alte, ganz verstört, «Hans, jetzt sind wir gleich reich, du und ich.» «Ja», erwiderte Hans, «jetzt gilt der Spruch:
«Ds Harzemachers Tochter und d's Hungerlyders Suh, die beiden händ enander einewäg gnuh.» und er umarmte das Mareili und küßte es vor allen Leuten mitten auf den Mund. Und am anderen Tage schon warf er einen der Kiesel in die Aare, um den Zwergenkönig samt seiner Gemahlin zur Hochzeit zu laden. |
Als man die Brandstätte aufräumte und die Trümmer des Hauses durchsuchte, fand man den Maien. den das Zwergenweiblein Mareili geschenkt hatte, frisch und unversehrt unter der rauchenden Asche. Er war wie durch ein Wunder erhalten, denn die Lade, in der er gelegen, war verbrannt. Mareili trug ihn beim Kirchgang als ihren schönsten Schmuck an der Brust.
Lange hatte das Hochzeitpaar auf den Zwergenkönig gewartet. Vergeblich, er blieb aus. Als man nun aber nach der Trauung zu Tische ging und die Suppenschüssel abdeckte, siehe, da war die Suppe verschwunden, die Schüssel aber bis zum Rande mit Goldstücken gefüllt. Das Haus wurde stattlicher und schöner wieder aufgebaut. Und Hans, der nun
der reichste Mann im Dorfe war, lebte fortan glücklich mit Mareili. Die verbliebenen Kiesel aber trug er eines Tages auf den Räterichsboden hinauf und legte sie dort nieder, damit niemand in Zukunft sie sollte mißbrauchen können, indem er dem guten Zwerg innig Dank sagte. Mareilis Maien aber bewährte im Laufe der Jahre, die da gingen und kamen, häufig seine heilende Kraft. Ihre Kinder wuchsen und gediehen. Und in hohem Alter beschloß ein sanfter Tod ihr glückliches Leben an ein und demselben Tage.
Der Silberberg
Es war einmal ein blutjunger Geselle, dem waren beide Eltern gestorben und sie hatten ihm nichts hinterlassen als gesunde Glieder, ein frisches Herz und unverdrossenen Mut. Aber so allein und verlassen hielt es ihn nicht länger in der Heimat und er beschloß, in die weite Welt hinaus zu wandern, daß er fremde Länder beschaue und anderer Menschen Sitten kennenlerne, und, wer weiß, dachte er. vielleicht mache ich da draußen mein Glück, denn das Glück soll auf der Straße liegen, sagt ein altes Wort. — Und so schnürte dann unser Geselle sein Bündel, nahm den Weg unter die Füße und wanderte ohne Rast und Ruh über Berg und Tal, und zweimal ging die Sonne auf und zweimal ging sie nieder, und noch immer wollte der Weg kein Ende nehmen. Dem Burschen aber deucht's, es könne nun nicht mehr weit sein bis zum Ende der Welt.
Am dritten Tage kam er in ein liebliches Tal beidseits zwischen hohen Bergen, und dunkle Tannen standen hoch die Halden hinauf. Die Bergseiten aber waren zerschrunden und zerklüftet von reißenden Wildbächen, die hatten tiefe Runsen gerissen voller Grus und Grien. Als die Sonne eben auf der Höhe der Berge stand, kam er zu einer Gand, da fühlte er sich mit eins so müde, daß er sich unter einer alten Schirmtanne ins weiche Moos streckte, um ein Weilchen zu ruhen. Ein leiser Wind bewegte die Wipfel der Tannen. Wie er so dalag und die Augen schweifen ließ, erblickte er gerade gegenüber auf einem schroffen Nossen das Gemäuer einer alten Burg. Ei, dachte er bei sich, was mag das voreinst für ein lautes, lustiges Leben gewesen sein, als da die alten Ritter ein und ausritten mit Waffengeklirr und Hörnerschall, und erst in den Hallen, wenn die Herren und Edelfrauen an festlicher Tafel saßen und einander bei Lautenschlag und Liederklang aus goldenen Bechern zutranken: — und unversehens war der gute Geselle eingeschlummert.
Aber wie ihm die Augen zugefallen waren und seine Seele versunken im tiefen Schlafe, da gingen ihm bunte Träume auf. Träume von Glück und Glanz, so hell wie die Sterne am Himmel. Und da war's ihm, als sehe er drüben ein herrliches Schloß, das glänzte wie lauteres Gold gegen die Sonne, und auf dem Söller des höchsten Turmes saß die allerschönste Jungfrau, ein goldenes Krönlein auf dem goldblonden Chruselhaar, die winkte ihn mit ihrer lilienweißen Hand zu sich herauf. Und im selben, da wisperte und flisterte es in allen Bäumen, es trippelte und tappelte in Busch und Strauch, und aufs Mal stand ein uraltes Waldmännlein vor ihm in einem kurzen, grauen Tschöplein, ein haseliges Stet klein in der Hand. Ein langer, schlohweißer Bart hing ihm bis über die Knie herab, und Augsbrauen hatte es, die waren so buschig und spissig wie Reckholdergesträuch. Aus Äuglein, die dicht beieinander lagen, schwarz wie Moosbeeren. beschaute der Wicht den Schläfer eine Weile und hustete und prustete dabei in seinen Bart, kicherte und lachte. Aber der Geselle schlief fort und erwachte nicht. Da trat das Männlein herzu und berührte mit seinem Stecken die rechte Hand des Burschen. Der erwachte alsbald, saß auf, rieb sich die Augen und strich sich das Haar aus der Stirn. Verwundert staunte er den Wicht an und wußte nicht, was er sagen sollte. Dann aber sprach er herzhaft: «Warum weckst du mich aus dem Schlafe auf? Was willst du von mir?» Da trat das Männlein vom einen Bein aufs andere, räusperte sich, hustete und kicherte, zwinkerte mit den Äuglein und sprach: «Folge mit, wohin ich gehe, ich werde dir den Weg weisen dahin, wo du alles finden wirst, was du im Traume geschaut hast, und noch mehr als das. Nur, schau niemals hinter dich was auch geschehen mag!» Sprach's, wandte sich um und tappelte hurtig ins Gehölz und hielt sein Stecklein vor sich. Und schon stand auch der Geselle auf den Beinen - er wußte nicht, wie ihm geschah - und folgte dem Zwerge auf den Fersen nach mitten durch Gestrüpp und Gestäude,
wo's am dichtesten stand. Aber siehe, die Äste und Zweige bogen sich von selber zur Seite, so daß kein Dorn ihm das Kleid zerriß. So gingen sie eine lange Zeit weiter, immer tiefer und tiefer in den Wald hinein, und unversehens war es finstere Nacht geworden. Aber die Sterne über den Bergen blinkten hell durch die Tannenwipfel hernieder, und der volle Mond schien auf Blätter, Steine und Moos. daß alles schimmerte und flimmerte wie Silber. Hinter dem Jüngling aber huschte, rauschte und raschelte es, als schlüpften Vögel durchs Laub oder schnellten Häslein übers Moos. Endlich tat der Wald sich auf und das Männlein blieb auf der Lichtung stehen: sie standen unter der Fluh, darauf die Burg sich erhob, die der Geselle aus der Ferne gesehen hatte. Da sprach das Männlein: «Folge mir weiter nach, aber schau beileibe nicht hinter dich!» und dann klomm es hurtig wie ein Wiesel den Fels hinan, so daß der Jüngling ihm kaum zu folgen vermochte.Endlich langten sie oben an. Das Tor war verschlossen. Da tat der Zwerg drei Schläge mit seinem Stecklein an das Schloß, und alle Riegel sprangen auf. Das Männlein blieb vor dem Tore stehen und sagte wieder: «Schau nicht hinter dich und du wirst dein Glück finden!» und damit war es verschwunden, wie weggeblasen. Der Jüngling aber ging auf leisen Sohlen vorwärts - denn es war ihm doch nicht ganz geheuer zu Mute - durch ein langes, dunkles Gewölbe. Am Ende des Ganges kam er zu einer schmalen Wendeltreppe. Er stieg die Treppe hinauf und kam in eine weite, gewölbte Halle, beschlossen von mächtigen Flügeltüren. Die standen offen. Er ging hindurch und kam in einen gewaltigen Saal, an dessen Wänden bunte Wappenschilder und mannigfaltige blanke Wehr und Waffen hingen. Der Jüngling blieb stehen und beschaute die prächtige Zierat, da hörte er aufs Mal einen dumpfen Ton wie fernes Donnerrollen oder das Tosen eines Wassersturzes. Ein kalter Schauter fuhr ihm den Rücken hinunter, und die Knie schlackerten
ihm vor Angst. Aber er raffte sich auf und schritt weiter, Fuß vor Fuß setzend, dem Geräusche zu.Er kam abermals zu einer Tür. Er drückte die Klinke, die Tür sprang auf, und ein neuer Saal tat sich auf, noch größer als der vorige, und noch prächtiger zu schauen. Mitten drin aber - oh Graus - saßen lautlos, im schwachen Schein einer Ampel um einen großen runden Tisch zwölf düstere Mannen in langen, schwarzen Mänteln, breitrandige Schlampihüte mit wallenden Federbüschen tief über die Stirn herabgezogen, darunter hervor aber funkelten feurige Augen, wie glühende Kohlen dem Burschen entgegen. Auf der Tischplatte stand vor einem jeden ein weißer Totenschädel gefüllt mit einem Trank, der war rot wie Blut.
Dem Jüngling gefror das Blut in den Adern und das Mark in den Knochen vor Grauen. Jetzt erhob sich der älteste von den Zwölfen, nahm eine große goldene Kugel, die neben seinem Sitze lag, und reichte sie dem Gesellen. Dann wies er nach dem anderen Ende des Saales, das hell erleuchtet war. Da stand ein goldenes Kegelspiel. Und der Alte sprach: «Verbinde dir die Augen und tu drei blinde Würfe. Aber sieh zu, daß du dabei den König aus der Mitte der anderen allein umwirfst. Gelingt's dir nicht, so bist du dem Tode verfallen. Schon mancher, der sich hierher verstiegen, hat's versucht, doch noch keinem ist es gelungen. Dein Leib wird in Stücke zerrissen und vor die Raben geworfen, die diese Mannen umfiettern. dein Blut aber trinken wir in unserem Wein.» Dem Mutigen hilft Gott, dachte der Jüngling, drückte sich die Mütze mit der Linken fest vor die Augen, ergriff mit der Rechten die Kugel und tat den ersten Wurf. Und siehe da, der König war aus dem Ris wie herausgeblasen. Da erhoben sich die finsteren Mannen mit beifälligem Gemurmel von ihren Sitzen bis auf einen und tranken dem Jüngling zu. Der eine aber, der auf seinem Stuhl sitzen blieb, war der König, der war seit vielen hundert Jahren durch einen bösen Bann verzaubert gewesen und hatte
der Erlösung geharrt. Der Alte nickte dem Gesellen freundlich zu, und wies dann auf die Tür am andern Ende des Saales, und die Mannen geleiteten ihn bis zur Schwelle, dann kehrten sie stumm an ihre Plätze zurück.Der Jüngling öffnete keck die Türe und - dergleichen hatte er seiner Lebtage noch nie gesehen - er trat in einen Wundergarten: Ringsum, soweit sein Auge reichte, blühten in Fülle die lieblichsten Blumen und ein Duft erfüllte die Luft. so süß, daß ihm schier die Sinne schwanden. und überall standen in langen Zeilen die prächtigsten Bäume, deren Zweige und Äste hingen so voll der seltensten Früchte, daß sie bis auf den Boden sich bogen, und allenthalben im Laube schwirrten und flatterten, zwitscherten und pfiffen buntgefiederte Vögel, rote und blaue, weiße, grüne und gelbe, und manche schimmerten gar in vielen Farben zugleich. Und so fröhlich liedeten sie, daß es dem Gesellen ganz warm ward unter dem Tschopen. Unter gewaltigen Schattenbäumen glänzten Teiche und Seelein, darin sich Fische tummelten, blauschimmernd die einen, die anderen goldfarben und wieder andere rot wie Mohn. Springbrunnen sprudelten silberhell empor und plätscherten sanften Schalles. Hirsche, Rehe, Hasen und andere Tiere des Waldes ästen friedlich auf den Matten und äugten ohne Scheu zu dem Jüngling herüber.
Da auf einmal ward's stille rundum, kein Lüftlein ging, kein Blättlein regte sich, kein Tierlein rührte sich, kein Vöglein flog. Aber kaum vernehmbar kam aus der Ferne ein Getön wie von leiser Musik, und alsgemach erscholl eine zarte Weise und ein Lied, inniger und inniger und immer näher. Dem Jüngling war's, als müßte ihm das Herz zerspringen vor lauter Lust und Wonne. Da trat unter zwei blühenden Bäumen eine Jungfrau hervor in blütenweißem Gewande, darüber ein Mantel herab wallte, blau wie der Himmel, und ein goldener Stirnreif, mit Edelsteinen besetzt und Perlen, die glitzerten wie Tautropfen im Strahl
der Morgensonne, umschloß ihr goldenhelles Gelock. Und der Jüngling erkannte in ihr das Bild jener Jungfrau, die er im Traume geschaut.Mit einer Stimme so fein und rein wie der Schall eines Silberglöckleins, das die Gläubigen von dem Altar zur Andacht ruft, sprach die Jungfrau: «Du bist der erste, der hier mich heimsucht in diesem Garten, und noch keines Menschen Auge hat mich je erblickt. Lösest du den Zauber, der auf dem Haupte meines Vaters liegt, so hast du zugleich auch mich erlöst, und meine Hand wird dein sein mit seinem Segen. Aber vorerst ist noch manche Mühsal und Gefahr zu bestehen. Tief im Silberberg ist ein Ring verschlossen. den Schlüssel dazu verwahrt eine Hexe dort drüben auf dem Berge jenseits des Tales. Der Ring aber ist gleich diesem Ringe hier an meiner Hand», und die Jungfrau streifte einen goldenen Ring mit einem leuchtenden Rubin vom Finger und reichte ihn dem Jüngling. «Nimm diesen Ring», sprach sie weiter, «birg ihn an deiner Brust, und wenn du vor das Schloß kommst, wo die Hexe haust, so stehe still und halte den Ring in die Höhe. Dann wird die Hexe sich im Fenster zeigen und dir sagen, was du weiter zu tun hast. Gewinnst du den Ring im Silberberg, dann ist auch sie erlöst. Du aber wirst gebieten über den Berg und alle seine Schätze und der reichste Mann sein weit und breit.» Der Geselle war wie aus den Wolken gefallen und konnte nichts fragen und nichts sagen; er empfing den Ring und barg ihn im Busen. Aber da war die Jungfrau verschwunden, als wäre sie in der Erde versunken. Als der Jüngling, ganz sturm von allem, was er in dem Schlosse gesehen und gehört, wieder vor das Tor hinaus kam, da stand auch das Waldmännlein aufs Mal wieder da, hustete und räusperte sich in seinen Bart und kicherte und lachte. Es stand von einem Fuß auf den anderen, zwinkerte mit den Äuglein, klopfte auf die Tasche seines Tschöpleins und nahm ein seidenweißes Tüchlein hervor, das im Lichte in allen Farben
des Regenbogens schillerte. Das band der Wicht an sein Stecklein und ließ es wie ein Fähnlein lustig im Winde flattern. Und ehe der Bursche sich's versah - er hätte nicht sagen können, wie's geschah -, standen sie selbander schon vor dem Schloß auf der anderen Seite des Tales. Aber da war das Männlein aufs Mal auch wieder verschwunden.Der Jüngling griff in den Busen, holte den Ring hervor und hob ihn in die Höhe. Da erschien unter dem Fenster eine graue verhutzelte Alte, mit wirren verfilzten Haaren, in einer ganz zerschlissenen Schlutte, die war zündfeuerrot. Den einen Arm hielt sie in die Hüfte gestemmt, mit dem anderen aber schwenkte sie einen Schlüsselbund und mit heiserer Stimme schrie sie hinab:
«Schlüssel, Schlüssel kling, klang, kling, Tief im Berge liegt der Ring. Geh mir. Fant, vom Schloß hier fort. Schleich dich hin zur Scheune dort. Schlüssel, Schlüssel, kling, klang, kling, Dorthin ich den Schlüssel bring.» |
Umweit von der Burg stand ein alter Stall und eine verfallene Sennhütte. die waren leer und verlassen. Der Geselle ging dahin und wartete vor der Hütte. Mittlerweile war es stockfinstere Nacht geworden. Der Mond war untergegangen und dunkle Wolken verbargen die Sterne. Da grunzte und quickte es aufs Mal gar gräßlich hinter dem Stalle, daß der Schauder dem Jüngling alle Haare sträubte, und plötzlich rannte eine große, schwarze Sau mit glühenden Augen und gesträubten Borsten auf ihn los, den rasselnden Schlüsselbund im Rüssel. Das Grausen packte den Gesellen, und lähmte ihm alle Glieder, aber er biß die Zähne aufeinander und klemmte die Nase zusammen und mit einem herzhaften Ruck riß er dem Untier die Schlüssel aus dem Maule. Grunzend stürzte die Sau davon. Da stand aufs Mal das
Waldmännlein wieder da, hustete und räusperte sich in seinen Bart und kicherte und lachte. Es zwinkerte mit den Äuglein und klopfte dem Burschen mit seinem Stecklein auf die Schulter. Dann spannte es sein seidenweißes Tüchlein wieder aus, und im Nu standen sie selbander vor dem Silberberge. Aber da war das Männlein schon wieder verschwunden.Jetzt war guter Rat teuer. Denn die Fluh des Silberberges stieg glatt wie Glas empor, und nirgends war ein Tor zu sehen, nur Spalten, Klunsen und Ritzen. Vielleicht paßt der Schlüssel in eines der Löcher, dachte der Geselle. Er probierte und da paßte just der erste beste Schlüssel ins nächste Loch. Er drehte ihn dreimal um, und der Fels tat sich lautlos auf. Der Jüngling trat ein und kam in einen langen, schmalen Gang, daraus ein schwacher Schimmer drang. Er ging auf den Schein zu, und je weiter er vorwärts schritt, um so heller wurde es um ihn her, und die Wände begannen zu leuchten. Da endete der Gang, und er kam hinaus auf einen weiten überwölbten Platz, darin war ein kleines Seelein. Mehrere andere Gänge gingen von da aus strahlenartig nach allen Richtungen. Aber wie er genauer hinsah, gewahrte er, daß alles Gestein eitel Silber war, auch der Teich war aus flüssigem Silber, und rings träufelten aus dem Gewände und von dem Gewölbe Silbertropfen, und aus allen Klüften und Schlüften rieselten Silberbächlein in das Seelein, wie aus den Adern das Blut ins Herz sich ergießt.
Aufs Mal aber hub es an zu flimmern und zu glimmern in den Mündungen aller Gänge, Schächte und Stollen, und getrippelt und getappelt kamen hustend und prustend, sich räuspernd, kichernd und lachend unzählige winzig kleine, langbärtige Erdmännlein mit Hämmern und Hauen. Sie hatten spitzige Mützen auf, und an den Mützen vorn über der Stirn waren Edelsteine befestigt, die leuchteten heller als Grubenlichter. Voller Mutwillen hüpfend und müpfend, kichernd und trällernd, wuselten und diselten sie dem
Gesellen um die Beine und kribbelten zwischen den Füßen durch Ameisen gleich, sodaß er ganz irr und wirr wurde von all dem Gewimmel. Plötzlich stellten sie sich in einer Reihe auf, ordneten sich zu einem Zug und liefen flink durch den hellsten Gang tiefer in den Berg hinein. Der Geselle besann sich nicht lange, sondern folgte ihnen hurtig nach. Denn es nahm ihn nach allem gar sehr wunder, wie's weiter innen aussehen möchte. Da aber war eine Pracht allenthalben an Wänden und Gewölben, es ist nicht zum sagen: Alles Gestein strahlte und funkelte in den mannigfaltigsten Farben, es leuchtete wie das Abendrot auf den Gletschern und GipfeIn, es schimmerte wie der Schnee der Firne und glänzte grün und blau wie Gletschereis. Der Jüngling aber mußte die Augen schließen ob all dem Glanz. Und alle Wasser und Quellen sangen und klangen tief aus dem Herzen des Berges herauf wie ferne Musik. Ei, was mag's wohl da unten erst für Herrlichkeiten geben! — dachte der Geselle, strich sich die Locken aus dem Gesicht, nahm den Rubinring der Jungfrau aus dem Busen und steckte ihn auf seine Kappe, denn wie die Erdmännlein wollte auch er den Stein sich leuchten lassen und mit etwas Schönem sich zeigen in all der Pracht. Er stand und drehte die Mütze in den Händen, beschaute den Ring, und siehe, aus dem Rubinstein leuchtete wunderhold das Bild der Jungfrau, daß er vor Entzücken schier verging. Er küßte den Ring, drückte sich die Mütze wieder aufs Haar und eilte dem Zug der Erdmännlein nach.Bald mündete der Gang aus, und vor ihm lagen weite, hohe Hallen, größer als die größste Kirche. In der Mitte war die Haupthalle und seitlich zwei Nebenhallen, die waren durch lange Reihen herrlicher Säulen getrennt. Die Schäfte der Säulen ruhten auf Sockeln von himmelblauem Saphir, und der Wulst gleißte wie flüssiges Rotgold. Die Schäfte waren aus purem Silber, sie schwollen nach der Mitte zu an und verjüngten sich nach oben. Die Häupter waren gebildet
wie Feuerlilien, und darüber wölbten sich weitgespannte goldene Bogen und azurblaue Kuppeln, davon es strahlte und funkelte als wie von tausend Sternen und Sonnen. In der Tiefe der Haupthalle aber erhob sich über sieben steilen Stufen, die in den sieben Farben des Regenbogens glänzten, ein hoher, goldener Thron. Und auf dem Throne lag ein Kissen aus hellgrünem Sammet, und auf dem Kissen lag ein Ring mit einem leuchtenden Rubinstein, ganz dem Ringe gleich, der auf der Mütze des Jünglings prangte. Das war also der andere Ring, den er holen sollte.Wie der Geselle durch die Halle auf den Thron zuschritt, hub der ganze Bau zu tönen an von sanft rauschender Musik, und alle Säulen und Gewölbe klangen. Da wuselten aufs Mal von allen Ecken und Enden die Erdmännlein herbei und hüpften und sprangen, tanzten und sangen und trieben mutwillig ihr Spiel mit dem Burschen, der eben die ersten Stufen des Thrones hinanstieg, so daß ihm schier Hören und Sehen verging. Wie er auf der dritten Stufe stand, warf er das Haupt zurück, um besser nach dem Ring auf dem Kissen sehen zu können, da fiel ihm die Mütze. die ihm nur lose auf den Locken saß, rückwärts vom Kopfe mitsamt dem Ring. Er wandte sich um, daß er sie aufhebe. Aber da ward's mit einem Schlage nachtschwarz und totenstill um ihn her.
Der Jüngling fuhr aus dem Schlafe auf. Die Morgensonne schien golden durch die Baumwipfel, die Quellen und Bäche rauschten, und rundum im Walde zwitscherten die Vögel. Er aber saß unter derselben Tanne, unter der er sich am Abend zuvor niedergelegt hatte. Er wusch sich Gesicht und Augen frisch mit dem Morgentau und schaute in den hellen Tag und schüttelte den Kopf. Dann setzte er seine Mütze auf, zog ein Stück Brot aus dem Schnappsack, schoppte es in den Mund und nahm den Weg wieder unter die Füße. «Bei Gott», sagte er zu sich selber, «bei Gott, hinter mich schauen werd ich nimmermehr!»
SCHWANKE
Wie's einem erging, der's allen Leuten recht
machen wollte
Eines Tages ging ein Landmann mit seinem Sohne nach der Stadt zu Markte. Der Vater saß auf dem Esel und ritt, der Knabe ging zu Fuß nebenher. Unterwegs begegneten ihnen Leute, die blieben stehen und sagten: «Ei, sehet doch den Alten, der reitet und läßt den armen Knaben gehen! Er täte auch besser, jenen reiten zu lassen, und ginge selber zu Fuß.» Als der Vater das hörte, stieg er alsbald ab, und der Sohn saß auf, und freute sich sehr, daß er auch reiten dürfe. Und dem Alten behagte es, nebenherzugehen. Nach einer Weile kamen wieder Leute des Weges. Die sprachen zueinander: «Schaut nur an Freunde, der Alte muß wohl ein Tor sein, daß er den Knaben reiten läßt, und selber zu Fuß geht. Der hat junge Beine und sollte laufen und traben, indes der Alte ritte.» Der hörte diese Worte, und alsbald saß er hinter dem Sohne ebenfalls auf, und so ritten sie beide fürbaß. Unlang begegneten ihnen abermals Leute. «Gott sei's geklagt», sprachen die, «sehet nur, wie der alte Tor auf dem armen Esel reitet mitsamt dem Sohne! Sie wollen wohl das gute Tier tot haben. Der Alte sollte allein reiten und der Junge gehen.» Als der Alte diese Rede hörte, sprach er zum Sohne: «Wohl, so laß uns absteigen und beide gehen. Der Esel soll auch ruhen und es gemächlich haben.» Also gingen sie beide hinter dem Esel her, der seiner Last entledigt munter die Straße trabte. Da begegneten ihnen wieder eine
Schar Männer und Weiber. Die riefen alle aus einem Munde: «Nein, sehet nur, die beiden müssen rechte Toren sein. der Alte und der Junge, daß sie nicht reiten, sondern ihren Esel leer laufen lassen.» Da sagte der Alte: «O heie, Bub, wohlauf denn, so wollen wir beide den Esel tragen, und hören, was die Leute dann sagen werden.» Sie warfen das Tier zu Boden, banden ihm die Beine mit Stricken zusammen. hängten es an eine Stange und schleppten es dergestalt des Weges weiter. Das aber gefiel dem Esel gar nicht, und er schrie gar jämmerlich. Die nächsten, die die Straße gegangen kamen, riefen: «Wartet, wartet und schaut euch dies Schauspiel an! Einen Esel tragen zwei Männer, wo derselbe doch billig sie beide tragen sollte. Wer wollte auch solches glauben. Es müssen wahrlich rechte Narren sein.» Da seufzte der Alte, sah seinen Sohn an und sprach: «Hör, Bub, was ich dir sage, und bewahr die Worte wohl: Es sei, daß mich der Esel trug oder dich, so sind wir in der Leute Augen Toren. Trägt er uns beide, ist's auch nicht recht. Gehet er leer, ist's wieder falsch; tragen wir ihn gar, dann sind wir vollends Narren. Davon nimm den Rat: Wer vor der Welt bestehen will, der darf in seinem Tun sich nicht beirren lassen von dem, was die Leute sagen, sondern er tue frei nach Fug und Recht, was allemal das Beste ist. Denn die gescheiten Schwätzer, die alle Dinge besser wissen, sind mit sehenden Augen blind sich selber zu Spott und Schaden.»
Das Findelkind
Ein Bauer hatte ein Findelkind groß gezogen, als wie den eigenen Sohn. Als aber der Bub herangewachsen war, da stand ihm der Sinn nach der Fremde, und eines Tages lief er ohne Abschied in die weite Welt, und ließ seine treuen
Pflegeeltern allein zu Haus, statt ihnen die harte Arbeit abzunehmen, wenn sie alt und älter würden. Da rief der Bauer in seinem Unmut: «Ja, wahrlich, das alte Wort ist ewig wahr: Man soll nie ein Findelkind erziehen, keinem Weibe etwas anvertrauen und kein Märzenwasser trinken.» Das hörte die Frau, und sie sagte: «Ach schweig doch still und rede nicht so dumme Sachen. Das ist ja alles nicht wahr!» Denn es wurmte sie, daß der Mann meinte, man könne einer Frau kein Geheimnis anvertrauen. «Warte nur», erwiderte der Mann, «du wirst schon noch inne werden, ob wahr ist, was ich sage, oder nicht!»Nach einiger Zeit, da schaute der Mann gar traurig drein, und machte ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter und keine Stunde schön. Und als die Frau wissen wollte, was ihn plage, da schüttelte er bloß den Kopf, seufzte und sprach: «Nein, das kann ich dir nicht sagen. Es ist entsetzlich.» Aber die Frau ward nur um so begieriger, den Grund seiner Traurigkeit zu erfahren, und lag ihm Tag und Nacht in den Ohren, er solle ihr doch sagen, was es sei, das ihn so bedrücke. Endlich sprach er: «Nun, wenn du's durchaus wissen willst — ich habe einen umgebracht und im Mist verscharrt. Aber Gott gnade dir, wenn du's weiter sagst.» Die Frau erschrak so, daß ihr der Besen aus der Hand fiel, und sie versprach hoch und heilig zu schweigen.
Aber wie sie am Dorfbrunnen die Kübel füllte, da machte sie ein Gesicht wie eine übergelaufene Sauerkrautstande und seufzte in einem fort. Und als die Nachbarsfrau sie fragte, was ihr fehle, da brach sie in Tränen aus und flüsterte: «Ach, daß Gott erbarm! ich darf's keinem Menschen sagen.» «O, mir darfst du es schon anvertrauen, ich werd es gewiß niemand sagen», erwiderte die andere. Da floß der Frau der Mund über, und sie erzählte der andern, welch entsetzliche Untat ihr Mann verübt habe; denn leichtlich spricht ein Weib, was es nicht sprechen sollte. Die Nachbarin machte Stielaugen, man hätte auf das eine knien und
das andere absägen können. Am selben Abend noch wußte das ganze Dorf von der Sache.Der Mann wurde als Mörder gefangen gesetzt und vor Gericht gestellt, und da er nicht leugnete, einen umgebracht und im Mist verscharrt zu haben, zum Tode mit dem Schwert verurteilt. Aber als er auf den Richtplatz geführt wurde, fand sich niemand, der dem allgemein geachteten und beliebten Manne das Haupt abschlagen wollte. Da setzte man eine Belohnung aus und siehe, da trat ein junger Bursche aus der Menge und trug sich als Henker an. Das aber war niemand anderes als das Findelkind. Da sprach der Verurteilte: «Jedem Übeltäter ist vor seinem Ende noch eine Bitte erlaubt, und so werde auch ich dieses Recht haben.» «Gut, so verlange, was du willst, nur nicht das Leben», erwiderte der Obmann. «Nun, so gehet zu meinem Misthaufen», sagte der Mann, «und sehet nach, wen ich umgebracht und verscharrt habe.» Die Hinrichtung wurde aufgeschoben. Man ging hin und fand, daß er seinen alten kranken Geißbock getötet und vergraben hatte. Und darauf stand wahrlich keine Strafe. Man ließ den Mann frei. und alle lobten seine Klugheit. Er aber sprach zu dem Volke: «Sehet, ihr Leute, ich hab es immer gesagt. Und das Wort hat sich erwahrt: man soll kein fremdes Kind aufziehen, keiner Frau etwas anvertrauen und kein Märzenwasser trinken. Und wenn ihr's nicht glauben wollt, so lasset nur ein Faß voll ein Jahr lang stehen, und dann sehet zu, wieviel Ungeziefer es zieht.»
Wie ein Müller um seinen Esel kam
Hinter einer Weißdornhecke an der Landstraße nach Astano lagen zwei Tagediebe in der frühen Nachmittagssonne und ruhten von ihrer Arbeit aus. Sie hatten Nüsse gebettelt in
der Gegend und die schweren Säcke bis hierher gebuckelt.Da kam ein Mann des Weges. Hinter ihm her stockelte ein Esel. Er hatte ihn am Morgen auf dem Markt gekauft und führte ihn frohgemut seiner Mühle zu.
Sagte der eine Landstreicher zum andern: «Schau, wie die beiden im gleichen Schritt einhertrotten. Ich wollte wetten, dem Alten könnte man den Esel abhaiftern, und er würde es nicht merken.» «Hei, da gibts was! Du nimmst den Esel und ich laufe hinter dem Alten her. Ich werde mich schon aus der Sache herausschwatzen können», antwortete der Gesell.
Gesagt, getan. Sie schlichen dem Alten nach, der vom Rattern der Mühlräder etwas schwerhörig geworden war. Der eine flattierte dem Grautierchen, löste es vom Seil und führte es zurück zu den Nußsäcken, der andere band sich die Halfter um den Hals und trottete an des Esels Stelle. Bald wurde der Landstreicher müde und verlangsamte den

Der Müller machte sich gedankenversunken auf den Heimweg. Nach dem ersten Staunen über dieses göttliche Wunder stieg ein Zorn in ihm auf, weil er an diesem Esel so viel Geld verloren hatte. Der andere kehrte lachend zu seinem Gesellen zurück.
Nun aber trachteten sie, den Esel schnellstens loszuwerden, damit sie nicht mit den Strickreitern unliebe Bekanntschaft machten. Darum bogen sie in den nächsten Weg ein, der in ein Nachbardorf führte. Unlang trafen sie ein Bäuerlein, das vom Feld heimkehrte. Im Plaudern trugen sie ihm den Esel für wenig Geld an. Das Bäuerlein witterte einen guten Handel und schlug ein. Hinter des Bauern Scheune teilten sie den Erlös. Nun aber machten sich die beiden Diebe eiligst aus dem Staub mit dem festen Vorsatz, wenn sich wieder eine solche Gelegenheit biete, munter zuzupacken. Der Bauer aber verkaufte den Esel anderntags einem vorbeifahrenden Händler und gewann ein schönes Sümmchen.
Etwa zwei Wochen danach machte sich der Müller wieder auf den Weg, um auf dem Markt des Nachbarstädtchens einen Esel zu erstehen, denn er hatte einen nötig um die Säcke zu tragen.
Als er die angebotenen Tiere beschaute - beim Eid -, da stand ein Esel, der dem, den er in Astano drüben gekauft hatte, glich auf Tupf und Strich. Er näherte sich dem Tier, untersuchte es von allen Seiten und erkannte, daß es dasselbe war, das er vor kurzem erstanden und das ihm auf so merkwürdige Weise abhanden gekommen war. Er tätschelte den Esel, beugte sich zu ihm und tuschelte ihm ins Ohr: «Oh, oh, hast du wieder eine große Sünde begangen, daß du schon wieder hier bist?» Das Grautierchen, nicht gewohnt, daß man ihm ins Ohr flüsterte, schüttelte heftig den Kopf, weil es gekitzelt war. Aber der Müller sagte zu ihm: «Ei, du mußt jetzt nicht den Kopf schütteln und nein sagen. Denn lueg, ich kenne dich. Aber ein zweites Mal lasse ich mich nicht erwischen!» Sprachs und kaufte einen andern Esel.
Betrogene Schelme
Einmal fuhren zwei Kaufleute, zwei rechte Schälke, miteinander aus auf eine weite Reise in ferne Länder, um des großen Gewinnes willen, den sie sich davon erhofften. In einer Stadt nahmen sie einmal Quartier in einer Herberge. Da wurden sie von der Wirtin nach Gebühr empfangen und traktiert; denn diese war eine gute, einfältig Frau, der das Wohl ihrer Gäste gar sehr am Herzen lag. Bei der Abreise befahlen die beiden ihr ganzes Gut und Geld in ihre Obhut mit dem Beding, daß sie beide miteinander wiederkommen und eines Mundes ihr Eigentum zurückfordern wollten, an-
ders dürfe sie es nicht aus der Hand geben. Und so fuhren sie ihres Weges weiter.Die Frau hielt derweilen das anvertraute Gut wohl verwahrt nach ihrer Pflicht, denn fremden Gutes soll man wie des eigenen pflegen. Aber nach einer Weile kam von den zweien der eine ganz unverhofft zurück und sprach: «Ach, gute Frau, ich bin in tiefster Seele betrübt. Groß Ungemach hat mich betroffen. Wisset, mein guter Geselle, der ist tot. In großen Schulden hat er mich gelassen, für die ich jetzt allein aufkommen muß. Gebt mir unser Gut zurück, daß ich den Gläubigern das ihre bezahlen kann.» Die rechtschaffene Frau meinte nichts anderes, als es wäre wahr, was der Schelm da redete, und gab ihm gleich das Gut heraus. Der lachte sich ins Fäustchen und machte sich schleunigst wieder fort.
Unlang aber, begab es sich, daß eines Tages auch der andere Kaufmann wiederkam und sein Gut zurückverlangte. Die Frau in ihrer Unschuld erschrak und sprach: «Gott weiß, wie dies bewandt ist. Eurem Freunde hab ich das ganze Gut gegeben auf sein Geheiß. Er wär' in Not, sprach er, und ihr, sein Geselle, wäret tot.» Der Mann erwiderte: «Ich hab anderes nicht zu sagen, als euch der Bedingnis zu erinnern: das Gut sollte keiner erhalten, wir wären denn beide zur Stelle und forderten es eines Mundes zurück. So war's zwischen uns ausgemacht, und so soll's gelten. Doch wie dem nun sei, ihr schuldet mir auf alle Fälle meinen Teil.»
Da geriet die arme Frau in große Pein und wußte nicht mehr aus noch ein. In ihrer Not ging sie zu einem weisen Mann und klagte ihm ihr Leid und bat ihn um einen Rat, wie sie mit Glimpf aus diesem bösen Handel kommen möchte. Der Ratgeb hörte sich die Geschichte an, dann sprach er: «Liebe Frau, seid nur getrost und guten Mutes. Nach dem, was ich aus eurem Munde vernommen, so sollt ihr nicht zu Schaden kommen bei diesem Schelmenspiel. Ich will euer Fürsprech sein, und ich getrau mich, euch zu
helfen.» Zu dem Kaufmann aber sprach er, nachdem er seine Rede gleichfalls angehört und seiner Schalkheit gewiß geworden: «Die Frau, die hier zugegen ist, sie leugnet nicht; ihr ist von dir und deinem Gesellen Gut und Geld befohlen worden. Das hat sie wohl behütet, wenn ihr beide wiederkämet, so sollte sie es euch zusammen zurückgeben. Dieses Wort steht fest, und alle sind gebunden, sich treu daran zu halten. Geh also hin und bringe deinen Gesellen her. Und zur Stunde wird sie euch alles geben, was sie euch rechtens schuldig ist.» Da zog der andere Schelm mit einer langen Nase ab und suchte seinen Gesellen, er hat ihn aber bis heute nicht gefunden. Also ist die Frau von ihrer Sorge gekommen durch des weisen Mannes Rat.
Der Vogt vo Schwendi
I de Schwendi henne, e Stond hönder Appezöll, ischt emol e Schloß ond im sebe Schloß en Edelmaa gse. De ischt allpott für syn Torin amahi gsesse. En Bueb ischt vil dra verby gange, i d'Berg uhi gi Schottä hole. Dee hed sibe Gschwösterni gka ond ischt gad e Bröckli wyt vom Schloß eweg dehäme gse; im Rachetobel säd me. De Vatter hed döt gmalen-ond bache.
letzt ischt emol de Bueb am Schloß verby gange, ond de Edelmaa hed zonem gsäd, was de Vatter ond d'Muetter tüeid. De Bueb hed cm zor Antwort gee: «De Vatter bacht eh gesses Brot ond d'Muetter macht Böös of Böös.» De Edelmaa hed wölle wessä, was ächt das hääßi, ond ischt do me worde, daß de Alt das Mehl. woner vebachi, nüd zalt hei. ond daß die Alt Bletz in es verschrenzts Häas büezi. Wo do de Edelmaa gfroget hed, woromm as si das tüeid, süd de Bueb: «Ebe dromm, will't üs alls Geld nenscht!» De Edelmaa
het cm do dräut, er weil cm d'Hönd arääze. De Bueb god hää ond verzeih ails mitenand. Do ged em de Vatter e Rät ii, er soll gad en andersch mol d'Taase onderschöberschi trääge ond e Chatz dre tue. De Bueb machts ase ond god do de Weg cm Schloß zue. De Edelmaa stellt en wider z'Red: «Ho, du Witznase, selle chascht mer säge wedesch: hend d'Aegerschte meh wyß, oder schwarz Federä?» Dä Bueb säd: «Meh schwarz.» «Worom?» «Will halt d'Tüfel mit de Zwingherre meh z'schaffe hend als d'Engel!» Do loht de Edelmaa d'Hönd ab. De Bueb loht d'Chatz use. Die Hönd springid de Chatz noe ond de Bueb hed amig möge lache, aber er hed si de gnooteweg is Tobel abgemacht. De Edelmaa nüd fuul, ischt cm mit cm Spieß noc, hed en donné öberchoond z'Tod gstoche.Me cha si tenke, dä Vatter vom Bueb hed do vor Rooch völli gyret ond di ganz Puursam zemme grüeft. Es sönd dem Edelmaa do Füeß gmacht worde, ond er hed nüd möge of de Fähneresetz uhi cho, so hed er scho gse s'Füür zorn Schloß usfiacke!
D'Binziger Chue
Es seid es Pürli zu syner Frau, es weil goge-n-e Chue chauffe. So seit sy Frau zue-n-em: «Ja, de wirscht e türi beibringe.» Do seit de Ma: «Ja, de chascht dänn luege.» Und do gaht er uf de Mert, und do ischt det es Mändeli miteme Chucli und do seit er zunern: «Mano, wie tär das Chueli?» Und so seit das Mandeli: «A gsehnder, i gib si urne-n-en Schilig.» Do seit er: «He, da isch nüd vil, warum gänd er mer si urne-n-en Schilig?» Do seit das Mandeli: «He, i wil ech's säge:
«si mag das Heu nüd byße, si mag vor Angscht nüd schyße und git kei Milch dezue und ischt die alt Binziger Chue.» |
Do chauft si de Ma und füehrt sie hei. Do seit er zur Frau: «Wa meinscht?» Do seit si: «He s'ischt e bravs Chueli. aber de wirscht au brav zahlt ha!» Do seit er: «He, so rat emal!» Do seit si: «Nün Tuble.» Do seit er: «Hasch nüd erate. muescht weniger rate.» Do seit si: «Acht Tuble» — und so abe bis uf feuf Guldi, 4, 3, 2, 1 Gulden, 30 Schilig, 20, 10, 5, 4, 3, 2 Schilig. Jez rati nüme. Ein Schilig!» «Jez häsch es ufeimal erate.» Do füert er d'Chue in Stal und git ere brav z'frässe, Heu und Gras. Do git si der erscht Tag ei Maß Milch, und do git er ere nameh z'frässe, do git si der ander Tag zwo Maß Milch und e so furt bis uf zwölf Maß. Und so seit er zur Frau: «Ghörscht, jez hämmer e schöns Häuptli Veh und jez wil j mittere z'Mert und wil si verchauffe. «Do seit d'Frau: «Ja, isz wirsch si wieder wele go verchauffe und dann chunscht vilicht en Schilig über.» Und do seit er: «He, de chascht ja dänn luege», und do gat er mittere uf de Mert, und do chunt eine und seit: «Ghöred ihr. Mano. ihr händ da es Gstaatshäupli Veh, was wänd er defür?» Und do seit er: «Hundert Guldi und gwüß e keis Äugerli weniger, gsehn. der, si git al Tag zwölf Maß Milch.» Und do chunt er die hundert Guldi über, und do häb d'Frau wider müese-n-ufe rate vo eim Schilig bis uf hundert Guldi.
Etwas von den Lötschern
Wäre das Pulver nicht längst erfunden, die Lötscher hätten es getan, denn sie sind erfindungsreiche Leute.
Es mangelte ihnen an Salz. Nach langem Werweißen hatte einer ihrer Räte einen glänzenden Einfall wie man billig zu Salz käme: man könnte Salzkörner säen!
Wie gedacht, so getan. Der Gemeindeacker wurde bestellt und vor versammeltem Rat streute einer Salz in die Furchen. Es gediehen aber nur Nesseln.
Im Spätsommer kam einer der Räte am Acker vorbei und verspürte auf einmal die Not, etwas zu verrichten. Da brannten ihn die Nesseln an den Hintern. Freudig eilte er ins Dorf zurück und rief: «Es ist geraten, es ist geraten! Das Salz tut schon rätzen!» Der Gemeinderat versammelte sich und die Mannen schritten bedächtig dem Acker zu und streckten vorsichtig prüfend die Hände in die Nesseln. Wie vom Blitz getroffen zuckten sie zurück. Meinte einer: «Ja, ja, drin wäre es schon, aber wie können wir es herausbekommen?» »
Die Schwarzkünstler und der Teufel
Einmal haben sieben fahrende Schüler aus dem Bündnerland sich zusammengetan, um miteinander nach Wittenberg zu reisen, daß sie allda auf der Hohen Schule die Schwarze Kunst studierten. Aber der oberste Herr und Meister aller schwarzen Kunst, der Teufel, hatte sich als Lohn ausbedungen: wenn sie ausgelernt hätten und Meister geworden wären, dann werde er nach dreien Tagen kommen und einen von ihnen heim in die Hölle holen. Aber welcher von ihnen das sein würde, das wußte keiner.
Als nun die lange Lehrzeit um war, und ein jeder sein Meisterstück geleistet und die Prüfung bestanden hatte, da ward es allen gar übel zu Mute, denn keiner wußte, ob der Böse nicht just ihn auswählen werde. Nur einer, der jüngste, der immer als lustiger Schelm und listiger Schalk sich bezeigt hatte, war munter und wohlgemut wie immer. «Seid getrost, liebe Gesellen, und fürchtet euch nicht», sprach er. «Ich weiß einen Rat. Tut nur, wie ich sage, und keinem von uns wird ein Leides geschehen.»
Als nun der Tag gekommen war, wo der Teufel seinen Lohn sollte holen kommen, da stellten sich die sieben Gesellen hintereinander in einer Reihe-auf, grad der Sonne zu, und der jüngste stand zuhinterst. Da kam auch schon der Teufel an, packte den ersten und rief: «Du bist wohl der, der mir gehört!» «Nein, der hinter mir!» antwortete dieser. Und so ging's fort von Mann zu Mann bis zum letzten. «Dann bist du's!» rief der Teufel und packte den Jüngsten am Kragen. Der aber rief unerschrocken: «Nein, der hinter mir!» Da ließ der Böse ihn fahren und schlug seine Krallen in den Schatten, der hinter ihm am Boden lag, und fuhr damit unter gräßlichem Gelächter geradeswegs zur Hölle.
So waren sie alle gerettet, aber der Jüngste von den sieben Meistern ging sein Leben lang, auch im hellsten Sonnenschein. stets ohne Schatten.
Uf der Wallfahrt
Zwo Lütli us am hindere Bregenzerwald hend au amol mitanand a Wallfahrt uf Eisidla gmacht. D'Weg sind aber schlecht gsi und voila Dreck, und 's Wybli het d'Röck recht guet uffa gno, daß as jo suber uff Eisidla kiem. Wie die zwo Lütli aso wyter wanderen, ist dem Wybli kurios vorko, daß
am ails nohlachet, wer's gseha het. «Was hend jez die Lüt allemol für a närrsches Lacha?» fraget as äntlig 's Mandli.» «I glaub's scho. du loscht jo 's Füdla seha.» «Jo, bygoscht, worum hes ht mer das nit frücher gseit?» «Jo, j han halt gmeint, du heiest d'Wallfahrt aso versprocha.»
Lacrimae Christi
Amol, es mag scho lang här si, isch e Schwob ins Welschland (ho, und um isch er gwanderet, so wyt me wandere cha, und chunnt zletzscht uf Neapel abe. Den het er e Landsma atroffe. Wo wär ächt uf der ganze Welt en Ort, wo nid au Schwabe wäre? Dä nimmt ne voller Freude mit sich hei, und wyl heidi Durscht gha händ - s'macht wacker heiß im Welsche -, so goht er in Keller und holt halt e paar Fläschli vo syner beschte Sorte-n-ufe-n-und schenkt dem Schwöbli e Gläsli y. Dä setzt a und trinkt, und wie Baumöl isch's em

MÄRCHEN
|
Butälli: Flasche (bouteille)
geusset: vor Angst hell aufschreien
|
|
Ma und Frau im Essigkrueg
miend: müssen
munzige: zierlich, klein
miede: nötigen
nyttue: nichtstun
tirs: teures
Firreder: Feuerräder LEGENDEN
| SAGEN
|
| rabien: klettern, mühsam hinaufsteigen Bunt, w.. Heubühne Gaschterren: Heulager der Älpler riewwig: ruhig schpratzlen: Geräusch von springenden Funken im Holzfeuer gwirben: gewerben, zu schaffen izitbigiren. schimpfen Mutten, w.: rundes, hölzernes und niedriges Gefäß zum Aufbewahren der Milch trogen: unterschätzt faalwen: fahl huf schnell, flink Schiufi, rn.: Männerrock e sie eis: ab und zu chlipfige schreckbar Guttren, tv.. Flasche firche: hervor Chaasleb: Lab zum Dicken der Milch beim Käsen Chääsbrächen: Holz mit Querstäben, oft ein geschältes junges Tännchen zum Rühren im «Chäaschessi» schteerren: rühren, stören flux anhi: bald, sogleich emmumhi: wiederum Schrooten: Ecke ds erder Mal: das erste von zwei Malen zäme-l-liiten: feierliches Kirchengeläute verschiedener Glocken zusammen old: oder grünen: weinen si grächen: sich bereit machen; bereit sein lahr!» s.: ringförmiger, zusammenziehbarer Holzstreifen, worin der Käse geformt wird |
Sirten, w.: was nach Herausnahme
des Käses im «Chessi»
bleibt. Vor dem Kochen
(Erwellen) heisst es «Sirten»,
nachher «Chääsmilch».
verzwingged me: ihm mit den
Augen ein Zeichen geben
Schweifel: gewundene Ringe
von Tannenästen zum Zusammenhalten
von Zaunstecken
schliifen: schlüpfen
braschtig: krank, bresthaft
choischd: kannst
griisli: sehr, grausam
verzennen: gelüsten
nadischt: denn doch
Droslenblöömi: Alpenrosen
frewwen: freuen
dän den erfreut es
zimpfer: zimperlich
angääns: sogleich, bald
|
|
Das Büblein und das Vögelein
Hofstettli: kleine Wiese mit
Fruchtbäumen
Schildvogel: Spatz
cheust: kannst FENGGENGESCHICHTEN
|
Holtschä: Holzschuhe
Hds: Gewand, Kleid
Bulschä: Imbiss, in ein Tuch
eingepackt
|
Bestrafter Fürwitz
Wunderfitz: Gwunder, Neugierde
hofeli: sorgfältig, leise
Hab: Besitz
lybig: fett und rund
Beil:: Knochen
Suul: Säule
|
|
SCHWÄNKE
|
do Füess gmach: worde: es wurden
ihm Beine gemacht, er
wurde vertrieben
Föhneresetz: erste Ruhestelle
beim Aufstieg auf die Alp
|
QUELLENNACHWElS
MÄRCHEN
«Die Schöne mit den goldenen Zöpfen». Keller, Walter: «Tessiner Märchen». Frauenfeld/Leipzig 1927.
«Die verfluchte Prinzessin». Jegerlehner: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Turtmanntal, Nr. 139. Basel 1913. Deutsche Märchen seit Grimm! «Märchen aus dem Donaulande». Jena 1926.
«Das Märchen vom Schuster und vom Schneider». Jegerlehnerjohannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Turtmanntal, Nr. 145. Herausgegeben durch die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde. Basel 1913. — «Am Herdfeuer der Sennen». Bern 1916. Bächtold, Hans: «Schweizer Märchen». Basel 1916.
«Die drei Raben». Sutermeister. Otto: «Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz». Aarau 1873. Grimm, Jacob und Wilhelm: «Kinder- und Hausmärchen», Nr.9, 25 und 49 (1815-22). Neuausgabe Leipzig 1924.
«Das Mägdlein ohne Hände». Jecklin, Dietrich von: «Volkstümliches aus Graubünden». Zürich 1874. Grimm: «Kinder- und Hausmärchen», Nr.31. «Märchen aus dem Donaulande», Nr. 56. Diedrichs. Jena 1926.
«Vom Rudi u vom Reich», Berner Oberland. Mündlich überliefert. «s'Merli vom Funtechächeli». Wolf, W.: Schweiz. Idiotikon. Zürich. Vom goldenen Lzirlüäserli». Berner Oberland. Sooder, Melchior: «Zelleni usem Haslital». Basel 1943. Jegerlehner: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Turtmanntal, Nr.132. Basel 1913.
«Der Bueb mit em ysige Spazierstöcke». Aargau. Sutermeister, Otto: «Kinder- und Hausmärchen». Aarau 1873. Keller, Walter: «Tessiner Märchen». 1927.
«Das Märchen von den drei Winden». Graubünden. Decurtius, Caspar: «Studien aus dem Bündner Oberlande» in «Monatsrosen des Schweiz. Studentenvereins». Stans 1876.
«Der dumme Hans». Kandertal. Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Nr. 17. Basel 1913.
«Das Fröschlein mit dem roten Halsband». Berner Jura. Rossat, Arthur: «Les Fôles» in: Archiv für Volkskunde 18. Jahrgang. Basel 1911/13.
«Das Katzenschloß». Graubünden. Jecklin, Dietrich von: «Volkstümliches aus Graubünden», Zürich 1874. Neuauflage 1916.
«Nedeibriet». Wallis. Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Turtmanntal, Nr.62. Basel 1913.
«Der dumme Peter». Bächtold, Hans: «Schweizer Märchen». Basel 1916.
«Hans und Urschel». Graubünden. Jecklin, Dietrich von: «Volkstümliches aus Graubünden». Zürich 1874.
«Ma und Frau im Essigkrueg». Basel. Siehe Stöber.
FABELN
«Demut adelt». Wallis. Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Turtmanntal, Nr. 136. Basel 1913.
«Von der Verkehrtheit der Welt». Quelle unbekannt.
«Des Kaisers Stein». Boner, Ulrich: «Der Edelstein», Nr. 56. Herausgegeben von Franz Pfeiffer. Leipzig 1844.
«Der dankbare Löwe». Boner Nr.47 und Gesta Romanorum: «Das älteste Märchen- und Legendenbuch des christlichen Mittelalters». Übertragen von). G. Grasse. Leipzig 1905.
«Das dankbare Mäuslein». Boner Nr.21.
«Wer hängt der Katze die Schelle an?» Boner Nr.70.
«Der Fröschenkönig». Boner Nr. 25.
«Wie ein Frosch eine Maus schwimmen lehrte». Boner Nr.6.
«Der schlaue Fuchs und der eitle Rabe». Boner Nr. 18.
«Der betrogene Doktor». Boner Nr.11.
«Fuchs und Wolf». Bächtold, Hans: «Schweizer Märchen». Basel 1916.
«Die listige Krähe und der arme Schnegg». Boner Nr. 17.
«s dankbar Hegge:ßl:». Graubünden. Vonbun, F. J.: «Die Sagen Voranbergs». Innsbruck 1890.
SAGEN
«Ritter Georg und der Drache». Schaffhausen. Frauenfelder, Reinhard: «Sagen und Legenden aus dem Kanton Schaffhausen». Schaffhausen 1933. Rüttgers, Severin: «Der Heiligen Leben und Leiden». Leipzig 1922.
«Tannhuser». Tobler, Ludwig: «Schweizerische Volkslieder». Frauenfeld 1882/84. — Erk, Ludwig und Böhme, Franz: «Deutscher Liederhort». Leipzig 1893. —Grimm, Gebrüder: «Deutsche Sagen» (1816). Neuausgabe bei Georg Müller, München o. J. —Bechstein, Ludwig: «Deutsches Sagenbuch». Meersburg/Leipzig 1930. — Kuoni, J: «Sagen des Kantons St. Gallen». St. Gallen 1903.
«Rabiusa». Graubünden. Liechti, Samuel: in «Berna. Album Schweizer Dichter», 2. Jahrgang. Bern 1864. — «Zwölf Schweizer Märchen». Frauenfeld 1865.
«Vom Himmelreich und ewiger Seligkeit». Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Turtmanntal, Nr. 123. Basel 1913.
«Das Kind in der Hostie. Rochholz, E. L.: «Wunderlegenden aus der Oberdeutschen Pestzeit». Aarau 1887.
«Der erleuchtete Senn». Wallis. Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Turtmanntal. Nr.10. Erschmatt-Leuk Nr.1. Basel 1913.
Der Betbübl». Wallis. Tscheinen, M. und Ruppen, P.J.: «Wallisersagen». Herausgegeben vom Historischen Verein Ober-Wallis. Brig 1907.
«Die sonderbaren Tierlein». Wallis. Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis». Basel 1913.
«Der Balmenmann auf Blatten». Wallis. Tscheinen M. und P.J. Ruppen: «Wallisersagen», (1872). Herausgegeben vom Historischen Verein Oberwallis. Brig 1907. —Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Lötschental, Nr.36. Basel 1913.
«Der ungläubige Bauer». Zug. Vernalecken, Theodor: «Alpensagen». Wien 1858. — Hans Koch: «Zuger Sagen und Legenden». Zug o. J.
«Die weißen Vögel vom Arpsee». Wallis. Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Nr.68. Basel 1913.
«Dreierlei Milch». Berneroberland.
«Die Kristallböhle». Berner Oberland. Streich, A.: «Brienzersagen». Interlacken o. J.
«Der Schatzgräber». Graubünden. Vonbun, Franz Joseph: «Die Sagen Vorarlbergs». Innsbruck 1890.
«Das Kind und die Krönliotter». Schaffhausen. Utzinger, W.: «Schaffhauser Sagen und Schwänke» in: Schaffhauser Jahrbuch I. Thayngen 1926.
«Die seltsame Spinnerin». Rheintal. Vonbun, Franz Joseph: «Die Sagen Vorarlbergs». Innsbruck 1890.
«Frau Ude». Haslital. «Flora Alpina. Sammlung von Sagen und Geschichten aus dem Haslital». Ein Beitrag zur Heimatkunde von A. Willi. Meiringen 1885.
«Der Milchriemen». Haslital. «Flora Alpina. Sammlung von Sagen und Geschichten aus dem Haslital». Meiringen 1885.
«Das Stollen-Hauri». Haslital. «Flora Alpina. Sammlung von Sagen und Geschichten aus dem Haslital. Meiringen 1885.
«Der Chnab ufern Fluß». Zürich. Sutermeister, Otto: «Sammlung deutsch-schweiz. Mundartliteratur». Kanton Zürich. Zürich 1882.
«Der wild Jeger». Oberaargau. Rothenbach, J. E.: «Volkstümliches aus dem Kanton Bern».
«Zwiesprache mit dem toten Bräutigam». Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Lötschental Nr. 113. Basel 1913.
«Das Büblein und das Vögelein». Brienz. Streich, Andreas: «Brienzersagen». Interlaken 1938.
«Die Tennenbozen bei Wyler». Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Lötschental Nr. 121.
«Seltsame Begegnungen». Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Lötschental Nr 109.
«Der Ritt auf dem Teufel». Wallis. Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Lötschental Nr.88. Basel 1913.
«Der Ge:ßbub auf der Martinswand». Rheintal. Gabathuler, H.: «Wartauer Sagen». Buchs 1938.
'Der betrogene Teufel». Graubünden. Jecklin, Dietrich von: «Volkstümliches aus Graubünden». Chur 1916.
FENGGENGESCHICHTEN
«Der Zwergenprinz und die Müllerstochter». Wallis. Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Lötschental, Nr.87. Basel 1913.
«Der Zwerglein auf der Spiezer Fluh». Berner Oberland. Gempeler, O.: «Sagen und Geschichten aus dem Simmental». Thun 1888/1912. — Hartmann, H.: «Das Berner Oberland in Sage und Geschichte». Bümpliz 1910.
'Das Feuerzeug». Lütolf, Alois: «Sagen, Bräuche und Legenden aus den fünf Orten». Luzern 1865. — Herzog, H.: «Schweizersagen für Jung und Alt». Aarau 1887.
«Das Wunderjiaschlein». Rossat, Arthur: «Les Fôles». Archiv für Volkskunde, Basel. 18. Jahrgang, Heft 2.
»Das Dingweiblein». Luzern. Lütolf, Alois: «Sagen, Bräuche und Legenden aus den fünf Orten». Luzern 1865 und «Schweizer Archiv für Volkskunde» (Zürich). Basel 1897ff Band XVII.
«Das Wildmannli im Val Davos». Graubünden. Aus einem unveröffentlichten Notizheft von Pfr. Tschumpert.
«D's Bärgmandli». Graubünden. Sutermeister, Otto: «Sammlung deutsch-schweizerischer Mundart-Literatur». Aus dem Kanton Graubünden. I. Heft. Zürich 1882.
«Die wilden Mannli von Selun». Bolt, Ferdinand: «Toggenburger Sagen im Schweiz. Blindenfreund Kalender St. Gallen 1944.
«Das Crestamannli als Aiphirt». Gabathuler, H.: «Wartauer Sagen». Buchs 1938.
«Die verlorenen Kühe». Berner Oberland. Sooder, Melchior: «Zelleni us cm Haslital». Basel 1943.
«D'Schalmeipfyfli». Graubünden. Vonbun, Franz Joseph: «Die Sagen Vorarlbergs». Innsbruck 1890.
«Bestrafter Fürwitz». Graubünden. Vonbun, Franz Joseph: «Die Sagen Vorarlbergs». Innsbruck 1890.
«A bsundara Loh». Graubünden. Vonbun, Franz Joseph: «Die Sagen Vorarlbergs». Innsbruck 1890.
«Das stumme Weiblein». Quelle unbekannt.
«Der Schneider von Isenfluh». Berner Oberland. Michel, Hans: «Ein Kratten voll Lauterbrunner Sagen». Interlaken 1936.
«Ein Zwerglein warnt vor dem Bergsturz». Haslital. Sooder, Melchior: «Zelleni uf cm Haslital». Basel 1943.
«Der Marcher». Berner Oberland. Michel, Hans: «Ein Kratten voll Lauterbrunner Sagen». Interlaken 1936.
«Der Jäger Ueli und der Rothäubler». Berner Oberland. Rykenbach, Chr.: Es par Gschichtlene vom «Rothübe».
«Der Zwerg am Karren». Bern. Küffer, Georg: «Sagen aus dem Bernerland». Bern 1925.
«Vom Viertelseeli». Berner Oberland. Laubscher, Maria: «Häb Sorg der. zue». Sagen aus der Talschaft Frutigen. 1946.
«Batzibitzii». Nach Else Franke «Alpenmärchen». Berlin/Wien 1924.
«Der Zwergenkönig». Haslital. Vogt, C.: «Im Gebirg und auf den Gletschern». Solothurn 1843. — und «Flora Alpina». Sammlung von Sagen und Geschichten aus dem Haslital. Herausgegeben von Andreas Willi. Meiringen 1885.
«Der Silberberg». Graubünden. «Berna. Album Schweizerischer Dichtter». II. Jahrgang. Bern 1864.
SCHWÄNKE
«Wie's einem erging, der's allen Leuten recht machen wollte». Bern. Boner, Ulrich: Der Edelstein» Nr. 52. Herausgegeben von Franz Pfeiffer. Leipzig 1844.
'Das Findelkind». Wallis. Jegerlehner, Johannes: Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Turtmanntal, Saas Grund, Nr.74. Basel 1913. - Bächtold, Hans: Schweizer Märchen». Basel 1916. —«Gesta Romanorum: Das älteste Märchen- und Legendenbuch des christlichen Mittelalters», übertragen von J. G. Grässe. Leipzig 1905.
«Wie ein Müller um seinen Esel kam». Nach Keller, Walter: Tessiner Sagen und Volksmärchen». 1924.
«Betrogene Schelme». Bern. Boner, Nr.62.
'Der Vogt vo Schwendi». Appenzell. Sutermeister, Otto: «Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz». Aarau 1873. —Vernaleken, Theodor: «Alpensagen». Wien 1858. — Simrock, Karl: «Deutsche Märchen». Stuttgart 1864.
«D'Binziger Chue». Dän41 nach Wilhelm Wolf. Idiotikon.
'Etwas von den Lötschem». Jegerlehner, Johannes: «Sagen und Märchen aus dem Oberwallis», Nr. 159, Lötschental Nr. 159. Basel 1913.
«Die Schwarzkünstler und der Teufel». Graubünden. Nach einer mündlichen Überlieferung.
«Uf der Wallfahrt». Dörler: «Zeitschrift für Volkskunde». Berlin 1891 if. Band 16.
«Lacrimae Christi». «Breisgauer Volksspiegel. Volkstümliche Lieder». Der Schwob im Welschland. S. 105.



