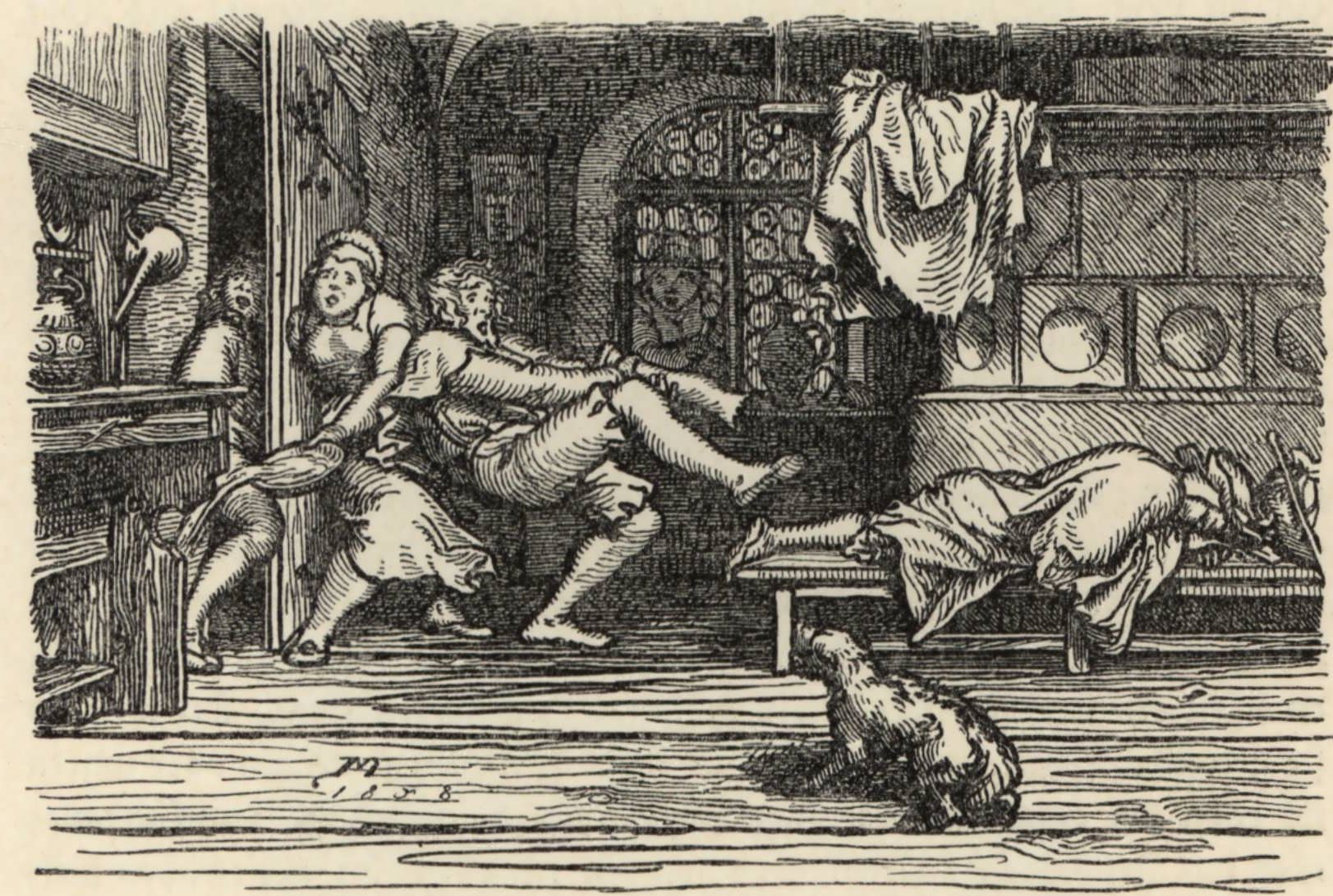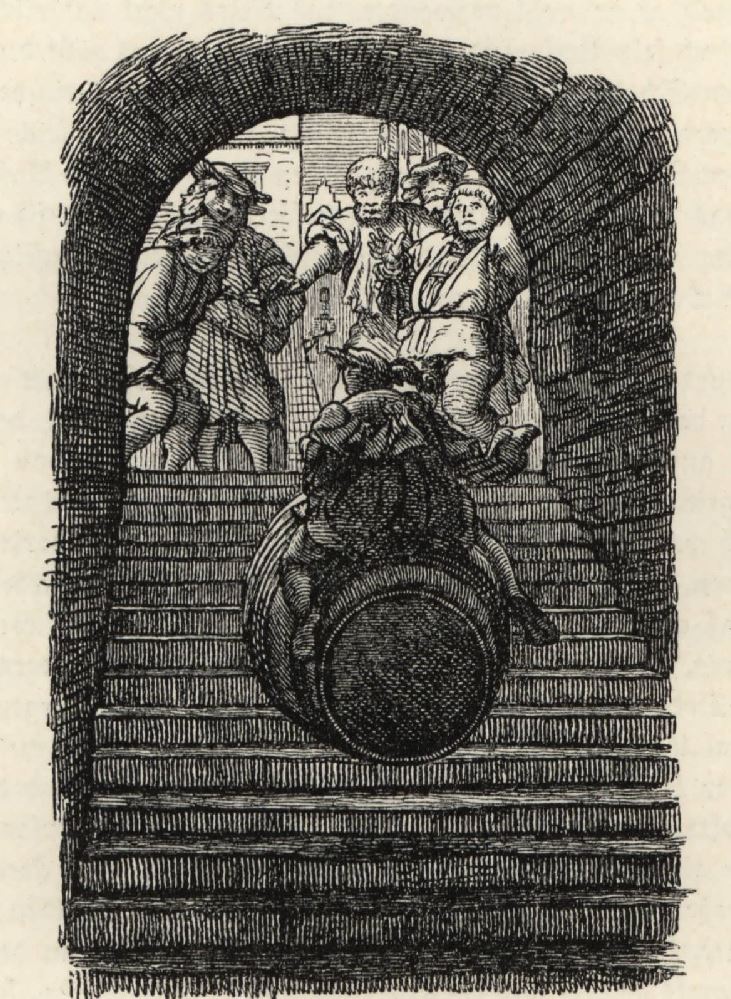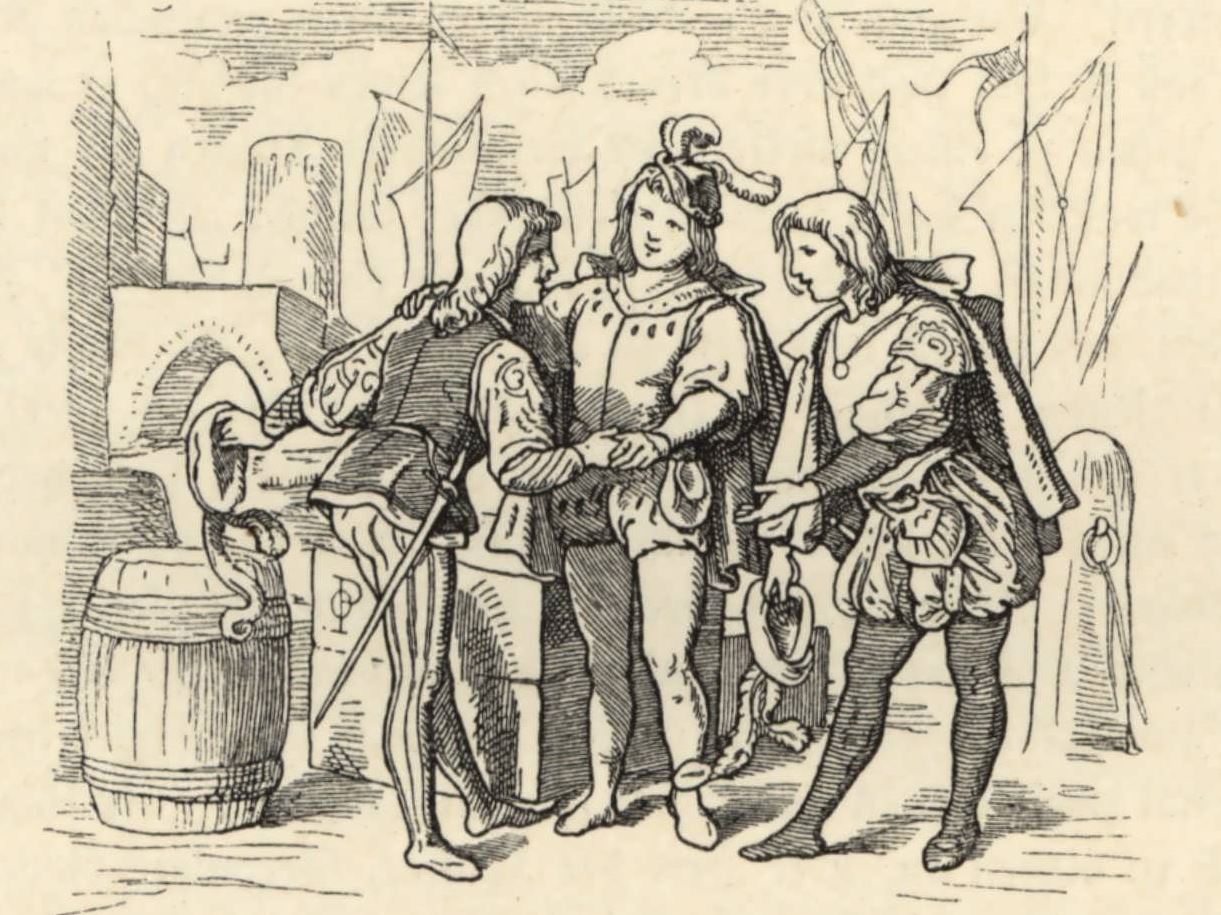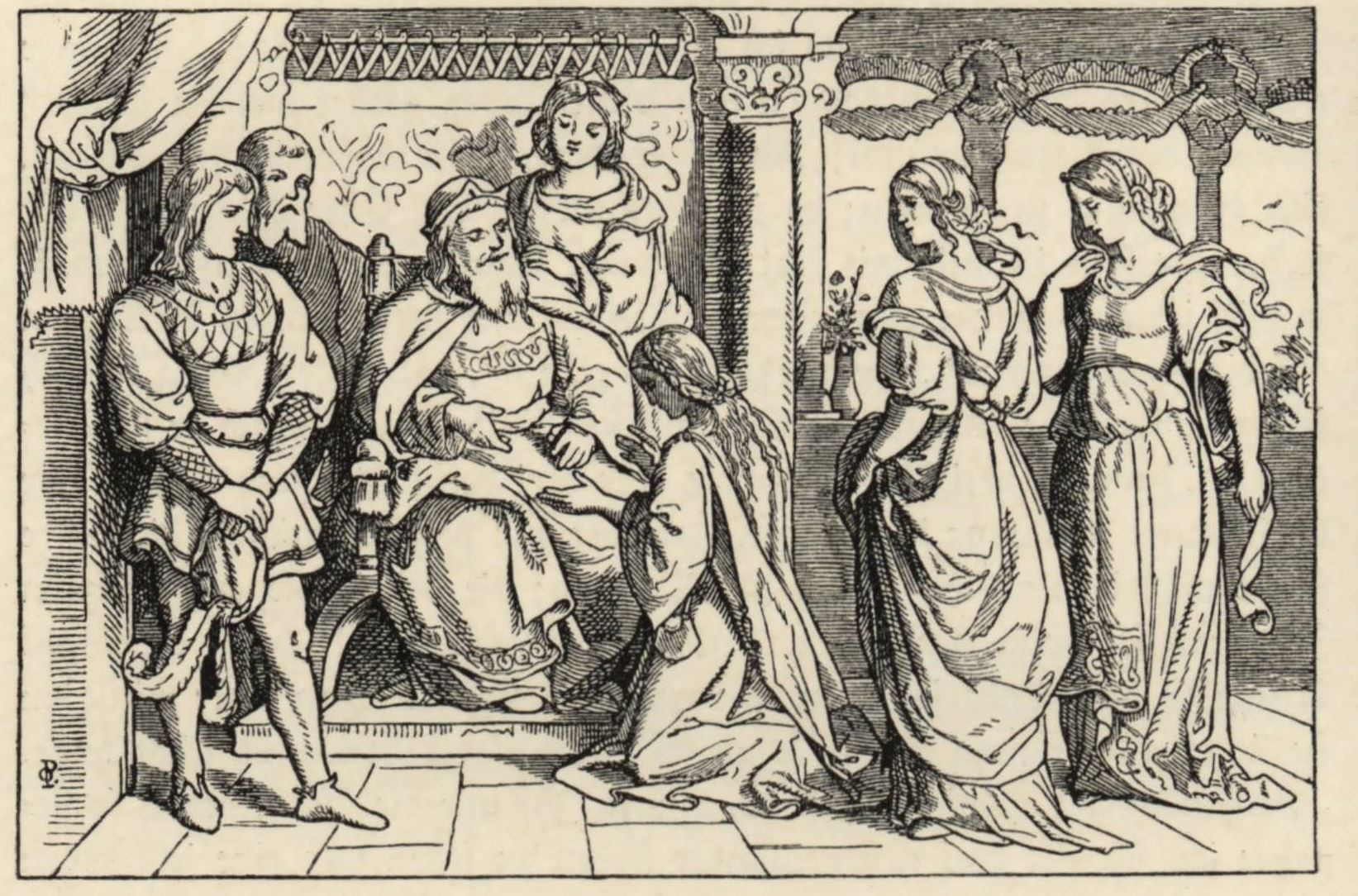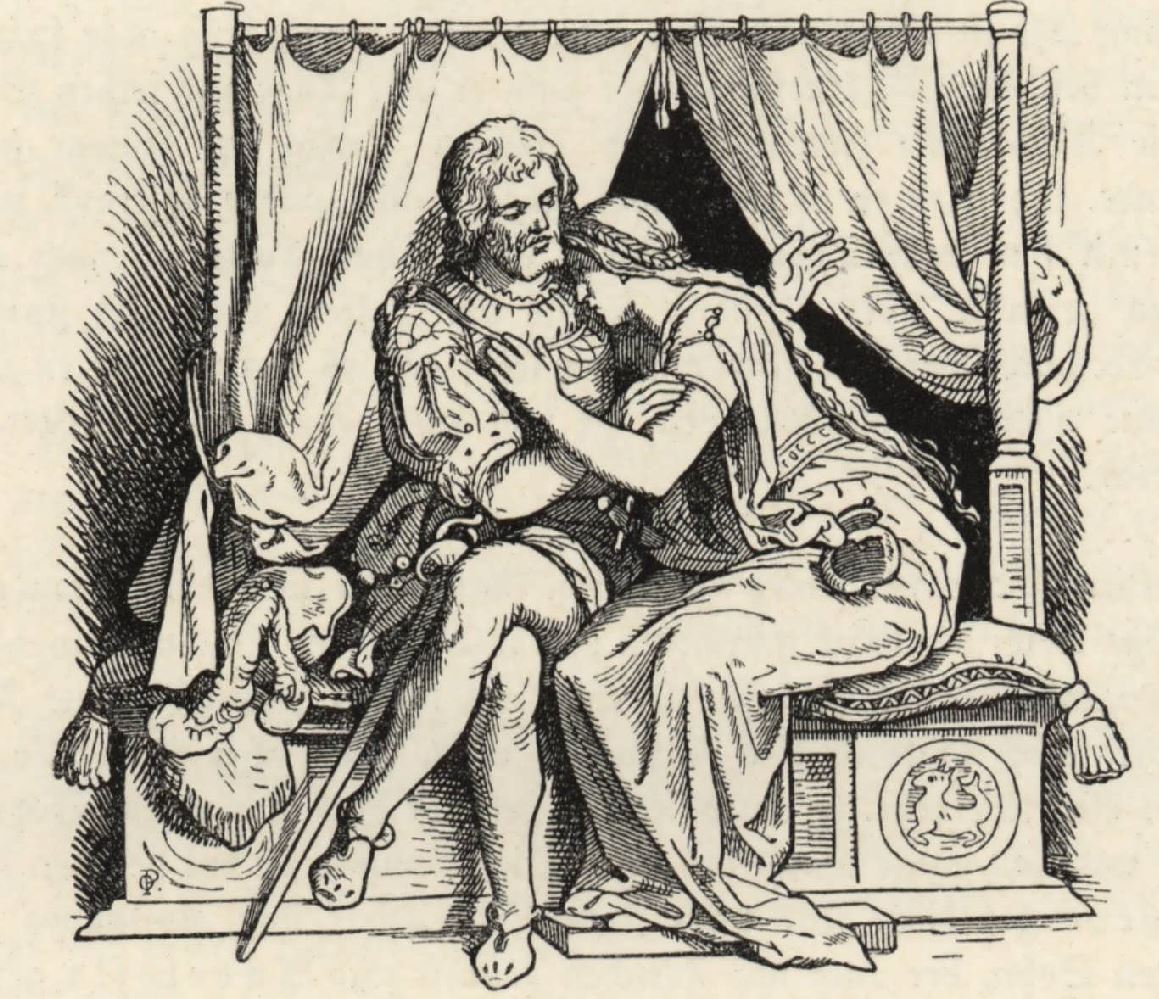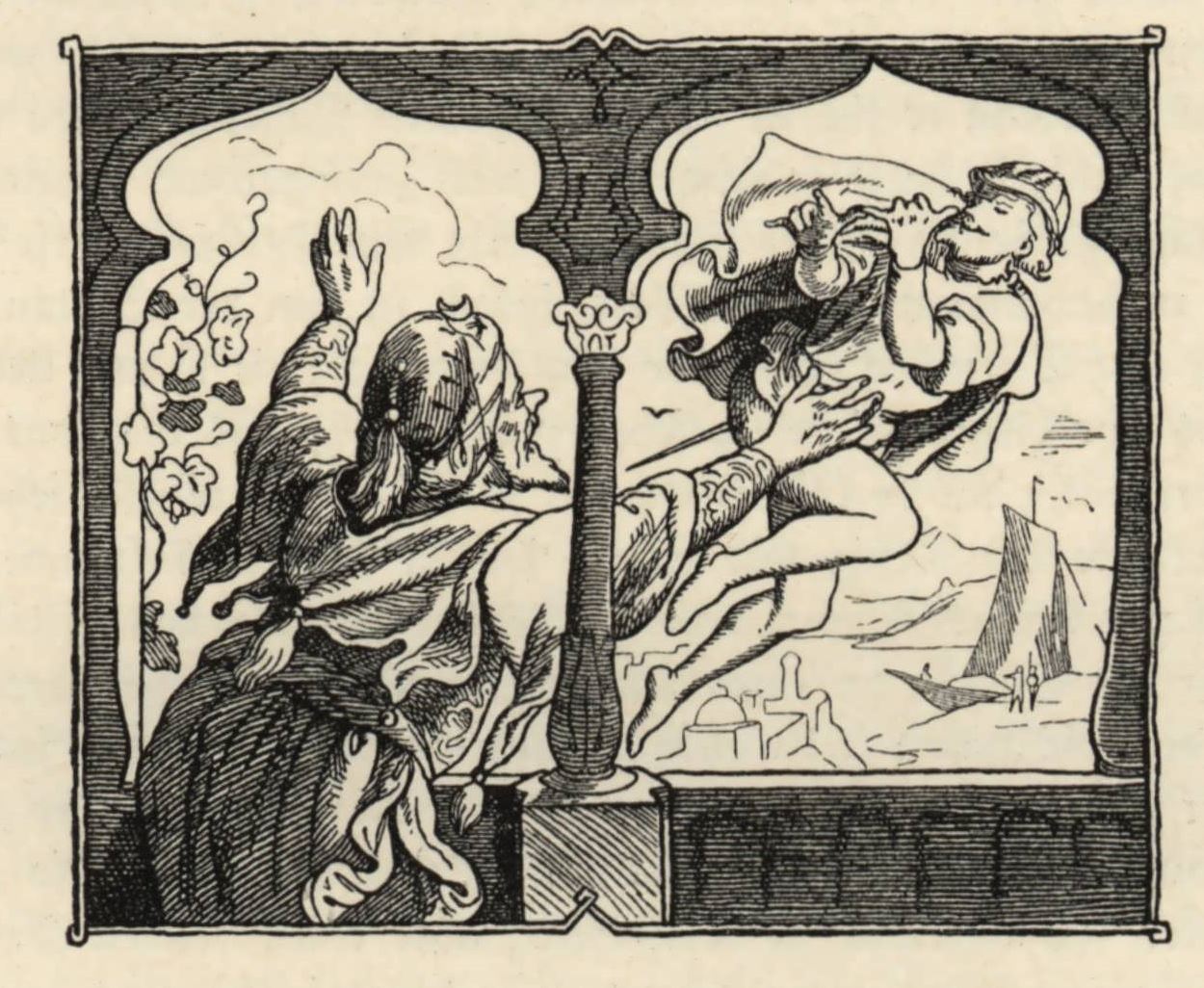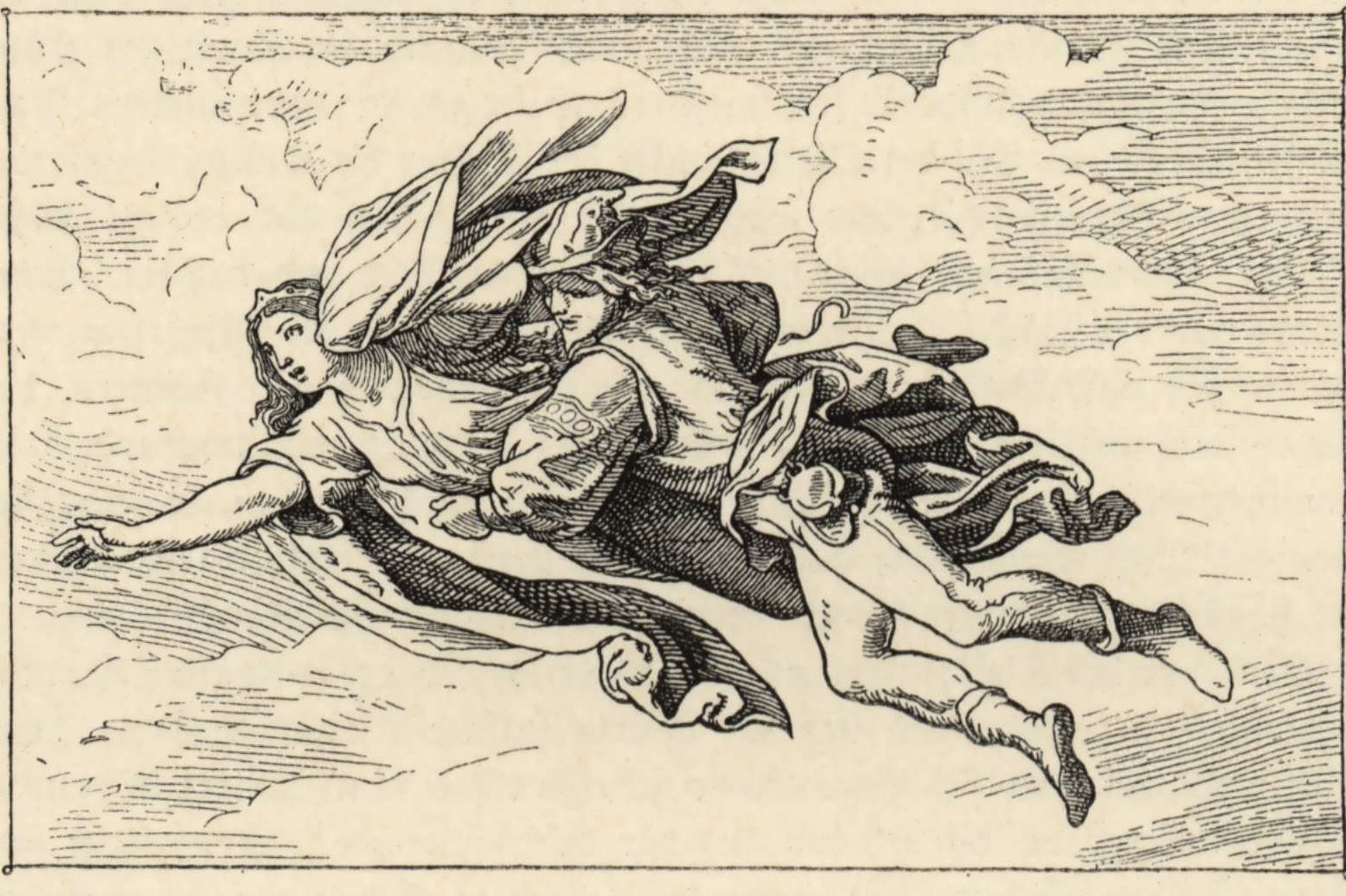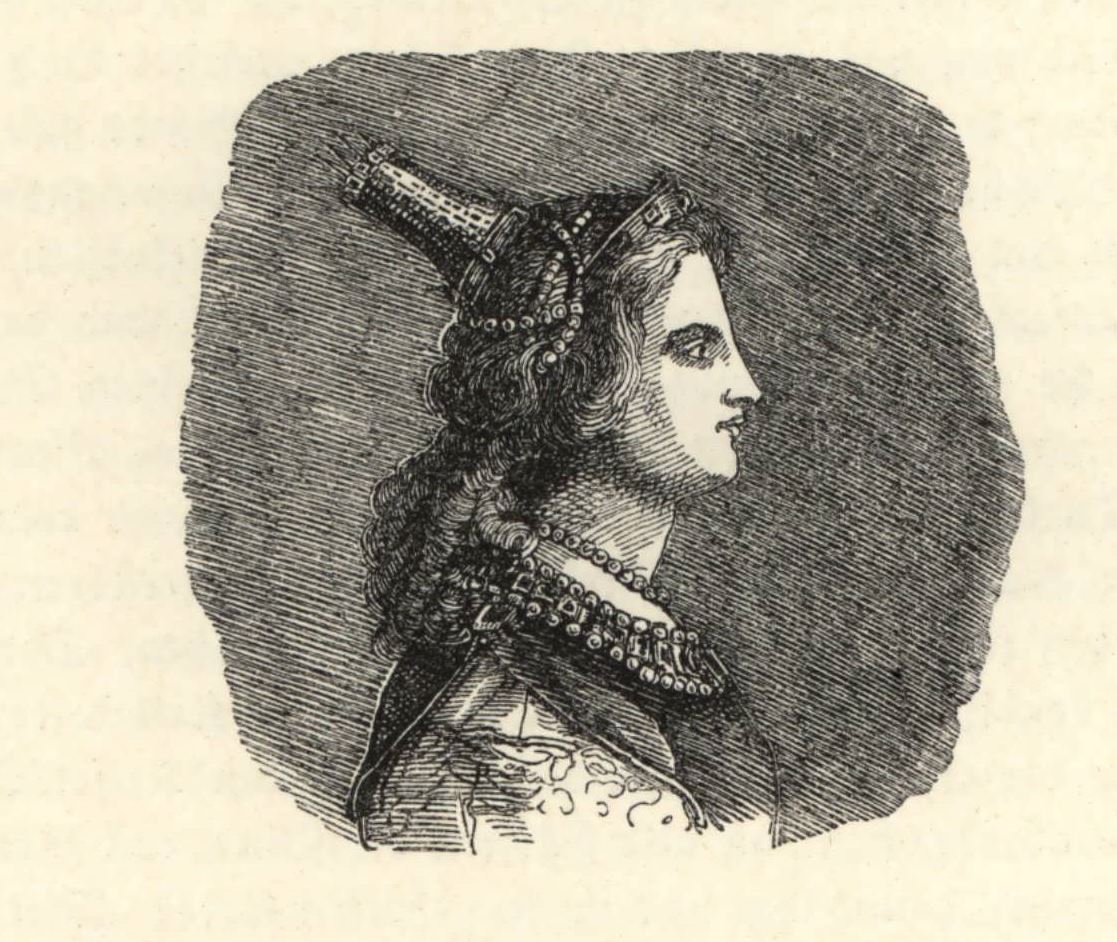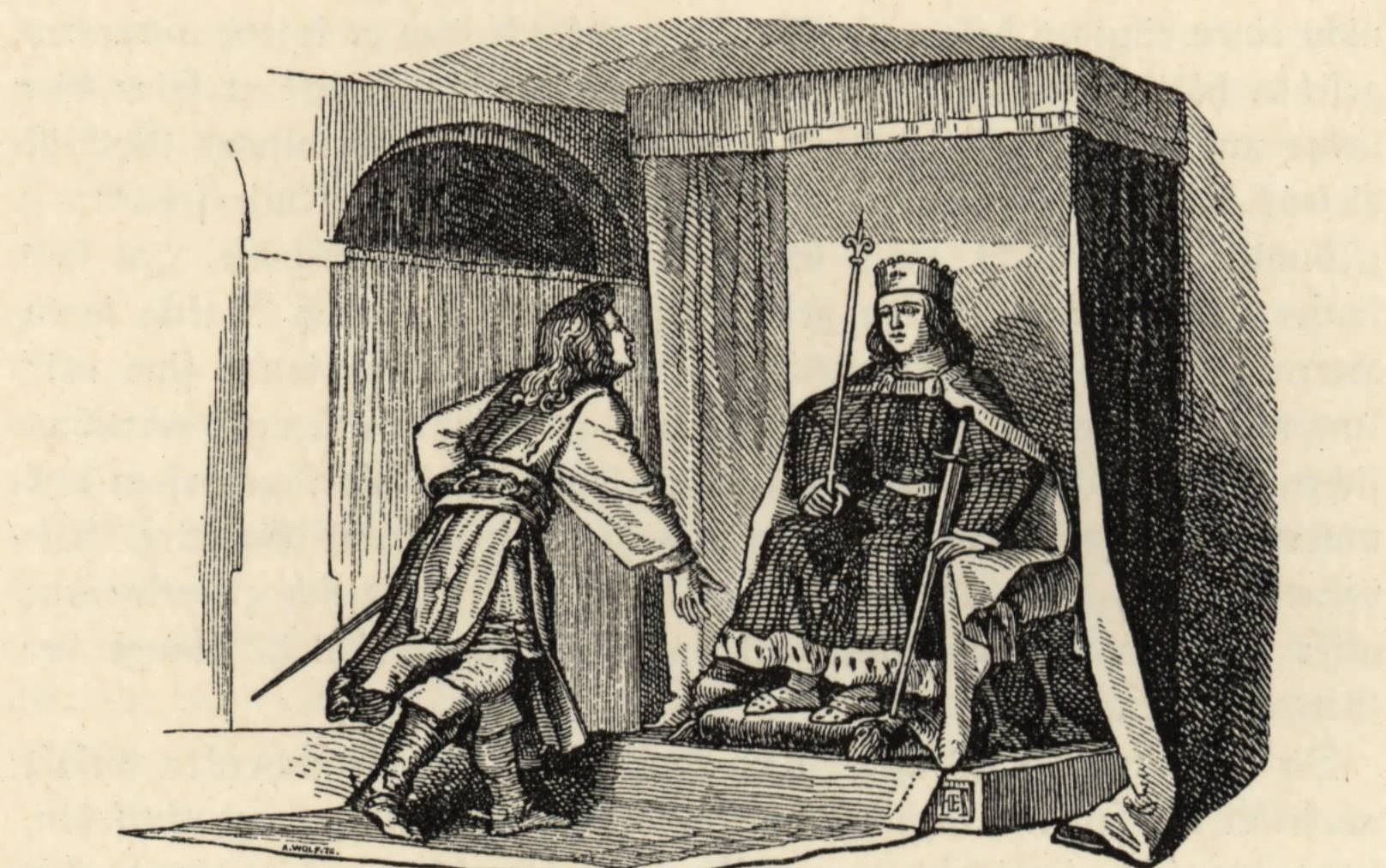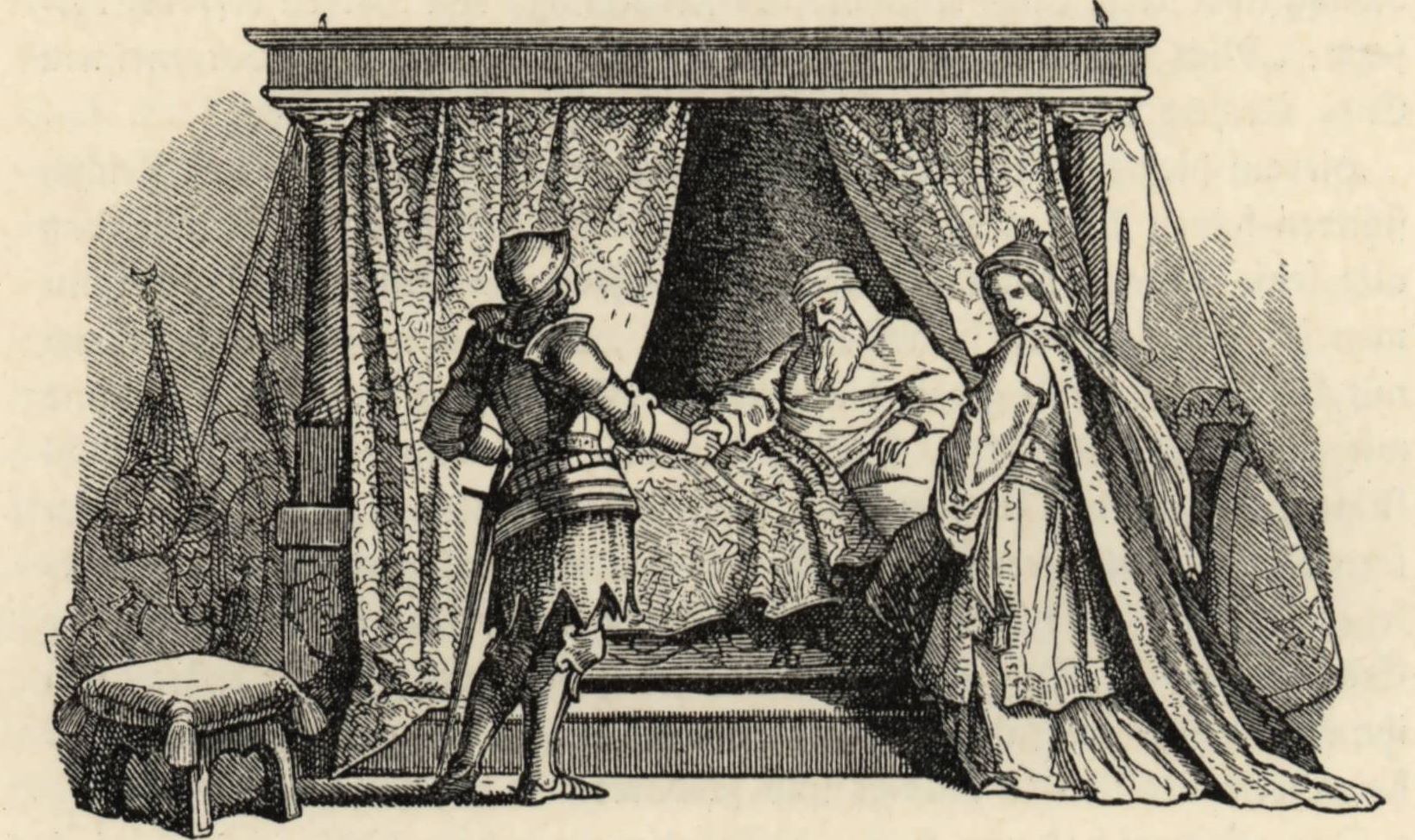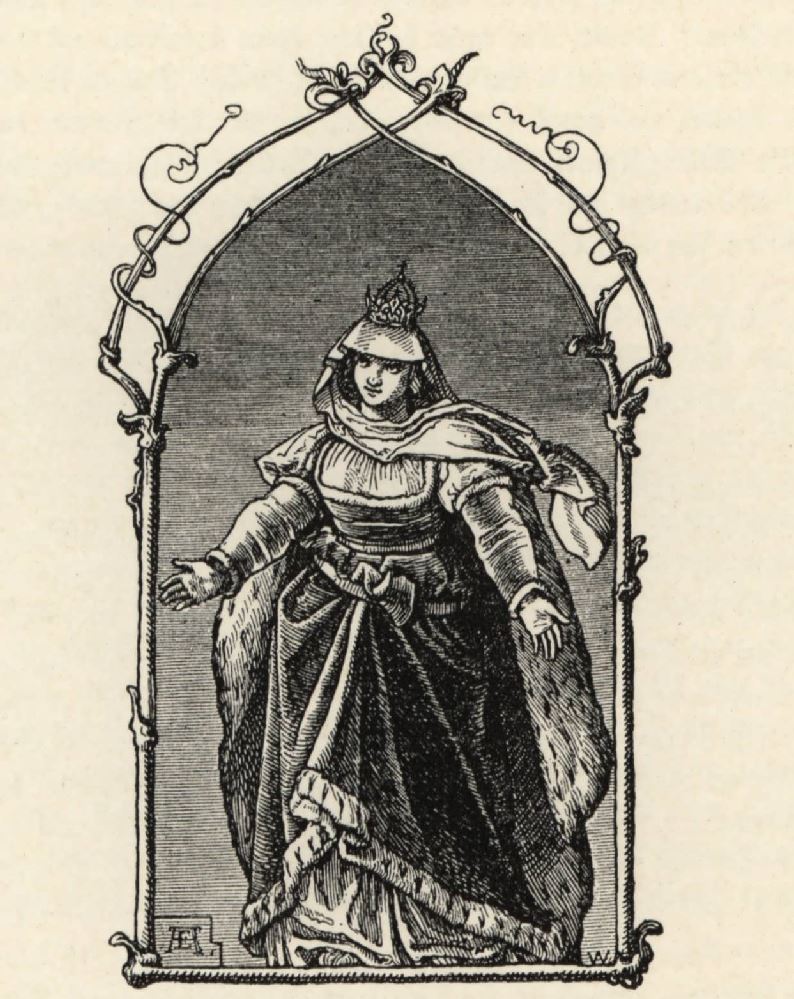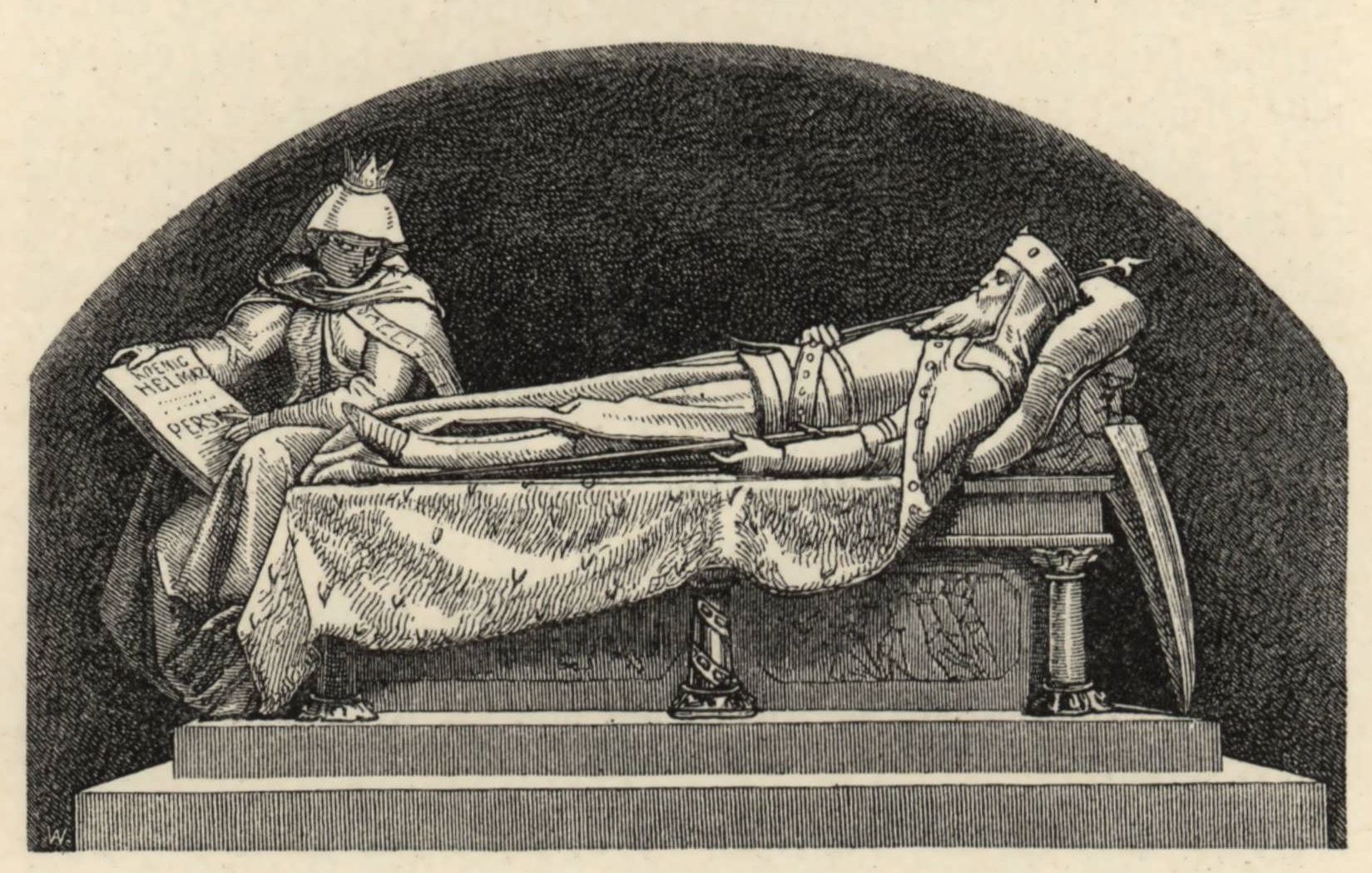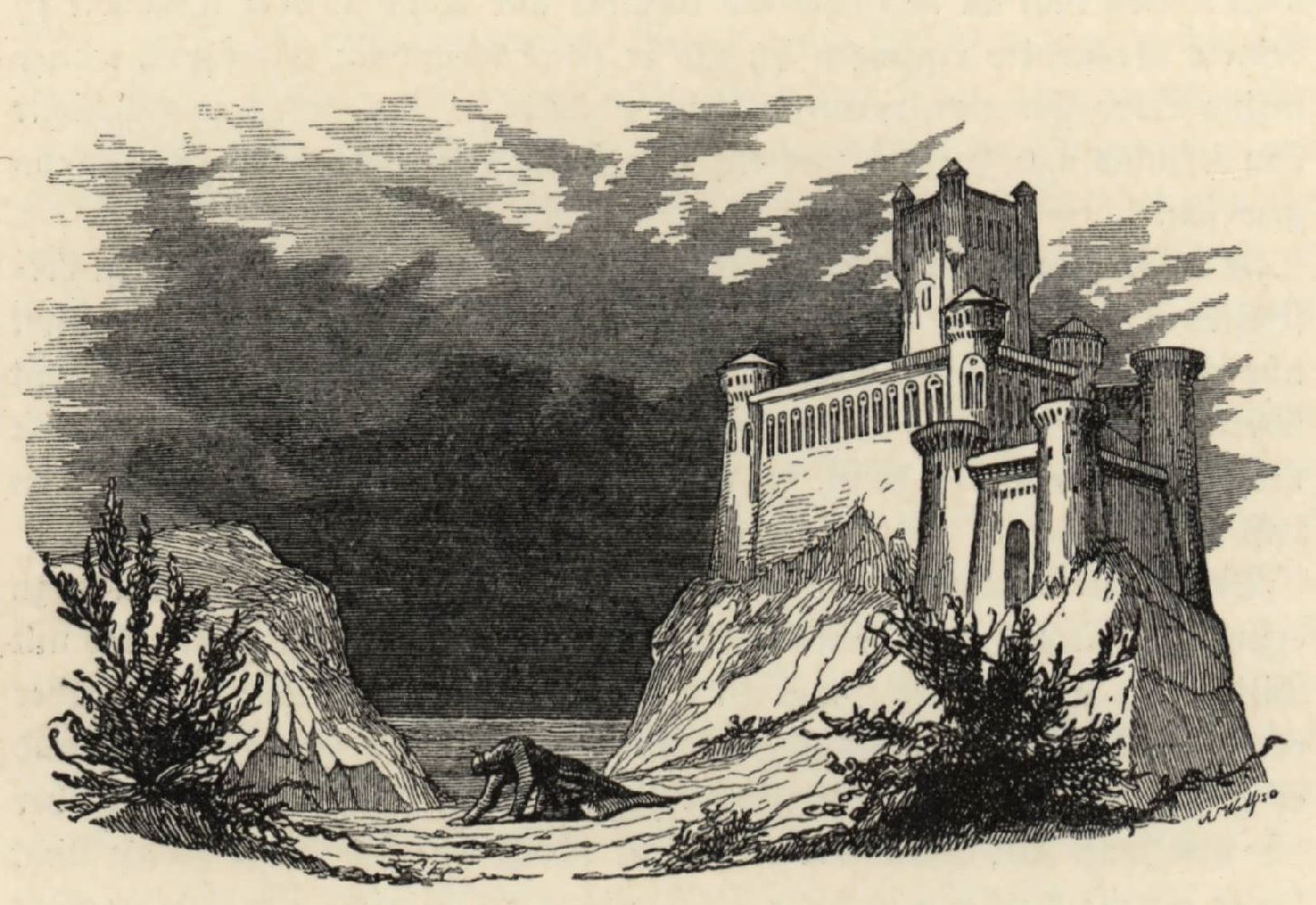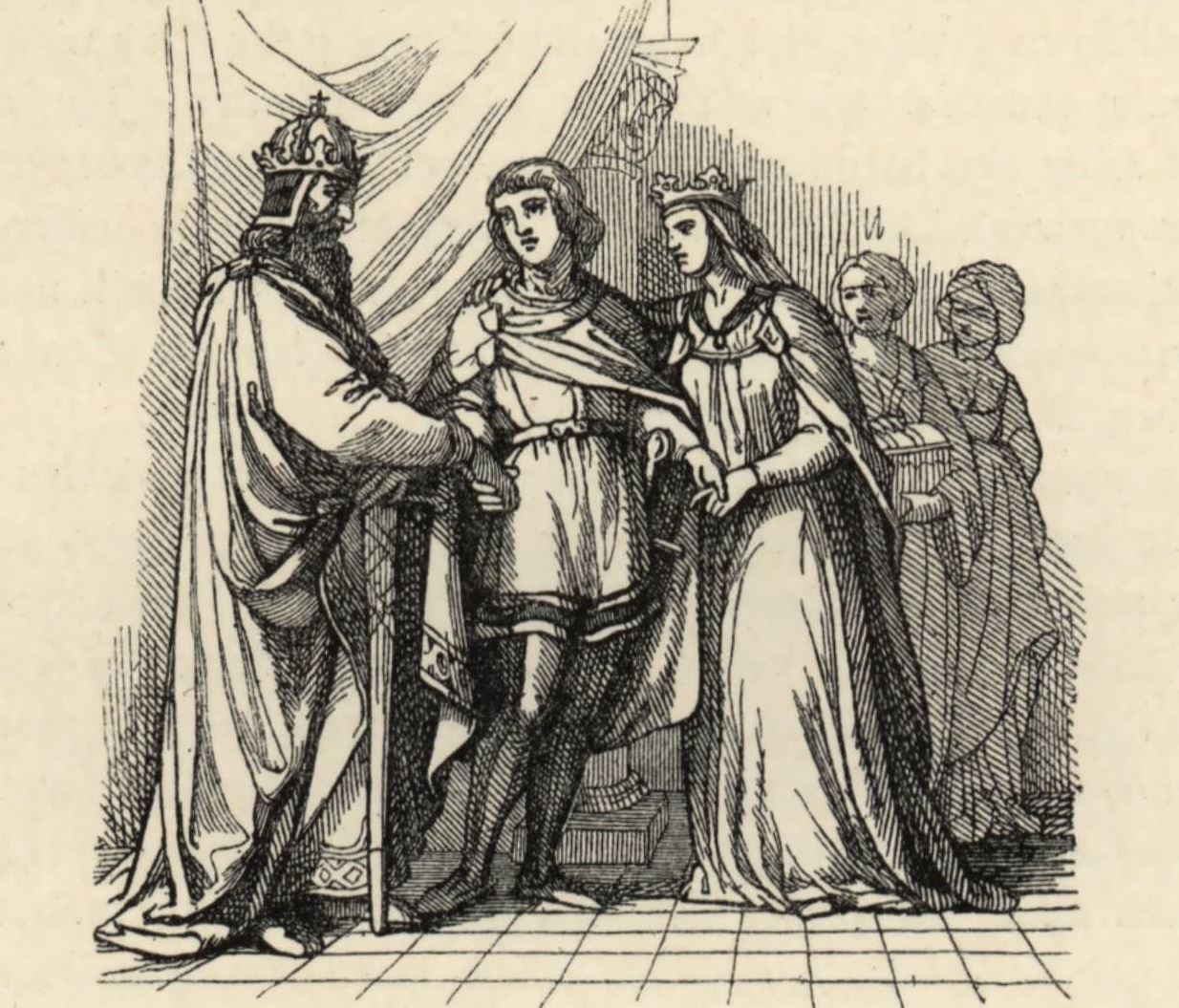Die deutschen
Volks-Bücher
wiedererzählt von
Gustav Schwab
II
Kaiser Oktavianus
Mit Bildern von Adolf Ehrhardt
Es war, als der König Dagobert in Frankreich regierte, zu Rom ein gewaltiger
und unüberwindlicher Kaiser, Oktavianus genannt. Dieser hatte
eine Gemahlin, welche zu ihrer Zeit als die allerschönste und klügste Frau
gepriesen wurde; in aller Menschen Augen erschien sie lieblich und tugendsam
, und das ganze römische Volk war ihres Lobes voll. Der Kaiser
und seine Gemahlin wohnten glücklich und freundlich beieinander; lange
Zeit jedoch war ihre Ehe mit keinen Kindern gesegnet. Endlich aber gebar
die Kaiserin zwei Söhne auf einmal; schönere und lieblichere Knaben
konnte man nicht sehen. Solches war niemand leid als des Kaisers Mutter;
denn diese war ihrer Schwiegertochter sehr feind. Darum dachte sie
darauf, in die schöne Saat Gift zu säen. Und nachdem sie vergebens versucht
hatte, dem Kaiser Zweifel gegen die Treue seines Weibes einzuflößen,
bestach sie einen unehrlichen Diener, daß er sich in das Gemach der
schlummernden Kaiserin schlich und dort von dem Kaiser, den das tückische
Weib gerufen hatte, betreffen ließ. Der Kaiser, in großem Zorn, zog
sein Schwert aus; doch bedachte er sich und wollte sie nicht im Schlaf ermorden.
"Warum ertötet ihr sie nicht eilig?" sprach die alte Mutter zu
ihrem Sohne. "Ist sie Euch nicht überwiesen genug? Folget meinem Rat
und bringet beide eilends um." Dem Knechte aber hatte das falsche
Weib verheißen, es sollte ihm kein Leid widerfahren. Oktavianus antwortete
seiner Mutter: "Es will sich nicht geziemen, daß ein Kaiser jemand
unverhört im Schlafe hinrichte." Er sah dabei seine fromme Gemahlin,
welche so sanft schlief wie eine, die nichts Arges im Herzen hat, lang und
unverwandt an. Indem nun der Kaiser vor ihr stand, kam ihr ein schwerer
Traum vor die Seele. Ihr deuchte, ein starker Löwe nahe sich, werfe
sie auf die Erde nieder, reiße ihren schneeweißen Schleier ab und zerre
ihn in Stücke. Alsdann fasse er ihre beiden Kinder an, sie wegzutragen.
Da fing sie laut an zu schreien: "Ach Gott, meine lieben Kinder l Wer
will mich an dem starken Löwen rächen?"Indem sie so schrie, gingen ihr
die Augen auf, und sie sah den Kaiser mit dem bloßen Schwerte vor sich
stehen. Doch nicht dieses machte ihr Not, sondern sie suchte nur nach ihren
Kindern, ob die noch da wären. Indem erblickte sie den Diener neben sich
und schrie mit lauter Stimme: "Ewiger Gottl Wer hat mir eine solche
Verräterei zugerichtet? Wer ist dieser Menschl Ich habe ihn nie gesehen!"
— "Ach, liebe Frau", sprach da des Kaisers falsche Mutter, "es ist ja der,
den Ihr so lange liebgehabt habt, und den Ihr jetzt in des Kaisers Abwesenheit
habt rufen lassen. Aber der Kaiser", fuhr sie fort, "mein Herr
und Sohn, ist solches längst gewahr worden, und du, Schälkin, magst es
immerhin verhehlen wollen. Schändliche Metze, deine Sache ist endlich an
den Tag gekommen!" Die arme Kaiserin rechtfertigte sich unter Seufzen
und Weinen, und der Kaiser selbst war so betrübt, daß er lieber hätte tot
sein wollen. Doch sprach er: "Wer ist, der seine Frau mit einem Buben
findet und nicht glauben wollte, daß sie an ihm treubrüchig geworden?"
Die Kaiserin konnte nicht mehr sprechen, sondern fuhr nur fort zu weinen.
Der Kaiser aber ward ergrimmt und sprach: "Frau, Euer Weinen hilft
Euch nichts; denn ich habe die Sache mit meinen eigenen Augen gesehen!"
Und von Stund an rief er Ritterschaft und Diener herbei und sprach zu
ihnen: "Ihr sehet, liebe Herren, die ehrlose Tat, deren sich meine Frau
wider mich schuldig gemacht hat. Darum nehmet sie mitsamt ihren Kindern
gefangen und werfet sie in das tiefste Gefängnis!" Als die Kaiserin
nach ihres Gemahles Befehl von den Dienern weggeführt worden war
und der Kaiser sich mit dem falschen Knecht allein sah, kam ihn ein solcher
Grimm an, daß er demselben, ohne Verhör und Verantwortung sein
Haupt mit dem Schwerte spaltete. Am andern Morgen ward der Leichnam
hinausgeschleift und an den Galgen gehenkt. Hierauf ging der Kaiser
weiter zu Rate, was mit der Kaiserin und ihren zwei Kindern, die er
nicht mehr für die seinigen hielt, zu tun wäre; denn er gedachte, sie alle
drei verbrennen zu lassen. Als nun die Herren zu Rate saßen, stellte
ihnen der Kaiser die große Schmach vor, welche seine Gemahlin an ihm
begangen hätte, und verkündigte ihnen seinen Entschluß. Wie er seine
lange Rede geendet, sahen die Herrn und Räte einander an, und keiner
wollte zuerst das Wort nehmen. Endlich wagte es der Älteste, welcher sich
immer mehr um das Tun und Lassen der Kaiser bekümmert hatte als die
andern, und sprach: "Gnädiger Herr! Ihr begehret, wir sollen die Kaiserin
verurteilen, und doch ist die Tat noch nicht bezeugt. Auch stehet die
Beklagte nicht vor uns, daß wir ihre Verantwortung anhören könnten;
denn es wäre möglich, daß diese Sache durch Verräterei veranstaltet
worden." Jetzt wagte es auch ein anderer und sprach: "Gedenket, Herr,
an den Eid, den Ihr der Kaiserin geschworen, als Ihr sie zur Ehe begehrtet:
daß Ihr ihren Leib schirmen und bewahren wollet wie Euern
eigenen. Nun ist diese Tat nicht bezeugt, und wissen wir nicht, ob nicht
Neid und Verrat im Spiele sind. Darum sehet zu, daß Ihr nicht treulos
an Eurer Frau werdet und Euren Eid an ihr nicht brechet!" Alle Räte
miteinander traten dieser Meinung bei, so daß niemand mehr auf der
Seite des Kaisers war als seine alte Mutter, die ihm stets anlag, er sollte
die fromme Kaiserin, die mit ihren wimmernden Kindern hart gefangen-
verbrennen. Die arme Frau im Kerker gab den Kindern manchen
Kuß und sprach: "Liebe Kinder, was haben wir unserem Gott getan, daß
wir so unschuldig sterben müssen?" Solche Klage führte sie Tag und
Nacht. Endlich, als drei Tage umwaren, versammelte der Kaiser seine
Räte wieder und begehrte, daß sie das Urteil wider die Kaiserin sprechen
sollten. Da die Räte des Kaisers Ernst sahen, sprachen sie einmütig:
"Allergnädigster Herr! Sehet wohl zu, was Ihr tut. Wir können die
fromme Kaiserin auf keine Weise verurteilen und haben nichts wider sie
gefunden; sehet und werdet nicht meineidig an ihr. Unser Rat wäre,
Ihr solltet die Unschuldige zufrieden lassen und die beiden Knaben aufziehen,
bis sie den Harnisch tragen könnten und man sähe, was aus ihnen
werden soll." Der Kaiser besann sich lang über diesen Worten; denn er
hatte sie sehr liebgehabt. Doch fiel ihm der Diener wieder ein, von dem
er meinte, daß sie lange mit ihm gebuhlt hätte, so daß er seine eigenen
Kinder nicht für solche anerkennen mochte. Da ging er zu seiner Mutter
und erholte sich Rats bei ihr. Diese schalt die Räte meineidige Bösewichter
und drang fortwährend in ihn, Mutter und Kinder verbrennen zu
lassen. Nun fügten sich endlich die Obersten und Räte, als sie sahen, daß
der Kaiser unerbittlich war.
Jetzt wurde ein großes Feuer vor der Stadt Rom aufgemacht, und dreißig
Stadtknechte erhielten den Befehl, die Kaiserin samt ihren zwei Kindern
aus dem Gefängnis zu holen und vor die Stadt hinauszuführen.
Reich und arm, jung und alt, wer es mitansah, hatte ein großes Mitleiden
mit der hohen Frau und den zwei unmündigen, unschuldigen Kindern.
"Lieben Männer", sprach die Kaiserin zu den Dienern, als sie das Feuer
von ferne auflodern sah, ,saget mir um Gottes willen, was wird man mit
mir und meinen Kindern anfangens" Da erhub sich einer unter den
Stadtknechten und sprach: "Weh mir, daß ich es Euch sagen sollt Aber
da es Euch doch nicht verborgen bleiben kann, so wisset, daß der Kaiser
jetzt ein großes Feuer vor der Stadt hat anzünden lassen und uns befohlen,
Euch und Eure zwei Kinder darin zu verbrennen." Da das die Kaiserin
hörte, erschrak sie von Herzen, doch wandte sie sich zum Gebet und
sprach: "Allmächtiger Gott! Wer weiß, womit ich es verdient habe; wenn
es dein Wille ist, so mag ich ihm nicht widerstreben!" So kam sie unter
Weinen und Beten vor den Kaiser und die andern Herrn, die ein großes
Erbarmen mit ihr hatten. Der Kaiser aber, sobald er ihrer ansichtig
wurde, hieß sie samt ihren Kindern ins Feuer werfen, weil sie so schändlich
an ihm wortbrüchig geworden. Und doch war es ihm, als wollte ihm
sein Herz vor Leid zerspringen; denn er hatte sie sehr liebgehabt. Die
arme, gefangene Frau fiel vor dem Kaiser aufs Knie, und mahnte ihn an
seinen Eid. Alle Menschen, die zugegen waren, fingen an zu weinen, besonders
die Armen, denen sie täglich viel Almosen ausgeteilt hatte. Der
Kaiser sah seine Frau ganz traurig an, als er sie so kläglich weinen und
doch so willig zum Tode sah. Auch die unschuldigen Kinder dauerten ihn,
so daß er sehr bestürzt wurde und lange nicht wußte, was er tun sollte;
denn es stieg in ihm der Gedanke auf, daß er ihr doch vielleicht unrecht
tue. Seine Mutter aber schrie mit lauter Stimme: "Sohn und Kaiser;
was zögert Ihr lange? Lasset sie mitten ins Feuer werfen in Gegenwart
des Volks; denn sie hat es längst wohl verdient Da antwortete ihr der
Kaiser und sprach: "Mutter, Ihr habt unrecht; denn als ich sie zur Ehe
begehrte, da schwur ich einen teuern Eid, ihr Leib und Leben zu beschirmen.
Den Schwur muß ich halten, darum wird sie nicht verbrannt." So
rettete die Frau des Kaisers Eid. "Stehet auf", sprach er, "ich habe mich
über Euch erbarmt; verlasset mein Reich mit Euren beiden Kindern. Wo
Ihr weiter in meinem Lande gefunden werdet, werde ich Euch alsbald
verbrennen lassen!" Die fromme Kaiserin erholte sich bei diesen Worten
von ihrer großen Angst und sprach: "Herr, wenn es denn so sein muß, so
bitte ich Euch, Ihr wollet mir einen frommen Mann zum Begleiter verordnen
, damit ich auf der Straße nicht verunehrt werde. Aber wahrlich,
Herr, sei mir diese Sache, durch welchen Verrat sie wolle, zugerichtet; so
weiß ich doch, daß durch mich weder Eure noch meine Ehre befleckt worden
ist!" Aber da half keine Verantwortung mehr. Der Kaiser kehrte sich um,
er konnte vor Weinen kein Wort mehr reden. Seine Gemahlin fiel ohnmächtig
zur Erde, wurde jedoch von den edeln Frauen bald wieder aufgehoben,
und als sie wieder zu sich kam, nahm sie ihre zwei Kinder auf
die Arme und rüstete sich zu wandern. Von seiten des Kaisers wurde ihr
ein starkes, wohlgesatteltes Pferd vorgeführt und hundert Kronen zur
Zehrung mitgegeben. Fünf frommen und mitleidigen Rittern ward der
Auftrag erteilt, sie aus dem Lande zu führen und sie, wie sie eidlich versprechen
mußten, in einem öden Wald an der Reichsgrenze, der voll wilder
Tiere und Mörder war, sich selbst zu überlassen.
Als sie hier angekommen waren, schieden die Ritter von ihr und befahlen
sie Gott. Die Kaiserin dankte ihnen herzlich für ihr gutes Geleit und
sprach: "Grüßet mir meinen lieben Herrn, den Kaiser, noch einmal zuletzt;
saget ihm, er werde mich nun nimmer wiedersehen, und meldet ihm,
daß ich seine zwei Söhne, welche wahrlich sein Fleisch und Blut sind, mit
mir trage. Wenn mich Gott behütet, so will ich sie tugendlich erziehen." —
Die Ritter hatten sie verlassen, und die Kaiserin bedachte sich hin und
her, welchen Weg sie einschlagen sollte. So zog sie in Gedanken fort und
verlor bald die rechte Straße. Als sie lang und weit geritten war, kam
sie auf einen Fußpfad, der jedoch wenig betreten war: dieser führte sie zu
einem hohen Felsen; unten an dem fand sie einen schönen Brunnen, lauter
wie Kristall; über dem Brunnen stand ein Baum, der duftete so lieblich
wie Balsam. Sowie die Kaiserin den Born erblickt hatte, stieg sie von
ihrem Pferd und nahm ihm das Gebiß aus dem Maul, daß es von den
Kräutern, die dicht im Walde standen, weiden konnte; denn Heu und
Haber war nicht vorhanden. Die Verirrte sah um sich, und da sie keines
Menschen gewahr wurde, verfiel sie in tiefe Kümmernis; doch erfreute sie
wieder ein Blick auf ihre zwei Kinder, die küßte sie und legte sie nieder in
die schönen Blumen und in das Gras. Dann labte sie sich mit einem
Trunk des köstlichen Wassers aus dem Brunnen und ass von den Speisen
, die ihr aus des Kaisers Küche mitgegeben waren. Und jetzt setzte sie
sich nieder und überdachte ihr großes Leid; aber sie war so müde von Reisen
und von Trauern, daß sie bald einzuschlafen begann. Nun hielten sich
in jenem Walde viel wilde Tiere auf. Als daher die Kaiserin mit ihren
beiden Kindern eingeschlafen war, kam von ungefähr ein großer und starker
Affe, der sah die Kinder so lieblich schlummern. Da bekam er große
Lust, das eine Kind zu stehlen, schlich deswegen ganz heimlich und still zu
den Kleinen heran und erwischte behend das eine: mit dem eilte er durch
den Wald, so lange, bis er zu einem grünen Platze kam; daselbst setzte der
Affe es nieder und wollte das Kind nackt sehen, deswegen legte er es
sanft auf die Erde und entband es von den Windeln, mit denen es umwickelt
war, bis es ganz bloß vor ihm lag. So saß er vor dem Kinde, fing
an, freundlich zu grinsen, und bleckte die Zähne, kurz, er gebärdete sich,
wie eine Mutter gegen ihr Kind tut, und meinte, das Kind sollte auch
gegen ihn lachen. Aber das Kind wollte es nicht tun, sondern fing an zu
weinen und laut zu schreien.
Nun fügte es Gott, der das Kind behüten wollte, daß ein mannlicher
Ritter mit seinen Dienern sich auch in dem Walde verirrt hatte. Der Ritter
kam getrabt, seine Knechte voran, die ihm allenthalben Bahn machen
und ihn vor dem Angriff der Mörder und der Bestien schirmen sollten.
Als nun der Ritter den Affen gewahr wurde, der ein nacktes Kind mit
seinen Tatzen handhabte, sprengte er mit seinem Pferde hinzu, zog sein
Schwert aus und schrie mit lauter Stimme: "Ei, Meister Affe, laß das
Kind liegen; denn du darfst es nicht mit dir tragen!" Sobald der Affe

den Ritter sah, verließ er das Kind, machte einen grausigen Satz auf den
Ritter zu und wollte ihn vom Pferde zerren, ja, er riß ihm ein großes
Stück aus seinem Rock. Der Ritter aber, der ein starker und beherzter
Mann war, führte einen so sichern Streich, daß er dem Affen seinen rechten
Arm vom Leibe hieb. Als der Affe diese Verstümmlung empfand,
sprang er vor Schmerz und Zorn wohl zehn Schuh hoch auf wie ein unsinniges
Tier. Zugleich schlug das Pferd des Ritters hintenaus so ungestüm
, daß es ein Greuel anzusehen war; es traf den Affen so hart an
die Seite, daß er zur Erde fiel. Jetzt sprang der Ritter behend auf seine
Füße, hieb dem Affen den Kopf ab, nahm das Kind, und nachdem er es,
so gut er gekonnt, in seinen Mantel gewickelt, setzte er sich wieder auf sein
Pferd. Bald hatte er seine Diener eingeholt; er erzählte ihnen zu ihrer
Verwunderung die Geschichte, und so ritten sie miteinander durch den
Wald, obwohl sie Straße und Fußpfad verloren hatten. Endlich gerieten
sie unter eine Rotte Mörder, die daselbst schon manchen braven Mann
beraubt und getötet hatten. Der Ritter, als er sich von den Räubern dicht
umringt sah, rief Gott um Beistand an und sparte sein Schwert nicht,
auf ihre harten Stöße zu antworten; einem schlug er sein Haupt ab, daß
es zur Erde fiel, drei andere verwundete er so, daß sie ihre Waffen fallen
lassen mußten. Als die übrigen Mörder, deren noch sechse waren, dies
sahen, schrien sie dem Ritter zu, er sollte stillehalten und das Kind liegenlassen;
denn er habe es gewiß einem mächtigen Fürsten gestohlen. Der
Ritter aber sprach: "Nein, ihr Bösewichter; wollt ihr die Wahrheit hören,
so wisset, daß ich das Kind einem Affen abgenommen habe; ich kann euch
die Stelle zeigen, wo ich das Tier erlegt habe!" Jetzt meinten die Mörder
erst recht, es müsse eines großen Herren Kind sein, weil der Ritter so albern
lüge; sprengten von neuem auf ihn ein und wollten eher sterben als
das Kind dahinten lassen, so daß am Ende der Ritter und seine Diener,
obwohl sie einige verwundet und umgebracht, sich genötigt sahen, das
Kind zu verlassen, ihren Pferden die Sporen zu geben und davonzureiten.
Nachdem die Mörder sie vergebens verfolgt hatten, kehrten sie zu dem
Kinde zurück und warfen das Los, welcher unter ihnen es tragen sollte.
Das Los fiel auf den Vornehmsten der Räuber. Dieser trug das Kind,
bis es ihm zu schwer wurde. Dann sprach er zu seinen Gesellen: "Lieben
Freunde, gebt mir einen Rat, was wollen wir mit dem Kinde anfangen?
Seine Schönheit zeigt, daß es nicht von niedriger Geburt ist. Ich meine,
wir sollten es bis an das Gestade des Meeres bringen und dort verkaufen;
denn da finden sich Kaufleute aus Frankreich und andern Ländern, die
vielleicht das Kind in Betracht seiner Schönheit uns wohl bezahlen
werden."
Indem nun die Mörder dem Meeresufer zugehen, finden sie unterwegs
den Affen tot liegen, wie ihnen der Ritter gesagt hatte. "Fürwahr",
sprach einer zu dem andern, "der Ritter hat die Wahrheit gesagt; er hat
das Kind ritterlich erlöst und erobert." Dessenungeachtet behielten sie das
Kind; denn was sollten sie jetzt anderes tun, und eilten ans Gestade zu
den Kaufleuten, die sie bald fragten, ob ihnen das Kind feil sei. Die Mörder
sprachen: "Ja, ebendarum bringen wir es hierher." — "Nun sagt",
fragte ein Kaufmann, "wie hoch schlagt ihr das Kind an?" Die Mörder
sprachen: "Es kann kein schöneres Kind auf der Erde gefunden werden;
wenn es Euch Ernst ist, so wollen wir es Euch um vierzig Pfund geben."
Die Kaufleute fanden das Kind zu teuer. "Behaltet es nur", sagten sie,
"ihr habt es doch aus eines Biedermanns Hause gestohlen." — "Nein",
erwiderten die Räuber, "wir haben es einem Ritter abgejagt, der hat es
von einem Affen erlöst, den er totgeschlagen." — "Liebe Herren", sprachen
da die Kaufleute, "wollt ihr zehn Pfund, damit ist es unser Ernst.
Bedenkt's, der erste Kauf ist der befiel" Da wollten die Mörder um so
geringes Geld das Kind nicht geben. Nun war in diesem Kaufmannsschiffe
ein frommer Pilger, Klemens genannt, der sah sich das Kleine an
und fand es gar schön; dachte, es werde wohl adliger Abkunft sein. Er
faßte auch eine solche Liebe zu dem Kinde, daß er nach kurzen Worten mit
den Räubern eins wurde und ihnen dreißig Kronen für dasselbe gab. Als
die andern Kaufleute dies sahen, spotteten sie des Klemens und sagten:
"Fürwahr, Ihr scheint Gelds und Goldes genug zu haben, daß Ihr so
teuer einkaufet!" Klemens achtete aber nicht darauf. Erst als das Schiff
sein Ziel erreicht hatte, wo Klemens und die andern Pilger dann zu Fuße
gehen mußten, wollte den Pilger, als er den Knaben auf dem Rücken
hatte, sein Geld auch reuen. "Was bin ich für ein närrischer Mann",
sagte er zu sich selbst, "daß ich mir solche Mühe aufgeladen und ein Kind
erkauft habe, das ich an meinem Halse tragen muß." Doch dachte er wieder:
"Gott hat mir das Kind beschert, so will ich's annehmen; hab ' ich
doch daheim nur einen einzigen Sohn bei meinem Weibe gelassen und
weiß nicht einmal, ob er noch am Leben ist oder nicht. Das Kind ist so
hübsch; daheim habe ich Geld genug, es zu erziehen. Drum sei es!" Und
so nahm er den Knaben, gab ihm einen Kuß, hängte ihn wieder auf seinen
Rücken und zog seines Weges durch Frankreich. Als das Kind ihm gar
zu beschwerlich wurde, kaufte er ihm einen Esel und mietete eine Wärterin
die er, mit dem Knaben im Arm, auf das Tier setzte, und so wanderte
er den nächsten Weg auf Paris zu wie ein Zigeuner. Tag und Nacht
hatte er keine Ruhe, bis er in diese Stadt kam. Dort wurde er von allen,
die ihn kannten, und namentlich von seinen besten Freunden aufs herzlichste
empfangen. Als er aber gefragt wurde, woher er denn das schöne
Kind bringe, da antwortete er: "Ich habe es jenseits des Meeres erobert:
seine Mutter ist auf dem Wege gesiorben; deswegen mußte ich
diese Frau bestellen, obgleich sie aus einem andern Lande ist als das
Kind; wäre seine Mutter gesund geblieben, die hätte ich lieber mit mir
gebracht als diese alte Frau!" So sprach der ehrliche Klemens mit lachendem
Munde und zog mit diesen Worten weiter nach der Vorstadt St. Germain
, wo seine rechte Wohnung war. Hier wurde ihm von seiner Hausfrau
große Ehre bewiesen. Die gute Frau meinte, das Kind gehöre einem
großen Herrn in Frankreich, welcher es ihrem Manne zur Erziehung anbefohlen
habe. Sie fragte auch nicht weiter darnach, wie weise Frauen
zu tun pflegen, sondern sie lebten freundlich miteinander, ließen das Kind
taufen und Florens nennen und zogen es in Zucht und Tugend auf. Florens
aber war schön und holdselig, wuchs lustig heran und wurde in kurzer
seit stark und männlich. Doch von ihm sei für jetzt genug gesagt!

Wir haben gehört, wie die Kaiserin bei dem Brunnen eingeschlafen war
und das eine Kind ihr von dem Affen gestohlen wurde. Sie schlief noch,
als bald darauf eine Löwin durch den Wald gelaufen kam und das andere
Kindlein sanft bei seiner Mutter schlummern sah; sie schlich alsbald hinzu
, nahm das Kind in den Rachen und wollte es ihren jungen Löwen zu
essen bringen. Indem sie nun das Kind mit den Zähnen faßte, erwachte
die Kaiserin und sah, wie das reißende Tier das eine ihrer Kinder von
dannen trug und ihr anderes nicht mehr da war. Sie meinte nicht anders,
als dieses hätte die Löwin schon gefressen, und das andere werde sie
auch zerreißen. Deswegen fing sie an, jämmerlich zu weinen und nach
Gott zu schreien, nahm das weidende Pferd, legte sein Gebiß ihm wieder
ins Maul, setzte sich darauf und tat einen Schwur, daß sie nicht aufhören
wollte zu reiten, bis sie die Löwin eingeholt und sich an ihr gerächt hätte.
Die Löwin aber rannte vor ihr her und hörte nicht auf zu laufen, bis der
Wald zu Ende war, so schnell, daß die Kaiserin nicht nachfolgen konnte
und das Tier aus den Augen verlor. Doch bekam diesem seine Beute auch
nicht gut; denn sowie die Löwin den Wald verließ, ward sie von einem
gewaltigen Greifen erblickt, der mit aller Stärke auf sie zuflog und sie
mitsamt dem Kinde so heftig mit seinen Klauen packte, daß die Löwin sich
nicht zu regen vermochte und große Schmerzen empfand. Der Greif
schwang sein Gefieder mächtig, flog über Berg und Tal, Wald und Wasser
, und endlich eilte er einer Insel zu. Die Löwin aber wollte nicht von
dem Kinde lassen; denn Gutt hütete es, und so behielt sie es in ihrem Rachen,
bis sich der Greif auf einem meerumflossenen Eilande zur Erde niederließ
. Als die Löwin sich auf der Erde fühlte, legte sie das Kind in den
Sand und ergriff den Vogel Greif im grimmigen Zorn so stark und grausam
beim Hinterfüße, daß dieser ihm entzweibrach. Der Greif fiel zur
Erde nieder vor Schmerz; doch wehrte er sich, so gut er konnte: er schlug
auf die Löwin mit Flügeln und Klauen wie ein erbittertes Tier, aber es
half nichts; die Löwin stürzte mit Hast auf den Vogel und zerriß ihn; so
wurde er der Stärkeren Speise. Nachdem die Löwin satt war von des
Greifen Fleisch, legte sie sich neben dem Kinde nieder, als ob sie bei ihren
jungen Löwen wäre. Das Kindlein aber erreichte das Euter der Löwin,
und als es spürte, daß dasselbe voller Milch war, hub es an zu saugen;
als dies die Löwin empfand, bot sie ihm die Brust erst recht in sein Mündlein
daß es desto sanfter saugen möchte. So ward das Kind gespeist; denn
Gott der Herr wollte dasselbe nicht verderben lassen. Hierauf grub die
Löwin eine tiefe Grube in der Insel mit ihren spitzen Klauen, nahm das
Kind, .trug es in die Grube und blieb bei ihm acht Tage und Nächte. Sie
leckte es mit der Zunge, damit es gesäubert würde, und von ihrer langen
Mähne machte sie ihm ein Bett oder Nest, darin es sanft und warm lag.
Trinken konnte es, wann es wollte, und war die Löwin hungrig, so ass sie
von des Greifen Fleisch.
Nun begab es sich durch Gottes Veranstaltung, daß Schiffsleute, denen
der Wind ungünstig war, genötigt wurden, mit ihrem Fahrzeug an der
Meeresküste zu landen, wo eben die Kaiserin ihr Kind und die Löwin
suchte. Sie hörte das Geschrei, eilte herbei und sah, wie die Pilger mit
ihrer Galeere ans Land gefahren waren. Die Seefahrer kamen ihr vor
wie Christenleute; daher nahte sie ihnen und sprach: "Liebe ,Herren, wo
wollet Ihr hinreisen? Ich komme aus fernen Landen und bin eine arme
verirrte Frau, ich weiß nicht, wo in der Welt ich bin, und wohinaus ich
soll!" — "Frau", antworteten ihr die Schiffsleute, "wir wollen in das
Heilige Land fahren, wo unser Herr Christus erstanden ist; wenn der Wind
uns nicht zuwider ist, so hören wir nicht auf zu schiffen, bis wir nach Jerusalem
kommen." Da bat die Frau aufs inständigste, sie doch mitzunehmen,
bis der Patron und die Schiffsleute ihr gestatteten, sich zu ihnen in
die Galeere zu setzen; und als der Ungestüm des Meeres sich gelegt hatte,
fuhren sie weiter. Die Pilger wurden der schönen Frau bald geneigt, und
als sie in sie drangen, ihnen zu sagen, wie sie an diese wilde Stätte gekommen
wäre, fing sie an, ihnen ohne Hehl zu berichten, wer sie sei und
wie es ihr ergangen. Die Erzählung währte mehrere Stunden, und da
war keiner, der nicht über ihre wunderbaren Schicksale gestaunt hätte.
Sie waren wieder eine gute Weile geschifft und eben der Insel gegenüber
, auf welche die Löwin samt dem Kinde von dem Greifen getragen
worden war, als der ungünstige Wind sie wieder ergriff und am Eiland
ihre Anker auszuwerfen nötigte. Es warm unter den Pilgern einige kühne
Leute, die betraten das Land, sich zu ergehen. Als sie nun so hin und her
wandelten, kamen sie vor die Höhle, worin jene Löwin lag und eben schlief.
Die Pilger sahen das schöne Kind in der Grotte liegen und hatten sich von
ihrem Staunen noch nicht erholt, als die Löwin erwachte und mit einem
gräßlichen Satze aufsprang, so daß die Pilger kaum noch zu fliehen Zeit
hatten und außer Atem wie gejagte Tiere auf dem Schiffe ankamen. Die
andern Pilger, die sie so atemlos daherkommen sahen, fragten sie nach
der Ursache, und nun meldeten jene, was sie erblickt hatten, und bejammerten
es, daß sie das Kind nicht erretten konnten. "Denn wenn auch die
alte Löwin sein schont", sprachen sie, "so werden doch die jungen Löwen,
sobald sie welche bekommt, dasselbe auffressen!" Wie nun so die Sage
im Schiffe umging, hörte es auch die Kaiserin, drang hervor und sprach:
"Ach, lieben Männer, Gott sei gelobt, daß ich diese Mär höre; denn es ist
fürwahr mein Kind, das die Löwin hinweggetragen hatt Lasset mich zu
ihm!" Die Pilger stellten der Frau das gewisse Verderben vor, das ihrer
bei der Löwin warte. "Was wollet Ihr von uns ziehen", sprachen sie,
"erbarmet Euch über Euch selbst und laßt das Kind fahren. Es ist besser;
ein Mensch sterbe als zwei!" Da sie sich aber nicht wehren ließ, so sagten
die Pilger: "Nun, wenn es Euch so hart im Sinne liegt —sehet, dort
sitzt ein Priester, beichtet ihm; denn Ihr gehet dem Tod in den Nachen,
und bittet Gott, daß er Euch helfen möge!" Die Kaiserin kniete vor dem
Priester nieder, beichtete und empfing den Segen; dann bat sie die frommen
Pilger, eine kleine Zeit zu warten, und trat ans Land.
Es währte nicht lange, so kam sie zu der Grube. Da erblickte sie ihr
Kind, welches mit der Löwin spielte und fröhlich war. Als die Frau dieses
sah, erschrak sie, fiel nieder auf die Knie, fing an die Löwin zu beschwören

und zu sprechen: "Ich sage dir bei Gott; dem Allmächtigen, bei
seinem Sohn und seinem Tod am Kreuz, daß du keine Macht und Gewalt
über mich habest." Kaum hatte die Kaiserin diese Worte gesprochen, als
die Löwin den Schweif zu sich zog, sich wie ein gehorsames Haustier gebärdete
und das Kind vor sich auf den Boden legte. Nun ging die Kaiserin
ohne Furcht in die Höhle, umarmte das Kind, küßte es wieder und
wieder und trug es auf den Armen von dannen nach dem Schiffe. Die
Löwin, die sich ihres Kindes beraubt sah, folgte traurig nach und wollte
mit in die Galeere; die Pilger aber fürchteten sich sehr und wollten sich
zur Wehre setzen und auch die Kaiserin nicht einlassen. Diese gab jedoch
so guten Bericht über das Tier, daß wenigstens sie selbst auf das Schiff
zugelassen wurde. Und so stießen sie schnell von dem Lande; die Löwin
wollte auch in das Schiff hineinspringen, aber der Sprung fehlte; denn
die Schiffsleute waren zu behend. Doch wollte das Tier nicht nachlassen,
sondern schwamm neben dem Schiffe her. Die Pilger spannten eilig die
Segel auf, um zu entfliehen; aber es half nichts: die Löwin klammerte
sich mit ihren spitzigen Klauen und scharfen Zähnen an das Schiff und
versuchte von Zeit zu Zeit den Sprung, bis es ihr endlich gelang. Die
Pilger schrien vor Entsetzen; ein jeder meinte, er müßte sterben. "Beschirmet
uns vor der Löwin", riefen sie die Frau an, "sonst werfen wir
Euch mitsamt dem Kind über Bord." —"Seid unerschrocken", sprach die
Kaiserin, "sie wird keinen von euch verletzen!" Und wirklich ging die
Löwin mitten durch alle Pilger hindurch wie ein zahmer Hund, bis sie zu
der Kaiserin kam. Und als sie das Kind auf der Fürstin Arm erblickte,
hob sie den Kopf über sich zum Zeichen, daß sie dem Kinde wohlwolle.
Hierauf legte sie sich der Kaiserin zu Füßen und wollte sie gar nicht verlassen.
Diese hatte das Tier auch sehr lieb, trug große Sorge für dasselbe
und ließ ihm an Essen und Trinken nichts mangeln; denn sie teilte
ihre Zehrung mit ihm. Die Löwin aber beschirmte sie, daß ihr auf dem
ganzen Wege von dem Schiffsvolke kein Leid geschah; denn es waren auch
einige schlechte Leute darunter; und als nur einmal einer es wagte, der
Herrin auf unziemliche Weise zu nahen, so sprang die Löwin auf, ergriff
den frechen Schiffsmann mit ihren Klauen und scharfen Zähnen und zerriß
ihn in vier Stücke. Als die Schiffsmannschaft dieses Wunderwerk
sah, sprachen sie alle, ihm wäre recht geschehen, und warfen seinen zerrissenen
Leichnam in die See. Der Kaiserin geschah kein Leid mehr; von
allen im Schiffe wurde ihr die größte Ehre erwiesen. Endlich kam das
Fahrzeug beim Gelobten Lande an. Die Kaiserin trat mit ihrem Kind
aus dem Schiffe, die Löwin sprang ihr nach. Dann segnete sie Pilger und
Schiffsleute und gab ihnen reichlichen Lohn. Diese dankten ihr hinwider,
führten ihr das Pferd aus dem Schiff und halfen ihr hinauf. So ritt sie,
das Kind im Arme, noch dieselbe Nacht weiter und in die nächste Stadt;
die andern Pilger folgten von ferne. Am nächsten Morgen reisten alle
zusammen und kamen in die Stadt Jerusalem.
Hier ging die Kaiserin alsbald zu Gottes Tempel und betete am Heiligen
Grabe, darein der Leichnam Jesu von Nikodemus gelegt worden, und
daraus er erstanden war. Auch legte sie ihr Kind auf den Altar, nahm
etwas Geld aus ihrem Säckel und warf es auf den Altar, als wollte sie
sprechen: "Gott sei gelobt; ich habe mein Kind wieder erkauft und erlöset
." Dann betete sie gar fleißig, daß Gott ihren lieben Herrn, den
Kaiser Oktavianus, friedsam, glücklich und in Gesundheit wolle leben lassen;
; denn sie hoffte nicht mehr, ihn jemals wiederzusehen. Hierauf verließ
sie den Tempel, setzte sich mit ihrem Kind auf das Pferd und ritt
durch die Stadt Jerusalem. Die Löwin aber wollte keinen Tritt von ihr
weichen; mochte sie durch Paläste, Kirchen oder Höfe gehen, überall ging
sie mit, so daß die Leute, die solches sahen, große Furcht ankam. Während
nun die Kaiserin so durch die Stadt ritt, begegnete ihr ein fremder Edelmann
, den redete sie freundlich um Herberge an; denn sie sah wohl, daß
er fromm, tugendreich und aus edlem Stamm entsprossen war. Der Edelmann
empfing sie würdig in seinem Hause und befahl, man sollte sie
pflegen und ihr dienen wie ihm selbst und seiner Hausfrau. Dies nahm
die Kaiserin mit großem Danke an und blieb eine Zeitlang bei dem Edelmann
mit ihrem Kind und der Löwin, die so zahm war, daß sie niemand
etwas zuleide tat.
***Ihr habt gehört, wie Florens dem Affen abgenommen, übers Meer verkauft
und von dem frommen Pilger Klemens nach Paris getragen worden.
Nun folgt, wie es weiter mit ihm ergangen ist. Das Kind ward
tugendlich erzogen, so daß es jedermann gefiel. Klemens kleidete und hielt
ihn wie seinen eigenen Sohn, welcher Klaudius hieß. Wenn diese beiden
Knaben in ihrem schmucken Aufzug über die Straße gingen, so sagten die
Bürger: "Selig ist der Vater, der so wohlgezogene Kinder hat!" Auch
meinte Florens nicht anders; denn daß Klaudius sein leiblicher Bruder
sei und Klemens sein rechter Vater; denn als der Affe ihn seiner Mutter
stahl, war er erst sechs bis sieben Wochen alt. Allmählich wurde er stattlicher
und größer als sein Bruder Klaudius, und auch unter den Nachbarkindern
war keines, das sich mit Florens vergleichen konnte. Jedermann
wunderte sich über seine Schönheit und Stärke; denn an Gebärde
und Gestalt glich er seinem Vater, dem Kaiser. Oft sagten auch die Nachbarn:
"Fürwahr, der Knabe ist des Klemens natürlicher Sohn nicht; sondern
er hat ihn irgend von einem großen Herrn heimlich entführt." Klemens
' Frau mußte dieses nicht selten hören, aber sie schwieg stille dazu;
denn sie hatte den Florens so lieb wie ihren eigenen Sohn.
Nun wuchsen die zween Knaben miteinander auf, so daß sie beide tüchtig
wurden, Handwerke zu erlernen, wiewohl Florens in allwege stärker
war als Klaudius. Klemens beriet sich deswegen mit seiner Hausfrau,
was er aus den beiden Knaben machen sollte, daß, wenn sie ins Mannesalter
kämen, sie sich auch ehrlich nähren könnten. Da sprach seine Frau:
"Lieber Hauswirth Unser Sohn Klaudius ist von wenig Stärke und deswegen
zu keinem groben Geschäfte zu gebrauchen; darum ist mein Rat;
wir sollten ihn zu einem Wechsler tun, und Ihr sollt ihm Euer Gut geben,
daß er es im Handel umtreibe; dadurch könnte er reich, berühmt, ja, zu
einem Herren werden. Der andere Sohn, Florens, nun der wird recht
zum Fleischerhandwerk sein; denn er ist stark; Rinder und anderes Vieh
zu schlachten, wird ihm nicht schwer werden. So wären unsere beiden
Söhne versorgt." —"Wahrlich, Frau, du hast mir recht geraten", sprach
Klemens, "ich will deinem Rate folgen." Zur Stund rief er seinen beiden
Söhnen und sagte zu ihnen: "Lieben Söhne, ihr sollt meinem Rat folgen
und tun, wie gehorsamen Kindern geziemt." Dann nahm er zuerst seinen
Sohn Klaudius vor und sprach zu ihm: "Lieber Sohn, höre mein Wort;
geh morgen früh zu dem Wechsler, da mußt du Gold und Münze wechseln
lernen, auf daß du ein rechter Handelsmann werdest." — "Von Herzen
gern, Herr Vater", sprach Klaudius, "ich will nach Eurem Willen leben;
auch wäre es mir lieb, wenn Ihr mir meinen Bruder Florens mitgäbet,
und er würde ein Wechsler wie ich." —"Ach, lieber Sohn Klaudius, laß
den Florens zufrieden", sagte der Vater, "der soll eine andere Hantierung
treiben, bei welcher ihm der Mund manchmal mit guten Bissen gespeist
werden wird; du siehst ja, wie stark er ist; ich denke, er wird die gemästeten
Schweine wohl auf dem Rücken tragen können." So stellte er den
Klaudius zufrieden und rief den guten Florens auch vor sich. "Florens,
mein lieber Sohn", sprach er zu ihm, "sei unerschrocken; du weißest; daß
ich dir günstig bin und dich sehr liebhabe; ich will dich deswegen zu einem
guten Handwerk tun; denn morgen, wenn du aufgestanden bist, gebe ich
dir Geld, damit gehst du zu einem Fleischer und gibst es ihm, daß er dich
seine Hantierung lehre. Das wird etwas für dich sein; denn du bist stark;
ich glaube, wenn du einen Ochsen, wie stark er auch ist, bei den Hörnern
erwischen könntest, du würdest ihn nicht gehen lassen! Auch haben wir dahinten
im Stalle zwei gute, feiste Rinder, die mußt du mit dir in das
Schlachthaus treiben, da wird dein Lehrmeister dir zeigen, wie du sie
schlachten sollst. Dann nimm sie auf deinen Hals und trage sie an den
rechten Ort, wo du sie verhauen und verkaufen mußt. Siehe zu, sei fleißig
und geschickt mit der Waage und tue niemand unrecht; so wirst du
aus einem Pfennige drei machen und Geld genug bekommen."
Als Florens die Lehren seines Vaters Klemens vernommen hatte, erklärte
er, alles gerne tun zu wollen, was ihm gefällig wäre. Mit Tagesanbruch
nun stand der alte Klemens auf, weckte seinen Sohn Klaudius,
schickte ihn auf die Wechselbank mit großem Gut an Geld und Gold, daß
er damit wechseln und gewinnen sollte. Dann weckte er auch seinen andern
Sohn Florens, half ihm, zwei fette Ochsen an den Hörnern zusammenbinden,
und schickte ihn mit denselben fort auf die Fleischerbank. Hier
fand der neue Fleischerjunge einen Knecht, den er nach dem Fleischer
Gumbrecht fragte. Als der Knecht den Florens mit den zwei feisten Ochsen
vor sich stehen sah, so fragte er ihn: "Was ist dein Begehren an den Meister?
Ich meine, du möchtest auch gern ein Fleischer werden?" Florens
antwortete und sprach: "Ja, warum nicht? Mein Vater ist wohl reich,
so daß er mich gut versorgen wird, und ich soll immer Minder, Schweine,
Hammel und Schafe genug zu schlachten haben. Darum will ich das
Handwerk lernen; denn mein Vater sagt mir, daß ich drei Pfennige mit
einem gewinnen könne und gute Bissen essen, wie die Fleischer gewöhnlich
essen, auch guten weißen und roten Wein trinken. So hat mich mein Vater
unterwiesen." Als der Fleischerknecht dies hörte, schlug er ein Gelächter
auf, spottete des Jünglings und sprach: "Der Teufel hat dich hergetragen,
willst du auch ein Fleischer werden? Wahrlich, du sollst mir die
Schlachtbank nicht mehr sehen! Packe dich hinweg in aller bösen Geister
Namen; willst du mit dem Handwerk dein Spiel treiben? Nimm deine
Minder mit dir, ehe ich dir den Kopf zerschlage!" Da gedachte Florens
bei sich selbst: "Auf diese Weise komme ich nicht in das Schlachthaus; ich
will gehen und meinen Vater mit mir bringen, der wird mir wohl einen
Meister zu schaffen wissen." So trieb er die Rinder wieder nach seines
Vaters Hause. Aber auf halbem Wege begegnete ihm eine andere Sache.
Denn er sah einen Edelmann gegen sich herreiten, der auf seiner Hand
einen gar schönen Sperber trug, welcher an den Füßen glänzende; hellklingende
Schellen hatte. Der Vogel gefiel dem Florens so überaus wohl,
daß er den Edelmann anredete und fragte, ob ihm der Sperber nicht feil
sei; er wolle ihm darum geben, was er begehre. Der Edelmann wurde
zornig auf Florens; denn er wußte nicht, ob er seiner spottete, oder was
er damit meinte. Der Junge sah ihm gar nicht darnach aus, als ob er ihm
den Vogel bezahlen könnte. Darum sprach er: "Ja, du Bettlerbube, es
tut mir not, ihn an dich zu verkaufen! Führe du deine Rinder in die
Metzing und schinde sie, dann verkaufe das Fleisch; das wird dir nutzer sein
als Sperber kaufen!" — "Ach, mein guter Herr", erwiderte Florens,
"Rinder schlachten ist nun einmal meine Hantierung nicht; damit kann
ich mich nicht ernähren. Drum lasset Euch den Sperber feil sein, lieber
Herr l Was er wert ist, will und kann ich Euch darum geben!"Der Edelmann
sah Florens an und dachte: "Laß sehen, was der Junge machen
will. —Ich will dir den Sperber zu kaufen geben", sprach er, "aber nicht
anders als um die zwei Rinder, und auch so nicht gerne; denn ich möchte
ihn viel lieber selbst behalten!" Florens war in seinem Herzen sehr erfreut
und dachte: "Wenn er nicht mehr als die zwei Rinder kostet, was
ist das viel? Der Sperber muß mein werden!" So machten sie den Kauf;
und Florens nahm den Vogel; der Edelmann aber trieb die Rinder vor
sich her in sein Haus, lachte bei sich selbst und sagte: "Nun ist aus dem
Weidmann ein Viehtreiber geworden!" Florens hingegen trug den Sperber
auf seiner Hand und sprach zu sich selbst: "Fürwahr, heute bin ich zu
einer glückseligen Stunde aufgestanden, daß mir ein so trefflicher Tausch
geraten ist; denn der Vogel ist doch gewiß seine hundert Mark Silbers
wert! Ei, wie wird mein Vater fröhlich werden, wenn er mich mit dem
Vogel kommen sieht, den ich auf den Händen trage, als wenn ich ein
Edelmann wäre!" Die Bürger, die den Tausch gesehen hatten, lachten
und spotteten über Florens; doch dies kümmerte ihn nicht; denn der Vogel
gefiel ihm, und als er in seines Vaters Haus kam, jauchzte er vor Freuden.
Klemens saß auf einer Bank vor der Tür, auf einen Stecken gestützt
und dachte über das Schicksal seiner beiden Söhne nach. "Mein
Sohn Florens", dachte er, "hat nun wohl die zwei Rinder geschlachtet,
diesen Nachmittag wird er sie verkaufen und Geld lösen; hoffentlich schickt
er sich in sein Handwerk und lernt brav." Wie er so in Gedanken sitzt;
blickt er von ungefähr auf und sieht seinen Sohn Florens mit dem Vogel
daherziehen. "Was ist das für ein Vogel", rief er ihm entgegen, "wo
kommt er her? Wo sind deine zwei Rinder?" — "Mein lieber Vater",
antwortete Florens, "ich habe die zwei Minder um den Vogel gegeben; so
einen schönen habt Ihr Euer Lebtage nicht gesehen! Freuet Euch, daß ich
Eure Ochsen so wohl angelegt habe!" — "Wie?" sagte Klemens, "ich
glaube, du bist unsinnig." "Bei Gott", sprach Florens, "ich habe sie um
den Vogel gegeben und spotte Euer gar nicht! Darum ratet mir, lieber
Vater, wo soll ich den Sperber aufheben? Ich denke, in Eurer Kammer
wäre er am besten versorgt; da sollte ihm kein Leid widerfahren." Als
nun Klemens hörte, daß es wirklich so geschehen war, hätte er mögen von
Sinnen kommen und sagte zu Florens: "Bei Gott, wenn ich meiner nicht
schonte, so wollte ich dir jetzt mit diesem Stecken hier Rippen und Kopf
entzweischlagen! Du Narr! Mir einen solchen Kaufmannsschatz ins Haus
zu bringen; da du doch weißest; daß ich kein Weidmann bin!" —"Ach,
lieber Vater", sagte Florens ganz betrübt, "seht Ihr denn nicht an seinen
Federn, daß es ein hübscher Vogel isi? Wahrlich, Ihr habt unrecht und
seid ohne Ursach zornig; gewiß, der Vogel ist großen Schatzes wert!"
Klemens hätte vor Ingrimm lachen mögen, doch faßte er sich und sprach:
"So geh denn hin und versorge den Vogel wohl; wenn du seiner recht
wartest, wird er dich schnell reich machen. Iss nur nicht mehr; als er dir
einträgt, so wirst du seinen Nutzen bald innewerden!" Dann mußte ihm

Florens noch weiter berichten, wie es ihm auf der Fleischerbank ergangen
sei. Als nun Klemens seine gute, einfältige Erzählung hörte, konnte er
ihm nicht länger zürnen. Er dachte: "Ich will den Burschen nicht mehr
auf die Schlachtbank, sondern auf die Wechselbank schicken; dort gehen
vielleicht seine Sachen besser!"
Indem kam sein andrer Sohn Klaudius von dem Wechsler; er hatte
sein Geschäft an diesem Tage gut gemacht, und von dem Vogel wußte er
auch gar nichts. Klemens aber, als er seinen Schaden ein wenig verschmerzt
hatte, sprach zu seinem Sohn Klaudius: "Sei so gut, lieber
Sohn, und nimm deinen Bruder Florens mit zum Wechsler; denn ich
fürchte, auf dem Schlachthause wird er nicht guttun!" —"Gerne", sprach
Klaudius, "lieber Vater! Folgt er mir, so will ich mein Bestes an ihm
tum" — "Ich hoffe, er soll dir folgen", antwortete Klemens, "er ist
stark und mag dir den Geldsack morgens und abends leicht nachtragen."
Nun hielt sich anfangs Florens auf der Wechselbank recht gut, und sein
Bruder Klaudius lehrte ihn zuerst mit Zahlpfennigen rechnen und die
Münze kennen. So trieb er es einen Monat lang, und Klemens meinte,
die Sache könnte gut werden. Jetzt teilten sie sich so in das Geschäft: des
Morgens ging Klaudius auf die Börse, bestellte die Bank und bereitete
den Sitz zu. Wenn der Tag ganz heraufgekommen, so brachte Florens
den Sack mit dem Gelde nach; und dieser Brauch währte einige Zeit. Nun
stand es aber nicht lange an, als Florens auch einmal wieder den Sack
mit dem Gelde trug, in welchem wohl sechshundert Pfund Münze waren,
daß ihm bei der Brücke ein überaus schöner Hengst begegnete, welcher
aufgezäumt war und zum Verkaufe geritten werden sollte. Florens wandelte
eben auf den Kaufmann zu und trug seinen Geldsack auf dem Rücken;
; und da er sah, wie der Hengst so stark war und so überaus schön
trabte; dachte er bei sich selbst: "Wie selig ist, wer ein solches Pferd hat
und es zu brauchen versieht! Du hafi Münze genug in dem Sack. Wem
ist sie nützet Mein Vater Klemens hat sie ohnedies lange genug in der
Truhe liegen gehabt, und niemand ist ihrer froh geworden: ich wollte;
daß mir der Kaufmann das Roß darum gäbet" Gedacht; getan; er grüßte
den Kaufmann und sagte: "Herr, ist Euch das Tier feil? Ich trage Gelds
genug in diesem Sacke hier; darum sagt mir mit einem Worte, wie Ihr
es geben wollt!" Der Kaufmann sprach: "Willst du das Roß haben, so
wirst du es nicht unter dreißig Pfund Münze von mir bekommen; es ist
noch tung und stark und läuft vortrefflich." Florens war froh, daß ihm
der Mann das Pferd so wohlfeil gönne, und sagte treuherzig: "Ich meine,
Ihr seid nicht bei Sinnen, daß Ihr mir ein so schönes Tier um dreißig
Pfund überlassen wollt; ich gebe Euch vierzig drum; ich will nicht, daß
Ihr Verlust an mir haben sollt!" —"Großen Dank, Junker", sagte der
Kaufmann und mußte heimlich lachen. Florens tat seinen Sack auf, der
Kaufmann zählte die Münze heraus; dann gab er dem Jüngling das
Pferd mit dem Zügel in die Hand, segnete ihn und kehrte sich seiner Wohnung
zu. Florens eilte mit dem Roß nach Hause; er fürchtete immer, der
Kaufmann möchte ihm nacheilen und das Pferd zurückfordern, weil er es
so guten Kaufs gegeben. So ritt er denn geradenwegs nach St. Germain.
Klemens saß über Tisch mit seiner Hausfrau, die in allen Dingen gerecht
und fromm war und den Florens so liebhatte wie ihren eigenen
Sohn Klaudius. Auch war sie von allen Nachbarn als klug und vorsichtig
wohl gelitten. Nun kam Florens vor das Haus gesprengt. Klemens
hörte ihn reiten, rief ihn und sprach verwundert: "EI, Sohn, wer hat dir
das große Roß gegeben?" —"Vater", antwortete er, "das Roß hab ' ich
gekauft; ich habe vierzig Pfund von dem Gelde drum gegeben, das ich
auf die Wechselbank tragen sollte; ich hoffe, ich habe recht damit getan,
und das Geld sei wohl angelegt; besehet es nur; es hat gute Augen und
kann recht laufen; es wäre um hundert Pfund Münze nicht zu teuer!"
Als Klemens das hörte, sank er vor Zorn vom Tische zurück und verwünschte
sich, daß er den bösen Buben, der ihn noch an den Bettelstab
bringen werde, mit sich übers Meer genommen. Dann erhub er sich vom
Tische, nahm den Florens mit beiden Händen beim Haar, warf ihn zur
Erde und trat ihn mit Füßen. Ja, er hätte ihn totgeschlagen, wenn nicht
seine gute Hausfrau die Streiche unterlaufen und so dringend gebeten
hätte, daß er ihr den Sohn ließ. Dann machte sie dem Vater sanfte Vorwürfe
und sprach: "Euer Sohn hat doch noch nichts getan, das nicht adelig
wäre; wer weiß", setzte sie leise hinzu, "von welcher Geburt er ist." Da
reuete es den Vater, ihn so hart geschlagen zu haben. Florens aber sprach:
"Lieber Vater, ich bin Euer Kind; darum schlaget mich, sooft Ihr wollt,
aber besehet mir nur den Hengst; ist es nicht ein starkes Pferd? Ich hoffe,
er soll mir noch gute Dienste tun!"
Da Klemens sah, daß sein Pflegsohn von dem Pferde zu reden nicht
aufhören wollte, dachte er an die Worte seiner Hausfrau, verschmerzte
den Verlust und hieß Florens an den Tisch sitzen und essen; indem kam
sein Bruder Klaudius, der den ganzen Morgen auf der Börse das Geld
erwartet hatte, und wie er den Bruder tafeln sieht, wird er zornig und
spricht zu seinem Vater: "Wie möget Ihr doch solches tun und mich ,so
lange auf der Wechselbank sitzen lassen? Wie kommt es, daß Ihr mir
das Geld nicht schicket und bei dem Burschen da sitzet, der Euch mit den
zwei feisten Rindern so großen Schaden getan hats" Wie er nun auch
das Pferd in dem Hofe stehen sah, da fragte er verdrießlich: "Wo kommt
denn das grausame Tier her?" Der Vater erzählte ihm die ganze Geschichte
mit Seufzen und fügte hinzu: "Ich will nichts von dem Roß, will
auch sein nicht warten, und sollte es Hungers sterben !" "Es geschieht
Euch recht", sprach der Sohn Klaudius, "er wird Euch gar verderben;
es wäre besser, wenn er gar nicht geboren wäre! Ich will sein Pferd auch
nicht warten; wenn es seinen Kopf aufhebt, meine ich, es wolle mich fressen
!" — "Tut, was ihr wollt", sagte Florens, "ich will schon für das
Tier sorgenl" Damit nahm er das Roß am Zügel, zog es in den Stall,
gab ihm Heu und Haber genug und machte ihm eine gute Streu. Am
andern Morgen frühe eilte er in den Stall, sattelte und zäumte sein
Pferd, sah es mit Freuden an und dachte: "ES ist doch viel mehr wert, als
es kostet!" Dann sprang er drauf und gab ihm die Sporen, daß es einen
Sprung nach dem andern machte und seine ganze Stärke zeigte. Das
Reiten stand Florens so wohl und adelig, daß, wer ihn sah, ihn darum
lobte. Als das Pferd müde war, ritt er es wieder nach Hause, ließ es sich
allgemach erkühlen und an Haber, Heu und Stroh keinen Mangel leiden.
Dabei sah er es immer an und dachte in seinem Herzen: "Könnte mir
nicht vielleicht das Roß einmal zustatten kommen? Denn ich habe große
Lust; Waffen zu tragen. Da würde mir ein Reitpferd nicht übel anstehen
Und nun wollen wir den Florens mit seinem Rosse eine Weile
ruhen lassen.
***Zu der Zeit, als König Dagobert in Frankreich wohl und löblich regierte,
waren die Heiden noch nicht lang aus dem Lande abgezogen, das
sie eine Weile innegehabt und im Kriege wieder verloren hatten. Die
Stadt Paris lag an vielen Stellen öde; aber jetzt fing das Volk an, sich
wieder zu vermehren, und die Hauptstadt des Landes wurde unter Dagoberts
Regierung groß und herrlich, dazu sicher und fest gebaut, und
wo zuvor ein wüster Platz gewesen, da ließ der König das herrliche Münster
zu St. Denis bauen, nicht weit von Paris.
Nun entspann sich wieder ein Krieg zwischen dem König von Frankreich
und den Ungläubigen, welche gewohnt waren, sich noch als Herren dieses
Landes zu betrachten. Die Obersten der Heiden und der Türken saßen
miteinander zu Rat und beklagten sich bei dem Sultan zu Babylonien
über die französische Nation, daß sie sich nämlich zu Paris unterstünden,
einen Tempel zu bauen wider den wahren Gott Mahomets, wie sie denn
überhaupt meineidigerweise vom heidnischen Glauben abgefallen seien.
Als der Sultan diese Rede vernahm, sprach er zu ihnen: "Wohlan, meine
lieben Herrn, ich will Frankreich mit meiner Gewalt von Grund aus zerstören,
seinen König aber an den Galgen hängen und verbrennen lassen!"
Auf diese Zusage ließ er in alle heidnischen Königreiche eine Aufforderung
ergehen, sie sollten ihm zu Hilfe kommen und mit ihm Frankreich verderben.
Da kamen zusammen die Könige aus Arabien und Persien mit
großer Macht, dann der König der Riesen mit dreißigtausend Mann, dann
der König aus Aethiopien, aus Merach und Krypte. Diese miteinander
brachten an zwanzigtausend Mann; da war kein Heide oder Türke, der
nicht gerne vor dem Sultan erschienen wäre. So kam auch der Admiral
oder Emir aus Persien, des Sultans Bruder, und brachte einen großen
Haufen mit sich, so daß auf das Aufgebot des Sultans in dreißig Tagen
an hunderttausend Mann zu Roß und zu Fuß beisammen waren. Diesen
allen zog der Sultan entgegen, empfing einen um den andern aufs freundlichste
und hieß sie willkommen.
Der Riesenkönig, welcher der mächtigste unter ihnen war, begehrte darauf,
mit dem Sultan zu reden, und als es ihm gestattet war, da sprach
er: "Herr und König von Babylon, unser Begehren ist, daß Ihr Euer
Vorhaben so schnell als Möglich ausführet. Lasset Schiffe und Galeeren
wohl beschlagen, daß man alles Volk dareinsetze und nach Venedig schicke.
Denn, beim Gott Mahomets und meiner Treue, komme ich glücklich übers
Meer und finde den König Dagobert, so will ich ihn mit meinen eigenen
Händen erwürgen und mich nicht eher schlafen legen, bis ich mit meinem
Heerhaufen in die Stadt Paris eingezogen bin, daselbst Haus und Hof
gehalten und das ganze Frankreich bezwungen habe. Und dann soll Euch
das Land geschenkt sein, König von Babylon!" Dies zu hören, war dem
Sultan sehr tröstlich, und er dankte dem Riesenkönige wegen seines hohen
Anerbietens. Jetzt hatte er keine Ruhe mehr, bis die Schiffe zugerüstet
und mit Erz beschlagen waren, zweitausend an der Zahl. Dann besetzte
er sein Land mit Wachen und bereitete sich zur Abfahrt.
Der Sultan hatte von seinen vielen Weibern dreißig starke Söhne und
einige Töchter. Unter den letztern befand sich eine schöne Jungfrau, die
ihm vor den andern Kindern lieb war; denn sie war so schön, daß man
meinte, in der ganzen Heidenschaft wäre kein schöneres Mädchen geboren.
Ihr Leib war zierlich und edel gestaltet; ihr Mündlein rot wie Rubin, ihr
Hals weiß wie Milch, ihr Angesicht prangte wie eine Rose; ihre Augen
waren durchsichtig und klar wie Falkenaugen: ja, es war nichts an ihrem
ganzen Leibe vergessen, und wäre sie wohl der schönen Helena aus Griechenland
zu vergleichen gewesen. Ihr Haar, dessen Farbe dem gelben
Dukatengolde glich, wußte sie gar zierlich aufzubinden. Köstlicher Schmuck
glänzte ihr von Haupt und Hals, und ihre Gebärden waren überaus holdselig.
Diese Tochter trat vor ihren Vater, den König von Babylonien,
und bat ihn freundlich, sie mit über das Meer fahren zu lassen; denn sie
hätte ein großes Verlangen, Frankreich zu sehen. Auch sprach sie: "Da
Ihr willens seid, mich zu vermählen, so kann ich nun sehen, welcher König
streitbar ist; denn fürwahr dem, der am ritterlichsten ficht, dem will ich
meine Liebe und Gunst zuwenden und ihn zur Ehe nehmen. Dann rächet
den Schaden, den Euch Frankreich angetan hat, als Ihr aus dem Lande
vertrieben worden seid, und wenn es Euch gefällig ist, so schenket mir das
Haupt des Königs Dagobert." — "Ja, bei Mahomet, das sollst du haben"
, sprach der Sultan, und darauf gingen die Fürsten und Herrn alle
zu Schiff. Der Sultan mit den dreißig gekrönten Fürsten nahm seinen
Sitz auf keiner gewöhnlichen Galeere, sondern er bestieg mit ihnen und
seiner Tochter einen herrlichen Dreimafter, auf welchem vier Adler aus
klarem, lautrem arabischen Golde ihre Köpfe und Schnäbel gegen Frankreich
kehrten. Auf diesem Schiffe saß der König von Babylon und seine
Tochter ihm zur Seite. Der Wind wehte günstig, die Segel waren seiner
voll, unablässig arbeiteten die Ruderer, und in wenigen Tagen gingen
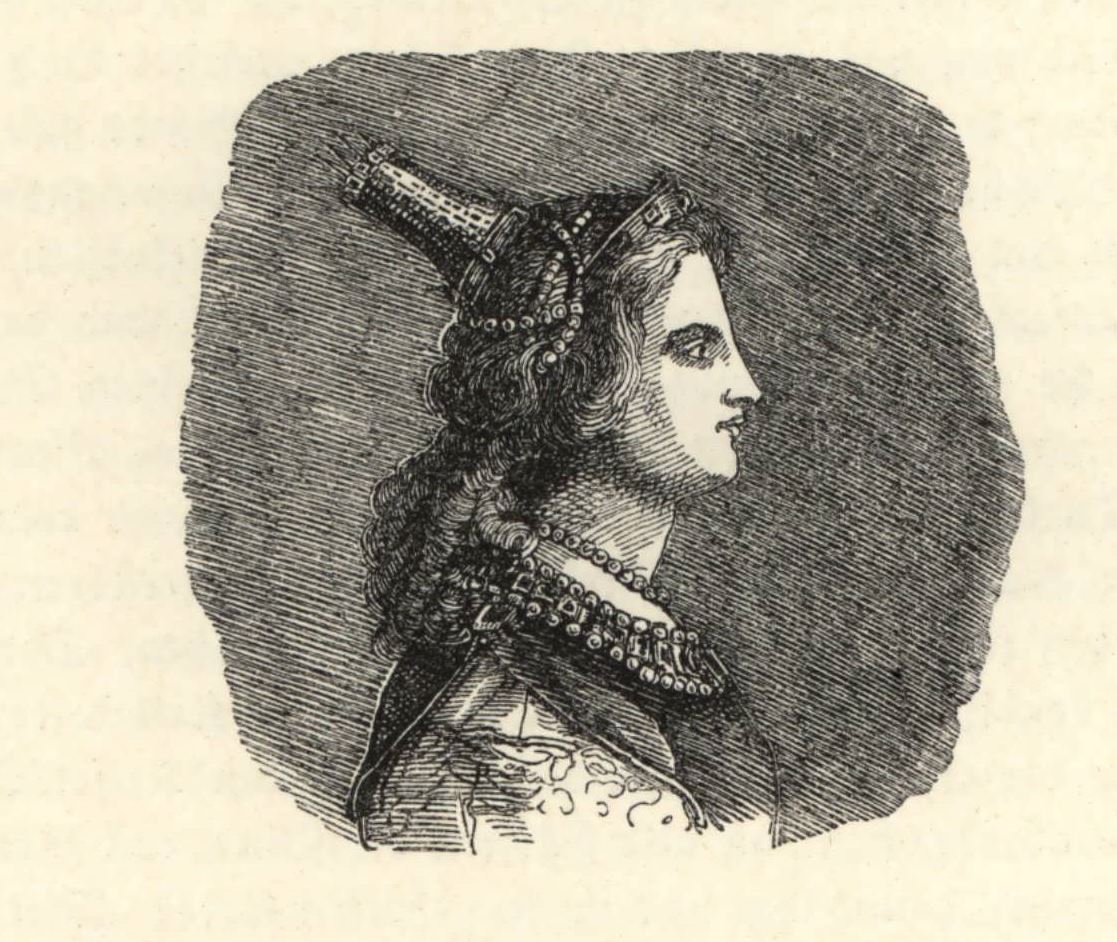
sie bei Venedig vor Anker. Auch hatten die Türken den Plan des ganzen
Kriegs zum voraus entworfen. Demzufolge schlugen sie ihr Lager in
Venedig auf und verwüsteten einen ganzen Monat das Land mit Sengen
und Brennen. Sie jagten durch die Stadt und ihre Dörfer wie Drachen,
schonten nicht Weib und Kind, nicht alt und jung, und auf ihrem ganzen
Wege ließen sie an Häusern und Kirchen keinen Stein auf dem andern stehen.
Die Fürsten und Herren der Christenheit, soviel ihrer in der Umgegend
hausten, kamen in große Not und begaben sich alle in den Schirm des
Königes von Frankreich. Durch diese Flucht erfuhr der König Dagobert
zuallererst von dem Einfalle der Heiden; denn sie trafen ihn gerade über
dem Bau des schönen Münsters zu St. Denis. Da sprachen die Fürsten
zu ihm: "Seid von uns gewarnt, Herr König, versehet Euch wohl mit
Kriegsvorräten; denn der heidnischen und türkischen Hunde sind sehr viele.
Wenn Eure Wacht nicht gut bestellt ist, so sind wir alle verraten und verloren
!" Und nun erzählten sie ihm von all den Streitkräften, die gegen
Frankreich aufgeboten worden. Der König Dagobert war darauf nicht
vorbereitet. Er wandte sich aber mit Zuversicht an seinen Schutzpatron
und sprach: "Heiliger Dionys! Beschirme Frankreich vor allem Unglück!
Wenn die Türken und Heiden überhandnehmen, so wird dein Münster
nimmermehr ausgebaut; die Ungläubigen werden es zerstören oder nach
ihrem Belieben einen heidnischen Tempel daraus machen. Darum, heiliger
Dionys, beschirme deine Stadt Paris!" Darauf fertigte er Boten ab
an die Heere der Christenheit; und vor allen an den Kaiser Oktavianus
zu Rom, die überbrachten an alle Fürsten die Bitte, mit ihrer Heeresmacht
zu kommen, damit ihm und ihnen geholfen werde. Von allen diesen
erhielt er gute Botschaft, und während er sich selbst rüstete, trafen
seine Bundesgenossen schon allmählich ein. Der König von Holland kam
über Meer her und brachte vierzehntausend Mann; der König aus Irland
brachte fünfzehntausend Mann, lauter beherzte Leute, und der König
von England kam mit einer Macht, die nicht zu beschreiben ist. Der König
Dagobert ritt ihnen mit großer Pracht entgegen und dankte ihnen aufs
freundlichste für ihre Hilfe.
Jeder König lagerte sich vor einem andern Tor, und da die Heiden schon
herangekommen waren und nicht ferne von der Stadt ihr Lager hatten,
so fiel, noch ehe der König seine Erlaubnis dazu erteilt hatte, hier und
dort ein Scharmützel vor. Und einer sprach zu dem andern: "Wollte
Gott, der König Dagobert gestattete es uns, so wollten wir bald unsern
Mut an den Türkenhunden kühlen!"
Endlich kam auch der mächtige Kaiser Oktavianus mit seinen Römern
auf einem andern Weg gar stark herangezogen bis an die Stadt Paris.
Aber beinahe kam er zu spät; denn der Sultan war schon zu weit ins Land
hereingekommen. Jedoch den Heiden erschien er immer noch frühe genug.
Der Kaiser hatte seine Gemahlin und seine Kinder noch nicht vergessen,
und sooft er an sie dachte, konnte er sich des Weinens nicht enthalten.
Dieses seines Leides sich zu entschlagen, war er nach der Stadt Paris aufgebrochen.
Da er aber sah, daß alle Fürsten und Heere ihr Lager außerhalb
der Stadt aufgeschlagen hatten und vor den Toren selbst kein Platz
mehr war, so lagerte er sich mit den Seinigen in der Vorstadt St. Germain.
Als nun der König von Frankreich vernommen, daß Kaiser Oktavianus
wohlgerüstet mit dreizehntausend Mann herangekommen und mit
seinem Volke vor St. Germain sein Lager genommen hatte, so ritt er
ihm mit großer Pracht in sein Zelt und bat ihn freundlich, bei ihm selbst
in seinem Palaste Herberge zu machen. Der Kaiser bedankte sich aufs
höflichste und erklärte, die erste Nacht mit seinem Volke hierbleiben zu
wollen. "Doch eines muß ich Euch sagen, Herr König", sprach er, "wes
ist denn das schöne und große Haus, das da vor uns stehet? Die Mauern
sind hoch und stark; der, der es gebaut, hat sich's keine Arbeit kosten lassen
, sondern viel Fleiß und Kunst angewendet. Ohne Zweifel ist auch der
Hausherr, der darin wohnt, sehr angesehen!" —"Nein, das ist er wahrlich
nicht", sprach der König, "es ist einer meiner Bürger, Klemens mit
Namen; aber er ist verständig, und durch seine Klugheit, durch viel Sorgen
und Mühen ist er endlich zu solcher Wohlhabenheit gediehen! Auch
ist er vor Jahren über Meer gekommen, da hat er ein fremdes Kind
mit sich gebracht, so schön und adelig, als man in Paris kaum eines
sehen kann!"
Als der Kaiser Oktavianus dieses hörte, da entfuhr ihm ein Seufzer
um den andern, und er konnte sich des Weinens kaum enthalten. König
Dagobert, der seine Bekümmernis merkte, fragte ihn freundlich, was sein
Anliegen wäre. Da hielt sich Kaiser Oktavianus nicht länger zurück, sondern
erzählte Stück für Stück, wie es ihm mit Frau und Kindern ergangen.
Der König Dagobert schüttelte sein Haupt und strafte den Kaiser
mit weisen Worten, daß er so rasch verfahren sei und sich nicht besser nach
der Sache erkundigt hätte. Auch verschwieg er nicht den Verdacht; den
er hege; daß nämlich die Mutter des Kaisers die Urheberin alles dieses
wels sei. "Wenn jedoch Eure Frau und Kinder noch leben", fügte er
hinzu, "so getröstet Euch Gottes, der stark und mächtig genug ist, sie zu
schirmen, und Eure Unlust wohl noch in Freude zu kehren vermag!" Damit
beurlaubte sich der König Dagobert von dem Kaiser und ritt nach
seiner Stadt Paris zurück. Der Kaiser Oktavianus aber blieb mit großem
Kummer in St. Germain.
Inzwischen verstärkten sich die Türken und Heiden und verderbten während
ihres Durchmarsches das ganze Land. Vor der großen Heerschar
zog ein verlorener Haufe von zehntausend Mann, die gar kein Erbarmen
mit den Christen hatten, sondern Mann und Weib, auch die unschuldigen
Kinder zu Tode schlugen. So erhub sich Heulen und Jammern im ganzen
Lande, und endlich kam diese Vorschar in den ersten Tagen des Aprilmonats
vor den Mauern von Paris an und schlug davor ihr Lager auf.
Bald nach ihnen kam der Sultan von Babylon, mit lauter Gold bekleidet
. Vorn an der Brust seines Pferdes hing ein güldenes Kleinod, mit
Diamanten und Rubinen besetzt. Sein Bart war so lang, daß er bis an
den Sattelknopf reichte, dazu weiß wie Schnee. Sein Helm saß mächtig
hoch und war mit goldnen Knöpfen geziert; er hatte große Augen und
war von stattlichem Wuchse, so daß man nicht leicht seinesgleichen finden
mochte. Sein Pferd hatte auf der Stirn ein gekrümmtes Horn aus lautrem
Golde geschmiedet. Neben dem Sultan ritt Marcebylla, seine Tochter
, aufs köstlichste gekleidet und mit Kleinodien geschmückt. An der Stirn
ihres Pferdes hing eine goldene Sonne, mit einem Rubin, einem Smaragd
, einem Diamant und vielen Perlen des Morgenlands schön verziert.
Vor und nach ihr ritten Jungfrauen, Königs- und Herrentöchter, dreihundert
an der Zahl, die wären manches guten Gesellen Freude gewesen.
Auch den Gott Mahomets ließ der Sultan auf einem vergoldeten Wagen
führen, und täglich betete er ihn auf den Knien an. So ritt er Tag und
Nacht mit seiner Ritterschaft, daß er den König von Frankreich um so eher
grüßen möchte.
Auf diese Weise kam er endlich vor Paris und ließ sein Zelt so köstlich
aufschlagen, daß es höher zu achten war als manches Fürstentum. In
demselben übernachtete er mit seiner vornehmsten Ritterschaft; doch stellte
er sorgfältig Wachen aus und schickte Kundschafter ab, das französische
Heerlager zu besehen. Diese kamen zurück und berichteten dem Sultan,
wie sie die Franzosen alle in guter Ordnung gefunden, die Tore und
Mauern wohlbesetzt, der Christen Kriegsheer so groß, daß es ihnen unmöglich
gewesen, die Menge zu erkunden. Diese Kundschaft brachten sie
dem Sultan in Gegenwart des Riesenkönigs, der sehr zornig ward und
zu dem Sultan sprach: "Ich will keine Ruhe haben, bis diese Stadt mitsamt
,dem Lande zerstört ist, daß kein Stein auf dem anderen bleibt!"
Aber viele Türken, welche die Botschaft auch vernommen hatten, entsetzten
sich vor den Christen und dachten heimlich bei sich, wenn sie nur zu Hause
geblieben wären. Als die Boten abgehört waren, kam die Jungfrau Marcebylla
vor ihren Vater und bat ihn mit holdseligen Worten, daß er ihr
vergönnen wolle, vor die Stadt Paris zu reiten, weil sie große Lust hätte,
dieselbe von nahem zu sehen. Dies gestattete auch ihr Vater, doch befahl
er sie in den Schutz des Riesenkönigs, was diesem keine kleine Freude
machte; denn er fand dadurch Gelegenheit, sich bei dem Sultan in Gunst
zu setzen, und überdies war er der Jungfrau von Herzen hold.
Die Franzosen und ihre Verbündeten ihrerseits, als sie die Ungläubigen
so nahe an die Stadt Paris gerückt sahen, schwuren zusammen, sich sobald
als möglich zu schlagen. "Ich will den ersten Angriff tun", sprach
der König von Spanien. — "Ich will", sprach der Kaiser Oktavianus,
"Mann für Mann gegen den Sultan kämpfen." — Die Könige aus
Schottland und England sprachen: "Desgleichen wollen auch wir tun!"
Und so wappneten und rüsteten sie sich, ein jeglicher zur Schlachtordnung.
***Als sich Dagobert mit den Königen und allem Volke zur Schlacht gegen
die Heiden vorbereitete, kam ein ungestalter Bote mit einem großen Höcker
auf dem Rücken; seine Augen standen handbreit voneinander, er hatte
krumme Schenkel, eine breitgedrückte Nase, einen dicken Kopf: kurz, er
war sehr häßlich anzusehen. In seiner Hand trug er anstatt der Peitsche
ein Seil mit scharfen Knöpfen, damit schlug er seinem Pferde zwischen die
Rippen. Als diesen einige Franzosen gewahr wurden, machten sie sich in
seine Nähe; denn sie meinten, es wäre ein Meerwunder. Dieser ungestalte
Bote ritt durch die französischen Heerhaufen und rief mit heller Stimme:
"Wo ist Dagobert, König von Frankreich, welcher Ehre und Ruhm in der
Stadt Paris behauptet? Ich bringe ihm Botschaft von meiner gnädigen
Frau, der Tochter des Königs von Babylon, und habe mit ihm zu reden."
Als die Franzosen dies hörten, verwunderten sich alle über den haarigen,
häßlichen Kerl, der zum Boten gewählt worden; doch führten sie ihn vor
den König, zu hören, was sein Anbringen wäre. Wie nun der mißgeftalte
Mann vor den König kam, kniete er nieder und sprach mit heller Stimme
zum König und allen anwesenden Herren: "Merket auf, Herr König in
Frankreich 1 Meine gnädigste Herrin Marcebylla, Prinzessin von Babylon"
entbeut Euch, daß sie gekommen sei, Euch und die Eurigen zu verderben.
Zu dem Ende hat sie das Land zum größten Teile verwüstet und jetzt ihr
Lager vor dem Tore von Paris auf dem Montmartre aufgeschlagen. Deswegen
läßt sie Euch fragen, ob Ihr Euch getrauet, die Stadt Paris zu
beschützen, oder ob Ihr nicht vorzieht, Euch gutwillig zu ergeben. Weiter
entbeut sie, daß morgen zur rechten Tagszeit ihr Geliebter vor der Stadt
Paris erscheinen wird im Panzer und mit Schild und Speer, wie es einem
Streiter gebührt, und mit dem mannlichsten Ritter, den Ihr unter den
Eurigen finden möget, zu fechten bereit ist. Findet Ihr unter Eurer Ritterschaft
keinen, so wird der Kämpfer meiner gnädigen Frau doch nicht
ungestritten von Paris abziehen. Vielmehr wird von ihm morgenden Tages
die Stadt Paris bestürmt werden. Darum, Herr König, bedenket
Euch kurz, was zu tun ist." Der König erwiderte: "Lieber Freund, hat
deiner Gebieterin Liebhaber Lust zu streiten, so soll ihm dieses gewährt
sein, und er mag sich zur rechten Stunde auf dem Kampfplatze einfinden."
Da sagte der Bote dem König großen Dank. "Aber wahrlich", fügte er
hinzu, "es wird Euch gereuen; denn ehe ein Monat vergeht, trägt meiner
Herrin Liebster Eure königliche Krone auf dem Haupt, und Euer Volk
hat er getilgt und ausgerottet." Mit diesen Worten schied er von dem
Könige, ritt aufs schnellste zurück zu des Königs von Babylonien Tochter
und meldete ihr den günstigen Erfolg seiner Botschaft. Der Riesenkönig,
als er dieses hörte, wurde halbunsinnig vor Freuden. Er verhieß der Jungfrau
, daß er am andern Morgen sicher vor der Stadt Paris erscheinen
und allen Franzosen Fehde verkünden wolle. Ja, alle, die er in seine Gewalt
bekäme, die wolle er mit seinen Händen in Stücke reißen. Dies gefiel
der Jungfrau wohl, und sie bedankte sich für seinen guten Willen.
Am andern Tage vor Sonnenaufgang wappnete sich der Riesenkönig
vom Kopf bis zu den Füßen; er begehrte jedoch weder Spieß noch Speer,
noch Hellebarde, sondern einzig und allein sein Heidenschwert. Ebenso
wollte er auch auf kein Roß sitzen, sondern frei und ledig zu Fuße gehen;
denn er war bei zwölf Fuß lang. Als er nun gerüstet und angetan war;
begab er sich zu der Jungfrau, beurlaubte sich von ihr und schlug den geraden
Weg nach Paris ein. Wie er vor die Stadt gekommen war, zog er
sein Schwert aus und schrie mit lauter Stimme: "Ich streite, ich streite
für meine Herzallerliebste. Wer da Lust hat, komme, so will ich sein nicht
fehlen!" Die Einwohner der Stadt Paris hatten dieses Geschrei gehört,
liefen eilig auf ihre Mauern, und als sie den entsetzlichen Riesenkönig
sahen, erschraken sie vor ihm über alle Maßen, so daß sich keiner vor die
Mauern hinauswagte. Auch König Dagobert empfand keine sonderliche
Freude, als ihm der Riesenkönig gezeigt ward. "Heiliger Dionysius", rief
er, "beschirme dein Münster und bitte Gott für uns, daß wir nicht von
den Widerspenstigen vertrieben werden!" Aber kein Fürst noch Herr wollte
es wagen, mit dem Riesen zu streiten, bis sich endlich ein junger, edler
Ritter aus Frankreich fand, der sprach: "Wahrhaftig, wir sind nicht eines
faulen Apfels wert, wenn keiner unter uns ist, der das Herz hätte, diesen
Feind zu bestehen! Darum bringet mir meinen Harnisch, Schild und
Speer, Stiefel und Sporen, vor allem aber mein Pferd und mein Schwert;
denn ich habe große Lust, mit diesem Riesen zu streiten!" So wurde der
Ritter in Eile gewaffnet. Er hatte ein gutes Roß, auf das er sich verlassen
konnte; dieses bestieg er, nahm den Speer in seine Hand, und nachdem
er, sich versuchend, eine gute Weile die Gasse gerüstet auf und ab
geritten, nahm er Urlaub von dem Könige, der eine große Freude an ihm
hatte, und das Stadttor öffnete sich ihm.
***Als der junge Ritter im freien Felde war, ritt er auf dem nächsten
Wege nach dem Riesen zu. Die Franzosen aber lagen auf den Mauerzinnen,
zu sehen, wie er sich helfen würde. Beim Anblick des christlichen
Ritters wurde der Riese zornig; er achtete es für einen Spott, mit einem
so kleinen Männlein zu streiten. Der Ritter aber rannte mutig auf den
Riesen los, so daß ihm sein Panzer durchstochen ward, doch drang der
Speer nicht in den Leib, und der Riese stand unerschütterlich wie ein Turm.
Dabei war er nicht säumig, sondern lauerte auf seinen Vorteil, und eh'
sich's der Ritter versah, geriet dem Riesen ein Griff, daß er seinen Feind
erwischte, aus dem Sattel hob und, ihn wie eine Feder auf seine Achsel
nehmend, mit ins Lager trug. Der Ritter saß auf der Schulter des Riesen
und rief Gott und alle Heiligen zu Hilfe; denn ihm war's, als wär '
es der lebendige Teufel und wollte er ihn geradezu in die Hölle tragen.
Der Riese eilte zu seiner Jungfrau, und nach gar freundlichem Gruß und
Gegengruß setzte er seinen Gefangenen auf die Erde und schenkte ihn seiner
Geliebten. Der junge Ritter aber meinte nicht anders, als daß er auf
der Stelle sterben müßte. Aber die Königstochter erbarmte sich seiner;
denn sie war den Christen im Herzen nicht feind. Doch wollte sie wissen,
wie es gekommen, daß gerade dieser kleine Ritter ausgezogen, mit dem
Riesenkönige zu kämpfen, und drang mit strengen Worten in ihn, die
Wahrheit zu gestehen. Den Ritter kam aufs neue Furcht an; er erzählte
alles, wie es ergangen war, und kniete dann in seinem Panzer vor der
Prinzessin nieder. Diese wunderte sich über seine Kühnheit; hieß ihn den
Panzer ablegen und sich gütlich tun. Der Ritter meinte, jetzt gehe es
ihm an den Hals; aber es ward ein gutes Mahl aufgetragen, und seinen
ritterlichen Mut zu ehren, hieß die Fürstin ihn zu Tische sitzen und fröhlich
sein. Nun sah er wohl, daß ihm sein Leben geschenkt war, und dankte
der Jungfrau mit weinenden Augen. Das Nachtmahl wurde prächtig
gefeiert mit großer Freude und Frohlocken des Sieges halber, den der
Riesenkönig im Felde erhalten hatte.
Am andern Morgen begrüßte die Jungfrau ihren Buhlen, und der Riesenkönig
bat sie mit sanften Worten um einen Kuß. Aber die Königstochter
wehrte ihm und sagte: "Ja, wenn Ihr mir den König von Frankreich
bringet; wie Ihr mir diesen Ritter gebracht habt, dann will ich Euch
einen freundlichen Kuß geben." Darüber ward der Riese hoch erfreut;
neigte sich tief vor seiner Geliebten und waffnete sich abermals zum Streite.
Bald darauf hörte man ihn hart am Tore von Paris mit lauter Stimme
gräßlich schreien: "Hier steh ' ich allemand zum Streite bereit, von meiner
Geliebten Marcebylla gesandt! Oh, König Dagobert, dir soll es übel ergehen,
wenn du die Stadt Paris nicht übergeben willst; denn du wirst
keinen Ritter mehr finden, der mit mir streiten mag!" Und wirklich waren
alle Fürsten und Herren erschrocken, und keiner von ihnen empfand
eine Lust, mit dem Riesen zu kämpfen. Der fromme König Dagobert

schaute um sich und sprach: "Wohl denn, wappnet mich behende; denn ich
selbst will Leib und Leben gegen diesen Teufelsriesen wagen und ihn mit
Gottes Hilfe umbringen, wo nicht, so mag er mich totschlagen! Heiliger
Dionys, du wirst nicht dulden, daß ich dein Münster unausgebaut lasse,
komme du mir zu Hilfe!"
Als dies Oktavianus, der römische Kaiser, hörte, sprach er zu Dagobert:
"Das wolle Gott nicht, mein Herr Bruder, daß Ihr selbst mit dem
Riesen streitet; vielmehr lasset mich hingehen und den Kampf wagen!"
Aber der König von Frankreich wollte es nicht gestatten, und so stritten
sie miteinander um die Ehre des Kampfes.
***Während nun die Fürsten und die Herren so miteinander sprachen, spazierte
der Bürger Klemens durch die Straßen von Paris, und sein Sohn
Florens trat ihm an Dieners Statt nach. Wie sie nun sahen, daß die
Herren auf dem Balkon des Schlosses so traurig beieinander standen,
fragte Florens seinen Vater nach der Ursache. "Ach lieber Sohn", sagte
Klemens, "du weißest ja, daß die Ungläubigen vor Paris sind. Nun ist
da ein mächtiger Riesenkönig, ein Liebhaber der Tochter des Königs von
Babylon, an den will sich kein Herr, kein Ritter oder Knecht wagen; denn
er hat ganz plötzlich einen jungen mannlichen Ritter überwunden. Darum
sind die Fürsten so erschrocken; denn wäre der Riese besiegt, so würden die
übrigen Heiden bald aus dem Lande geschlagen sein." "Wie?" sprach
Florens, "hat der Riese den Ritter denn gefressen?" "O nein", erwiderte
Klemens, "er hob ihn mitsamt seinem Panzer auf die Achsel und trug
ihn in das Zelt der Jungfrau." — "Oh, wenn mir solches widerführe",
rief Florens, "ich wollte unerschrocken sein! Mit Jungfrauen ist gut handeln!"
— "Lieber Sohn", erwiderte ihm Klemens, "du hifi wohl ein frischer
Junge; aber bedenke, wie groß und stark der Riese ist; es ist kein
Wunder, wenn sich die Fürsten bekümmernd"
Da fing Florens an, seinen Vater inständig zu bitten, daß er ihn mit
dem Riesen streiten und seine Stärke versuchen lasse. "Ich habe ja", sprach
er, "ohnedies ein Pferd, das mich teuer genug zu stehen kommt!" Als
Klemens lange vergebens seinen Sohn abgemahnt und dieser endlich gedroht
hatte, so wie er da stünde, ohne alle Waffen zu dem Riesen zu
gehen, so wurde der Vater zornig und sprach: "So fahre hin und lebe
nach deinem Willen l Wolltest du aber meinem Rate folgen, so bliebest
du daheim und ließest den Riesen zufrieden. Ich habe auch keinen doppelten
Harnisch für dich, mein Krebs ist nichts mehr nütze, sondern rostig, die
Armschienen sind ganz schmutzig; seit dreißig Jahren hab ' ich kein Stück
mehr von allem am Leibe gehabt; auch mein Spieß ist ganz krumm und
schwarz vom Rauche. Du weißest ja, ich bin lieber hinter dem Ofen gesessen
als zu Felde gezogen. Harnisch tragen bringt selten Nutzen, wohl
aber viel Schläge auf den Rückens" — "Vater", sagte Florens, "das
schadet all nichts, gebt mir nur die Stücke, von denen Ihr gesprochen; so
rostig sic sind, so will ich doch Ehre damit einlegen. Ja, ich möchte sie
nicht mit andern vertauschen, die noch so schön glänzen!" — "Nun, so
will ich dir meine rostige Rüstung holen", sprach Klemens verdrießlich,
"weiß ich doch wohl, daß du damit wirst ausgelacht werden. Aber sei dem
Allmächtigen befohlen, der wolle deine Seele bewahren!" Jetzt war Florens
vergnügt, und bald hatte er sich mit dem rostigen Hamisch gewaffnet
. Sein Vater Klemens setzte ihm den alten Helm auf, der inwendig
voll Spinnweben und von außen ganz schwarz war; Mäuse und Ratten
hatten lange darin genistet; dann gab er ihm sein Schwert, das wohl dreißig
Jahre nicht aus der Scheide gekommen war und vor lauter Rost sich
nicht ausziehen lassen wollte. Klemens nahm es beim Kreuz, der andere
Sohn Klaudius bei der Scheide; sie zogen so hart, daß beide rückwärts
fielen, Klemens mit dem Schwert in der Hand, Klaudius mit der Scheide.
Da hätten beide lieber geweint als gelacht. Doch gefiel es dem Florens,
und er sagte scherzend zu seinem Vater Klemens: "Fürwahr, Vater, Ihr
müßt schon lang keinen Zückfrevel mehr gezahlt haben, das sieht man
Eurem Schwerte wohl ant" Klemens erwiderte: "Weißt du was, mein
Sohn, hänge das Schwert lieber ohne Scheide um, dann brauchst du beim
Ausziehen nicht mehr auf den Rücken zu fallen!" So scherzten sie miteinander
Endlich brachte ihm Klemens auch das Roß, das er mit des
Vaters Münze und Schätzen erworben hatte; es war stattlich anzuschauen
und nach französischer Sitte wohlaufgezäumt, der Sattel hübsch durchbrochen,
der Zaum an drei oder vier Orten mit Nesteln wohlgeziert. Das
gefiel Florens gar wohl; er schwang sich hinauf und rief: "Wo ist der
Riesenkönig? Nun gebt mir nur noch den Sperr! ' Der Vater reichte ihm
auch den, der sah aber gar dürr aus; denn er hatte lang als Hühnerstange
gedient.
"Nun fahr hin, lieber Sohn", sprach Klemens, "Gott wolle dir Gnade
verleihen, daß du an diesem Tage Ehre einlegest. Ich will dir das Geleite
geben bis zur Pforte der Stadt und auf der Zinne achthaben, wie es
dir geht. Je größere Streiche du dem Riesen versetzest, je lieber wirst du
mir sein!" — "Vater", sagte Florens, "vermag ich's, so will ich Euern
Willen, tun. Ja, ich hoffe, dem König Dagobert noch am heutigen Tage
das Haupt des Riesen in die Hände zu liefern!" Mit diesen Worten nahm
Florens Urlaub von seiner Pflegemutter, die sehr um ihn weinte, und von
seinem Bruder Klaudius. Er ritt in seiner rostigen Rüstung durch die
Gassen von Paris, von Klemens begleitet, von allen andern Bürgern
aber verspottet. "Sehet doch", sprach einer, "was da für ein glänzender,
wohlaufgeputzter Ritter kommt!" Ein anderer sprach: "Laßt ihn nur reiten
, der wird uns großen Nutzen schaffen. Wenn den die Heiden erblicken,
werden sie an ihm so erschrecken, daß alle die Flucht ergreifen!" —"Gewiß
, der will mit dem Riesen streiten", sagte ein dritter, "und will des Königs
von Babylon Tochter freien!" Auch unter den Fürsten und Herren
wurde er so zum Gespötte. Er tat aber, als ob er es nicht hörte, und ritt
so fort bis ans Tor.
Zur selben Stunde erschien auch der Riesenkönig vor den Toren und

hub abermal zu schreien an: "Ihr Pariser, ihr Bastarde, wollet ihr nicht
das Tor auftun? Es wird euch übel gehen, ihr müßt alle von meinen
Händen sterben, dawider vermag euer Gott nichts. Euren König Dagobert
hänge ich an den Galgen; was nicht umkommt, soll schmählich aus
Stadt und Land verjagt werden und nimmermehr zurückkommen." Die
Wächter auf den Mauern hörten das Geschrei, und als es den Fürsten und
Herren angezeigt wurde, erschraken sie nicht wenig. Florens aber, als er
den Riesen so schreien hörte, hatte keine Ruhe mehr. Man mußte ihm das
Tor auftun und ihn hinauslassen. Da lief in Paris alles auf die Mauern;
denn jetzt merkten sie, daß der rostige Ritter mit dem Riesen streiten wolle.
Der gute alte Klemens, um besser zusehen zu können, saß rittlings auf
die Mauerzinne und rief seinem Sohne den Segen hinab. Indem sprengte
Florens auf den Riesen zu. Als dieser ihn kommen sah, rief er ihm entgegen:
"Wahrlich, du glänzender Ritter, du magst dem wohl billig danksagen,
der dich gewappnet hat. Beim Gott Mahomets, dein Hamisch und
deine Rüstung sind gar zu lustig; ich meine, du hast ihn in einer Pfütze
aufbewahrt. Was ist dein Begehr? Warum bist du hier? Du wirst doch
gar nicht mit mir streiten wollen? Kehr um und sage deinem König Dagobert,
er soll selber kommen, mit mir zu kämpfen. Mit einem so rostigen
Ritter zu fechten, wäre mir Schande!" Bei diesen schimpflichen Worten
zitterte Florens vor Zorn und sprach zum Riesen: "Ich merke wohl, daß
du mein spottest, aber ich will dich bald besser reden lehren! Denn mit
deinem Haupte will ich meinen gnädigen König Dagobert begaben. Ein
anderes Geschenk verlange ich nicht von dir!"
Mit diesen Worten rannte Florens gegen den Riesen und sprach ein
leises Gebet. Da stand ihm Gott in seinem ersten Ritte bei, also daß er
den Riesen mit dem Speer auf den Boden rannte. Er hatte ihm den
Rücken so durchstochen, daß der Spieß ein Klafter lang herausragte. Das
Blut floß auf die Erde wie das Wasser aus einem Röhrbrunnen; der
Riese war mit seinem eigenen Blute besudelt bis an die Fersen. Als der
alte Klemens auf der Mauer jenen Stoß sah, dankte er Gott mit großen
Freuden und sprach: "Gesegnet sei die Stunde, in der ich dich übers
Meer getragen habel" Der Riesenkönig war durch den Stoß schwer erzürnt
und holte, auf der Erde liegend, mit seinem gewaltigen Schwert
aus. Aber Florens, der sorgte, er möchte ihn hinwegtragen, wie er es mit
dem jungen Ritter gemacht, sprang mit dem Pferd ein wenig beiseite und
faßte den Streich mit dem rostigen Schwert auf, das er nicht zu ziehen
brauchte; denn er hatte es nach des Vaters lustigem Rat ohne Scheide an
sich hangen. Dann holte er selbst zum Streiche aus, so sicher und stark,
daß er dem Riesen den linken Arm abschlug, so daß dieser vor ihm nieder
auf die Erde fiel. Den Streich sah Klemens abermals und schrie: "Gott
stärke dich! Ich bin fröhlich, wenn ich dich ansehe! Glückselige Stunde, wo
ich dich kaufte l Noch glücklichere, wo ich dich nach Paris brachte! Fürwahr;
du hast mein Geld um das Pferd wohl angelegt! Auch werden die Franzosen
deines rostigen Harnisches nimmer spotten! Schlag ihm den andern
Arm auch entzwei, mein Sohn, daß er sich in den Tod geben mußt" Dies
Geschrei hörte Florens und sah, wie sich alle, die auf den Mauern waren,
mit seinem Vater Klemens für ihn freuten.
Der Riese aber trauerte um seinen Arm und sprach in großem Zorn:
"Du Bösewicht; mit deinem rostigen Schwert hast du mir manchen Schlag
gegeben und mich schwer beschädigt! Meinst du aber, du habest mich damit
überwunden? Nein, beim Gotte Mahomets, und wenn du fünfzehn
der stärksten Ritter bei dir hättest, so müßten sie alle mit dir sterben!" —
Florens antwortete: "Du lügst, mit mir ist der lebendige Gott!" Damit
faßte er sein rostiges Schwert mit beiden Händen und tat einen so harten
Streich auf den Riesen, daß er ihm den Helm vom Kopfe schlug. Der
Riese aber war auch nicht unbehende; er erwischte den Florens bei seinem
Schild und gedachte, ihn dadurch unter sich zu zerren. Aber Florens ließ
den Schild in der Hand des Riesen. Dieser schleuderte ihn hoch in die
Luft; daß ihn Florens nimmer zu sehen bekäme, dann schlug er ernstlich
auf diesen zu und traf ihn mit seiner Faust auf den rechten Schenkel, so
daß Florens beinahe rücklings vom Pferd gefallen wäre, doch kam er bald
wieder in den Steigbügel. Klemens hatte alles von der Mauer herab gesehen.
"Ach, lieber Florens", rief er, "ich glaube, du schläfst; erwache
von deinem Schlummer; denn wenn du von dem Riesen überwunden
wirst, so ist ganz Frankreich verdorben!" Florens hörte das Geschrei seines
Vaters und machte sich mit seinem rostigen Schwert wieder an den
Riesen; er gab ihm einen solchen Streich auf die Schultern, daß ein großes
Stück des harten Leders, welches in Kappadozien gefertiget worden,
und womit der Riese bekleidet war, mitsamt seinem Fleisch zur Erde fiel.
Das Blut floß auf den Boden, als hätte man einen Ochsen geschlachtet.
Als der Riesenkönig sein Blut so rinnen sah, hätte er lieber gewollt, er
wäre bei dem Sultan oder bei der Jungfrau Marcebylla, denn er empfand
über sich einen, der sein Meister war, und ein solcher war ihm noch
nie unter die Augen gekommen. Doch erholte er sich von seinem Entsetzen
und eilte mit großem Grimm auf Florens zu. Dieser wich vier oder
fünf Schritte hinter sich; doch der Riese verfolgte ihn und traf sein Roß
auf den Kopf, daß es zur Erde fiel. Florens, der dem Tier auf dem Rücken
lag, säumte nicht lang, sondern schwang sich herab auf seine Füße,
doch mit großen Sorgen; denn er fürchtete, den Fußkampf mit dem Riesen
nicht auszuhalten. Die Ritter, die auf der Mauer standen und zusahen,
schrien alle mit lauter Stimme: "Oh, du starker Gott, komm unsrem
jungen Ritter zu Hilfe, daß er den grimmigen Verfolger deiner Christenheit
überwinden möge!" Den Riesen machte dieser Zuruf wieder mutig,
er trat auf Florens zu und sagte zu ihm: "Nun hast du deinen letzten Tag
erlebt; nun will ich Frankreich in dir überwinden! Und wiewohl du mir
einen Arm abgehauen hast, so soll es mir doch nicht viel schaden; denn
ich habe einen Arzt; der mir meine Wunden bald heilen kann." Florens
aber sprach: "Ich aber habe noch viel bessere Hilfe bei mir, ich habe den
lebendigen Gott mit seiner Gnade. Und obwohl du mir den Schild genommen
hast, so hast du mich doch nicht überwunden!" — "Laß sehen",
sprach der Riese, "wir wollen es bald innewerden, wie stark dein Gott
ist!" Und nun schlug er mit seinem Schwert so gräßlich auf Florens los,
als wollte er ihn mit einem Streich voneinander baun Florens aber
war ihm viel zu geschwind, sprang aus dem Streich und wehrte sich so
ritterlich, daß ihm der Riese keinen Schaden zu tun vermochte. Da wurde

sein Feind immer wilder, aber in der Hitze übersah er die Schanze an
der sie fochten, strauchelte über einen Stock und tat einen Fall, von dem
der ganze Platz erzitterte. Jetzt nahm Florens seinen Vorteil wahr, sprang
mit seinem alten Schwert hinzu und gab dem Riesen so manchen harten
Streich, daß er sterbend seinen Sieger um Gnade anflehen mußte. Aber
Florens sprach: "Gott allein sei die Ehre, ihm, der mir geholfen hat; darum,
du falscher Heide, mußt du sterben!" und mit diesen Worten hieb er
dem Riesen sein Haupt ab und sagte: "Dies Haupt soll ein Ehrengeschenk
für meinen König Dagobert sein." Das Haupt war aber so groß, daß es
Florens mit aller seiner Stärke kaum an seinen Sattel zu binden vermochte
; denn sein Roß war während des Fußkampfes von dem Stoße
wiedergenesen und hatte sich neben seinem Herrn aufgestellt.
Nun dankten Klemens und alle, die auf der Mauer waren, Gott mit
lauter Freude, daß er dem Florens soviel Gnade verliehen; sie sprangen
hinab von der Mauer und rannten zum Tor hinaus, ihm entgegenzugehen;
denn sie glaubten nicht anders, als der Ritter würde von Stund an mit
ihnen in die Stadt reiten. Aber Florens hatte ein anderes Anliegen. Er
gab ihnen das ungeheure Haupt des Riesen und befahl ihnen, dasselbe
dem Könige Dagobert zum Geschenk zu bringern Ihn selbst mußten sie
des Wegs reiten lassen. Und so begab sich denn sein Vater Klemens mit
den andern Franzosen in die Stadt zurück und brachte dem König Dagobert
das Haupt des Riesen; dieser aber konnte des Staunens und der
Freude kein Ende finden.
***Florens war nicht sobald allein auf freiem Felde, als er sich selbst einen
Schwur tat, nimmermehr nach Paris zurückzukommen, er hätte denn zuvor
des Königs Tochter aus Babylonien gesehen. Denn er hatte so viel
von ihrer Schönheit gehört, daß er keine Ruhe hatte, ehe er ihres Anblicks
teilhaftig geworden. So hörte er denn nicht auf zu reiten, bis er nach
dem Berge Montmartre kam, wo der Jungfrauen Lager in Zelten aufgeschlagen
stand. Wie nun Florens so den Heiden entgegenritt, da sprachen
sie zueinander: "Sehet doch zu, was will dieser trefflich gerüstete,
rostige Ritters Beim Gott Mahomets, sein Harnisch glänzet sehr, obwohl
meistenteils von Rost; so sehet auch, wie sein Speer so schön bemalt ist;
freilich hat es nur der Rauch getan! Auf gleiche Weise ist auch sein Schild
(denn diesen hatte Florens wieder zu sich genommen) trefflich aufgeputzt.
Sein Schwert bedarf keiner Scheide; denn der Rost ist sein genügender
Überzug! seine ganze Rüstung zeigt etwas Seltsames an; laßt uns
ihn gefangennehmen und ihn mitsamt seiner Bekleidung dem Riesenkönig
übergeben, der macht ihn gewiß zu unserem Hauptmann; denn seine Rüstung
zeigt uns an, daß er etwas Vortreffliches ist!" So redeten die Heiden
die Wahrheit, ohne es zu wissen. Florens ritt inzwischen auf das Zelt
der Jungfrau Marcebylla zu, die sich gerade mit ihren Jungfrauen vor
dem Zelt im Grünen erging; denn sie hatte es an einem lustigen Ort
aufgeschlagen. Auf der einen Seite des Lagers war ein kleines dichtbelaubtes
Wäldchen, in welchem die Nachtigallen Tag und Nacht lieblich
sangen; auch waren grünende Matten da, mit bunten Blumen schön verziert:
hier brachen die Jungfrauen Blümlein und wanden manchen Kranz
daraus. Einen solchen hatte auch die Prinzessin Marcebylla selbst gewunden
und gedachte, ihn dem Riesenkönige zu übergeben, wenn er vom siegreichen
Streit nach Hause käme. Auf der andern Seite des Lagers floß
das rasche Wasser, die Seine, so daß man keinen anmutigeren Ort, sich
zu lagern, hätte wählen können. Die Jungfrau Marcebylla selbst war
köstlich geziert, sie hatte ein grünes Seidenkleid an, das zu Alexandrien
gefertigt und mit lautrem, klarem Golde verbrämt war. Ihr Haar war
nach heidnischer Sitte mit edlen Steinen geschmückt, in denen sich die
Sonne hell spiegelte, und die einen solchen Glanz von sich gaben, daß
Florens von ferne dachte, es seien gewaffnete Heiden, die zur Hut der
Jungfrau dahin abgeordnet wären. Deswegen erschrak er anfangs ein
wenig. Aber das brennende Verlangen, das er nach der unbekannten
Jungfrau trug, gab ihm wieder Mut, daß er vorwärts und auf der Fürstin
Lager zu eilte. Als die Jungfrau aufblickte und einen Ritter von
ferne so ernstlich auf ihr Zelt zureiten sah, verwunderte sie sich über diesen
unerwarteten Anblick, und mit ihr zugleich alle ihre Jungfrauen. Diese
trieben großes Gespötte mit der rostigen Rüstung des Fremden; am meisten
aber spottete seiner die Jungfrau Marcebylla selbst, und endlich sagte
sie lachend: "Ich glaube gar, er hat unser Oberhaupt, den Riesenkönig
getötet; denn sein Schwert ist noch voll Bluts, wenn es anders nicht auch
Rost ist." — Eine andere Jungfrau, die erste nach der Fürstin, um ihr
zu Gefallen zu sein und den Spott zu vermehren, hub ganz feierlich an:
"Fürwahr, Prinzessin, Ihr habt unrecht, den rostigen Ritter so zu verspotten
So wahr mir der Gott Mahomets helfe, mein Sinn fängt seinethalben
an sich zu bewegen; es ist auch kein Wunder, er ist so schmuck
und schön! Ich wollte, ich könnte ihn mit meinen Armen umfangen; wie
wollte ich seine rostige Schönheit herzen!" — Und noch war es des Spottens
nicht genug; denn eine andere Jungfrau erhob sich und sprach: "Laßt
ihn doch zufrieden mit Eurem Spotten, der rostige Ritter ist mein Trost,
sobald ich mit ihm reden kann, soll er mein Buhle werden!"
So spotteten sie in die Wette. Aber Florens wußte von allem dem
nichts, sondern trabte nur sehr ernstlich auf das Zelt der Jungfrau zu
und dachte: "Ich will auf dieser Reise Leib und Leben wagen; bekomme
ich nur einen freundlichen Kuß von des Sultans Tochter, so gehe ich nimmermehr
nach Paris zurück." Marcebylla stand vor ihrem Zelte still und
war begierig, was der rostige Ritter begehren würde. Florens aber gebärdete
sich wie einer, der sich auf solche Händel wohl versteht; er tat; als
ob er ihrer nicht achtete, bis erste überraschen zu können hoffte. Da
wandte er plötzlich sein wohlabgerichtetes Pferd, faßte sie beim Arm und
schwang sie mit aller Geschicklichkeit zu sich auf den Sattel. Als er sie
einmal auf dem Roß hatte, drückte er sie an seine Brust und gab ihr manchen
Kuß; denn der Pfeil der Liebe hatte sein Herz getroffen. So ritt er
mit ihr davon. Der Fürstin Marcebylla aber war kläglich zumute. Sie
wußte nicht, wer ihr Räuber war, ob Christ oder Heide, darum rief sie
jammernd: "O Gott Mahomets, ist denn kein frommer Held da, der mir
zu Hilfe kommen Ach, mein Vater, ich werde dich nimmer sehen!" Auf
diesen ihren Hilfeschrei eilten Heiden und Türken herbei, schwangen sich
auf ihre schnellen Pferde und rannten dem Florens mit ihren Spießen
und krummen Säbeln eilig nach, des Willens, ihm die Jungfrau wiederabzunehmen
. Florens indessen gab die Hoffnung nicht auf, ihnen mit
Hilfe seines schnellen Rosses zu entgehen: er setzte die Jungfrau vor sich
auf den Sattel zur Rechten, und indem er sie vielmal küßte, rief er: "Billig
sollte der fröhlich sein, der einen solchen Schatz erbeutet hat. Aber
bekümmert Euch nicht so schwer, schöne Jungfrau! Seid fröhlich mit mir;
denn Ihr seid der Trost und das Leben meines Lebens! Und in kurzer
Zeit werdet Ihr mein Ehegemahl sein!" Die Jungfrau schwieg stille und
seufzte nur manchmal auf. Jetzt waren ihm die Heiden auf die Fersen
gekommen; er mußte sich zur Wehre setzen; denn die Ungläubigen schrien
ihm überlaut zu: "Ei, du Bösewicht, so halte still und laß des Sultans
Tochter zurück, wenn du nicht von unsern Händen sterben willst!" Florens
merkte wohl, daß er die Jungfrau nicht behalten konnte. Drum
wurde er gar traurig, küßte sie noch zweimal inbrünstig, und da sie sich
sträubte, so blieb ein Armel ihres schönen Gewandes in seinen Händen;
dann ließ er sie vom Sattel mit großem Unmut auf die Erde gleiten.
"Lieber wollte ich", sprach er, "alles andere verlieren, was ich habe, denn
Euch; das aber sei Euch verheißen: in kurzer Zeit will ich wieder bei Euch
sein, und mein ganzes Leben lang sollt Ihr dann meine Herzgeliebte bleiben
. Denn wisset, daß ich Euch ritterlich dem Riesenkönig, Eurem Buhlen,
abgefochten habel Von mir liegt er erlegt, und sein Haupt habe ich
dem Könige Dagobert geschenkt. Vor seiner Werbung dürfet Ihr hinfort
sicher sein!" Die Jungfrau hörte die freundlichen Worte wohl, aber sie
schrie unaufhörlich um Hilfe, und mehr denn hundert Heiden hielten den
tapfern Florens umringt und schlugen alle mit großem Geschrei grimmig
auf ihn zu. Da feierte er auch nicht und fuhr unter sie mit seinem rostigen
Schwerte, daß mancher zu Boden fiel und viele riefen: "Das ist kein
Mensch, sondern ein lebendiger Teufel aus der Hölle!" Diese Worte
hörten zwei Könige aus der Heidenschaft und fragten: "Wo ist der grausame
Teufel, daß wir ihm seinen Sold bezahlen!" — "Hier bin ich",
sprach Florens, und nun schlug er sich mit ihnen, bis sie beide zu Boden
fielen und ein Jammern unter den Heiden entstand. Der Admiral aus
Persien wollte den Schaden rächen und rannte mit seinem Speer gegen
Florens, ihn zu durchbohren. Aber Florens traf ihn mit seinem rauchichten
Spieße eher, so daß er seine Waffen fallen ließ. Schnell warf Florens
den Spieß von sich, ergriff sein Schwert ohne Scheide und hieb auf
einige Streiche dem Admiral die Hirnschale entzwei, daß er zu Boden fiel
und tot auf der Erde lag. Zwölf Heiden hatte Florens so erschlagen; als
aber ihrer immer mehr und sie immer grimmiger wurden, da mußte er
endlich die Flucht ergreifen. Auf seinem Wege sah er seinen Vater Klemens
mit zweihundert wohlgerüsteten Franzosen, die der König Dagobert
ihm zur Hilfe ausgeschickt hatte, sich entgegenreiten. Und gewiß hätten
die Heiden den Fliehenden erreicht und umgebracht, wenn sein Vater nicht
erschienen wäre. Nun kehrte Florens um, und sie alle miteinander schlugen
die Feinde und jagten sie in die Flucht; die Jungfrau Marcebylla
aber rettete sich nach ihren selten, sonst wäre sie gen Paris geführt worden;
die andern Türken und Heiden mußten ihre Hälse hergeben bis auf
zwei, welche sie übrigließen, um dem Sultan die Niederlage zu verkündigen.
Klemens aber, so alt er war, hatte dennoch das Beste getan, und
wenn man ihm gefolgt wäre, so würden sie bis Montmartre gerückt sein,
wo die Jungfrau Marcebylla ihr Lager hatte. Aber Florens wollte dies
seinem Vater nicht zugeben, weil die Heiden dort ihrer dreitausend wären:
"Und doch", sprach er, "wenn ich meinem Pferde trauen dürfte, so wollten
wir die Sache versuchen!" Denn sie waren alle freudig und beherzt.
Während sie sich so besprachen, kam ihnen Kundschaft, daß die Feinde
durch den unerwarteten Angriff in großer Bestürzung seien und scheil auf
die Flucht dächten. Da berieten sich Florens und sein Vater nicht lange
mehr, sondern rannten auf die Türken los und nötigten sie, Panzer und
Gewehr im Stiche zu lassen und nach Dampmartin in das Hauptlager
des Sultans zu flüchten. Auf dieser Flucht erschlugen die Franzosen an
zweitausend Mann, plünderten das Vorlager der Heiden und führten bei
sechstausend Mark Goldes als Beute nach Paris. Das reisige Volk wußte
nicht, wie es dem Florens genug Ehre erweisen sollte; die Ungläubigen
aber sprachen: "Jetzt hat uns der Gott Mahomets ganz und gar verlassen;
wenn er uns nicht besseres Glück gibt, so müssen wir mitten im Christenlande
sterben!" In diesem Schrecken kamen sie nach Dampmartin vor
den Sultan und klagten ihm ihre Not. Der Sultan sprach: "Seid unerschrocken:
ich habe in meinem Lager noch fünfundzwanzig Könige und
Geld und Mundvorrat auf volle vier Jahre." Als sie ihm aber von dem
Tode des Riesenkönigs und von seiner Tochter Marcebylla erzählten, wie
sie von dem rostigen Ritter Florens, der den Riesen umgebracht, beinahe
geraubt worden wäre: da fiel der Sultan von Babylon vor Zorn und
Kummer auf den Boden. Und als er wieder zu sich selbst kam, schwur er
bei seiner königlichen Krone, er wolle das ganze Land Frankreich verwüsten
, alle Franzosen niedermachen und den König Dagobert elendiglich
umbringen.
Noch sprach er, als seine Tochter Marcebylla mit allen ihren Jungfrauen
auf der Flucht dahergeritten kam. Sie ward vom Pferde gehoben,
kniete mit weinenden Augen vor ihrem Vater nieder und grüßte ihn mit
klagenden Worten. Der Sultan hob sie empor und fing an, sie zu trösten:
"Liebe Tochter", sagte er, "laß ab von deiner Bekümmernis; es soll gewiß
nach deinem Willen geschehen: der Ritter, der deinen Liebhaber getötet
hat, soll eines bösen Todes sterben; ich will ihn zu Asche verbrennen
lassen! Jetzt aber gehe mit deinen Jungfrauen in dein Zelt, erhole dich
und pflege des Schlafest" — "Euer Wille geschehe, mein Vater!"sprach
die Jungfrau, "aber mein Verlangen steht nach den Christen; ohne Mache
darf ihr Mutwill nicht bleiben, und wäre es nur, weil der rostige Ritter
unter ihnen ist, der mich fast eine Meile Weges entführt hat und mich
ohne Erbarmen nach Paris gebracht hätte, wenn nicht große Macht unterwegs
gewesen wäre." So nahm sie Urlaub von ihrem Vater und ging mit
ihren Gespielen in ihr Zelt. Hier war der Jungfrau sanft gebettet, doch
lag sie hart und übel auf ihren weichen Kissen und hatte die gange Nacht
keine Ruhe. Den lieblichen Kuß, den ihr Florens gegeben hatte, den konnte
sie nicht vergessen. Ihr ganzes Herz war von Liebe gegen ihn entzündet.
Und wenn sie vor Einschlafen mit ihren Jungfrauen von einer andern
Sache reden wollte, so nannte sie unversehens den rostigen Ritter. "O
Gott Mahomets", sprach sie zu sich selbst, "wie ist mir zu helfen, ich bin
krank, und Leid habe ich in Fülle. Unglückhaft war die Stunde, wo ich
den rostigen Ritter das erstemal angesehen habe, noch viel unglücklicher
der Augenblick, wo er mir den ersten Kuß gab! Es war ein Kuß, der
brannte, als wollte er mich töten. Seine Gebärde, als er mich zu Rosse
hub, war fürstlich, männlich und mächtig. Gott Mahomets, warum hast
du ihn nicht in deinem Glauben geboren werden lassen! Und ach, wenn
er zugegen wäre, meine Liebe könnte ich ihm nicht versagen. Kein anderer
Christenmann soll je in meine Nähe kommen; aber dieser Ritter, wenn
er dich anbeten lernt, Gott Mahomets, muß mir zuteil werden!"
Am andern Morgen, als sie vom Lager erstanden war, fühlte sie sich
so schwach, daß sie die Dienerin rief und sich das Bett noch einmal bereiten
ließ; dann legte sie sich wieder nieder, wandte sich von einer Seite
auf die andere und gebärdete sich, daß es zum Erbarmen war. Sie konnte
es auch nicht lang im Bette aushalten, erhub sich wieder und hatte keine
Ruhe. Die Jungfrauen, die dies mit ansahen, konnten nicht mehr dazu
schweigen. "Herrin, was liegt Euch so schwer auf der Seele", sprachen
sie, "mit welcher Krankheit seid Ihr beladene" —"Ach, ich weiß es selbst
nicht", erwiderte Marcebylla, "und wenn ich es wüßte, so darf ich es
euch doch nicht eröffnen." Da drangen die Gespielinnen nur um so mehr
in sie, und endlich, nach langem Bitten, erzählte sie ihnen die Ursachen
ihrer Krankheit.
"Liebe Freundinnen", sagte sie, "wisset, der rostige Ritter, der so häßlich
gewaffnet nach Montmartre kam, der hat mich in solche Pein gebracht
, die mich Tag und Nacht betrübt; denn er hat den Pfeil der Liebe
mir mitten durchs Herz geschossen, so daß ich sein nicht mehr vergessen
kann: auch werde ich nimmermehr erfreut, bis ich ihn mit meinen Armen
umfangen habe. Wenn dies geschehen ist, so darf er nicht von mir weichen
, bis er meinen Willen vollbracht und den Gott Mahomets angebetet
hat. Tut er dieses nicht, so mag man ihn verbrennen oder schimpflich an
den Galgen hängen!"
Auf diese Rede antwortete ihr eine von den Jungfrauen, Atymedes ',
des Königes aus Asia, Tochter: "Edle Jungfrau, was bekümmert sich
Euer Herz um eines solchen armen, vielleicht unedeln Ritters; könnt Ihr
doch an seiner rostigen Rüstung abnehmen, wes Adels und Standes er
sein mag! Überdies ist er ein Christ und unserm Glauben aussätzig. Darum
ist mein Rat: schlaget es Euch aus dem Sinn; Euer Vater hat noch
manchen Königssohn am Hofe, so daß er Euch wohl Eurer Würde gemäß
vermählen kann. Wollet deswegen des Ritters vergessen!" — "Ach", erwiderte
Marcebylla, "wie kann man das sich aus dem Sinn schlagen,
was das Herz am liebsten hat! Auch kann er nicht von niedriger Geburt
sein; seine adelige Gebärde, sein freundliches Gespräch zeigen an, daß er
von hohem Stamm entsprossen ist, so rostig er einhergeritten kam. Und
wisset nur, wenn er mir nicht zuteil wird, so steht mein Leben in Gefahr!"
So führte sie seufzend ihre Klagen fort, und ihre Jungfrauen
vermochten nicht, sie zu trösten.
Nach dem Siege über die Heiden zog nun Klemens mit den Franzosen
freudig und reich an Beute in der Stadt Paris ein. Dem Florens ward
sein rostiges Schwert vorangetragen. Die Fürsten und Herren ritten ihm
mit großen Ehren entgegen, alle Welt begehrte, ihn zu sehen, und gab
ihm das Geleite bis in König Dagoberts Palast. Und als Florens und
die Ritter von ihren Pferden abzusitzen begonnen, eilte ihnen Kaiser Oktavianus
entgegen und half dem Helden Florens aus den Steigbügeln. Und
er wußte nicht, daß es sein leiblicher Sohn war, dem er dieses tat. Als
Florens abgestiegen war, nahm er sein rostiges Schwert und wurde von
sämtlichen Fürsten in den Palast des Königs geleitet. Hier trat er vor den

König Dagobert, kniete nieder und sprach: "Allergnädigster Herr, mein
Vater Klemens hat Euch des Riesen Haupt überreicht; hier bringe ich das
rostige Schwert, womit ich die Gabe erobert habe. Es gehört Euch, wie
Euch des Gefallenen Haupt gehört! Wenn Ihr möget, so sei es mir vergolten!"
Der König Dagobert sah dem Florens mit Ernst ins Angesicht,
dankte ihm mit lauter Stimme und hieß ihn aufstehen und an seine Seite
sitzen. Dies schlug Florens dem König in aller Ehrerbietung ab und
sprach: "Nein, das ziemt mir nicht, neben einem Könige zu sitzen!" Aber
Dagobert nötigte ihn dazu. "Du hast es verdient", sprach er, "und morgen
zur rechten Zeit will ich dich zum Ritter schlagen. Dann sollst du bei
mir wohnen und großes Gut von mir bekommen; wenn ich in der Schlacht
bin, mußt du bei mir stehen und meinen Königsstab vor mir hertragen!"
Als Klemens den König so reden hörte, tat er Einsprache und rief dazwischen:
"Oh, Herr König, laßt meinen Sohn Florens zufrieden, es ist
nicht mein Wille, daß er zum Ritter geschlagen werde; denn alsdann
bleibt er nicht mehr bei mir daheim: er wird in alle Scharmützel reiten,
vielleicht wird er auch erschlagen werden; dann kümmert sich mein Herz
um ihn. Mein Wunsch und Wohlgefallen ist, daß er ein Wechsler werde,
das ist eine Hantierung, die auch Nutzen und Gewinn bringt!" Darauf
sprach Florens: "Lieber Vater, wenn es des Königes Wille ist, daß ich ein
Ritter werden soll, so sperrt Euch nicht dagegen, lasset es Euch gefallen,
und saget dem Könige Dank dafür!" Da warf sich Klemens auf die Knie
und sprach: "Herr König, meinem Sohn geschehe nach Eurer Majestät
Gefallen. Doch daß nicht zuviel Unkosten daraufgehen; denn, ach, Ihr
wisset nicht, was dieser Sohn mich bis auf diesen Tag gekostet hat!"
Der König Dagobert mußte lachen und sagte: "Florens, es ist mein königlicher
Wille, daß du morgen zum Ritter geschlagen werdest!"
Hierauf ließ der König das Haupt des Riesen auf eine Stange stecken
mitten in der Stadt auf einen weiten Plan, daß alle Menschen das Wunder
sehen könnten, das geschehen war. Und als es Morgen ward, wurden
die Herren und Fürsten zusammenberufen, um dem Ritterschlage anzuwohnen
. Da kam zuerst Kaiser Oktavianus, den eine besondere Zuneigung
zu Florens trieb. Er wußte nicht, wie ihm war, aber er mußte an
Weib und Kinder denken; er konnte sich nicht enthalten, sondern er gab
Florens einen Kuß. Nächst ihm waren auch der König von Spanien und
der Herzog aus Irland beflissen, dem Florens gar eifrig zu dienen; auch
der Fürst von Östreich und sonst viele Herren erwiesen ihm große Ehre.
Nun wurden ihm Rücken- und Brustharnisch mit goldenen Spangen köstlich
geziert. Der Kaiser Oktavianus legte ihm Armzeug und Beinschienen
an, der Fürst aus Östreich setzte ihm den Helm auf, der mit goldenen
Knöpfen herrlich geschmückt war. Zuletzt steckte ihm der König von Frankreich
einen goldenen Ring an den Finger und sprach: "Der Gott, der alle
Dinge erschaffen hat, der wolle Euch erleuchten und beschirmen, daß Ihr
im ritterlichen Stande mit Ehren und Gesundheit verharren möget!"
Klemens hatte ruhig gewartet; bis diese Dinge zu Ende sein würden;
als er aber sah, daß sein Sohn noch keine Sporen hatte, sagte er in seiner
Einfalt: "Fürwahr, gnädiger Herr Königl Ich will meinem Sohn Florens
die Sporen anlegen!" Der Kaiser sprach mit lachendem Munde:
"Klemens, wenn das Euer natürlicher Wille ist, so muß ich mir es auch
wohl gefallen lassen!" Da kniete Klemens nieder und wollte seinem
Sohne die Sporen, die aus gutem Golde waren, anziehen; aber der gute
Klemens hatte vergessen, wie man sie anlegen müsse, und zog sie ihm verkehrt
an. Und wie es lange nicht gehen wollte, da wurde er zornig und
sprach: "Ich weiß nicht; welcher an den rechten Fuß gehört; denn sie sind
beide auf eine Form gemacht. Auch hab' ich in dreißig Jahren, ja, noch
drüber, keinen Sporn angelegt; und den Heiden gestern bin ich ohne Sporen
entgegengeritten. Der Böse hat es mir eingegeben, was ich jetzt eben
versucht habel" Darüber mußten die Fürsten und Herren, auch der neue
Ritter Florens, herzlich lachen. Klemens bemühte sich so lange, bis es
ihm endlich gelang. Und nun mußte Florens sich erheben und ward von
allen Fürsten und Herren beschauet und gelobt.
Hierauf ließ der König Dagobert in einem schönen Garten einen Pfahl
aufrichten, auf dem zwei starke Panzer und zwei mächtige Schilde angeknüpft
wurden, und dorthin wurde Florens in großem Triumphe geführt.
Mancher Fürst und Herr, Ritter und Knecht ritt ihm nach. Der König
aber sprach zu ihm: "Guter Freund Florens, Ihr sollt den alten Brauch
Frankreichs halten und als ein Ritter mit Eurem Speer wider den Pfahl
rennen!" Aber der alte Klemens, der nahe dabeistand, sprach: "Gnädiger
König, mit Verlaub, das ist ein närrischer Brauch in Frankreich; es
wäre viel nutzer, der Stich wäre auf einen Heiden gerichtet als auf einen
Panzer!" Fürsten und Herren lachten über diese einfältige Rede, und sein
Sohn Florens sprach: "Lieber Vater, seid zufrieden, zu einer andern Zeit
wollen wir auch nach den Heiden stechen; diesmal aber will ich des Königs
Willen vollbringen; denn ich soll sein Ritter sein." — "So gebe dir
Gott Glück und Heil", erwiderte Klemens, "daß du den Panzer erlegest!"
Florens tummelte sein Roß und rannte so ritterlich gegen den Pfahl, daß
er die zwei alten Panzer und die zwei neuen Schilde durchrannte, so daß
Panzer und Schilde zu Boden fielen. "Gott gebe dem Ritter Glück und
Heil!"rief das zuschauende Volk, "gewiß ist er aus königlichem Stamme
geboren! Vor allen auf Erden soll ihn der König Dagobert am Hofe
haben; lebt er nur noch kurze Zeit, so jagt er uns alle Heiden aus dem
Lande!"
Das glückliche Rennen des neuen Ritters machte dem König Dagobert
große Freude. Er ging auf Florens zu und reichte ihm aus herzlicher
Liebe die Hand. Dasselbe tat auch Kaiser Oktavianus; denn dem war niemand
lieber als Florens. Und nun führte ihn der König wieder in seinen
Palast zurück, und Klemens, der sich seines Sohnes überall erfreuen
wollte; folgte nach. Im Schlosse war ein köstliches Mahl bereitet; und
Fürsten und Herren waren zum Schmause gebeten. Saitenspieler, Geiger
und Lautenschläger, Trommler und Trompeter waren aufgestellt und
spielten um einen guten Lohn köstliche Stücke auf. Da ward es dem alten
Klemens bange und zu viel; denn er dachte an die Rinder und an das Roß
und meinte, am Ende für seinen Sohn die Zeche zahlen zu müssen. Und
weil er nicht wußte, wie es am Hofe Brauch war, so holte er sich einen
Stecken und schlug auf die Spielleute zu, indem er rief: "Ihr Lotterbuben,
wollt ihr auch schmarotzen? Sehet ihr nicht, daß mein Sohn ohnedies
genug aufgehen läßt, und daß er mich zum Bettler macht?" Da die
Musikanten sahen, wie ungebärdig sich Klemens stellte, fürchteten sie, es
möchten noch mehrere mit Prügeln nachfolgen. Sie flohen deswegen mit
leerem Magen zum königlichen Schlosse hinaus und waren übel zufrieden.
Als Florens von diesem Handel Kunde erhielt, schämte er sich für seinen

Vater"rief ihn zu sich und sprach: "Vater, was denket Ihr, daß Ihr so
eine grobe Unvernunft begebt; und die Spielleute, die mir zu Ehren erschienen
sind und den Fürsten und Herren und allen Jungfrauen Freude
und Kurzweil bereiten sollten, so schmählich vom Hofe gejagt, und ihnen
ihre Instrumente zerschlagen habt? Wahrhaftig, sie müssen ihnen doppelt
wiederbezahlt werden!" Klemens erschrak und sagte: "Ach, mein lieber
Sohn, ich hab ' es nicht recht verstanden, sondern ich meinte, sie hätten
Euer gespottet. Wenn es aber Euer Wille ist, so werde ich sie eilends
wiederholen." Und so lief der Alte zum Palaste hinaus und den Spielleuten
nach. Doch diese, als sie den alten Klemens mit seinem Stecken
in der Hand daherrennen sahen, liefen noch viel mehr, und je gewaltiger
ihnen Klemens nachschrie, je eifriger flohen sie, so daß er sie nicht mehr
einholen konnte. Im Saale war darüber ein großes Gelächter, und die
schönen Jungfrauen mußten ungetanzt nach Hause kehren.
Jetzt nahm Kaiser Oktavianus des Augenblickes wahr, nahm den Ritter
an der Hand, hieß ihn neben sich sitzen und sprach zu ihm: "Lieber Florens,
saget mir die lautre Wahrheit. Ist der alte Klemens Euer rechter
Vater von Geburt?" — "Erhabener Kaiser", erwiderte Florens, "das
kann ich Euch nicht sagen, sondern nur, daß er mir so lieb ist, als ob er
mein leiblicher Vater wäre. Aber das ist wahr, seine Hausfrau hat andern
Leuten gesagt, er habe mich am Gestade des Meeres gefunden und
einen guten Teil des Weges auf seinem Rücken getragen und dann auf
einem Esel vollends nach Paris gebracht und in St. Germain als sein
Kind auferzogen bis auf diese Stunde. Ob sie recht hat oder mich damit
verleugnen will, das weiß ich nicht. Mir aber wird es bei Euch, Herr
Kaiser, so wohl zumut, als ob Ihr mein rechter Vater wäret; denn ich
weiß keinen Menschen auf Erden, den ich lieber sehe als Eure Kaiserliche
Majestät." "Habt Ihr Eure rechte Mutter gekannt?" sprach der Kaiser.
"Ich habe sie mit Wissen nie gesehen", erwiderte Florens. Da erkannte
der Kaiser Oktavianus, daß Florens sein leiblicher Sohn sei. Das Herz
im Leibe wollte ihm zerspringen, und doch wollte er seine eigene Sünde
nicht offenbaren, aber beinahe wäre ihm das Wort entfahren: " , du
bist mein rechter Sohn, die Natur spricht aus dir!" Aber er schluckte die
Rede wieder hinter sich, und so blieb die Sache stehen. wischen wurde
das Mahl aufgetragen, jedermann setzte sich zu Tische, und der köstlichen
Speisen wollte kein Ende werden.
Der alte Klemens war bestellt; die Pforte zu hüten. Ihm war aber
noch immer bange, daß er für alles die Zeche bezahlen müßte. Er dachte
daher darauf, wie er sich eines Unterpfandes versichern wollte. Und als
das Mahl vorüber war und die Fürsten vom Tische aufstanden und jeder
sein Oberkleid suchte, es anzulegen und Abschied zu nehmen, fand keiner
das seinige. Die Diener wurden darum gefragt, aber keiner konnte Bescheid
geben; denn Klemens hatte die Kleider ohne der Leute Wissen verborgen
. Die Fürsten lachten und sagten: "Merket wohl auf, solches ist
uns noch nie geschehen!" Klemens aber stand nicht ferne und hörte das
Gemurmel. Er lachte in die Faust und dachte bei sich selbst: "So fängt
man die Mäuse; hätte ich die Kleider nicht aufgehoben, sie wären wahrhaftig
unbezahlt weggegangen!" Endlich aber, als die Herren laut zu
klagen anfingen, sprach er mit lauter Stimme: "Liebe Herren, seid unbesorgt,
ich habe die Kleider aufgehoben, sie sind unverloren. Aber das sage
ich euch, ihr werdet sie nimmermehr überkommen, ihr habet denn die
Zeche bezahlt! Meinet ihr, ich werde euch so heimschleichen lassen?" Als
Florens dieses hörte, wurde er zornig und wußte doch nicht, wie er die
Sache zurechtsetzen sollte; er schämte sich vor den Fürsten und wollte doch
seinen Pflegvater nicht beleidigen; denn er hatte ihn sehr lieb. So zornig
er war, so sprach er darum doch mit lachendem Munde: "Lieber Vater,
gebt uns die Kleider wieder!" —"Nein, fürwahr", sprach Klemens, "sie
haben denn zuvor alles bezahlt, was an Unkosten aufgegangen ist!" —
Da mußten alle Umstehenden lachen, und Florens stellte den Alten zufrieden
; denn er verbürgte sich bei ihm mit seinem Pferde. Nun erhielten
die Herren jeder das Seinige und schieden unter fröhlichem Gelächter.
***Der Tag war verflossen und die Nacht herbeigekommen. Aber Florens
konnte nicht schlafen; er dachte nur stets daran, wie er den Sultan in seinem
Feldlager sehen könnte, und nicht den Sultan allein, sondern auch
sein schönes Töchterlein Marcebylla; denn das brennende Feuer der Liebe
flammte in seinem Herzen. Nach langem ,Hin- und Herdenken konnte er
nicht länger im Bette bleiben. Er stand mitten in der Nacht auf, rief
seinem Kämmerling und hieß ihn Harnisch, Armzeug, Kragen, Helm und
Schwert; und was zur Rüstung sonst gehört, bringen, wappnete sich und
befahl dem Diener, ihm sein Roß zu satteln. Während Florens sich wappnete,
fragte der Kämmerling, wohin er denn zu reiten willens sei. Aber
Florens gab keine andre Antwort; als er sollte sich wegen des Reitens
nicht kümmern; er selbst würde bald wiederkommen. So setzte er sich zu
Pferd und ritt um Mitternacht davon durch die langen Gassen von Paris
bis ans Tor. Als er an die Pforte kam, weckte er den Torhüter und
sprach: "Guter Freund, öffne mir die Pforte; denn ich habe ein Geschäft
zu verrichten, das dir und allen Franzosen zugute kommen soll." Der
Torhüter sprach: "Lieber Junker, es kann nicht sein; es ist mir von unserm
Herrn, dem Könige, bei Verlust meines Lebens verboten!"—"Ach",
sprach Florens, "es soll dir kein Ungemach daraus erwachsen; glaube mir,
es wird dir vom Könige wohlbelohnt werden." Und nun redete er dem
Wächter so freundlich mit Gelde zu, daß dieser ihm endlich heimlich das
Tor aufschloß und ihn hinausließ.
Also ritt Florens fröhlich fort und machte noch vor Tage die fünf Meilen
bis in das Feldlager des Sultans. Und als der helle Tag anbrach,
war er nicht mehr weit von den heidnischen selten. Diese waren alle köstlich
zubereitet, und das Zelt des Sultans übertraf alle andern; denn es
war mit Gold und Edelsteinen bedeckt und gab einen hellen Schein von
sich. Aus den Heidenzelten ertönten Pfeifen, Trompeten und Posaunen
und ein greuliches Geschrei, so daß sich Florens einen Augenblick entsetzte.
Doch bald wieder seiner vorigen Taten und des Kampfes mit dem Riesenkönige
eingedenk, ermannte sich der Held und sprach zu sich selbst: "Es
gehe, wie es will, noch heute muß ich den Sultan in seinem Lager sehen
und mit ihm reden und ihm sagen, was mein Vorhaben gegen ihn ist."
Als er jedoch die große Menge der Heiden sah, wurde er wieder unschlüssig
. "Soll ich mit ihnen streiten", dachte er, "so sind ihrer so viel, daß ich
nicht davonkommen kann; soll ich meinem Roß die Sporen geben, so haben
sie so rasche Pferde, daß ich nicht entrinne." Inzwischen stieg er von
dem Pferde, hieb einen Zweig von einem Ölbaum und hing sich den vor
seine Brust. Dann bestieg er das Roß wieder und dachte, sich für einen
Boten auszugeben, der mit dem Sultan zu verhandeln hätte. So befahl
er sich dem Allmächtigen und ritt auf das feindliche Lager zu. Dies hatten
einige gewaffnete Heiden gesehen, und da sie in ihm einen Christen
erkannten, so rannten sie auf ihn zu in der Absicht, ihn niederzuhauen.
Als sie jedoch den Ölzweig an seiner Brust gewahr wurden, der auch bei
den Heiden ein Zeichen des Friedens ist, wagten sie nicht, ihm ein Leid
zuzufügen; denn sie hielten ihn für einen Abgesandten und dachten, er
habe vielleicht dem Sultan Gutes vom Könige von Frankreich zu überbringen
. Also ritt Florens ungekränkt fort bis an das Zelt des Sultans;
da stieg er ab, band sein Pferd an einen Baum und trat ritterlich hinein.
Er fand den Sultan in großer Majestät auf dem Stuhle sitzen, der köstlich
und mit golddurchwirkten Tüchern umhängt und geziert war, so daß
man mit dem Zeltschmucke ein ganzes Fürstentum hätte bezahlen können.
Um ihn saßen im Kreise sechzehn Könige gelagert. Florens staunte über
all der Macht; doch faßte er sich bald, zog den Helm ab, um verständlicher
reden zu können, und sprach mit männlichem Stolze zu dem Sultan:
"Der Gott, der von dem Himmel herabgekommen ist und an dem
Kreuz den Tod für die Menschen gelitten hat, der ist's, der dem frommen
König Dagobert täglich mehr Stärke gibt und alle seine Feinde zerstören
will, zuvörderst dich, Sultan und König von Babylon; es sei denn, daß
du den Befehl des Königes von Frankreich hören wollest, welcher also
lautet: du sollst vor allen Dingen vor seiner königlichen Krone erscheinen
und von ihr Gnade begehren, weil du den Frevel gewagt hast, übers
in unser Land zu kommen. Tust du dieses nicht, so kommst du mit deinem
Volke nimmermehr in die Heimat; dein Haupt muß dir von den Achseln
gehauen werden, danach kannst du dich richten; und was du für eine Antwort
zu geben hast, das weißt du jetzt!" Der Sultan war über dieser
trotzigen Rede fast von Sinnen gekommen. Er ergriff ein scharfes Messer
und warf es nach Florens; dieser aber wich behende dem Wurf aus,
und das Messer fuhr drei Finger tief in einen Pfosten, daran das Zelt
gespannt war. Florens war über diesen Wurf nicht wenig verdrossen;
aber auch den Sultan reute, was er getan hatte, weil Florens ein Bote
vor seinen Augen war. Daher sagte er: "Bei dem Gotte Mahomets, der
die Welt geschaffen hat, wenn du kein Bote wärest, so müßte dein Leib in
Stücke gehauen werden. So aber soll dir nichts geschehen, und mit dem
Wurf habe ich mich übereilt: es soll auch dein Schaden nicht sein; nimm
diesen Beutel mit vierhundert Dukaten, kehre zurück zu deinem Könige
Dagobert und sag ihm meine Antwort: Wenn er unsern Gott Mahomets
nicht anbeten und ihm dienen will, so werde ich nimmermehr übers Meer
zurückkehren, und mein Herz wird keine Ruhe haben, ehe denn ich ihn
getötet und mir das Land unterwürfig gemacht habe."
Der Sultan hatte eben diese Rede vollendet, als seine Tochter Marcebylla
, von schmucken Jungfrauen begleitet, eintrat und ihren Vater mit
tiefer Beugung freundlich grüßte. Der Sultan, samt den Königen, die
bei ihm saßen, stand auf und empfing seine Tochter mit ihrer Begleitung
gar gnädig. Dann mußte sie zu ihrem Vater auf das Polster sitzen, und
er mit allen Fürsten erfreute sich ihres holden Gespräches und ihrer um
aussprechlichen Schönheit. Sie war in roten Karmoisin gekleidet, der von
goldenen Blumen durchsäet und mit Perlen und Edelsteinen herrlich gestickt
war, so daß ihre Gestalt durch das ganze Gezelt einen klaren Schein
gab. Als Florens sie sah, verlor er Kraft und Besinnung; und als Marceabyllas
Blick auf ihn fiel, da wich alle Farbe von ihr; denn sie hatte ihn
auf der Stelle wiedererkannt. Doch blickte sie den Florens mit lieblichen
Augen an und fing an, mit verstellten Worten zu ihm zu sprechen: "Sag
an, du Christenmann, kennest du nicht einen Ritter am Hofe des Königs
von Frankreich, der in einem rostigen Hamisch den Riesenkönig vor den
Mauern von Paris zu Tode geschlagen hat? Mein Verlangen, ihn zu
sehen, ist groß; nicht aus Liebe, die ich zu ihm trage; sondern wenn ich ihn
in meiner Gewalt hätte, von Stund an müßt' er verbrannt werden, weil
er mir meinen Buhlen, den Riesenkönig, erschlagen hat." Unter diesen
Reden warf sie dem Ritter Florens heimlich manchen zärtlichen Blick zu
und fuhr unter großem Seufzen fort: "Oh, daß ich jenen Ritter, der mein
Räuber ist, hier hätte; er müßte mein tägliches Seufzen zufriedenstellen.
Ich leide große Qual von dem Kuß, den er mir gegeben hat. Daß ich
mich nicht an ihm rächen kann, das bringt mir schwere Peinl" Der Sultan
und die Könige bei ihm verstanden diese Rede nicht recht, aber Florens
ward ihre Bedeutung bald inne. Daher erwiderte er mit Ehrerbietung
und sprach: "Ja, gnädigste Fürstin, ich kenne jenen Ritter sehr gut; er ist
meiner Länge und hat meinen Gang; im Rennen und Stechen kann man
uns nicht unterscheiden, so gleich sind unsere Gebärden. Auch ist er ein
getreuer Mehrer der Christenheit und Zerstörer der Abgötterei. Und wenn
ihm Leids von Euch geschähe, so tatet Ihr großes Unrecht; denn ich weiß,
daß er Euch von Herzen hold ist. Zum Zeichen führt er auf seinem Helm
den rechten Armel, den er Euch entrissen hat, als Ihr mit ihm zu Pferde
saßet, damit Ihr stets an ihn gedenket, wo Ihr ihn in der Schlachtordnung
erblicken werdet!"
Jetzt erkannte die Jungfrau Marcebylla erst recht gewiß, daß es der
Ritter Florens sei, der mit ihr sprach, und gern hätte sie noch lange mit
ihm geredet, wenn sie sich nicht vor ihrem Vater gefürchtet hätte.
***Florens aber setzte sich wieder auf sein Roß und rief ins Zelt hinein
dem Sultan zu: fahre diesmal wieder davon; aber du hast unredlich
nach mir mit dem Messer geworfen; darum sei dir gesagt, in kurzer Zeit
soll es dich reuen; dein Leben steht auf der Spitze meines Speeres!" —
"Was sagst du, schändlicher Bube", rief der Sultan, "du gibst dich für
einen Boten aus und verrätst dich doch durch schnöde Drohworte?" Und
mit lauterer Stimme schrie er: "Lieben Könige und Herren, schlagt mir
den Schelmen tot!" Als das die Türken und Heiden hörten, rannten sie
dem Florens mit Bogen und Pfeilen nach, schossen nach ihm und wollten
ihn umbringen. Doch Florens wendete sein Pferd, zog sein Schwert und
schlug unter sie, daß bald zwei Könige tot auf dem Boden lagen und drei
andere Heiden lahmgehauen waren. Aber sein Roß wurde ihm hart verwundet
, und nur mit Mühe erwehrte er sich ihrer. Dreihundert waren
auf ihm; der Vorderste war der König von Alamphatin, der hoffte, den
Ritter gewiß zu treffen, und rief: "Halt stille, du Bastard; denn von meiner
Hand mußt du sterben !" Als Florens dies hörte, kehrte er sich auf
seinem Heimritt um und sah, daß dieser König ihm allein nachgefolgt
war. Da säumte er nicht, sondern legte seinen Speer ein; sein Gegner
war auch gerüstet, so machten sie nicht viel Worte, sondern rannten ritterlich
aufeinander und trafen alle beide so gut, daß beider Speere in Stücke
und himmelauf sprangen. Florens war betrübt, daß er keinen Speer mehr
hatte. Doch zückten jetzt beide ihre Schwerter und fochten ritterlich. Und
endlich geriet dem Florens ein Streich, daß er dem König durch den Helm
in die Hirnschale hieb und ihm sein Haupt zerspaltete, so daß er vor Ohnmacht
vom Rosse fiel. Florens hielt sich nicht lange mit ihm auf, er war
zufrieden, seiner los zu sein, und tauschte nur des Königs gesundes Pferd
gegen sein verwundetes ein; auf jenem rannte er, so schnell er konnte, der
Stadt Paris zu. Aber sein verwundetes Roß wollte ihn dennoch nicht verlassen
und lief ihm unausgesetzt nach bis an die Tore.
***Als die Heiden auf den Platz kamen, wo der König Alamphatin tot in
seinem Blute lag, mochte vor dem großen Leide, das sie um ihn trugen,
keiner mehr dem Florens nachrennen; denn er hatte ihnen einen großen
Vorsprung abgewonnen. Sie nahmen den toten König und trugen ihn
nach heidnischer Sitte unter lautem Wehklagen in das Lager. Dann meldeten
sie dem Sultan alles, was mit dem Boten geschehen war, auch daß
er auf des erschlagenen Königs Pferd davongeritten, das mehr Pfund Silbers
wert sei, als es wäge. Der Sultan, wie er dies hörte, wurde ganz
rasend, lief mit einem Prügel nach seinem Götzen, schlug ihm auf den
Kopf vier harte Streiche und schrie: "Oh, du böser Gott Mahomets, du
bist keines toten Hundes wert, daß du den Bastard entrinnen und den
König, meinen Freund und Bruder, hast erschlagen lassen!" Und nun versammelte
er alles Volk, tat kund, wieviel Schaden Florens angerichtet,
und sprach: "Liebe Herren und gute Freunde, rüstet euch alle zur Wehr;
denn die Stadt Paris muß zerstört werden. Achtzigtausend Mann will ich
davorschicken, und kommt der König Dagobert und sein Bote in meine
Gewalt, so müssen sie eines grausamen Todes sterben."
Die Jungfrau Marcebylla vernahm aus den Reden ihres Vaters, daß
der König Alamphatin umgekommen und Florens kein Leid widerfahren
sei; darüber freute sie sich und bat den Gott Mahomets, daß er ihn schirmen
möge.

Während nun die Heiden sich rüsteten, war Florens glücklich an das
Stadttor von Paris gelangt, und als er hineinritt, grüßte er den Torwärter
freundlich, schenkte ihm das verwundete Roß und sprach: "ES schadet
nicht, daß es wund ist; es wird bald wieder heilen; dann ist es immer
noch fünfzig Kronen wert." Der Torwärter bog seine Knie und dankte
ihm mit demütigen Worten. "Sooft Ihr kommt, lieber Herr", sagte er,
"soll Euch das Tor von mir willig aufgeschlossen werden!" Und von
Stund an verbreitete sich die Kunde in der Stadt, daß Florens wiedergekommen
sei, darüber jung und alt höchlich erfreut waren. Florens aber
ritt wieder durch die langen Gassen zurück bis an Dagoberts Palast und
wurde von dem König so freundlich empfangen, wie er es verdiente.
***Der Sultan tat, wie er geschworen hatte. Er schickte all sein Kriegsvolk
vor Paris, es aufs härteste zu belagern. Die Heiden lagen auf drei Seiten
vor der Stadt, sie hatten den Bauern alles Vieh weggenommen, die
Dörfer verbrannt; die armen Leute totgeschlagen. Aber auch König Dagobert
hatte alle seine Leute zur Schlachtordnung aufgeboten, und Florens
war der erste, der, trefflich bewaffnet, auf des Königs Alamphatin
Rosse sitzend, sich einstellte. So zogen die Franzosen mutig aus der Stadt
und hatten zusammen einen Eid geschworen, daß keiner von des andern
Seite weichen wolle. Und nun griffen sie die Heiden im Sturme an, und
kein Christenfürst war, der nicht ritterlich in den Kampf gegangen wäre.
Der mutigste Kämpfer war der König von Frankreich; alle Streiche, die
er schlug, saßen fest, sei es auf Roß oder Mann. Auch Kaiser Oktavianus
wollte nicht säumen, er rannte mit seinem Speer durch die Heiden hin
und her, machte großen Raum und leerte manchen Sattel. Der Herzog
von Östreich, der König von Spanien und andere Fürsten brachten unzählige
Feinde ums Leben. Aber keiner war über Florens; vor dem konnte
kein feindlicher Held standhalten; sie flohen, sowie er nur gegen sie rannte.
Dennoch wollten die Heiden nicht abziehen, sie schlugen sich noch so männlich
um den Sieg, daß zuletzt der König Dagobert von ihnen umringt
wurde. Manch harter Streich traf ihn; doch war sein Harnisch gut, und
er selbst fehlte ihrer auch nicht. Zuletzt wurde sein Roß unter ihm erstochen
, und wie er auf der Erde war, schlug er noch wie ein Löwe um sich.
wurde er müde und rief zuletzt in der Not: "Ach, Gott, und du, heiliger
Dionysius!" Diesen Ruf hörte Florens, der nicht weit von dem Könige
war. Er kannte des Königs Stimme und drang, so gut er vermochte,
zu ihm, indem er eine lange Gasse vor sich her machte. Der erste, den er
zugrunde stach, war der König von Persien. Dessen Roß nahm er, setzte
den König von Frankreich darauf und sprach zu ihm: "Seid unerschrocken,
Herr, wir wollen unsere Feinde bald dämpfen t" Jetzt aber fing die
Schlacht erst recht von neuem an, und auf beiden Seiten wurde viel Blut
vergossen. Endlich aber hielten die Heiden den Anlauf nicht länger aus,
sondern fingen an zu fliehen, und Florens samt dem Kaiser Oktavianus
und dem König von Spanien setzte ihnen nach auf zwei Meilen Weges,
und auf der Flucht erstachen sie über fünftausend Heiden. Mancher lag
lahm gehauen, mancher halbtot vor der Stadt Paris; Acker und Wiesen
waren von Toten bedeckt, das Blut floß wie ein Bach. Am Ende waren
der Heiden auf dreißigtausend erschlagen. Der König mit seinem Volke
zog wieder ein in Paris und lobte Gott. Die Heiden aber flohen in das
Lager von Dampmartin zu ihrem Sultan und klagten ihm, was geschehen
. Da sprach der Sultan: "Bei unserm Gott, der Tod unsers Volkes
darf nicht ohne Rache bleiben; seid zum Streite gerüstet; vierzigtausend
tapfere Streiter vermag ich noch; die müssen zum zweitenmal die
Stadt belagern!" Dann rief er sieben Könige, die ihm übrig waren, und
übergab ihnen dieses Heer. Auch schwur er, wenn er den Boten bekäme,
so wolle er ihn durch vier starke Pferde in Stücke zerreißen lassen. Diese
Drohungen hörte die Jungfrau Marcebylla wohl und betete heimlich zu
ihrem Gotte, daß er den Ritter aus den Händen ihres Vaters reißen
wolle. Aber zum Sultan sprach sie: "Möchte uns doch der Lotterbube
zur Beute werden; denn er hat mir den Riesenkönig umgebracht! Darum,
Vater; wenn Ihr meinem Rate folgen wollet, ich glaube, ich wollte das
Wagnis unternehmen und ihn in Eure Gewalt bringen." — "Wie sollte
das möglich sein, liebe Tochter?" fragte der Sultan. — "Ich will es
Euch sagen", erwiderte die Jungfrau. "Mit meinen Gespielinnen samt
Zelten und Rüstung will ich mit den sieben Königen zu Felde ziehen; auf
der grünen Matte vor der Stadt Paris am Gestade des Seineflusses will
ich mein Lager ausschlagen. Sobald der Schändliche meine Ankunft erfahren
hat; wird er zu mir kommen, das weiß ich gewiß. Dann sollen
ihn meine Ritter in Stücke reißen und sein Haupt Euch zum Geschenke
bringen." —"Wohlgeredet; schöne Tochter", sprach der Sultan, "Eurem
Rate soll in allen Stücken gefolgt werden!"
***So zogen die Heiden noch einmal mit vierzigtausend Mann vor die
Stadt Paris. Sie schrien und heulten, daß die ganze Gegend zitterte.
Aber in der Stadt war man auch gefaßt, alles lief auf die Mauern, schoß
Pfeile und warf Steine auf die heranstürmenden Heiden. Am Gestade des
Seinewassers war Marcebylla gelagert und schärfte ihren Blick auf Florens.
Dieser wußte gar nichts von ihr; er war zu Hause, rüstete sich
eilends und wollte aus der Stadt unter die Heiden fahren. Da kam ein
edler ihm vertrauter Ritter zu ihm und sprach: "Wisset, edler Ritter Florens,
die Jungfrau, die Euch so wohlgefällt und Euch so hold ist, hat ihr
Lager samt ihren Jungfrauen am Gestade des Stromes errichtet." Florens
wurde von Liebe entzündet; als er dieses hörte und sprach: "Morgen
erhaltet Ihr eine Rüstung für diese Nachricht zum Lohn, lieber Ritter!"
und so entließ er ihn. Am andern Tage ließ Florens den Ritter
waffnen und rüstete sich selbst. Unverweilt machten sie, sich auf den Weg
nach der Seine. Da sah Florens von weitem seine geliebte Marcebylla,
und auch sie erkannte ihren Ritter von ferne; denn um den Helm trug er
den Armel geknüpft, den er ihr einst abgenommen hatte. Blut und Farbe
verließ sie bei diesem Anblick, und ihre Jungfrauen fragten sie ängstlich,
was ihr wäre. Da gestand sie ihnen die Ursache abermals. Ihre Gespielinnen
riefen einstimmig: "Wir wollen Euch nicht verraten; rufet ihn nur
getrost herbei; wir alle sind so gesinnt, daß wir Leib und Leben für Euch
lassen wollen! Darum seid guter Dinge: seid Ihr noch in des Ritters
Huld, so wird er von selbst herankommen; ist aber Eure Liebe in ihm verblichen,
so hilft all Euer Trauren nicht dazu."
Lange bedachte sich die Jungfrau Marcebylla, endlich aber sandte sie
dem edeln Florens eine Freundin entgegen, die ihn von ihrer Nähe benachrichtigen
sollte. Als Florens die Botin nur von weitem erblickte, da
hatte er keine Ruhe mehr. Mit Helm und Harnisch angetan, sprang er zu
Roß in den Seinefluß, durchschwamm ihn und war bald auf der andern
Seite des Wassers, wo der Jungfrauen Zelte standen. Hier ging Marcebylla
am Gestade auf und ab wandeln; sobald sie ihren Geliebten sah,
begrüßte sie ihn mit holdseliger Gebärde und sprach: "Gelobt sei mein
Gott, daß er Euch zu mir hieher geführt hat! Welche Gefahr habt Ihr
ausgestanden! Den Wellen habt Ihr mir zuliebe getrotzt!" —"Schöne
Jungfrau", erwiderte Florens, "die Liebe zu Euch hat mich über das Wasser
getragen; wenn Euer Angesicht mich bescheint, kann mir nichts mißlingen"
— "Lieber Ritter", sprach Marcebylla, "wie große Schmerzen
habe ich um unserer Liebe willen erduldet; jetzt aber, wo Euer Licht mir
leuchtet, bin ich gesund geworden." Darauf nahm die Jungfrau den Ritter
an der Hand und führte ihn in ihr eigenes Zelt; hier löste er Helm
und Harnisch, umfing die Jungfrau und gab ihr einen Kuß um den andern
. Da schwur sie dem Gott Mahomets ab, und der Ritter bekehrte sie
zum wahren Glauben; auch mußte er ihr versprechen, sie von hinnen zu
bringen. Darauf sagte Florens: "Hierzu weiß ich keinen andern Weg, geliebte
Jungfrau, als daß ich Euren Vater, den König von Babylon, zum
Gefangenen mache. Alsdann könnt Ihr selbst mir auch nicht entgehen."
— "Geliebter Ritter Florens", sprach Marcebylla, "kein Mensch auf Erden
vermag meinen Vater zu fangen; er müßte denn von seinem guten
Rosse Pontifex verlassen werden, das er nicht um die halbe Welt gäbe;
dieses ist schnell wie der Wind und so stark, daß darauf zwei Reiter im
vollen Harnische auf einmal in den Streit reiten und sich wehren können.
Es läuft so geschwind mit ihnen, als ob es nichts auf sich trüge. Durch
das Wasser schwimmt es wie ein Fisch durchs Meer: seinesgleichen ist nie
gesehen worden." Florens ward von Verlangen nach dem Roß entzündet
und fragte eilig: "Was für eine Farbe hat das Roß Pontifex? Es
ist ganz weiß", erwiderte die Jungfrau, "den Kopf trägt es allezeit auf

recht wie ein Löwe, mitten auf seiner Stirne aber hat es ein scharfes,
spitzes Horn, wie ein Schermesser so scharf: was es damit trifft, das muß
alles zugrunde gehen."
Nun war fast eine Stunde vergangen mit beider Gespräch, und Florens
sagte: "Die Zeit ist hie, Geliebte, daß ich von Euch scheiden muß. Aber
mich verlangt zu wissen, wann ich Euch nach Paris bringen darf." —
"Ich will Euch eine List angeben", sprach Marcebylla, "vielleicht dient sie,
mich fortzuschaffen. Wenn es dazu kommt, daß mein Vater dem Könige
von Frankreich eine Schlacht liefert, was nicht mehr lange anstehen kann,
und wenn sich nun alles Volk im Kampfe vermischt, dann verlieret Euch,
wenn Ihr meinen Vater am ernstlichsten kämpfen sehet, aus dem Streite
und begebet Euch so, daß ja niemand es merke, zu mir. Mein Vater
ahnet wohl unsere Liebe, aber er glaubt nicht daran, weil wir zweierlei
Götter haben. Würde er sie gewiß inne: glaubet mir, vierundfünfzigtausend
Mann würden ihm nicht zuviel sein, mich zu hüten. Gebet also wohl
acht; daß Ihr von niemand gesehen werdet. Ehe Ihr aber in die Schlacht
reitet; bestellt ein Schiff, und sobald die Schlacht anfängt, soll der Fährmann
nicht säumen, das Schiff zu mir heraufzuführen; dorthin will ich
meinen Schatz und alle meine Kleinodien tragen lassen, dann will ich mit
meinen Jungfrauen und mit Euch mich auf das Schiff setzen, und so
wollen wir nach Paris fahren. Dies ist das Mittel, wie Ihr mich hinwegbringen
könnet." Florens freute sich über den sinnreichen Einfall seiner
Geliebten. "Ihr habt den rechten Weg gefunden", rief er, "ich will
ihm nachkommen!" Und so drückten sie Lippe an Lippe und Herz an Herz;
dann legte Florens den Panzer wieder an und befahl seine Jungfrau in
den Schutz des allmächtigen Gottes. "Oh, du Leben meines jungen Lebens"
, antwortete ihm Marcebylla, "ich weiß nicht, wann ich dich wiedersehen
werde, aber laß mein Herz in dem deinen beschlossen sein. Keinem
Manne will ich untertänig sein als dir!"
***So schied Florens, schwamm wieder über das Wasser und fand dort den
Ritter, der mit ihm gezogen war und seiner wartete. Kaum waren sie zusammengekommen
, als Florens einen Türken dahertraben sah, der unter
großem Geschrei begehrte, mit ihm zu kämpfen. Florens war nicht säumig;
er legte den Speer ein und rannte auf den Türken, daß er zu Boden
fiel und ein Bein entzweibrach. "Geschwind", sprach Florens zu seinem
Begleiter, "setzet Euch auf des Heiden Pferd; es ist viel stärker als das
Eure; so kommen wir schneller davon." Aber kaum war dies geschehen,
so sahen sich die .beiden von einer wilden Heidenschar umgeben. Doch
schlugen sie sich ritterlich mit ihren scharfen Schwertern, daß die Heiden
wie der Schnee niederfallen mußten. Da erstach auch der andre Ritter
den Admiral von Persien, daß ihm das Eingeweide, als er vom Pferde
sank, auf die Erde fiel. Und so schlugen sie sich endlich durch und gelangten
fröhlich nach Paris. Dem König Dagobert aber war bald hinterbracht
worden, was der Ritter Florens unternommen hatte. Da beschickte
er ihn und fragte ihn: "Nun, Florens, saget an, was macht die Jungfrau
Marcebylla? Wahrlich, Ihr traget eine große Gunst zu ihr, daß Euch
das Seinewasser nicht zu kalt zum Bade war. Um ihretwillen werdet Ihr;
deucht mir, noch manchen Heiden darniederstrecken!" Da sprach Florens
mit lachendem Munde: "Ja, es möchte so geschehen, mein Herr und König;
denn meine Hoffnung auf Erden stehet allein zu ihr!" Und nun beurlaubte
sich Florens mit gebogenen Knien von dem König Dagobert und
ritt zu seinem Pflegevater Klemens. Diesem erzählte er als ein gutes
Kind alles, was sich begeben hatte, und verschwieg ihm seine Liebe zu
Marcebylla nicht, und wie er sie mit ihrem Willen bald nach Paris bringen
werde. Auch berichtete er ihm von dem köstlichen Pferde, Pontife
genannt. "Was hat das Roß für Farbe?" fragte Klemens. — "ES ist
ganz weiß wie ein Schwan", sagte Florens, "und an der Stirn hat es
ein langes Horn, scharf wie ein Schermesser." — "Um Gott", sprach Klemens
, "da ist es wohl ungezäumt und furchtbar anzufassen? Doch getraue
ich mich, seiner Meister zu werden." Florens mußte lachen und hielt
des alten Mannes Rede für einen Scherz. Aber Klemens ließ sich von
seinem Weibe den Pilgermantel und Hut reichen, womit er am Heiligen
Grabe gewesen. Er warf den Mantel zur Hälfte über sich und machte
sein Angesicht mit einer Salbe schwarz wie eine Kohle; einen kohlschwarzen
langen Bart hatte er schon vorher. So entstellt sah er einem Heiden
nicht unähnlich, und wer es sah, dem kam das Lachen. Darnach nahm
Klemens seinen Pilgerstab in die Hand und sprach zu Florens und zu seiner
Hausfrau: "Nun gehabet Euch wohl miteinander; ich will nicht wiederkehren,
ich habe denn das köstliche Roß Pontifex gewonnen!" Das
ganze Hausgesinde hatte seine Freude darüber, daß der alte Mann noch
so leichtsinnig war. Doch glaubten sie nicht, daß es ihm geraten würde.
Und so hinkte er davon.
Es dauerte nicht lange, so kam der alte Klemens unter die Heiden, und
er grüßte jeden, dem er begegnete, treuherzig bei dem Gotte Mahomets.
Klemens verstand nämlich die heidnische Sprache ganz gut; weil er lang
über Meer gewesen war; und die Heiden dankten ihm wieder bei Mahomets
Gott; denn sie dachten, er sei ein heidnischer Pilgersmann.
So kam er ungefährdet bis Dampmartin, wo der Sultan sein Lager
hatte. Er aber hatte zuvor wohl bedacht, was er mit dem Sultan reden
wollte. Wie er nun in das königliche Zelt trat, zog er seinen Hut demütiglich
ab, grüßte ihn und sprach: "Der Gott Mahomets, welcher Tag und
Nacht geschaffen hat und den Bäumen und allen Kräutern Blüten gibt,
wolle den großmütigen Sultan von Babylonien segnen! Großmütiger König
, um Euer Majestät willen bin ich diesen weiten Weg gereist und mit
großer Mühe in Euer Lager aus der fernen Heimat gekommen, etwas zu
schaffen, das meinem Herrn angenehm wäre." Der Sultan dankte dem
alten Klemens und sprach: "Sag an, mein Pilger, wie lebt man in unserm
Lande? Sagt man davon, welch großen Schaden ich erlitten habe?
Ich habe manchen Heiden verloren, vor allen den Riesenkönig; darüber
werde ich noch zornig! Aber es soll gerächt werden, bei Mahomet! Nun
sprich, Pilger, was bringst du Neues?" —"Allergnädigster Herr", sagte
Klemens, "ich will es Euch nicht vorenthalten: als ich aus unsrem Lande
zog, betete jedermann zum Gotte Mahomets, daß er es Euch nicht mißlingen
lassen möge, sondern Euch Macht gebe, Frankreich zu verderben,
und Euch glücklich wieder heimbringe." Der Sultan sprach: "Wohl, ich
will nicht weichen, Frankreich sei denn zuvor verloren. Aber sage mir,
Pilger, was ist deine Hantierungen" Klemens antwortete ihm: "Herr, ich
bin ein erfahrener Meister über alle Pferde; kein Pferd ist so groß oder
wild, von dem ich nicht sagen könnte, wie alt es ist, und wie lang es noch
leben wird; es wäre denn, daß ich nicht darauf zu sitzen käme; aber sobald
ich darauf sitze, so kann ich es Euch sagen." — "Du hifi wahrlich ein
geschickter Meister", sagte der Sultan darauf, "und ich freue mich deiner
Ankunft; denn ich habe ein Roß, das mir sehr lieb ist; das sollst du mir
besehen; denn es gibt seinesgleichen nicht auf Erden." —"Großmächtiger
König", sagte Klemens, "so gewiß ich Euch täglich gehorsam bin, so gewiß
will ich Euch die Wahrheit über des Rosses Leben sagen, sobald ich
auf seinem Rücken sitze."
Jetzt gebot der Sultan, daß man eilig sein Pferd vor ihn bringen
sollte; dieses war mit zwei silbernen Ketten angelegt und mit einem Zaum
von schönem roten Samt aufgezäumt, darin lag ein Gebiß von reinem
Silber, und silberne Spangen daran. Auf der Seite war das Gebiß köstlich
mit Gold eingelegt und mit manchem edlen Stein besetzt. So wurde
das Roß Pontifex vor den Sultan geführt und von ihm und allem Volke
mit Lust betrachtet. Als Klemens das Roß ansah, ward er im Herzen betrübt
; besonders das spitzige Horn an der Stirne wollte ihm gar nicht gefallen
, und überhaupt war das Pferd übermächtig und furchtbar anzusehen
. Da kehrte sich Klemens um, neigte sein Haupt und den Pilgerstab
und rief den wahren Gott ernstlich an, daß er ihm sein Vorhaben gelingen
lassen möge. "Nun, alter Vater", sprach der Sultan vergnügt;
"wie gefällt dir das Pferd? Sage mir etwas von seiner Art und Tugend
t" — "Ja, Herr Sultan", sagte Klemens, "sobald ich daraufsitze;
eher kann ich es nicht anzeigen!" — Der Sultan sprach: "Nun, so lege
Sporen an, und man sattle dir das Roß!" So wurde das Pferd Pontifex
gesattelt, die Steigbügel sorgfältig umgehängt und das Tier in seiner köstlichen
Ausrüstung vor den Sultan geführt. Je länger dieser das Pferd ansah
, desto größere Freude hatte er daran und sagte zu seinen Fürsten:
"Habt ihr auch euer Lebtage so ein schönes und starkes Tier gesehen? Es
ist wohl wert, daß es der Alte beschauen" Und nun befahl er dem Klemens
aufzusitzen. Dieser warf Pilgermantel und Hut vor dem Sultan
auf die Erde, legte sich die Sporen an und wollte, seinen Pilgerstab in
Hand, das Roß besteigen; dieses aber stellte sich sehr ungebärdig, als
es einen fremden Reiter auf den Rücken nehmen sollte; es schlug ihn mit
den Hinterfüßen so hart, daß er zwei Ellen weit rückwärts gestreckt ward.
Da hätte einer den Sultan und sein Volk sollen lachen sehen! Man mußte
dem Alten wiederaufhelfen; als er nun wieder auf seinen Füßen stand,
lachte auch er unter Weinen, gab dem Roß ein paar Streiche mit seinem
Stab, nahm es am Zaum und führte es so lang im Kreise um, bis es ihm
gelang, sich hinaufzuschwingen. Sowie er die Füße im Bügel, den Zaum
fest in den Händen hielt; sprach er vom Pferde herab zum Sultan: "Fürsichtiger
Sultan von Babylon, Euch sei mein Pilgermantel und Hut um
das Roß Pontifex geschenkt, und damit Gott befohlen; denn ich will den
nächsten Weg nach Paris reiten!"
Mit diesen Worten gab Klemens dem Roß beide Sporen; da hub es an
zu laufen, nicht anders, als wie ein Vogel durch die Lüfte zieht. Jetzt erst
merkte der Sultan, daß er schmählich um sein Pferd betrogen sei, und fiel
vor Zorn und Schrecken wie tot zu Boden. Als er wieder zur Besinnung
kam, versprach er dem, der es ereilen würde, hundert Mark Silbers. Da
tagten ihm viele nach, aber es war vergebens: ehe sie auf die Pferde kamen,
war Klemens weit davon und pries seinen Gott, daß er ihm so glücklich
davongeholfen. Zuletzt kamen sie ihm aber näher, und er sah von weitem
den Staub in den Lüften. Da eilte er nur um so mehr und wäre noch
zu rechter Zeit in die Stadt gekommen, wenn das Tor nicht verschlossen
gewesen wäre. Nun waren die Heiden so nahe, daß er schon ihre Flüche
vernehmen konnte. Klemens schrie kläglich nach dem Torwärter: "Ach,
tut mir doch das Tor auf, ich habe des Sultans gutes Roß. Wenn Ihr
mich nicht gleich einlasset, muß ich sterben!" Zum Glück hörte Florens,
der eben auf der Mauer war, seines Vaters Stimme und ließ ihm das
Tor öffnen. Nun schlüpfte er hinein, aber die Türken waren so nahe, daß
sie ihn um ein kleines noch erwischt hätten. Das Tor aber ward hinter
ihm zugeschlossen; Klemens ritt vor seinen Sohn, stieg ab und sprach:
"Hier ist das köstliche Roß, das meine Kunst dem Sultan abgewonnen;
dir sei es geschenkt, mein Sohn Florens!" Darüber verwunderte sich Florens
und dankte seinem Vater von Herzen. Er schwang sich auf das herrliche
Roß und tummelte es auf einem offenen Platze der Stadt vor vielen
Zuschauern, darunter mancher Herr und Edler war. König Dagobert und
Kaiser Oktavianus kamen auch herbei und hatten ihre Lust an dem Rosse
Pontifex. Als Florens sah, daß dem Könige das Pferd besonders in die
Augen leuchtete, stieg er ab, faßte es beim Zaum und führte es dem König
als ein Geschenk zu. Dafür schenkte der König Dagobert dem Ritter
Florens zwei Herrschaften mit schönen Schlössern in seinem Lande, und
Klemens ging auch nicht leer aus für seine Arbeit. In Paris wurde ein
herrliches Fest gehalten; aber der Sultan zerschlug seine Götzen im Grimm
und beschloß, Paris zum drittenmal zu belagern.
***Bald lagen die Heiden Zelt an Zelt vor der Stadt. Auf des Sultans
hohem Gezelte stand ein Adler vom feinsten Gold, seinen Schnabel der
Stadt Paris zugekehrt, als wollte der Sultan damit ihre Zerstörung andeuten.
Auch diesmal rüsteten sich die Feinde zum Sturm, und mehr denn
zwölftausend Heiden zogen mit Äxten, Hellebarden und langen Spießen
heran. Aber auch Ritterschaft und Volk in Paris waren wohl gerüstet;
und das Tor tat sich auf, das Christenheer hinauszulassen. Das erste,
was der Sultan erblickte, war sein gutes Roß Pontifex, auf dem der
König Dagobert vor allem Volke ritt. Darüber kam er vor Wut fast von
Sinnen und rannte mit solchem Grimm auf den König ein, daß er ihn
fast durchbohrte. Doch führte Gott den guten König; denn das Speereisen
haftete nicht auf seinem Harnisch, so daß der Sultan voll Zornes
wurde. Nun legte auch Dagobert seinen Speer ein und rannte gegen den
Sultan mit solcher Stärke, daß dieser wohl empfand, mit wem er es zu
tun hatte. Ehe es aber zum vollen Zweikampfe kam, verwundete des Sul
taus eigenes Roß diesen mit seinem scharfen Horne so schwer, daß er von
seinem Pferde herab und zu Boden sank. Dagobert zog sein Schwert und
wollte dem Gefallenen das Haupt abschlagen, aber fünfhundert Heiden
kamen ihrem Sultan zu Hilfe, wehrten die Streiche von ihm ab und halfen
ihm wieder auf das Pferd. Nun wurde das Schlachtgetümmel erst
recht allgemein.
Da gedachte Florens an Marcebyllas Rat, schlich sich, nachdem er aufs
tapferste gestritten, heimlich aus der Schlachtordnung und begab sich in
den Rücken der Stadt Paris, wo ein trefflich bestelltes Schiff seiner wartete,
so daß er bald zu der Geliebten kam, welche sein sehnlich harrte. Sie
fielen sich um den Hals und küßten sich mehr denn hundertmal. Derweil
wurde alles Gut und Kleinod der Fürstin auf das Schiff gebracht, und
Florens und Marcebylla samt allen ihren Jungfrauen säumten nicht
lange, sondern traten auf das Schiff und fuhren auf Paris zu. Gar froh
und kurzweilig saßen die zwei beieinander, und eins erzählte dem andern

die Schmerzen, die sie erduldet hatten, bis sie zusammengekommen. Auch
unterrichtete Florens die Jungfrau im christlichen Glauben. Die Zeit verflog
ihnen, und es fuhren die Schiffsleute eilig, so daß sie bald in der
Stadt ankamen. Dort führte Florens seine Geliebte mit ihren Jungfrauen
in das Haus seines Vaters Klemens und bestellte zwanzig Edelknaben,
die ihrer warten sollten; dann führte er sie in ihre Kammer und
nahm Urlaub von ihr, um die Schlacht zu vollbringen. Marcebylla aber
befahl ihn mit großem Seufzen dem wahren allmächtigen Gott; denn von
Mahomets Gott wollte sie nichts mehr hören.
Florens ritt indessen mit großen Freuden wieder in die Schlacht und
war leichten Sinnes als einer, der seine Beute schon empfangen und in
der Kammer geborgen hatte. Im Treffen begegnete er bald einem Könige,
der auch damals bei dem Sultan gesessen, als Florens die Botschaft
ausrichtete; den rannte er mitsamt seinem Pferde zu Boden, daß
er das Genick brach. Dann stürzte er sich immer tiefer in die Haufen und
brachte viele Heiden um, bis er zu tief unter sie kam und zuletzt umringt
wurde. Da vergalt ihm König Dagobert und kam ihm zu Hilfe. Auf
einer andern Seite des Schlachtfeldes rannten der Kaiser Oktavianus und
der Sultan gegeneinander; der Speer des Kaisers prallte an dem Harnisch
des Sultans ab, und dieser schrie seinem Heidenvolk zu: "Wird der
schändliche Verräter nicht von Euch gefangen, so bin ich Euch nimmermehr
günstig!" Nun schlugen alle Heiden auf den Kaiser zu, und sein
Pferd wurde ihm unter dem Leibe erstochen; da wurde er erst traurig;
dennoch wollte er sich nicht gefangengeben, sondern brachte noch manchen
Heiden um. Aber jetzt konnte er sich nicht länger mehr wehren; sein Helm
war zerschlagen, sein Leib verwundet, uno all sein Volk war ferne von
ihm. Nur Florens ersah des Kaisers Not im wüsten Getümmel, eilte zu
ihm und verließ ihn nicht, auch fehlte keiner seiner Streiche. Als die Heiden
den Schaden empfanden, da wollte jeder den Todesstreich auf Florens
führen; sein Roß ward unter ihm erstochen, so daß er auf die Erde fiel.
Doch erhob er sich bald wieder und focht wie ein grimmiger Löwe.
Zuletzt aber wurden sie doch müde und mußten sich beide, der Kaiser
und Florens, den Heiden gefangengeben, und so wurden die zwei vor den
Sultan geführt und seiner Gewalt überantwortet. Der grimmige Heide
gebot, sie hart zu binden und abzuführen in sein Gezelt. Florens war sehr
betrübt; er dachte nur an die schöne Marcebylla, und wiewohl er sich des
Lebens ganz verzieh, so betete er doch heimlich zu Gott um Errettung.
Ebenso tat auch der Kaiser Oktavianus. Die Heiden aber schnürten sie so
fest, daß die Stricke hart in das Fleisch gingen. So kamen sie in Banden
zu des Sultans Zelt.
Vergebens suchte der König Dagobert in der Schlacht nach seinen beiden
Freunden; niemand wußte von ihnen zu sagen. Da ward er traurig
und ergrimmt und schwur, die Heiden zu verderben. Aber ihrer waren
zehn gegen einen Christen, so daß die Franzosen immer härter ins Gedränge
kamen und es nahe an der Flucht war. Dagobert stellte sich an
die Spitze der Seinigen; die Krone Frankreichs funkelte auf seinem Haupt,
und er betete und schrie gen Himmel: "Heiliger Dionys! Schirme die
Krone Frankreichs, daß sie nicht vertilget werde!" In dieser Not sandte
Gott den Christen eine wunderbare Hilfe; denn er stellte den Heiden ein
Blendwerk vor die Augen, als wenn bei Montmartre in das Lager der
Christen ein fremdes Volk den Franzosen zu Hilfe gekommen wäre, alle
mit weißen Kleidern angetan, ihrer mehr denn zwanzigtausend. Der König
Dagobert aber hörte eine Stimme vom Himmel: "König von Frankreich
, sei unverzagt, die weißen Ritter werden dir zu Hilfe kommen."Jetzt
faßte sich Dagobert wieder ein Herz und rief den Seinen zu, sie sollten
tapfer auf die Heiden schlagen, damit sie des Streites müde würden. Zugleich
rückten die weißen Ritter, die Gott gesandt hatte, von hinten gegen
die Schlachtordnung der Feinde an, und der Anblick dieser neuen Heerscharen
verwirrte deren Reihen, daß sie sich in Unordnung zusammendrängten
und an zweitausend von den Heiden erschlagen wurden. Dieser
Streit gefiel dem Sultan nicht wohl: "Verwünscht sei die Stunde", sagte
er zu seinem Volke, "wo ich nach Frankreich gekommen bin! Laßt uns
fliehen, die weißen Ritter werden uns alle umbringen!" So kehrten die
Türken um und ergriffen die Flucht. Da schlugen die Franzosen unter sie,
daß Acker und Matten mit Leichnamen bedeckt wurden und ein gleiches
Gemetzel in Frankreich noch nicht gesehen worden war. Noch auf der
Flucht erhielt der Sultan die Nachricht, daß seine Tochter Marcebylla gen
Paris geführt worden sei. Da brach er in ein lautes Jammergeschrei aus.
Und als er in sein Zelt gekommen war, trat er mit dem Schwert vor seinen
Götzen, der dastand, herrlich mit Gold und Silber geschmückt, hieb
ihm alsogleich das Haupt ab und steckte es in einen Sack. Man wußte
nicht, ob es aus Zorn geschah, oder um es vor den verfolgenden Christen
zu retten. Zugleich sprach er: "Liebe Herren und gute Freunde, es wird
wahrlich not tun, daß wir uns bald von hinnen machen; sehet zu, daß die
zwei gefangenen Bösewichter wohl verwahrt seien, führet sie über das
Meer mit in unser Land. Kein Silber und kein Gold, ja, nicht das Gut
aller Welt nähme ich für sie. Vier Pferde sollen sie unter den Galgen
schleifen, dort will ich sie selbst in Stücke hauen." Oktavianus und Florens
wurden bald inne, was man mit ihnen vorhabe. Schimpflich mit
Seilen und Stricken gebunden, wurden sie von dem fliehenden Heere der
Heiden hinweggeführt. Bei Dagobert und seinen Scharen war laute
Klage um sie; denn niemand wußte, wo sie hingekommen waren.
***Nun lassen wir Florens, seine wunderbaren Taten und mannigfaltigen
Geschicke ruhen und kehren uns zu seinem Bruder Lion und der Kaiserin,
seiner Mutter. Als diese zu Jerusalem bei dem redlichen Edelmann Herberge
machte, nahm derselbe sich des kleinen Kindes an und erzog es ritterlich.
Alle Welt hatte den Knaben lieb, er wurde mannlich und stark
und war schön und wohlgezogen. Seiner Mutter erwies er große Ehre
und treuen Gehorsam; darum ward er von jedermann gepriesen.
Es geschah aber um diese Zeit, daß der türkische Kaiser wider den König
von Akron Krieg führte und mächtig zu Felde lag. Von ungefähr kam der
junge Fürst Lion an den Hof dieses Königes und begehrte, in seine Dienste
zu treten. Der schöne und starke Jüngling gefiel dem Könige, ward willig
angenommen und erhielt einen guten Hamisch samt voller Rüstung
zum Geschenke. Lion war ein Christ; denn die Kaiserin hatte ihn zu Jerusalem
taufen und seinen Namen nach der treuen Löwin, die immer ihre
Hausgenossin war, nennen lassen. Auch wich die Löwin von dem Knaben
nimmer, und so zog sie auch mit ihm in diesen Krieg. Als die beiden
Heerhaufen zusammenkamen, schlugen sie sich ritterlich. Lion focht mitten
unter den Heiden, und seine Löwin half ihm streiten; er erschlug, sie erwürgte
viele Feinde. Zuletzt, es kurz zu sagen, flohen die Feinde. Der
türkische Kaiser wurde gefangen und ihm das Haupt abgeschlagen. Der
König von Akron, der die Heldentaten des jungen Lion mit angesehen
hatte, ließ ihn rufen und fragte nach seiner Geburt. Der Jüngling erzählte
dem Könige, was er von seiner Mutter gehört hatte. Sogleich wurde
nach der Mutter gesandt, welche bald vor des Königes Angesicht erschien.
Da sprach der König zu ihr: "Würdige Frau, ist's Euch nicht zuwider,
so sagt mir, von welchem Geschlecht Ihr seid." Da sprach die Kaiserin:
"Herr König, mein Gemahl ist Oktavianus, der Kaiser zu Rom." Und
damit erzählte sie ihre Verfolgung und ihr ganzes Geschick. Als der König
dieses vernahm, ward er erstaunt und betrübt und sprach: "Wahrlich, erlauchte
Frau, Ihr habt unrecht getan, daß Ihr so manches Jahr in meinem
Lande gewohnt habt; ohne es mir zu wissen zu tun. Gewiß, ich hätte
Euch nicht so lang im Elende gelassen. Nun aber seid fröhlich; was ich
habe und vermag, das will ich mit Euch teilen!" Die Kaiserin dankte
dem Könige von Herzen, und während sie miteinander redeten, kam Lion
zu dem Könige und sprach zu ihm: "Unüberwindlicher Herrscher, meine
Bitte an Euch lautet, daß Ihr Euch meiner erbarmen und mich aus
Euren Diensten entlassen wollet. Ihr wisset durch mich und meine Mutter,
wie unschuldig ich enterbt worden bin. Darum ist mein Vorhaben,
zu dem Könige von Frankreich über Meer zu fahren. Er ist ein Freund
des Kaisers, und ich habe das Zutrauen zu ihm, daß er seinen Einfluß
darauf verwenden wird, meine Mutter in ihre Würde und Ehre wiedereinzusetzen
." Der König antwortete dem Jünglinge Lion: "Eure Bitte ist
ganz billig und soll Euch gewährt werden, schon um der großen Hilfe willen,
die Ihr mir gegen die Türken geleistet habt. Deswegen sollt Ihr auch
von mir eine ehrliche Summe Goldes zum Geschenk erhalten und tausend
gewappnete und wohlgerüstete Ritter, die Ihr von dem Gelde ernähren
möget."
Die Kaiserin und ihr Sohn dankten dem Könige von Akron aus gerührtem
Herzen, machten sich mit ihren Rittern auf, zogen durch das Land
und fuhren über das Meer. Sie langten in kurzer Zeit in der Lombardei
an. Dort begegnete ihnen ein junger Ritter, der aus Frankreich gebürtig
war. Diesen grüßte der Jüngling Lion und sprach: "Lieber Freund, zürnet
nicht; ich muß Euch eins fragen. Aus Eurer Kleidung ersehe ich, daß
Ihr aus Frankreich gebürtig seid." Der Ritter antwortete: "Wahrlich,
Ihr habt recht gesehen. Es sind noch nicht vier Tage vergangen, daß ich
in der Stadt Paris bei dem Könige war." Als Lion dies hörte, fragte er
ihn, ob der König Dagobert zu Paris hofhalte, wie es ihm gehe, ob er
frisch und gesund sei. Der Ritter sah den Lion an und sprach: "Fürwahr,
Herr, ich glaube, Ihr spottet mein mit Eurer Frage! Wißt Ihr denn nicht,
daß die Heiden in Frankreich eingefallen sind und fast das ganze Land
verwüstet haben? Obgleich große Fürsten und Herren dem Könige zu
Hilfe kamen, so konnten sie den Heiden doch nicht genug widerstehen;
denn die waren mehr als zweimalhunderttausend Mann stark. Ich glaube
deswegen, eine gute Belohnung könnte Euch nicht fehlen, wenn Ihr dem
bedrängten Könige mit Euren Reisigen zu Hilfe ziehen wolltet; denn alle
seine Bundesgenossen müssen vor den Heiden weichen." Die Kaiserin und
ihr Sohn dankten dem Ritter für seine Nachricht, und Lion sprach zu seinen
Rittern: "Seid wohlgemut, liebe Freunde! das Glück trifft uns, daß
wir in den Sold des Königes von Frankreich kommen!" Und zu seiner
Mutter: "Seid fröhlich, liebe Frau Mutter, in kurzer Zeit sollt Ihr zu
Rom als gewaltige Kaiserin gekrönt werden."
Sie waren noch nicht lange unterwegs, als die Kaiserin von ferne eine
große Staubwolke sich erheben sah, wie sie von Kriegsleuten und Rossen
kommt. "Lieben Freunde", sprach sie zu ihrem Sohn und seinen Rittern,
"das dürften wohl die Heiden sein, von denen uns gesagt ist, daß sie das
ganze Frankreich verderbt haben. Laßt uns schnell eine Schlachtordnung
bilden, damit ihr, wenn es vonnöten ist, ritterlich wider sie streiten möget
." Dies taten die Ritter, und noch waren sie nicht weit geritten, als
sie auf viele tausend Türken und Heiden zu Roß und zu Fuße stießen
Unter ihnen befand sich auch der Sultan; er war mit seinem gang Volke
nach jener dritten Schlacht vor Paris auf der Flucht und im Begriffe;
nach Babylon zurückzukehren. Auch führten sie zwei Gefangene harb
gebunden mit sich, der eine war der Kaiser Oktavianus, der andere der
Ritter Florens; sie waren wie Jagdhunde mit Stricken zusammengeknebelt
und wurden schimpflich mit Prügeln getrieben. Beide sprachen klagend
einer zu dem andern: "O frommer König Dagobert, Gott wolle deiner
pflegen; denn du und wir werden einander nimmer sehen; aber doch
sei Gott gelobt, daß die Heiden von uns Christen überwunden sind!"Auf
der andern Seite führte der Sultan große Klage wegen seiner Tochter
Marcebylla, die von den Franzosen nach Paris entführt worden war.
Inzwischen rückte Lion mit seinen Rittern so nahe auf die Heiden, daß
er erkannte, welch ein Volk es wäre, und sah, daß sie auf der Flucht und
noch ganz müde und atemlos waren. Auch gewahrte er den Sultan, der
zwar das königliche Diadem auf dem Haupte trug, aber so traurig aussah,
nicht als ob er von einem Schmause aus Frankreich käme. Darum
sprach Lion zu den Seinigen: "Seid unerschrocken! Es sind die Heiden,
die gegen das Christenblut toben! Seht, dort führen sie zwei vornehme
Gefangene: die werden hart von ihnen geschlagene Es sind Fürsten. Laßt
sehen, was das alles ist!" Seine Genossen erklärten sich bereit, in allem
seinem Willen zu folgen. Die Löwin aber, die immer bei dem edlen Jüngling
Lion war, begann, mit ihren Klauen in der Erde zu scharren, als
wollte sie andeuten, daß sie bereit sei, zu kämpfen und unter den Heiden
zu wüten. Davon gewann die ganze Ritterschaft ein fröhliches Herz.
"Seid getrost", rief der Jüngling seiner Mutter zu, "wir wollen sie so
empfangen, daß ihrer keiner am Leben bleibe außer ihren zwei Gefangenen
!" Mit diesen Worten führte er sie an einen sichern Platz, bis
Treffen vorüber wäre. Dann fiel er mit seinen Rittern unter die Heiden,
die nichts dergleichen erwarteten, und erwürgte ihrer in kurzer Zeit
die Hälfte. Auch die ungeheure Löwin machte eine weite Gasse um sich
und zerriß manchen Türken und Heiden. Und als sie gar von einem
Feinde wundgeschlagen worden war, wurde sie noch viel grimmiger und
stürzte so tief unter sie, daß sie endlich den Sultan erreichte, ihn mit grostem
Ungestüm anfiel und zu Boden warf. Ja, sie hätte ihn in Stücke
gerissen, wenn nicht Lion dazugekommen wäre. Dieser merkte bald an
seiner Tracht und Haltung, daß der Sultan ein Oberster der Heiden sei,
und wehrte der Wut des Tieres. Doch stellte er sich, als wollte er dem
zu Boden Liegenden das Haupt abschlagen, bis der Sultan um Gnade
flehte, sein Schwert als Gefangener darreichte, großen Tribut zu bezahlen
versprach und am Ende gar seinen heidnischen Glauben abschwur.
Darüber war Lion sehr erfreut und sagte ihm sein Leben zu. Doch wurde
er hartgebunden und so an einem Strick vor die Kaiserin geführt. Inzwischen
hatten die edlen Ritter und die Löwin auch die übrigen Heiden
vollends erlegt.
***Die Schlacht war vorüber, und alle ruhten vom heißen Kampfe aus.
Da trat Lion zu den beiden Gefangenen, dem Kaiser und Florens, und
sprach: "Liebe Herren, sagt mir die Wahrheit, von wannen ihr stammt;
denn ich bin's, der euch erlösen will." — Der erfreute Oktavianus erwiderte:
"Wir wollen Euch die Wahrheit nicht verhehlen, werter Ritter:
ich bin der römische Kaiser und werde Oktavianus genannt, und dieser
mein Genosse hier heißt Florens und ist wahrlich ein rechter Held. Wir
sind von den Heiden während der Schlacht gefangen worden, und jetzt
wollen wir gern Eure Gefangenen sein und ganz nach Eurem Willen tun.
Aber, wenn es Euch gefällt, so überliefert uns nur dem Könige Dagobert
von Frankreich; der wird Euch so begaben, daß Ihr nimmermehr in
Armut kommen möget." Als der Jüngling Lion diese Rede hörte, konnte
er vor großer Freude nicht mehr reden; denn er erkannte in dem Reden-
den seinen leiblichen Vater, obwohl er ihn in seinem Leben noch nicht
gesehen hatte. Darum lobte er Gott, daß er ihn auf diese Weise seinen
Vater hatte fangen lassen, und fragte den Kaiser: "Mein lieber Herr,
saget mir, habt Ihr jemals eine Gemahlin gehabt?" — "Ja, lieber
Freund", erwiderte Oktavianus, "von ihretwegen bin ich der allertraurigste
Mensch auf Erden. Ich glaube gewiß, daß alles übel und alle
Schande, die ich bis auf diesen Tag erlitten habe, meiner Sünden Schuld
ist weil ich an meiner unschuldigen Gemahlin so freventlich gehandelt
habe." —"Was habt Ihr denn Unbilliges an ihr getan?"fragte Lion, als
wüßte er von nichts. —"Ach", erwiderte der Kaiser, "die Frau war fromm
gegen mich und jedermann, und ich hatte sie auch lieb. Aber durch eine
große Verräterei, welche gegen sie erdacht wurde, habe ich sie aus meinem
Lande verbannt und ins Elend geschickt. Und die Bosheit kam von
meiner Mutter her. Die Kaiserin hatte mir zwei Söhne geboren: da
überredete mich meine Mutter, sie wären nicht meine Kinder; darum
wollte ich Mutter und Söhne verbrennen lassen, und nur mit Mühe begnadigte
ich sie. Aber wahrlich, es hat mich seitdem bitter gereut, und
ich habe keine gute Stunde mehr gehabt von jenem Augenblick an." So
erzählte der Kaiser dem Jünglinge Lion alles Stück für Stück, was sich
mit seiner Gemahlin begeben; da fragte dieser noch weiter: "Lieber Herr
und Kaiser, wie heißt denn Euer Genosse ?" — "Dieser", sprach Oktavianus
, "wird Florens genannt, wie ich Euch schon gesagt habe; aber es
ist wunderbar, meiner Lebtage habe ich keine zwei Männer getroffen, die
einander von Antlitz und Gebärde so ähnlich sehen wie Ihr. Man sollte
meinen, daß Ihr leibliche Brüder wäret!"
Kaum konnte sich Lion länger halten. "Herr Kaiser", sprach er, "wenn
Eurer Majestät Gemahlin Euch vor die Augen gestellt würde, vermeintet
Ihr, sie zu erkennen?" — "Fürwahr, sehr wohl", erwiderte der Kaiser,
"aber, Gott erbarm's, ich bin wohl sicher, daß ich sie nie mehr sehen
werde." Da nahm Lion den Kaiser bei der Hand und sprach zu ihm:
"Folget mir nach, beide Herren!" Und nun führte er sie dem Orte zu,
wo er seine Mutter vor der Schlacht geborgen hatte. Sobald die Kaiserin
von ferne ihren Gemahl sah, erkannte sie ihn, und als sie ihn ansah,
mußte sie vor Freuden weinen. Wie nun alle drei vor sie gekommen waren
, sprach Lion zu dem Kaiser: "Lieber Herr, sehet diese Frau an, ob es
nicht die sei, die Ihr, wie Ihr mir gesagt habt, aus Eurem Lande verbannt
und verstoßen habet."
Oktavianus durfte die edle Frau nicht lange ansehen; er erkannte sie
alsbald, empfing sie mit weinenden Augen und nahm sie in seinen Arm.
Sie selbst fiel dem Kaiser, ihrem Herrn und lieben Gemahl, dessen sie so
lange beraubt gewesen war, unter lautem Schluchzen um den Hals und
küßte ihn mit liebevollem Seufzen mehr denn hundertmal. Da mochte
man große Freude sehen. Der Kaiser bat sie voll Scham um Verzeihung;
er erzählte ihr alles, was sich mit seiner Mutter begeben, und sagte ihr
feierlich zu, daß er in kurzem zu Rom ihr die Kaiserkrone auf das Haupt
setzen wolle. Dann fragte der Kaiser die fromme Frau weiter, ob der
Jüngling Lion, der ihn gefangen und erlöst habe, ihr Sohn sei. "So wahr
wir hier beisammenstehen, ist er Euer und mein Sohn", sagte sie, "Gott
hat es gefügt, daß er ein so beherzter Mann geworden ist. Aber wegen
meines andern Sohnes hin ich sehr bekümmert; denn ihn habe ich elendiglich
verloren!" Der Kaiser fiel seinem Sohne Lion um den Hals und gab
ihm vor großer Liebe einen Kuß um den andern. Die Kaiserin aber sah
nur immer den Ritter Florens an und fragte ihn: "Lieber, junger Ritter,
sagt mir, von wannen seid Ihr? Denn wahrlich, Ihr und mein lieber
Sohn Lion seid einander gang ähnlich von Angesicht und Gebärden!"
Florens sprach: "Gnädige Frau, wo ich geboren bin, weiß ich nicht; das
aber weiß ich wohl, daß mich ein Bürger von Paris gütig erzogen hat.
Dieser sprach bald zu mir, er habe mich gezeugt, bald, er habe mich am
Meeresgestade gekauft." Die Kaiserin fing an zu erkennen, daß Florens
ihr anderer Sohn sein müsse; ihr Blut kam in heiße Regung, und sie
sprach schnell: "Junger Ritter, ich glaube, daß ich Euch unter dem Herzen

getragen habe, daß ich Eure Mutter und der Kaiser Euer Vater sei. Gott
gebe, daß der Bürger von Paris Euch gekauft oder gefunden habe. Doch,
um die Wahrheit zu erfahren, laßt uns miteinander zu König Dagobert
nach Paris ziehen!"
Alle waren in großer Freude und Erwartung, und so rückte der ganze
Heerhaufe, Kaiser Oktavianus und die Kaiserin, Florens und Lion, samt
allen Rittern nach Paris. Doch war die glückliche Botschaft von der Erlösung
des Kaisers und des Ritters noch vorher bei König Dagobert angelangt
. Der dankte Gott mit heller Stimme; denn er hatte sie für tot
verlorengegeben. Auch Marcebylla erhielt einen Brief von ihrem Geliebten
und wußte nicht, wie sie vor Freuden sich gebärden sollte. Und bald
darauf kamen alle miteinander an, und der König mit allen Rittern und
Edeln war ihnen vor das Tor entgegengezogen. Da mußte vor allen Dingen
Marcebylla ihren Florens umhalsen und küssen, aber reden konnte
sie nicht zu ihm. Alles Blut war ihr vor großer Freude zu dem Herzen
gelaufen. Als sie wieder zu sich kam, sprach sie: "Ach, du Trost meines
Lebens, sei willkommen; warum hast du mich so lange verlassen?" Florens
aber sprach nichts, sondern küßte sie nur. Und nun ritten sie alle,
Kaiser Oktavianus und seine Söhne Florens und Lion und die fromme
Kaiserin mit dem ganzen Gefolge, ein in Paris.
Hier wurde der Sultan von dem jungen Fürsten Lion sogleich dem König
Dagobert ausgeliefert. Aber ihm geschah kein Leid. An einem und
demselben Tage wurde er und seine Tochter Marcebylla durch den Bischof
von Paris getauft und der edle Florens mit seiner Geliebten zur Kirche
geführt und vermählt. Es war eine gute Ehe; denn die Geschichte meldet,
daß sie mit keinem Worte je gegeneinander gezürnt haben. Dem Sultan
wies der König von Frankreich eine eigene Landschaft an, doch mußte er
seine Wohnung an dem Hofe des Königs haben. Der Christenglaube
machte ihn fromm und sanft, und durch seinen hohen Geist wurde er des
Königs oberster Rat in allen wichtigen Dingen.
Jetzt schickte König Dagobert auch zu dem Bürger Klemens, welcher den
Florens so lange erzogen hatte. Dieser war gar wohlgemut, daß sein
Pflegesohn wieder erlöst worden war. Und als König Dagobert die drei,
den Kaiser Oktavianus, den Ritter Florens und den jungen Lion ernstlich
ins Auge faßte, da konnte er nach langem Anschauen nicht mehr zweifeln,
daß beide Jünglinge Brüder seien und Oktavianus beider Brüder Vater.
Daher rief er den guten Klemens nahe zu sich und sprach: "Klemens,.
höret mir zu, ich habe etwas mit Euch zu reden. Bei dem Eide, den Ihr
mir als guter Untertan zugeschworen habt; sagt mir, ist der Jüngling
Eures Geschlechtes?" Klemens erschrak vor dem Ernste des Königs und
erzählte, wie er den Knaben erkauft habe, ohne einen einzigen Umstand
zu verschweigen. Sobald die Kaiserin die Rede vernahm, rief sie: "Ja,
es ist wahrlich mein Sohn; er ist mir in dem wilden Walde gestohlen worden!"
—lief auf Florens zu und küßte ihn mit klopfendem Herzen. Dem
Kaiser, als er seine liebe Gemahlin und die Kinder wiedergefunden hatte,
gingen die Augen über. Der König von Frankreich nahte sich ihm und bezeigte
ihm seine große Freude. Da sprach Kaiser Oktavianus: "Ja, es ist
eine große Gottesgabe, die mir armen Sünder zuteil geworden ist. Darum
nehmet es nicht übel auf, lieber König und Bruder, wenn ich mit meinem
Weib und meinen Söhnen wieder nach Rom ziehe." Aber Dagobert
bat ernstlich, ihm doch seinen lieben Sohn Florens zu lassen, damit er ihn
mit einer Landschaft in Frankreich begaben möge, so daß der Kaiser es
nicht abschlagen konnte. Doch blieb die Reise wohl noch zehn Tage anstehen
, während welcher der König mit seinen Großen allerlei Festbarkeiten
anstellte. Am eilften Tage verließ der Kaiser die Stadt Paris, und
der König, Florens und sämtliche Ritter gaben ihm das Geleite. Die
Römer empfingen ihren Kaiser köstlich, und als Oktavianus in seiner
Stadt angekommen war, setzte er der Kaiserin eine köstliche Krone auf
das Haupt, und die fromme Frau vergaß ihres vorigen Leides und wurde
hoch erfreut.
Darnach fragte der Kaiser, wo seine Mutter sei. Das Hofgesinde sprach:
"Eure Mutter ist vor langer Zeit gestorben, aber fast unchristlich. Vor
ihrem Ende ist sie taub und wahnsinnig geworden und wollte alle Leute
lebendig auffressen. Zuletzt mußte man sie an eine starke Kette legen; so
trug sie die Schuld ihrer Sünden, bis sie ihren Geist aufgab." Der Kaiser
war froh, daß er seine Mutter nicht bestrafen durfte. Er wandte sich
nun zu fröhlicherem Dinge, schlug seinen lieben Sohn Lion zum Ritter,
und alles Volk hatte große Freude.
***Da begab es sich, daß der König von Spanien ein Turnier ausschrieb
an alle Könige und Fürstenhöfe, also daß, wo ein tapferer Ritter wäre,
der seine Kraft und Mannheit versuchen wollte, derselbe sich in der spanischen
Stadt Valencia einfinden sollte: da würde ein jeder seinesgleichen
finden. Als dies vor die Ohren des edlen Ritters Lion kam, säumte er
nicht lange. Er gebot einigen seiner Ritter, sich auf das Turnier zu rüsten,
erbat sich von seinem Vater die Erlaubnis zu reisen und zog mit zweihundert
wohlgewaffneten Rittern nach Valencia. Hier blieben sie acht Tage
stilleliegen und ruhten, bis alle Ritterschaft zusammengekommen. Dann
ließ der König von Spanien einen schönen Turnierplatz zurichten und
öffentlich ausrufen, wo ein Ritter wäre, der turnieren möchte um einen
Kranz, den des Königs Tochter Rosamunde selbst gewunden, der solle sich
des andern Tags zu guter Zeit auf den Platz verfügen.
Als der Ritter Lion dieses hörte, konnte er kaum erwarten, bis die
Sonne aufging, und ließ sich schon vor Tag seine Rüstung bringen. Diese
war gut und schön gefertigt: vorn auf der Brust war sie mit feinem arabischen
Golde zusammengeschmelzt und mit viel köstlichen Edelsteinen besetzt
. Auf seinem Helm führte er einen Löwen aus klarem Golde, der trug
ein Wickelkind im Nachen. Sobald er nebst allen seinen Begleitern fertig
war, begab er sich den nächsten Weg auf den Kampfplatz. Hier fand er
manchen kühnen Ritter; doch war keiner so wohl gerüstet wie er, daher
wurde er auch von allen Anwesenden mit Neugierde betrachtet. Wie nun
die Zeit kam, daß man zusammentreffen sollte, teilten sich die Ritter in
zwei Haufen; aber Lions Begleiter trennten sich nicht von ihrem Herrn;
sie legten ihre Lanzen ein und rannten allweg mit ihm, und das so gewaltig,
daß mancher von den Gegnern den Sattel räumen mußte. Auch
Lion säumte nicht und warf alle zu Boden, die ihm vorkamen.
Die Königstochter Rosamunde lag auf den Zinnen mit ihren Jungfrauen
und schaute dem Kampfe zu. Wie sie nun den Jüngling so ritterlich
streiten sah, hätte sie gerne gewußt, wer der Ritter sei, der einen
goldenen Löwen auf dem Helm hatte. Als das Turnier vorüber war, das
bei fünf Stunden gewährt hatte, und jedermann wieder in seine Herberge
gezogen war, auch Lion sich entwaffnet hatte, begab er sich mit seiner Gesellschaft
sofort zu dem Könige von Spanien und wurde von diesem gar
höflich empfangen. Und als es Zeit war, zu Tische zu sitzen, und alle Ritterschaft
zugegen war, siehe, da trat Rosamunde mit ihren Jungfrauen in
den Saal, köstlich geziert. Auf dem Haupte trug sie eine goldene Krone
und auf der Krone das Kränzlein. Und als sie in dem Königssaale vor
ihrem Vater stand, hub dieser an und sprach: "Liebe Herren und Ritter,
der Kranz, der dem Tapfersten unter euch gehört, ist hier vor euch. Fragt
ihr aber, wer der sei, so ist mein Bedenken, daß der Ritter; der einen
goldenen Löwen auf dem Helme führt, der würdigste sei, ihn zu tragen.
Welcher nun derselbe ist, der melde sich, daß ihm hie gebührende Ehre
geschehe." Lion stand hinten in der Tiefe unter den andern Rittern und.
scheute sich, seinen eigenen Namen zu nennen. Als aber der König immer
ernstlicher nach dem Ritter fragte, trat einer von Lions Genossen hervor;
deutete auf den Fürsten und sprach: "Hier stehet der, nach dem Ihr fraget
." So mußte Lion hervortreten und sich dem Könige zeigen. Die
schöne Rosamunde nahm den Kranz von ihrem Haupte und setzte ihn dem
Jüngling Lion mit den Worten auf: "Edler Ritter, dieses Kränzlein möget
Ihr wohl in Ehren tragen; denn Ihr habt wahrlich ritterlich gefochten
Lion dankte ihr mit einer tiefen Verbeugung und trat wieder zurück
zu seinen Kampfgenossen. Alsdann begann das Mahl, und der Jüngling
wurde neben Rosamunde gesetzt. Die beiden vergaßen aber das Essen und
vertrieben sich die ganze Zeit mit freundlichem Gespräche. Und unter ihren
Worten entzündete sich das unauslöschliche Feuer der Liebe, so daß sie am
Ende verstummten und keines mit dem andern mehr reden konnte, sondern
daß sie nur Seufzer ausstießen. Der alte König von Spanien merkte dieses
; er fragte deswegen heimlich, wer denn der Ritter Lion wäre. Als
ihm darauf die Antwort geworden, daß er des römischen Kaisers Oktavianus
Sohn sei, verwunderte sich der König dessen und ward im Herzen
sehr darüber erfreut. Sowie man von der Tafel aufgestanden war, führte
er seine Tochter Rosamunde und den Ritter Lion in seine Kammer und
sprach zu diesem: "Lieber Herr und guter Freund, wir haben wohl vermerkt,
daß Ihr und meine Tochter große Liebe zusammen traget. Wenn
es Euch nun beliebt, so will ich Euch meine Tochter zum ehelichen Gemahl
geben." Jener antwortete: "Gnädigster Herr, ich bin allezeit bereit,
Euren königlichen Willen zu tun, bevorab diesmal!" Auf solches zog
der König seinen eigenen Ring von der Hand und verlobte Lion mit Rosamunde
, und bald darauf wurde eine köstliche Hochzeit gehalten; worauf
der Ritter Urlaub nahm und mit seiner jungen Gemahlin und den zweihundert
Rittern wieder nach Rom fuhr, wo er von seinem Vater, dem
Kaiser, gar wohl empfangen wurde.
Florens hatte dem Könige von Frankreich drei Jahre lang gedient und
war nun schon ein Jahr darüber bei ihm, seitdem sein Vater wieder zu
Rom hauste. Da kamen im vierten Jahre die Großen von England zu
dem Könige Dagobert und beklagten sich, daß ihr König gestorben sei und
keinen Erben hinterlassen hätte, der die Krone antreten könnte. Sie baten
ihn mit Ernst, er möchte ihnen einen König wählen, der sie regiere und
wider ihre Feinde beschirme. Darauf sprach Dagobert: "Bei der Treue,
die ich Gott schuldig bin, ich wüßte keinen auf Erden, der dies füglicher
sein könnte als Florens, ein Sohn des römischen Kaisers Oktavianus.
Denn wenn nicht erstlich Gott und dann er gewesen wäre, so wäre mein
Land von den Ungläubigen erobert worden. Darum, einen bessern Rat
kann ich Euch nicht geben." Die englischen Fürsten waren dieses Rats
sehr zufrieden; denn sie hatten von Florens, seinen Tugenden und männlichen
Taten schon vieles reden hören. Dagobert meldete seinem Freunde
Florens die Sache, und dieser nahm das Königreich mit gutem Willen
an. So ward er im Triumph in das Münster St. Denis geführt und
vom Könige Dagobert zu einem König in England gekrönt.
Als er nun nach England zog, wollte er seinen lieben Pflegvater Klemens
, dessen Hausfrau und seinen vermeinten Bruder Klaudius nicht hinter
sich lassen, sondern sie mußten alle drei mit ihm nach England ziehen.
So saßen sie auf, zogen durch Brabant, setzten sich auf das Meer und
schifften gen England, und bald waren sie in der Haupstadt London. Hier
wurden Florens und Marcebylla samt dem König Dagobert, der sie begleitet
hatte, feierlich empfangen. Dem Florens wurde das Gesetz von
England vorgelesen, dasselbe zu halten, wie es einem frommen Könige
gebührt. Und Florens tat einen willigen Schwur.
Darauf segnete König Dagobert sie alle und schied von dannen. Der
König Florens, dem Gott allezeit beistand, regierte sein Volk weislich, und
es gehorchte ihm in Ehrfurcht und Liebe. Auch wurde ihm und seiner
Gemahlin Marcebylla ein schöner Sohn beschert, welchen sie Wilhelm
nannten. Dieser wuchs in allen Tugenden auf und wurde von allen
Menschen in Ehren gehalten. Nach langen Jahren starben Florens und
seine geliebte Marcebylla kurz nacheinander, und Wilhelm ward zum König
in England gekrönt. Auch dieser hielt gut Recht, achtete den Armen
wie den Reichen und war seinem Volke sehr lieb.
Dies ist die Geschichte vom Kaiser Oktavianus und seinen zwei Söhnen.
Die schöne Melusina
Mit Bildern von Adolf Ehrhardt
Zu Poitiers in Frankreich war ein Graf, namens Emmerich, ein gelehrter
Herr, und besonders in der Wissenschaft des Himmelslaufes und zukünftiger
Dinge vielerfahren. Derselbe war auch gar reich an Gütern und
pflog großer Ergötzlichkeit mit Jagen. Er hatte nur einen Sohn und eine
einzige Tochter, die er beide inniglich liebte. Der Sohn hieß Bertram,
die Tochter Blaniferte. Die letztere war eine sehr schöne und züchtige
Jungfrau und in allem mit Tugend wohlgeziert. Nun gab es in dieser
Landschaft überaus große Wälder, und namentlich fand sich in der Gegend,
wo Graf Emmerich lebte, ein Holz, welches der Kürbisforst hieß. In diesem
lebte zu der nämlichen Zeit ein berühmter Graf von gutem Geschlechte,
aber arm an Habe und mit vielen Kindern gesegnet. Doch ersetzte
er solchen Abgang an zeitlichen Gütern durch viele andre seinem
Stande wohlgeziemende Tugend; denn er war ein weiser, verständiger
Herr von gar redlichem Gemüte, der mit seinem jährlichen Auskommen
bescheiden und ohne Pracht haushielt und mit guter Zucht seiner Kinder
pflegte, weswegen er denn auch von jedermann geehrt und wertgehalten
wurde. Dieser Graf war auch aus dem Geschlechte derer von Poitiers,
führte in seinem Wappen gleichen Schild und Helm wie jener und war
mithin dessen leiblicher Vetter.
***Der Graf Emmerich von Poitiers nun erwog bei sich, daß sein Vetter,
der Graf von dem Forste, sehr arm und mit vielen Kindern beladen sei;
er dachte deswegen darauf, ihn teilweise zu erleichtern und ihm unter die
Arme zu greifen, damit er seine zeitliche Nahrung besser haben und seine
Kinder dereinst standesmäßiger aussteuern könnte. Es fügte sich darauf,
daß der reiche Graf von Poitiers in seiner Residenz einst ein großes Bankett
zurichtete und seinen Vetter, den armen Grafen von dem Forst, dazu
berufen ließ. Dieser fand sich zu der Festlichkeit mitsamt seinen drei Söhnen
, welches junge wohlgezogene Herren waren, mit aller Höflichkeit ein.
Hier wurde ihnen alle nur ersinnliche Ehre und Freundlichkeit erwiesen;
da erhub sich in dem Herzen des Grafen Emmerich eine solche Flamme
der Liebe und Zuneigung gegen diese drei Jünglinge, am allermeisten aber
gegen den Jüngsten, welcher Raimund hieß, daß er sich nicht länger mehr
bergen konnte, sondern dieses Gefühl seinem Vetter, dem Grafen von
dem Forst, eröffnete mit der herzfreundlichen Anrede: "Lieber Vetter, ich
sehe wohl, daß Ihr mit Kindern sehr überhäuft seid. Darum ist mein
Wunsch, Ihr wollet geruhen, mir einen Eurer Söhne an Kindes Statt zu
überlassen, welcher zu allem Guten erzogen und wohlversorgt werden
soll." Der redliche alte Herr stellte ihm auf ein so geneigtes Anerbieten
frei, welchen von den dreien er sich auswählen wollte. Also erbat sich
Graf Emmerich den Jüngsten, Raimund, der ihm am allerbesten gefiel.
Dafür bedankte sich der Graf vom Forste aus ganzem Gemüt und übergab
ihm den schönen, jungen, wohlgestalteten Herrn, seinen jüngsten Sohn,
mit höchstem Vergnügen.
***Nachdem das herrliche Bankett geendet war, welches drei Tage lang
gewährt hatte, nahm der alte Graf wieder Abschied von seinem Vetter;
willens, sich wieder nach Hause zu begeben, seinen jüngsten Sohn Raimund
also zurücklassend, wiewohl es nicht ohne nasse Augen und heimliche
Betrübnis bei dem alten Vater ablief. Das junge Herrlein aber
hätte sich keine bessere Aufnahme wünschen können; auch erwies er sich
in seinem Dienste vor allen andern angenehm und wußte sich höchst beliebt
zu machen; daher wurde er nicht nur von seinem Vetter als ein
Freund recht innig geliebt, sondern dieser befahl auch allen Haus- und
Hofgenossen, ihn aufs achtsamste zu behandeln, damit ihm ja von niemand
Leid zugefügt würde.
***Als nun einmal Graf Emmerich seiner Gewohnheit nach auf der Jagd
war und die Seinigen einem wilden Schweine nachjagten, da ritt auch
Raimund demselben nach; das Schwein aber eilte, sich vor den Hunden
zu retten, und zog so den ganzen Schwarm der Jäger nach sich. Auch
Raimund war darunter, da er seinen Herrn nicht verlassen wollte, zumal
es später Abend und verführerisches Mondlicht war. Solange das
Schwein verfolgt wurde, hielt er aufs getreueste aus. Dieses hatte inzwischen
viel Hunde teils getötet, teils verwundet; und nach und nach hatten
sich alle Diener von dem Grafen verloren, so daß keiner von ihnen
wußte, wo derselbe hingekommen wäre, außer Raimund, der bei ihm war.
Als nun dieser solches bemerkte und sich beide in der äußersten Verlassenheit
fanden, begann Raimund endlich, seinen Herrn Vetter wohlmeinend
also anzureden: "Gnädiger Vetter, wir sind von allem unsrem Volke abgekommen,
haben Hunde und Jäger verloren; es will sich wegen eingebrochener
Nacht nicht wohl tun lassen, so weit zurückzureiten; auch können
wir unser Gefolge nicht wohl wiederfinden. Darum rate ich, daß wir
in dem nächsten Bauernhof einkehren, wo wir diese Nacht Herberge haben
können." Der Graf antwortete ihm: "Du redest recht und rätst sehr
wohl, getreuer Raimund; denn die Sterne stehen bereits am Himmel, und
der Mond scheint gar helle!" Also fingen sie an, quer durch das Holz zu
reiten, und fanden zuletzt nach vieler Mühe einen schönen Weg, von welchem
dem Raimund deuchte, daß er sie nach Poitiers leiten werde. Der
Graf, welcher hoffte, einige seines Volkes wiederzutreffen, sprach: "Laß
uns eilen, unser Poitiers wird uns auch noch bei später Nachtzeit unversperrt
aufnehmen!" So ritten sie den Weg, Graf Emmerich voran, Raimund
als sein Diener hinter ihm drein.
***Indem nun diese beiden also dahinritten, fügte sich's, daß der Graf,
dem als einem guten Himmelskundigen der Lauf der Gestirne ziemlich
bekannt war, unter den andern Sternen einen ganz fremden Stern gewahr
wurde. Darüber seufzte er aus Herzensgrund und brach in folgende,
tief heraufgeholte Worte aus: "Ach, Gott, wie sind doch deine
Wunder so mannigfaltig, wie kann die Natur ein so widerwärtig Spiel
mit sich selbst treiben, daß sie einen Menschen entstehen läßt; der durch
Übeltun zu so großen zeitlichen Ehren erhöht werden soll, während es
doch sonst unziemlich ist, wenn sich jemand um der Missetat willen hoch
ehren lassen will." In solcher Verwunderung über den seltsamen Himmelsaspekt
sagte er zu Raimund abermal tief seufzend: "Komm herzu,
Sohn, ich will dir groß Wunder und eine bedenkliche Vorbedeutung am
Himmel zeigen, dergleichen nicht leicht gesehen wird!" Raimund, als ein
lernbegieriger Jüngling, fragte, was denn das wäre. "Siehe", sagte Graf
Emmerich, "ich sehe am Himmel, daß in dieser Stunde einer seinen Herrn
töten und ein gewaltiger Herr werden wird, mächtiger, als je einer seines
Geschlechts gewesen ist!"
***Raimund schwieg still und redete kein Wort; indessen fand er ein Feuer,
das hatten die Herren, die im Gefolge des Grafen gewesen, im Holze gelassen;
deswegen stieg er vom Pferde und klaubte kleines Holz zusammen,
womit er das Feuer unterhielt; denn es war kalt. Der Graf, sein Vetter,
stieg auch ab und wärmte sich, aber es war ihm zum Tode. Denn in diesem
Augenblick hörten sie durchs Holz etwas daherbrechen: Raimund griff
schnell zu seinem Schwerte, desgleichen der Graf zu seinem Spieße. Kaum
hatten sie sich zur Wehr gefaßt gemacht, da kam ein großes Schwein auf
sie daher mit wildem Grunzen; das rückte knirschend und schnaubend in
voller Wut immer näher auf sie zu. Raimund bat seinen Vetter inständig
, daß er doch, um sein Leben zu retten, sich auf einen Baum flüchten
und ihn allein mit dem Schweine kämpfen lassen möchte. Aber den Grafen
, als einen entschlossenen Helden, verdroß solches, daß er so wider seine
Gewohnheit vor einer Bestie fliehen und ihr furchtsam ausweichen sollte;
er beschloß bei sich und schwur, standzuhalten und des Himmels Willen
über sich ergehen lassen. Er sagte auch seinem Raimund, daß er ihn
ferner mit solchen Zumutungen verschonen möchte; zugleich setzte er seinen
Spieß an und ging dem Schwein entgegen, sich ihm widersetzen; er
versetzte dem Tier auch wirklich einen Fang, aber das Schwein schlug den
Stoß, der zu schwach war, mit einem Satze ab und warf seinen Feind ergrimmt
zur Erde hin. Nun rückte geschwind auch Raimund mit seinem
Spieße hervor, um der Bestie den Refi zu geben und seinen Vetter zu erretten;
allein er fehlte zu allem Unglück, und im großen Eifer glitt ihm
der Spieß an dem Schweine ab, und während er in Hitze nachdruckte,
fuhr der Speer dem auf dem Boden liegenden Grafen tief in den Leib hinein
. Raimund zog ihn zwar gleich wieder heraus, verfolgte das Schwein
und fällete es auch: bis er aber zurückkehrte, fand er den Grafen schon in

seinem Blute schwimmend und tot. Mit höchster Betrübnis floh er von
dem Orte und machte sich auf weitere Flucht gefaßt.
So hatte Raimund ohne Vorsatz seinen allerbesten Freund, den Beförderer
seines Glückes, ums Leben gebracht. Er wehklagte, rang die Hände,
kehrte die Augen gen Himmel, welche nicht anders flossen als wie zwei
Tränenquellen, ritt jedoch mittlerweile allgemach fort und führte mit sich
selbst ein her leidiges Jammergespräch. Bald klagte er über die Mißgunst
seines widrigen Geschickes, bald über den unseligen Stoß seines Speeres;
bald verfluchte er die Stunde, darin er zu seinem Herrn gebracht worden,
und bald hub er an, über seine unglückschwangere Geburtsstunde zu klagen.
Solche Gedanken halfen ihm seine Betrübnis noch mehr vergrößern.
"Du unbarmherziges Glück", seufzte er, "hast du denn alle Herzensplagen
auf einmal über mich ausgeschüttet? Warum habe ich doch alle meine
Hoffnung so ganz auf dich vielmehr als auf den gütigen Himmel selbst
gesetzt? Du Betrügerin aller Menschen, du reichest für ein Quentchen
Wohlfahrt und ergötzlicher Freude, damit du uns alberne Jünglinge
köderst, einen ganzen Zentner Herzeleid hernach; du lässest uns nach dem
Schatten der Reichtümer und der eiteln Wollust schnappen und hernach
das Wesen unsers Wohlstandes selbst verlieren! Nun hast du mich zu
einem armen Bettler gemacht, der gedachte, ein begüterter, reicher Herr
zu werden! Dem, der mir sein Herz gegeben, habe ich sein Leben und mir
selbst alle Hoffnung und zugleich die Freudigkeit meines Gewissens genommen.
Ach Vetter, lieber Vetter! Warum hast du so oft die Hände
deines Mörders geküßt? Warum durfte ich nicht vor dir sterbens Nun
wird mich die Rache und der Argwohn aller Leute verfolgen! Alle Bäume
im Walde werden mich anfeinden und ihre Aste von mir abkehren, die Luft
wird mich nicht mehr anhauchen, die Sonne ihr fröhliches Licht mir mißgönnen
, und nimmer werde ich solche Tat an meinem Wohltäter dem
gerechten Himmel abbitten können."
***Mit solchen und vielen andern Klagen ließ er sein Pferd gehen, wohin
es selbst wollte und ihn das Verhängnis führen würde. So kam er zu
einem Brunnen, der Durstbrunnen genannt. Bei diesem standen drei
Jungfrauen von überaus schöner Gestalt, die er vor Leid und Jammer
ganz übersehen hatte. Von diesen trat die schönste und jüngste zu ihm an
den Weg hervor und sprach: "Mein Freund, Ihr seid ziemlich unbescheiden
für einen Ritter, daß Ihr den Frauen keine Höflichkeit zu erzeigen
wisset, sondern ohne Gruß und Anrede vorbeireitet!" Raimund antwortete
hierauf gar nicht und trieb seine Klage fort wie vorher, bis die
Jungfrau endlich das Pferd beim Zügel ergriff und zu ihm sprach: "Fürwahr
, Ihr wisset nicht; was Euer Stand erfordert; wenn Ihr, so stillschweigend
vorüberzueilen, gedenket."
Da nun Raimund die wunderschönen Nymphen mehr ins Auge faßte,
erschrak er und wußte nicht, ob er lebendig oder tot sei, oder ob ein Gespenst
mit ihm rede. Indem nun die Nymphe Melusina — denn so hieß
die Jüngste von ihnen, die sein Pferd hielt —bemerkte, daß er wie von
einem tödlichen Gesicht überrascht und aus Schrecken ganz verfärbt und
gar erblaßt war, fing sie an, ihn noch mehr zu versuchen, und beschuldigte
ihn noch heftiger großer Unfreundlichkeit, weil er nicht mit ihr redete.
Dem Raimund aber, obwohl er noch voll betrübter Gedanken war, fiel
die unvergleichliche Schönheit der Nymphe immer mehr und mehr ins
Angesicht; und die Augen begannen ihm bereits recht aufzugehen. Er
sprang daher schnell vom Pferde zur Erde und sprach: "Ach, erhabene
Göttin, ich bitte in tiefster Demut, daß Eure Wohlgewogenheit mir meinen
Fehler vergessen und Eure holden Blicke deswegen nicht entziehen
wolle. Ich bin ohnedem in solcher Betrübnis wie in einem Labyrinthe
verfangen, daß ich nicht weiß, wie ich mich aus demselben herauswinden
soll. Deswegen war ich mit sehenden Augen blind, dazu von solcher
Schönheit entzückt und entgeistet und zugleich von meinem innerlichen
Unmute ganz betäubt. Damit ich aber auch wegen meiner Unhöflichkeit
Buße tun und die schuldige Strafe dafür erleiden möge, so befehlet Eurem
Diener, Allerschönste, was er zu vollbringen hat, daß er Ihrer holden
Blicke wiedergenieße!" — "Nicht also, mein Raimund", hub die holdselige
Nymphe an, "stehet zuvor von der Erde auf: ein so edler Ritter hat
nicht Ursache, so gebogen auf derselben zu liegen! Die Reue über einen
so kleinen Fehler und die Ursache desselben ist schon Strafe genug! Wir
sind Euch alle insgesamt gewogen, tapferer Gallier!" Raimund, solches
hörend und, daß sie seinen Namen nannte, erstaunte noch mehr; denn er
wußte nicht, wie dieses zuging. "Göttergleiche Jungfrau", sprach er",nun
merke ich recht, daß Ihr von dem gütigen Himmel abgeschickt seid, mich
aus meiner Unruhe zu erlösen und aufs neue zu erquicken. Denn kein
Mensch ist in der Gegend, der meinen Namen weiß, und auch der Eurige
ist mir unbekannt; auch halte ich Euch viel mehr für ein Engelsbild in
menschlicher Gestalt als für einen natürlichen Menschen. Könnt Ihr deswegen
, schöner Engel, dieses Gemüt mit einigem Trost erfrischen, so wie
ich von Eurer Lieblichkeit schon einige Erquickung spüre, oh, so fahret fart,
meine halberstorbenen Kräfte durch solche Anmut neu zu beseelen und
Euren Diener glückselig zu machen."
"Stillet Euren Kummer, betrübter Raimund!" — fing die liebliche
Nymphe wieder an —"lasset Euer liebes Herz solchen Unfall nicht allzusehr
kränken: ich kenne Eure Not und Klage; wollet Ihr aber meiner
Lehre folgen, so will ich dafür sorgen, daß Eure Wohlfahrt wieder neu
grüne und Ihr an Gut, Ehre und Glück nimmermehr Mangel leidet!
Lieber Raimund, alles, was Euch Euer Vetter aus dem Stand der Sterne
geweissaget hat, das muß durch die Gnade des Himmels an Euch vollbracht
werden, der alle Dinge leitet." Als nun Raimund hörte, daß sie
von der Gnade Gottes sprach, gewann er allgemach wieder neuen Trost in
seinem bekümmerten Hergen, daß die Nymphe doch kein Gespenst und
keine ungläubige Heidin war, sondern von christlichem Stamme sein
mußte. Er sprach demnach zu ihr: "Schönste Gebieterin! Ich werde mit
aufmerksamem Ohr und gehorsamem Herzen Euren getreuen Beirat anhören,
und mein ganzes Gemüt soll Eurem Willen demütig unterworfen
sein: nur lasset mich zuvor Eure Neigung und Euer Wohlwollen verspüren
dadurch, daß Ihr mir eröffnet, woher Ihr meinen Namen und
das unselige Ereignis kennet, damit ich, aus allem Zweifel gehoben, die
mildselige Schickung des Himmels um so mehr zu erkennen und zu loben,
Ursache habe, da sich derselbe zu meinem Troste eines so wunderbaren
Werkzeuges bedienen wollte."
Hierauf begegnete die Nymphe ihm aufs neue mit tröstlichem Zuspruch:
"Zweifle nicht, lieber Raimund", sprach sie, "daß ich dein Glück und deine
Ehre erneuern werde; frage nicht mehr so inständig nach meinem Wissen,
und woher mir dein Name bekannt sei, sondern glaube vielmehr, daß der
Himmel es also füget. Sieh mich demnach für kein verstelltes Engelsbild,
sondern vielmehr für eine gute Christin an; was ich bin, bin ich durch die
Gnade des Himmels; ich glaube alles, was einem Christen zu glauben zusteht:
daß ein Wunderkind von einer keuschen Jungfrau geboren worden
und der Sohn Gottes genannt wird, daß er in der Zeitlichkeit für alle
Menschen gelitten, als Gott und Mensch wahrhaftig auferstanden und
wieder gen Himmel gefahren sei. Dies alles weiß und glaube ich. So
verbanne denn allen Kleinmut und alle Traurigkeit aus deiner geängsteten
Brust und gib nicht zu, daß ferner ein Zweifel dein Gemüt besitze.
Betrachte das Glück, das bereits vor deinen Augen schwebt!"
Durch solchen Zuspruch fingen die muntern Lebensgeister dem guten
Raimund wieder aufzusteigen an, und der lebhafte Purpur seines Gesichtes
schimmerte aufs neue durch seine Wangen. "Schönste, liebenswürdigste
Nymphe", sprach er laut, "alle meine Kräfte, all mein Wollen soll nach
Euren Befehlen wie der Schatten nach der Sonne gerichtet sein. Ich vergehe
fast vor Verlangen, den Inhalt meines Glückes von Euren klugen
Lippen anzuhören. Wenn Ihr mir denselben nicht bald eröffnet, so sterbe
ich!" "Wohl denn, begieriger Raimund, so höret", sprach sie, "was
Euch zu leisten obliegt; wenn Ihr Eures Glückes teilhaftig werden wollt.
Ich verlange ernstlich, daß Ihr mir beim Himmel schwöret und bei dem
Heiligsten, das er enthält, daß Ihr mich zu Eurer ehelichen Gemahlin erkieset
An jedem Sonnabend sollt Ihr mich in Ruhe lassen und nichts von
mir zu fragen begehren, mir auch an selbigem Tage nichts befehlen; ja,
ganz und gar nicht mit mir reden, mich nicht sehen, auch nicht durch jemand
anders sehen lassen, sondern mich gänzlich in Ruhe lassen, so daß
ich den ganzen Sonnabend frei und unbekümmert bleiben mag. Dagegen
gelobe ich Euch hinwider, daß ich die ganze Zeit meines Lebens, besonders
aber am gedachten Tage nirgends hingehen will, wo es Euch nicht lieb

und angenehm wäre, sondern mich an demselben in meinem Frauengemache
ganz stille, züchtig und verschlossen halten werde."
Alles das gelobte und schwur sofort Raimund, ihr getreu und unverbrüchlich
zu halten. Der Nymphe kam inzwischen sein leichtsinniges Erbieten
und sein schneller Eid noch ziemlich verdächtig vor; denn sie glaubte,
er verspreche mehr, als er halten würde; doch gab sie ihm dies nur ganz
gelinde zu verstehen: "Ihr leistet zwar", sprach sie, "meinem Willen vergnüglichen
Gehorsam, wiewohl Ihr noch nicht alles vernommen. Gleichwohl
sehe ich aus Euren Mienen, daß Ihr mehr gelobet, als Ihr zu halten
gedenket; sollte es aber je geschehen, daß Ihr mir untreu würdet, davor
Euch der Himmel behüte, so wisset, daß Ihr selbst der einzige Urheber
wäret, der einzige Schlüssel, welcher die Türe zu seinem Unglück eröffnet;
denn nicht nur würdet Ihr mich unfehlbar von Stund an verlieren und
nimmermehr zu Gesichte bekommen, sondern auch Euch und Euren Erben
schaden und Unglück bis auf Kindeskinder zuziehen."
Als Raimund solches vernahm, schwur er ihr vermessentlich noch einmal
und wollte nicht für den angesehen sein, den sie in ihm argwöhnte. "Wohlan",
versetzte die Nymphe, "ich nehme die gute Meinung an, die Ihr mir
von Euch machen wollt. Reiset hin, mein Geliebter, nach Poitiers, der
Himmel begleite Euch mit seinem Schutze! Wenn Euch aber jemand fragt,
wo Euer Vetter, der Graf, hingekommen, so antwortet nicht anders, als
daß Ihr ihn im Wald verloren und er vielleicht irregeritten sei, wie denn
auch seine andern Diener sagen und Euch beistimmen werden. Dann
werden sie ihn eiligst suchen und endlich auch finden und mit großer
Klage nach Poitiers bringen; der Himmel weiß, mit welcher Betrübnis
ihn die Gräfin, seine Gemahlin, mit ihren Kindern samt allen Untertanen
beweinen wird. Diese alle sollt Ihr dann trösten und ihren Kummer mildern
helfen, dann wird ihre Neigung und ihr Dank wie ein reicher Strom
auf Euch wallen, und jedes wird Euch anstatt des toten Grafen Emmerich
zu seinem Herrn wünschen. Nach seiner Beerdigung werden sich seine
Verwandten und die Edeln des Landes einfinden, um von seinem Sohne
als ihrem jetzigen Herrn die Lehen zu empfangen. Dann sollt Ihr Euch
auch in Demut melden und bitten, daß er Euch für Eure treu geleisteten
Dienste ein Stück Landes bei dem Durstbrunnen schenken wolle, wäre es
auch nur soviel Land und Wald, als Ihr mit einer Hirschhaut umschließen
könnet. Diese ehrerbietige Bitte wird des Grafen Herz dermaßen bewegen,
daß er sie Euch gewähren wird." Dann sagte die Listige weiter voll Freuden:
"Eilet, mein teuerster Raimund, und säumet nicht, Brief und Siegel
darüber zu bekommen, welche von des Grafen Hand unterzeichnet sein
müssen, und trachtet ja, daß selbige schleunig ausgefertigt werden, des
Inhalts, was die Gabe sei, wann und warum sie Euch verliehen sei, samt
dem Jahr und Tage, an dem das alles geschehen und vollzogen ward.
Nach allem dem wird Euch ein Mann begegnen, der eine Hirschhaut zu
Hause trägt. Diesem handelt sie ab ohne vieles Wortemachen, lasset sie
zerschneiden zu einem schmalen Niemen, so dünn er nur sein mag, jedoch
an einem Stücke, bis die ganze Haut aufgebraucht ist. Alsdann gehet hin
und lasset Euch das Versprechen vollziehen und fanget von dem Brunnen
an. Solches wird Euch eine ganze Tagreise Landes im Umkreise bis wieder
an die Stelle verschaffen, von welcher Ihr ausgegangen seid, und
niemand wird Euch dies streitig machen können."
So entließ die schlaue Nymphe ihren Liebling mit listigem Rat und
hieß ihn in des Himmels Geleite gehen.
***Raimund hatte nun mit tausend Küssen von seiner liebsten Melusina
zärtlichen Abschied genommen. Er ritt Poitiers zu und gedachte auszuführen,
was sie ihm zu tun geraten hatte. Auch handelte er ganz nach ihrem
Sinne und kam am frühen Morgen in der Stadt an. Während er hereinging
fragte ein Mann: "Wie kommt es, Raimund, daß Ihr so ohne
Euren Herrn erscheinet?" Raimund antwortete: "Ich habe ihn wahrhaftig
seit verwichenen Abend nicht gesehen; denn er entritt mir im Wald
dem Gejage nach, so daß ich ihn nicht ereilen konnte. Ich habe ihn dann
verloren und bin später seiner nicht mehr ansichtig geworden." Bei dieser
Verantwortung ließen sie es bleiben, und niemand war da, der an ein
Unglück dachte oder etwas Widriges geargwohnt hätte. Raimund aber
wußte nach der klugen Art, die ihm seine Geliebte angeraten hatte, alles
auf das beste zu verbergen; nur seufzete er zuweilen bei sich, durfte es
jedoch nicht merken lassen.
Inzwischen kamen alle Diener des Grafen von dem Jagen einer um
den andern nach Hause geritten bis auf zwei, welche noch aus waren.
Ihrer keiner aber wußte zu sagen, an welchem Orte ihr Herr sich von
ihnen verloren, und wo sie ihn am vorigen Abend zuletzt gesehen hätten.
Dies verursachte bei Hof ein großes Klagen, besonders bei der Gräfin
und ihren Kindern. Als sie nun im uutesten Jammer begriffen waren,
da kamen auch die zwei letzten Diener aus dem Gefolge herbeigeeilt und
brachten ihren Herrn, den Grafen, tot mit sich, was sehr kläglich anzuschauen
war und das Weinen aller Anwesenden noch vermehrte. ?luch
dem unwuldigen Täter Raimund wurden die Augen gang naß, und das
Herz klopfte ihm heimlich mit schnellen Schlägen. Die Diener erzählten,
wie sie den Grafen in seinem Blute ganz blaß und entseelt bei dem wilden
Schwein auf der Erde liegend gefunden; da sah man im ganzen
Schlosse nichts als verzweifeltes Händeringen, besonders von seiten der
vaterlosen Kinder und der Witwe. Ihre Augen ergossen gange Ströme
von Tränenbächen, und ihre Gestalten sahen Leichen nicht unähnlich.
Dennoch eilte man, damit der endlosen Klage in etwas gesteuert würde
und der Leichnam ihnen aus dem Gesichte käme, gleich des folgenden
Tages zum Begräbnis, das unter großer Trauer, jedoch in schönster Ordnung
angestellt ward. Raimund, welcher nicht der am wenigsten Betrübte
war und auf das heftigste mitklagte, wurde wegen seiner treu
geleisteten Dienste von allen Anwesenden höchlich gelobt; besonders daß er
nach seines Herrn Tode ihm noch die letzte Ehre mit vielen Tränen erweisen
wollte. Dies alles aber hatte er niemand anders zu danken als
seiner geliebten Melusina, die er bei dem Durstbrunnen angetroffen.
Als Graf Emmerich auf diese Weise bestattet war, fanden sich die
Edeln des Landes alle bei seinem Sohne, Grafen Bertram, ein und empfingen
von ihm ihre Lehen, wie dies bei einem neuen Herrn zu geschehen
pflegt. Da trat auch Raimund hervor und brachte seine Bitte vor, wie er
von Melusina unterrichtet war. Der Graf aber ließ sich diese demütige
Bitte von Raimund wohlgefallen und versprach ihm auf der Stelle, solches
zu gewähren; auch alle Räte desselben gaben einmütig ihre Zustimmung.
Nach dieser allseitigen Einwilligung bat Raimund um die Ausfertigung
eines versiegelten Lehensbriefes, von des Grafen Hand unterzeichnet
der ihm sofort ohne Widerspruch gewährt und eingehändigt
wurde.
Kaum hatte Raimund den gesiegelten und unterschriebenen Brief empfangen,
so fügte sich zu seinem Glücke die erwünschte Gelegenheit, daß
ein Mann eine schöne gegerbte Hirschhaut feiltrug, die er denn unverzüglich
ankaufte und in ganz schmale und dünne Riemen zerschneiden ließ,
soviel man immer daraus machen konnte. Nachdem auch dieses geschehen
war, meldete er sich abermals bei dem Grafen und stellte die fernere geduldige
Bitte, daß man ihm dasjenige Stücklein Lands, das er um die
Gegend des Durstbrunnens auserlesen würde, als Lehen übergeben wollte.
Der Graf bestellte sofort einige Amtleute und Räte, die mit Raimund
nach dem Brunnen ritten. Da fanden sie, daß Raimund eine Hirschhaut
zu den allerschmalsten Riemen zerschnitten hatte, und verwunderten sich
höchlich über die List. Sie wußten nicht, was sie in diesem Falle zu tun
hätten; denn sie dachten wohl, daß die lederne Schnur ein gut Teil Feld,
Wald und Felsen umspannen würde, wie dies auch in der Tat sich zeigte.
Auch erschienen von Stund an zwei hierzu bestellte unbekannte Männer;
welche die zerschnittene Hirschhaut nahmen und sie beim Anfang des Riemens
an einen Pfahl banden. Sie umspannten so ein großes Stück Landes
von dem Durstbrunnen an bis wieder zu demselben, und in diesem
großen Umkreise fand sich eingeschlossen, was man nur wünschen mochte;
insonderheit floß ein schönes, reichliches Wasser durch das umfangene
Land. Die Amtleute selbst konnten dem Raimund über die Klugheit seines
Anschlages, von dem sie nicht wußten, woher er ihm kam, ihr Lob nicht
versagen. Obgleich sie gestanden, daß sie es mit der Hirschhaut ganz anders
gemeint hätten, ließen sie es doch, weil der Graf sein Wort einmal
gegeben hatte, bei der Schenkung bewenden, kehrten um und ritten auf
einen Ort zu, der die Kartause genannt war und nicht ferne von dem
Brunnen lag. Von dannen reisten sie weiter und nach Poitiers zurück.
Hier erzählten sie ihrem Herrn, dem jungen Grafen, alles, was sich begeben
. Als dieser die seltsame Begebenheit vernommen, konnte er sich
nicht genugsam verwundern; doch mußte er es auch geschehen lassen, zumal
er sich einbildete, es müßte bei diesem Brunnen gespenstisch und geisterhaft
zugehen, weil es dort der Abenteuer schon mehrere gegeben habe; woraus
er schloß, daß auch dem Raimund dort etwas Wunderbares zugestoßen sei.
Doch gönnte er ihm als seinem lieben Vetter und Freund, der sich auch
um seinen Vater wohl verdient gemacht hatte, alles Gute mit dem
Wunsch, daß es ihm dabei glücklich ergehen und kein ferneres Ubel daraus
entstehen möchte. So treumeinend ist die heutige Welt nicht gesinnt.
Mittlerweile hatte sich auch Raimund selbst bei Hofe mit gar fröhlicher
Miene eingestellt; er dankte seinem Vetter, dem Grafen, aufs höflichste
für seine Gnade, wodurch die Verwunderung und Bestürzung aller Anwesenden
nur noch vermehrt wurden, wenn sie bedachten, daß Graf
Bertram so gütig und Raimund so kühn sein könnte. Raimund aber hatte
seinem Herrn und Vetter mitten im höchsten Leidwesen anstatt einer ungnädigen
Miene ein verwundertes Lachen abgewonnen, weil er sich mit
seiner listigen Tat so wohl geholfen.
Jener, nachdem ihm sein Hofritt besser ausgeschlagen, als jemand geglaubt
hätte, setzte sich nun wieder auf sein Roß und ritt mit frühem Morgen
dem Durstbrunnen zu. Hier traf er seine liebe Verlobte, die unvergleichlich
schöne Melusina, welche seiner Ankunft mit höchstem Verlangen
gewartet Hatte und ihn auf das allerherzfreundlichste mit tausend holden
Blicken und Grüßen bewillkommte. "Seid mir gegrüßt", rief sie, "mein
Beherrscher, mein liebster Raimund! Ihr habt aufs weislichste vollzogen,
was Euch zu tun oblag; dafür statte ich Euch als meinem einzigen Geliebten
auf Erden den innigsten Dank ab. Folget mir nun und lasset uns
dem gütigen Himmel für das gnädige Gedeihen unsers Vornehmens demütigsten
Dank sagen!"Mit diesen Worten faßte sie ihn bei der Hand und
führte ihn zu einer abgelegenen Waldkapelle. Als sie in diese eingetreten,
erblickte Raimund einen Haufen des schönsten Volkes, Ritter und Bürgersleute
, Frauen und Jungfrauen, Alte und Junge, auch Priester, die alle
ihren Gottesdienst verrichteten. Er wußte nicht, ob er unter Menschen oder
Geistern sich befinde; denn nachdem er sich lange umgesehen, hatte er auch
nicht einen einzigen bekannten Menschen entdeckt, den er irgend anderswo
gesehen hätte. So, in der höchsten Verwunderung, fragte er seine Geliebte
und sprach: "Mein Kind, was für ein mir unbekanntes Volk ist
dieses? Wes sind die Leute, die ich also geschmückt vor mir sehe?" —
"Wundert Euch nicht, mein Geliebter", versetzte die Schöne, "es sind
lauter Leute, denen Ihr zu gebieten habt, und die Euch künftig ihren
Herrn heißen sollen, kurz, mein Volk und meine Untertanen sind es!"
Und nun wandte sie sich zu dem Volk und gebot ihnen allen mit vernehmlicher
Stimme, daß sie ihrem Geliebten Raimund hinfort gehorsam und
untertan sein sollten als ihrem rechtmäßigen Herrn und Gebieter. Alle
verneigten sich tief und gaben ihre Untertänigkeit sogleich zu erkennen;
aller Augen waren ehrfurchtsvoll auf Raimund gerichtet, solange der
Gottesdienst währte.
Da Raimund solches alles nicht ohne Staunen und Schrecken ansah,
mußte er den seltenen Gehorsam heimlich, aber mit Zittern und Entsetzen,
bewundern, schwieg jedoch ganz still und wußte nicht, was er hier denken
oder sagen sollte. Melusina merkte, daß er in schweren Gedanken begriffen
sei, und hub daher an, ihm mit leisem Zusprüche zu begegnen: "Lieber
Raimund, entsetzet Euch nicht ob dem, was Euch so seltsam und fremd
vorkommt. Es ist ganz kein Zweifel, daß Ihr mein eigentliches Wesen noch
nicht vollständig erkennen vermöget; es wird Euch aber nicht eher möglich
werden, als bis Ihr mich zum ehelichen Gemahl ordentlich angenommen
habt. Ihr habt mir zwar, in allem getreu zu sein und in der Ehe mit
mir zu leben, gelobt und geschworen; aber vollzogen ist unsere priesterliche
Einsegnung noch nicht; ohne diese aber wird Euch die völlige Erkenntnis
meiner Person immer fehlen."
Raimund fühlte sich durch diese Worte Melusinens wieder etwas getröstet
und sagte zu ihr: "Ich bin ja bereit, meine Schöne, jederzeit
Euren Willen zu tun." — "Es ist wahr, mein Raimund", erwiderte sie,
"und ich kann es nicht leugnen, daß Ihr mir alle Treue und Ehre erwiesen:
aber nur noch dieses eine ist not; alsdann werdet Ihr aller Glückseligkeit
vollkommen genießen. Ihr müsset eine förmliche Hochzeit anstellen,
ansehnliche Gäste dazu einladen, die Trauung vollziehen lassen,
das Mahl abhalten und jeden Anwesenden fröhlich machen. Alsdann wird
es eine ganz andere Gestalt mit unsrer Liebe gewinnen; dies muß aber,
wenn Ihr anders glückselig sein wollt, ehester acht Tage, und zwar mit
dem frühen Morgen geschehen."
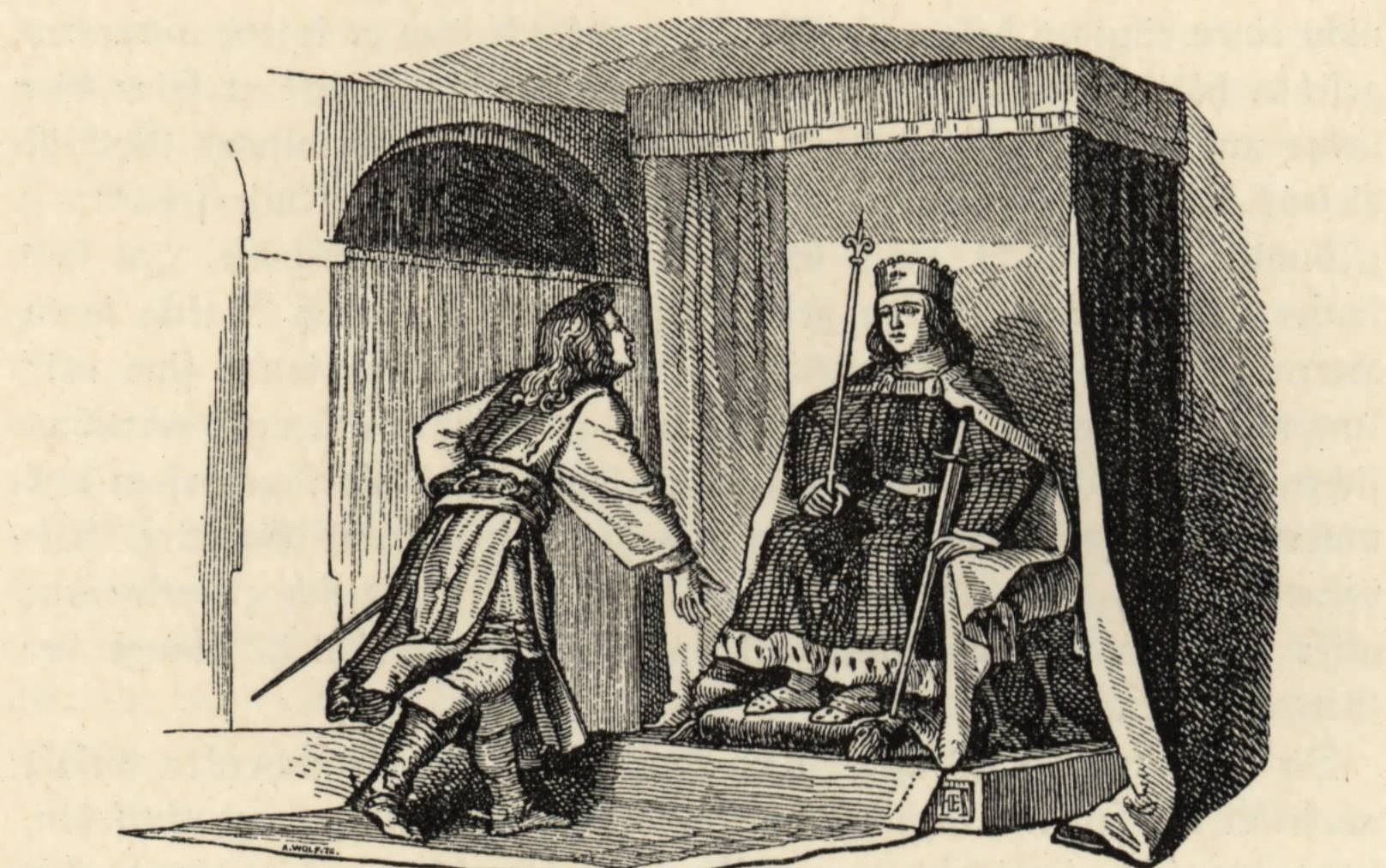
Raimund bewilligte Melusinen all ihr Begehren, damit er doch einmal
den rechten Grund dessen, was ihm noch unbekannt war, bald erfahren
möchte. Er schwang sich abermals ungesäumt und mit höchster Begierde
auf sein mutiges Roß und begab sich wieder nach Poitiers zu seinem Herrn
Vetter. Jedermann besann sich, was diese baldige Rückkehr Raimunds an
den Hof wohl bedeuten möge. Dieser wurde aber bald vorgelassen, und
der Graf war begierig, sein Anliegen zu vernehmen. Siehe, da war er
sein eigener Hochzeitbitter selbst und brachte seine Bitte mit folgender
höflicher Rede vor: "Gnädiger Herr Vetter, geruhet, nicht unwillig dar
über zu sein, daß ich mich so bald und unverhofft wieder bei Hofe einfinde,
Euch aus besonderer Zuneigung etwas Neues zu entdecken; denn
ich halte es für Schuldigkeit, Euch alle meine Heimlichkeiten zu offenbaren.
Wisset denn, ich bin ein Bräutigam und komme deswegen her, Euch und
Eure geliebte Frau Mutter ehrerbietig zu meinem Hochzeitfeste einzuladen
, das bei dem Euch wohlbekannten Durstbrunnen begangen werden
soll. Wofern ich nun die Ehre von eurer beider Gegenwart nächstkünftigen
Montag früh genießen könnte, so würde ich und meine Liebste solches für
ein ganz besonderes Glück halten und in steter Dankbarkeit niemals vergessen
."
Diese höfliche Einladung hatte Raimund kaum ausgesprochen, als der
Graf höchst neugierig die Frage fallen ließ, wer denn wohl seine Liebste
sei. "Sie ist eine edle, reiche und mächtige Dame", versetzte Raimund,
"deren Herkunft ich übrigens selbst noch nicht eigentlich weiß und auch
nicht eher als bis nach der Trauung erfahren werde." Graf Bertram
konnte sich der Verwunderung und des Lachens kaum enthalten. Doch gab
er ihm diesen höflichen Bescheid: "Liebster Vetter, wir vernehmen mit
größtem Vergnügen und Wohlgefallen Euer Glück und sind entschlossen,
auf Euer freundliches Ersuchen an Eurem Hochzeitfeste, wozu der Himmel
sein Gedeihen geben wolle, uns einzufinden; aber sehet zu, ob Euch diese
Heirat nicht übel ausschlage. Denn wenn Eure Liebste vielleicht von unedlem
Geschlechte geboren wäre, so könnte sie Eurer edlen Herkunft einen
Schandfleck anhängen." Raimund antwortete sogleich: "Edler Vetter,
obschon ich meiner Geliebten Abkunft selbst noch nicht eigentlich weiß, so
bin ich doch dessen gewiß versichert, daß sie meinem Stande gleich, wo
nicht gar überlegen sei, und verlange daher nichts mehreres, als daß Ihr
sie mit ihren vortrefflichen Eigenschaften persönlich kennen lernen möget."
— "ES sei so, wie wir Euch schon vorhin versprochen, geliebter Vetter!"
antwortete der Graf noch einmal lächelnd; "wir werden gewiß kommen
und die unbekannte Braut einsehen, ob Ihr Euch auch etwas Schönes
ausgelesen!" — "Zweifelt daran nicht, Vetter", versetzte Raimund, "ihre
Schönheit und Sitten lassen sie wie eine Königin erscheinen; wohl möchte
sie auch vielleicht eines Herzogs oder Markgrafen Tochter sein!" — "Der
Himmel bestätige Euren Glauben, daß Ihr nicht betrogen seid!" sprach
der Graf, "das Verlangen, diese Göttin zu sehen, macht uns die Zeit recht
lang!"
So schied Raimund mit der Zusage des Grafen und höflichem Danke;
er ritt davon und zu seiner Geliebten. Der gewünschte Montag kam herbei,
und mit dem frühesten Morgen machte sich Graf Bertram samt seiner
verwitweten Mutter und allem Hofgesinde von Poitiers auf, ihrem Versprechen
nachzukommen und seines Vetters Ehrenfest mitbegehen zu helfen.
Unterwegs hatten sie immer die kurzweilige Sorge, daß bei dem verrufenen
Durstbrunnen ein gespenstisches Gaukelspiel und Blendwerk vorgehen
könnte, worüber sie dann genug lachen und den Bräutigam zu
necken nicht vergessen wollten. Nun ging die Reise dem Walde zu nach
Colombiers, und von da gegen den Felsen, welcher auf einer Höhe gelegen
war. Kaum aber waren sie bei jenem Felsgestein angelangt, da erblickten
sie schon in dem Grunde auf einer schönen, grünen, lustigen Ebene
verschiedene anmutige Bäume und zwischen ihnen eine Menge trefflicher
Zelte aufgepflanzt; aus denen hier und dort ein Rauch aufstieg, woran
zu erkennen war, daß daselbst ein Sieden und Braten vor sich ging. Auch
wurden sie sehr viel Volks ansichtig, lauter unbekannte Leute, die um die
Zelte herumwandelten. Dies bestätigte sie in der Meinung, daß das alles
nichts anders sein könne als eine Gespenstererscheinung, besonders auf
einer solchen Einöde, wo sonst kein Mensch anzutreffen war.
In diesen Gedanken wurden sie durch die Ankunft einer Menge von jungen
Rittern und Edelleuten unterbrochen, die bei sechzig Menschen, alle
landfremd, aber in schönstem Schmucke und auf das beste bewaffnet, daherritten.
Diese empfingen den Grafen, seine Mutter und alles, was bei
ihnen war, auf das allerhöflichste im Namen ihres Herrn Raimund und
begleiteten sie in zierlichern Auftritte bis vor die Gezelte. Diese gar artige
Aufnahme, die sorgfältige Verteilung der Gäste in die Gezelte und die
treffliche Herberge machten den Grafen Bertram nicht wenig bestürzt und
brachten ihn auf ganz andere Gedanken, als die er sich eingebildet hatte.
Nicht nur schön und kostbar waren die Zelte und an einem lieblichen Platz
aufgeschlagen, sondern selbst die Krippen für die Pferde waren so schön
eingerichtet, daß es den lustigsten Anblick gewährte. Auch hatten sich die
fremden Gäste kaum in den Gezlten niedergelassen, da fand sich schon
eine Anzahl schön geschmückter Frauen und Jungfrauen ein, welche im
Namen der Braut die Gräfin Mutter samt allen den Ihrigen aufs artigste
begrüßten. Alle Gemächer fanden sie mit Bequemlichkeiten und
Zieraten auf das kostbarste eingerichtet, wie man es in dieser Einöde nimmermehr
hätte erwarten sollen.
Indem kam auch Raimund mit einem Gefolge von Kavalieren daher,
den Grafen, seinen Herrn Vetter, zu bewillkommen und ihn in seine
Wohnung zu begleiten. Da es nun bereits Zeit zu der Trauung war und
in die Kirche geläutet wurde, verfügten sich alle Herrschaften, in einem
zierlichen Ring in bester Ordnung gestellt, nach der Kapelle, und es wurde
zwischen ihnen ein mit den größten Kostbarkeiten gezierter Altar aufgerichtet
. Auch die Kapelle selbst war mit Tapeten und Kleinodien auf das
prächtigste geschmückt. Die Braut endlich war so wohlgetan an Schönheit
wie an Kleiderschmuck, daß sie mehr einem Engelsbildnis als einem Menschen
zu vergleichen war. Die Gewande schimmerten und spielten von
Gold, Perlen und Edelsteinen wie der gestirnte Himmel, kurz, alles war
schön und köstlich anzuschauen.
Der Graf von Poitiers samt seinem ganzen Gefolge, sobald erin die
Kapelle hineintrat; wandte sich zu der Braut, umfing sie und beglückwünschte
sie mit aller Ehrerbietung. Melusina und ihre Jungfrauen erwiderten
diesen Gruß mit tiefer Verneigung. Nachdem nun alle in der
rechten Ordnung sich gesetzt hatten, ließ sich eine vortreffliche Musik von
allerlei lieblich klingenden Saitenstücken, Flöten und Posaunen hören, und
die Fremden hatten mit höchstem Staunen nur genug zu hören und zu
sehen, solange sie sich in der Kapelle befanden, so daß sie selbst unter sich
bekennen mußten, dergleichen Hochzeitaufzüge niemals gesehen zu haben.
Nach geendigter Messe wurde zur Trauung geschritten und die Braut in
ihrem Schmucke von zwo Jungfrauen, sowie Raimund von zween Rittern
zu dem Altar begleitet und allda beide eingesegnet. Da stand die Braut
mit Raimund unter einem köstlichen Thronhimmel. Nach verrichteter
Trauung führte sie der Graf von Poitiers und ein anderer vornehmer
Herr zur besondern Ehre dem Gezelte zu. Hier wurde das Handwasser
in goldenen Schalen herumgetragen und jedem Gaste auf die Hände gegossen
, dann setzte man sich zu Tische; die gräflichen Gäste wurden zuoberst;
nächst dem Brautpaare, in goldene Sessel gesetzt. Die köstlichsten
Gerichte wurden aufgetragen und bei allem eine Pracht angewendet; daß
es fast königlich anzusehen war.
Nachdem die Vorgerichte genossen waren, stand Raimund mit einigen
seiner vornehmsten Ritter von der Tafel auf, und indem man eben die
andern Trachten aufs herrlichste daherbrachte, fing er selbst mit ihnen an,
bei Tische zu dienen. Der Gerichte waren so viele, daß man nicht wußte;
wo man sie hinsetzen sollte; in eitel goldenen Pokalen wurden Weine von
der köstlichsten Gattung kredenzt und mit diesen so vertraulich umgegangen,
als wäre es bloßes Bier; ja, selbst Diener und Knechte hatten nichts
als edle Weine zu trinken, an denen sie sich vergnüglich abweiden konnten.
Auf die Tafel folgte ein ergötzliches Turnier. Die Ritter in herrlichem
Putz und Geschmeide stellten sich, in zwei Partien geteilt; auf den
zubereiteten Plan; der eine Haufen wollte für Melusina, der andere für
Raimund, beiden zu besondern Ehren streiten. Die Frauen im köstlichsten
Schmucke von Edelsteinen (wiewohl keine schöner und geschmückter war
als die Braut) schauten bei diesen herrlichen Ritterspielen zu. Jedermann
erwartete voll Neugier, wer siegen würde. Jedermann tat sein Bestes,
aber Raimund selbst trug das Allerbeste davon, und dies war ein ganz
herrliches Kleinod von Diamanten. Darüber wurde ihm zur großen
Freude seiner Geliebten ein munteres Lebehoch zugerufen.
Am späten Abende, nach gänzlicher Beendigung des Ehrenfestes, wurde
das Brautpaar mit vielen Fackeln und Windlichtern zu seinem Zelte begleitet
. Dieses war von lauterer Seide, mit dichten Goldstreifen und
bunten Vogelgestalten herrlich durchwirkt; das Lager und die Decken von
Seide, mit lauter goldenen Lilien gestickt, so daß der Glanz die Augen
blendete. Die Priester segneten das Paar noch einmal, und alle Hochzeitsgäste

verabschiedeten sich. Um das Zelt herum aber ertönte eine liebliche
Musik von allerlei Instrumenten wie mit halben Stimmen, so daß
die Töne noch anmutiger ins Gehör fielen. Die jungen Diener und Bursche
blieben wach während der ganzen Nacht und bezeigten sich dem getrauten
Paare zu Ehren mit Singen und Springen gar lustig. Melusina aber
sprach zu ihrem Gemahl: "Ich bin jetzt deine Hälfte, wie du die meinige
zu nennen bist. Und das laß uns bleiben, bis uns der Tod trennen wird.
Nur sei nicht lüstern, nach meiner Herkunft zu forschen oder dein Gelübde
, mich Sonnabends nicht zu sehen, an mir zu brechen, wenn du nicht
selbst der Urheber deines äußersten Verderbens sein und mich selbst von
Stund an verlieren willst." Raimund umarmte seine Gemahlin und
schwur ihr alles, wie er es schon zweimal gelobt hatte, auch zum dritten
Male. Dann kehrte der stille Schlafgott bei ihnen ein und schloß unter der
Bedachung des Augenlides die kristallenen Fenster ihres Angesichts.
***Am andern Morgen sammelten sich die Gäste wieder, und sie empfingen
von allen den freundlichsten Gruß. Darauf ging die Fröhlichkeit wieder
an, und so währten die Hochzeitfreuden fünfzehn Tage lang. Zuletzt kam
auch der Abschiedstag herbei, an welchem sämtliche Gäste aufbrachen.
Anstatt aber, daß sie für die genossene Ehre die Braut beschenken sollten,
siehe, da eröffnete Melusina einen mit Elfenbein ausgelegten großen
Schrein, in welchem die allerkostbarsten Kleinodien von Gold, Perlen und
Edelsteinen in unzählbarer Menge verwahrt waren, die man zuvor nie gesehen
hatte. Damit beschenkte sie die meisten ihrer Gäste, vor allen den
Grafen, seine Mutter und ihre Hoffrauen. Darüber brach ihrer aller Bewunderung
immer mehr und mehr aus. Welch ein wunderglückseliger
Herr doch Raimund sein müsse, dachten sie, daß er eine so gute Heirat
getroffen habe. Hierauf verabschiedeten sich die Gäste mit dem höflichsten
Danke, besonders von der schönen Melusina, und diese mit Raimund tat
ein gleiches. Zwar hätte Graf Bertram gar gerne gefragt, welchen Ursprungs
die junge Frau doch sei, weil er sie immer noch nicht für etwas
recht Natürliches halten wollte. Allein er fürchtete den Zorn, in welchen
Raimund über solchen Verdacht geraten könnte; deswegen unterließ er es,
und so schieden alle in Liebe voneinander, jedoch ohne daß die aus Poitiers
wußten, bei wem sie gewesen und woher Raimunds reiche Staut wäre.
Von Raimund und seinen Rittern wurden sie bis vor den Saum des
Waldes begleitet. Dann ritt dieser wieder zurück und erzählte seiner Gemahlin
vom letzten Abschiede. Diese empfing ihn mit tausend Küssen und
vertröstete ihren Geliebten, weil nun diese Unruhe vorbei wäre, wollte sie
nächstens einen denkwürdigen Bau und durch diesen ihres Gemahles Gedächtnis
susten, was Raimund sich ganz wohl gefallen ließ.
Acht Tage waren verflossen, da kamen eine Menge Werkleute von allerlei
Handwerken bei dem Durstbrunnen an, die fällten alles Holz ringsumher,
soviel innerhalb des Hirschriemens begriffen war, und schlugen es
zu kleinen Trümmern mit Ausnahme dessen, was zum Bauholze nützlich
schien. Dann machten sie gar tiefe Gräben um die hohen Felsen herum;
auch bezahlte sie Melusina alle Tage mit barem Gelde, daher sie
ihr Werk um so williger vollbrachten. Sie legten ein tiefes und starkes
Fundament und setzten die ersten Grundsteine auf den harten Fels. Durch
solchen Fleiß hatten sie in kurzer Zeit großmächtige Türme und dabei eine
über die Maßen hohe und dicke Ringmauer gesetzt. Innerhalb derselben
bauten sie zwei gute und starke Schlösser. Um das unterste machte man
einen hohen Zwinger, welcher sehr fest war.
Als nun die Leute des Landes ein so unsäglich großes und starkes Werk
in so gar kurzer Zeit aufgeführt sahen, konnten sie sich nicht genug darüber
verwundern. Und weil das Schloß zu aller Gegenwehr hinlänglich gerüstet
war, so nannte es Melusina nach ihrem Taufnamen und sprach: "Lus
inta soll dies Schloß heißen und hoffentlich ewig diesen Namen führen."
Nun fügte sich's, daß Melusina mit der Zeit eines jungen Herrleins genas,
gar eines muntern Söhnleins, den nannte sie Uriens, und er kam in
der Folge zu großen Ehren. Doch war er keineswegs schön von Angesicht,
sondern hatte eine seltsame Gestalt; er war gar kurz und breit, flach unter
den Augen, überdies war das eine Auge rot, das andere grün; er
hatte dabei einen weiten Mund und lang hängende Ohren; aber an Armen,
Beinen und allen andern Gliedern war er sonst gerade und wohlgewachsen
, auch zierlicher Gebärden.
Hierauf ließ Melusina das gange Schloß einrichten. Die Gänge, die
Erker, alles wurde unter Dach gebracht. Dann ward es mit Leuten und
Kriegszeug also besetzt, daß es schwer zu gewinnen oder zu stürmen war.
Die Gräben waren ungeheuer tief, Mauern und Türme sehr hoch und
stark; die Tore waren mit mächtigen Riegeln und einem starken Schloßturm
versehen. Daneben ließ sie heidnische Türmer dareinlegen, die des
Schlosses Tagwächter waren und die ankommenden Fremden mit einer
bestimmten Losung verkündigen mußten.
Noch dasselbe Jahr gebar Melusina einen zweiten Sohn, der Gedes
genannt wurde und eine so brennende Röte unter seinem Angesicht hatte,
daß sie gleichsam einen Widerschein gab, sonst aber war er ganz schön
und von wohlgestaltem Leibe. Darnach baute sie wieder ein Schloß, das
sie Favent nannte, und den Turm Mervent. Dann erbaute sie der Mutter
Gottes zu Ehren ein schönes Kloster, welches sie Mallières nannte.
Zuletzt endlich ließ sie das Schloß und die Stadt Portenach ausbessern
und erneuen.
Alle diese Gebäude waren fertig; da gebar Melusina abermals einen
Sohn, welcher gar schön war: nur stand ihm das eine Auge um ein weniges
höher als das andere. Dieser Sohn hieß Gyot. Selbiges Jahr
baute Melusina wieder ein Schloß, Larochelle genannt, und zu Soniets
ließ sie eine herrliche Brücke anlegen. Dann gebar sie wiederum einen
Sehn, Antonius geheißen, welcher einen Löwengriff an seiner Wange mit
auf die Welt brachte, auch sehr behaart war und lange scharfe Nägel an
den Fingern hatte. Dieser war nun so scheußlich, daß wer ihn nur ansah,
sich schon vor ihm fürchten mußte. Doch vollbrachte er nachgehends zu
Luxemburg große Taten, so daß alle Welt darüber staunte. Hierauf gebar
sie wieder einen Sohn; selbiger hatte nur ein Auge, welches ihm mitten
auf der Stirne stand; dieser wurde Reinhard genannt. Doch sah er mit
dem einen Auge viel besser, als wenn er deren zwei gehabt hätte. Als
derselbe wuchs und zu seinen Jahren kam, vollführte er, nicht weniger
als die andern, herrliche Taten.
Es folgte nun auch der sechste Sohn, den man Geoffroy mit dem Zahne
hieß, weil er einen großen Zahn mit auf die Welt brachte, der ihm wie
ein Eberzahn aus dem Munde hing. Dieser wurde überaus starken Leibes
und zeigte auch mehr als seine andern Brüder fremde und wilde Sitten.
Es blieb aber auch bei diesem sechsten Sohne nicht, sondern ein siebenter
folgte, welcher Freimund geheißen ward; dieser war sehr schön von Leib
und Angesicht, hatte jedoch auf der Nase ein haariges Mal, als wäre ihm
ein Stück von einer Wolfshaut eingesetzt. Der wurde vernünftig und
weise, aber lebte nicht lang. Bald aber nach diesem kam der achte Sohn,
welcher drei Augen hatte, von denen eins ihm auf der Stirne stand. Er
wurde um seines abscheulichen Aussehens willen Horribil genannt und
zeigte schon in zarter Kindheit böse Sitten; sein ganzes Gemüt war auf
nichts anderes bedacht, als Arges zu stiften. Diesem folgte der neunte
Sohn, den man Dietrich nannte; an dem war nichts Besonderes zu sehen,
und er wurde ein sehr tapferer und kühner Ritter. Der zehnte Sohn beschloß
die Reihe, er hieß nach seinem Vater Raimund und wurde in der
Folge auch Graf vom Forst.
Der älteste Sohn, Uriens genannt, war indessen herangewachsen und
ins männliche Alter getreten; ihm stand sein Herz und Gemüt nach nichts
sehnlicher als nach hoher Kriegsehre. Deswegen nahm er einige Segel-
und Ruderschiffe und ließ sie mit allem Nötigen ausrüsten, so daß sie
wohl den Namen Galeeren führen durften. Auch bestellte er zu dieser
Fahrt viel Volkes, und zwar die Besten und Wehrhaftesten aus dem Lande
seiner Mutter. Als sein jüngerer Bruder Gyot dieses sah, bekam er Lust;
mit ihm fahren, wiewohl er noch jünger als sein Bruder Gedes war,
welcher auch an dieser Reise ein Belieben gefunden hatte. Der mutige
Uriens aber hatte größere Neigung zu seinem Bruder Gyot, so daß er sich
diesen zum Reisegefährten wählte und den Bruder Gedes für diesmal zurückließ
. Melusina freuete sich über den löblichen Vorsatz ihrer Söhne und
hoffte auch, daß es ihnen auf dieser Reise glücklich ergehen würde. Sie
rüstete sie deswegen mit Habe, Geld und Zubehör reichlich aus und ließ sie
also in des Himmels Geleite dahin fahren.
***So steckten sie ihre Segel mit Freuden auf und stießen vom Strand,
kamen aber in kurzem wieder zu Lande, und dies war das Königreich Zypern
. Daselbst trafen sie die beste Gelegenheit, ritterliche Taten zu erweisen;
denn der König von Zypern war in seiner Stadt Famagusta von
dem mächtigen Heidensultan selbst mit mehr als hunderttausend Mann
belagert. In der Stadt herrschte große Hungersnot, und der König sah
nichts anders vor sich, als den Heiden unterwürfig und vom christlichen
Glauben hinweggedrungen zu werden, und dies verursachte großes Jammern
und Wehklagen in der Stadt. Aber der Schutz des Himmels, der
die Seinigen nicht hilflos läßt, ließ sich plötzlich spüren; denn kaum hatte
Uriens die Kunde vernommen, als er sich mit seiner Flotte nach der Stadt
hinwendete und sein köstlich in Seide gesticktes Panier flattern ließ.
***Die Heiden wurden die Ankunft dieser neuen Gäste bald gewahr; auch
die in der Stadt vernahmen, daß fremdes Volk herbeikomme; sie konnten
aber so schnell nicht wissen, ob es Christen oder Heiden wären. Der
Sultan aber, sowie er die mächtige Herankunft der christlichen Schiffe
inneward, begann, sein Volk zusammenzuziehen. Da glaubte der König
von Zypern, die Heiden wollten die Flucht ergreifen, befahl den Seinigen,
sich zum Streite zu rüsten, und steckte die rote Blutfahne aus. Die Trompeter
fingen an, fröhlich zu blasen, die Tore wurden aufgeschlossen, und
zog also das ganze Volk mutig gegen die Heiden hinaus. Nur die Prinzessin
Herminia, seine schöne Tochter, ließ der König in der Stadt zurück.
Da erhub sich ein strenger Kampf: die Heiden widerstanden mit großer
Macht; viel fromme Christen wurden erschlagen; ja, der König von Zypern
selbst wurde durch das vergiftete Geschoß eines Heiden tödlich verwundet,
so daß man kaum hoffte, ihn lebendig von dem Schlachtfelde
hinwegzubringen. Daher mußten die Zyprier, gedrängt von den Heiden,
zwar mit bewehrter Hand, aber doch nicht ohne großen Verlust wiederabziehen
. In der Stadt Famagusta erhub sich eine große Klage um die
Toten und Verwundeten. Die Kinder weinten und schrien um ihre Väter,
die Weiber rauften sich mit großem Geheul die Haare aus. Viele liefen
in der Stadt herum und schlugen die Hände zusammen; am kläglichsten
aber gebärdete sich die Prinzessin Herminia, des verwundeten Königes
Tochter; denn sie hatte aus dem Berichte der Arzte schon geschlossen, daß
das Leben ihres Vaters nicht mehr lange dauern würde und seine Wunden
unheilbar seien.
Unterdessen war Uriens mit seinem Bruder Gyot und der Heerschar, die
mit ihnen auf den Schiffen war, gelandet und jählings auf die Heiden
losgerückt. Sie fielen in die Reihen derselben voll Heldenmut, und Uriens
selbst verwundete und erlegte deren mehrere mit eigener Hand; auch Gyot
focht nicht weniger männlich, so daß die Heiden endlich ein großer Schrecken
ankam und sie auf den Rückzug zu denken anfingen. Doch wurde auch
dieser von ihnen nur unter hitziger Gegenwehr angetreten. Da sah man
mit Erstaunen, wie ritterlich der Sultan von Babylon noch stritt und
einen Christen um den andern zu Boden warf. Solches ersah nun Uriens,
drang auf ihn ein und versetzte ihm einen so mächtigen Streich mit dem
Schwerte, daß ihm das Haupt bis auf die Zähne gespalten wurde und er
vom Rosse elendiglich in den Staub dahinsank. Als dies seine Völker, die
Heiden, gewahr wurden, entsetzten sie sich über die Maßen und nahmen
von Stund an die Flucht. Der tapfere Uriens und sein Bruder eilten
ihnen nach, erlegten ihrer ohne Erbarmen eine unglaubliche Menge und
trugen so den Sieg davon.
Wie die Schlacht zu Ende war, nahmen Uriens und Gyot samt all
ihrem Volk von der Heiden Lager und Gezelten Besitz und ruhten daselbst
vergnüglich aus. Hierauf fertigte der todkranke König von Zypern durch
einen mächtigen Landesfürsten und etliche seiner Räte eine Gesandtschaft
an Uriens ab mit dem höflichen Ersuchen, doch zu ihm in seine Stadt
Famagusta und an seinen Hof zu kommen; läge er nicht an einer tödlichen
Wunde darnieder, so würde er selbst ihm, als dem Obsieger seiner Feinde,
einen Besuch in seinem Lager abgestattet haben. Uris nahm solches Anerbieten
mit vielem Danke auf und entließ die Gesandtschaft mit dem Versprechen
, sich einzufinden und Seiner Majestät aufzuwarten. Auch machte
er sich alsobald mit seinem Bruder Gyot auf und langte an dem Hofe des
Königs an. Aber das Volk in der Stadt Famagusta empfing ihn anfangs
nicht sehr freundlich, sondern sah ihn wegen seines unförmlichen Gesichts
recht mit Verwunderung und Erstaunen an. Ein jeder sagte, nie hätte er
ein so fremdes und seltsames Antlitz gesehen. Ja, sie kreuzten sich vor
Wunder und sprachen: "Der hat wohl die Gestalt, viel Land und Leute
zu überwinden und zu bekommen, weil man sich vor ihm fürchten mußt"
Indessen kamen sie in des Königs Palast und fanden diesen, geschwollen
und ohnmächtig von den Wunden des vergifteten Geschosses, in seinem
Bette liegen. Uriens grüßte den König mit höflicher Verneigung und beklagte
ihn sehr. Jener hingegen versetzte: "Mein Freund, Ihr habt gar
tapfer gefochten und mit Eurer ritterlichen Hand große Ehre eingelegt,
auch uns und der ganzen Christenheit damit gedient, so daß Ihr vor aller
Welt billig Preis und Ehre davontraget und Eure Nachkommen um solcher
Heldentat willen noch gepriesen werden sollen. Doch eins wünschen
wir von Euch zu wissen, wer Ihr von Geschlecht, von wannen Ihr gebürtig
seid." Uriens antwortete ihm mit tiefster Verbeugung: "Allergnädigster
König und Herr! Eure Majestät beliebe zu vernehmen, daß ich
von dem Stammhaus zu Lusinia geboren bin. Ich verhehle meinen Namen
nicht." Der König sprach: "Von Eurem Geschlecht haben wir viel
vernommen, daß alle, die daraus geboren, gar tapfere, heldenmütige Leute
seien. Anjetzt aber ist unser gnädiges Verlangen, daß Ihr, tapferer Ritter,
uns in einer Sache zu Willen seid und einen besondern Gefallen tun
wollet. Es soll dies zu Eurer eigenen großen Ehre gereichen. Wisset demnach",
fuhr der König mit einem lauten Seufzer und tiefem Atemholen
fort, "daß unsere Tochter Herminia, die einzige Erbin dieses Königreichs,
welches nun auch bald nach unserm bevorstehenden Hinscheid auf sie gelangen
wird, weil das Gift des empfangenen Geschosses uns schon fühlbar
zum Herzen eilt — daß unsere Tochter Herminia eines Schutzes und
dies Reich selbst eines tapfern und heldenmütigen Thronfolgers bedarf,
indem es den heidnischen Grenzen gar zu nahe liegt. Darum begehren wir
von Euch, daß Ihr unsere Tochter und dieses Reich zusammen übernehmet
und vor allem Anfall der Feinde beschützen wollet; denn derzeit ist in
allen Landen unter allen Rittern der Welt kein glückseligerer Held als
Ihr, keiner, der an Klugheit und tapfern Taten Euch gleich, keiner, mit
dem unsere Tochter und unser Reich besser versehen wäre, zu finden.".
Uriels erschrak vor großer Freude hierüber nicht wenig. Er antwortete
dem König in tiefster Demut also: "Großmächtigster König, ich sage für
diese hohe und unverdiente Gnade meinen untertänigen Dank und erkenne
mich viel zu gering, die Erbin einer Königskrone als Gemahlin heimzuführen;
noch geringer aber, ein so mächtiges Reich zu beherrschen. Jedoch
eine so unvergleichliche Gnade auszuschlagen und den Schluß des
Himmels zu verwerfen, würde vielmehr Vermessenheit als Demut heißen.
Deswegen kann ich nicht anders als folgen und Gehorsam leisten, wenn
Ihr anders mit Eurem Knechte nicht scherzet, daß ich die jetzt so betrübte
Fürstin hinfüro meine Geliebte und mich selbst ihren Diener nenne." Der
König, über diese kluge Antwort des Fremdlings von Herzen erfreut, versetzte:
"Nun preise ich den gütigen Himmel, daß ich noch vor meinem
Ende Tochter und Reich nach meinem Wunsche versorgt habet"
Hierauf hieß er den Helden Uriens abtreten, bis er den Hof- und Reichsständen
seinen Willen vorgetragen hätte. Auch gebot er zur Stunde, daß
alle seine Räte, insonders aber seine Tochter, die Prinzessin, herbeikommen
sollten. Zu jenen sprach er alsdann: "Sehet, wir haben unser Reich
mit bewehrter Hand gegen die Heiden bisher beschirmt. Nun aber sind
wir durch ein vergiftetes Geschoß dermaßen verwundet, daß wir wohl
fühlen, unser Leben sei dem Ende nahe. Nun bedürfet ihr sehr eines tapfern
Helden zum Herrn; denn ihr seid den Ungläubigen gar zu nahe gelegen
. Es fällt aber das Reich auf niemand anders als auf unsere einzige
Erbin Herminia. Demnach fordern und begehren wir, daß ihr erstens von
ihr eure Lehen empfahet, ihr auch als eurer gnädigen Königin und Beherrscherin
des Reichs huldigt und schwöret."
Das alles geschah von Hof und Ständen nach dem Willen des Königs.
Dann fuhr der todschwache Fürst fort und sprach: "Ihr wisset ferner,
Liebe und Getreue, daß einem schwachen und jungen Weibe, Reiche und
Länder zu regieren und vor feindlichen Anfällen zu beschützen, fast unmöglich
sei. Weil wir sie nun gerne solcher Last entbürdeten und doch als
Königin gewürdigt wissen möchten, in unserm ganzen Reich und allen
Nachbarländern aber keinen tauglichern Ritter finden, welcher ihr Gemahl
und königlicher Herrscher zu sein verdiente, außer dem Helden
Uriens von Lusinia, der sich, an unsern Hof berufen, allhier befindet und
diese Stadt aus der Heiden Händen mit seiner tapfern Faust errettet;
auch den Sultan und sein mächtiges Kriegsvolk aufs Haupt geschlagen
hat:- darum so sind wir entschlossen, mit eurer Bewilligung ihm unser
einziges Kind, die Prinzessin Herminia, zu vermählen und somit ihm das
Zepter des Reichs einzuhändigen. Erinnert euch also der schuldigen Treue,
ein solches wohl zu erwägen und ihn zu ersuchen, daß er die angebotene
Gnade erkennen und annehmen wolle, weil ihr wisset, daß ihr mit des
gütigen Himmels Hilfe vor den Heiden durch ihn wohl gesichert sein
werdet!"
Die Landesherren kamen dem königlichen Befehle freudig nach und bedeuteten
dem tapfern Uriens, daß er sich mit der Prinzessin Herminia vermählen
sollte; dann wollten sie ihm auf der Stelle schwören und ihn zu
ihrem Könige krönen. Dies nahm der edle Ritter dankbar und mit Freimut
an und entließ die Abgeordneten mit dem besten Bescheid an den
todkranken König zu seinem und des Landes Vergnügen. Der König ließ
den Uriens nun wieder vor sich rufen und wiederholte ihm seinen Entschluß.
"Ihr seid würdig", sprach er, "das Zepter zu tragen und dieses
ganze Königreich zu beherrschen; ja, alles Volk jauchzet schon vor Freuden,
Euch als seinem künftigen Gebieter zu huldigen!" Uriens dankte noch einmal
mit tiefer Verneigung und versprach seine willigsten Dienste. Zur
Stunde wurden sodann die zwei im Angesichte des sterbenden Königs
vermählt, und alsobald verschied der König.
So ward die Hochzeit mit vielem Leid und Jammer begangen, kein Tanz
wurde gehalten, kein Saitenspiel ertönte; der verstorbene König aber
wurde mit großem Gepränge zur Erde bestattet. Übrigens lebten Uriens
und Herminia in zärtlicher Liebe miteinander, und ihrer Zeit genas ,die
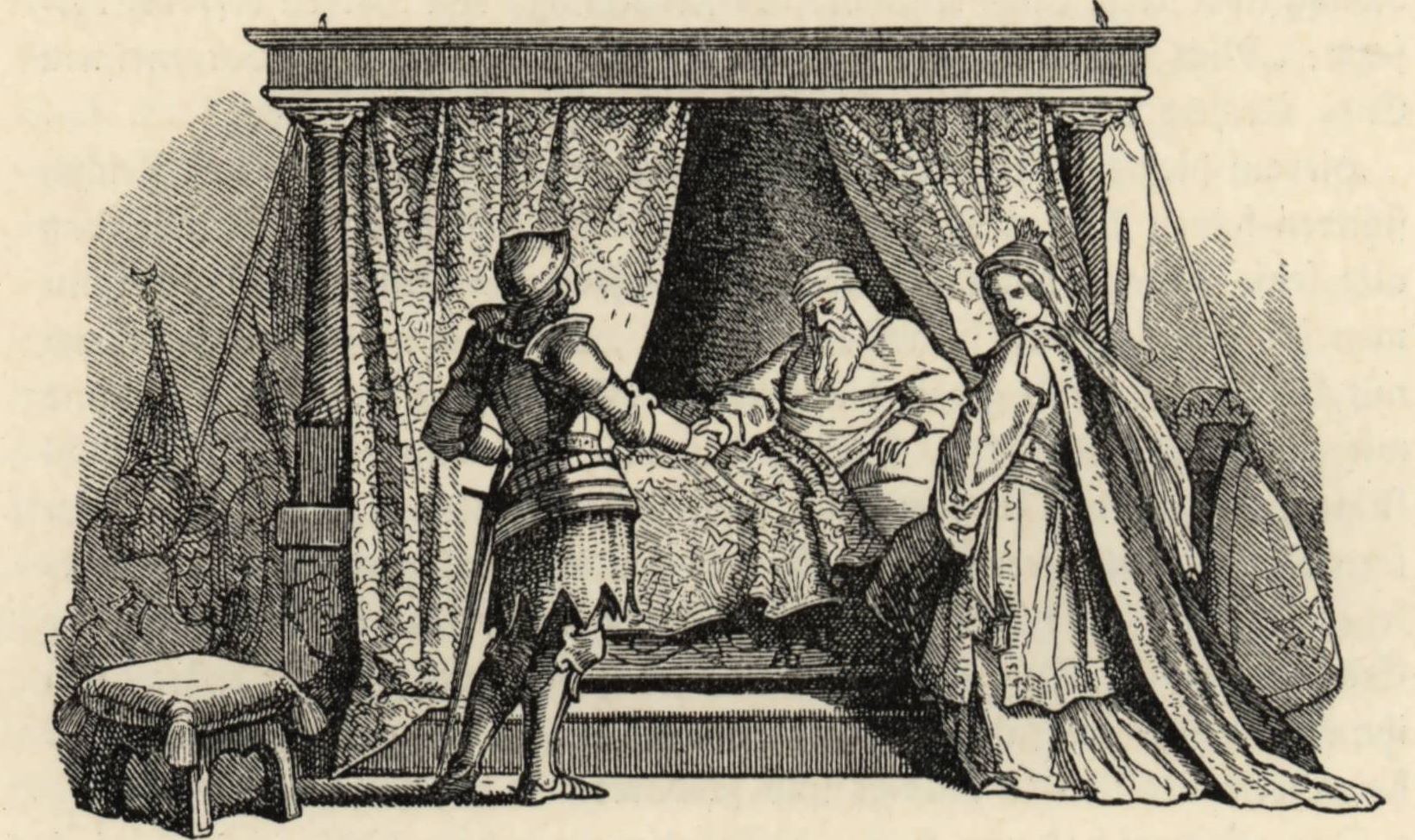
junge Königin eines Prinzen, den man den Greif nannte. Dieser Greif
ward nachmals so tapfer und kühn, daß er in einem fremden Lande viel
Städte und Leute und große Herrschaften gewann; den Palast zu Colliers
, der sehr stark war, eroberte er, dazu eine Insel in dem Meere, wo
ein großer Schatz verborgen war, nebst dem goldenen Vlies, welches Jason
vorzeiten gewonnen hatte. Auch eroberte er eine Stadt im Mohrenlande
und steckte auf ihren Zinnen sein Panier auf.
Nun erkrankte auch der König von Armenien, Herminiens naher Verwandter
, der leibliche Bruder ihres Vaters, und es mehrte sich mit seiner
Krankheit dermaßen, daß sein Ende bevorstand und die Kunde davon nach
Zypern kam. Er starb und hinterließ eine einzige schöne Tochter, welche
Floria hieß und noch ohne Gemahl war. Da traten die Landesherren zusammen
und hielten Rat, was zu tun wäre, und infolge ihrer Beratung
sandten sie eine Gesandtschaft an den König von Zypern ab und baten,
weil die verstorbenen Könige von Zypern und Armenien leibliche Brüder
gewesen wären, so möchte der neue König, Herr Uriens, seinen Bruder
Gyot zu ihnen abschicken und ihn der Prinzessin Floria zum Gemahl gönnen;
dann wollten sie ihm huldigen und ihn zum König krönen. Uriens
hielt deswegen einen geheimen Rat; die Stimmen lauteten aber einhellig,
er sollte seinen Bruder dahin abschicken. Darauf machte sich Gyot schnell
auf die Reise und kam nach Armenien, wo er die schöne Floria antraf.
Man ritt ihm mit allen Ehren entgegen und empfing ihn auf das trefflichste
. Ohne vielen Verzug wurde er unter den größten Festlichkeiten zu
ihrem Könige gekrönt. Von dieser Zeit an waren die zwei berühmten
Königreiche wieder in zweier Brüder Händen, und beide regierten gar
klug und mächtig und taten dem Heidenvolke kräftigen Widerstand. Auch
zeugten die zwei königlichen Brüder viel tapfere und schöne Söhne, welche
noch zu ihrer Väter Lebzeiten erwuchsen und ebenfalls den Heiden nicht
wenig Abbruch taten.
***Als inzwischen Raimund und Melusina durch sichere Botschaft in Erfahrung
gebracht hatten, daß ihre beiden Söhne durch so tapfere Taten
zu hohen Ehren gekommen und sogar auf Throne erhoben worden wären,
wurden sie sehr fröhlich und voll inniglicher Herzensfreude. Zum andachtsvollen
Danke gegen diese Fügung des Himmels ließ Melusina eine
herrliche Kirche aufbauen, welche der Tempel zu Unserer Lieben Frauen
in Portenach genannt wurde; auch ließ sie noch viel andere Kirchlein und
Kapellen errichten.
Nach diesem vermählte sie ihren zweiten Sohn, den Gedes, an eine
Tochter des Grafen von der Mark. Indessen wurde auch ihr Sohn Reinhard,
welcher nur ein Auge hatte, sehr stark, wuchs gar frisch heran und
entschloß sich, mit seinem Bruder Antonius, gleich seinen beiden ältern
Brüdern, in die Fremde zu gehen und daselbst durch ritterliche Taten Ehre
einzuholen. So zogen sie miteinander in Begleitung eines sehr schönen
Gefolges und mit dem trefflichsten Kriegszeug von Lusinia ab und gingen
nach Luxemburg, welches eben der Fürst von Elsaß mit großer Macht belagert
hielt. Auch hätte er diese Stadt ohne Zweifel genommen, wenn ihr
nicht die unerwartete Hilfe von jenen beiden jungen Helden zugekommen
wäre. Jener Fürst von Elsaß war von Herkunft ein König von Böhmen,
daher man ihn auch insgemein den König von Elsaß hieß. Nun wußte jedermann
wohl, daß jener Angriff ein Mutwille und freventliche Gewalt
war, mit welcher der Fürst von Elsaß die Herzogin von Luxemburg, die eine
betrübte und hilflose Waise war, zu erschrecken sich aufgemacht hatte. Er
wollte nämlich entweder sie zur Gemahlin oder Schloß und Stadt mit
Gewalt von ihr haben.
Auf die Nachricht von dieser Gewalttätigkeit sandten die Brüder, von
großem Mitleid bewogen, eilend einen Herold zu dem König von Elsaß,
kündigten ihm wegen so ungerechten Verfahrens ernstlich den Krieg an
und steckten zum Beweise dessen ihr Banner auf. Ungesäumt rückten sie
gegen das feindliche Lager an, fanden aber dort alles in bester Ordnung
und den Feind mit Schwertern, Spießen und Hellebarden wohlversehen.
Darauf stellten sie ihre Mannschaft in Schlachtreihen, zogen mit ritterlicher
Unverzagtheit auf den Feind los und griffen ihn männlich an. Aber
auch die Elsasser unterließen nicht, auf das fremde Volk mit großer Gewalt
einzudringen. Der Kampf hielt heftig an, doch erlegten die Lusinier
die meisten Feinde, und man sah, wie sich der Sieg ihnen zuneigte. In
diesem Streite hielten sich die zwei Brüder höchst ritterlich und verrichteten
mit ihren streitbaren Armen die herrlichsten Taten. So wurde der
Schrecken auf seiten des rheinischen Volkes überaus groß, ihre anfänglichen
Siegesblicke und prahlerischen Mienen verwandelten sich merklich;
die Lusinier hingegen triumphierten und sprachen einander mit lautem
Rufen zu.
***Inzwischen geriet der jungmütige Held Antonius ganz in die Nähe des
Königs von Elsaß und focht ritterlich mit ihm, so daß zuletzt der König
sich gefangengeben mußte und ihm sein Schwert williglich darbot, .und
wenn er das nicht bald getan hätte, würde es ihm wohl das Leben gekostet
haben. Doch nahm ihn Antonius noch zu Gnaden an. Als nun das rheinische
Volk seinen Herrn gefangengenommen sah und ihn nicht mehr zu
Gesichte bekam, da ergriff es die Flucht. Die Lusinier aber eilten ihnen
nach, und besonders Reinhard tat großen Schaden, indem er den Feinden
nachjagte.
***Nachdem nun der Streit zu Ende und der Feind völlig aus dem Felde
geschlagen war, schickten die zwei Brüder den König von Elsaß, ihren Gefangenen
, nach Luxemburg in die Stadt und ließen ihn durch sechs ihrer
Ritter der Erbin von Luxemburg zum Zeichen des Sieges überantworten.
Die Prinzessin, solche königliche Beute erblickend, erinnerte sich der Drangsale
, die ihr der Gefangene zugefügt, und des Übermuts, den er an ihr
verübt hatte. Kein Wunder, wenn ihr die Rache, welche der Himmel an
ihm genommen, und ihre eigene Errettung tief zu Herzen ging! Sie sprach
daher zu den Rittern, die ihr den König brachten: "Tapfre Ritter, sehr
werte Freunde! Ihr habt mir hier meinen Feind und mächtigen Verfolger
in die Hände geliefert, und ich kann an ihm den Wankelmut des
Glücks und die Nichtigkeit alles Menschenhochmuts erkennen. Der Himmel
, welcher alle gerechte Sache zu einem erwünschten Ende führt, hat
mir, einer verwaisten Fürstin, starke Geduld, euch aber heldenmütige
Kräfte, solches Werk auszuführen, verliehen. So saget mir denn", fuhr
die erfreute Prinzessin weichherzig fort, "wer sind die siegreichen Helden,
welche unsere und des Landes Not angesehen und uns mit des Himmels
Hilfe aus den Händen dieses Tyrannen errettet haben!" Da antwortete
ihr ein alter Ritter: "Durchlauchtigste Fürstin, es wäre unhöflich, den
Namen so tapferer Überwinder und ihre Herkunft so würdiger Bitte zu
verschweigen. Wisset denn, sie stammen aus Lusinia in Frankreich und
sind zwei Brüder, der eine heißt Antonius, der andere Reinhard. Ihre
Losung und ihr Feldgeschrei war das Wort Lusinia."
Die Prinzessin antwortete hierauf: "So danken wir denn dem gütigen
Gott und jenen zugleich, daß sie solch Erbarmen an uns erwiesen, und
weil wir durch diese mutigen Helden uns angstfrei und siegreich fühlen,
so soll inskünftige nichts ohne ihren Willen und klugen Beirat von uns
unternommen werden. Ja, alles, was der Himmel in meine Hände gegeben
hat, soll zu ihren Diensten stehen." Dann befahl sie sofort, daß
man beiden Siegern die besten Herbergen in der Stadt aufs reichlichste
auszieren lasse, überdies für all ihr streitbares Volk Unterkunft bei den
Bürgern bereitet werden sollte, damit, wenn sie eingezogen kämen, alles
schon zu ihren Diensten in bester Bereitschaft stünde. So wurden die sechs
Ritter von ihr in Gnaden entlassen, kamen in des gefangenen Königs Gezelt
zurück, wo die zwei Brüder ihr Quartier genommen hatten, und erzählten,
was ihnen begegnet. Kaum hatten sie den Bericht abgestattet; als
schon Abgeordnete der Herzogin in dem Zelt ankamen, um die Brüder im
Namen ihrer Gebieterin zu begrüßen und zum Aufbruch in die Stadt zu
vermögen. Hier sahen sie das ganze Gezelt mit einer Menge der reichsten
Beute von Silber, Gold, Kleinodien angefüllt; dies ließen jedoch die beiden
Sieger meist unter ihr tapferes Volk austeilen und behielten das
wenigste für sich selber.
***Auf der Abgeordneten inständige Einladung wurde hierauf zum Aufbruch
geblasen und der Einzug in die Stadt angeordnet. Man bestellte
Führer und Vorreiter, denen sofort fünfzehnhundert andere in schönem
Ritte nachfolgten. Dann kamen die beiden Sieger nebeneinander auf
buntgezierten Pferden und hinter ihnen die ganze Zahl ihres Volkes mit
fliegenden Sanieren in schönster Ordnung. So ging der Zug nach der
Stadt. Vor dieser wurden sie mit lieblicher Musik und allerlei Saitenspiel
empfangen und ihnen für die Erlösung von der Macht der Feinde
sogleich bei ihrer ersten Ankunft anstatt des Dankes ein lautschallendes
Lebehoch von der ganzen Bürgerschaft zugerufen. Hierauf fanden sich zwei
Abgeordnete, hohe Landesfürsten, ein, welche Reinhard und Antonius mit
demütiger Verneigung freundlich empfingen, sie auf die Burg begleiteten
und bei der Herzogin einführten.
"Seid willkommen, ihr meine sieghaften Erlöser!" rief die denselben
entgegengehende Fürstin ihnen mit den liebreichsten Mienen zu, "und auch
ihr, tapfere Mitstreiter dieser heldenmütigen Anführer, seid alle aufs
herzlichste aufgenommen! Seid willkommen, rastet aus von eurer Mühe
und seid fröhlich; ihr sollt bei einem Ehrenmahle alle eure Beschwerden
mit einem Meere der Freuden abspülen!"
Unter allerlei Unterredungen und Glückwünschen wurden allgemach die
Zurüstungen zu dem Bankette fertig. Man brachte das Handwasser in
einem goldenen Becken. Die Speisen wurden reichlich aufgetragen und
die werten Gäste zur Tafel geführt. Obenan gesetzt wurde der gefangene
König, seine beiden Sieger kamen in die Mitte der Tafel zu sitzen, ihnen
gerade gegenüber saß die Herzogin selbst. Nach ihr folgten abermals drei
hohe Landesfürsten und verschiedene andere Kavaliere und Edle. Da gab
es allerlei Freudengespräche und Gesundheitstrünke. Ein jeder erzeigte
sich fröhlich, vor allen die beiden überwinder des gefangenen Königs. Dieser
allein untermengte seine Reden zum öftern mit einem tiefgeholten
Seufzer, ohne daß es, wie er meinte, jemand merken sollte; denn es ging
ihm der Verlust seiner Leute und die kostbare Beute, die er dahintenlassen
mußte, noch immer zwischen aller Fröhlichkeit zu Herzen.
Als nun endlich nach lang gehaltener Tafel die Tische wieder aufgehoben
wurden und das Dankgebet gesprochen war, redete der König von
Elsaß folgendermaßen zu seinen beiden Obsiegern: "Meine Herren! Nachdem
ich heute durch des Himmels Fügung und meines widrigen Glücksterns
Verhängnis euer Gefangener geworden und in eurer Gewalt bin,
so werdet ihr auf die Bitte eines Königs nicht saumselig sein, mir anzuzeigen,
welches Lösegeld ihr für mich verlanget, und zugleich dieses so bestimmen,
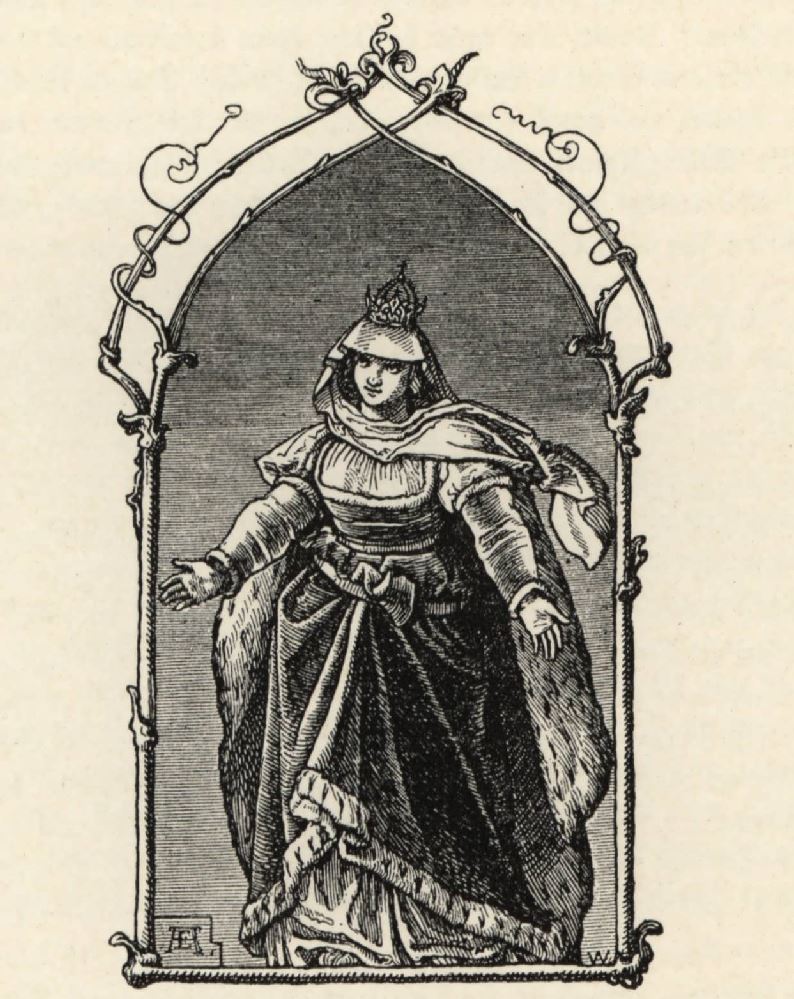
daß es nicht über die Kräfte meines Reiches geht, wofür ich mich
meinerseits auch gegen euch auf alle Weise erkenntlich beweisen werde."
Die beiden Brüder gaben ihm in aller Höflichkeit folgende Antwort:
"Zwar sei der König ihr Gefangener; doch hätten sie die freie Verfügung
über ihn ganz der Herzogin eigenem Belieben anheimgestellt. Wie diese
nun in solch wichtiger Sache beschließen und handeln möchte, das werde
auch ihnen wohlgetan heißen. Anders gedächten sie sich nicht weiter darin
zu verflechten." Kaum war diese höfliche Rede beendigt, als des Königs
Angesicht erbleichte, wie wenn er von einem großen Schreck befallen wäre;
denn er konnte sich wohl einbilden, daß er bei der Fürstin durch seine
allzuharte Beängstigung und seine Gewalttätigkeiten wenig Gnade oder
gütliche Milderung des schwersten Lösegeldes verdient hätte, obschon sie
mit Worten sich anscheinend ziemlich freundlich gegen ihn erzeigte.
***Aber die kluge Herzogin, welche selbst zugegen war und alle solche Gespräche
zur Seite mit anhörte, brach ganz entschlossen und großmütig mit
dieser sehr gnädigen Rede hervor: "Ihr meine werten Erretter, ich danke
euch nicht nur für eure getreue Hilfe, sondern überlasse euch auch, nach
Willkür mit eurem Gefangenen als seine Überwinder zu verfahren." Wie
der König dies hörte, bekam er seine natürliche Farbe wieder. Die Brüder
aber erwiderten voll Edelmut und mit lauter Stimme: "Durchlauchtigste
Fürstin, wir nehmen zwar das großmütige Geschenk einer Siegesbeute
, die ganz und gar Euer ist, mit ehrfurchtsvollem Danke an, erklären
aber, daß wir kein Lösegeld verlangen, sondern beiderseits auch unserem
Gefangenen die Freiheit zum Geschenke machen, nur mit diesem einzigen
Vorbehalte, daß der König Euch kniend seinen Dank sage, für alle Beleidigungen
und Bedrängnisse, die er der erhabenen Herzogin zugefügt,
ernstliche Abbitte tue, und künftig solches zu unterlassen, mit einem Eidschwur
und schriftlicher Versicherung samt Unterschrift und Insiegel am
gelobe."
***Nicht nur der Herzogin, sondern auch dem gefangenen König selbst
schien diese Forderung gang billig und annehmlich, und er tat es auf der
Stelle mit Freudigkeit und zum Vergnügen aller Anwesenden, indem er
mit tiefer Verbeugung und demütigem Danke Abbitte leistete. Als er sich
von der Erde erhoben hatte, ging der König erst noch mehr in sich und erwog
die huldvolle Behandlung, die er von den zween tapfern Helden erfahren
hatte, in deren Banden er sonst hätte verbleiben müssen. Er versprach
ihnen deswegen treue Freundschaft und königliches Wohlwollen,
um für keinen Undankbaren gehalten zu werden. Dann wandte er sich an
die Herzogin, dankte auch dieser und riet ihr, sich mit dem Helden Antonius
zu vermählen. Diese schöne Rede nahmen nicht nur die Räte und
Landesfürsten mit großem Wohlgefallen auf, sondern auch die Herzogin
selbst wies sie nicht ab; sie bedankte sich und gab durch eine Liebe lächelnde
Miene zu verstehen, daß sie diesen wohlwollenden Rat in reiferes Bedenken
ziehen wolle.
***Nicht mit Unrecht wird die Liebe einem Feuer verglichen. Jenes Wort
des Königs von Elsaß bewährte genugsam diese Vergleichung. Kaum
war es gesprochen, so fing das Fünklein schon an, in dem Herzen der schönen
Herzogin Feuer zu fangen und wie in der Asche dermaßen zu glimmen,
daß es mehr und mehr um sich griff und endlich in volle Flammen
ausbrach. Die kluge Fürstin erwog reiflich, daß des Königs Wunsch, wenn
er erfüllt würde, ihrem eigenen Lande nur gedeihlich und von großem
Nutzen sein könnte. Daher ließ sie, als inzwischen der Held Antonius
selbst um sie geworben hatte, die Vermählung ohne weiteren Aufschub vor
sich gehen, um so mehr, weil dies ihren Räten selbst willkommen war und
sie es dem Lande selbst für höchst zuträglich hielten. Daher wurden eiligst
alle Vorbereitungen zu der Hochzeit gemacht und diese selbst gefeiert. Der
König von Elsaß mußte dabei die Stelle eines hohen Ehrengastes bekleiden,
und das Fest lief mit aller Vergnüglichkeit ab, nachdem eine große
Zahl hochansehnlicher Gäste acht Tage lang es hatten feiern helfen und
der König von Elsaß in den zur Hochzeitsfeier angestellten Turnieren sich
aufs ritterlichste gehalten, auch einen Preis davongetragen hatte.
Es waren aber kaum die Tage der Fröhlichkeit zu Ende, da folgte auf
die Freude schon wieder eine Schreckenspost; denn als sich bereits alles
verabschiedete und die Gäste voneinander zogen, da kam ein eilender Bote
aus Böhmen bei Hofe an. Dieser fragte nach dem Könige von Elsaß und
begehrte, auf der Stelle vorgelassen zu werden. Nun übergab er dem König
einen schriftlichen Bericht von seinen Brüdern und bekräftigte denselben
mündlich dahin, daß die Stadt Prag von dein türkischen Großsultan
mit einer gewaltigen Heeresmacht belagert und von allen Seiten eng eingeschlossen
sei, auch keinen Ersatz zu hoffen habe. Der jetzt regierende
König in Böhmen ersuchte daher seinen Bruder um schleunige Hilfe. Der
König von Elsaß erschrak heftig über diesem Schreiben; er ließ es noch
einmal laut ablesen und bat die beiden Heldenbrüder, Antonius und Reinhard,
Mitleiden mit diesem Jammer zu tragen und zum Kennzeichen der
neugeschlossenen Freundschaft seinem bedrängten Bruder, ihm zur Seite,
mit vereinigter Heeresmacht zuzuziehen, damit das Land Böhmen vom
Ruin errettet und dem allgemeinen Chrisienfeinde gesteuert würde. Dadurch
würden sie ihren Heldennamen noch weiter kundmachen und sich
Ruhm in aller Welt erwerben.
Nun wollte freilich den tapfern Helden Antonius seine Gemahlin in
der ersten Flitterwoche aus glühender Liebe nicht von sich lassen, doch
wirkte die dringende Bitte des Königs bei ihm so viel, daß er, von innerlichem
Mitleiden getrieben, ihm versprach, sein treuer Bruder Reinhard
müsse auf der Stelle mit einer stattlichen Anzahl tapferer Streiter aufbrechen:
sollte es dann die höchste Not erfordern, und die vereinigte Macht
des Königs und seines Bruders noch nicht hinreichen, so wollte auch er auf
die Kunde davon ihnen mit seiner eigenen Person und einem neuen Heere
eilends kräftigen Beistand leisten, damit sie sobald als möglich Sieg und
Ehre wider die ungläubigen Heiden erhalten möchten.
Da brach vor großer Freude der getröstete König von Elsaß in das Versprechen
aus: sein Bruder in Böhmen, sonst ein sehr mächtiger König,
habe eine einzige Tochter; weil nun derselbe ein reicher und gar alter Herr
sei, so wolle er selbst es vermitteln, daß Reinhard durch seine Hilfleistung
die königliche Prinzessin und nach ihres Vaters Tode die Krone von Böhmen
als ein ehrwürdiger Regent aus den Händen der Stände davontrage.
Die Herren von Lusinia sagten ihm dafür ehrerbietigen Dank und waren
um so begieriger, Sieg und Ehre einzulegen. Von Stund an boten sie
allem Volke auf, der König mit Reinhard eilte über den Rhein und hatte
keine Ruhe, bis er auf böhmischem Boden war. Aber da standen die Feinde
in unglaublicher Menge, so mächtig und stark, daß sie allein sie nicht bekämpfen
zu dürfen glaubten. Deswegen sandten sie einen Eilboten an den
Herzog Antonius ab mit der dringenden Bitte, sich auch an die Spitze seiner
Heeresmacht zu stellen und den Sieg befördern zu helfen.
Infolge dieser Nachricht traf Antonius alle Anstalten, verabschiedete sich
von seiner geliebten Gemahlin und brach zur Rettung der Christenheit,
und besonders des Königs von Böhmen, mit einem Gefolge von mehreren
tausend Streitern auf. Er hatte viele mutige Bretagner und einen guten
Teil tapferer Luxemburger bei sich, so daß die beiden Brüder ohne das
wehrhafte Volk des Königes allein über vierzigtausend Mann stark waren.
Als nun Antonius bei den andern Hilfsvölkern anlangte, da begann den
Türken etwas bänglich zu werden; sie erwarteten keinen geringen Kampf.
Indessen betete die fromme Herzogin Christina von Luxemburg fleißig
für das Wohlergehen ihres Herrn, und in dem ganzen Lande bat alles
Volk in den Kirchen um Glück für seines Königs Waffen. Auch hatte die
Fürstin ihren Gemahl gebeten, ihres seligen Vaters, einst eines tapfern
und siegreichen Helden, Schild, Helm und Panzerkleid nie von sich zu
lassen, dabei auch sein Wappen zu führen. Sie hatte aber von Antonius
hierüber den Bescheid erhalten, sie sollte ihr liebes Herz unbekümmert lassen
; denn er habe schon von seinem Vater ein angeerbtes Wappen, welches
ihm nicht zu verlassen gebühre. Auch habe ihn die gütige Natur selbst
gleichsam mit einem Wappen und besondern Kennzeichen, nämlich mit
einem Löwengriff in seiner Wange, von der Geburt an bezeichnet, wodurch
er schon von viel Tausenden unterschieden und mit Verwunderung
erkannt worden. Deswegen wolle er auf seinem Helm einen Löwen zur
Losung führen und auch ihrer beiden Wappen zum Andenken einen Löwen
beifügen lassen.
So vertröstete beim Abschied Antonius seine Geliebte und war willens,
eine schöne Palmenernte unter den Feinden abzuhalten. Sobald er sich
nun auf böhmischer Grenze befand und dem Lager nahekam, auch das Gerücht
von so trefflicher Mannschaft, die heranziehe, unter den Feinden erscholl
, da vergrößerte sich ihr Schrecken noch mehr, und sie dachten wohl,
daß es nunmehr scharf hergehen würde. Der König von Elsaß aber, als
er sah, daß seine Fürbitte einen so guten Erfolg habe, war vor Freuden
außer sich und eilte dem Helden Antonius auf etliche Meilen weit entgegen.
Er dankte beiden Brüdern für ihre Nothilfe aufs herzlichste und
äußerte alle Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang. Nun wurden herrliche
Zelte bereitet und den umliegenden Ortschaften der ernstliche Befehl
erteilt, beide Herren und all ihr Volk aufs beste zu bewirten. Alles stand
ihnen offen, in allen Städten, wo sie durch- oder einzogen, wurden sie
mit höchster Freundlichkeit bewillkommt, und bei ihrer Ankunft jubelte das
Volk ihnen zu: "Hier kommen unsere Erlöser. Seid willkommen, ihr
tapfern Erretter des Reiches Böhmen ! Helfet uns, daß wir nicht in der
Ungläubigen Hände geraten!"
Endlich langten sie vor Prag und im Angesichte der Feinde an. Zu allem
Unglück aber waren die Ungläubigen zwei Tage vorher durch Eilmärsche
der Stadt, die sie schon lange berennt hatten, noch viel näher gerückt und
hatten sich den besten Platz zum Sturme ausersehen. Der König von
Böhmen nun, welcher in der Stadt Prag eingeschlossen war, als er sich
einerseits von so mächtigen Feinden, ja dem türkischen Sultan selbst mit
einem so gewaltigen Kriegsheere beängstigt andererseits mit schutzfertigen
Freunden —dem König von Elsaß und den zwei Herren von Lusinia, deren
gesamte Macht den Türken wenig nachzustehen schien — umgeben und
getröstet sah, fühlte seinen Mut wieder etwas wachsen; auch wollte er zeigen,
daß er von Gemüt und Geblüt ein tapferer König sei und sich noch
wohl getraue, eine Heldentat auszurichten, wie sie Königen gezieme. Als
daher der türkische Kaiser einst mit großem Prahlen vor die Stadt ritt,
die Belagerten herausforderte und ihnen zum Schimpf sein Panier aufsteckte,
wollte der König solchem Hochmut nicht länger mehr zusehen, sondern
nahm eine Anzahl seiner Reiter und streitbarsten Männer, sowohl
edle als unedle, zu sich; die wappneten sich mit Schild und Helm, ließen
sich das Tor öffnen und zogen, der König an der Spitze, auf des Himmels
Schutz vertrauend, den Türken zum Trotz hinaus.
Alsbald entspann sich ein lebhaftes Scharmützel; sehr viele Türken stürzten
zu Boden; es war eine rechte Lust, wie die Christenschwerter unter den
Ungläubigen obsiegten und deren Köpfe gleich Krauthäuptern von ihren
Rümpfen abhieben, als wären sie nie festgestanden. Die Türken wehrten
sich aber verzweifelt, und am Ende fand es sich doch, daß die Christen zu
einem solchen Ausfalle zu schwach waren. Sie zogen sich daher in guter
Ordnung, nach errungenen Vorteilen, sieghaft zurück und ließen, ohne
einen Mann verloren zu haben, der Türken Leichen auf der Walstatt liegen.
Der König selbst, welcher bisher wie ein mutiger Löwe unter lauter
Tigern und Panthertieren gefochten hatte, wollte unerachtet der Einsprache
seiner Leute mit diesem Siege nicht zufrieden sein, sondern hieb, wie einem
tapfern Helden zusteht, noch immer auf dem Rückzuge um sich, erlegte
mehrere Feinde mit eigener Hand, wurde aber zuletzt mit einem sehr spitzen
Pfeil, der vergiftet war, von einem türkischen Schützen, die man Janitscharen
nennt, zwischen den Panzer getroffen und so verwundet, daß das
Gift durch die Wunde in das Herz drang und er daher seines Lebens verlustig
werden mußte.
So ward bei den Böhmen die Freude jählings in Leid verkehrt; und sobald
sie alle es gewahr wurden, erhub sich von klein und groß eine jammervolle
Klage. Die Türken aber, als sie solches sahen, wurden darüber
nur noch mehr hochmütig und bildeten sich gewaltige Taten ein, die sie
getan hätten und noch verrichten wollten, gedachten auch, den Belagerten
alles mögliche Leid und allen Schimpf anzutun. Aber es gedieh ihnen
schlecht, es begann damit nur ihr größeres Unglück; denn die Rache Gottes
brach über die wütenden Hunde aus. Inzwischen zogen die Böhmen aus
der Stadt, ihren erlegten König hereinzubringen, und die Barbaren streckten
in solchem Leidwesen gar viel streitbare Ritter darnieder. Immer mehr
wuchs der Verlust so tapferer Helden und machte die in der Stadt eingeschlossene
Prinzessin, die der Tod ihres Vaters aufs tiefste gebeugt hatte,
noch wehmütiger und herzleidsvoller, besonders als sie und alles Volk in
der Stadt sehen mußten, wie die Türken vor den Toren ein großes Feuer
anschürten, die Leichname der Christenhelden darauf warfen und unter
Jubelgeschrei von der Flamme verzehren ließen. "Ach, trostlose Eglantina",
sprach sie zu sich selbst unter Tränen und Seufzen, "wie kannst du
solchen Jammer ansehen, ohne dich von der Mauer hinabzustürzen und so
deinen toten Vater ins Schattenreich zu begleiten? Bekränzet man also
die sieghaften Helden? Geht man so mit Kron- und Zepterträgern um?
Brecht hervor, ihr Tränen, löschet, wenn es möglich ist, die mörderische

Flamme mit eurem heißen Strome aus! Soll ich nun zur verlassenen
Waise gemacht und der Thron meines Reichs seines vortrefflichen Herrschers
beraubt sein? Sollen die Ungläubigen ihr Siegesbanner auf meinen
Mauern aufpflanzen und ihre Waffen unter den Stadttoren anlehnend
Ach, höre mich, gütiger Himmel, und laß nicht zu, daß dieses verkehrte
türkische Volk über das Häuflein starkmütiger Christen herrsche!"
Also seufzte die Betrübte und mit ihr alle Einwohner der Stadt, so daß
man die Wehklage weithin erschallen und im türkischen Lager selbst hören
konnte.
Inzwischen hatten sich die mutigen Christen jenseits der Hauptstadt, bewogen
durch das klägliche Jammergeschrei, das aus der Stadt herübertönte
, endlich mit ihrer großen Heeresmacht in völlige Schlachtordnung
gestellt; auch ihr ganzes Volk in drei Heerhaufen eingeteilt und kamen
nun mit hitzigen Schritten auf die Feinde losgezogen. Alles war mutig
und munter vor Begierde, die Stadt nur recht bald von ihren grausamen
Stürmern befreien. Vorher hatten sie einen Eilboten abgefertigt, der
sich mit kluger List nach Prag hereinschlich und den Bürgern die angenehme
Kunde der herannahenden Errettung brachte. Sobald dieser Bote
die Stadt betreten, fing er überlaut an auszurufen: "Getrost, ihr beängstigten
Bürger, seid männlich und gutes Muts; ich bin ein Bote der
Freuden. Der Himmel hat euer Elend angesehen, und eure tapfern Erretter
gehen bereits auf den Feind los. Der König von Elsaß und der
Herzog von Luxemburg mit Meinhard von Lusinia werden in kurzem
die siegreichen Überwinder und eure Rächer an den Feinden genannt
werden."
Diese angenehme Zeitung machte die Einwohner mitten in ihrer Betrübnis
wieder fröhlichen Mutes. Der Bote erzählte ihnen auch alles,
was sich Denkwürdiges vor Luxemburg begeben, wie der König von Elsaß
seiner Bande erledigt worden und der tapfere Antonius nunmehr Herzog
von Luxemburg sei. Hierauf begaben sie sich auf die Mauer, ein jeder mit
guter Wehr versehen, und fochten so mannlich von den Zinnen herab, daß
die staunenden Türken selbst den Rückzug von den Mauern nahmen, indem
sie untereinander sprachen: "ES ist nicht möglich! Der Böhmen Gott
streitet selbst für sie, oder sie haben einen großen Entsatz bekommen!"
Während sie sich noch so untereinander wunderten, siehe, da kam ganz
schnell aus der Heiden Gezelten einer dahergerannt voll Entsetzen und
großen Geschreis: sie sollten auf der Stelle von dem Stürmen ablassen
und sich in ihr Lager zurückziehen, wenn sie nicht alle des Todes sein wollten.
Dazu rief er: "Ich sehe, dicht wie eine Nebelwolke, fremdes Volk
zum Entsatz der Christen auf uns daherrücken. Sie werden uns gewiß wie
eine Flut überfallen!"
Auf dieses Geschrei zogen die Türken eilig zurück und stellten sich in
Schlachtordnung. Von beiden Seiten hörte man die Trompeter blasen.
Die tapfern Christen gingen wie Löwen auf die Türken los, zertrennten
ihre Reihen, fällten eine große Menge derselben, durchstachen ihnen Schild
und Helme; besonders ließ sich der edle Held Reinhard von Lusinia als
ein tapferer Vaterlandsverfechter vor allen andern Kämpfern sehen, und
sein Bruder Antonius gab ihm an Heldenmut nichts nach. Auf solche Weise
fingen die Ungläubigen an, sehr schwach, die Christen aber, immer mutiger
zu werden, so sehr, daß sie einander zuriefen: "Seid Männer und erleget
eure Feinde! Auf, ihr Brüder, der Sieg ist in unsern Händen!"Der
Sultan, der dies hörte und die Niederlage seines Volkes anschaute, gebärdete
sich wie unsinnig, griff nach den Waffen, erhob sich aus seinem
Zelte und rasete selbst unter die Christen, deren er auch in seiner Wut sehr
viele erlegte.
Reinhard aber, der muntere Held, als er den Sultan erblickte, griff zum
Schwert und rannte auf ihn mit gesporntem Rosse los. Es geriet ihm
auch so glücklich, daß er dem türkischen Kaiser den Kopf in der Mitte voneinander
spaltete und so den wütenden Heidenhund in den Staub streckte.
Da die Türken gewahr wurden, daß ihr Oberhaupt gefällt sei, ergriffen
sie die Flucht in unordentlicher Hast. Aber Reinhard, Antonius und der
König von Elsaß setzten ihnen nach, erlegten ihrer viele ritterlich auf der
Flucht und erjagten den Sieg mit höchstem Ruhme. Nach ihrer glorreichen
Zurückkunft erfuhr der König vom Elsaß erst, daß der Sultan seinen Bruder
getötet und vieler Helden Leiber habe verbrennen lassen. Da ließ er
auf der Stelle einen großen Holzstoß zusammentragen und also seine
Rache vollziehen. Die Leichen sämtlicher gefallenen Türken, und darunter
der Sultan selbst, wurden auf den Scheiterhaufen geworfen, auf daß sie
ebenso von der Flamme verzehrt und zu Asche verbrannt würden. So
endete die Türkenniederlage und wurde Prag von der feindlichen Belagerung
erledigt.
Nach diesem rühmlichen Siege, als die Türken bereits fern waren, faßten
die beiden Heldenbrüder festen Fuß in dem feindlichen Lager und bedienten
sich, den Ungläubigen zum Spott, ihrer hinterlassenen Gezelte.
Der König vom Elsaß aber begab sich in die Stadt Prag hinein und besuchte
die verwaiste Königstochter, seine Nichte. Diese ging ihrem königlichen
Oheim entgegen und bedankte sich, wiewohl in gar tiefer Betrübnis,
bei dem Könige selbst und den zahlreichen Helden, die in seinem
Gefolge waren. Der König dagegen sprach ihr freundlichen Trost ein und
klagte zugleich mit ihr um den Verlust desjenigen, der sein Bruder und
ihr und des ganzen Landes Vater gewesen war.
Hierauf wurde die Leiche des Königs mit feierlichem Glanze begraben.
Alle Feldhauptleute, und was sich in dem von den Feinden verlassenen
Lager befand, erschienen in gewohnter Trauerkleidung; die beiden Brüder
von Lusinia wurden von allem Volke der Stadt mit Verwunderung betrachtet
als zwei so löwenmutige Helden, besonders aber Antonius, der den
Löwengriff auf der Wange zum Wahrzeichen mit auf die Welt gebracht
hatte. An Reinhard aber wurde seine königliche Haltung und Miene bewundert
und daher von dem Volke geschlossen, daß diesem majestätischen
Manne wohl noch eine Krone blühen könnte. Während sie nun so die
Helden anstaunten, nahm das Trauergeleite ein Ende.
Dann ließ der König vom Elsaß alle Großen des Landes und den gesamten
Adel von Böhmen vor sich rufen und stellte ihnen in einer beweglichen
Rede vor, was dem Vaterlande not täte. "Geliebte Herren und
Edle", sprach er, "treue Freunde meines in Gott ruhenden Bruders, euch
allen ist der leidige Trauerfall, der dieses Königreich zur Waise gemacht
hat, wohlbekannt. Deswegen ist vonnöten, damit das Reich nicht ohne
Vater sei und der Thron seines Königes beraubt stehe, auf die Wiederbesetzung
bedacht zu sein. Weil nun mein glorwürdiger Bruder eine
einzige Erbin als eure Gebieterin hinterlassen hat, so siehet zu raten,
was ihr für das Beste des böhmischen Reiches und der Krone halten
werdet."
Die Ritterschaften und der ganze Reichsadel dankten in Untertänigkeit
dem Könige für diese getreue Vorsorge, mit dem Beisatze, daß sie keinen
bessern Rat wüßten, als es Seiner Majestät zur eigenen freien Verfügung
anheimzustellen und die Sorge für des Landes Wohlfahrt zu überlassen
. Sie versicherten dies alle einstimmig und bekräftigten ihre Willfährigkeit
mit einer tiefen Verneigung. "Gut", versetzte darauf der König,
"weil ihr denn dies Vertrauen zu uns gefaßt habt, so finden und wissen
wir keinen Tauglichern, diese Thronschwelle zu betreten und das Zepter
des Reiches zu tragen, zugleich als Versorger der königlichen Erbin einzustehen
, als den großmütigen und um das Reich durch erfochtene Siegesehre
unsterblich verdienten jungen Helden, Grafen Reinhard von Lusinia. .
Er ist es, welchen wir als neuen Zepterträger und sorgsamen Landesvater,
wenn eure Einwilligung ihm zuteil wird, erkennen und hiermit empfohlen
haben wollen."
Jauchzen und Frohlocken ertönte aus der Mitte der Landesstände auf
diese willkommene Erklärung des Königs, und auch das gemeine Volk
jubelte über einen so männlichen Beschluß. Die ganze Stadt erscholl von
einem Freudenrufe, daß sie einen so schönen und großmütigen König
haben sollten. Auch die vortreffliche Prinzessin war außer sich vor Freude,
so sehr hatte die Liebe ihr Herz eingenommen. Herzog Antonius dankte
hierauf zuerst für die Ehre, die seinem Bruder Reinhard widerfuhr. Dieser
aber stattete ganz fröhlich seinen eigenen Dank ab und versprach feierlich
, daß er jederzeit als ein sorgender Vater des Reiches sich erweisen und
mit Maß und Gelindigkeit regieren wolle. Er wurde auch von jedermann
wegen der Krone beglückwünscht, die sein Haupt zieren sollte, und alles
wünschte, daß er nur recht bald die Regierung antreten möchte. Und so
wurde nach Gottes wunderbarer Schickung Reinhard mit einem Königreich
und einer schönen Königstochter als Gemahlin, das Reich aber mit
einem zepterwürdigen Helden begabt.
Als alle hochzeitlichen Freuden zu Ende waren, trat Reinhard seine
Regierung an, tat sich von Tag zu Tag immer mehr hervor mit liebreicher
Vatertreue und Beglückung seines Landes und erwies sich als einen
recht großmütigen Regenten; brachte auch eine Menge Landschaften, dazu
das ferne Königreich Dänemark, in seine Gewalt, so daß jedermann von
diesem heldenmütigen Fürsten nicht genug zu rühmen wußte.
Herzog Antonius von Luxemburg aber begab sich nach beendigten Hochzeitsfeierlichkeiten
, als auch der König vom Elsaß Urlaub nahm und sein
Kriegsvolk mehrenteils verabschiedete, zurück in seine neue Heimat, nach
Luxemburg. Hier blieb er bei seiner geliebten Gemahlin, welche ihm zwei
schöne Prinzen zur Welt gebar, von welchen der eine Bertram, der andere
Loyers genannt wurde. Eine lange Zeit lebten sie so in Liebe miteinander.
Dann unternahm der Herzog einen Krieg gegen den mächtigen Grafen
von Freiburg und zog in der Folge auch gegen Östreich, wo er sich verschiedener
Orte und Landschaften bemächtigte. Das alles ging ihm aufs
glücklichste vonstatten. Sein älterer Sohn Bertram tat sich mit den mannbaren
Jahren auch hervor und erhielt des Königs von Elsaß eine Tochter
zur Gemahlin, wodurch er nach ihres Vaters Tode zum Throne gelangte.
Der andere Sohn Loyers wurde auch ein wackerer Held; er ward als
Mann groß in der Dordogne, baute das Schloß von Jaly und später die
schöne Brücke von Mallières und verrichtete allerlei ritterliche Taten.
Nun wollen wir uns zu Raimund und Melusina zurückwenden und von
dem Schicksal ihrer übrigen Kinder Meldung tun. Jene beiden gingen
ihren Söhnen mit den schönsten Tugenden als leuchtende Nuhmfackeln
voran, und der Vater eroberte fast das ganze französische Land nach der
einen Seite bis gegen Bretagne hin. Sein Sohn Geoffroy, der den großen
Zahn mit auf die Welt gebracht hatte, erwies sich ebenfalls sehr tapfer
. Denn als ein schreckliches Gerücht erscholl, daß in dem Land Garande
sich ein entsetzlicher Riese aufhalte, der Land und Gegend bis an die Stadt
Rochelle, die von Melusina erobert war, verwüste; da erbot sich der frischmutige
Ritter Geoffroy, Lande Heil und Rettung zu verschaffen.
Sein Vater hörte dies nicht gern: er fürchtete, der Riese möchte ihm zu
stark sein und ihn überwältigen. Aber der junge Held beharrte auf seinem
Entschlusse, ließ sein mutiges Roß satteln und zäumen und ritt in die
Landschaft Garande, dem ungeheuren Riesen den Hals zu brechen.
Inzwischen war auch der jüngste Sohn Melusinens, Freimund, herangewachsen,
ein Jüngling von stillem Gemüte und andächtigen Sinnen, gelehrt
und ein Liebhaber des geistlichen Standes. Dieser besuchte aus
freier Lust öfters das Kloster zu Mallières und empfand endlich ein lebhaftes
Verlangen, in den Orden der Mönche aufgenommen werden,
auch sein Leben in gedachtem Gotteshause zu beschließen. Er entdeckte
diese Neigung seines Gemütes beiden Eltern, die ihm die Heldentaten seiner
Brüder und die Ehrenstufen, welche diese erreicht hätten, zu bedenken
gaben, und das junge Blut auf andere Gedanken zu bringen bemüht waren,
daß er auch nach dergleichen Weltwürden streben sollte. Aber keinerlei
Weltlust noch Liebe zu Heldentaten vermochte das junge Herz von
seiner stillen Liebe zu Gott und seinem heiligen Dienste abwendig zu
machen.
Da nun weder Vater noch Mutter ihren jungen Sohn Freimund bewegen
konnten, von seinem Vorhaben abzustehen, ließen sie ihm endlich
seinen Willen und stellten verschiedene geistliche Orte in seine Wahl, auch
Domherrnstellen und Bistümer in Aussicht. Aber Freimund blieb bei seiner
ersten Erklärung: er wollte nichts anders als ein Mönch im Kloster
zu Mallières werden und Gott lieber in Demut als in hohen Würden dienen.
Darauf folgte bald sein Eintritt in den Orden, worüber die Mönche
sich sehr erfreuten, wiewohl ihnen diese Aufnahme des Grafen in ihre
Mitte nicht so gedeihlich war, als sie vermeinten, sondern zu ihrem großen
Herzeleid ausschlug.
Mittlerweile, während sich die beiden sonst glückseligen Eltern so heimlicherweise
betrübten, kam ihnen, als sie gerade Favent Hof hielten,
durch einen Eilboten die frohe Nachricht von dem Sieg ihrer beiden
Söhne, Antonius und Reinhard, vor Luxemburg und Prag, wie der erste
das Herzogtum, der andere die böhmische Krone und beide so schöne und
reiche Fürstentöchter zu Gemahlinnen davongetragen. Es läßt sich kaum
denken, welche Freude und Sänftigung ihrer Betrübnis diese Botschaft
beiden Eltern verursachte. Sie dankten Gott von ganzem Herzen für diese
Wunderschickung und waren es nun auch zufrieden, bei drei gekrönten
Königen und einem Herzog einen Mönch in ihrem Geschlechte zu haben,
der für sie alle beten könnte, damit die übrigen Kinder ebenfalls wohl
geraten und zu so hohen Würden sprossen möchten.
***Gleichwie aber das Leid die Freude auf der Welt gemeiniglich zu begleiten
oder ihr doch auf dem Fuße zu folgen pflegt, so geschah es auch hier.
Und wie vorher das wunderbare Glück, so fing auch das Unglück diesmal
zuerst von den Eltern an. Es hatte nämlich eines Sonnabends ganz von
ungefähr der Vater Raimund seine Melusina aus den Augen verloren.
Weil er ihr aber durch ein teures Gelübde versprochen hatte, an keinem
Sonnabend ein Wort mit ihr zu wechseln oder auch nur nach ihr zu fragen,
so machte er sich keine argen Gedanken darüber, daß er nicht wußte,
wo sie war. Nun fügte es sich aber in der gedachten Zeit, daß eben der
alte Graf vom Forst, Raimunds Vater, mit Tode abgegangen und der
ältere Bruder Raimunds nach Lusinia kam, um diese Trauerpost zu überbringen
. Der mit vielen hohen Herren ankommende Freund wurde nach
Würden empfangen und ihm alle Ehre angetan.
***Weil es aber eben ein Sonnabend war, so vermißte der Graf vom Forst
seine Schwägerin Melusina und bat seinen Bruder mit freundlichen Worten:
"Lasset mir nach Belieben auch Eure Gemahlin erscheinen, lieber
Bruder, daß wir ihr die gebührende Ehre erzeigen können!" Nun erwiderte
ihm zwar Raimund mit aller Höflichkeit und aufs bescheidenste, daß es
diesmal nicht möglich wäre, aber morgenden Tages geschehen solle. Der
Graf wollte sich jedoch so schlechtweg damit nicht begnügen, sondern führte
während der Mahlzeit seinen Bruder beiseite und sagte ihm leise ins Ohr:
"Lieber Bruder, mich dünkt, Ihr seid verzaubert! Das ganze Land hegt
auch diese Meinung von Euch. Wie könnet Ihr so geduldig sein und gar
nicht nach dem Tun und Lassen Eurer Gemahlin fragen! Meinet Ihr,
daß Ihr Ehre davon habt und nicht allmählich bei dem Volke ein Verdacht
entstehe über einen so seltsamen Lebenswandel? Es ist ja bekannt
genug, daß Eure Frau ein offenbares Gespenst ist, das nur Abenteuer
mit Euch spielt!"
Zorn und Ingrimm erfüllten die Seele Raimunds bei diesen Worten,
er ward blaß und wieder rot: der Schimpf, den er erfuhr, machte, daß
er seine Besinnung verlor; voll Rachwut ergriff er das beste und größte

Schwert und drang damit in das Geheimzimmer seiner Gemahlin. Hier
Süess er aber auf eine wohlverwahrte, mit Eisen beschlagene Türe, die sich
gleichsam seinem Grimme zu widersetzen und ihn zum Bewußtsein zurückzurufen
schien. Aber der rasende Verdacht kehrte immer wieder, und wenn
er auch nicht an das Gerede glaubte, dessen sein Bruder erwähnt hatte,
so vermutete er dafür nichts Besseres und gab böslichen Gedanken an die
Untreue seiner Gattin Raum. Er bohrte daher mit seinem spitzen Schwert
ein Loch durch die Türe von Eichenholz und blickte mit finsterem Auge
hinein, um sein eigenes Unglück zu schauen.
Zu seinem ungeheuern Schrecken sah er seine Gemahlin mit ganz verwandelter
Gestalt in einem Wasserbecken sitzen. Das Gesicht und die
obere Hälfte des Leibes war wunderbar schön, aber von der Hälfte abwärts
ging sie in einen langen und mißgestalten, recht schlangenartigen
Schweif aus: der glänzte wie Lasurblau, mit Silber vermengt. Raimund
stand vor der Türe, ihn überlief der kalte Schweiß, die Bangigkeit wollte
ihm das Herz sprengen, er konnte nichts sagen und nichts denken. Doch
fiel ihm endlich das teure Versprechen ein, das er seiner Gemahlin getan
und jetzt im Zorn so kaltsinnig gebrochen hatte. Er verklebte daher das
Loch, das er mit seinem Schwerte gebohrt, mit Wachs und schmeichelte
sich mit der Hoffnung, Melusina werde seinen Treubruch nicht wahrgenommen
haben. Dann verließ er mit heimlichem Grimm und in tiefer
Schwermut ganz stillschweigend das Vorgemach und verfügte sich wieder
zu seinem Bruder. Aber er konnte sich nicht so verstellen, daß dieser an
Miene und Farbe keine Veränderung an ihm bemerkt hätte und nicht der
Gedanke in ihm aufgestiegen wäre, Raimund müsse seine Gemahlin auf
irgendeiner bösen Tat ergriffen haben. Er sprach deswegen ohne Scheu
zu ihm: "Lieber Bruder, ich merke wohl, daß Ihr mit Eurer Gemahlin
betrogen seid!" Raimund aber, um seinen Kummer noch mehr zu verbergen,
erwiderte darauf ganz entrüstet: "Ihr irret Euch; man versuche
nicht, die Ehre meiner Gemahlin zu beflecken, es sei denn, daß einer Lust
habe, sich eine unglückselige Stunde auf den Hals zu hürden! Ihre Frömmigkeit
leidet keine solche Beschimpfung, wie Ihr Euch deren schon zuviel
gegen sie erlaubt habt! Darum eilt aus meinem Angesicht und reizet
nicht ferner meinen Zorn, so lieb Euch Euer Leben ist! Denn Eure Gegenwart
ist mir verdrießlich und ein Pfeil in meinem Herzen!"
Der Graf, der den Raimund in seinem Gemüt so berückt sah, schwang
sich in höchster Bestürzung eilends wieder zu Pferd, indem es ihm sehr leid
tat, durch ein einziges Wort solchen Zorn auf sich geladen zu haben. Indessen
nahm bei Raimund die schmerzliche Betrübnis darüber, daß er
seinem Gelübde entgegengehandelt hatte, innerlich immer mehr überhand;
denn er konnte leicht bei sich die Rechnung schließen, daß seine Melusina
sich ihrer Drohung gemäß nun gänzlich von ihm verlieren und er ihrer
nicht mehr ansichtig werden würde. Dies alles ging ihm sehr zu Herzen,
und er brach in seiner Einsamkeit in bittere Klagereden aus: "Unglück
seliger Raimund", sprach er zu sich selber, "warum verfluchst du nicht die
Stunde deiner Geburts Nur darum bist du zu solchem Glück erhoben
worden, damit du jetzt desto tiefer fallest! So soll ich mir denn durch
meine eigene Schuld die größte Freude meines Lebens für die Zukunft entzogen
sehen, sie, die ich wie meine Seele geliebt?" So warf er sich im
äußersten Unmut auf sein Lager. Aber die Zährenflut die er vergoß, verschaffte
seinem geängsteten Herzen keine Ruhe. Von Liebe und Ungeduld
gepeinigt; rief er aufs neue aus: "Melusina, mein einziges Ergötzen, einziger
Trost meines Lebens, du Schöpferin meines Glücks, wenn ich dich
verliere, so verliert sich auch meine Freude. Soll ich aber ohne dich so
einsam leben, so will ich mich lieber in die Einöde verbergen!" Und so
währten seine Klagen den ganzen Tag und die schlaflose Nacht hindurch;
doch, sooft er sein schon ausgeweintes Haupt umkehrte, so wollte immer
die Trauer aus dem betrübten Herzen nicht weichen, bis endlich der erwünschte
Sonntag zu seinem Troste wiederanbrach.
Nun ging ihm die Freudensonne wieder auf, und der Stern seines
Glückes begann wieder heller zu werden; denn die Kammertüre öffnete
sich, und Melusina trat mit dem gewohnten freundlichen Herzgruße vor
ihn in aller ihrer menschlichen Schönheit. "Mein Geliebter", sprach sie,
"welche Schwermut hält Euer Herz befangene Was ruht für eine Wolke
auf Eurer Stirne? Entdecket mir Euer Anliegen, damit ich Euch helfen
kann!" Wer war fröhlicher als Raimund, da er solches hörte! Er glaubte,
Melusina habe keine Ahnung davon, daß er die Türe durchbohrt und sie
in ihrem unnatürlichen Zustande gesehen habe. Er erwiderte daher: "Nur
Eure Abwesenheit hat eine so große Sehnsucht nach Euch in mir erregt, so
daß ich mich noch matt und schlaflos befinde. Aber Eure liebe Gegenwart,
mein bester Arzt, wird diese Betrübnis schon von mir verscheuchen! Ich
fühle gar nichts mehr, und mir ist sehr wohl!" Melusina aber wußte
alles, was geschehen war. Sie mußte bei sich selber lächeln, daß Raimund
seinen Fehler so gut zu beschönigen und sich anzustellen wußte, als
wenn er nicht das geringste wahrgenommen hätte.
***Während dieses in Lusinia vorging, war Geoffroy auf der Fahrt nach
dem Niesen und fragte allerorten seinem Aufenthalte nach, bis er endlich
erfuhr, daß sich derselbe auf einem sehr festen Schloß aufhalte und sein
Name Gedeon sei. Es fügte sich auch so glücklich, daß Geoffroy ohne
allen Anstoß durch fleißiges Nachforschen in die Nähe des Platzes gelangte
. Da sprang er vom Pferde, waffnete sich mit Harnisch, Helm,
Schwed und herrlichem Goldschild, nahm einen trefflichen Speer zur
Sand, schwang sich wieder auf sein mutiges Roß und ritt so dahin. Alle
Umstehenden, welche die freudige Zurüstung des jungen Herrn mit ansahen,
gönnten ihm zwar von Herzen den Sieg und sahen seinen Feuergeist
genugsam aus seinen Mienen hervorblicken; doch waren sie von
Herzen betrübt; und jedermann sah ganz traurig aus; denn das Erkühnen
kam ihnen sehr zweifelhaft vor, wenn sie bedachten, daß der junge
Ritter seiner Größe und Stärke nach nur wie ein Kind jenem Ungeheuer
gegenüber anzusehen sei. Weil er sich aber nicht abhalten ließ, so hießen
sie ihn unter vielen Glücks- und Segenswünschen seinem Vorhaben nachziehen
. Er aber, statt durch den Jammer des Volks weich und verzagt zu
werden, tröstete noch die Betrübten und sprach sie mit munterer Rede an:
"Seid getrost und bekümmert euch nicht! Ich reite dahin, Ehre einzulegen
, dem Lande Heil zu verschaffen, eure Furcht und euren Schrecken
auszutilgen und mit des Himmels Hilfe das Ungeheuer zu besiegen."
Damit rief ihm alles Volk ein segnendes Lebehoch unter des Himmels Geleite
zu und sah ihm zwischen Hoffnung und Kummer geteilt nach.
So ritt Geoffroy in mutigem Verlangen bis vor die Brücke des Schlosses,
in welchem der Riese war. Er sah sich zuerst vorsichtig um, wo er
sich befände, dann fing er mit heller Stimme zu rufen an: "Wo hifi du,
schändlicher Bösewicht, welcher mein Land also verwüstete Hier steht dein
Bestrafer und der Rächer deiner Verbrechen, welcher dich mit Gottes
Hilfe dem Tode auszuliefern entschlossen ist. Heute, du Bluthund, sollen
dein Blut die Hunde lecken, deine ganze Macht soll sich zur Erde strecken!"
Kaum hatte er diese Aufforderung beendigt, als der grausame Riese
schon zuoberst im Schlosse das Fenster öffnete. Sein Haupt übertraf an
Größe bei weitem den größten Büffelskopf; er sah den jungen Ritter und
verwunderte sich, daß er so ganz allein und ohne Begleitung zu ihm käme;
darüber begann er zu lachen, schüttelte mit spöttischen Mienen seinen
Dickkopf und rief aus dem Fenster herab: "Woher so allein, du Kleiner?
Suchest du deinen Tod und bist du deines Lebens müde? Fast schäme ich
mich, dich aus der Welt zu fördern; doch weil du es also haben willst, so
bin ich bereit, deine Vermessenheit zu strafen!"
Hierauf nun zog der Riese schnell seinen Hamisch an und stellte sich mit
einem stählernen Schilde, drei eisernen Stangen und drei Hämmern, die
er an die Brust steckte, vor das Schloß heraus. Seine Länge war fünfzehn
Schuh; dennoch vermochte sie nicht, dem unverzagten Geoffroy nur
das geringste Entsetzen einzuflößen, sondern er verwunderte sich nur, daß
ein so ungeheures Menschenbild auf Erden leben könne; indessen machte
er sich alles Ernstes, aber auch freudig auf den Streitplatz. Da fragte ihn
der Riese, wer er sei. "Ich bin Geoffroy mit dem Zahn", erwiderte jener,
"und bin gekommen, dich noch heute zu töten."
Gedeon, hierüber lächelnd, antwortete: "Mich jammert deines Persönchens,
du Kleiner, daß ich dich mit einem einzigen Streiche töten soll. Besinne
dich auf einen ansehnlicheren Menschen, mit mir zu kämpfen. Du
aber rette wieder nach Haus und freue dich deiner Jugend; denn für diesmal
ist dir dein Leben geschenkt." Dem Geoffroy kam diese Rede schimpflich
vor; ganz entrüstet versetzte er ihm: "Es ist gar nicht nötig, daß du
so ein Mitleiden mit mir habest; denn ich bin nicht hiehergekommen, daß
du Erbarmen mit mir zeigest, sondern daß ich dein grausames Leben von
dir fordere!" Der Riese, der solches noch immer für einen Scherz hielt,
unterließ, sich in Positur zu stellen; nachdem nun Geoffroy ihn alles
Ernstes hierzu wiederholt ermahnt hatte, rannte er mit einem Satze
auf ihn zu und stieß dem Riesen mit dem Speer auf die Brust so heftig,
daß er alsbald auf den Boden stürzte und die Erde von dem Falle erzitterte.
Als der Riese auf diese Weise den Ernst sah, wurde er vor Scham und
Zorn ganz wütend, daß ihn der kleine Ritter auf einen einzigen Stoß darniederwerfen
sollte. Behend richtete er sich wieder auf, ergriff eine von
seinen stählernen Stangen und holte aus zu einem Streiche auf Geoffroy,
der bereits zum zweitenmal gegen ihn anrannte. Der Streich traf Geoffroys
Pferd und schlug diesem mitten im Laufe die beiden Vorderbeine ab,
davon das Roß zur Erde fiel und liegenblieb. Geoffroy aber achtete dies
nicht, sprang behende vom Roß, ergriff mit Hast sein Schwert, eilte damit
auf den Riesen zu und versetzte diesem, ehe er es sich recht versah,
wieder einen so tapfern Streich, daß ihm davon die Tartsche aus der Hand
fiel. Sogleich aber griff jener nach seiner stählernen Stange und versetzte
dem Ritter damit einen so kräftigen Schlag auf den Helm, daß Geoffroy
von dem Schalle des Schlags beinahe taub geworden und von der Wucht
desselben zur Erde gezogen worden wäre. Doch erholte er sich gleich wieder,
, steckte das Schwert schnell ein, eilte mit einem Sprung auf das Pferd
zu, das auf dem Boden lag, und riß seinen stählernen Kolben mit solcher
Geschwindigkeit vom Sattelknopf herab, daß es jener kaum gewahr wurde.
Mit diesem prellte er dem Niesen unversehens auf einen Schlag die eiserne
Stange aus der Hand. Solchem Anfall zu begegnen, ergriff der Riese
einen von den Hämmern, welche er an der Brust stecken hatte, und warf
ihn nach dem Ritter; der traf und schleuderte diesem gleichfalls den Kolben
aus der Hand. Der Riese Gedeon, als er solches sah, bückte sich vor
großer Freude, den Kolben selbst aufzuheben. Geoffroy aber, während
jener sich bückte, ergriff sein Schwert wieder und hieb ihm sogleich einen
Arm von der Schulter hinweg; Gedeon, darüber sehr in Schrecken, wollte
sich doch den Schmerz nicht so geschwind merken lassen, sondern griff mit
der andern Hand nach der einen Stange. Der hurtige Geoffroy aber entwich
ihm, so daß jener vom starken Schwung auf die Knie darniederfiel
und seine Götter um Hilfe zu rufen anfing. Der Ritter fürchtete sich
jedoch davor nicht, nahm die Gelegenheit wahr, führte einen tüchtigen
Hieb auf des Riesen Helm und spaltete Helm und Kopf zugleich. Da nahm
er sich gute Weile und hieb dem Riesen das Haupt ganz ab. So wurde
derselbe überwunden und das Land von seinem Verderber errettet.
Nun begann der Sieger zum ermunternden Zusammenruf in des Besiegten
eignes Horn zu stoßen. Darauf eilte alsobald alles Volk zum Wiesengründe
hinab, um das traurige Schauspiel zu betrachten. Denn sie
meinten bereits alle, der kleine, junge Ritter werde seine Kampflust mit
dem Leben bezahlt haben. Aber die Hinzueilenden fanden es ganz anders,
als sie sich eingebildet hatten. Das tote Ungeheuer lag in seinem Blute
hingestreckt, der Rumpf vom Haupte abgesondert. Der junge Ritter hingegen,
ohne einen Blutstropfen verloren zu haben, wandelte frisch und gesund
auf dem Kampfplatze herum. Alles war voll Freuden und Glückwünschens,

man hörte keine andern Worte als nur immer: "Sehet den
tapfern Helden, unseren Erretter! Dem hat der Himmel diesen Sieg verliehen
! Sehet sehet, wie frisch und mutig er umhergehet; merket ihr nicht,
welch ein Feuergeist und großmütiger Sinn aus seinen Blicken und Gebärden
hervorleuchtete Der ist es, den ihr dort vor euch sehet! Kommt,
laßt uns dem Helden Glück wünschen!" So währte es eine lange Zeit
unter dem Volk, und sogar von des Riesen eigenen Leuten erscholl ein
Freudenruf über dem Anblick seiner Niederlage.
Indem nun also die Menge sich zudrängte und viele gerne wissen wollten,
wie wunderbar es doch bei diesem Kampf zugegangen sei, und doch
nicht so kühn waren, den jungen Obsieger mit zudringlichen Fragen anzusprechen,
merkte Geoffroy dieses und sprach endlich zu ihnen: "Geliebte
Freunde, ihr seht hier den Prahler und verderblichen Landesfeind, welcher
mit großer Gewalt auf mich zudrang und mir sehr viel zu schaffen machte.
Der Himmel war auf meiner Seite: ohne seine gnädige Beihilfe würde
mir der Sieg entgangen sein. Umsonst rief er seine Götzen an; denn sie
waren viel zu ohnmächtig gegen den einigen Gott. Danket anjetzo demselben
mit mir, welcher mir also Fäuste und Arme gestärket, daß sie wider
solche Macht bestehen konnten!" Hiermit verfügte er sich in das gewonnene
Schloß. Der Siegesruf und das Freudengeschrei aber erschallte durch
das ganze Land.
Das erste, was Geoffroy in dem Schlosse vornahm, war dieses, daß er
einen Eilboten abfertigte, welcher seinen Eltern nach Favent die gute Botschaft
von der Besiegung des Riesen überbringen mußte. Welche innerliche
Freude diese Siegesnachricht in dem Vaters und Mutterherzen erregte,
läßt sich mit Worten und Feder nicht beschreiben. Der Bote mußte
nach reichlichem Botenlohn sogleich wieder ein Schreiben Raimunds an
seinen Sohn Geoffroy mitnehmen, in welchem er ihm den elterlichen
Gruß meldete, zu seinem Siege Glück wünschte und zugleich berichtete,
daß sein Bruder Freimund in dem Kloster 'Mallières Mönch geworden
sei. Aber diesen Brief hätte der gute Raimund besser unterlassen; denn
er schmiedete mit demselben sein eigenes Unglück, wie wir hören werden.
Mittlerweile, während dem Geoffroy zu Garande alle mögliche Ehre
angetan wurde, fügte sich's, daß ein eilender Bote dahergeritten kam, welcher
Briefe an Geoffroy mit der Nachricht brachte daß auch im fernen
Lande Norwegen in der Landschaft Norheim sich ein ungeheurer Riese
aufhalte, der fast das ganze Land verheere und großen Schaden in der
Gegend anrichte, weswegen er, der berühmte Riesentöter, von sämtlichen
Landesherren daselbst ersucht würde, sich unverzüglich aufzumachen und
ihnen wider jenes Ungeheuer Schutz und Hilfe zu leisten. Dafür wollten
sie ihm statt des schuldigen Dankes huldigen und ihn für ihren von Gott
gesandten Herrn erkennen.
Dieser Brief war für den heldenmütigen Geoffroy lustig zu lesen; er
förderte den Boten mit dem mündlichen Bescheide ab, er sollte seinen
Herren sagen: daß er ihnen alles Gute wünsche und nicht um großen Gutes
willen, auch nicht; um Land und Leute zu gewinnen, sondern von Mitleid
bewogen, sich bald bei ihnen einfinden und Leib und Leben wagen
werde, auch mit Gottes Hilfe, wie zuvor, den Sieg davontragen.
***Als der Ritter so in voller Zurüstung begriffen war und eben zu Schiffe
sitzen und sich den wilden Meereswellen vertrauen wollte, siehe, da kam
der Bote seiner Eltern mit Raimunds Briefe, in welchem ihm seines
Bruders Freimund Eintritt ins Mönchsleben gemeldet ward, auch in dieser
Sache noch guter Rat von ihm begehrt wurde. Darüber ergrimmte
Geoffroy dermaßen, daß ihn der Zorn nicht nur bleich machte, sondern er
auch mit den Füßen zu stampfen, ja sogar sein Mund zu schäumen anfing.
Alle, die um ihn herstanden, zitterten bei dieser jähen Entstellung vor
Schrecken, und doch durfte sich niemand .unterstehen, ihm nur im geringsten
zu widersprechen. "Ich will", schrie er voll Wut; "dieses verführerische
Volk, die Mönche zu Mallières, züchtigen, und es rächen, daß sie
aus einem so jungen Ritter einen faulen und zaghaften Stubenbuben gemacht
haben. Sollte er seinen Ritterorden um eine Kutte und einen
Kahlkopf vertauschen und das Feuer seiner Jugend also in Trägheit verdampfen
lassen? Ich schwöre, daß dieser Frevel an dem ganzen Kloster
mit Feuer bestraft werden soll."
Der Norweger Bote, der noch zugegen war und alles mit anhörte, zitterte
vor Furcht über solches Vorhaben, weil es die Abreise des Ritters
nach Norheim verhindern könnte. Aber Geoffroy, der diese Besorgnis
wohl merkte, redete ihn so an: "Ihr, Bote, ziehet nicht von hier, bis ich
zuvor eine gewisse Rache genommen haben werde; alsdann will ich, den
Verderber Eures Landes auszutilgen, mit Euch ziehen!" Mit diesem Trost
mußte sich der Fremde zufrieden geben. Hierauf ließ sich Geoffroy in aller
Eile die Pferde rüsten und ritt mit wenigen seiner Diener unverzüglich
dem Kloster Mallières zu. Es war eines Dienstags, als er daselbst anlangte;
der Abt samt dem gangen Konvent ging ihm demütig mit großer
Freude und Ehrenbezeugung entgegen, um den Ankommenden zu bewillkommnen.
Allein gar bald verwandelte sich das Schauspiel. Geoffroy
redete sie nämlich voll Zornes also an: "Ihr Verführer und Verlocker
eines jungen Ritterblutes, wer zum Henker hat euch befohlen, meinen
Bruder Freimund auf die faule Klosterhaut zu legen und sein edles Gemüt
der trägen Ruhe ergeben zu machen, daß er die härene Kutte gegen
den blanken Degen vertauschte ? Wisset ihr auch, daß ihr für solches Verbrechen
alle miteinander den Feuertod verdient habt? Und der soll augenblicklich
durch diese meine Hand an euch Vermessenen vollzogen werden,
an euch, die ihr so freventlich die alten Stämme der jungen Aste beraubet
Der Abt und der ganze Konvent zitterte und stand in äußersten Sorgen;
denn keiner wußte vor Schrecken, was er auf die schnaubenden Worte
des ergrimmten Geoffroy antworten sollte. Zuletzt erholte sich der Abt
ein wenig und hub zu beteuern an, daß nur die eigene Andacht und die
Begierde des Herzens seinen Bruder Freimund bewogen habe, den Orden
anzunehmen, und daß Freimund dieses selbst bezeugen könne. "Dem ist
so, mein Bruder", sprach dieser hervortretend, "nicht dieser Konvent, sondern
mein freier Wille ist schuldig daran, daß ich auf den Gedanken geraten
bin, Gott zu dienen und ein Mönch zu werden. Warum sollen die
Unschuldigen die Strafe des Schuldigen leiden? Bin ich straffällig, so
mag mich der Himmel bestrafen, den allein mein Verbrechen oder mein
Rechttun angeht. Vergreife dich nicht an dem geweihten Orte und seinen
Zugehörigen, die wir doch unablässig begriffen sind, für die Wohlfahrt
des ganzen Lusinischen Hauses, und somit auch für die deinige, zu beten!"
Diese Rede machte den zornigen Geoffroy noch grimmiger: er stieg
eilends vom Pferde, ließ zur Stund ' einen großen Haufen von Holz, Heu
und Stroh zusammenbringen und zündete diesen mit eigener Hand an,
daß der Wind die Flamme nach dem Kloster zutrieb. Alle Mönche waren
in die Kirche geflohen und mußten hier unter Flammen, Dampf und
Rauch jämmerlich ihr Leben enden. So hatten die mordbrennerischen
Hände eines tyrannischen Bruders über hundert Mönche; den Abt und
seinen Bruder Freimund nicht eingewählt, dem Feuer geopfert und der
Eltern eigenen Besitz nicht verschont.
Allein auch die Reue blieb nicht aus; sie folgte vielmehr der bösen Tat
auf dem Fuße. Als der Mörder den Aschenhaufen ansah und die vielen
unschuldigen Leichen und nach dem Ablodern der Flammen und dem Verhallen
des Wehgeschreis Gottes brennenden Zorn erwog, da erwachte, wiewohl
zu spät, sein Gewissen. Er ritt in der größten Bestürzung maeder
nach Garande zurück, wo der Bote von Norheim sein wartete. Der Bote
freute sich seines Anblicks; Geoffroy selbst aber schickte sich unverweilt zur
Meise an und segelte schnell Norwegen zu, um seine böse Tat desto eher
zu vergessen.
Als inzwischen Geoffroys Eltern einst zu Favent in den besten Gesprächen
und in herzlicher Vertraulichkeit über Tische saßen, siehe, da kam ein
Bote von Mallières an, welcher gar wenig Worte machte und dadurch
bald zu verstehen gab, daß sein Anbringen etwas Besonderes wäre. Er
wurde vorgelassen und gefragt, was er mitbrächte. "Wenig Gutes", antwortete
er und schwieg wieder stille. Ein tiefer Seufzer; den er aus der
Brust hervorholte, zeigte an, daß er vor Betrübnis kaum reden könne.
Endlich mußte er das Schweigen doch brechen und, was er zu melden
hatte, ausrichten. "Gnädiger Herr", sagte er, "Euer Sohn Freimund ist
tot; samt allen Mönchen; das ganze Kloster ist verbrannt: ich bin zum
Glücke entronnen, daß ich Euch den Jammer anzeigen kann; denn weder
Abt noch Mönch ist mehr übrig; das alles hat der Ritter Geoffroy verübt,
der im grimmigen Zorn das Kloster vorsätzlich angezündet hat."
Dann hub er an, den ganzen Verlauf der Sache umständlich zu erzählen.
Als nun Raimund den Jammerbericht zur Genüge vernommen, setzte er
sich mit betrübtem Herzen zu Pferde und ritt eilig nach Mallières, um
mit eigenen Augen zu sehen. Hier aber fand er nichts als Trümmer und
klagendes Landvolk, das sich in Verwünschungen über seinen Sohn Geoffroy
ergoß. Da drang ihm der Zorn so tief in das Herz, daß er vor innerer
Herzensunruhe den Aschenhaufen nicht mehr ansehen konnte. Er setzte sich
wieder zu Pferd und ritt nach Favent heim, wohin er noch am nämlichen
Tage gelangte. Da verschloß er sich in seine Kammer und beweinte in
der Einsamkeit das Herzeleid, das ihm sein Sohn Geoffroy angetan. Zugleich
fiel ihm das Unrecht wieder ein, das er in der Übereilung des Zorns
an seinem Bruder, dem Grafen von Poitiers, begangen; denn er erkannte
jetzt, daß jener darin recht gehabt habe, was er ihm vorgeworfen, indem
er doch an Melusina ein wahrhaftes Meerwunder und halbes Gespenst
und nicht ein natürliches Weib habe, obschon er zehn Söhne mit ihr gezeuget
, davon der eine jetzt so jämmerlich um sein Leben gekommen war,
und zwar von des eigenen Bruders Hand.
***In solchem Unmut traf ihn seine Gemahlin Melusina, die eben die Türe
des Kammergemachs aufschloß und in Begleitung vieler Ritter und Frauen
eintrat, um ihren betrübten Herrn, welcher noch immer, mit den Reisekleidern
angetan, auf dem Bette lag, in seinem gedoppelten Herzeleid zu
trösten. Sie schien aber gar nicht willkommen zu sein; denn Raimund
gab mit seiner finstern Miene ihr genugsam zu verstehen, daß ihre Gegenwart
nicht sonderlich erwünscht war. Dessenungeachtet fuhr die tugendhafte
und getreue Frau fort, ihm weiter mit herzlichem Troste zuzusprechen
, und stellte ihm vor, daß man dem Willen und der Schickung des
Himmels ja nicht widerstehen und seinen Schluß nicht hindern oder aufhalten
könne.
Aber Raimund sah sie sehr trotzig und mit grimmigen Gebärden an,
wie sie sonst von ihm nicht gewohnt war. Und zuletzt brach er in die ungestümen
und unglückseligen Worte aus: "Hebe dich von mir, du böse
Schlange und schändlicher Wurm; siehst du nicht, was dein Sohn Geoffroy
mit dem Zahn für einen saubern Lasteranfang seines Manneslebens gemacht
hat? Ach, mein Sohn, mein Sohn Freimund ist dahin, von Brudermördershand
in den Tod geschickt!" Und nun warf er sich unter einem
Strom von Tränen und mit Händeringen auf die andere Seite seines
Lagers und würdigte seine getreue Melusina nicht mehr des Anschauens.
Diese sprach ihm in tiefster Betrübnis, aber doch ganz bescheidentlich zu
und erinnerte ihn an den Fehler, den er begangen, und der nicht wiedergutgemacht
werden könne. "Ach, unbesonnener, ungeduldiger Naimund",
sprach sie, "welche Blödigkeit hält deine Vernunft gefangen, daß du über
all unser Unglück auch an mir Unschuldigen noch eidbrüchig wirst l Habe
ich nicht deine Wohlfahrt gesucht, dich geliebt, getröstet und vor allem
Unglück gewarnt? Und dieses will nun gleichsam zum Dache herein; denn
in kurzem wirst du mich verlieren. Unglücklicher, keines Erbarmens würdiger
Mensch, warum hast du dich nicht eines Besseren bedacht und mich
so vor allen Umstehenden beschimpfte"
Dann wurde sie ganz stille und sank vom Eifer ihrer Rede in einer tiefen
Ohnmacht auf die Erde. So lag sie bei einer halben Stunde ohne
Empfindung da und wurde fast für tot gehalten. Alle Hofherren und
Diener erschraken über die bedenklichen Reden, von deren Inhalt bisher
niemand etwas gewußt hatte; jeder konnte gar leicht denken, daß dieses
Gespräch große Erbitterung bei beiden nach sich ziehen würde, und es war
ihnen gar nicht lieb, diese Geheimnisreden und Offenbarungen eines jähen
Zornes mit anhören zu müssen; auch ahnten sie wohl, daß am Ende zu
späte Reue bei beiden nachfolgen würde. Indessen eilte man ungesäumt
der ohnmächtigen Melusina zu und bespritzte sie mit frischem Wasser, um
nur zu sehen, ob auch noch Leben in ihr wäre. Dann eilte man mit andern
Mitteln, sie zu stärken, bis sie endlich wieder zu sich selbst kam, sich
aufrichtete und mit gar langsamer, doch deutlicher und nachdrucksvoller,
klagender Stimme die Worte sprach:
"Ach, Raimund, was hast du getane Oh, ich Törichte, die ich mich von
deinem eiteln Gesichte blenden ließ und deinen verführerischen Gebärden
und einschmeichelnden Worten getraut habe! Zu welcher unglückseligen
Stunde habe ich dich an dem Brunnen angetroffen und diese falsche Brust
umhalset! Ist dies Pflicht und Treue gehalten, dies Wohltat mit Dank
bezahlte Habe ich dich darum so mächtig und begütert gemacht, daß ich
durch dich ins Unglück versinken sollten Undankbarer! Nicht ich, du bist
eine Schlange, die ich mir selbst, mir zum Falle, an meinem Busen großgezogen
habe. War es dir nicht genug, Treuloser, mich heimlich belauscht
zu haben, ohne daß ich ein Zeichen der Mißgunst oder Rachgier vermerken
ließ, wenn nur dein bundbrüchiges Herz sich bescheiden, dein falscher Mund
hätte schweigen wollens Nun hast du mir und dir geschadet und uns beide
mutwillig um unsere Wohlfahrt gebracht; denn ich wäre nicht von dir
gewichen, bis mein natürlicher Tod mich von dieser Welt abgefordert
hätte; so aber bringst du mir Leib und Seele bis an den Jüngsten Tag
in Pein und Trübsal. Wie eine zergliederte Kette wird dein Land von dir
gerissen und nach deinem Tode da und dorthin verteilt werden. Ich sehe
schon das Unglück deines Geschlechts vor meinen Augen schweben; nichts
als Zwietracht und Uneinigkeit wird in demselben herrschen, weil mit mir
all dein Glücksstern verschwindet. Und ich selbst, wie gern ich es wollte,
wie wehe es mir tut, ich selbst vermag das alles nicht mehr zu ändern!"
Nachdem sie solche Klage- und Strafworte gesprochen, ergriff sie drei
Große des Landes, die zugegen waren, bei der Hand, trat mit ihnen gegen
Raimund und hob noch einmal nachdrücklich zu reden an: "Falscher Raimund!
Die Stunde meines Abscheidens rückt immer näher herbei. So
merke dir denn, was ich vor diesen Zeugen, dir zum Besten, aus Mitleiden
(das du freilich nicht verdient hast) hinterlasse. Horribil, unsern jüngsten
Sohn, der drei Augen mit auf die Welt gebracht hat, diesen mußt du nicht
leben lassen, sondern gleich in der ersten Stunde meines Hinscheidens ertöten,
wenn du anders nicht großem Unglück die Hand bieten willst.
Bliebe er am Leben, so würde der Krieg dein ganzes fruchtbares Land in
eine elende Wüstenei verwandeln. In ihm erblickst du den Verderber aller
seiner Brüder, den Schänder deines gagen Geschlechts. Darum vertilge
diese Schlange, wenn du nicht noch mehr Herzeleid beweinen willst! Den
Unmut aber, welchen dir Geoffroys Missetaten verursacht haben, den
tilge; denn wisse, daß jenes Jammergeschick vom Himmel über die Mönche
wegen sündhafter Ausschweifungen verhängt war, dem Ärgernis zu wehren.
Und wisse, daß ebendieser, dein Sohn, jenes Kloster weit herrlicher
aufbauen und versorgen wird, als es bisher gewesen. Endlich sage ich
dir, was ich nicht vergebens geredet haben will, ehe ich dich ganz verlasse:
wenn man mich einst in der Luft über Lusima daherschweben sieht; dann
sollt ihr wissen, daß das Schloß in selbigem Jahr einen andern herm
bekommen wird; ja, sollte ich in der Luft nicht wahrgenommen werden
können, so wird man doch meine Gegenwart bei dem Durstbrunnen verspüren
können, weil dort das Schloß zu meinen Ehren gebaut und meines
Namens Gedächtnis daran geknüpft worden ist. Ich werde aber den Freitag
zuvor gesehen werden, ehe das Schloß seinen Herrn ändert. Und dies
ist es, was am meisten an meinem Herzen nagt. Die Zeit meines Abscheidens
ist nun da, und bald werde ich dahin müssen, wo mein Kummerlied
sich erst recht anhebt."
Diese Rede fuhr dem Raimund wie ein Dolch durch das Herz, und er
brach in Tränen und Händeringen aus. Er wünschte sich nichts anders,
als im Augenblick sterben zu dürfen. Er blickte seine treue Melusina lange
und beweglich an, konnte sich nicht mehr halten, fiel ihr um den Hals und
küßte sie mit klagenden Gebärden, so daß allen Anwesenden die heißen
Tränen hervorquollen und selbst die Hofdiener sich nicht halten konnten.
Es war ein Jammer anzusehen; denn alle beide lagen ohnmächtig auf der
Erde. "Verzeihe mir, Geliebte, und bleib bei mirl"hub endlich der seufzende
Raimund an. — "Ich kann nicht", sprach Melusina, "denn das
Verhängnis hat es also beschlossen. Darum vergiß deines armen Sohnes
Freimund und laß dir dagegen nichts aus dem Gedächtnis kommen, was
ich dir gesagt habe; sorge auch besonders für deinen Sohn Raimund; denn
dieser wird an deines Bruders Stelle Graf vom Forst werden."
"Erinnere dich auch öfter", fuhr sie fort, "deines jüngsten Sohnes Dietrich,
welchen die Amme noch sanget, und wisse, daß selbiger dereinst zu
Portenach und Rochelle ein gebietender Herr sein und große Rittertaten
verrichten wird, auch alle seine Söhne sollen heldenmütige, berühmte Leute
werden. So viel sei dir, kaltsinniger Raimund, noch aus Mitleid und
Wohlmeinung zur Nachricht hinterlassen. Aber laß dir befohlen sein,
künftig den Himmel für mich zu bitten; denn auch ich will bedacht sein,
deiner nicht zu vergessen, sondern dir noch viel Trost und Förderung in
allen deinen Anliegen verschaffen, obschon du mich in weiblicher Gestalt
von nun an nimmer zu sehen bekommen wirst."
Als diese Worte gesprochen waren, verwandelte sie im Augenblicke ihre
Gestalt, nahm zur Hälfte die einer Sirene oder eines Fisches an und
sprang mit einem Satze auf das Fenster, um sich hinauszuschwingen. Doch
kehrte sie sich noch einmal um und wollte nicht ohne allerletzten Abschied
von ihrem Raimund und den Herren des Landes scheiden. Daher sprach
sie zum Beschlusse: "Lebe wohl, mein Raimund, ich vergesse, was du mir
zuleid getan Basil Lebe wohl, du bisheriger Besitzer meiner treuen Liebe,
du, selbst eine Zeitlang mein einziger treuer Freund! Ich verlasse dich mit
Schmerzen; ob du mich schon bitter betrübt hast, so habe ich dich dennoch
geliebt. Lebt auch ihr wohl, getreue Herren des Landes und Diener des
Hofes, ihr werdet mich nun nimmermehr bedienen; der Himmel segne
euch und auch mein Volk, dessen Gebieterin ich war. Lebet wohl, glücklich
und gehorsam unter meinem Raimund, solange ihr in seinen Diensten
stehen werdet! Der Himmel streue Glück auf dich, du mein herrliches
Schloß Lusinia, und seine Güte bedecke dich auch noch, wenn ich, deine
Stifterin, in leiblicher Gestalt ferne von dir bin!"

Indem sie solches sagte, verwandelte sie sich noch entsetzlicher, sprang
vom Fenster auf und fuhr zu aller Entsetzen zu demselben hinaus, in Gestalt
eines abscheulichen Wurmes vom Gürtel an, wie sie Raimund früher
allein gesehen hatte. So war dies eine recht unglückselige Stunde,
als Raimund über seinen Sohn Geoffroy Streit mit Melusinen angefangen
hatte. Jenes Hinscheiden aus dem Fenster geschah mit einem Rauschen
in der Luft, das sich dreimal um das ganze Schloß hören ließ, jedesmal
mit einem vernehmlichen Klagegeschrei, und so verlor sie sich aus
dem Gesicht und wurde hernach nicht wiedergesehen.
Raimund stand mit weit offenen Augen staunend und sprachlos da;
dann fing er bitterlich zu weinen und zu klagen an und sich sein Haar auszuraufen
und rief ihr mit wehmütiger Stimme viel tausend Abschiedsgrüße
nach. Seitdem sah man ihn nicht mehr fröhlich, solange er lebte.
Doch fanden sich noch gute Leute, die ihm mit Trost und Zuspruch nahten.
Einer aber von seinen Räten erinnerte ihn noch in selbiger Stunde, als
Melusina so kläglichen Abschied genommen, der Lehre, die sie ihm vor
ihrem Scheiden in betreff ihres Sohnes Horribil anempfohlen hatte. "ES
ist wahr", sagte Raimund, "aber meine Wehmut läßt mir nicht zu, jetzt
solches zu tun. Gehet ihr zur Stunde hin und vollbringet augenblicklich
ihren Willen, wenn ihr solches für gut befindet; weil ihr so getreulich mich
daran erinnert habt. Es sterbe die Natter, welche solches Blutbad mit
der Zeit anrichten soll, damit der Ruhestand des Landes erhalten und befördert
werde." Mit diesen Worten sonderte sich Raimund von ihnen ab,
verschloß sich in ein einsames Gemach und lag seinen Kummergedanken
seufzend ob. Die Diener aber, denen er die Tötung Horribils aufgetragen
hatte, nahmen den Knaben und führten ihn, dem Unglück vorzubeugen,
in einen Keller, verstopften hier alle Türen und Fenster, trugen nasses
Heu und Stroh herzu und zündeten es an, um nur nicht selbst Hand
an ihn legen zu müssen. So erstickte der Knabe im Rauch und Dampf.
Hernach richteten sie einen Sarg zu und beerdigten ihn ganz still in der
Kirche, womit Melusinas und Raimunds Wille vollzogen ward. Von
Raimund aber sah man noch geraume Zeit nichts; denn er hielt sich immer
ganz still in seinem Gemach verschlossen.
Melusina hatte ihrem verlassenen Gemahl zwei junge Söhne in der
Wiege zurückgelassen, die einer Säugamme übergeben waren. Diese hießen
Dietrich und Raimund. Deren Amme und Wärterin nahm zu verschiedenen
Malen wahr, daß Melusina in gespenstischer Gestalt bei später
Nachtzeit in die Schlafkammer kam, eins der Kinder nach dem andern aus
dem Bette hub, es an dem Feuer wärmte, sie an ihre Brust legte, säugte
und sodann wieder sanft in das Bett hineinlegte. Obwohl die Amme ein
solches Schauspiel nicht ohne Entsetzen ansah, unterstand sie sich doch nicht,
dem Geiste selbiges zu wehren oder einen Lärm darüber zu machen, sam
dern weil den Kindern dadurch kein Leid widerfuhr, ließ sie es mit Erstaunen
so geschehen. Doch wurde es als eine nicht zu verschweigende
Sache dem Raimund mit Betrübnis gemeldet und aller Verlauf berichtet.
Dieser hörte es mit innigem Vergnügen, tröstete sich damit in seinem
Kummer und labte sich an der nichtigen Hoffnung, seine geliebte Gemahlin
einst doch wiederzubekommen. Er befahl mit großem Eifer, daß
man auf keine Weise den Geist, sooft er komme, beschreien noch weniger
ihn verhindern oder ihm irgend zuwider sein sollte; denn er hielt es für
ein gutes Anzeichen und fühlte sich seitdem in seiner Betrübnis ein Merkliches
erleichtert.
Indessen nahmen die beiden Kinder, besonders das Herrlein Dietrich,
in kurzer Zeit gar trefflich zu, so daß man an ihren Kräften und ihrer
Gesundheit gar keinen Mangel verspürte, sondern sich vielmehr höchlich
darob verwundern mußte, wie sie in einem Monat fast mehr als andere
Kinder in einem halben Jahre wuchsen, so daß man solches Wachstum
der mütterlichen Milch zuschrieb, weil sie von dem Geiste gesäugt wurden;
obgleich niemand begreifen konnte, wie es damit zuging.
***Nun vernehmen wir wieder, wie es Geoffroy in dem Lande Norheim
ergangen ist. Dieser war glücklich angelangt, und zugleich erschallte in
dem ganzen Lande das Freudengeschrei, der junge, tapfere Ritter sei angekommen,

der im Lande Garande den ungeheuren Riesen erlegt hätte.
Jedermann eilte, denselben zu sehen, ja, es kamen alle Herren des Landes,
ihm Glück zu wünschen und ihm alle mögliche Ehre zu erweisen, wobei
ihm dann zugleich von einem der Vornehmsten erzählt wurde, wie
grausam der in ihrem Lande sich aufhaltende Riese bisher gehaust, und
wie er schon manchen tapfern Ritter erwürgt, ja, noch vor kurzem ihrer
wohl hundert auf einmal erschlagen hätte, das gemeine Volk gar nicht gerechnet.
Das ganze Land sei verwüstet und ausgeraubt.
"Das muß ein Teufel und kein Mensch sein", antwortete Geoffroy hierauf,
"doch seid getrost, ihr Herren, und helfet mir nur, daß ich ihn treffe;
dann verhoffe ich, mit Hilfe des Himmels gleichwohl Sieg und Ehre einzulegen,
und euch von diesem Ungeheuer zu befreien, wofür mir das ganze
Land danken möge!" Kaum hatte Geoffroy diese Worte ausgeredet; da
wurde ihm von den Landesherren ein erfahrener Wegweiser zugeordnet;
dem die Gegend des Landes, wo der Riese seine Wohnung hatte, wohlbekannt
war. Geschwind mußte nun alles zur Reise fertiggemacht werden;
dann beurlaubte er sich aufs höflichste von allen Herren des Landes
und ritt immer getrost dem Berge zu, wo der Riese am meisten sich aufzuhalten
pflegte. Als sie bereits den Berg hinanritten, hub der Wegweiser
zu Geoffroy an: "Gnädiger Herr! Auf diesem Berge, Avelon genannt,
und in dieser Gegend hat der Riese seine Wohnung." Geoffroy schaute
auf; denn sie waren gerade neben einem Felsen, in dessen Höhle der Riese
zum öftern zu sitzen pflegte. Der Wegweiser selbst zitterte, und es war
ihm nicht wohl bei der Sache zumut; er sah sich hier und da um, ob er
ihnen nicht von irgendeiner Seite her auf den Nacken käme. Unter
Umschauen ward er gewahr, daß unweit von einem gewaltigen Felsen der
große Valand oder Teufel, — wie ihn insgemein das Volk des Landes
nannte —sich unter einem lieblichen, schattenreichen Baum auf eine marmorne
Ruhebank niedergesetzt hatte. "Herr, wir sind des Todes", schrie
der erschrockene Wegweiser, "wenn wir nicht eilends zurückgehen! Ich bitte,
entlasset mich, dort oben auf der Anhöhe sehe ich das Ungeheuer sitzen!"
"Verzagter, was entsetzet Ihr Euch", sprach Geoffroy, "bleibet bei mir,
ich werde Euch und dem ganzen Lande Rettung verschaffen!" —"Immerhin"
, sprach dieser, "aber laßt mich unten! habe Euch nun den Weg
gewiesen, wo Ihr Euren Tod finden könnet; kommen wir weiter hinauf,
so treten wir schon auf Totenbeine." — "Blöder Mensch, ich werde dich
nicht entlassen", sprach Geoffroy, "wenn ich auch deine Hilfe nicht verlange
, so sollst du doch meinen Sieg mit anschauen." Und so nötigte er
ihn, unwillig und in höchster Angst den Berg mit hinaufzureiten. Geoffroy
mußte über den Zitternden lachen, der sich gebärdete, als hätte er das
dreitägige Fieber. Sie wurden auch bereits von dem Riesen Grymold
(denn dies war sein rechter Name) wahrgenommen, welcher aber aus
Verachtung ganz regungslos sitzenblieb.
Endlich, als sie ganz in der Nähe waren, hieß Geoffroy lachend und
mitleidig den Wegweiser mit seinem Pferd stillehalten, und dem Spiele
ruhig zusehen. Der Wegweiser versprach ihm zu bleiben, wenn der Kampf
nicht zu lange dauern würde. "Sonst", sprach er, "ehe mich der Schwindel
gar ankommt, werde ich das Weite suchen. Darum wagt Euer Leben
nicht allzu verwegen; denn dieser Wüterich hat schon viele tapfere Helden
aufgerieben." —"Sorget nicht, mein Freund", sprach Geoffroy und ritt
noch ein kleines weiter aufwärts, bis er den Riesen erreichte. Dieser wunderte
sich über des Ritters Kühnheit, der so allein bei ihm erschien; doch
dachte er, es könnte vielleicht ein vom Lande Abgefertigter sein, der etwas
bei ihm anzubringen hätte. Er stand deswegen von seinem Sitze auf,
nahm eine große, dicke Stange von Holderholz und ging dem ankommenden
Ritter auf einer schönen Bergwiese entgegen. Wenige Schritte von
Geoffroy hielt er still und schrie: "Wer und von wannen hifi du, Vermessener,
daß du so freventlich allein gegen mich zu reiten dich erkühnst?"
— "Ich komme", erwiderte Geoffroy, "mit dir zu streiten, du Ungeheuer,
und ohne weitere Worte dich herauszufordern!" — "So, hifi du deines
Lebens müde?"sprach der Riese. "Komm", sagte darauf Geoffroy, "und
mache nicht viel Worte! Ertöte mich, wenn du kannst!" — "Ei nicht so",
versetzte der Riese spottend, "schone meines Lebens, du Ohnmächtiger, und
bring mich nicht so eilends um!"
Dem tapfern Geoffroy griff diese Hohnrede ins Herz, er zückte seinen
Schild, ritt ohne ein Wort auf den Prahler mit seinem Speer los und traf
diesen so empfindlich auf die Brust, daß, wäre er nicht mit einem stählernen
Harnisch bedeckt gewesen, Geoffroy ihn auf den ersten Stoß durchrannt
haben würde. Aber auch so fiel er auf die Erde und kehrte die
Beine in die Höhe; doch raffte er sich geschwind wieder auf, so heftig er
den Stoß empfand. Der Ritter, welcher merkte, daß der Riese einen
Streich auf sein Roß zu führen beabsichtigte, sprang behend vom Pferde.
Da rief der Riese: "Du hast mir einen empfindlichen Bruststoß beigebracht,
kühner Ritter; bist du redlich und guten Herkommens, so nenne
mir deinen Namen!" —"Ich bin weltbekannt", sprach der Ritter, "und
heiße Geoffroy mit dem Zahn!" — "Sol" erwiderte der Riese; "habe ich
doch von dir gehört, daß du meinen Oheim, den Riesen Gedeon von Garande,
gefällt hast! Dafür soll dir bald dein Lohn werden!"Ungeduldig
griff der Riese zu seiner Stange und führte damit, weil er links war, einen
furchtbaren Streich auf Geoffroys rechte Hand. Aber dieser entwich dem
Hieb, so daß die Stange gegen den Felsen schlug und man den Streich
einen Schuh tief darin sehen konnte.
Unterdessen ergriff Geoffroy sein Schwert, und schlug dem Riesen auf
den Harnisch, daß Splitter davonsprangen und das Blut aus den Ritzen
hervordrang. Der Riese führte nun ganz grimmig einen zweiten und dritten
Streich, denen Geoffroy immer auswich, so daß die Stange, am Felsen
zerspaltet, in der Mitte zerbrach und der Arm des Riesen ganz müde
ward. Jetzt versetzte der Ritter dem Riesen einen Schwerthieb auf den
Helm, daß ihm Hören und Sehen verging; aber noch war dessen Faust
so kräftig, daß ein Schlag des Unbewehrten auf Geoffroys Helm diesen
wie einen Trunkenen taumeln machte. Doch faßte der Ritter wieder neuen
Mut und traf mit einem Streiche glücklich des Riesen Achsel, tief durch
den Panzer, so daß das Blut Strömen von ihm floß. Jetzt warf sich
der Riese rasend auf Geoffroy und begann, mit demselben zu ringen. Sie
faßten sich auch so gut, daß jedem der Atem ausgehen wollte. Aber der
große Blutverlust machte den Riesen kraftlos, so daß er abstehen mußte.
Dadurch kam Geoffroy abermals zum Schwerte, versetzte ihm einen neuen
Streich und zwang das Ungetüm, nach seiner Felsenhöhle zu eilen und sich
dort zu verbergen.
Dieser Fels, in den der Riese sprang, war ein düsteres Loch, wie ein
tiefer Keller anzuschauen, und der Held konnte ihn hier nicht mehr erreichen.
Der muntre Ritter schwang sich indessen fröhlich auf sein Pferd,
ritt zu dem Wegweiser, der noch zagend auf seiner Stelle stand, zurück,
erzählte ihm den ganzen Vorfall, den jener aus Angst nicht so genau beobachtet
hatte, und zeigte ihm seinen von den Fehlhieben des Riesen getroffenen
Harnisch, auch den Helm voll Beulen.
Während Geoffroy mit dem Wegweiser sprach, kamen die Herren des
Landes in Begleitung vielen Volkes. Sie meinten, der völlige Sieg sei
vollzogen, und fingen an, den Obsieger mit Glückwünschen zu überschütten.
Sie hörten aber bald, daß es ganz anders stand. Da fragten sie den
Ritter, ob der Riese sich nicht nach seinem Namen erkundigt habe. "Ja",
antwortete Geoffroy, "und ich habe es ihm auch ohne alles Bedenken frei
herausgesagt!" —"Nun", fing einer von den Herren an, "dann wird er
auch nicht mehr aus seiner Höhle herauskommen, solange der tapfere
Geoffroi im Lande ist; denn er hat eine sichere Weissagung, daß er von
diesem abgetötet werden soll." — "Wenn er auch sich nicht herauswagen ',
antwortete der Ritter, "so will ich ihn dennoch töten, um den Sieg vollzumachen.
. Ich mag aus diesem Lande nicht scheiden, ehe meine Faust dieses
Ungeheuer erlegt hat!"
Ein anderer Landesherr, der Mitleid mit dem jungen Helden empfand,
fing an, ihn zu warnen; denn in dem Berge gebe es Gespenster und seltsame
Abenteuer: der alte Beherrscher des Landes Norheim, König Helmas,
sei von seinen drei Töchtern in diesem Berge verschlossen worden
und habe bis zu seinem Tode dort bleiben müssen, einzig darum, weil er
Persona, seine Gemahlin, im Wochenbette besucht und daher ihre Geheimnisse
erkundigt hätte. Auch wisse man nicht, wohin hernach die drei Töchter
des Königs mitsamt ihrer Mutter gekommen seien. Einen Riesen habe
es an diesem Ort immer gegeben, und der habe den Berg gehütet; der
jetzige sei bereits der fünfte oder der sechste, und alle hätten das Land
verwüstet und mit Feuer verheert. Insonderheit habe dieser alle Helden,
die gegen ihn ausgezogen, bezwungen und getötet. Geoffroy sei glücklicher
gewesen als alle Könige ihres Landes, die nicht hätten wagen dürfen,
was er gewagt. Jedoch sollte erden Riesen nicht anders bestehen, als
wenn derselbe außerhalb des Berges zu treffen wäre.
Geoffroy, durch diese Rede bewogen, versprach ihnen, jedenfalls den
Riesen zu erlegen, und nun ritten sie, weil die Nacht herbeirückte, den
Ritter aufs ehrerbietigste begleitend, mit ihm zur Abendtafel nach ihrer
Stadt zurück.
***Als der frühe Morgen anbrach, machte sich der Held Geoffroy auf den
Weg und ritt wieder dem Berge zu. Dort angekommen, hatte er eine gute
Zeit zu suchen, bis er unter so vielen Löchern und Klüften das rechte und
den Eingang zu der Riesenhöhle traf. Geschwind, als er solchen gefunden
, sprang er vom Pferde, ergriff seinen Speer, bezeichnete sich mit dem
Kreuz und ließ sich in das Felsenloch hinab, nachdem er sich von dem ihn
begleitenden Ritter verabschiedet hatte, und es ward ihm unter tausend
Wünschen Glück nachgerufen. Als er Grund spürte, stieß er mit vorgehaltenem
Speer überall herum, ob er nicht den Riesen in irgendeinem
Winkel der Höhle auffinden möchte. So kam er immer tiefer hinein, bis
er einen Lichtschimmer sah, dem er nachging, und der ihn in eine helle
Kammer führte, die nur eine Türe hatte, aber mit Gold, Silber und
Edelgesteinen sehr herrlich angefüllt war.
Er sah sich verwundert in dem Gemach um: in der Mitte der Kammer
stand ein erhabenes Grabmal auf sechs zierlichen Pfeilern mit Edelsteinen,
die in diesem Berge häufig wuchsen, reich geziert; auf dem Male
war ein bewaffnetes gekröntes Königsbild, aus milchblauem durchsichtigem
Chalzedon, liegend abgebildet; zu dessen Füßen war ein Frauenbild
zu sehen, das eine Tafel von etlichen Blättern in den Händen hielt; auf
der war folgende Schrift ganz deutlich zu lesen: "Dies ist der König Helmas,
mein liebster Gemahl, der hier begraben liegt; ein mächtiger König
von Nordland, der mir geschworen, mich zur Gemahlin zu erkiesen, doch
nie mich im Wochenbette zu besuchen noch besuchen zu lassen. Weil er
treubrüchig geworden, verlor er mich. Die drei schönen Töchter; die ich
im selben Jahre geboren, nahm ich mit mir; säugte, ernährte, erzog sie
bis ins fünfzehnte Jahr; er wußte nicht, wo. Dann entdeckte ich ihnen
des Vaters Untreue, darüber wurden sie eifernd, und insonderheit beschloß
die jüngste, Melusina, solch Verbrechen an ihrem Vater statt meiner
selbst zu rächen. So sperrten sie ihn in diesen Felsen ein bis ans Ende
seines Lebens. Ich selbst begrub ihn unter diesen Stein: und daß sein
Grab vor Dieben, Räubern und Schatzgräbern sicher wäre, habe ich den
Riesen hieher gelegt, Grab und Felsenhöhle zu hüten. Meine drei Töchter
haben drei besondere Merkzeichen: die jüngste, Melusina, die sehr klug
und scharfen Verstandes ist, das, daß sie alle Sonnabende vom Gürtel an
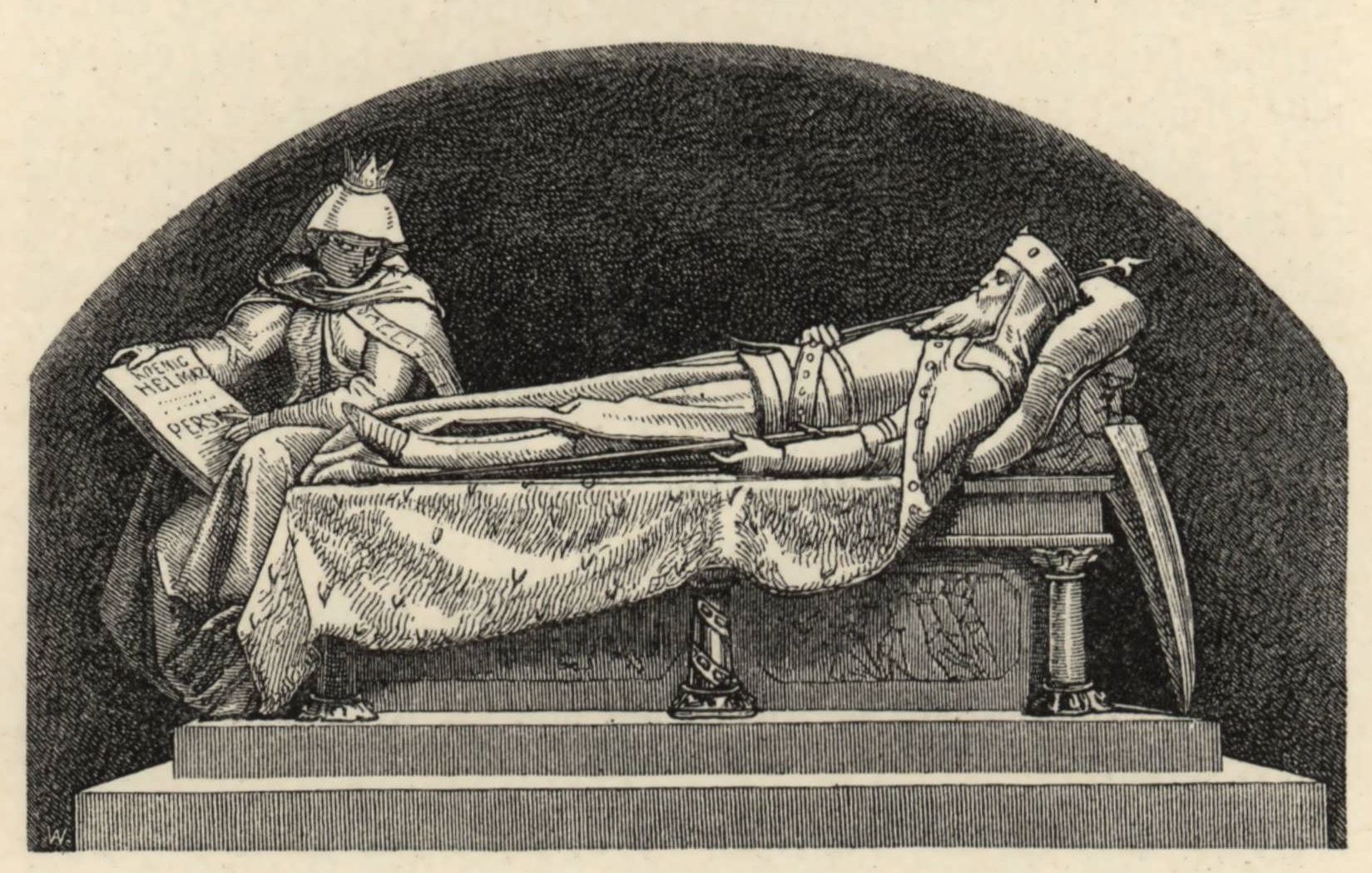
zur Schlange wird. Wer sie freit, soll ihr geloben, sie an selbigem Tage
weder zu besuchen noch zu sehen, noch nach ihr zu fragen, auch keinem
Menschen solch Geheimnis entdecken. Melora, meiner zweiten, wunderschönen
Tochter legte ich auf, daß sie als Geist eines herrlichen Bergschlosses
in Armenien hüten, daneben unablässig einen Sperber auf dem
Haupte haben soll. Wer sich ihr nahen will, der muß von adeligem Ritterblute
sein, ohne Entsetzen drei Tag ' und drei Nächte des Sperbers
schlaflos hüten, keine Furcht und Scheu tragen: dann soll ihm vergönnt
sein, von dem jungfräulichen Geist eine Gnade, welche er will, außer
ihrer Person und Liebe zu erbitten. Wer sich aber vom Schlaf überwinden
läßt, der soll sein Lebenlang, bis zum Jüngsten Tage, des Geistes
Gefangener sein. Meiner dritten Tochter, Plantina, gab ich auf dem
hohen Berge Roniche in Arragonien ihres Vaters unendliche Schätze zu
hüten, bis sich einer unseres Geschlechtes findet, der Burg und Schatz mit
wehrhafter Hand erobert und König zu Jerusalem werden wird. Solches
habe ich, ihre Mutter Persina, ihnen auferlegt. Damit begnüge sich, wem
diese Tafel zu Gesichte kommt!"
Geoffroy, der den Inhalt dieser Blätter bedächtlich gelesen, geriet in
großes Staunen. Er merkte jetzt, daß seine Mutter die Nymphe Melusina
war, und König Helmas sein Großvater, Persina seine Ahnfrau gewesen.
Aber völlig wollte er es erst glauben, wenn er glücklich den Riesen
erlegt hätte; dann erst wollte er sich für jenen wahren Erben und vom
Schicksal dazu ersehen halten. Mit neuem Eifer verließ er das Zimmer,
allenthalben mit dem Speere umherfühlend. In solchem Fortgehen geriet
er auf einen weiten Platz, auf dem sich sogar ein hoher Turm befand, so
daß er ganz aufrecht gehen konnte. Er nahm daher seinen Speer bequem
auf die Achsel und ging unter scharfem Umschauen auf den Turm los, den
er offen und darin herrliche Gemälde fand.
Im Hingehen jedoch bemerkte er unter dem Gebäude einen abscheulichen
Kerker, in welchem sich viele Gefangene befanden, die sich alle höchlich
verwunderten, woher er käme, uno welcher entschlossene Mut ihn so weit
gebracht. Einige warnten ihn mitleidig vor dem Niesen, dagegen riefen
andere: "Schweigt, ihr redet zu unser aller Schaden; laßt den jungen
Helden doch ziehen, er dürfte vielleicht unser Erlöser werden! Gott der
Herr, der ihn hiehergeleitet hat, wird ihn auch noch weiter bewahren können
Diese Rede gefiel Geoffroy wohl, er wurde noch mutiger in seinem
Sinn und hub lächelnd zu fragen an: "Wo ist das Ungeheuer, das euch
also quält? Zeiget mir den Ort, daß ich meinen ritterlichen Mut an ihm
üben möge!" Darauf hub einer von den Gefangenen an: "Nehmet Euer
Leben in acht, Herr Ritter; Ihr werdet ihn bald zu sehen bekommen!"
Kaum waren diese Worte gesprochen, so kam der Riese dahergetreten.
Aber statt daß Geoffroy vor ihm hätte fliehen sollen, erschrak der Riese,
als er den Ritter erblickte, und verkroch sich vor ihm in ein Gemach, dessen
Türe er eilig hinter sich zuschloß. Geoffroy, dadurch ganz kühn gemacht,
sprang ihm schnell nach und pochte an die Türe so mächtig, daß sie
in Stücke sprang, so gut sie das Ungeheuer von innen verriegelt hatte.
Nun hatte aber der Riese einen großen viereckichten Hammer aus Stahl,
mit dem gab er dem Ritter einen Streich aufs Haupt; aber der Helm
hielt ihn aus und blieb unbeschädigt. "Dieser Streich soll dir gedoppelt
auf deinen verfluchten Schädel fallen", rief Geoffroy, und nun zog er
sein Schwert und stach den Riesen durch und durch, so daß er auf die
Erde fiel. Dies geschah mit einem solchen Schrei, daß der ganze Turm
davon zu zittern schien. Damit blies er zugleich seinen Atem aus, und
die Leiche lag ausgestreckt auf der Erde.
Da dankte Geoffroy dem Höchsten für den verliehenen Sieg, steckte das
Schwert in die Scheide, eilte zu den Gefangenen in dem Turme und fragte
sie, ob sie aus dem Lande der Norheimer wären, und als sie dies bejahten:
was denn ihr Verbrechen sei. Darauf sagten sie ihm, daß sie den
Tribut nicht bezahlen konnten, den der Riese von ihnen forderte. "Nun
so sei euch derselbe mitsamt eurer Freiheit geschenkt!" sprach Geoffroy
und versprach ihnen, unter Jauchzen und Frohlocken, ihren Kerker zu
öffnen. "Aber", fragte er, "ihr müßt mir auch sagen, wo die Schlüssel
des Gefängnisses aufbehalten werden." Das wußte keiner; Geoffroy selbst
mußte lange Zeit suchen, bis er endlich den Schlüssel fand und über zweihundert
Gefangene befreite. Diese führte er alle in das Zimmer, wo er
den Riesen erlegt hatte; sie betrachteten die Leiche des Ungeheuers mit
Entsetzen und weideten sich mit Staunen an der Heldentat des jungen
Ritters.
Dann sprach dieser zu ihnen: "Höret, lieben Freunde und erledigte Gefangene
, womit ich euch erfreuen will. Es liegt in diesem Berge und seinen
verschiedenen Höhlen ein großer Schatz an Gold, Silber und Edelsteinen
verborgen. Das alles schenke ich euch; denn ich will von dem übel
gesparten Gute nichts haben!" Die armen Leute konnten nicht aufhören
danken; sie wollten auch das Geschlecht des edlen Ritters wissen; denn
seit König Helmas ' Tode sei kein Mann lebendig aus diesem Felsen gekommen.
Der Ritter willfahrte und sagte ihnen, daß er Geoffroy mit dem
Zahne heiße: dann erzählte er ihnen von seiner Herkunft weitläufig.
Hierauf begleiteten ihn die Befreiten zum schuldigen Dank aus der Höhle.
Vorher hatten sie noch einen Karren zubereitet, auf den der ungeheure
Riese geworfen und aus dem Berge hervorgesogen wurde. Die Leiche saß
auf dem Karren, mit Ketten gebunden, aufrecht, als lebe das Ungeheuer
noch; so führten sie das Scheusal im Lande herum, jedermann zur Verwunderung
und zum Abscheu. Alles Volk lief herzu und dankte Gott und
lobte den Sieger Geoffroy, der zur rechten Stunde gekommen sei.
Mittlerweile kam Geoffroy wieder zu den Herren des Landes, von welchen
er vor kurzer Zeit geschieden war, und die mit großer Betrübnis und
unter vielen Zweifeln seiner gewartet hatten. Da ward ihm und den befreiten
Gefangenen alle ersinnliche Ehre angetan. Und weil gerade der
König von ganz Norheim ohne Leibeserben mit Tod abgegangen war, so
wurde ihm nicht nur großes Geld und Gut, sondern die königliche Krone
selbst angeboten, wenn er bei ihnen bleiben wollte. Dies alles aber schlug
Geoffroy mit großer Höflichkeit ab, und nach kurzer Zeit machte er sich,
von ihnen allen gesegnet, wieder reisefertig auf den Weg, nachdem er zuvor
den Landesfürsten die Verwesung des Reiches und seine Wohlfahrt
sorgsam anbefohlen hatte. Und nun reiste er mit großem Verlangen, seinen
Vater und seine Mutter nur recht bald ansichtig zu werden, von dannen,
bis er an das Meer kam, wo er zu Schiffe saß und nach seinem Vaterlande,
der Herrschaft Garande, zu segelte. Als das Volk seine Ankunft
gewahr wurde, lief ihm alles voll Freuden zu, ihren Erretter wiederzusehen
und zu bewillkommen, weil es noch nicht so lange her war, daß er
sie von dem Riesen Gedeon erlöset hatte.
***Nun kam die Kunde von seiner Rückkehr auch zu seinem Vater Raimund.
Er ritt, seinen Sohn Geoffroy zu empfangen, ihm entgegen und
hielt auf der Straße, wo er vorbei mußte, zumal da ihm schon hinterbracht
worden war, wie viel Ruhm und Ehre jener im ganzen Reich Norheim
erlangt hätte. Diese neue Freude hatte den guten Raimund wieder
ein wenig seines schweren Kummers entledigt. Er wartete deswegen nicht
länger, sondern ritt in seines Herzens Fröhlichkeit gar bis an das Gestade
des Meeres, wo sein Sohn bei seiner Ankunft unfehlbar landen mußte.
Dies geschah, und es war ein rechter Freudenempfang von beiden, der gar
beweglich anzuschauen war, so daß vielen die heißen Tränen darüber ausbrachen
. Endlich nahm der Vater Raimund seinen Sohn bei der Hand,
führte ihn beiseite und entdeckte ihm sein ganzes Herzeleid, den Verlust
seiner Mutter und alles, was sich bisher zugetragen.
Geoffroy erschrak darüber heftig; er merkte wohl, daß auch sein böses
Beginnen hierzu nicht wenig geholfen und das Öl zum Feuer gegossen
hatte. Von innerlicher Reue und Bewegung des Herzens brach ihm der
Angstschweiß aus, und er sprach: "Sei es dem Himmel geklagt, in welchen
Jammer ich mich durch mich selbst gesetzt sehet" Unter so kleinmütigen
Seufzern stand er eine gute Weile in sich gekehrt; dann fing er an, und
erzählte dem Vater von der Tafel und Schrift, die er in dem Gespensterberge
im Norheimerlande gefunden und gelesen habe, und von dem ganzen
Begräbnis. Raimund vernahm zu seinem Troste, was er vorher selbst
nicht gewußt, wer nämlich Melusina, seine Gemahlin und Geoffroys
Mutter, gewesen, und daß sie aus königlichem Geschlechte entsprungen
war. Dagegen hatte auch sein Sohn hinwider von seinem Vater erfahren,
was er noch nie gewußt, wie nämlich des Vaters Bruder ihn gereizt,
seine Melusina an einem Sonnabend zu besuchen und am Ende gar ihren
Zustand ihr vorzuwerfen und sie damit zu beschämen.
Darüber schwur Geoffroy dem Grafen den Tod. Er setzte sich zu Pferde
und ritt in Begleitung seines jungen Bruders Raimund Tag und Nacht
auf den Forst zu, worüber denn Raimund, sein Vater, in neuen Kummer
fiel; denn es reute ihn, daß er seinem Sohn alles so klar geoffenbaret
hatte, und nun vielleicht auch dieses zu einem bösen Ende ausschlagen
möchte.
Geoffroy aber gelangte von niemand erkannt und in aller Stille in die
Grafschaft vom Forst und bis dicht an das Schloß des Grafen. Dies fand
er offen, stieg alsbald von dem Pferd ab und kam unversehens in den
Saal, wo sein Oheim sich aufhielt. Geschwind griff er nach der Wehre,
rannte auf ihn zu und fuhr ihn mit ungestümer Rede also an: "Ha, Verräter,
du bist derjenige, durch welchen wir alle unsere Mutter verloren
haben. Aufrührer, Verführer, Bösewicht, du mußt des Todes sterben."
Der Graf vom Forst, von dieser Überraschung ganz bestürzt, wußte nichts
anders zu tun, als sich zu retten und sein Heil in der Flucht zu suchen.
Er verschloß sich in einen Turm, dessen hohe Treppen er hinaneilte, und
war froh, als er sich vor dem Zorn des Ritters geborgen sah.
Weil nun Geoffroy diesmal nichts ausrichten konnte, hub er an, aufs
heftigste in Worten gegen des Grafen Diener zu toben, die ihm aber alle
entliefen. Dadurch fand er freie Bahn, den Grafen noch weiter zu verfolgen
, so daß dieser endlich zu einem Fenster des Turms hinausspringen
mußte um sich auf ein gegenüberstehendes Dach zu flüchten; er verfehlte
es aber mit seinem Sprunge und fiel zu Tode. Nun ließ ihn Geoffroy begraben,
und die Seinen, die ihn an dem grimmigen Ritter nicht zu rächen
wagten, bejammerten ihn alle. Dann befahl Geoffroy den Dienern, daß
sie nunmehr seinem Bruder Raimund ohne alle Widerrede huldigen sollten;
dies taten sie mehr aus Furcht als aus gutem Willen; denn alles
Land scheute seinen Namen.
Der schwermütige Vater Raimund war inzwischen auch nach Lusinia zurückgekehrt,
aber voll Unmut und Betrübnis; denn die Tötung seines leiblichen
Bruders durch seinen Sohn Geoffroy war ihm berichtet worden.
Aber er konnte nicht ändern, was geschehen war. Er versank nun aufs
neue in die tiefste Reue und beschloß, nach Rom zu ziehen, dort ernstliche
Buße zu tun und nimmermehr nach Hause zu kommen, sondern sein Leben
in einem Kloster mit Weinen und Beten zu beschließen. Während er sich
mit so traurigen Gedanken abquälte, siehe, da kam sein Sohn Geoffroy
in den Schloßhof eingeritten, stieg vom Pferde, ging zu seinem betrübten
Vater hinauf und fiel vor ihm alsobald auf die Knie. Da bat er um
Gnade wegen aller seiner Missetaten und gestand ganz freimütig, daß er die
einzige Ursache aller schmerzhaften Verluste sei, die seinen Vater betroffen.
"ES ist so, mein Sohn, wie du sagst", hub Raimund seinem Sohn zum
Troste an, "allein wir können die Toten mit allen unsern Klagen nicht
erwecken. Doch sei dir hiermit zur väterlichen Strafe auferlegt, das verbrannte
Kloster Mallières wieder aufzubauen und andere Mönche zu
Dienst und Ehren Gottes darein zu stiften." Geoffroy ließ sich dieses gar
gerne gefallen und versprach, dasselbe herrlicher und reicher zu bauen,
als es zuvor gewesen. Dies tröstete den alten Raimund nicht wenig.
"Wohlan", sprach er, "die Vollziehung deines Versprechens wird deinen
Gehorsam betätigen, mein Sohn Geoffroy! Doch vernimm das, was ich
dir jetzt entdecken will. Ich habe mir zur Buße eine Reise in fernes Land
vorgesetzt und will dies jetzt als ein Gelübde vollbringen. Demnach befehle
ich dir, das Land löblich zu regieren, daß du dich als ein Vater und
nicht als ein Tyrann, wie du bisher gepflogen, gegen die Untertanen erweisest,
deinen jüngsten Bruder aber, meinen Sohn Dietrich, in aller
Frömmigkeit und Tugendübung getreulich anstatt meiner auferziehest und,
wenn er erwachsen ist, ihm die Herrschaft Portenach, Favent und Rochelle
zum Besitze einräumest. So hat es mir deine selige Mutter anempfohlen,
und ich will es auch dir ans Herz gelegt haben; denn es scheinet ein gar
sonderliches Licht aus dem Knaben, welches wohl zu pflegen ist."
Geoffroy versprach ihm reumütig unverbrüchlichen Gehorsam, und dem
Raimund rannen über seinen treugemeinten Worten die Freudentränen
über die Wangen. Dann berief er alle Untertanen zusammen, stellte
ihnen seinen Sohn als künftigen Regenten vor, ließ die Huldigung vor sich
gehen und trat die Reise an. Seine Söhne Geoffroy und Dietrich gaben
ihm mit einem kleinen Gefolge zu Roß das Ehrengeleit. Am andern Tag
umhalsten sie den Vater und nahmen einen tränenvollen Abschied.
***Der junge Dietrich wuchs gerade und herrlich heran und hatte die
Mannsjahre erreicht. Da tat er dem väterlichen Befehle gemäß einen
schönen Ritt nach Portenach und nahm daselbst Besitz von seinem Erbteil
mit den andern ihm zugehörigen Orten. Er regierte klug und glücklich
und galt für einen weisen Regenten des ganzen Landes. An Tugend,
Tapferkeit und Heldentaten nahm er alle Tage zu; sein Vater Raimund
aber, obgleich er lebte, war dem Lande längst gestorben. Inder Folge
heiratete Dietrich eine schöne Dame aus der Bretagne, und es stammet
bis auf diesen Tag von ihm das hohe Geschlecht derer von Portenach.
Geoffroy hatte nach halber Jahresfrist das Kloster Mallières schöner
und größer, als es zuvor gewesen, wieder aufgebaut. Der vorher so wilde
und grausame Mann zeigte bei diesem Bau einen solchen Bekehrungseifer
, daß in dem ganzen Lande das Sprichwort von ihm erscholl: "Geoffroy
ist ein Mönch, der Wolf ist ein Schaf geworden."Obwohl ihm nun
dieser Spott zu Ohren kam, fuhr er doch in dem guten Werke fort und
ruhte nicht, bis es fertig dastand.
Inzwischen war Raimund zu Rom angelangt und hatte vor dem Papst
seine Beichte wehmütig abgelegt, Absolution empfangen und die auferlegte
Buße mit demütigem Gehorsam angenommen. Auf die Frage des Papstes,
was jetzt sein Vorsatz wäre, erwiderte er: "Allerheiligster Vater, ich
gedenke, mein Leben an einem Orte zu schließen, wo nicht viele Leute um
mich sind; denn ich möchte mich von der Welt absondern." Und als der
Papst diesen Vorsatz lobte und ihn um den Ort befragte, den er sich ausersehen
hätte, da sagte er, daß er nach Montserrat in Aragonien, zu Unserer
Lieben Frauen Kloster, Belieben trüge; denn der schöne, reine Gottesdienst
, der dort gepflogen werde, gefalle ihm vor allen andern.
Da wurde ihm vom Papst ein Priester und ein Schüler zugeordnet, die
ihn sein Leben lang bedienen sollten. So nahm er seinen Abschied, und
sie ritten zusammen mit einem schönen Gefolge von Rom weg. Als er zu
Tolosa ankam, wurde er wider seinen Willen dort aufs herrlichste empfangen
und ihm alle mögliche Ehre angetan. Nun entließ Raimund alle
andern Diener und behielt niemand als den Priester und Schüler bei sich.
Und sowie er an dem erwünschten Orte angekommen war, ließ er sich und
dem Priester Einsiedlerskleider machen und begab sich in das Gotteshaus,
dem Herrn dort zu dienen, solang er lebte.
Als seinem Sohne Geoffroy die Ankunft Raimunds zu Rom berichtet
wurde, beschloß er bei sich, seinen Vater auch noch einmal zu sehen und
in Rom aufzusuchen. Er übergab seinem Bruder Dietrich die Regierung
für einige Zeit und machte sich auf. Zu Rom angelangt, beichtete auch er
dem Papste und erfuhr von diesem, daß sein Vater ein Einsiedler zu Montserrat
geworden wäre. Dem Geoffroy wurde aber eine weit härtere Buße
auferlegt, insbesondere, daß er darauf bedacht sein sollte, vor allen Dim
gen das Kloster Mallières wieder aufzubauen und hundertundzwanzig
Mönche darein zu stiften. Der Ritter erklärte dem Papst, daß bereits das
Gebäude weit größer und herrlicher, als es zuvor war, wieder aufgerichtet
stünde; da lobte der Papst diese rühmliche Tat und nahm sie für hin-
reichende Buße an. "Euer Vorsatz ist gut", sagte der Heilige Vater zu
ihm, "und der Himmel vermehre seine Gnade an Euch noch ferner l Wenn
Ihr Euren Vater am Orte seiner Andacht besuchen wollet, so begleitet
Euch mein väterlicher Segen!"
Der Ritter zog weiter und traf seinen Vater zu Montserrat. Des Halsens
und Küssens war kein Ende. Aber vergebens bemühte sich Geoffroy,
den alten Raimund zu bewegen, daß er mit ihm zurückkehren und sein Leben
zu Lusinia in gleichmäßiger Ruhe beschließen möchte. Er machte sich

daher nach fünftägigem Aufenthalte bei ihm wieder auf den Heimweg,
nachdem er vergnügte Unterhaltung mit ihm gepflogen und von allem
Bericht eingenommen hatte. Beim Abschied aber vergossen Vater und
Sohn bittere Tränen. Kaum war Geoffroy wieder zu Mallières angelangt,
so besetzte er das Kloster mit der verlangten Anzahl von Mönchen
und sorgte in allem für ihren Unterhalt.
Als nun auch er gealtert war und mit seinem hochbejahrten Vater dem
Ende entgegenging, verfügte er sich noch einmal nach Aragonien zu diesem
, den er, wiewohl schwach und hinfällig, noch beim Leben traf. Er
empfing von ihm den Segen, drückte dem lebenssatten Greise die Augen
zu und bestattete ihn ehrlich. An dem Freitag aber, ehe Raimund starb,
drei Tage vor dessen Tode, hörte man zu Lusinia über dem Schlosse ein
Rauschen; das war der Geist Melusinas, der das Schloß dreimal umkreiste
, und, wie sie einst ihrem Gemahl verkündet hatte, allem Volk seinen
Tod weissagte.
Der alte Raimund hinterließ sein Geschlecht in hohen Ehren blühend. —
Sein ältester Sohn Reinhard regierte in Böhmen und tat den Ungläubigen
großen Widerstand; Antonius führte das fürstliche Regiment als
Herzog von Luxemburg; der jüngere Raimund war Graf vom Forst;
Uriens regierte in Zypern, tat auch den Heiden große Drangsale an und
stand den Rittern auf der Insel Rhodus getreulich in ihren Nöten bei.
Gyot aber war König von Armenien und verfuhr auch streng gegen die
Heiden; Gedes war frühzeitig gestorben, Horribil im Keller erstickt, Freimund
mit dem Kloster verbrannt. Geoffroy, der tapfere Riesenwürger,
war Herr in Mallières und Lusinia, und Dietrich, auch ein berühmter
Held und Ritter, hielt zu Portenach Hof.
***Das alles aber lassen wir jetzt beiseite und melden von einer sonderbaren
Begebenheit in Armenien, wo Gyot als König regiert hatte. In
diesem Königreiche nämlich war ein Schloß, in welchem ein Gespenst
hauste; genau nach der Beschreibung, die Geoffroy auf dem Denkmal im
Riesenberge zu Norheim von dem Geist auf dem Berge Avelon gelesen
hatte. Ebendaselbst fand sich auch ein Sperber von sonderbarer Art. Wer
bei diesem Gespenst Gnade finden und seines Lebens sicher sein wollte,
der mußte sein Geschlecht vom lusinischen Stamme erweisen, dann drei
Tage und Nächte ohne Schlaf dem Sperber wachen und ihn hüten kön-
nen; anders vermochte er ohne Lebensgefahr nicht, sich diesem Schlosse
zu nahen. Hatte er aber dies ohne Anstoß verrichtet, so durfte er eine
Gabe fordern, nur die Person und Liebe der Jungfrau Melora nicht. So
nämlich hieß das Gespenst, wie wir oben aus der Grabtafel schon vernommen
haben.
Nun war nach Gyots Zeit ein König in Armenien, der wollte sich unterstehen,
, dem Sperber zu wachen, aber begehrte, sich die verzauberte Jungfrau
selbst als Gnade auszubitten und sie unter dieser Bedingung zu erlösen.
Doch hielt er es in seinen Gedanken nur für ein Gaukelspiel und
eine Posse. Aber endlich machte er sich wie zum Spaße dahin auf; die
Sache in Augenschein zu nehmen. Als er nun unfern von dem Orte auf
eine Wiese gerade unterhalb des Schlosses gelangte, ließ er ein Gezelt
daselbst aufschlagen, verfügte sich aber in voller Rüstung den Berg hinan
bis an das Tor des Schlosses, darin sich der Geist und der Sperber befand
. Er hatte deswegen auch einen Köder in der Hand, um den Sperber
damit zu ätzen. Indem er nun solches Vorhabens war, begegnete ihm auf
dem Wege vor dem Schloß ein alter Mann, ganz bleich und mager von
Gestalt; weiß gekleidet. Der fragte ihn, was er hier suche. "Ich will den
Bedingungen, die für dieses Schloß festgesetzt sind, ein Genüge leisten und
dem Sperber wachen", sagte der muntere König. "Wohlan", versetzte der
Alte, "so kommet denn mit mir; ich will Euch hierzu anweisen und an
den Ort führen, Ihr leisten könnt, was Ihr schuldig seidl"
Hierauf führte der Alte ihn in einen herrlichen Palast und Saal, welcher
des Königs Bedünken nach zuoberst in dem Schlosse zu sein schien.
Alles sah so majestätisch und prächtig darin aus, daß sich jener nicht genug
verwundern konnte. In diesem schönen Gemache nun zeigte sich auch ein
Sperber, auf einer Stange sitzend, der gar schön und wohlgestaltet anzuschauen
war. "Hier ist der Ort", hub der Alte an, "wo Ihr drei Tage
und drei Nächte wachen müsset, und wenn dies vorüber ist, habt Ihr die
Freiheit, um alles zu bitten, was Ihr wollt, nur nicht um die Person und
die Liebe der Jungfrau. Wenn Ihr aber Eure Wache schläfrig und also
zum Unglücke verrichtet, so sollt Ihr wissen, daß Ihr bis an den Jüngsten
Tag in diesem Schlosse bleiben müsset!" — "Wohl", sagte der allzufreche
König, "ich werde meine Schuldigkeit aufs beste tun, hernach aber
auch die gebührende Gabe zu fordern wissen!" Damit zielte er aber in
seinen Gedanken einzig und allein auf die Jungfrau. Er hätte aber viel
klüger getan, wenn er dem Alten gefolgt wäre.
Nun vollzog er einen Tag und eine Nacht seine Wache mit Freuden und
ätzte den Sperber auf das beste, so daß es schien, als ob einer mit dem andern
gar wohl zufrieden wäre. An köstlichem Essen und Trinken zu bestimmten
Zeiten war kein Mangel, und dies stand dem König in einem
Augenblicke vor dem Gesicht, so daß er sich auf das niedlichste pflegen
konnte, als ob er an seiner königlichen Tafel selbst säße. Des andern Tags
am Morgen ätzte er wieder den Sperber und verrichtete seine Wache vortrefflich
. Indem erblickte er eine überaus schöne Kammer, deren Türe
offenstand. In diese trat er ein und betrachtete mit Verwunderung, wie
kunstvoll sie mit Abbildungen von Vögeln aller Art bemalt war; die Felder
waren mit Gold aufs feinste ausgefüllt; dazwischen aber waren allerlei
Rittergebilde, mit Schild und Helmen gewappnet, in Lebensgröße mit
beigeschriebenen Namen zu sehen. Diese alle hatten dem Sperber gewacht
und in dem Schlosse geschlafen, waren aber nachlässig gewesen, und es
war nun unter den Bildern ihre ewige Sklaverei bis an den Jüngsten
Tag, mit Beifügung des Jahres und Tages, wo es ihnen mißlungen, zugleich
angedeutet. Nicht minder standen an drei besonderen Enden noch
drei andere Ritter abgebildet, ebenfalls gewaffnet, welche ihre Wache sehr
wohl verrichtet, wie nebst Jahr und Tag die Inschrift meldet; unter
ihnen stand eingeätzt der Name, wie auch das Land, aus dem sie stammten.
Aber der König wollte sich auch in diesem Gemache nicht lange verweilen,
sondern kehrte zum Sperber zurück, um nicht Unlust für sein getreues
Wachen zu verdienen. So erreichte er mit seinem Fleiße auch den
dritten Morgen. Siehe, da kam die gespenstische Jungfrau, in grünem
Kleide aufs prächtigste angetan, mit ganz freundlichen Mienen auf ihn
daher in das Gemach gegangen, grüßte und empfing den König und redete
ihn mit den höflichsten Worten also an: "Ihr habt Euer Vorhaben gar
klug und glücklich geendet und der Sache ein Genüge getan; so fordert
denn nun auch Eure Gabe, damit solche Euch gereicht werde."
Der König, sich ein wenig rüstend, dankte für das gute Anerbieten und
fing ganz hochmütig an: "Ich will keine andre Gabe als Euch selbst und
Eure Liebe davontragen." Die Jungfrau, als sie dies hörte, erwies sich
etwas zornig, erwiderte ihm jedoch also: "Ihr müsset eine andre Gabe
fordern, Freund; denn ich selbst kann Euch nicht werden!" Der König
aber wollte von solcher Forderung nicht abstehen, sondern beharrte auf
seiner Rede, worüber die Jungfrau, noch zorniger, ihm folgende Antwort
gab: "Ihr strebet nach Unglück; ich warne Sneh vor solchem und rate
Euch, alsbald von Eurem Verlangen abzustehen, wenn Ihr anders wollet;
daß Euer Königreich nicht aus Euern Händen gerissen werde."
"Sei es töricht oder klug gehandelt", hub der vermessene König wieder
an, "so werde ich doch nicht ablassen, Eure Person zur Belohnung zu fordern,
und mich mit keiner andern Gabe befriedigen lassen, so wahr ich
König von Armenien heiße!" Die Jungfrau, darüber noch mehr entrüstet;
antwortete dem Ritter: "Du handelst so töricht als dein Großvater Raimund,
welcher in beharrlicher Torheit den weisen Rat verwarf und sein
Gelübde brach, worüber er alles verlor, was er gehabt hatte. Auch du hast
nun all deine vermeintlichen Gaben, nach welchen du getrachtet hast, verloren
. Von nun an ist nichts als Unglück und Trübsal dein Teil, wie es
deinem Großvater ergangen ist, als er seine Gemahlin Melusina, welche
meine Schwester war, verlor." Dann erzählte sie ihm die ganze Geschichte
von Helmas und Persina, und daß sein Vater Gyot ihrer Schwester Sohn
gewesen.
"Du siehest also", schloß sie, "wie töricht deine Forderung und dein verstocktes
Beharren ist, daß du dadurch dein Reich verloren, welches nicht
nur von dir genommen werden, sondern auf ein ganz anderes Geschlecht
übergehen wird. Alles Glück und alle Ehre hast du mit deiner Torheit
verscherzt. So weiche denn, du armseliger Gyot, Gyots Sohn; denn du
hast übelgehandelt und sofort wird dein Unglück beginnen!"
Der junge Gyot aber, von Verlangen geblendet, gedachte, die Sache zu
erzwingen, vergaß, was ihm der Alte vor dem Tore gesagt hatte, und mit
Bitten und Flehen ihre Gunst zu gewinnen, eilte er in ihre Arme. Aber
er fand sich betrogen. Das schöne Bild verrann unter seinen Armen, und
er hatte nichts als einen Schatten gehalten: mit diesem Schatten aber
schwand auch sein Glück und sein Heil. Doch war der junge König nicht
lange allein; denn ein anderer abscheulicher Geist zeigte sich, den er nicht
sehen, wohl aber hören und fühlen konnte. Dieser schlug ihn zur Erde und
spielte ihm so übel mit, daß er, Arme und Beine von sich streckend, auf
dem Boden lag. Wie er erbärmlich zu schreien anfing, so wurde er nur
noch ärger von dem Geiste geschlagen. "Wehe mir", rief er, "wenn diese
Geisterplage nicht von mir abläßt, so bin ich des Todes und muß mein
junges Leben lassen! Ich Armseliger, daß ich ohne Gegenwehr Streiche
erdulden muß! Erscheinst du mir nicht mit Hilfe, o gütiger Gott, so muß
ich in Schmach und Schande verderben!"
Er hatte diesen Seufzer noch nicht ganz ausgestoßen, als er in einem
Augenblicke von dem Gespenst aus dem Schlosse geworfen ward, so daß
er halbtot auf der Erde lag und mehr einem kriechenden Wurm als einem
Könige gleichsah. Doch zwang er sich empor und schwankte mit schwachen
Kräften den Schloßberg hinab, seinem Gezelte wieder zu, welches auf dem
Wiesengründe stand. Dort konnte er vor Mattigkeit und Zittern kaum mit
den Seinigen reden, und auch diese waren über den Zustand ihres Herren
ganz bestürzt. Endlich unterstanden sich einige zu fragen, ob der
König bei dem Sperber gewacht und die Gaben gewonnen habe. "Elender
Gewinn!"versetzte er ihnen ganz wehmütig. "Mich hat ein unglückliches
Gestirn hiehergeleitet! Geschwind, sattelt mir die Pferde und schicket euch
zum Aufbruch an, daß ich nicht auf dem Wege sterbe."
Alsobald wurde alles zugerüstet, der todschwache König selbst zu Pferde
gebracht und mit ihm an das Gestade des Meeres geeilt; hier nahmen sie
ihm den Harnisch ab, brachten ihn zu Schiffe und segelten der Heimat zu.
Unterwegs gingen ihm erst die Augen seines Verstandes auf, und er sah
ein, wie guten Rat und treue Warnung er in den Wind geschlagen und
in welches Elend er sich gebracht habe. Auf der Reise verfolgte ihn ein
Sturm mit ungeheuren Meereswellen, was ihm so sehr zusetzte, daß er
abermals in Todesgefahr stand und Wasser und Erde durch des Himmels
Verhängnis seine Feinde zu sein schienen. Endlich, nach vielen Trübsalen,
kam er nach Hause und regierte mit schwachen Kräften. Diese nahmen
von Tag zu Tag mehr ab. Und so ging es, wie der jungfräuliche Geist
angekündigt hatte, mit ihm auf die Neige. Bald starb er an gänzlicher
Auszehrung, und nach ihm wurde ein andrer König, aus ganz andrem Geschlecht,
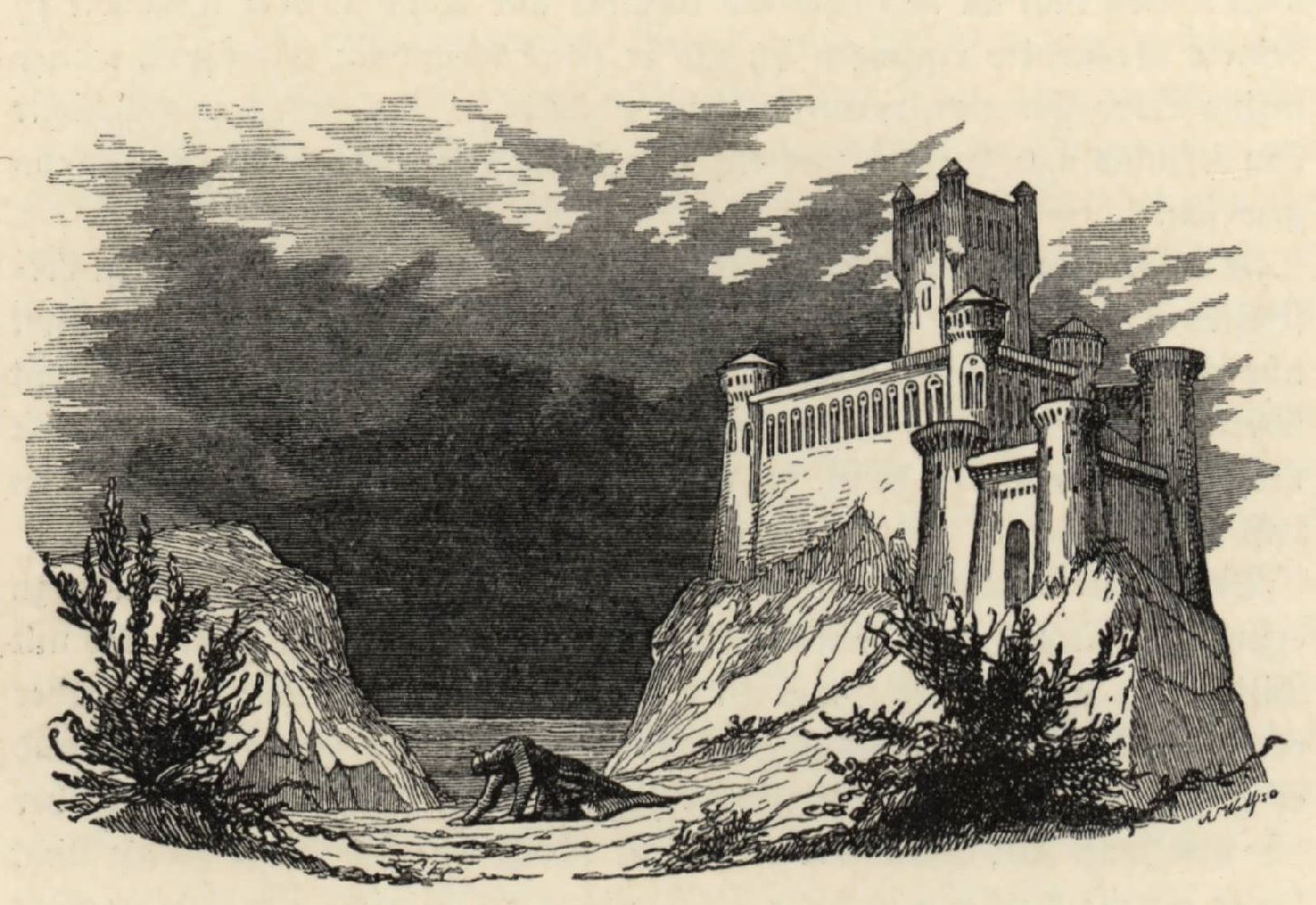
erwählt und auf den Thron gesetzt. Dieser aber hatte gar schlechtes
Glück in seinem Regiment; so daß das Königreich gleichsam mit seinen
Herrschern erkrankte und fast augenscheinlich in ein elendes Schwinden
geriet. Und so währte es von diesem Gyot an gerechnet bis ins neunte
Glied und auf den neunten Kronenträser.
***Die dritte Tochter des Königes Helmas, Plantina, war von ihrer Mutter
Persina als Hüterin des väterlichen Schatzes auf einen Berg in Aragonien
abgeordnet. Sie war von Gestalt eine wunderschöne Jungfrau.
Dieser Schatz nun sollte von niemand erhoben werden können, als wer aus
dem Geschlechte des Königs Helmas stammte. An jenem Berge aber hielten
sich viel grausame Drachen mit andern wilden Tieren in unglaublicher
Menge auf, so daß man ohne große Arbeit und augenscheinliche
Lebensgefahr sich diesem Berge nicht wohl nahen durfte; denn viel tapfere
Ritter hatten da schon ihr Leben gelassen, so daß keiner von denen, die dahingelangt
waren, zurückgekehrt war.
Nun fügte es sich einst, daß ein frischmutiger junger Ritter, aus England
gebürtig, dahinkam, mit dem kühnen Unterwinden, zuvörderst den
verborgenen Schatz daselbst und dann auch das Heilige Land zu erobern.
Wie er nun in Aragonien anlangte, war sein erster Schritt der, daß er
nach dem verzauberten Berge, wo sich der Schatz befinden sollte, genaue
Nachfrage hielt. Da wurde ihm denn alles bedeutet und urkundlich gezeigt
. Die Herkunft des frischen Ritters war keine gemeine; er stammte
vielmehr von einer gar hohen Geschlechtslinie; denn er war einer von den
Rittern der Tafelrunde des Königs Artus und ein naher Freund des Helden
Tristan.
Dieser Ritter wurde endlich durch seine Begierde bis an den Fuß des
gedachten Berges getrieben und traf hier sogleich ein ungestaltes und abscheuliches
Tier, vor welchem der ganzen Natur hätte grauen sollen. Sein
Bauch war wie ein Weinfaß gestaltet; es hatte nur ein einziges Ohr und
nur ein einziges Auge, welches ihm auf der Stirne stand; die Nase selbst
war drei Schuh breit und ebenso lang, aber es war kein Nasenloch darin,
sondern sein Atem ging zu dem Ohr aus und ein. So abscheulich nun
dieses Ungeheuer aussah, so wild und grausam war auch seine Natur, so
daß es dem Ritter genug zu schaffen machte.
Die rechte Höhle, in welcher der Schatz verborgen war, befand sich in
der Mitte des Berges, wo schon mancher tapfere Held sein Leben hatte
lassen müssen. Rings um die Höhle waren kleinere Löcher, in welchen
allerlei abscheuliche Lindwürmer und wilde Tiere hausten, und an allen
diesen vorbei mußte derjenige, der zu der Höhle mitten auf dem Berge gelangen
wollte. Der Berg selbst war drei aragonische Meilen lang, und es
führte nur ein einziger schmaler Weg hinauf; wer dahin wollte, mußte
schnell reiten oder gehen, ohne sich viel zu säumen oder lang umzusehen;
denn man hatte weder Weile noch Raum, lange auszuruhen, da der Weg
so weit war und die vielen Schlangen und das Ungeziefer jeden Schritt
umlagerten.
Dessenungeachtet war der kühne Ritter, nur von einem einzigen Wegweiser
begleitet, immer getrost dem Berge zugeritten, indem der Führer
voranging und der Ritter zu Pferde folgte. Endlich kehrte auch der Wegweiser
um, nachdem er mit großer Gefahr seine Schuldigkeit getan hatte;
aber der Ritter hieß ihn stillehalten, stieg vom Pferde ab und gab ihm
dasselbe an die Hand. "Bleibe über ein kleines hier", sagte er, "und
weiche nicht von der Stelle, bis ich komme!" Aber der gute Führer würde
leider eine lange seit haben warten müssen, wenn er sich nicht endlich aus
dem Staube gemacht hätte.
Indessen betrat der Ritter den schmalen Steig, welcher so mühselig zu
gehen war, daß er seinesgleichen noch niemals gegangen war. Er war
wohlgewaffnet und trug sein Schwert in der Hand. Da begegnete ihm
bald ein großer Drache, der mit offenem Machen auf ihn zuschoß. Als der
Ritter dieses Untier in Wut auf sich zueilen sah, zog er alsbald sein
Schwert und hieb ihm mit einem einzigen Streich den Kopf ab; als er
ihn aber, wie derselbe tot auf der Erde lag, abmaß, so erwies sich der
Kopf nicht weniger als zwanzig Schuh lang. Hierauf ging der Ritter
auf dem schmalen Stege gutes Mutes vorwärts. Da begegnete ihm ein
ungeheuer großer Bär, welcher auch ganz grimmig auf ihn zulief und
ihm so nahe kam, daß er ihm sogar seinen Schild aus der Hand zu zerren
suchte und den Harnisch an mehreren Orten beschädigte. Als der gute
Ritter auch dieser Bestie grimmigen Zorn sah, nahm er sich einen sichern,
unverzagten Hieb vor und traf den Bären glücklich mit dem Schwert auf
die Schnauze, so daß derselbe augenblicklich zur Erde fiel. Hierüber wurde
der Bär noch grimmiger, schlug nach dem Ritter und ging ihm immer
näher auf den Leib. Der Ritter aber wich mit einem Sprung auf die
Seite und hieb zugleich dem Tier eine Tatze ab. Nun wich das Ungetüm
etwas rückwärts, setzte sich auf die Hinterfüße und tat vorwärts auf den
Ritter einen vorteilhaften Schlag, welcher so stark war, daß er seinem
Harnische Löcher schlug. Und durch die heftige Bewegung gerieten der
Bär wie der Ritter zu Falle, so daß beide miteinander sich nicht mehr halten
konnten, sondern den Berg herabrollten.
Der tapfere Ritter verlor zwar hierüber sein Schwert, griff jedoch nach
seinem Dolche, den er neben der Brust an seiner Seite stecken hatte, zückte
diesen und gab dem Bären hinterwärts so seinen Teil, daß er ein schreckliches
Gebrüll ausstieß und damit bezeugte, daß er jetzt endlich wohl getroffen
sei. Der Ritter kam nun den Berg abermals hinan, suchte sein
Schwert, fand auch solches und erlegte noch viel scheußliche Gewürme und
andere wilde Tiere mehr, die ihm alle den Weg streitig machten, und
womit er sich ziemlich abmattete. Zuletzt gelangte er doch an die eiserne
Türe, vor der, schon überwölbt von der Höhle, ein entsetzliches Ungeheuer
lag, das die Kluft hütete, in welcher der große Schatz und die gespenstische
Jungfrau seit langen Jahren verborgen waren. Der mutige Jüngling
trat beherzt in die Höhlung, um das gräßliche Tier dort aufzusuchen.
Er traf dasselbe nur allzufrühe an; denn sobald ihn das Ungeheuer erblickte
, richtete es sich mit solchem Ungestüm wider ihn auf, daß, wer es
sonst gesehen hätte, vor Schrecken umgesunken sein würde. Und so lief es
im höchsten Grimme mit offenem Rachen auf ihn zu. Obwohl nun der
Ritter ganz flink der Bestie den Fang zu geben versuchte, indem er sein
Schwert behend auszog und mit demselben auf solche stieß und zuschlug,
auch ihr gar damit in den Rachen hinabrannte, so wollte es doch auf keine
Weise bei durch Zauberkünste festgemachten Untier verfangen; der
Ritter aber wurde immer müder und entkräfteter, weil Stahl und Eisen
nicht tüchtig genug waren, es zu verwunden. Endlich, als er das Schwert
mitteninne in der halben Tiefe des Rachens stecken hatte, ergriff das
Tier dasselbe mit seinen Zähnen, biß es in zwei Stücke, ließ voll Grimm
ein schreckliches Gebrüll hören und verschlang plötzlich den armen Ritter,
welcher so große Taten verrichtet und es weiter gebracht hatte als irgendeiner
vor ihm. Und jedermann bedauerte und beklagte ihn hernachmals.
Der Wegweiser hatte sich zwei Tage und Nächte lang müde gewartet
und war des Harrens samt dem Pferd ganz überdrüssig geworden; er
setzte sich endlich auf das Roß und kehrte ohne seinen Herrn nach England
zurück, um daselbst zu erzählen, daß sein Herr nicht aus dem Berge zurückgekehrt
und ohne allen Zweifel verloren sei, ohne daß er den Hergang
der Sache selbst recht gewußt hatte.
Es fügte sich aber, daß er von ungefähr zu einem weltweisen Manne,
der Melisa Jünger hieß, geriet. Dieser hatte lang bei dem Berge in
Aragonien gesessen und kannte alle Lage und Örtlichkeit daselbst. Weil
dieser unter anderem Wissen auch in der schwarzen Kunst wohlerfahren
war und sie vollkommen erlernt hatte, entdeckte er dem Wegweiser in
Kraft seiner Wissenschaft alles klar: daß nämlich sein Herr, der Ritter
von England, mit welchem er nach Aragonien gereist, mit verschiedenen
wilden Tieren gestritten und sie überwältiget, zuletzt aber von einem ganz
ungeheuern und wunderbaren Tier auf jenem Berge verschlungen worden
sei. Der Führer glaubte dem Weisen als einem geborenen Spanier, der
über zwanzig Jahre jener Wissenschaft obgelegen, und machte die ganze
Sache kund, wo er immer hinkam, so daß das Gerücht davon in ganz England
erscholl.
Ein anderer kühner Ritter, aus Ungarn gebürtig, nahm sich nun ebenfalls
vor, den Kampf zu vollziehen und den Schatz zu erobern. Allein ehe
er noch zwanzig Schritt den Berg hinangestiegen, siehe, da war der eingebildete
Sieger schon besiegt und von einem abscheulichen Lindwurm
umgebracht; wo nicht gar auch verschlungen worden. Er hatte es also mit
seinem Siege lange nicht so weit gebracht als der englische Ritter; diesem
freilich war vor und nach keiner gleichgekommen, und er würde unfehlbar
den verborgenen Schatz erreicht haben, wenn er nur dem Geschlechte des
norheimischen Königs Helmas angehört hätte.
***Als sich nun einstens auch Geoffroy, der allertapferste Held und Riesenstreiter
zu Lusinia, in seines Schlosses Lustgarten bei einem Bankett in
guter Gesellschaft fröhlich erzeigte, da geschah es, daß ein Bote herangeeilt
kam, welcher gewiß sonderliche Neuigkeiten oder wichtige Sachen
zu überbringen haben mußte. Als dieser dem Schlosse näher kam, ließ
Geoffroy ihm alsobald entgegengehen und ihn befragen, was für einen
wichtigen Auftrag er auszurichten hätte, daß ihn der Weg an diesen abgelegenen
Ort führe.
"Ich soll", sprach der Bote, "einen Ritter und beherzten Mann aufsuchen,
welcher das Land Aragonien von einem unruhigen Verggeiste, um
welchen herum sich auch noch giftige Würmer und grausame Bestien aufhalten,
worüber schon viele tapfere Ritter ihr Leben eingebüßt haben, zu
erlösen imstande ist!" Das berichtete der Diener dem Grafen, wie es der
Bote ihm gemeldet; darauf ließ Geoffroy diesen auf der Stelle rufen und
vernahm dieselbe Kunde genauer aus seinem Munde. Namentlich fügte
er die Nachricht von dem Unglücke bei, welches die beiden Ritter aus
England und Ungarn betroffen hätte, und daß den Schatz niemand heben
könne, der nicht aus dem Geschlechte des Königes Helmas entsprungen
sei.
Auf diesen Bericht, der dem Geoffroy schon genug war, hieß er alsobald
alle Fröhlichkeit einstellen, befahl, dem Boten Speise und Trank zu reichen,
ließ viel Volk seines Landes die Pferde rüsten und sich fertighalten
und schickte ein Schreiben an seinen Bruder Dietrich ab mit dem Berichte,
daß er unverzüglich zu ihm kommen und auf kurze Zeit die Regierung des
Landes anstatt seiner übernehmen möchte, bis er von einer notwendigen
Reise glücklich zurückgekehrt sein würde.
Dietrich fand sich auf diesen Ruf in aller Schnelligkeit ein, und es
wurde ihm von Geoffroy das Regiment übergeben. Zu dem Boten aber
sagte der Graf: "Verziehet, Ihr Laufer, und scheidet nicht von hier, bis ich
selbst aufbreche; denn ich bin gesonnen, Euer Land mit Gottes Hilfe von
jenem Übel zu erlösen!" Darüber freute sich der Bote heimlich in seinem
Herzen.
Aber wie eitel und nichtig sind doch aller Menschen Anschläge gegen
den verborgenen Ratschluß Gottes! Dies mußte Geoffroy an seinem
eigenen Beispiel innewerden. Denn als alles zum Aufbruch fertig und
bereit stand, siehe, da kam ein anderer Bote, welcher sein Anbringen
und seine Abfertigung noch vor dem aus Aragonien beschleunigt wissen
wollte.
Dieser Bote war der Tod; denn Geoffroy erkrankte jählings, und weil
er schon ziemlich bei Jahren war, auch sich durch viele ritterliche Taten
sehr abgemattet hatte, so nahm seine Krankheit immer mehr und mehr
zu, so daß er in kurzem starb und die aragonische Vergreise mit einer am
dern, mit der Reise zum Grab, vertauschte. Er wurde wegen seiner löblichen
Taten von jedermann höchlich beklagt, und alle Welt meinte, er sei
noch zu frühe gestorben, weil er besonders in der Grafschaft Poitiers mehrere
Kirchen und Kapellen zu bauen angefangen hatte und dieselben noch
nicht in vollkommenem Stande waren. Auch hatte er noch vorher viel
anderes Rühmliche getan und gestiftet. Das alles blieb jetzt abgestellt
und unausgebaut.
Nach Geoffroys seligem Ende war sein Bruder Dietrich der einzige Erbe
aller seiner Güter; dieser regierte sehr löblich und klug, teilte das Erbe,
das ihm zugefallen, in vier Teile und gab sie nachmals seinen Kindern
zur Morgengabe; denn er zeugte vier Söhne, die alle gar tapfre und berühmte
Helden wurden.
Diese Geschichte hat einer aus dem Lusinischen Geschlechte, Wilhelm von
Portenach mit Namen, vor vielen hundert Jahren zuerst in welscher Sprache
geschrieben; und damals war dies edle Geschlecht in vielen Stämmen über
viele Lande ausgebreitet und mit Königen und Fürsten und uralten Geschlechtern
befreundet und verwandt.

Herzog Ernst
Mit Bildern von Theobald von Oer
Es regierte in dem Herzogtum von Bayern und Östreich vorzeiten ein
hochgeborner Fürst, mit Namen Herzog Ernst, der sein väterliches Erbe
friedsam, in Gerechtigkeit und Einigkeit, beisammenhielt. Dieser ließ sich,
nach seiner adeligen Frömmigkeit, eine hochgeborne und schöne Jungfrau
vermählen, Adelheid genannt, eines Königs Tochter, der Lotharius hieß.
Dieselbe gebar ihm einen überaus schönen Sohn, dem er in der heiligen
Taufe seinen eigenen Namen Ernst beilegte. Über kurze Zeit jedoch wurde
nach des allmächtigen Gottes Schickung dem Kind sein Vater durch den
bittern Tod hinweggenommen und seine Mutter Adelheid dadurch in großen
Kummer versetzt.
Die einzige Freude, die ihr blieb, war der nachgelassene adelige Sohn,
der auf ihre Veranstaltung, als er heranwuchs, bald in vielen Sprachen
unterrichtet und in Latein, Griechisch und Welsch wohlbewandert wurde,
auch ein männliches Gemüt zu entfalten begann und in allen guten Tugenden
aufwuchs. Das Hofgesinde gehorchte ihm gern, und sein ganzes
Land, das er von seinem Vater ererbt hatte, war ihm in Liebe untertänig.
Als er anfing, Ritterspiel zu treiben, erwarb er sich auch bei den Rittern
und Grafen gutes Lob; insonderheit war ein Graf bei ihm, der Wetzel
hieß und ihm nahe verwandt war. Diese beiden Herrn hielten stets zueinander,
und die Mutter des jungen Herzogs hatte ihre große Freude
daran, doch setzte sie ihre Hoffnung auf Gott und nicht auf Menschen, hielt
Tag und Nacht in der Andacht ihres Gebetes an und bestrebte sich, durch
Werke der Barmherzigkeit ein christliches Leben zu führen, um dereinst ein
Kind des ewigen Lebens zu werden.
Aber die Ritter und Herren des Landes lagen ihrem Sohne, dem Herzog
Ernst, unaufhörlich an und baten ihn, er sollte seiner Mutter Adelheid
doch raten, daß sie wieder zu einer Ehe schreiten möchte. Auch an die
Herzogin selbst richteten sie dies ihr Begehren. Sie aber schlug es ihnen
immer ab; doch wurde sie von ihrem geliebten Sohn so heftig mit Bitten
bestürmt, daß sie ihm endlich angelobte, wenn es etwas wäre, was ihrem
Geschlechte keinen Schaden brächte, so wollte sie sich willig dareinergeben.
Nun herrschte zu denselbigen Zeiten im Römischen Reich mit ganzer
Gewalt Kaiser Otto, der erste Kaiser desselben Namens, der war geboren
zu Braunschweig und gekrönt zu Aachen; sein Ahnherr hieß Altherzog
Otto von Sachsen, der hatte die Schwester des letzten Königs Karl, welcher
von des großen Kaisers Karls Geschlechte war. Desselben Herzogs
Sohn, der Kaiser Ottens Vater war, den nannte man den ersten Kaiser
Heinrich, den Vogler; denn da ihn die Kurfürsten suchten, ihm die Krone
aufzusetzen, da fanden sie ihn bei seinem lieben Kind, mit einem Netze
Vögel fahend. Dieser hatte eine Frau, die war Mechtilde genannt, des
Kaisers Otto Mutter. Dieser Kaiser nun gewann die Stadt Straßburg
und zerstörte sie mit Gewalt und gab ihr den Namen, den sie jetzt führt;
denn vorher hieß sie, wie sie noch in Latein heißt, Silbertal. Er überwand
auch die Ungarn, die, ehe er Kaiser ward, von Augsburg aus alles
Land verdarben und großen Schaden anrichteten. Er unterwarf dem Römischen
Reiche viele Länder, war ein Freund der Gerechtigkeit und hieß
darum des Landes Vater. Als er noch in der grünenden Blüte seiner Jugend
war, wurde ihm eine überaus schöne Hausfrau angetraut, mit Namen
Ottogeba, die voll Zucht und Tugend war und aus dem erlauchten
Hause der Könige von England stammte. Aber nur kurze Zeit hatte Kaiser
Otto in süßem Glücke mit ihr gelebt; da kam die Stunde, in welcher
Gott sie aus diesem Erdenleben forderte.
Als die fromme Kaiserin Ottogeba nach fürstlichem Brauche feierlich
zur Erde bestattet war, lebte der Kaiser Otto einige Zeit in Trauer und
Einsamkeit. Dann aber betrachtete er in seinem Gemüte die Worte des
heiligen Apostels Paulus, daß es besser wäre, sich ehrlich zu vermählen,
als allerlei Anfechtung zu leiden, forderte seinen Rat zusammen und trug
ihm die Sache vor. Da beschlossen seine Räte allesamt daß sie einen
Boten an die Herzogin Adelheid in Bayern senden wollten und sie befragen
lassen, ob sie den gewaltigen Kaiser Otto zum ehelichen Gemahl
haben wollte. Hierzu wählten sie einen ansehnlichen Herrn und geboten
ihm, alle Sachen aufs treulichste auszurichten, wie es ihm vom Kaiser
und seinen Räten befohlen würde.
Diese Botschaft kam vor die Herzogin; sie aber erschrak im Herzensgrunde
, da sie solche neue Mär hören mußte; denn sie hatte lange Zeit in
stillem und ehrbarem Wesen ihren Witwenstand tugendhaft gehalten und ,
sich vorgesetzt, darin zu verharren. Darum berief sie von Stund an die
Edeln ihres Landes samt dem Herzog Ernst, ihrem lieben Sohn, legte
ihnen den Antrag vor und bat sie, dem Kaiser eine höfliche Antwort zu
geben. Dies versprachen die Herren und gingen darüber zu Rat; und allesamt
waren für die Einwilligung in die Heirat. Sie baten daher den
Herren Ernst, den Sohn der Herzogin, und den Grafen Wetzel, seinen
vertrauten Freund, sie möchten der Herzogin anzeigen, was der Rat ihrer
Edeln beschlossen habe. Jene beiden taten dies. Die Herzogin erschrak
von ganzem Herzen und sprach: "Mein lieber Sohn! Ich fürchte sehr,
wenn ich nach dem Nate der Gewaltigen dieses Landes und deinem eigenen
mit dem Kaiser mich vermähle, so dürfte zwischen ihm und dir Zwietracht
und Uneinigkeit entstehen, wodurch ich in großem Jammern vor dem
Tode meine Zeit verzehren würde." Dawider sprach Herzog Ernst: "Herzallerliebste
Frau Mutter, eine so sorgliche Furcht sollte Euch nicht von der
Vereinigung mit dem allerwürdigsten Fürsten abhalten. Ich selbst will
mich mit Hilfe des barmherzigen Gottes, der unser aller oberster Kaiser
ist, jenem meinem irdischen Kaiser in glücksamen wie in widerwärtigen
Sachen dienstbar erzeigen und ihm allezeit gehorsam sein, will ihn und die
Seinen mit meinen Armen umfahen, so daß ich stets die Gnade Seiner
Kaiserlichen Majestät zu genießen habe."
Von so mannlichen Worten des jungen Fürsten, ihres geliebten Sohnes,
wurde die Frau gestärkt; sie faßte alle Worte, die ihr Sohn geredet, in
ihr Herz und tat dem Römischen Kaiser Otto durch seinen Boten ihres
Herzens Willfährigkeit zu wissen, bestimmte auch Zeit und Tag der Vermählung.
Kaiser Otto ward über die Maßen froh, als sein Bote mit so
fröhlicher Nachricht wiederkehrte; sofort versammelte er alle seine Fürsten
und Lehensherren zu einem gemeinsamen Hofgelage; dann machte er sich
samt ihnen allen mit großer Macht und Herrlichkeit auf und ritt nach
Bayern, wo die Herzogin wohnte. Diese ward ihm hinwiederum von
ihrem Sohne, Herzog Ernst, und andern Herrn ihres Landes würdiglich
und mit großem Gefolge entgegengeführt und überantwortet. Der Kaiser
aber führte sie mit all seinem Volk unter lautem Jubel nach der Stadt
Mainz. Daselbst hielt er eine große Hochzeit, wie einem so mächtigen Kaiser
wohl gebührte. Dann ritten die Gäste alle wieder heim, ein jeglicher
in seinen Ort, woher er gekommen war.
Als der Kaiser Otto dies hochzeitliche Fest wohl vollbracht hatte, zog er
um etlicher wichtigen Ursachen willen mit seiner kaiserlichen Gemahlin in
manche Stadt des Reiches. Nach diesem zögerten sie nicht lange, sondern
schickten einen angesehenen Herrn zu dem jungen Herzog Ernst; und nun
kam dieser mit großem Zeuge, gar lustig anzusehen, zu dem Kaiser. Dieser
empfing ihn mit hoher Freundlichkeit, und der junge Herr erwies dem
Kaiser alle Ehrfurcht, fiel ihm zu Fuß und erwies sich in allem gegen ihn
als ein gutwilliger Sohn, der ihm gerne untertänig und gehorsam sein
wollte. Wie sie in solchen Freuden beieinander waren, kam Frau Adelheid
, die Kaiserin, Herzog Ernsts Mutter, mit vielen Jungfrauen gegangen
und empfing ihren lieben Sohn mit großen Freuden; er aber dankte
ihr und allen Jungfrauen mit tiefer Verneigung. Dann nahm ihn der
Kaiser bei der Hand, führte ihn in den Saal und sprach zu ihm: "Wisse,
mein geliebter Sohn, daß ich deine Mutter von ganzem Herzen liebe.
Auch dir möchte ich gerne mehr dienen, denn ich vermag. Doch auch so
will ich darauf denken, daß ich dir dein Land vergrößere; denn ich habe
ein herzliches Wohlgefallen an dir um deiner Frömmigkeit und Mannheit
willen." Während sie im Gespräche waren, kam die Kaiserin dazu
und redete also zu ihrem Sohne: "Geliebtester Sohn, ich bitte dich flehentlich,
du wollest deinen Vater in allen Ehren halten und ihm immer gehorsam
sein."Zugleich schenkte sie ihm herrliche Kleinodien und begabte alle
seine Herren und Diener, jeden nach seinem Stande. Und darauf schieden
sie gar liebreich voneinander.
Aber dieses friedliche Leben währte nicht lange; denn es war einer am
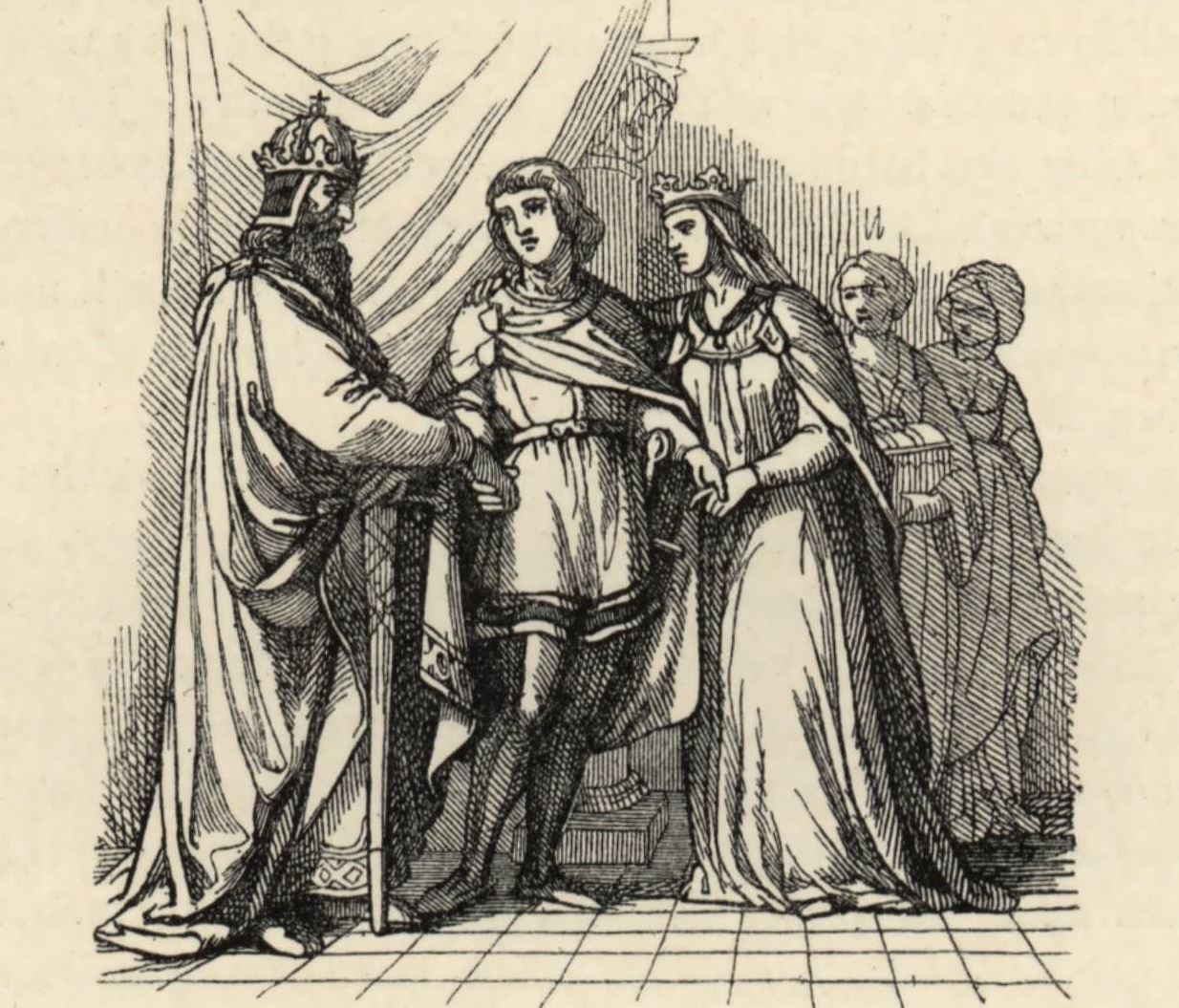
Hofe, der Pfalzgraf Heinrich genannt, ein ungetreuer, falscher Mann, der
die Einigkeit und das ruhige Leben, das der Kaiser und die Kaiserin mit
ihrem Sohne führten, nicht mit ansehen konnte. Darum dachte er oft, wie
er doch bösen Samen darein säen könnte, damit der junge Fürst, Herzog
Ernst, des Vaters Huld verliere; und endlich ersann er eine falsche List,
von der ihr bald hören sollet, die ihm aber doch zuletzt allzusauer wurde.
Sonst hielt das ganze Hofgesinde den jungen Fürsten in großen Ehren,
und auch er vertrug sich gut mit jedermann, und wenn dem Lande eine
Widerwärtigkeit zustieß, so beschirmte er dasselbe im Namen seines Vaters
, so daß der Kaiser eine Zeitlang ganz ruhig bei seiner Gemahlin leben
konnte. Jetzt aber geschah es, daß der Pfalzgraf Heinrich die Esse seines
Herzens mit dem Feuer des Neides in Flammen setzte. Dieser verklagte
den jungen Fürsten fälschlich bei seinem Stiefvater, Kaiser Otto, und
sprach einsmals, als er vor ihn kam, zu dem Herrscher: "Oh, wie ein getreuer
Vater des Kaiserreichs seid Ihr, allergnädigster Herr! Aber ich
habe einige wunderliche, ja boshafte Reden vor Eure Kaiserliche Majestät
zu bringen von Eurem Sohne, Herzog Ernst, den Ihr so liebhabt; den Ihr
vor andern Räten ehret. Dieser Fürst trachtet früh und spät, Eurem alten
Leben ein Ende zu machen, um das ganze Reich allein besitzen zu können.
Darum sehet Euch vor, daß Ihr das abwehret, ehe er seinem bösen, begierigen
Herzen, das zu solcher Bosheit nur allzugeneigt ist, Raum gibt,
sonst ist Euer Leben ohne allen Zweifel verloren!"
Da der Kaiser solche Worte von Heinrich, dem Pfalzgrafen, vernommen
hatte, ward er ganz zornig über ihn und sprach: "Was sagst du,
Heinrich? Von wem kommt dir solche Nachricht? Fürwahr, wenn mir
das ein anderer sagte, ich wollte ihm den Kopf abhauen lassen! Und wenn
ich wüßte, daß du solches aus Haß gegen meinen Sohn tust; so sollte auch
dir das gleiche widerfahren; denn ich habe noch nie Unrechtes von Herzog
Ernst gesehen noch gehört, so wenig als von seiner Mutter, der Kaiserin;
er schützet mich in allen meinen Angelegenheiten, worin es immer sein
mag, mit Kriegen oder Verträgen; darum kann ich es nun und nimmer
glauben. Doch sage mir, von wem du solches gehört hast, damit ich der
Sache auf den rechten Grund komme!" Da sprach Pfalzgraf Heinrich:
"Das kann ich Eurer Majestät wohl sagen, wenn es nötig ist; denn nicht
von einem allein habe ich es gehört, sondern von zweien und dreien; dazu
habe ich auch an ihm selbst gemerkt, daß er auf Bübereien sinnt. Darum,
gnädigster Herr und Kaiser, wollte ich Eure Majestät treulich vor solchem
Schaden gewarnt haben; denn das bin ich schuldig und verpflichtet zu tun."
Nun fing der Kaiser mit traurigem Mute an und sprach zu dem Verleumder:
"Oh, mein lieber Heinrich, wenn dem also ist, wie du mir von
meinem Sohne angezeigt hast, so bitte ich dich weiter um guten Rat; wie
ich ihn aus dem Lande vertreiben kann, ehe er sich untersteht, sein Vorhaben
auszuführen." — "Das will ich meinem kaiserlichen Herrn wohl
anzeigen", erwiderte der Falsche, "während Euer Sohn gen Regensburg
geritten ist, so sammelt Ihr ingeheim und ohne der Kaiserin Wissen viel
Kriegsvolkes, schicket die hin und lasset ihn aus dem ganzen Lande verjagen
Der Kaiser tat also. Er brachte durch Herrn Heinrich in kurzer
Zeit einen großen Haufen mannlicher Ritter zusammen, an deren Spitze
der Pfalzgraf selbst gestellt wurde, und das geschah alles ohne Wissen der
Kaiserin. Dann zog der Arge wider den frommen Herzog Ernst, verwüstete
Östreich, schlug viel Volkes zu Tode, hauste grimmig mit Sengen
und Brennen und zog dann nach dem Bistum Würzburg, wo er gleichen
Schaden verübte. Auch schickte er heimlich Kriegsvolk gen Bamberg und
befahl ihnen, daß sie eine Zeitlang stilleliegen und sich nicht merken lassen
sollten, was sie im Sinne hätten, bis er selbst mit dem ganzen Zuge käme;
alsdann sollten sie sich plötzlich in ihre Rüstung stecken und die Bürger
in aller Schnelligkeit überfallen. Das geschah auch; doch wehrten sich die
Bürger und schlugen ihrer vielhundert zu Tode. Erst als sie sahen, daß
sie überwältigt waren und solches Blutvergießen auf des Kaisers Befehl
durch den Pfalzgrafen Heinrich angerichtet worden, ergaben sie sich. Nichtsdestoweniger
schickten sie eilends einen Boten an ihren Schutzherrn, den
Herzog Ernst, nach Regensburg und ließen ihm alles anzeigen, was sich
mit ihnen begeben hatte. Als der Bote mit dieser Zeitung vor den Herzog
kam, erschrak dieser sehr, ging zu seinem Freunde Wetzel und erzählte es
ihm unter bitteren Tränen. "O allmächtiger Gott", rief er, "welche Verleumdung
mag zu meines Vaters, des Kaisers, Ohren gekommen sein,
daß er es über sich vermocht hat, mich also zu verderben!"
So ging er mit bekümmertem Herzen und in schweren Gedanken auf
und nieder. Endlich befahl er seinen Räten, sich zu versammeln; denn er
habe ihnen Ernsthaftes anzuzeigen. Und sie versammelten sich auf sein
Geheiß. Da trat der junge Fürst mit seinem Freunde, Grafen Wetzel, unter
sie und gab den Räten den Brief, den die Bürger von Bamberg an ihn
abgeschickt hatten. Als diese ihn gelesen und das Blutvergießen daraus
ersehen hatten, das der Pfalzgraf angerichtet, wurden sie ganz traurig,
doch beschlossen sie schnell, daß Herzog Ernst sein bestes Kriegsvolk, das
er im Lande hätte, an sich ziehen und den Feind aus dem Lande schlagen
sollte., Aber sie wußten noch nichts von der Verleumdung, die ihnen zugerichtet
worden war. Also sammelte der kühne Herzog Ernst seine Ritter,
wohl an viertausend streitbarer Männer, und zog mit dem Volke
Bamberg zu. Wie das Heinrich, der Pfalzgraf, vernahm, besetzte er die
Stadt Bamberg mit Kriegsvolk und zog mit seiner übrigen Macht dem
Herzog Ernst entgegen; und das Ziehen währte nicht lang, da trafen ihre
Scharen zusammen und schlugen einander auf beiden Seiten viel Volkes
zu Tod. Zuletzt behielt Herzog Ernst das Feld, und der Pfalzgraf entkam
nur mit wenigen Reitern.
Dieser ritt geradenwegs zum Kaiser und meldete ihm, wie es gekommen
sei, daß ihm sein Sohn Ernst fast all sein Volk erschlagen habe, und wie
er ihm mit seinen Scharen zu mächtig gewesen sei. Als der Kaiser alles
gehört, wurde er ergrimmt über den guten Herzog Ernst und sprach:
"Das will ich nicht ungerächet lassen; von aller seiner Habe soll mein
Sohn verjagt werden." Und jetzt nahm er viel Kriegsvolk und eroberte
eine Stadt nach der andern. Wie das der junge Fürst sah, wurde er hartbekümmert,
schickte einen Boten zu seinem Vater, dem Kaiser, und ließ
ihn bitten, daß er doch sein Land nicht also verwüsten möchte; denn er
habe doch Seiner Majestät sein Leben lang nichts Böses zugefügt, weder
mit Worten noch mit der Tat; wisse sich in allem unschuldig und könne
daher nicht begreifen, warum er von dem Kaiser mit Krieg heimgesucht
werde. Der Bote brachte dem Kaiser den Brief in Beisein der Kaiserin,
und diese verbot demselben heimlich, wider ihren Willen heimzuziehen,
sondern er sollte sie wiederum aufsuchen, ehe er ginge; und dazu verstand
sich auch der Bote.
Der Kaiser hatte den Brief durch und durch gelesen; er ging hin und
wider in dem Saal mit zornigem Mute wie ein grimmiger Löwe. Die
Kaiserin aber merkte wohl, daß es ihrem Sohne galt, näherte sich ihrem
Herrn, dem Kaiser, und sprach: "Allergnädigster Herr, ich bitte Euch um
Gottes Barmherzigkeit willen, daß Ihr in dem Zorne, den Ihr gegen unsern
Sohn tragt, nicht beharret!" Da sprach der Kaiser ihr: "Liebe
Frau! lasse mich nicht überreden; darum entfernet Euch nur und
gehet Euren Geschäften nach; die Übeltat, die er an mir verübt hat, ist zu
groß, als daß ich sie vergessen könnte." Aber die Kaiserin sprach nur noch
kläglicher: "So bitte ich um Gottes willen, Ihr wollet wenigstens eine
Versammlung und Zusammenkunft beider Teile anstellen, damit man doch
auf einen sichern Grund der Verfolgung komme, die gegen meinen unschuldigen
Sohn angezettelt worden ist!"
Aber bei dem Kaiser war keine Barmherzigkeit zu finden. Als dies die
Kaiserin sah, ging sie mit betrübtem Hergen in ihre Kammer und schrie
im Gebete zu Gott. Da war es, als käme ihr eine Stimme vom Himmel,
die ihr sagte: "An all diesen Dingen ist der Pfalzgraf schuldig." Wie die
Frau die Stimme vernommen hatte, sprach sie weiter im Gebet: "O allmächtiger
Gott, wie ist es möglich? Was hat den Pfalzgrafen veranlaßt,
meinen lieben Sohn bei meinem Herrn so verleumdens O Gott; erbarme
dich meinert" In diesem Elend schickte sie einen Diener nach dem
Boten ihres Sohnes Ernst und befahl ihm, diesen über alles zu unterrichten,
wie es um ihn bei seinem Vater, dem Kaiser, stünde; insonderheit
gab sie dem Boten auf, daß er ihrem Sohne sagen sollte, all das Unglück
habe der Pfalzgraf Heinrich angerichtet, und er allein sei der Urheber dieser
Verräterei. Wie der Bote seinen Bescheid hatte, ritt er in E. le Regensburg
zu und hinterbrachte alles getreulich seinem Herrn, dem Herzog, wie
ihm von des Fürsten Mutter befohlen war. Nachdem Herzog Ernst alles
vernommen hatte, gab er dem Boten reichen Lohn für seine Bemühung,
eilte zu seinem Gesellen, dem Grafen Wetzel, und teilte ihm alles mit,
was er erfahren hatte. Und dieser geriet in große Verwunderung.
***Seitdem war der junge Fürst stets von schwermütigen Gedanken gequält
und mußte nicht, ob er wieder Gnade bei seinem Vater finden werde. Endlich
wandte er sich abermals an seinen Freund Wetzel und bat ihn, daß er
ihm einen Zug vollbringen helfen möge, auf welchem sie sich nur von
einem einzigen Diener begleiten lassen wollten. Das verhieß ihm Wetzel.
Damals nämlich hielt der Kaiser gerade mit seinen Kurfürsten einen
Reichstag zu Speyer, und war dort eine große Versammlung von Fürsten
und Herren. Dieser Gelegenheit nahm Herzog Ernst wahr und ritt mit
seinem Freund und dem Diener gen Speyer. Dort stiegen sie in des Kaisers
Hofe von ihren Rossen, hießen den Diener die Pferde halten und
gingen hinauf in den Palast. Da fanden sie den Kaiser mit dem Pfalzgrafen
allein in der Kammer sitzen, und Herzog Ernst ging zu letzterem
hin und sprach: "Du meineidiger, treuloser Pfalzgraf, warum $verleumdest
du mich so bei meinem Vater?" Mit diesen Worten zog er sein Schwert
aus und durchstach im wilden Zorne seinen Feind.
***Als der Kaiser dies sah, fürchtete er sich vor seinem Sohn und sprang
wohl vier Klafter tief hinab in eine Kapelle, deren Wölbung an die Kammer
grenzte, wo sie waren; darein verbarg er sich aus Furcht vor seinem
Sohne. Herzog Ernst, wie er sah, daß sein Vater entronnen war und der
Pfalzgraf tot vor seinen Füßen lag, lief mit seinem Gesellen Wetzel die
Treppe wieder hinab zu den Rossen, bei denen sie den Diener fanden. Da
saßen alle drei wieder auf, ritten in Eile durch die Stadt und nahmen
ihren Weg einem unbekannten Orte zu.
Der Kaiser blieb eine gute Weile in der Kapelle und hatte große Angst.
Erst wie er kein Getümmel mehr hörte, kam er heraus und sagte den
Herren, was sich Unerhörtes begeben habe. Auf die Kunde von diesem
großen, unsühnbaren Morde entstand in der gangen Stadt ein Aufruhr;
Reiter wurden auf allen Straßen hin und wider abgeschickt, mit dem Befehl
, wo sie Herzog Ernst mit seinem Gesellen, dem Grafen Wetzel, und
einem Diener begegneten, da sollten sie alle drei ohne Gnade totschlagen.
Aber Gott, wiewohl er dem Fürsten den Mord nicht verzieh, nahm die
Verfolgten doch in seinen Schirm und führte sie auf eine sichere Straße,
so daß sie nicht ereilt wurden. Die Reiter und Knechte kamen zurück und
sagten dem Kaiser, daß sie niemand hätten finden können. Darüber wurde
der Kaiser grimmig und schwur bei seinem Reiche, daß er es nicht ungerächt
lassen wolle.
Durch das große Geschrei, das hin und her in der Stadt ertönte, und
das viele Volk, welches zusammenlief, wurde endlich auch die Kaiserin

aufmerksam, suchte ihren Gemahl auf und fragte ihn: "Lieber Herr, saget
mir an, was dieses ungestüme Hin- und Herrennen bedeutete" Da erzählte
ihr der Kaiser Wort für Wort, daß ihr Sohn den Pfalzgrafen erstochen
habe, und wenn ihm der Kaiser nicht entronnen wäre, auch seinen
Vater umgebracht haben würde. Die Kaiserin dankte ihrem Gemahl für
diese Mitteilung, eilte aber sogleich in ihr Kämmerlein und betete zu Gott
mit allem Ernste, daß er ihren Sohn doch behüten und nicht in des Vaters
Hände fallen lassen wolle.
Inzwischen war der Leichnam des Pfalzgrafen mit großer Feierlichkeit
begraben worden; dann ging der Kaiser mit seinen Fürsten und Herren
zu Rate, und es wurde beschlossen, daß Herzog Ernst, der junge Fürst, aus
seinem Lande ganz und gar vertrieben werden sollte; auch wollte ihn der
Kaiser nimmermehr zu Gnaden annehmen; denn er war ihm von Herzen
feind geworden. Er sammelte daher ein Heer von zwölftausend Mann
und ritt selbst den nächsten Weg. auf Regensburg zu; denn er meinte,
sein Sohn wäre dort. Als sie aber nahe vor der Stadt waren, machten die
Bürger einen Ausfall, und es wurde auf beiden Seiten viel Blut vergossen.
Die Belagerung währte lange Zeit, und die Einwohner wurden
sehr betrübt, weil ihr Herr, der Herzog Ernst, nicht zum Entsatze kam.
Doch hielten sie sich, wie frommen Bürgern und Untertanen zusteht; und
wollten an ihm nicht treulos werden. Auch versammelten sie einen Rat
und beschlossen, ihrem Herrn und Herzog einen Boten zu schicken (denn
sie kannten seinen Aufenthalt), um ihm die große Not zu klagen, in der
sie durch seinen Vater schwebten; auch ihm zu melden, daß, wenn ihnen
nicht bald Hilfe käme, sie sich dem Kaiser ergeben müßten.
Die Botschaft gelangte glücklich zu dem jungen Fürsten, und dieser sprach
gar betrübt zu seinem Freunde Wetzel: "Mein allerliebster Freund, was
soll ich Unglücklicher anfangen? Des Lands und der Leute bin ich beraubt,
niemanden hab ' ich, auf den ich mich verlassen könnte; hilft Gott meinen
Untertanen nicht, so sind sie verloren" Doch schickte er den Boten eilig
wieder nach Regensburg zurück und ließ sie treulich bitten, sie sollten sich
nur noch eine kleine Weile halten; er verhoffe, bald bei ihnen zu sein.
Der Bote eilte heim und zeigte dies den Bürgern an.
Herzog Ernst aber ritt ohne Verzug zu dem Herzog Heinrich von Sachsen
und wurde von ihm mit seinen Dienern so gut und schön empfangen, als
billig war. Nach der ersten Begrüßung klagte der gebeugte Fürst dem
Sachsenherzog seine Not, erzählte ihm alles, was ihm widerfahren war,
und was er begangen hatte, und wie er jetzt ein Vertriebener sei und seine
Hauptstadt Regensburg belagert würde. "Darum, gnädigster Fürst",
schloß er, "bitte ich Euch, Ihr wollet mir eine Anzahl Kriegsleute geben,
daß ich in Sicherheit gen Regensburg kommen möge, damit ich meine kostbarsten
Kleinode wegschaffen und meine getreuen Bürger trösten und
kräftigen kann. Dann will ich in ein anderes Land ziehen, wohin mich
Gott führet. Solche Bitte hoffe ich, Herr Herzog, wollet Ihr mir nicht
abschlagen in diesem meinem Elend!"
Der Herzog antwortete gar freundlich: "Lieber junger Herr und Fürst!
Eure Bitte soll Euch nicht abgeschlagen sein!" Und von Stund an gebot
er, daß sich fünftausend Pferde rüsten sollten, was auch alsbald geschah.
Der Herzog von Sachsen ritt selbst mit dem Heerhaufen, und als sie gen
Regensburg kamen, sahen sie den Kaiser mit seinem Heere davor gelagert
. Doch ritten die Herzöge mit ihren Reitern bis dicht vor das Lager.
Als der Kaiser soviel Volks kommen sah, gebot er seinem Heer, auf der
Stelle sich zu rüsten und die Feinde von dannen zu schlagen. Aber der
Herzog von Sachsen begehrte mit dem Kaiser zu unterhandeln, und so
vernahm dieser aus des Herzogs eignem Munde, daß es seine Absicht sei,
den Fürsten Ernst in seine Stadt Regensburg zu bringen. Da sprach Herr
Otto: "Ist es auch recht, daß Ihr meinen Feind beschützen helfen wollet;
der meinen guten Freund Heinrich, den Pfalzgrafen, an meiner Seite erstochen
hat und mir dasselbe getan hätte, wenn ich nicht entsprungen
wäre? Sollte ich dem ungetreuen Sohn meine Treue beweisen? Nein,
fürwahr, er hat es nicht um mich verdient!"
Der gute Herzog von Sachsen wurde solcher Klage nicht froh, sondern
er sprach mit demütigen Worten: "Allergnädigster Herr und Kaiser, wollet
diese meine Weise nicht für übel nehmen, ich habe solches um des gemeinen
Besten willen getan. Ich wollt' Euch aufs untertänigste bitten,
daß Ihr Euerm Sohn gnädig sein möget und ihm vergeben; wer weiß,
ob er an den Dingen wirklich schuld hat, wegen deren er bei Euch angeschwärzt
worden ist." Aber der Kaiser, als er solche Worte vernahm, hieß
den Herzog von sich gehen. Dieser gehorchte und ritt zu seinem Freunde
zurück.
Unterdessen begannen die Bürger der Stadt zu merken, daß Ernst,
ihr Herzog, in der Nähe sei. Von Stund an schickten sie ihm Boten, daß
er doch sollte in die Stadt kommen; sie wollten Leib und Leben für ihn
lassen und ihm in Liebe untertänig sein. Auf dieses rüstete sich Herzog
Ernst, ging zu dem Fürsten von Sachsen, sagte ihm großen Dank für seine
Begleitung und bat ihn um einige Reiter und Knechte; der aber gab ihm
mit gutem Willen viele von seinem Volk. So machte sich Herzog Ernst
auf und ritt unangefochten in die Stadt; denn der Kaiser fürchtete die
Sachsen. Nachdem jener hinter den Toren der Stadt Regensburg wohlbehalten
angekommen war, ging der Herzog von Sachsen wieder vor den
Kaiser und sprach: "Allergnädigster Herr, mein Dank sei Euch gesagt,
und wollet Eurem Sohne gnädig sein!" So schieden sie traurig voneinander,
und der Sachsenherzog ritt wieder in seine Heimat.
Große Freude war bei den Bürgern, als sie ihren Herrn wieder in der
Stadt hatten; sie empfingen ihn mit seinem wohlgerüsteten Volk aufs
beste und hofften, er würde jetzt bei ihnen bleiben. Aber es geschah ganz
anders; denn Herzog Ernst befahl, alle Bürger sollten zusammen kommen,
und wie sie alle beieinander waren, redete er sie also an: "Liebste
Bürger und gute Freunde! Ihr sehet den großen Trotz meines Vaters,
des Kaisers, der sich unterfängt, mich von Land und Leuten zu vertreiben
Er hat auch wohl die Gewalt dazu, und ich will mich dessen nicht mehr
wehren, wie ich vor getan habe. Darum, liebe Brüder, bin ich zu euch hergekommen,
euch aufs dringendste zu bitten, daß ihr meinen Vater, den
Kaiser, beschicken wollet und ihn um Gnade bitten, daß er einem jeden von
euch erlaube, soviel von dem Seinigen mitzunehmen, als er tragen kann,
und euch so aus der Stadt gsehen lasse; die andre Habe wollet ihr dahintenlassen!
" Dieser Rat gefiel einem Bürger wohl, dem andern nicht.
Endlich beschlossen sie und zeigten es ihrem Herrn an, sie wollten bleiben
und bei Weib und Kind sterben und genesen. Also nahm ihr Herr unter
Tränen Abschied von ihnen, nahm aus seinem Schlosse zu Regensburg
die besten Kleinode und ritt mit dem ihm zugegebenen Sachsenvolke wieder
aus der Stadt durch das Lager des Kaisers ohn' Gefährde und fort
in das Land Sachsen zu seinem Bundesgenossen, dem Herzog Heinrich.
Seine Untertanen aber mußte er im Elend belagert zurücklassen, ohne daß
er seinem Vater, dem Kaiser, weil er ihm zu mächtig war, Widerstand zu
leisten gewagt hätte.
So sahen sich die Bürger allein: ihr Herr war von ihnen geritten; sie
wußten nicht, was sie tun sollten. Der Kaiser wurde dies wohl gewahr
und befahl jetzt seinen Söldnern, sie sollten die Bäume abhauen; er wolle
nun die Stadt mit Gewalt stürmen, um weiter zu ziehen und das übrige
Land auch einnehmen zu können; denn der große Zorn über seinen Sohn,
Herzog Ernst, wollte kein Ende bei ihm nehmen. Die Bürger sahen dies
ganz traurig mit an; sie meinten, wenn sie dem Kaiser die Stadt öffneten,
würde er sie alle töten lassen und alsdann die Stadt auf den Grund hinwegbrennen,
wie er ihnen gedroht hatte; doch ermannten sich einige, trösteten
die andern und gaben ihnen den Rat, sie sollten dem Kaiser die
Schlüssel ihrer Stadt überbringen und ihn um Gnade flehen. Er würde
doch nicht so unbarmherzig sein, als er im Zorn gesprochen hätte.
Des Kaisers Volk bereitete sich zum Sturm, und eben wollten sie anlaufen,
als die Bürger den Kaiser um eine kleine Frist bitten ließen, die
ihnen auch bewilligt ward. Nun bedachten sie sich nicht mehr lange, taten
ihre Tore weit auf, und die Ratsherren alle gingen vor die Stadt dem
Kaiser entgegen, fielen ihm zu Fuß und begehrten Gnade, indem sie ihm
in aller Demut die Schlüssel der Stadt überreichten. Kaiser Otto war
von Natur großmütig; als er ihre Trauer sah, jammerte ihn ihrer, und
er sprach: "Wohl, weil ihr euch so gutwillig erzeiget, so will ich euch erhalten
und bei euren Gerechtigkeiten bleiben lassen." So schwuren sie
ihm aufs neue und hielten sich, wie ehrlichen Bürgern geziemt.
***Darauf zog der Kaiser von der Stadt ab und schickte sein Volk in zween
Haufen aus. Dem einen befahl er, die Donau hinabzuziehen und alle
Städte und Flecken einzunehmen. Sie taten dies und verderbten viel Volks.
Doch wurden auch ihnen mieder viel Leute erschlagen; denn Herzog Ernst
hatte noch mehr Sachsenvolk an sich gezogen und leistete mit demselben
seinem Feinde Widerstand. Aber sein Vater, der Kaiser, besaß viel mehr
tapfere Kriegsleute; denn er hatte an achttausend Mann die Donau hinabgeschickt,
und Herzog Ernst befehligte kaum zweitausend. Gleichwohl
hielt er sich lange in Östreich. Sein Vater, der Kaiser, aber war mit dem
andern Heerhaufen an den Lech gezogen und nahm die Städte ein, die
einst dem Herzog gehörten. Was sich nicht bald ergeben wollte, ward mit
Sturm überwältigt, und alles totgeschlagen, was Waffen stand. Nachdem
er dort das ganze Land erobert; schickte er das übrige Kriegsvolk auch
zu dem Haufen an der Donau. Als das Herzog Ernst erfuhr, daß seinem
Feinde neuer Zuwachs an Heeresmacht komme, da sandte er dem Herzog
von Sachsen die geliehenen Kriegsleute wieder zurück, nachdem er ihnen
reichlichen Sold gegeben, ließ dem Herzog Dank sagen und warf sich mit
seinem Gesellen, Grafen Wetzel, und weniger Ritterschaft in eine starke
Feste. Dort schickte er sich an, das Land verlassen. Und nun nahm des
Kaisers Volk ohne Mühe alles Land ein, das Herzog Ernst zuvor mit den
Sachsen beschützt hatte, und alle Städte wurden mit des Kaisers Söldnern
besetzt.
Herzog Ernst aber, der von der Burg aus, auf die er sich zurückgezogen,
sein Land in Flammen stehen sah, forderte fünfzig der allerbesten Ritter
zusammen und sprach zu ihnen: "Liebe Herren, ich bitte euch getreulich,
daß ihr mir wollet einen Zug vollbringen helfen nach dem Heiligen Grabe.
Ihr sehet ja meines Vaters Zorn; dazu habe ich kein Schloß und keine
Stadt mehr, darin ich sicher wäre; ich bin gang elend: darum will ich das
Land verlassen, vielleicht, daß sich der Kaiser indessen eines andern bedenkt
und sein großer Grimm sich legt. Meinethalben soll kein unschuldiges
Blut mehr vergossen werden, es ist dessen schon jetzt zuviel!" Den
Rittern gefiel die Rede des jungen Fürsten, sie gelobten, ihm die Reise
vollbringen zu helfen, wofür er ihnen sehr dankbar war. Er sorgte sogleich
dafür, daß den edeln Rittern gans neue Rüstung und Wehr verfertigt
wurde, damit sie mit allem, was zur Reise gehörte, wohlversehen
waren.
Auch die Kaiserin erfuhr, daß ihr Sohn aus Deutschland hinwegziehen
wollte; sie schickte ihm daher ohne Wissen seines Vaters und gang im geheimen
hundert Mark Silbers, dazu viel andere Kleinode und entbot ihm
vieltausend gute Nacht. Dieses Gut teilte der junge Fürst alles unter
seine Ritter aus und besoldete sie damit; denn sonst hatte er nicht mehr
viel Guts und Geldes, weil er so elendiglich von seinem Vater aus allen
seinen Landen vertrieben war. Und wie er nun mit seinen Rittern vom
Lande schied, da hub er an zu weinen und sprach: "Nun erbarme es Gott,
daß ich so elendiglich aus meiner Väter Lande ziehen muß!" Doch getröstete

er sich seiner mannlichen Ritter, die alle so gutwillig mit ihm gingen
. Darauf zogen sie die nächste Straße nach Ungarn. Alldort wurden
sie gut empfangen von dem König und blieben acht Tage da. Darnach
schickte der König dem Herzog und seiner löblichen Ritterschaft etliche
Boten, die ihm den rechten Weg durch den Wald nach der Bulgarei weisen
sollten. Als sie glücklich hindurchgekommen waren, schickten sie die
ungarischen Wegweiser zurück, nachdem sie sie reichlich beschenkt und ihnen
aufgegeben hatten, dem König ihren großen Dank zu vermelden.
Wie sie sich nun im Kaiserreich der Griechen befanden, ritten sie den
nächsten Weg auf Konstantinopel zu. Als sie dort angelangt waren, empfing
sie der Kaiser gar schön und tat ihnen große Ehre an. Besonders
empfand er große Liebe für Herzog Ernst, weil dieser sich gegen seinen
Vater, den Römischen Kaiser, so mutig zur Wehre gestellt hatte. An diesem
Hofe blieb Herzog Ernst mit seiner Gesellschaft wohl drei Wochen
lang, bis daß ein überaus großes Schiff kam, welches der Kaiser mit allen
Lebensbedürfnissen versehen ließ. Dann befahl derselbe den besten Schiffsleuten
, die er hatte, den jungen Fürsten mit allem Fleiße zu fahren, damit
derselbe keinen Schiffbruch zu befürchten hätte. Als nun das Fahrzeug
mit allem Vorrat wohlversehen, auch mit Segelstangen, Stricken, Segeltüchern
und allem, was zu einem solchen Schiffe gehört, vollkommen ausgerüstet
war, segnete Herzog Ernst mit seiner Ritterschaft den Kaiser und
fuhr in Gottes Namen dahin und mit ihm viel Griechen, die ihm Gesellschaft
leisteten und ihn in zwölf Schiffen begleiteten, weil sie die heilige
Fahrt nach Jerusalem auch gerne vollbracht hätten. Sechs Wochen waren
sie mit gutem Winde gefahren; da erhub sich in der Nacht ein starkes Ungewitter
auf dem Meere, so daß die Fahrzeuge große Not von den Wellen
litten. Der Sturmwind war so heftig, daß die zwölf Schiffe mit den Griechen
von den grausamen Stößen des Orkanes alle entzweigingen und versanken,
weil es keine so wohlerbaute, starke Fahrzeuge waren als die Herzog
Ernsts; denn nur sein Schiff war so gut mit Eisen beschlagen, daß die
Wellen es nicht so bald auseinander zu reißen vermochten. Jedoch, hätte
es länger gedauert, so würde es das Ungestüm der Wogen auch nicht mehr
ertragen haben können, sondern in Stücke gegangen sein.
Als der Herzog seine Begleiter so jämmerlich ertrinken sah, weinte er
mit allen seinen Genossen und bat Gott, daß er doch ihnen selbst möge
gnädig und barmherzig sein. Nun wußten die Schiffsleute nicht, in welcher
Gegend oder in welcher Landesnähe sie waren; auch fing der Vorrat
an, ihnen auszugehen; denn sie waren wohl schon vierzig Wochen auf dem
Meere gefahren und hatten nichts gesehen als Himmel und Wasser: deswegen
flehten sie brünstig zu Gott, daß er sie dem Lande zuführen wolle;
sie litten großen Mangel, und wären sie noch einen halben Monat auf
dem Wasser gefahren, so würden sie Hungers gestorben sein.
***Endlich erblickten sie eine Küste, steuerten mutig zu und erreichten in
kurzer Zeit das Land. Sobald sie aus dem Schiffe gestiegen, setzten sie
sich auf ihre Rosse, ließen das Fahrzeug am Strande und mit den Schiffleuten
einige Knappen darin; die Ritter selbst gingen mit dem Herzog und
besichtigten von ferne eine Stadt, die sie vor sich sahen. In ihre Nähe sich
zu begeben, wagten sie nicht, weil niemand wußte, in welcher Landschaft
sie waren, und welche Leute da wohnten. Die Stadt war sehr schön gebaut
, hatte eine hohe und dicke Mauer und einen breiten Wassergraben,
auch gewaltige Basteien und einen schönen Wall. Nachdem sie lange hinund
hergeritten, entschlossen sie sich, zu ihrem Schiffe zurückzukehren, und
aßen und tranken dort, so gut sie es hatten; denn es war nicht viel mehr
übrig bei ihnen. Nach dem Essen warfen sie sich in ihre Rüstung, und
Herzog Ernst gab dem Grafen Wetzel die Fahnen, auf welchen ein goldenes
Kruzifix gestickt und der Spruch darunter geschrieben war: "Gottes
Wort bleibet ewiglich."
Die Völker, die in diesem Lande wohnten, hießen die Agrippiner. Ihr
König war eben mit seinen Untertanen ausgezogen, weil er gehört hatte,
daß eines Königs Tochter aus Indien durch sein Land reisen werde, welche
sich mit einem fremden Königssohne vermählen wollte: dieser Braut wollten
sie die Straße verlegen, und als die Herren kamen, welche sie
Königssohne zuführen sollten, erschlugen sie alle und nahmen die Jungfrau
mit sich. Da ritt Herzog Ernst mit seiner Ritterschaft um die Stadt,
zweifelte jedoch, ob er hineingehen sollte, und fürchtete sich sehr.
So hielten sie vier Tage still und wußten immer nicht, in welcher Leute
Land sie waren. Endlich ritten sie wieder landeinwärts und betraten die
Stadt. Aber kein Mensch war darin. Lange ritten sie hin und her in den
Gassen, gelangten endlich vor ein schönes Schloß, stiegen von ihren Rossen
, gingen hinein und kamen bald in einen hohen Saal. Da fanden sie
schön zugerüstete Tische, die mit Essen und Trinken reichlich verses waren,
wie wenn Hochzeit gehalten werden sollte. Das geschah denn auch
insoweit, als Herzog Ernst mit seiner ganzen Ritterschaft sich niedersetzte
und sich alle recht satt aßen und tranken. Dann schickten sie auch den
Schiffsleuten Essens genug, sich daran zu erlaben. Und darauf befahl
Herzog Ernst, daß man das Schiff mit Lebensmitteln versehen solle. Da
trugen die Diener von den Speisen, soviel sie konnten, zu Schiffe, so daß
sie wohl für ein halbes Jahr genug hatten. Jetzt ging Herzog Ernst und
Graf Wetzel im Schlosse herum; sie betrachteten sich alle Gebäude, die
sehr köstlich waren. Dann begaben sie sich wieder auf das Schiff und
blieben die ganze Nacht auf demselben. Wie der andre Tag anbrach, ging
Herzog Ernst zu seinem Freunde Wetzel und bat ihn, wieder mit ihm in
die Stadt zu gehen. Das tat der willig. Als sie die Stadt wiederbetreten
hatten, gingen sie aufs neue durch die Straßen lustwandeln und sahen
manchen schönen Bau, über den sie sich verwunderten. Dann betraten sie
wieder den Saal, aßen und tranken vom Besten, das vorhanden war, und
besahen sich auch sonst den Palast. Da fanden sie eine Kammer, in der
standen zwei herrlich bereitete Betten mit Decken von Goldstoff, und auch
die Bettstellen waren von lauterem Golde; mitten in der Kammer stand
ein Tisch, mit einem köstlichen Teppiche gedeckt, und auf diesem die lieblichsten
Gerichte. Zunächst an diese Kammer stieß ein kleiner Saal, und
an diesen ein Garten mit einem gar schönen Brunnen, der sprang in zwei
goldene Tröge.
Da sprach Herzog Ernst: "Lieber Freund Wetzel, wir wollen uns ausziehen
und baden"; das taten sie und wuschen sich zum besten. Dann gingen
sie in die Kammer, legten sich in die zwei köstlichen Betten und ließen
sich den Schlaf eine gute Zeit behagen. Nachdem sie genug gerastet
hatten, gingen sie abermal in dem Schlosse herum und betrachteten sich
alle seine Herrlichkeiten; dann besahen sie mit Gemächlichkeit alle angenehmen
Plätze der Stadt. Auf einmal sieht Graf Wetzel ein großes Heer
daherziehen, und wie er es sich näher betrachtet, was muß er sehen? Alle
Leute desselben waren so gestaltet, daß sie von unten bis an den Hals
ganz schön waren; oben aber hatten sie Kranichshälse. "Liebster Herr",
sprach Wetzel zu seinem Freund Ernst, "sehet Ihr nicht dieses ungeheure
Volk, das dort herzieht?" Da ward es auch Herzog Ernst gewahr und
sprach: "Was sollen wir tun? Ich denke, wir verbergen uns, damit wir
sehen, was sie anfangen!" So verbargen sich die zwei Helden hinter der
Türe in einem Winkel und sahen da zu, was die Agrippiner taten.
***Diese zogen feierlich in die Stadt, und ihr König betrat das Schloß: er
hatte eine schöne Jungfrau bei sich, die von königlichem Stamme war; es
war ebendie, welche der König mit seinen Untertanen den Brautfahrern
abgenommen hatte. Nun setzte sich der beschnabelte König mit seinen
Bürgern zu Tische; aber sie merkten bald, daß mehrere Speisen ihnen entrückt
waren, und konnten sich nicht denken, wie das zugegangen. Doch
aßen und tranken sie sich voll und fingen an schnattern und zu singen;
auch war unter ihnen mancherlei Saitenspiel, und sie trieben gar wunderliche
Abenteuer mit Springen, Tangen und Gaukeln. Der König saß
bei der schönen Jungfrau am Tisch und bot ihr öfters den Schnabel, damit
sie ihn küssen sollte. Aber die gute Jungfrau war voll Traurigkeit;
wandte den Mund stets seitwärts und dachte: "Oh, allmächtiger Gott;
wäre ich weit weg von diesen scheußlichen Geschöpfen! Ja, wenn ich in
einem Walde wäre, wo die wilden Tiere wohnen: ich wollte mich nicht
hieherwünschen!"
Solche Trübseligkeit der Jungfrau sahen die beiden Herren hinter der
Türe in ihrem Winkel und sprachen zueinander: "Wie könnten wir doch
die Jungfrau erretten!" —"Ich will", sprach Herzog Ernst, "mein Leben
daransetzen und die schöne Magd befreien!" So sprachen sie leise miteinander,
wie sie es anfangen wollten. Doch ließen sie die Sache eine Weile
auf sich beruhen; endlich sagten sie, einer zum andern: "Wenn es nur unsern
Rittern im Schiffe gut geht, und sie nicht von diesen Halbmenschen
erschlagen werden!" Und Herzog Ernst sprach: "Ich wollte, sie wären bei
uns im Saale, wir wollten hier unter sie fahren!" Dagegen dachten die
Ritter im Schiffe: "Wollte Gott, daß wir unsern Herzog Ernst und seinen
Freund, den Grafen Wetzel, wieder bei uns hätten; wir glauben nicht anders,
als daß sie tot sind." Und so gingen die Ritter traurig im Schiffe
auf und ab.
***Die Mahlzeit der Agrippiner hatte inzwischen lange gewährt, und sie
hatten groß Geschnatter zu Hauf getrieben. Da kam die Zeit, daß jedermann
nach Hause gehen sollte. "Mein liebster Freund", flüsterte der
Herzog Ernst seinem Gesellen Wetzel zu, "wie wollen wir es anfangen,
daß uns die Jungfrau zuteil wird? Ich denke, wir springen hervor und
stechen den König tot!" —"Nein", sprach Wetzel, "wir wollen achtgeben,
wenn der König zu Bette geht, dann wollen wir ihm die Jungfrau nehmen."
Dieser Rat gefiel dem Herzog. Wie nun das Mahl ein Ende hatte,
ging alles nach Hause; das schnablichte Gesinde war trunken und schnalzte
wie die Enten, der König aber begab sich in die schön geschmückte Kammer
, die allerorten mit lauterem Golde geziert war. Dann fertigte er
zwei Diener ab, welche die Jungfrau holen sollten: als nun diese mit ihr
unterwegs waren, kamen Ernst und Wetzel aus ihrem Schlupfwinkel ihnen
nachgefolgt; sprangen hervor und schlugen dem einen Diener den Kopf
ab; der andre entrann ihnen, kam in des Königs Kammer und schrie:
"Die Indianer sind da und wollen die Jungfrau wiedernehmen!" Da
schnalzte der König, sprang auf und der Jungfrau entgegen: diese stach er
mit seinem spitzigen Schnabel in beide Seiten, so daß ihr das Blut herunterfloß
und sie zur Erde fiel. Als die Helden dies sahen, wurden sie
grimmig wie Löwen: Herzog Ernst sprang auf den König zu und durchstach
ihn mit dem Schwert, daß er zu Boden stürzte. Nun wurden die
Herren von den Agrippinern umringt, daß sie sich ihrer kaum erwehren

konnten. Doch trieben sie diese zur Kammer hinaus, verschlossen dieselbe
fest und gingen dann zu der Jungfrau, die sie von der Erde aufhoben und
trösteten. Aber sie war von des Königs Schnabel so verwundet, daß sie
vor Sterbensangst fast nicht reden konnte. Endlich sprach sie: "Oh, ihr
kühnen Helden, hättet ihr mich meinem Vater lebendig heimgebracht, so
wäre ich einem von euch zuteil geworden; jetzt aber kann das nicht sein, die
Zeit meines Verscheidens ist da; Gott wolle meiner Seele barmherzig
sein!" So gab sie ihren Geist in Herzogs Ernsts Armen auf und starb.
Wie die Helden sahen, daß die Jungfrau tot war, sprachen sie zueinander:
"Sinn wollen wir uns wehren, oder wir sind des Todes!" Damit tat
Herzog Ernst die Kammertür auf; da stand es voll von Agrippinern, die
schlugen und stachen gegen die beiden. Die wehrten sich jedoch gar männlich,
schlugen ihrer viele zu Tode und machten sich endlich eine Bahn bis
zum Stadttore, aber dies war zugeschlossen. Jetzt standen sie erst recht in
Ängsten und riefen Gott und den Heiland um Hilfe an.
Da schickte es Gott, daß ihre Ritter das Schiff verließen, auf die Pferde
saßen und nach ihren Herren sehen wollten. Sie ritten bis ans Tor und
fanden es zu. Nun hörten sie großes Rauschen und Schlagen in der
Stadt; da erschraken sie, rannten wieder nach den Schiffen, rüsteten sich
mit ihren besten Wehren und eilten zurück nach dem Tor. Aber sie konnten
es nicht öffnen. Endlich schlugen sie es mit Streitäxten entzwei und
kamen so zu ihren Herren hinein. Da schöpften diese wieder Mut und
zerarbeiteten sich so lang an den Agrippinern, bis sie mit dem Leichnam
der Jungfrau vor das Tor kamen. Dort erhub sich ein neuer Streit, und
sie wurden so hart bedrängt, daß sie die Jungfrau unter den Feinden liegen
lassen mußten; denn jetzt zogen diese mit großer Macht in das Feld
und gedachten, den Herzog Ernst und seine Ritterschaft zu erschlagen.
Diese aber hielten sich, wie mannlichen Leuten geziemt, zogen in guter
Ordnung nach dem Schiff, schlugen um sich, stachen und hieben tapfer in
die Feinde; aber die Agrippiner schossen mit vergifteten Pfeilen nach
ihnen: da wichen die Helden allgemach in ihr Schiff zurück und hatten
große Arbeit, bis sie die vielen Verwundeten ins Schiff gebracht. Dann
segelten sie davon. Die Agrippiner hatten auch Schiffe, in die warfen sie
sich, fuhren ihnen nach und schossen mit ihren Giftpfeilen, als ob es
schneiete.
Nun hatte Herzog Ernst in seinem Schiff ein Wurfzeug, mit dem warf
er drei bis vier Schiffe in den Grund, so daß alle Kranichsleute, die darauf
waren, ertranken. Wie die übrigen sahen, daß sie den Helden nichts
abgewinnen konnten, kehrten sie wieder heim und beklagten ihren König,
der in der Stadt umgekommen war.
Aber Herzog Ernst und seine Ritterschaft schifften auf dem ungestümen
Meere dahin und dankten Gott von ganzem Hergen, daß er sie von den
Kranichsköpfen erlöst hatte. Doch lagen mehrere Ritter hartverwundet
von der Feinde Geschoß; denn diese hatten große Pfeile, deren Spitzen
alle vorn vergiftet waren; wen sie damit getroffen, und war auch nur die
Haut geritzt, der mußte sterben. Mit solchem Geschoß waren wohl an acht
tapfere Ritter verletzt worden; diese lagen gans elend auf ihrem Lager;
denn niemand konnte ihnen helfen, und keiner war im Schiff, der ihnen
ihre Schmerzen wenden konnte. Das Meer selbst wollte die kranken Ritter
nicht länger auf seinem Rücken dulden, es wurde wild und warf das
Schiff hoch auf den Wellen empor. Wären sie nicht bald gestorben, so
hätten der Herzog und seine Ritter sie über Vord werfen müssen; aber
Gott schickte ihnen den Tod. Als sie nun christlich verschieden, band man
sie auf einige Dielen und heftete wohl verwahrtes Geld daran, daß sie
ehrlich begraben werden konnten, wo man sie am Ufer fände. Dann wurden
sie unter großem Weinen der Üergebliebenen ins Meer geworfen.
***Vier Tage fuhren jetzt die Ritter ganz still und mit gutem Winde dahin,
aber ihrer wartete das Unglück. Denn am fünften Tage fing der Wind
an, aus Süden zu blasen, und erregte ein großes Ungewitter, so daß Herzog
Ernst meinte, das Schiff müsste untergehen. Der Steuermann wußte
nicht, in welcher Gegend sie wären; denn es war finstere Nacht. Als der
Tag anzubrechen begann, ging der oberste Schiffsmann hinaus aufs Verdeck
und sah sich um. Da erschrak er gewaltig und rief mit lauter Stimme:
"O allmächtiger Gott, komm uns am heutigen Tage zu Hilfe, sonst müssen
wir verderben!" — "Schiffsmann, was ist's, daß du so schreiest?"
sprach drunten im Schiffe der Herzog Ernst. "Herr, bittet Gott mit allen
den Eurigen um Gnade", antwortete der Schiffsmann, "wir sind gant
nahe beim Magnetenberg und können nicht mehr davonkommen. Alle
diese Schiffe, die Ihr da sehet, sind schon verdorben!" — Herzog Ernst
rief ihm zu: "Steig herunter und versuche, ob wir das Schiff nicht mit
Gottes Hilfe wenden können!" Aber der Schiffer sprach: "Das unmöglich
, wir müssten wider Gottes Gewalt handeln. Darum bittet ihn,
daß er Euch gnädig und barmherzig sein melle!" Wie nun der Herzog
sah, daß der Schiffsmann so verzagt war, wußte er nicht, was er tun
sollte, und sprach zu seinen Rittern: "Liebe Freunde, weil es Gott so
haben will, daß wir unser Leben in dem wilden Meere lassen sollen, so
falle ein jeder auf seine Knie, bitte Gott den Herrn um Gnade, daß er
jedem seine Sünden verzeihen wolle." Alle fielen auf die Knie. Nun fing
Herzog Ernst an und sprach: "O allmächtiger Gott, der du mich armen
Sünder mit meinem Volke beschützet hast, wenn jetzt unsere Stunde gekommen
ist, in der wir unser Leben enden sollen, so bitten wir dich, du
wollest uns deinen Heiland senden, daß er unsere Seelen in seine Hände
nehme!" Bei solchen Worten ergab sich ein jeder Ritter in Gottes Willen.
Da begann die Kraft des Berges das Schiff an sich zu ziehen, daß es
in Stücke ging. Jetzt fing erst ein rechter Jammer an; einige von ihnen
faßten die Trümmer des zerbrochenen Schiffs und arbeiteten ängstlich,
wie sic sich auf die am Berge liegenden zertrümmerten Schiffe retten
könnten. Nun trafen hier Herzog Ernst und sein Freund Wetzel mit noch
einigen Rittern zusammen, ihrer sieben auf einem solchen Schiff. In diesem
fanden sie viele Tote; dieselben legten sie oben auf das Schiff. Da
kamen die Greifen geflogen, nahmen die Leichname hinweg und brachten
sie ihren Jungen zum Fraße. Nun erscholl ein jämmerlich Geschrei; die
Ritter und Herren, die sich hin und mieder noch auf die Schiffe flüchteten,
schrien und weinten, und riefen zu Gott, daß er ihnen gnaden wolle. Diese
Klagen hörte Herzog Ernst, und die bei ihm waren; das jammerte sie sehr,
aber sie konnten ihnen nicht zu Hilfe kommen, sondern baten nur stets
Gott unter Tränen, daß er sich ihrer erbarmen wolle. So irrten sie traurig
auf dem Schiffe hin und her; da kam Wetzel von ungefähr in eins
Kammer, in der er viel Ochsenhäute beieinander liegen sah. Er ging zurück
zu Ernst und sprach: "Allerliebster Herr, wir müssen unser Leben
doch wagen; sollen wir hier so elendiglich unsern Tod abwarten? Es wäre
viel besser, Ihr folgtet mir diesesmal; eine andere Zeit will ich wieder
Euch folgen." — "Mein lieber Freund", antwortete Ernst, "wohl kommt
die Zeit, wo ein guter Geselle dem andern folgen soll! Je nachdem du
Rat gibst, je nachdem folge ich!" Da sprach Graf Wetzel: "Weil wir
unser Leben einsetzen müssen, so wäre das meine Meinung: es sind hier
im Schiffe viele Ochsenhäute, darein wollen wir uns nähen lassen, und
dann sollen uns die Diener auf das Schiff legen. Wann nun die Greifen
kommen, so meinen sie, es sei irgendein Leichnam; alsdann führen sie uns
in ihr Nest, den Jungen zur Speise. So möchte dann Gott ein weiteres
Mittel schicken, daß wir mit dem Leben davonkamen, und so gelangen wir
wenigstens glücklich über das Meer!" Herzog Ernst war dies zufrieden.
"Aber es dünkt mich", sprach er, "daß wir uns mit unserer Rüstung versehen
müssen; denn der Greif wird uns sonst mit seinen spitzigen Klauen
häßlich durchgreifen!"
So, nachdem sie alles im Schiffe gemustert; kamen sie in einen Winkel,
da fanden sie viel Edelsteine; von diesen nahmen beide ein gutes Teil zu
sich, legten ihre Rüstung an, versorgten sich aufs beste und ließen sich zusammen
in zwei Ochsenhäute nähen, worüber sich die guten Diener sehr
betrübten; sie taten es gar ungern, mußten sie nach ihres Herren Geheiß
handeln. So wurden sie fest eingenäht und oben auf das Schiff gelegt
. Kaum lagen sie eine Stunde da, so kam ein grausam großer Greif,
der nahm beide mit und führte sie in die Luft, als wenn ein Habicht eine
Lerche dahintrüge. Die Diener sahen ihren Herrn mitsamt Wetzel hinfahren
und wurden sehr traurig. Auch die zwei waren betrübt; denn der
Greif hatte sie so hart gefaßt, daß sie sich nicht rühren konnten, und wenn
sie nicht in ihrer Rüstung so wohlverwahrt gewesen wären, so würden sie
nicht davongekommen sein; denn sie meinten, der Atem würde ihnen ausbleiben.
Da nun der Greif in seinem Neste war, legte er sie nieder, schwang sich
wieder in die Luft und ließ die zwei Herren bei den jungen Greifen liegen
. Als diese sich allein fanden, sprach Herzog Ernst zu Wetzel: "O lieber
Geselle, lebst du noch?"Dieser konnte vor Müdigkeit und Ohnmacht kaum
antworten und sprach: "Wenn uns Gott nicht hilft, so können wir nicht
von hinnen kommen. Denn ich habe in meinen Armen keine Stärke
mehr, daß ich mich aus der Ochsenhaut schneiden könntet" Da sprach
Herzog Ernst: "Verziehe noch eine kleine Weile, bis wir besser zu Kräften
kommen!" So lagen die beiden eine Stunde und fürchteten sich sehr
vor dem alten Greifen, daß er wiederkommen würde. Doch fing Herzog
Ernst an, sich aus der Ochsenhaut zu schneiden, und als er aufgestanden,
schnitt er seinen Freund Wetzel auch heraus. Da alle beide los waren,
sahen sie die jungen Greifen an: die waren so groß als Kälber. Aber sie
durften den Rittern nichts tun; doch stiegen die bald aus dem Nest und
Sahen sich um; da wurden sie gewahr, daß sie der Greif über das große
Meer geführt hatte; sie wußten nicht, an welchem Orte sie sich befanden.
Es war ihnen aber auch einerlei; sie dachten nur an ihren Hunger und
aßen Wurzeln aus den Steinen; dann fielen sie wieder auf ihre Knie, lobeten
und preiseten Gottes Allmacht. Nur wußten sie nicht, wo sie heruntersteigen
sollten; denn wenn der alte Greif sie ereilt hätte, wären sie
von ihm umgebracht worden. Wie sie nun merkten, daß die alten Greifen
hinweggeflogen waren, stiegen sie mit großem Kummer von dem hohen
Berge hinab, und wie sie hinuntergekommen waren, liefen sie in einen
großen Wald und beklagten ihre fünf Diener sehr, die sie in dem Schiffe
verlassen hatten.
Nun aber berieten sich eben in dieser Zeit die Diener in dem Schiff, und
zwei von ihnen ließen sich von den drei andern auch in eine Ochsenhaut
nähen; und diese wurden von dem vorigen Greifen ebenfalls geholt und
in sein Nest geführt. Auch diese schnitten sich mit vieler Mühe aus der
Ochsenhaut. Als sie merkten, daß der Greif hinweggeflogen war, stiegen
sie mit großer Sorge aus dein Nest und gingen in den Wald; sie hofften,
hier ihren Herrn und seinen Freund aufsuchen zu können. Da nun die
übrigen drei Diener noch allein im Schiffe waren, wußten sie nicht, was
sie tun sollten. Zuletzt sprach einer von ihnen: "Meine Meinung wäre,
daß ihr euch beide auch in eine Ochsenhaut nähen ließet, und das wollte ich
tun, so ich hoffe auf Gott den Allmächtigen; hat er unseren Herren, Herzog
Ernst und dem Grafen Wetzel, davongeholfen und darnach den andern
zwei Dienern, die der Greif hinweggeführt hat, so wird euch Gott auch
helfen. Dann will ich allein in dem Schiff bleiben, solang mir Gott das
Leben vergönnt!"Diesem Rat folgten die zwei und zogen ihre Rüstung
an, da nähte sie der eine Genosse in zwei Ochsenhäute. Dann mühte er
sich lange mit ihnen ab, bis er sie auf das Verdeck brachte; wie sie nun
bereits vier Stunden gelegen waren, kam der Greif in schnellem Fluge;
nahm sie in seine Klauen und trug sie über das Meer zu seinem .

Als nun der eine Diener sah, daß er ganz allein in dein Schiffe war,
fing er an, ganz traurig zu werden, aber mehr um seiner Genossen und
seines Herrn als um seiner selbst willen. Bald hatte er nichts mehr zu
essen als ein halbes Brot, dies genoß er ohne einen Trunk; wie nun alles
verzehrt war und er sich so ganz allein sah und von keiner Seele mehr
Trost empfangen konnte, mußte er in Hunger und Durst elendiglich in
dem Schiffe sterben und allda den großen Tag der Zukunft Jesu Christi
erwarten. Inzwischen waren die zwei andern Gesellen in großer Furcht
und Müdigkeit eine Zeitlang im Neste des Greifen gelegen, bis sie wieder
zum Bewußtsein kamen. Auch sie schnitten sich mit vieler Mühe und
Arbeit aus der Ochsenhaut und kamen aus dem Nest in den Wald, wohin
die zwei vorigen gegangen waren, ihren Herrn zu suchen; aber sie konnten
ihn nicht finden. Alle vier liefen zerstreut hin und her wie die Schafe,
die ihren Hirten verloren haben, und hatten nichts zu essen als die Wurzeln
aus der Erde. Die zwei letzten Diener gingen und suchten einen
Brunnen; denn sie hatten sich gar müde an dem Berge gestiegen. Wie
sie nun so durstig in dem Walde umliefen, dabei über ihren Herrn und
ihre Gesellen klagten, so siehet der eine einen Hirsch daherspringen, der
am Brunnen trinken wollte. Als der Hirsch sich dem Brunnen näherte,
ward er scheu und lief, als wenn man ihn zagte: da merkten die zween,
daß jemand in derselben Gegend wäre, und gingen hinzu. Dort fanden
sie die zwei andern Gesellen beim Brunnen sitzend, wodurch alle vier nicht
wenig erfreut wurden. Sie erquickten sich an dem fließenden Wasser:
dann beratschlagten sie, wie sie ihren Herrn in dem dicken Walde suchen
wollten, und stiegen durch manche tiefe Kluft; zuletzt schwang sich einer
der Genossen auf einen hohen Baum und sah ihrer zween Leute in dem
Walde gehen; da fing er an zu pfeifen und zu rufen. Als Herzog Ernst
und der Graf das Geschrei und Pfeifen hörte, standen sie stille und wußten
nicht, was das für Laute waren. Indem siehet Ernst vier seiner Diener
daherkommen. Des wurden sie von Hergen froh und empfingen einander
mit lauter Freude. Ein jeder erzählte, wie es ihm ergangen war;
dann gingen sie eine Weile in dem Walde fort: da sahen sie einen tiefen
Grund, in dem ein reißendes Wasser floß; hier stiegen sie mit großer
Mühe über die Felsen, bis sie zu dem Wasser kamen. Denselben Weg,
von wo sie gekommen waren, konnten sie nicht wieder hinauf; denn er
war voll großer Steinklippen; es wunderte sie, wie sie, ohne zu fallen,
heruntersteigen konnten. Nun gingen sie längs dem Wasser hinunter in
der Hoffnung, irgendeinen Weg zu finden, aber es war vergebens; denn
je länger sie gingen, je schlimmer begann der Pfad zu werden, und je
höher die Berge waren, desto breiter wurde das Wasser und verlor sich
zuletzt in eine tiefe Kluft, da brauste es so abscheulich, daß es ein Schrecken
zu hören war. Nun wußten sie nicht, was sie tun sollten, standen beieinander
und ratschlagten.
Da befahl Herzog Ernst seinen Rittern, sie sollten große Bäume abhauen:
das taten sie und halfen einander getreulich, daß sie die Stämme
mit aller Macht zuhauf trugen, Weiden und anderes junges Gesträuch;
dann banden sie ihre Harnische darauf. Nun sprach Herzog Ernst:
"Meine lieben Freunde, welcher mit durch diesen Berg fahren will, der
befehle sich Gott, dem Allmächtigen, und bitte ihn um Gnade, daß er uns
den Heiland zum Geleitsmann schicken wolle durch diesen ungeheuren
Berg, damit wir glücklich mögen durchkommen!" Die Diener taten dieses
alle und baten den Allmächtigen um Sicherung ihres Lebens. Dann bestiegen
sie den Floß, den sie verfertigt hatten, und stießen ihn in das Wasser,
da schoß er hin wie ein Pfeil. Als sie nun in das Loch hineingekommen
waren, wurde es stockfinster, so daß keiner den andern auf dem Floße sehen
konnte. Da ging das Fahrzeug schwankend von einer Seite zur andern, so
daß sie meinten, es würde in Stücken gehen. Eine Weile ging es quer,
dann wieder der Länge nach: das Wasser brauste so sehr daß keiner
hören konnte, was der andere sprach. Dies ungestüme Fahren trieb sie
wohl einen halben Tag, während welcher Zeit keiner etwas sah; da kamen
sie wieder an einen Berg, der leuchtete so hell, daß es schimmerte wie
Feuer. Als sie ganz nahe waren, schlug Herzog Ernst ein Stück davon;
und diesen Stein heißt man auf Latein Unio und zu Deutsch Karfunkel.
Ihn hat Herzog Ernst seinem Vater mitgebracht; und dieser ließ ihn in
seine Krone setzen.
***Nachdem nun Herzog Ernst mit dem Grafen Wetzel und seinen Rittern
durch den dunkeln Berg gefahren war, kamen sie an einen großen Wald,
und als sie vor denselben fuhren, arbeiteten sie sich mit dem Floß an das
Land: da sahen sie viel schöner Städte und Schlösser, worüber sie von
Herzen froh waren, wiewohl sie der Hunger sehr hart quälte. Nun taten
sie alle ihre Harnische an, gingen miteinander nach einer großen Stadt
und stellten sich zueinander unter das Tor. Da kamen Völker gegangen
mit einem Auge, das hatten sie über der Nase; diese heißt man zu Latein
Zyklopen, und sie wohnen in Indien, sonst nennt man das Volk auch
Arimasper. Viele derselben kamen herbeigelaufen, besahen Herzog Ernst
mit seinen Leuten und verwunderten sich sehr, daß es Menschen gebe, die
zwei Augen hätten; denn sie meinten, das wären Wilde; damm gingen
sie fort und zeigten dem Herrn der Stadt an, es seien Leute vor dem
Tore mit zwei Augen. Als der Beherrscher das vernahm, wunderte er
sich sehr mit allen seinen Bürgern, schickte nach ihnen und ließ sie zu sich
rufen. Alsbald ging der oberste Statthalter hin zu dem Tor und fragte
sie, aus welchem Lande sie gekommen wären. Da antwortete ihm Herzog
Ernst, sie kämen aus dem Königreiche der Agrippiner. Nun führte sie
jener zu dem Herrn der Stadt und glaubte, es seien Satyrn oder Waldmenschen
, das heißt, halb Menschen und halb Böcke, und sie seien etwa
durch Verirrung aus dem Walde gekommen. Der Herr aber empfing sie
aufs freundlichste, und sie dankten ihm mit großer Ehrerbietung. Als er
sah, daß sie sich so höflich erzeigten, gewann er sie sehr lieb, da sprach
Herzog Ernst: "Lieber Herr, machet doch, daß Eure Diener uns etwas zu
essen bringen, damit wir uns des Hungers erwehren mögen; denn wir
haben seit sechs Tagen nichts als Wurzeln gegessen." Da befahl der
Herr, daß man ihnen zu essen brächte. Dies geschah auf der Stelle. Herzog
Ernst und Graf Wetzel setzten sich mit den vier dienenden Rittern zu
Tische und aßen und tranken sich recht satt. Nach vollbrachter Mahlzeit
führte der Herr der Stadt den Herzog Ernst und seinen Freund in die
Kammer und fragte sie, von wannen sie denn wären. Da sprach der Herzog
zu ihm: "Ich und meine Gesellen sind aus Deutschland, und mein
Vater ist der allgewaltigste Kaiser in der Christenheit. Ich wollte eine
Wallfahrt vollbringen nach dem Heiligen Grabe gen Jerusalem, da habe
ich auf dem Meere vor großem Ungewitter viel Gesindes verloren." Und
nun erzählte Ernst seinem Wirte alle Abenteuer, die ihn und seine Genossen
betroffen hatten, und dieser verwunderte sich nicht wenig über
solche Rede.
Am Ende erfuhr der König der Arimasper selbst, daß Herzog Ernst in
seinem Reiche wäre. Von Stund an sandte er einen Boten an den Herrn
der Stadt, der ihm diese Fremden schicken sollte, wiewohl derselbe sie nur
ungern von sich ließ. Wie nun Ernst mit seinen Rittern vor den König
kam, wurde er von ihm aufs beste empfangen, und dieser gewann sie in
der Folge gar lieb, besonders den Herzog Ernst und den Grafen Wetzel.
Sie waren eine gute Zeit bei dem Könige gewesen, als dieser einmal um
Mitternacht auf die Jagd ritt und seine beiden neuen Freunde mit ihm.
Wie sie eine kleine Weile geritten waren, sieht der König mit den Seinen,
daß die Sciapoden wieder ins Land gefallen waren; denn sie hatten eine
Stadt abgebrannt. Ernst fragte ihn, was das für Feinde wären, da sprach
der König: "ES sind unüberwindliche Feinde, Leute, die aus Morgenland
kommen; man nennt sie Sciapoden oder Monokolen, das heißt auf Deutsch
Einfüßler; denn sie haben nur einen einzigen Fuß, und überdies bedecken
sie sich damit, wenn die Sonne heiß scheint, und hüpfen so geschwind, daß
sie niemand erreichen kann, zumal wenn sie auf das Meer kommen, da
springen sie noch viel geschwinder als auf dem trockenen Lande." Da antwortete
Herzog Ernst Könige: "Gnädiger Herr, ich bitte Euch ernstlich
, daß Ihr mir einige streitbare, tapfere Männer gebet; dann will ich
es mit Gottes Hilfe wagen und sie zurück oder gar zu Tode schlagen."
Das ward dem Herzog Ernst vom Könige zugesagt, und so ritt er mit seinen
Gesellen und dem ihm zugegebenen Volk an das Meergestade und
schickte ihnen einige entgegen, die sie bis an das Meer trieben. Nun meinten
die Einfüßler, auf dem Wasser entfliehen zu können; aber Herzog
Ernst brach mit seinem verborgenen Volk hervor und schlug fast alle zu
Tode; nur einen fing er, und diesen führte er zum Könige. Wie sie
nun heimkamen, wurden sie mit Jubel empfangen von allen Leuten, und
besonders von dem Könige, wegen des großen Siegs, den sie gewonnen
hatten.
Bald nach diesem Streite kamen andere Völker, Panochen genannt, und
forderten auch Zins von dem Könige der Arimasper. Diese Völker haben
so große Ohren, daß die Lappen bis auf die Erde hangen. So wurde der
König von seinen Feinden aufs neue betrübt; denn kaum hatte er einen
Teil aue dem Lande gebracht, so waren andere da. Da fragte er den Herzog
Ernst um Rat, wie er es mit ihnen machen sollte, ob er ihnen den gewohnten
Zins zuschicken sollte oder nicht. Der kühne Held sprach: "Nein!
Sondern mahnet das Kriegsvolk wieder auf, das ich vorhin gehabt; dann
will ich sie wohl mit List abtreiben!" Da der König solchen Trost von
Herzog Ernst hörte, wunderte er sich sehr über seine Kühnheit und befahl
dem Volk aufzubrechen. Dies geschah, und so zog Ernst den Feinden mit
Macht entgegen. Als er merkte, daß sie in einem Wald ihre Versammlung
hatten, umlegte er den Ort mit seinem Volke und zündete ihn auf
der einen Seite an. Als die Feinde nun den Wald brennen sahen, liefen
sie zerstreut und wollten entfliehen; aber Herzog Ernst hatte ihnen den
Weg verlegt und schlug sie fast alle zu Tod, außer zweien, die nahm er
gefangen und führte sie mit sich in das Königreich der Arimasper zurück.
Hier wurde er nach errungenem Siege vom König und allem Volk wieder
aufs feierlichste empfangen.
Aber das Königreich der Arimasper hatte großes Unglück; denn es war
von vielen Völkern hart angefochten. Es kamen die Riesen, die in der
Gegend der Kananeer wohnten, und forderten ebenfalls Tribut von dem
König. Der Riesenbote, welcher vor ihn kam, war so groß, daß er nahezu
das Maß von zwölf Schuhen hatte, und das Volk, das ihn sah, entsetzte
sich vor seiner Größe. Dieser sprach mit trotzigen Worten zu dem Könige:
"König, du sollst wissen, daß du meinem Herrn, dem Riesenkönige, den
Zins zu geben schuldig bist; wenn du dies nicht bald tust, so werden wir
dein Land bis auf den Grund verderben!" Über solch frecher Rede erschrak
der König sehr und wußte dem Boten keine Antwort darauf zu geben; er
ließ denselben warten, und schickte unterdessen nach dem Herzog Ernst, der
in dem Lande war, das ihm der König eingeräumt hatte. Als dieser kam,
fragte ihn der König um Rat; wie er es mit den Niesen machen sollte, die
so starke Leute wären: er wolle ihnen den Zins schicken. Aber Herzog Ernst
widerriet das dem König und sprach zu dem Riesenboten, er solle wieder
heimziehen und seinem Herrn sagen, wenn ihnen die Haut juckte, so sollten
sie kommen, sie werde ihnen gekratzt werden. Diese Rede verdroß den Boten
, er ging wieder heim zu seinen Riesen und zeigte ihnen die schnöde
Botschaft an. Da wurden diese zornig, machten sich in schnellem Grimm
auf und fielen in das Gebiet der Arimasper ein. Als der König dies gewahr
wurde, rief er viel Volks auf und befahl ihnen, Herzog Ernst gehorsam
zu sein. Diese waren willig dazu. Nun zog der Herzog den Riesen
entgegen; wie sie nahe aneinander kamen, hielten sich jene in einem
Wald und beabsichtigten, den Feind bei Nacht zu überfallen. Aber Herzog
Ernst hielt gute Wache, so daß sie es nicht vollbringen konnten. So lagen
sie wohl einen Monat lang einander gegenüber und scharmützelten alle
Tage. Der Herzog verlor viel Volks und dachte auf etwas anderes; er
achtete sorgfältig darauf, wann die Riesen sich zum Mittagsmahle anschickten:
da wollte er sie in großer Eile überfallen. So brach er heimlich
mit seinem Volke auf und fiel in der Mittagsstunde in das Holz, da sich
die Riesen dessen nicht versehen hatten; ihrer viele wurden zu Tod gestochen;
; doch blieb auch auf des Herzogs Seite mancher im Walde liegen,
von den Riesen mit Bäumen erschlagen. Dennoch arbeitete Herzog Ernst
unter ihnen so, daß sie am Ende weichen mußten. Einige Riesen, die
sahen, daß es so übel stand, flohen aus dem Walde in ein weites Feld,
aber der Herzog, der dies gewahr wurde, ritt ihnen eilends mit seinem
Volke nach, doch waren sie ihm entronnen bis auf einen. Derselbe war
gar hart verwundet: da nahm ihn Herzog Ernst mit sich, ließ ihm einen
Arzt holen und die Wunden verbinden. Als er wiederaufgekommen war,
ritt der Herzog mit seinem Kriegsvolk zu dem Könige zurück und wurde
von diesem vor allem Volke seiner Mannheit halber gelobt; denn seinesgleichen
war nie einer in das Land der Zyklopen gekommen. Aber Herzog
Ernst wollte nicht daheimbleiben, sondern nahm seine Genossen mit einigem
andern Gefolge und zog weiter.
***Da er nun mancherlei Leute beieinander hatte, gefiel es ihm wohl; er
sprach zu seinem Freunde Wetzel: "Lieber Geselle, rate mir nun; ich habe
von den Leuten gehört, daß es in Indien ganz kleine Menschen gibt, die
in stetem Streite mit den Kranichen liegen. Nun habe ich Lust, solche
Menschen auch zu sehen. Darum ziehe mit mir, dann wollen wir noch
einige tapfere Männer mit uns nehmen." Graf Wetzel war dies wohl
zufrieden. Sie bestiegen alsbald ein Schiff mit Speise und aller Notdurft
und fuhren den nächsten Weg nach Indien. Wie sie in das Land gekommen
waren, nahmen sie ihre Straße nach den Pygmäen oder dem
Zwergvolke. Als diese den Herzog mit seinem Gefolge sahen, erschraken
sie vor den großen Leuten, gingen ihnen entgegen und baten sie um Frieden.
Da sprach Herzog Ernst: "Wir sind nicht gekommen, den Frieden zu
brechen; wir wollen euch vielmehr Frieden machen!"
Darüber wurden die Zwergenvölker froh, und einer fing an und sprach
zu dem Herzog: "Wisset, gnädiger Herr, daß uns die Vögel großen Schaden
tun; denn wir können vor ihnen am Tage gar nichts arbeiten, sondern
müssen es bei Nacht tun!"Indem kam ihr König gegangen, fiel dem
Herzoge zu Fuß und empfing ihn mit seiner Ritterschaft gar tugendlich, ließ
ihm auch ein gutes Nachtlager bereiten. Mit Tagesanbruch ging Herzog
Ernst nebst einigen der Zwerge aus und ließ sie einen Streit mit den Kranichen
anfangen. Die Vögel kamen geflogen und stachen mit ihren spitzen
Schnäbeln der Kleinen viel zu Tod. Herzog Ernst aber ritt mit etlichen
Dienern hinzu, schlug und schoß der Vögel eine solche Menge zusammen,
daß das Feld voller Kraniche lag und die Bewohner ein ganzes Jahr von
ihrem Fleisch zu essen hatten.
Als Herzog Ernst wieder bei dem Könige war, nach gewonnenem Siege,
ließ dieser ihm viel Golds und allerlei Edelsteine vortragen und bat ihn
sehr, er möchte nehmen, was ihm gefiele; aber der Herzog wollte nichts
davon, sondern bat den König nur, daß er ihm zwei kleine Männlein
gebe. Das tat der König mit Freuden und gab ihm zwei Zwerge zu Knechten
. Nun beurlaubte sich Herzog Ernst von dem König und fuhr mit seinein
Volke wieder zu den Arimaspern und hatte die wunderlichen Leute,
die er gefangen, die Zwerge und den ungefügen Riesen bei sich. Wenn er
sich dann eine Kurzweil machen wollte, ließ er sie miteinander streiten.
So hatte er es gut in dem Lande; denn der Zyklopenkönig hatte ihm fünf
große Städte und Schlösser geschenkt.
Einmal, als er das Mittagsmahl genommen hatte, ging er zu seiner
Lust ein wenig am Meeresgestade mit seinen Dienern spazieren. Wie er
sich nun so in der Gegend umsah, da siehet er ein Schiff ans Land kommen.
Neugierig ging er hinzu und fragte die Leute, von wannen sie
wären. Der Patron sprach: "Wir kommen aus Indien und sind vom
Winde hergetrieben worden!" Herzog Ernst fragte sie weiter, welches
Glaubens sie wären. Der Patron antwortete, sie glaubten an den eingebornen
Sohn Gottes, den Erlöser, und wollten ihn nicht verleugnen;
wenn sie auch darüber sterben müßten. Diese Rede gefiel dem Herzog
Ernst sehr wohl. Er sprach zu dem Schiffsherrn: "Lieber Schiffsmann,
sage mir, hat jenes Land auch Krieg mit einem Könige?"—"Ja", sprach
der Patron, "es hat eine Zeitlang schweren Krieg mit dem Sultan in
Babylonien gehabt; dieser hat sie des christlichen Glaubens halber bekriegt
und so angegriffen, daß er über das halbe Land mit Feuer verwüstet
hat; aber jetzt seit einem Jahre hat es mit diesem Könige guten Frieden;
doch fürchte ich, er werde bald wiederanfangen, denn ehe wir aus unsrem
Lande zogen, ging die Sage, er schicke sich wieder an, in unser Königreich
einzufallen!"

Da sprach Herzog Ernst zu dem Patron, er sollte ohne sein Wissen nicht
hinwegfahren; denn er hoffe, wenn es nach seinem Wunsche gehe, auch
mitfahren zu können. Dann lud er den Schiffsherrn mit allen den Seinigen
zu sich auf das Schloß ein und ließ sie dort aufs beste verpflegen.
Als er nun von diesen Mohren alles erfahren hatte, rief er seinen Freund
Wetzel samt seinem Kämmerer zu sich und sprach zu ihnen: "Lieben
Freunde, was ratet ihr dazu? Sollen wir uns aufmachen und zu diesen
Mohren nach Indien ziehen? Denn der dortige Mohrenkönig hat die Christen
sehr lieb. Auch wisset ihr wohl, daß wir uns hier nicht recht regen
dürfen, obwohl mir der König etliche Landschaften geschenkt hat; soll ich
aber deswegen unter den Heiden mein Leben enden? Das will ich nicht
tun, selbst nicht, wenn ich wüsste, daß es mir übler gehen sollte, als es mir
gegangen ist. Darum, liebe Herren, was ratet ihr dazu?" Sie sprachen,
das gefalle ihnen gar wohl, und zeigten sich willig, ihm auf die Reise zu
folgen. Jetzt befahl Herzog Ernst seinen Dienern, das Mohrenschiff mit
Speise zu versehen; dann nahm er seine wunderbaren Leute, bestieg das
Schiff mit Wetzel und seinen andern Rittern samt den Mohren, fuhr ohne
Urlaub aus dem Königreiche der Arimasper weg und ließ die Städte, die
ihm geschenkt waren, dem Könige liegen.
Ein guter Wind trieb ihr Schiff nach Indien. Wie sie dort angekommen
waren, gingen die Mohren sofort zu ihrem König und zeigten ihm an,
daß ein mannlicher Held mit ihnen gefahren, ein christgläubiger Mensch;
der König ging gleich hinaus an das Meeresgestade und empfing den
Herzog Ernst mit großer Achtung; er führte ihn heim und hielt ihn gar
herrlich mit seinen Rittern und Dienern. Sie aber blieben eine Zeitlang
in gutem Frieden bei dem König. Da kam eines Tags ein Bote von dem
Sultan in Babylon, während sie über der Mittagstafel saßen; der sprach
zum Könige: "Du, König der Mohren, wisse, daß ich von meinem Herrn
zu dir geschickt bin und dir sagen soll: wenn du von deinem Glauben nicht
abstehen wirst, so will er dich mit deinem ganzen Lande verderben; darnach
richte dich!" Der König hinter dem Tisch erschrak über solche Worte
und wußte nicht, was er dem Boten antworten sollte. Aber Herzog Ernst,
als ein mutiger Held, sprach zu dem Boten: "Sage deinem König, er
solle kommen; wir wollen seiner warten als Kriegsleute!" Und dann
sprach er zum Könige: "Gnädiger Herr, was denket Ihr, daß Ihr ein so
betrübtes Herz habt? Wisset Ihr nicht, daß Ihr ein Herr und Sultan in
Eurem Lande seid? Und wenn Ihr nur zehn Männer hättet, so solltet
Ihr Euch nicht fürchten! Tut Ihr ja doch solches um des Worts Gottes
willen! Er hat durch seinen Sohn gesprochen: ,Was ihr tut und leidet
um meines Namens willen, das soll euch tausendfältig vergolten werden!"
' Diese Rede gefiel dem König, er sprach zu Herzog Ernst: "Lieber,
Eure Worte, die haben mir mein Herz erquickt; nun will ich es wagen,
und sollte mein Königreich darum zu Scheitern gehen; denn der König
von Babylon hat mir früher mein Land mit Raub und Brand verwüstet,
auch zur See mir großen Schaden getan!"
Der Bote kehrte also zu dem Sultan von Babylonien wieder heim und
zeigte ihm an, was er von Herzog Ernst gehört hatte: "Allergnädigster
Herr König", sagte er, "ich darf Euch die Worte nicht vorenthalten, die
einer der Herren des Königs von Indien, der neben ihm stand, an mich
gerichtet hat. Dieser sprach also: ,Sage deinem König, er soll kommen,
wir wollen ihm Kriegsleute genug sein! ' und noch mehr schnöder Worte
fügte er bei, die ich Euch nicht sagen mag; denn ich fürchte meines Königs
Zorn." Diese Botschaft verdroß den Sultan sehr. Von Stund an
rief er an hunderttausend Heiden zusammen, fiel dem Könige von Indien
in sein Land, verwüstete, was er fand, schlug Männer, Weiber und Kinder
tot und vergoß viel unschuldig Blut. Nun zog auch der König von
Indien notgedrungen zu Feld und ließ sein Gezelt aufschlagen. Am am
dem Tage hieß er sein Volk in aller Frühe aufsein und sich zur Feldschlacht
anschicken. Er selbst durchritt seine Heerhaufen, tröstete sie und
sprach, sie sollten tapfer wider die Heiden streiten; wenn sie dies nicht
täten, so wären sie auf ewig aus ihrem Lande gestoßen. Dazu würde es
ihren Weibern und Kindern übel ergehen. Während der König solche
Rede hielt, kam Herzog Ernst geritten, den bat der König dringend, das
Panier zu tragen, wozu sich Ernst gerne bequemte; denn er hatte sich mit
Graf Wetzel wohl gerüstet; ebenso hatte er auch den großen Riesen stets
bei sich.
Als nun beide Heere eine gute Zeit in Schlachtordnung einander gegenübergestanden
hatten, ritt der König von Babylon auch um seinen Heerhaufen
, tröstete sie mit Mahomet und hieß sie beherzt dreinschlagen; denn
sie sähen ja, daß der König von Indien nicht viel Volks hätte; darum
sollten sie mit Eifer nach dem Panier trachten. Er wußte aber nicht, daß
es ein kühner Held trug. Wie man nun zum ersten und andern Mal geblasen
hatte, schickte sich ein jeder mit seiner Wehr aufs beste. Als man
zum drittenmal zum Angriffe blies, da hub sich ein Spießkrachen an und
ein Geschrei, daß man es auf eine Meile hätte hören können. Die Heiden
wagten es, dem Herzog das Panier streitig zu machen, aber das wurde
ihnen übel gelohnt: denn Graf Wetzel stand mit seinen Rittern nahe an
demselben und schlug so tapfer unter die Heiden, daß es um ihn her voll
von Toten lag. Besonders der Riese, den Herzog Ernst aus Arimaspien
mit sich gebracht hatte, der schlug mit seiner Keule so tapfer um sich, daß
ihm kein Heide mehr standhalten wollte. Mitten unter diesem grausamen
Schlagen von beiden Seiten ritt der König von Indien hinter seine
Schlachtreihen, stieg von seinem Pferd und kniete auf die Erde nieder, hub
seine Hände gen Himmel auf und flehte zu Gott, daß er ihm den Erlöser
zu Hilfe senden, und sein glaubig Volk gegen die Heiden beschirmen möge.
Indessen dauerte das Blutvergießen fort; es floß unter den Toten das
Blut dahin wie ein Bach, darin mancher Heide und mancher Mohr ertrinken
mußte. Der König von Babylon sah das große Gemetzel um
Herzog Ernsts Banner; er jagte in Eile auf ihn zu, als wollte er ihn niederreiten
, aber Graf Wetzel unterlief ihn und versetzte ihm mit seinem
guten Schwert einen so harten Schlag, daß der Sultan mitsamt dem
Rosse zu Boden fiel. Als die andern Heiden das sahen, wollten sie ihrem
Könige zu Hilfe kommen, aber der Riese stand mit seiner Keule dabei
und schlug unsäglich viele Heiden nieder, so daß ihrer keiner zu dem Könige
kommen konnte. Und so nahm diesen Graf Wetzel gefangen. Da

wurden die Heiden verzagt und fingen an, die Flucht zu ergreifen. Jetzt
bekamen die Mohren erst ein Herz, rannten ihnen mit aller Gewalt nach
und erstachen ihrer viele auf der Flucht, so daß der Heidenhunde nur
wenige davonkamen. Eine ganze Meile Wegs sah man nichts denn Leichname
. Als die Mohren sahen, daß sie das Feld behielten, ritten sie zurück
nach dem Walplatz, und nun suchte jeder seinen Freund; da fand mancher
den seinen tot liegen, ein andrer ihn ohnmächtig. Herzog Ernst aber berief
seine Ritter zusammen. Es kamen ihrer nur drei, der vierte blieb
aus. Alsbald ließ er unter den Toten suchen so lang, bis sie ihn fanden,
und der Leichnam wurde vor Ernst und Wetzel gebracht. Als ihn Herzog
Ernst so tot vor sich liegen sah, fing er mit seinem Freund und seinen
Dienern bitterlich zu weinen an und sprach: "Oh, du lieber Diener, soll
ich dich jetzt so tot vor mir sehen; Gott hatte dich so wunderbar in deinem
Leben erhalten, aber weil er dich nicht mehr darin haben will, nun, so
nehme er deine Seele in seine Hände!" Also ließ er ihn nach christlicher
Ordnung zur Erde bestatten. Dann ritt er mit traurigem Herzen zu dem
König von Indien zurück und klagte ihm den Tod seines Dieners; diesen
jammerte es auch.
Darauf ging Ernst mit seinem Freunde Wetzel zum König von Babylon
und sprach: "Du König der Heiden, warum unterstehest du dich, die
Christenheit also zu schwächen, und willst sie von ihrem Glauben abbringen
; das doch der einzig richtige Weg ist, der vor Gott gilts" Der
König von Babylonien sprach darauf zu Herzog Ernst: "Du mannlicher
Held l Wer magst du doch sein? Fürwahr, großer Schaden ist von deiner
Hand meinem Volke geschehen; und wenn du mit deinem Gesellen, der
mich gefangen hat, nicht gewesen wärest, so würde ich den Mohrenkönig
wohl überwunden haben. Nun aber bin ich ein gefangener Mann."
Da fing Herzog Ernst an und erzählte dem König von Babylon seine
ganze Reise, die er vollbracht hatte. Dann ließ er seine wunderlichen
Leute vor sich bringen, stellte sie vor den König und sprach: "Diese Menschen
habe ich mit meinen Genossen in seltsamen Landen überwunden.
Daran, Herr König aus Babylonien, könnet Ihr wohl abnehmen, wie es
mir ergangen ist." Und nun meldete er ihm alles von seiner Ausfahrt bis
auf diesen Tag. Da sprach der König von Babylon: "Lieber Herr, wenn
Ihr mir nicht aus dieser Gefangenschaft helfet, so muß ich all mein Lebtag
hier gefangenbleiben. Und komme ich los, so will ich Euch bis nach
der Stadt Jerusalem mit meinem Volke begleiten, und Ihr sollt für keine
Zehrung zu sorgen haben!"
Diese Verheißung gefiel Herzog Ernst gar nicht übel, er ging sofort zu
dem Mohrenkönig und sprach zu ihm: "Gnädiger König, weil ich Euren
großen Feind gefangen habe, deucht es mir, das beste zu sein, daß Ihr
von ihm Euch eine Versicherung geben laßt und gebet ihn gegen selbige
ledig!" Da sprach der König von Indien: "Nein, der Sultan von Babylon
wird nicht so bald ledig aus meinen Banden, sondern er muß den
christlichen Glauben annehmen!" über diese Worte erschrak Herzog Ernst
und sprach: "Wie wollt Ihr einen dazu zwingend Wisset Ihr nicht, daß
man niemand zum Glauben zwingen soll? Wer ihn nicht aus eigenem
Willen annehmen mag, den soll man in Ruhe lassen; wie er dann glaubt,
so wird er's am Gerichte Gottes empfinden! So wollen wir den König
der Heiden darum fragen; Ihr wisset wohl, daß beißige Hunde nicht leicht
zu bändigen sind!" Alsbald schickte der König von Indien zu dem von
Babylon und hieß ihn zu sich kommen. Dieser gehorchte auf der Stelle.
Wie ihn nun die Mohren, die ihn verwahren mußten, brachten, da fragte
ihn der König von Indien: "Ihr König von Babylon, Ihr wisset, daß
Ihr mein Gefangener seidl Wollt Ihr Euch nun taufen lassen und den
Christenglauben annehmen, so möget Ihr Eurer Bande ledig werden. Tut
Ihr aber dies nicht, so müßt Ihr Euer Leben lang mein Gefangener bleiben.
Darnach habt Ihr Euch zu richten."
Darauf erwiderte der König von Babylonien: "Ich weiß wohl, daß ich
Euer Gefangener bin, aber Euren Glauben nehme ich nicht an. Wenn
ich mich sonst loskaufen kann, sei es mit Gold oder Silber, soviel Ihr
immer verlangen möget, das will ich gerne tun, dazu Euch verheißen, daß
Ihr nimmermehr von mir sollt bekriegt werden, solang ich lebe; was ich
Euch vom Lande genommen habe, will ich Euch auch zurückgeben." So
willige Worte des Heidenkönigs hörte der Mohr nicht ungern, er nahm
den Herzog Ernst beiseite und sprach zu ihm: "Was meinet Ihr von solchen
Verheißungen?" Herzog Ernst sagte: "Habt Ihr meine vorige Rede
nicht behaltens Mein Rat wäre, daß Ihr ihn losgebet und Euch einen
Eid schwören lasset, daß er seine Zusage halten wolle; dann will ich mich
mit ihm aufmachen und den nächsten Weg nach Jerusalem mit ihm ziehen;
denn er hat mir sicher Geleit durch sein ganzes Land zugesagt." Nun traten
sie miteinander wieder zum König von Babylon, und der König von
Indien zeigte diesem seine Meinung an. Da schwur er vor Gott und den
Menschen für sich und seine Nachkommen, alle seine Zusage halten und
das Königreich der Mohren nimmermehr mit Krieg anzufechten.
Das alles gefiel dem König von Indien gar wohl, doch war er sehr betrübt;
daß Herzog Ernst von ihm scheiden wollte; er redete ihm auf das
allerfreundlichste zu, daß er doch bei ihm bleiben möchte; er wollte ihm
sein halbes Königreich geben. Aber der Herzog schlug es ihm ab. Der
babylonische König, nachdem er dem Könige von Indien geschworen hatte,
nahm nun mit Herzog Ernst Urlaub von dem Mohrenfürsten. Dieser
segnete den Herzog und sprach: "Liebster Freund, ich bitte Euch aufs ernstlichste,
wann Ihr ja nicht bleiben wollet, daß Ihr doch wenigstens Eurer
Diener einen bei mir lasset." Aber auch diese Bitte schlug ihm Herzog
Ernst unter vielem Dank ab und ritt mit großen Freuden samt dem Sultan
von Babylon in sein Land.
Wie sie nun zwei bis drei Tagreisen landeinwärts gekommen waren,
wurden viele heidnische Herren die Wiederkunft ihres Königs gewahr, ritten
ihm mit viel Volks entgegen und empfingen ihn herrlich samt Herzog
Ernst und Graf Wetzel: auch verwunderten sie sich über die seltsamen
Geschöpfe Gottes, die Herzog Ernst mit sich aus den Ländern genommen.
Nun zogen sie weiter unter mancherlei Kurzweil, bis sie in die schöne Stadt
Babylon kamen. Daselbst blieb Herzog Ernst drei Wochen und besah die
Stadt mit aller Aufmerksamkeit; dann beauftragte er seinen Freund
Wetzel, alles zur Reise vorzubereiten; denn er wollte aufbrechen und seinen
Weg gen Jerusalem nehmen. Und nun ging er zum Sultan und verabschiedete

sich von ihm, was diesem gar leid tat; denn wiewohl er kein
Christ war, so gefiel ihm doch Herzog Ernsts Tapferkeit wohl, und er
sprach zu ihm: "Weil Euer Bleiben nicht länger bei mir sein soll, so danke
ich Euch aufs höflichste; denn wenn Ihr nicht gewesen wäret, so hätte ich
müssen ein gefangener Mann bleiben, solange mein Leben gewährt hätte.
Nun aber bin ich durch Eure Bitte losgeworden. Dagegen habe ich Euch
verheißen, Euch mit meinem Volke bis zur Stadt Jerusalem zu geleiten."
Hiermit ließ er ihm viel Gold und Silber bringen und schenkte ihm mancherlei
Kleinode. Diese Schenkung nahm Herzog Ernst mit großem Dank
an und bat den König um zweitausend Heiden mit ihren besten Wehren.
Als dies geschehen, nahm Herzog Ernst Urlaub von seinem Wirte und ritt
mit seinen Dienern auf Jerusalem zu. Aber der König befahl insonderheit
seinen Kriegsleuten, daß sie auf Herzog Ernst Achtung haben sollten.
Dies taten sie und ritten eine lange Zeit, bis sie nahe bei Jerusalem waren
; da sprachen die Heiden zu ihm: "Ihr wisset, liebster Herr, daß wir
jetzt von Euch scheiden müssen; denn nun seid Ihr in der Christenheit, da
dürfen wir nicht hinein; denn sonst schlügen sie uns alle tot. Darum begehren
wir jetzt einen freundlichen Abschied von Euch!"
Da Herzog Ernst sah, daß sie nicht länger mitziehen durften, dankte er
ihnen herzlich für die Ehre, die sie ihm erwiesen hatten. So schieden sie
voneinander, dann ritt Herzog Ernst der Stadt zu. Als er nun hart davor
war, schickte er seine wunderlichen Leute mit einem Diener vor ihm
her und behielt nur den Riesen mit seiner großen Stange bei sich. Wie
der Diener mit den seltsamen Geschöpfen durch die Stadt Jerusalem zog,
erschrak das Volk sehr, lief dem Diener zu und besah die wunderlichen
Leute. Nun wurde die Straße so voll von Pilgern, daß niemand zu dem
Hause kommen konnte, in das der Diener zur Herberge gezogen war. Indem
ritt Herzog Ernst mit seinem Freunde herrlich in die Stadt ein, nebst
dem Riesen und zwei Dienern. Als er nun in die Straße kam, sah er viel
Volks stehen, so daß er nicht wohl zur Herberge gelangen konnte. Da bat
er den Riesen, Platz zu machen mit seiner Keule, was dieser auch unverzüglich
tat, indem er durch das Volk mit vieler Mühe drang, bis sie in
die Herberge kamen. Herzog Ernst hieß das Volk unter die Fenster stehen,
damit er und seine Gesellen genug von jedermann gesehen würden. Als
nun die Pilger hörten, daß es Herzog Ernst sei, zeigten sie das ihrem Könige
an, der solcher Märe froh war und ihn mit großer Freude empfing.
Nachdem sich das Getümmel des Volks ein wenig verlaufen hatte, gingen
einige vornehme Pilger, die Herzog Ernst kannten, dem König
von Jerusalem und zeigten ihm an, wie dieser Herr mit seltsamen Menschen
gekommen wäre, und wie er eine so große Wallfahrt vollbracht habe,
auch seine Genossen fast alle auf dem ungestümen Meer umgekommen
seien, bis auf sein eigen Schiff, auf dem er allein mit wenigen Dienern
davongekommen. Der König hörte diese Kunde ausnehmend gern, ging
alsobald zu Herzog Ernst in die Stadt, empfing ihn voll Hochachtung und
führte ihn mit sich heim in seinen königlichen Palast. Hier fragte er den
Helden nach allem, was ihm widerfahren sei. Herzog Ernst erzählte ihm
seine ganze Geschichte, und der König verwunderte sich über die Maßen.
Nun kam die Zeit, daß sie mit großen Freuden das Mittagsmahl nahmen;
darauf gingen sie zum Heiligen Grab, darin unser Herr Christus
geruht hat. Daselbst fiel Herzog Ernst auf seine Knie, dankte Gott und
sprach: "Oh, du barmherziger Gott, du hast mich wunderbar erhalten und
mir deinen lieben Sohn mehr als einmal geschickt, der mich gestärkt und
erhalten hat bis auf diese Stunde. Darum sage ich dir Lob, Ehre und
Dank bis in Ewigkeit!" Nach diesem Gebete zog er mit dem Könige wieder
in seinen Palast und blieb eine lange Zeit zu Jerusalem.
***Wie nun Herzog Ernst ein halbes Jahr zu Jerusalem gewesen war;
kamen dahin zween Pilger, die kannten den Herzog wohl, und als sie die
Fahrt vollbracht hatten und wieder heimkamen, gingen sie zu dem Kaiser
Otto und zeigten ihm an, daß sein Sohn, Herzog Ernst, zu Jerusalem sei
und viele wunderliche Leute aus seltsamen Ländern mit sich gebracht habe.
Darüber wunderte sich der Kaiser sehr und gab den Pilgern große Geschenke
. Dann ging er zu seinem Gemahl, der Kaiserin, und sprach:
"Liebe Frau, ich will Euch eine Märe sagen! Euer Sohn, Herzog Ernst;
ist zu Jerusalem und ist ganz grau geworden." Vor solchen Worten erschrak
die Kaiserin vor Freuden und sprach zu dem Kaiser: "Fürwahr,
mein gnädiger Herr, die grauen Haare, die er hat, die kommen ihm nicht
von kleinem Unglück; denn er hat manchen großen Schaden in seinem
Leben leiden müssen!"
Herzog Ernst hatte nun ein ganzes Jahr zu Jerusalem verweilt, da
sprach er einsmals zu dem König: "Gnädiger Herr, ich begehre einen
freundlichen Abschied von Euch; denn es ist nunmehr Zeit, mein Vaterland
zu besuchen." Der König erschrak über dieser Rede; denn er meinte,
der gute Herzog sollte sein Leben zu Jerusalem endigen. Doch weil das
nicht sein konnte, ließ er ihm zwei große Schiffe mit aller Beigehör zubereiten.
Darauf verabschiedete sich Herzog Ernst von dem König zu
Jerusalem, und fuhr mit seinem Volk nach Frankreich; auch viele andere
fuhren mit ihm. Sie kamen mit gutem Wind an die Küste und von da
glücklich in Paris an. Nachdem sie zwei Tage in der Stadt gewesen,
wurde einer seiner wunderlichen Männer, den er aus dem Arimasperlande
mitgebracht hatte, krank. Es war einer der Sciapoden, der einen so großen
Fuß hatte, daß er sich vor den Sonnenstrahlen damit bedecken konnte.
Dieser starb zu Paris. Herzog Ernst war darüber sehr bekümmert und
sprach zu Graf Wetzel: "Mich dünkt's, lieber Freund, wir wollen wieder
auf die See und nach Rom schiffen und diese Stadt auch besuchen. Dann
wollen wir zusehen, wie wir nach Deutschland kommen!"
So fuhren sie nach Rom in kurzer Zeit und wurden hier mit ihrem Gefolge
schön empfangen. Alle Leute verwunderten sich über die seltsamen
Menschen, die der Herzog mit sich führte und die er alle Tage auf den
Straßen herumführen ließ, damit sie jedermann genau besehen konnte.
Dann ging er zum Papst und bat ihn, da er mit etlichen hohen Herren
seinen Vater, den Kaiser Otto, besuchen möchte, er für ihn bitten möge ob
der Kaiser ihn doch wieder zu Gnaden annehmen wollte. Aber der Papst
schlug ihm diese Bitte ab, weil er eben nicht in Einigkeit mit dem König lebte.
Nun war Herzog Ernst wohl acht Tage zu Rom gewesen, und nachdem
er alle Merkwürdigkeiten der Stadt genau besehen hatte, ging er mit
dem Grafen Wetzel zu Rat und sprach zu ihm: "Oh, mein allerliebster
Freund, wir wollen uns aufmachen und nach unserem Vaterlande ziehen;
denn du weißt ja, daß wir mancherlei Gefahren hin und wieder ausgestanden
haben und in großen Ängsten um Leib und Leben gewesen sind.
Dennoch sind wir durch Gottes Hilfe daraus gekommen. Jetzt aber will
es mich bedünken, daß ich allererst in das größte Elend kommen werde;
denn mein Vater wird von seinem grimmigen Zorne wider mich noch nicht
gelassen haben, obwohl ich unschuldig daran bin. Darum bitte ich dich,
lieber Freund, um einen getreuen Rat; wie ich mich hierin verhalten soll."
Da sprach Graf Wetzel: "Lieber Herr und Freund, ich sehe wohl, daß es
uns jetzt übler gehen dürfte, als es uns bisher auf unsrer gangen Fahrt
gegangen ist. Doch bitte ich Euch, Ihr wollet mir diesmal folgen. Ihr
habt doch von unserm Wirte gehört, daß der Kaiser Otto einen Reichstag
zu Nürnberg mit seinen Fürsten und Herren halten will. Darum lasset
uns aufsitzen, daß wir bald dahinkommen; dann wollen wir unsere Leute
heimlich auf einem Wagen hinaufführen lassen, damit der Kaiser unsere
Ankunft nicht gewahr wird. Wer weiß, was für ein Mittel uns Gott inzwischen
schickt! Ihr sehet ja, daß wir vom Papst keine Hilfe haben!"
Dies gefiel Herzog Ernst, und er sprach zu ihm: "Noch den heutigen
Tag wollen wir uns hinwegmachen!" Und das taten sie auch. Nach dem
Mittagessen ließ Herzog Ernst zwei große gedeckte Wagen zurichten und
kaufte für jeden derselben vier Pferde; nahm noch zwei Knechte an, verbot
ihnen aber, jemand zu sagen, was auf den Wagen sei: und nun ritt
Herzog Ernst mit seinem Freunde Wetzel aus der Stadt Rom, und sie
ließen die Diener hinter sich nachreiten, die soviel Unglück mit ihnen erlitten
hatten; die zwei Wagen fuhren hintennach. Wo sie in eine Herberge
kamen, gebot Herzog Ernst dem Wirt, daß er niemand etwas von den
wunderlichen Leuten sagen sollte, die er mit sich führte. Aber der Riese
lief stets neben ihm her; wo er in eine Stadt kam. wer dessen Größe
staunten die Leute sehr. Und so ritt Herzog Ernst mit den Seinigen in
die Stadt Nürnberg, wo sie kein Mensch kannte; auch hielten sie sich mit
ihrem Gefolge ganz heimlich in der Stadt auf.
Später kam auch der Kaiser mit seiner Gemahlin und allen seinen
Herren in die Stadt. Nun war es an einem Christtage zu Morgen, daß
jedermann in die Kirche ging. Die Kaiserin war auch hineingefahren mit
etlichen Jungfrauen; das wurde Herzog Ernst gewahr, er sprach deswegen
zu seinem Gesellen, Grafen Wetzel: "Was rätst du mir? Jetzt ist meine
Mutter die Kaiserin, in der Kirche; ich dürfte wohl hineingehen und mich
ihr zu erkennen geben; dann will ich mich gegen sie anstellen wie ein Bettler,
der ein Almosen begehrt." Das billigte Wetzel, und nun begaben sie
sich miteinander zu der Kirche. Da ging Herzog Ernst von Stund an
durch das Volk zu der Kaiserin, seiner Mutter, und als er vor sie kam,
grüßte er sie freundlich und sprach: "Gebet mir doch ein Almosen um
Christi willen, von wegen Eures Sohnes Ernst!" Da sprach die Kaiserin:
"Ach, lieber Freund, meinen Sohn hab ' ich lange Zeit nicht gesehen. Wollte
Gott; daß er noch am Leben wäre, ich würde Euch ein gutes Botenbrot
geben!" Schnell sprach Herzog Ernst: "Gnädige Frau, gebt mir das
Botenbrot; dann will ich mich wieder von hinnen machen; denn ich bin
einmal in Ungnade bei meinem Vater und kann nicht wieder zu Gnaden
kommen!" Die Kaiserin sagte: "So seid Ihr selbst mein Sohn Ernst!"
Da entgegnete Herzog Ernst: "Mutter, ich bin Euer Sohn; darum helfet
mir, daß ich wieder zu Gnaden kommen möget" Wie nun die Kaiserin
inneward, daß ihr Sohn wieder in das Land gekommen war, so sprach sie
zu ihm: "Oh, du mein geliebter Sohn, da wir nicht Zeit haben, jetzt miteinander
zu reden, so will ich dir einen Weg anzeigen, wie du bei deinem
Vater Gnade erwerben kannst. Ich rate dir, daß du morgen kommest,
wann der Bischof von Bamberg das Evangelium gesungen hat, und mit
deinem Freunde, Grafen Wetzel, dem Kaiser zu Fuße fallest und ihn bittest
, dir um Christi willen zu verzeihen; dann will ich heute den Bischof
und andere Herren ersuchen, daß sie sich bei deinem Vater für dich mit
einem Fußfall verwenden. So hoffe ich, daß sich des Kaisers Herz erweichen
werde."
Herzog Ernst nahm mit großem Trost im Herzen Abschied von seiner
Mutter, ging wieder zu seinem Genossen Wetzel und erzählte ihm alles.
Der ward von Herzen erfreut, und nun gingen sie zusammen in die Herberge
und harrten auf den andern Tag. Als aber die Kaiserin aus der
Kirche heimgekommen war, schickte sie sogleich nach dem Bischof von Bamberg
. Dieser kam, und sie führte ihn in ihr Kämmerlein und bat ihn mit
weinenden Augen, daß er ihr doch eine Bitte gewähren wollte. Das verhieß
er ihr gerne, und sie sprach zu ihm: "Wisset; lieber Herr daß mein
Sohn Ernst bei mir in der Kirche gewesen ist und hat sich gegen mich
wegen des Kaisers Ungnade beklagt, wie Ihr ja selber wisset, daß er unschuldig
ist. Darum bitte ich Euch, wenn Ihr morgen das Evangelium
gesungen habt; so wollet hernach ein klein wenig stillhalten; dann wird
mein Sohn kommen und einen Fußfall vor dem Kaiser tun und ihn um
Gnade bitten: nun seid treulich gebeten, solches etlichen Fürsten und
Herren anzuzeigen, damit auch sie ihm Gnade erwerben helfen." Diese
klägliche Rede der Kaiserin erbarmte den Bischof sehr; er versprach ihr,
alles zu tun, und beurlaubte sich. Dann ging er zu vielen Fürsten und
Herren und meldete ihnen der Kaiserin Begehren; die verhießen ihm willig,
das Ihrige zu tun.
Herzog Ernst hatte mit großem Verlangen auf den andern Tag gewartet
; endlich war der Kaiser mit seinen Herren in die Kirche gegangen. Da
machten sich Ernst und Wetzel auf, zogen miteinander in die Kirche und
ließen ihre Diener von feme nachgehen. Als sie eingetreten, stand Herzog
Ernst bei der Türe still; Graf Wetzel trat hinter den Altar und wartete
der Zeit; denn wenn der Kaiser seinen Sohn nicht begnadigt haben würde
und ihn wieder zum Gefängnis verurteilt, so hätte er ihn erstochen.
Da saß der Kaiser auf seinem Stuhl ganz herrlich und die Kaiserin
neben ihm. Der Bischof von Bamberg fing an, das Evangelium mit lauter
Stimme zu singen. Wie das Amt aus war, verzog er mit der Predigt,
wie es alles von der Kaiserin verabredet war. Nun ging Herzog Ernst
mit großem Mut vor den Kaiser, seinen Vater, hatte seinen Mantel um
sein Angesicht geschlagen, fiel vor ihm nieder auf seine Knie, neigte sein
Haupt dreimal gegen ihn und sprach: "Allergnädigster Herr und Kaiser,
bitte Eure Majestät, daß Ihr einem Sünder verzeihen wollet; der vor
langer Zeit sich wider Euch vergangen hat, aber Gott weiß doch wohl,
daß er in der Hauptsache unschuldig ist!"
Der Kaiser hörte die Bitte an und sprach zu ihm: "Je nachdem die
Üeltat ist, wegen der du dich entschuldigst, so kann ich dir verzeihen!"
Da stund die Kaiserin von ihrem Stuhle auf und sprach: "Gnädiger
Herr, vergebet diesem Menschen, weil er Euch an einem hohen Feste so
inständig bittet!" Desgleichen kam der Bischof von Bamberg mit vielen
Fürsten und Herren; der bat auch und sprach: "Liebster Herr und Kaiser!

Ihr sollt diesem annen Menschen vergeben; denn Ihr wisset wohl, es ist
vor Gott kein Sünder so groß: wenn er rechte Reue über seine Sünden
hat; so werden sie ihm verziehen!" Da sprach der Kaiser: "Sie sollen ihm
verziehen sein; doch will ich wissen, wer er ist!"
Nun warf Herzog Ernst den Mantel von seinem Angesicht zurück, und
der Kaiser erkannte ihn erst und entfärbte sich in seinem Angesicht vor
Zorn. Herzog Ernst sah das, erschrak sehr und winkte seinem Gesellen
Wetzel am Altar, daß er Achtung haben sollte, wenn er ihn gefangenführen
lassen wollte. Aber der Kaiser, der sah, daß alle Herren so eifrige
Bitte für seinen Sohn einlegten, sprach: "Lieber Sohn, wo ist denn dein
Freund, Graf Wetzel, hingekommen?" Da sprach Herzog Ernst: "Dort
bei dem Altar steht erl" Damit rief er ihn, und Wetzel kam mit großen
Freuden gegangen, und der Kaiser gab ihnen den Kuß des Friedens. Darüber
war die Kaiserin sehr erfreut. So blieben sie in der Kirche, bis das
Evangelium von dem Bischof von Bamberg ausgelegt war. Dann gingen
sie mit großen Freuden heim, und jedermänniglich verwunderte sich.
Hierauf wurde das Mittagsmahl unter vieler Ergötzung und allerhand
erfreulichen Gesprächen eingenommen. Herzog Ernst fing unter anderm
an und sprach: "Lieber Vater, ich bitte in Untertänigkeit, daß Ihr mir
doch sagen wollet; warum Ihr mich also aus meinem Lande vertrieben
habt; und ich habe Euch doch in keiner Sache etwas zum Verdruß getan!"
Da sprach der Kaiser: "Lieber Sohn, ich will dir nicht verhehlen, warum
ich dieses getan habe. Der Pfalzgraf Heinrich kam einmal zu mir in meinen
Saal und sprach zu mir: ,Wisset, gnädiger Herr, es ist meine Schuldigkeit;
Euch vor Schaden zu warnen; denn Euer Sohn Ernst hat sich bet
mehreren Herren vernehmen lassen, wenn er allein zu seinem Vater käme,
wolle er ihn erstechen, damit er das Reich allein bekäme. ' Der Pfalzgraf
beteuerte, er selbst habe dieses aus deinem Munde gehört; er überredete
mich dermaßen, daß kein Mensch den Zorn, den ich über dich hatte mir
hätte ausreden können; darum schickte ich Kriegsleute gegen dich und wollte
dich vertreiben lassen: die schlugest du alle tot; dann, wie ich auf dem
Reichstage zu Speyer war, kamst du in meine Kammer und stachest den
Pfalzgrafen an meiner Seite tot, und wenn ich nicht in meine Kapelle
entflohen wäre, ich glaube, du hättest mich auch erstochen! Da ward ich
noch mehr von Zorn gegen dich bewegt und vertrieb dich ganz aus dem
Lande." Darauf sprach Herzog Ernst: "So wahr Gott lebt, gnädiger
Herr Vater, ich habe nie mit einem Wort wider Euch geredet; sondern als
ich erfuhr, daß Euch der Pfalzgraf so schändlich belogen hatte, da had ' ich
ihn getötet." Der Kaiser verwunderte sich nicht wenig über des Pfalzgrafen
Verräterei. Dann schickte Herzog Ernst, als die Mahlzeit vorüber
war, einen seiner Diener in die Herberge und sprach zu ihm: "Bring das
wunderliche Volk hieher, das ich mitgebracht habe!" Das tat der Diener.
Wie er sie aber über die Straße brachte, lief alles Volk ihnen nach, und
der Riese hatte sich genug zu wehren. Als sie in dem Saal waren, schob
man die Riegel vor, sonst wäre das Volk nachgedrungen; so neugierig war
es, sie zu schauen.
Dann sagte Herzog Ernst: "Lieber Vater; diese Leute hier habe ich dem
Könige der Arimasper ganz untertan gemacht; der Mensch mit dem einen
Auge aber ist in jenem Königreiche zu Hause. Nun möget Ihr wohl
schließen, wie mancherlei Gefahr ich ausgestanden habe. Einer von den
Leuten, der nur einen einzigen gar breiten Fuß hatte, ist mir in Paris gestorben.
Einen Agrippiner konnte ich nicht mitbringen, deren König habe
ich erstochen; diese Leute haben Kopf und Hals wie Kraniche und besitzen
ein großes Königreich. Von diesen schifften wir weiter und kamen an den
Magnetberg, da ging unser Schiff zu Stücken, und sieben von uns retteten
sich auf ein anderes Schiff. Dort nähten wir uns in Ochsenhäute,
und der Greif trug uns ans Land in sein Nest. Gott half uns in einem
Walde zueinander, da befuhren wir auf einem Floß im tiefen Grund ein
Wasser und fuhren durch einen großen Berg und kamen an leuchtendem
Gesteine vorüber; von dem hab ' ich dies Stück abgeschlagen." Damit zog
Herzog Ernst den Karfunkel heraus und gab ihn seinem Vater. Dann
erzählte er noch weiter alle seine Abenteuer.
Der Kaiser konnte des Staunens gar nicht müde werden. Endlich sprach
er zu Herzog Ernst: "Mein lieber Sohn, weil du so vielfältig versucht
worden bist, so verheiße ich dir hier vor allen diesen Herren, daß du all
dein Land wiederhaben sollst; und noch mehr Städte will ich dir dazu
schenken!" Das tat der Kaiser auch. Alles schied fröhlich voneinander.
Die Kaiserin lobte Gott in ihrem Herzen; Herzog Ernst mit seinem treuen
Freunde, dem Grafen Wetzel, ritt in sein Land, und ließ das Volk, das
ihn mit Freuden empfing, sich huldigen. So saß und regierte er dort in
guter Nuh. Der Kaiser aber zog gen Speyer auf den Reichstag, blieb
lange Zeit daselbst und hielt einen köstlichen Hof, weil sein Sohn in das
Land gekommen war. Die Kaiserin aber, Herzog Ernsts Mutter, bestellte
Bauleute zu Salza und ließ Gott zu Danke ein herrlich Münster aufrichten,
in welchem sie auch nach ihrem Tode begraben worden ist.
Doktor Faustus
Mit Bildern von Joseph Manes
I.
Johannes Faustus, der weitberühmte Schwarzkünstler, ward geboren in
der Grafschaft Anhalt; und haben seine Eltern gewohnt in dem Markt
oder Flecken Sondwedel: die waren arme fromme Bauersleute. Er hatte
aber einen reichen Vetter zu Wittenberg, welcher seines Vaters Bruder
war; derselbe hatte keine Leibeserben, darum er denn diesen jungen Faustus
, welchen er wegen seines fähigen Geistes herzlich liebgewonnen hatte,
an Kindes Statt auferzog und zur Schule fleißig anhielt; worauf dieser
mit zunehmendem Alter von ihm auf die Hohe Schule zu Ingolstadt geschickt
worden. Hier tat sich der junge Faustus in Künsten und Wissenschaften
trefflich hervor, so daß er in der Prüfung eilf andern Meistern
der freien Künste vorangesetzt und selbst mit dem Magisterkäppchen geschmückt
wurde.
Damals aber, da das alte päpstliche Wesen noch überall im Schwange
ging, und man hin und wieder viel Segensprechen; Geisterbeschwören,
Teufelsbannen und ander abergläubisches Tun trieb, beliebte auch solches
dem Faustus überaus. Weil er denn zu böser und gleichgesinnter Gesellschaft
, ja unter solche Bursche geriet, welche mit dergleichen abergläubischen
Zeichenschriften umgingen, die Studien aber auf die Seite setzten,
ward er gar bald und leicht verführt. Zu diesem kam noch, daß er sich zu
den damals umschweifenden Zigeunern fleißig hielt und von ihnen die
Chiromantie, wie man nämlich aus den Händen wahrsagen möge, erlernte:
dazu in allerlei Zauberkünste, wo er nur Gelegenheit fand, sich
einweihen ließ.
Als er nun in diese Dinge ganz versunken war und sich also den Teufel
gar einnehmen ließ, fiel er von der Theologie ab, legte sich mit Fleiß auf
die Arzneikunst, erforschte den Himmelslauf, lernte den Leuten, was sie
von ihrer Geburtszeit an für Glück und Unglück erleben sollen, verkündigen
und wußte mit Kalenders und Almanach -Rechnung wohl umzugehen.
Endlich kam er gar auf die Beschwörungen der Geister, welchen er dergestalt
nachgrübelte und darin dermaßen zunahm, daß er zuletzt ein ausgemachter
Teufelsbeschwörer wurde. Bei seinen Eltern und seinem Vetter
wußte er sich indessen recht schlau zu rechtfertigen, brachte auch von
der Universität zu Ingolstadt ein gutes Zeugnis mit, und so war ihm denn
der wohlhabende und gutmütige Vetter selbst behilflich, daß er nach dreien
Jahren Doktor in der Medizin werden konnte.
***Seit nun Doktor Faustus solchem teufelischen Wesen sich so gar ergeben,
vergaß er dabei Gottes und seines Worts: und weil er durch den
Tod seines Vetters zu Wittenberg zu einem schönen Erbe gelangte, so
fand er daselbst bald Gesellschaft seinesgleichen, war nicht mehr viel nüchtern,
wurde vielmehr zu allem unlustig und verdrießig. Und obwohl, weil
die Barschaft des Vetters bei täglichem Fressen, Saufen und Spielen in
Abnahme geriet, er sich in etwas der Gesellschaft entschlug, so ward er
doch darum bei solchem Müßiggang nicht viel besser, sondern trachtete nur
stets, wie er andere Gesellschaft, nämlich der Teufel und bösen Geister
Kundschaft und durch solcher Hilfe zeitliche Freude und tägliches Wohlleben
möchte überkommen; weswegen er hin und wieder bei leichtfertigen
Leuten allerhand teuflische Bücher, abergläubische Charaktere, gottesvergessene
Beschwörungen zusammenraffte, zum öftern abschrieb und sich vorsätzlich
darin übte. Unter solchem Studium fand er denn nicht nur, daß
er selbst mit einem hochfliegenden und herrlichen Geiste begabt sei, sondern
auch, daß die Geister eine besondere Zuneigung zu ihm hatten. In
dieser Meinung wurde er noch mehr bekräftigt, als er etlichemal nacheinander
in seiner Stube einen seltsamen Schatten an der Wand vorüberfahren,
auch darauf oftmals, wenn er aus seiner Schlafkammer bei Nacht
blickte, viel Lichter hin und wider bis an seine Bettstatt gleichsam fliegen
sah und zugleich dabei Laute vernahm, als ob Menschen miteinander leise
redeten; dessen er sich denn höchlich erfreuete und in den Stimmen Geister
und Gespenster erkannte, jedoch noch nicht soviel Mut hatte, dieselben
anzusprechen.
***Als nun Doktor Faustus in seiner teuflischen Kunst erlernt und studieret,
soviel ihm dienlich sein würde, dasjenige zu überkommen, was er lang zuvor
begehret hatte: siehe, da geht er einst an einem heitern Tage aus der
Stadt Wittenberg, um einen bequemen und gelegenen Ort zu finden, wo
er füglich seine Teufelsbeschwörungen ins Werk setzen möchte, und findet
auch endlich, ungefähr einer halben Meile Wegs von der Stadt gelegen,
einen Wegscheid, welcher fünf Ausfahrten hatte, dabei auch groß und breit
und also ein erwünschter Ort war. Hier verblieb er den ganzen Nachmittag,
und nachdem der Abend herbeigekommen und er gesehen, dast keine
Fuhre mehr oder jemand anders durchging, nahm er einen Reif, wie die
Küfer oder Büttner haben, machte daran viel wunderseltsame Charaktere
und setzte daneben noch zween andere Zirkel oder Kreise. Und da er solches
alles nach Ausweisung der Nekromantie bestermaßen angestellt hatte, ging
er in den Wald, der allernächst dabei gelegen war, der Spessartwald genannt
, und erwartete mit Verlangen die Mitternachtszeit, wo der Mond
sein volles Licht haben würde: kaum aber ist die Zeit herbeigekommen, so
beschwört er gleich zum Anfang, in den mittlern Reif tretend, unter Verlästerung
des göttlichen Namens, den Teufel zum ersten und andern und
dritten Mal.
Kaum waren die Worte recht ausgeredet, da sah er alsobald, während
der Mond schon hell schien, eine feurige Kugel anherkommen, die ging
dem Kreise zu mit solchem Knallen, gleich als ob eine Muskete wäre losgebrannt
worden, fuhr aber gleich darauf mit einem feurigen Strahl in
die Luft, ob welchem allen denn der Doktor Faustus sehr erschrak, so daß
er auch aus dem Kreise laufen wollte. Weil er jedoch, dem Reif entwichen,
nicht mehr lebendig heimzukommen hoffte, so faßte er sich wieder
einen Mut und beschwur den Teufel von neuem auf obige Weise; aber da
wollte sich nichts mehr regen noch ein Teufel sehen lassen. Er nahm derhalb
eine härtere Beschwörung zur Hand. Alsbald entstand im Wald ein

solcher ungestümer Wind und solches Brausen, daß es das Ansehen hatte,
als ob alles zugrunde gehen wollte: kurz darauf rannten etliche Wagen,
mit Rossen bespannt, bei dem Reif in einem Nasen vorbei und machten
einen solchen Staub, daß Faustus, bei dem hellen Mondenscheine, nichts
sehen konnte. Da endlich, obwohl Doktor Faust, wie leicht zu glauben, so
erschrocken und verzagt war, daß er schier auf seinen Füßen nicht mehr
stehen konnte und wohl mehr als hundertmal wünschte, daß er hundert
Meilen Wegs von da wäre, sah er wider alles Verhoffen, gleich als unter
einem Schatten, ein Gespenst oder einen Geist um den Kreis herumwandern.
Mutig beschwor er den Geist, er sollte sich erklären, ob er ihm
dienen wollte oder nicht; er sollte nur frei reden. Der Geist gab bald zur
Antwort, er wolle ihm dienen, jedoch mit diesem Bedinge, daß, so er anders
etlichen Artikeln nachkommen wolle, welche er ihm vorhalten werde,
er die Zeit seines Lebens nicht von ihm scheiden werde. Doktor Faustus
vergaß auf dieses all seines vorigen Leides und empfundenen Schreckens
und war in seinem Gemüte recht fröhlich und zufrieden, daß er endlich
nach so vielen Sorgen dasjenige überkommen sollte, wornach sein Herz so
lange Zeit verlanget hatte; daher sprach er getrost zu dem Geist: "Wohlan,
dieweil du mir dienen willst, so beschwöre ich dich nochmals zum
ersten, andern und dritten Mal, daß du morgen in meiner Behausung erscheinen
sollest; allwo wir denn von allem dem, was ich und du zu tun
haben, zur Genüge reden und handeln wollen." Dieses sagte der Geist
dem Doktor Faustus zu: alsobald zertrat dieser den Zirkel mit Füßen, ging
mit Freuden heraus, eilte der Stadtpforte zu und erwartete mit sehnlichem
Verlangen den bald ankommenden Tag.
***Nun saß er unter tausenderlei verwirrten Gedanken in seinem Stüblein.
Eine, zwei und mehr Stunden laufen vorbei, der Geist will doch nicht
erscheinen; hinter, vor und neben sich forschet ohne Unterlaß Doktor Faustus
, ob er noch nichts erblicken möge; aber alles vergebens, so daß er sich
schon des Geistes und seiner Erscheinung vezeihen wollte: endlich, da
ersiehet er zur Mittagszeit etwas nahe bei dem Ofen gleich als einen Schatten
hergehen, und dünkte ihm doch, es wäre ein Mensch; bald aber sieht
er denselben auf eine andere Weise; daher er denn zur Stunde seine Beschwörung
aufs neue anfing und den Geist beschwor, er sollte sich recht
sehen lassen. Da ist alsobald der Geist hinter den Ofen gewandert und hat
den Kopf als ein Mensch hervorgesteckt, sich sichtbarlich sehen lassen und
vor dem Doktor Faustus sich wieder und wieder gebücket und seine Reverenz
gemacht. Nach einigem Bedenken begehrte Faust, der Geist sollte
hervorgehen und ihm, seinem Versprechen nach, die Punkte vorhalten,
unter deren Beding er ihm dienen wolle. Der Geist schlug ihm solches
anfangs ab und meinte, er sei so gar weit nicht von ihm, er könne dennoch
mit ihm von allerhand nötigen Dingen Unterredung pflegen. Da ereiferte
sich Faustus und wollte aufs neue seine Verschwörung anfangen
und ihm noch härter zusetzen; das aber war dem Geist nicht gelegen, und
so ging er hinter dem Ofen hervor. Da sah nun Faust mehr, als ihm
lieb war; denn die Stube ward in einem Augenblick voller Feuerflammen,
die sich hin und wieder ausbreiteten; der Geist hatte zwar einen natürlichen
Menschenkopf, aber sein ganzer Leib war gar zotticht, gleich als
eines Bären, und mit feurigen Augen blickte er Faustum an, worüber dieser
sehr erschrak und ihm befahl, er sollte sich wieder hinter den Ofen
ducken, wie er auch tat. Darauf fragte ihn Doktor Faustus, ob er sich nicht
anders denn in einer so abscheulichen und greulichen Gestalt zeigen
könnte. Der Geist antwortete: "Nein"; denn, sagte er, er wäre kein
Diener, sondern ein Fürst unter den Geistern; wenn er ihm dasjenige leisten
und halten wolle, was er ihm vorhalten werde, so wolle er ihm einen
Geist zuschicken, der ihm bis an sein Ende dienen werde und nicht von ihm
weichen, ja in allem und jedem willfahren, was nur seinem Herzen würde
belieben zu wünschen und zu begehren.
Auf solchen Vorschlag des Satans antwortete Faust; er solle ihm nur
sein Verlangen eröffnen und vorhalten. Der Teufel spricht: "So schreibe
sie denn von Wort zu Worten auf und gib alsdann richtigen Bescheid, es
wird dich nicht gereuen! Ich will dir hiermit fünf Artikel vorschreiben:
nimmst du sie an, wohl und gut; wo aber nicht, sollst du mich hinfüro
nicht mehr zwingen zu erscheinen, wenn du auch gleich alle deine Kunst
zu Rate ziehen würdest." Also nahm Doktor Faustus seine Feder zur
Hand und verzeichnete, wie folgt:
1. Er soll Gott und allem himmlischen Heer absagen.
2. Er soll aller Menschen Feind sein, und sonderlich derjenigen, so ihn
seines bösen Lebens wegen würden strafen wollen.
3. Den Pfaffen und geistlichen Personen soll er nicht gehorchen, sondern
sie anfeinden.
4. Zu keiner Kirche gehen, die Predigten nicht besuchen, auch die Sakramente
nicht gebrauchen.
5. Den Ehestand hassen, sich in denselben nicht einlassen, nie verehelichen.
Wenn er diese fünf Artikel wolle annehmen, so solle er sie zur Bestätigung
mit seinem eigenen Blute bekräftigen und ihm einen Schuldbrief,
von seiner eigenen Hand geschrieben, übergeben; alsdann wolle er ihn
zu einem Mann machen, der nicht allein alle erdenkliche Lust und Freude
haben und die Zeit seines Lebens über genießen solle, sondern es sollte
auch seinesgleichen in der Kunst nicht sein.
Doktor Faustus saß hierüber in sehr tiefen Gedanken, und je mehr und
öfter er diese greuliche und gottsvergessene Artikel übersah und überlas,
je schwerer sie ihm zu halten fallen wollten: doch bedachte er sich endlich
und meinte, weil doch der Teufel ein Lügner sei, und ihm schwerlich alles
dasjenige, wonach etwa sein Herz verlangen würde, seiner Zusage nach
schaffen und zuwege bringen würde, so wolle er auch alsdann noch wohl
andern Sinnes werden. Und wenn es ja mit der Zeit dahinkäme, daß er
ihn, als sein wahres Unterpfand, haben und hinnehmen wollte, so könnte
er wohl beizeiten ausreißen und sich wiederum mit der christlichen Kirche
versöhnen; würde ihm denn über alles Verhoffen Zeit und Raum zu
kurz, sich zu bekehren, so habe er gleichwohl nach seines Herzens Lust und
Begierde in dieser Welt gelebt: halte der Geist etwa in einem und anderm
keinen Glauben, trotz seiner Zusage, so sei er ihm auch hinwiederum
nicht Glauben zu halten schuldig.
So sagte er endlich in Leichtsinn und Gottesvergessenheit zu einem Artikel
um den andern laut und unumwunden ja. Der Geist aber, auf des
Doktors deutliche Erklärung, wendete nichts weiter ein und sprach: "So
komm denn, soviel dir immer möglich ist, diesen Forderungen nach; aber
deine eigene Handschrift, mit deinem Blut gezeichnet, wirst du mir geben;
stelle es also an und lege sie auf den Tisch, so will ich sie holen." Doktor
Faustus antwortete: "Wohlan, es ist so gut: aber eines bitte ich dich zum
letzten, daß du mir nicht mehr so greulich und in deiner jetzigen Gestalt erscheinen
wollest; sondern etwa in eines Mönchs oder eines andern bekleideten
Menschen Gestalt", welches denn der Geist dem Faustus zusagte und
also verschwand.
***Nachdem nun der höllische Geist gewichen, vielleicht die Zeit zu gewinnen,
um die versprochene Handschrift zu fertigen, hätte Faust wohl
noch Zeit gehabt, seinen Abfall von Gott mit reuigem, bußfertigem Herzen
gutzumachen: allein er trachtete nur dahin, wie er seine Wollust und
sein Mütlein in dieser Welt recht abkühlen möchte, und war eben auch der
Meinung, welcher jener vornehme Herr gewesen, der unter andern auf
dem Reichstage zu etlichen gesagt hat: "Himmel hin, Himmel her, ich
nehme hier das Meinige, mit dem ich mich auch erlustige, und lasse Himmel
Himmel sein; wer weiß, ob die Auferstehung der Toten wahr sei?"
So nahm denn Faustus ein spitziges Schreibmesser und öffnete sich an
der linken Hand ein Äderlein; das ausfließende Blut faßte er in ein Glas,
setzte sich nieder und schrieb mit seinem Blut und eigener Hand nachfolgenden
Schuldbrief:
"Ich, Johannes Faustus, Doktor, bekenne hier öffentlich am Tag, nachdem
ich jederzeit zu Gemüt gefasset, wie diese Welt mit allerlei Weisheit;
Geschicklichkeit, Hoheit begabet und allezeit mit hochverständigen Leuten
geblühet hat; dieweil ich denn von Gott dem Schöpfer nicht also erleuchtet
und doch der Magie fähig bin, auch dazu meine Natur himmlischen
Einflüssen geneigt, zudem auch gewiß und am Tage ist, daß der
irdische Gott; den die Welt den Teufel pflegt zu nennen, so erfahren, gewaltig
und geschickt ist, daß ihm nichts unmöglich ist; so wende ich mich
nun zu ihm, und nach seinem Versprechen soll er mir alles leisten und erfüllen,
was mein Herz, Gemüt und Sinn begehret und haben will, und
soll an nichts ein Mangel sichtbar werden; und so denn dem also sein
wird, so verschreibe ich mich hiermit mit meinem eigenen Blut, welches ich,
obwohl ich bekennen muß, daß ich's von dem Gott des Himmels empfangen

habe, samt Leib und Gliedmaßen, so mir durch meine Eltern gegeben
sind, mit allem, was an mir ist, samt meiner Seele hiemit diesem
irdischen Gott zu Kaufe gebe und verspreche mich ihm mit Leib und Seele.
Dagegen sage ich vermöge der mir vorgehaltenen Artikel ab allem
himmlischen Heer und allem, was Gottes Freund sein mag. Zur Bekräftigung
meiner Verheißung will ich diesem allen treulich nachkommen,
und dieweil unser aufgerichtetes Bündnis vierundzwanzig Jahr
währen soll, so soll denn der Satan, wenn diese Jahre verflossen sind,
dieses sein Unterpfand, Leib und Seele, angreifen und darüber zu schalten
und walten Macht haben: soll auch kein Wort Gottes, auch nicht, die
solches predigen und vortragen, hierin einige Verhinderung tun, ob sie
mich schon bekehren wollten.
| Zu Urkund dieser Handschrift habe ich solche mit meinem
eigenen Blute bekräftiget und eigenhändig geschrieben. |
***Als er nun solche gräßliche Verschreibung verfertigt hatte, erschien bald
darauf der Teufel in eines grauen Mönchs Gestalt und trat zu ihm, da
denn Doktor Faustus ihm seine Handschrift eingehändigt; darauf dieser
gesagt: "Fauste, dieweil du denn mir dich also verschrieben hast, so sollst
du wissen, daß dir auch soll treulich gedienet werden. Ich jedoch, als der
Fürst dieser Welt; diene persönlich keinem Menschen; alles, was unter
dem Himmel ist; das ist mein, darum diene ich niemand: aber morgenden
Tags will ich dir einen gelehrten und erfahrnen Geist senden, der soll dir
die Zeit deines Lebens dienen und gehorsam sein; sollst dich auch vor ihm
nicht fürchten noch entsetzen, er soll dir in der Gestalt eines grauen
Mönchs, wie ich anjetzo, erscheinen und dienen. Hiermit nehme ich diese
deine Handschrift und gehabe dich wohl!" Also verschwand er.
***Gleich abends, als Doktor Faustus nun zu Nacht gegessen hatte und
kaum in seine Studierstube gekommen war, siehe, da klopft jemand sittiglich
an der Stubentüre, dessen Faustus sonst nicht gewohnt war, zumal die
Haustüren allbereits verschlossen waren. Er merkte aber bald, was es bedeute,
und öffnete die Türe: da stand ihm gegenüber eine lange in grauen
Mönchshabit gekleidete Person, dem Ansehen nach eines ziemlichen Alters:
denn der Fremde hatte ein ganz graues Bärtlein; den hieß er alsbald
in die Stube gehen und sich zu ihm auf die Bank niedersetzen, welches ,
der Geist auch getan. Auf das Befragen des Doktors, was denn des
Geistes Geschäft sei, antwortete dieser: "O Fauste, wie hast du mir meine
Herrlichkeit genommen, daß ich nun eines Menschen Diener sein mußt
Dieweil ich aber von unserm Obersten dazu gezwungen worden, muß ich
es wohl lassen geschehen. Wenn aber das Ziel wird erreichet sein, so wird
es mir eine kurze Zeit gewesen dünken, dir aber wird es ein Anfang sein
einer unseligen, unendlichen seit! So will ich mich nun von jetzo dir ganz
unterwürfig machen, sollst auch keinen Mangel bei mir haben, ich will
dir treulich dienen; so sollst du dich auch vor mir nicht entsetzen; denn ich
bin kein scheußlicher Teufel, sondern ein Spiritus familiaris. d. i. ein vertraulicher
Geist, der gerne bei den Menschen wohnet."
"Wohlan denn", sagte hierauf Doktor Faustus, "so gelobe mir im Namen
deines Herrn Luzifer, daß du allem fleißig nachkommen wollest; was
ich dir werde zumuten und von dir begehren." Der Geist beantwortete
solches mit Ja. "Du sollst zugleich wissen", sagte er, "daß ich werde
Mephistopheles genennet: und bei diesem Namen sollst du mich hinfort
jederzeit rufen, wenn du etwas von mir begehren willst; denn also heiße
ich." Doktor Faustus erfreute sich hierüber in seinem Gemüte, daß nun
sein Begehren einmal zu einem erwünschten Ende gekommen sei, und
sprach: "Nun, Mephistopheles, mein getreuer Diener, wie ich verhoffe, so
wirst du dich allezeit gehorsamlich finden lassen und in dieser Gestalt wie
du jetzund erschienen bist. Ziehe nun für diesesmal wiederum hin, bis auf
mein ferneres Berufen." Auf diesen Bescheid bückte sich der Geist und
verschwand.
***Obwohl nun Doktor Faustus vermeinte, es könne ihm hinfüro nichts
mehr mangeln, weil er einen so getreuen Diener an dem Geist habe, wollte
es doch gleichwohl nach und nach an einem und dem andern fehlen. Denn
die baren Mittel von der Verlassenschaft seines vor etlichen Jahren verstorbenen
Vetters hatten nunmehr ein Ende, und war von diesem allen
außer der Behausung, in welcher er wohnte, und etlichen Wiesen und
Feldern weniges mehr übrig, wegen des vielen Spielens und Bankettierens,
zu dem der Erbe sehr geneigt war. Daher hielt er mit seinem Mephistopheles
Rat, wie er doch andere Mittel anstatt der verlornen erlangen
möchte, damit er eine bessere Haushaltung führen könnte. Der Geist
sagte: "Mein Herr Fauste, gib dich zufrieden und beschwere dein Gemüt
nicht mit dergleichen kummerhaften Gedanken; sorge doch hinfüro für
nichts mehr, ich bin dein Diener, dein getreuer Diener, und solang du
mich haben wirst, sollst du keinen Mangel an irgend etwas haben: darum
sollst du nicht sorgen noch trachten, wie deine Haushaltung möge fortgeführet
werden, weil du weniges Einkommen hast und das andere fast
aufgezehret ist. Denn wenn du nur Schüsseln, Teller, Kannen und Krüge
hast; so hast du schon übrig genug; für Essen und Trinken aber darfst du
nicht sorgen, ich will dein Koch und Keller sein: dinge nur keine Magd,
die es vielleicht verraten möchte; aber einen Famulus oder Jungen magst
du wohl haben: ingleichen auch Gäste und gute Freunde, die dir Gutes
gönnen und des Deinigen bisher leidlich genossen: die magst du immerhin
einladen und berufen und mit ihnen fröhlichen und guten Mutes
sein."
Daß nun dieses Anerbieten des Geistes dem Doktor Faustus erfreulich
müsse zu hören gewesen sein, ist wohl zu glauben: allein er wollte fast
darob zweifeln, weswegen er auch zum Geist sprach: "Mein lieber Mephistopheles
, ich muß doch gleichwohl fragen, wie und woher willst du solches
alles überkommen?" Der Geist lächelte hierüber und sprach: "Dafür
sorge du nur nicht; aus aller Könige, Fürsten und großer Herren
Höfen kann ich dich sattsamlich versehen; an Kleidern, Schuhen und anderm
Gewand sollst du auch keinen Mangel leiden. Nur, Getränk ' und
Speise zu bekommen, dazu mußt du freilich auch das Deinige tun; denn
ich weiß nicht, was du am liebsten issest und trinkest: darum was du
abends und morgens verlangest und haben willst, das verzeichne und lege
das Verzeichnis auf den Tisch, daß ich es hole und alles dir zu rechter
Zeit verschaffe." Dessen erfreute sich Faustus gar sehr und tat dem also,
verzeichnete zur Stunde die Kost neben einem guten Trunk zweier oder
dreierlei Weingewächse, um zu sehen, ob ihm der Geist auch das getane
Versprechen erfüllen würde.
Abends um sieben Uhr wurde ihm hierauf zum erstenmal der Tisch gedeckt
, auf welchen denn der Geist ein zierlich vergoldetes Trinkgeschirr
setzte. Auf die Frage, woher denn der schöne Becher stamme, antwortete
der Geist, er solle danach nicht fragen; er habe ihm dieses in das Haus
verehrt, dessen sollte er sich inskünftige bedienen: worauf Faustus schwieg
und zugleich sah, daß Semmeln und andere Dinge mehr auf dem Tische
lagen, ja nicht lang hernach fanden sich da sechs oder acht Gerichte, welche
alle warm und auf das beste zugerichtet waren, wie denn auch die Weine
nacheinander auf den Tisch gestellt wurden.
***Da nun Faustus für nichts mehr zu sorgen hatte, woher er Essen, Trinken,
Geld und anderes überkäme, brachte er Tag und Nacht im Saus und
Brause hin, spielte, fraß und soff mit seinen Zechbrüdern, Goldmachern,
etlichen Studiosen so, daß nach einiger Zeit fast jedermann in der Stadt,
sonderlich die Nachbarschaft, weil Doktor Faustus sich um nichts mehr
bekümmerte, weder um die Praxis noch um seine "lasar und Wiesen, die
er von seinem Vetter ererbt hatte, zu zweifeln anfing, ob dieses recht zugehe
, weil Faustus nicht von der Luft leben könne, dazu er ohnedem schon
wegen Zauberei in ziemlichem Verdacht bei jedermänniglich stand. Diesen
Argwohn den Leuten zu benehmen, ermahnte der Geist seinen Herrn, eine
bessere Haushaltung zu führen, selbst die Acker zu besämen, das Heu und

Grummet von seinen Wiesen abzumähen und einzubringen, die Frucht zu
schneiden und einzuernten: legte sofort in Fausts Namen Hand an und
brachte diesen wieder in ehrlicheren Ruf. Es war damals aber eine unbequeme
Zeit und die Frucht nicht wohl geraten; dennoch schnitt Faustus
dreifach soviel von seinen geerbten Gütern, als sein nächster Nachbar tat.
Allein dem Doktor Faust wollte in die Länge dieses eingezogene ehrbare
Leben nicht gefallen, er sprach deshalb mit allem Ernst zu seinem Geiste:
"Schaffe mir, o Mephistopheles, Geld, woher du es gleich nehmen solltest;
denn ich bin gar geneigt zum Spielen, welches ich auch für meine
liebste Beschäftigung halte; damit will ich nicht allein meine Zeit vertreiben,
sondern auch außerhalb dieses meines Hauses meine Lust in guten
Gesellschaften recht büßen. Meinest du, Mephistopheles, ich habe mich
deinem Fürsten, dem Luzifer, so hoch verpflichtet, daß ich ein mönchisches
eingezogenes Leben führen wolle? O nein, es ist viel anders gemeint.
Schaffe du mir, nach deines Herrn Versprechen, ein gutes Leben auf dieser
Welt und verrichte darneben das Meinige wie bisher, um den Leuten
den Argwohn zu benehmen."Mephistopheles antwortete hierauf: "Mein
Herr Fauste, was habe ich dir jemals versagte Habe ich nicht durch Wartung
der Felder und Wiesen, durch Einsammlung der Früchte so viel zuwege
gebracht; daß du deine Haushaltung hast führen mögen, sondern
auch dadurch den Leuten ziemlich aus den Mäulern hifi kommen?" Doktor
Faustus bejahte solches und sprach: "ES ist wahr, und ich danke dir
wegen deines Fleißes und deiner Vorsorge; allein, mein Diener, es wird
mir, solches zu halten, in die Länge beschwerlich fallen, darum will ich
nun hiermit mein ganzes Herz vor dir ausschütten; willst du nicht alles
dasjenige tun und verrichten, was ich haben will, und mir meine übrige
Lebenszeit alle gehörige Notdurft und ersinnliche Ergötzlichkeit verschaffen,
so sage ja oder nein."
Mephistopheles sah wohl, daß sich Doktor Faustus ereifert hatte, und
antwortete demnach: "Wohlan, mein Herr, ich bekenne es, daß ich dein
Diener und also schuldig bin, dir allen gebührenden Gehorsam zu leisten.
Damit du mich nun nicht für einen Lügengeist halten mögest, so sollst du
sehen und in der Tat erfahren, daß keine Unwahrheit an mir sei, ich will
dir Geld und alles, was du vonnöten hast, zur Genüge verschaffen: aber
eines bitte ich dich, dieweil etliche dich ebendarum werden anfeinden, daß
es dir so wohl ergehet, so halte auch deine mit deinem Blut geschriebene
Zusage, daß du alle diejenigen wollest verfolgen, die dich etwa deines Lebens
wegen strafen werden, dessen erinnere ich dich nochmals." '
Doktor Faustus gab dem Geist wiederum gute Worte, und dieser erfüllte
nun in allem und jedem seinen Willen; Geld ward ihm zugetragen,
er wurde mit Kleidung, Schuhen, Bettgewand versehen, an allerhand
Speisen und Getränken mangelte es nie, kein Holz kaufte er je und hatte
doch dessen einen großen Vorrat. Hernach aber wollte es der Geist auch
nicht mehr schaffen, sondern Doktor Faustus mußte das Seinige dabei
tun und mit seiner Kunst etwas zuwege bringen, wie wir bald hören
werden.
***Doktor Faustus hatte nun gute Tage und tägliches Wohlleben, weil
ihm an nichts gemangelt, wonach sein Herz gelüstete; jedoch konnte es
unter solcher Zeit nicht wohl fehlen, daß nicht etwa ein einiger guter Gedanke
in seinem Herzen hätte sollen aufstehen, der ihm von der Allmacht,
Güte und Treue des Gottes, den er ja so schändlich wider besser Wissen
und Gewissen verleugnet, hätte sollen heimlich predigen und sein Gewissen
rühren; zumalen ihm solches sonst, wegen verbotener Besuchung des Gottesdiensts
und verwehrten Genusses des Heiligen Sakraments, nicht gerühret
werden mochte. So sprach er denn einsmals zu sich selber: "Ich
habe gleichwohl bei mir die Heilige Bibel und noch andere christliche
Bücher mehr; ich kann in diesen wohl lesen, ob mir gleich die Kirche und
der Gottesdienst verboten ; mit diesen will ich zu Hause meine Kirche
anstellen; es muß mein böses Gewissen dem Teufel nicht allezeit offenstehen;
ist doch noch bei mir ein kleines Fünklein einiger Zuversicht
und eines Andenkens an Gott! Wer weiß, Gott möchte sich meiner dermaleins
noch erbarmen!"
Hierauf ist der Geist Mephistopheles zu ihm getreten und hat ihm diese
seine Gedanken vorgehalten, sprechend: "Mein Herr Fauste, ich will dir
deines jetzigen Vorhabens halber ganz und gar nicht zuwider oder daran
hinderlich sein; allein eins bitte ich dich, betrachte wohl, was du in dem
vierten Artikel deiner Verschreibung zugesagt und versprochen; das halte,
willst du nicht in Unglück geraten. Das Bibelbuch belangend (denn die
andern achte ich nicht), soll dir wohl darin zu lesen vergünstiget sein; jedoch
nicht mehr als das erste, andere und fünfte Buch Mosis; der andern
Bücher aller, ohne den Hiob, sollst du müßig gehen. Den Psalter Davids
lasse ich nicht zu; desgleichen im Neuen Testament magst du drei Jünger,
so von den Taten Christi geschrieben haben, als den Zöllner, Maler und
Arzt lesen (der Geist meinte den Matthäus, Markus und Lukas); den
Johannes meide; den Schwätzer Paulus und andere, so Episteln geschrieben
haben, lasse ich auch nicht zu! Darnach wisse dich zu richten. Darum
wäre mein Rat, gleichwie du anfänglich in der Theologia studieret, nämlich
in den Schriften der Kirchenväter, daß du darin fortfahren möchtest;
diese will ich dir nicht verwehren; so hast du dich auch verschworen, du
wollest der Dreifaltigkeit absagen, wollest auch davon nichts reden oder
viel disputieren, wie ingleichen von den Sakramenten und andern Glaubenspunkten:
so du aber je mit Disputieren dich willst erlustigen, so nimm
dazu Anlaß, von den Konzilien, Zeremonien, Messe, Fegfeuer und andern
dergleichen Glaubenssachen mehr zu reden !"
Doktor Faustus ereiferte sich und sagte: "Ja, lieber Gesell, du wirst mir
nicht allzeit Maß und Ordnung vorschreiben, was ich hierin tun oder lassen
soll!" Mephistopheles, ganz erzürnt, gab ihm diese Antwort: "So
sage und schwöre ich bei meinem höchsten Herrn, der unter dem Himmel
ein Fürst, ja ein mächtiger und gewaltiger Fürst regieret, du mußt dieses
meiden und die Bücher, die ich dir verboten habe, verfolgen und darin
nicht lesen, oder dir soll etwas begegnen, das dir nicht lieb sein wird!"
Faustus antwortete: "Nun leider sehe ich, wie hoch ich mich an Gott
vergriffen, und wie vermessentlich ich mich durch jene Artikel verpflichtet
habe, daß ich nicht mehr lesen und reden darf, was doch andere frei und
ungehindert tun dürfen; ach, was hab ' ich getan! — Wohlan", sagte er
weiter, "besagte Bücher der Heiligen Schrift will ich nicht lesen, dazu von
Glaubenssachen nicht disputieren; das aber verlange ich von dir, du tuest
es gern oder nicht; daß du mir verheißest, mein Prädikant zu sein und mir
alles dasjenige, wovon ich gerne einen Unterricht und Wissenschaft haben
möchte, kurz und deutlich zu berichten und als ein hocherfahrener Geist zu
lehren": welches ihm denn der Geist treulich zusagte.
Da berichtete ihm denn der Geist ausführlich, zu welcher Klasse von
Geistern er selbst gehöre, wieviel der bösen Geister seien, warum der Teufel
aus dem Himmel verstoßen worden; er erzählte ihm, wiewohl widerwillig
und voll Ingrimm, vom Himmel und den himmlischen Heerscharen,
von den Engeln vor Gottes Thron, vom Paradies; dann wieder von der
Ordnung der Teufel, von ihrer Hoffnung, dereinst noch selig zu werden,
und von der Hölle. Da denn der Geist seine Rede mit den nachdenklichen
Worten beschloß: "Wenn ich aber ein Mensch geboren worden wäre wie
du, o Fauste, so wollte ich Tag und Nacht meine Hände mit Danksagung
gegen Gott im Himmel aufheben, daß er seinen Sohn mit dem menschlichen
Fleisch und Blut bekleidet hat; sich des menschlichen Geschlechtes .
annimmt, daß er es von des Teufels Gewalt erlöse; der Teufel ärgster
Feind worden und dem Menschen das ewige Leben gibt; dagegen muß der
Teufel in der Hölle wiederum büßen, was er verderbet hat: solcher Erlösung
, mein Herr Fauste, bist auch du teilhaftig gewesen, aber nun, wegen
deiner zeitlichen Pracht, Ehrgeizes und Hoffart, hast du solche verscherzt
und mußt ohne allen Zweifel gleicher Verdammnis mit dem Teufel, den
du hiezu gleichwohl herbeigerufen hafi, in der Höllen gewärtig sein."Auf
diese ungescheute Aussage des Geistes schwieg Doktor Faust und entließ
den Geist.
Als er aber des Nachts zu Bette gegangen, klangen ihm die Reden des
Geistes unaufhörlich in den Ohren wie ein ferner Sturmwind, worüber
er seufzte und also mit sich selbst sprach: "Ach, du elender und verfluchter
Mensch, dir hat Gott Leib und Seele gegeben, diese solltest du besser verwahret
haben! Zudem, wie hätte doch Gott, der Herr, seine Güte, Gnade
und Barmherzigkeit reichlicher gegen dich ausschütten oder dir zueignen können
, denn daß er seinen einigen Sohn in diese West gesendet, auf daß er
das verderbte menschliche Geschlecht wiederum zurechtbrachte und die
Menschen das ewige Leben hiedurch im Glauben erlangen möchten? Dafür
sollte ich ja billig, wie der Geist ganz recht gesagt, mein Leben lang dankbar
gewesen sein! Ach, daß ich um eines so kurzen und zeitlichen wollüstigen
Lebens willen mich mit dem Teufel also böslich verbunden habe!
Nunmehr aber ist es mit meiner Buße und Reue ohne allen Zweifel zu
spät. Ach, daß ich nur noch ein kleines Fünklein eines rechten Glaubens
hätte zu Christo: oder daß ich Macht und Erlaubnis hätte, mich mit einem
Geistlichen zu unterreden, auf daß ich von ihm einigen Trost oder wohl
gar die Vergebung meiner schweren Sünde empfinge! Aber von nun an
wird es leider viel zu spät sein!"
***So saß denn einmal Doktor Faust, den Kopf in der Hand haltend, daheim
in großem Unmut und dachte seinem künftigen bösen Zustande nach,
wie er sich so leichtfertig dem Teufel ergeben hätte, der ihn nun nach seinem
Gefallen regiere und führe: daher er seinen Geist ob der Mittagsmahlzeit,
da er niemand um sich gehabt, fragte, ob ihn denn der Teufel
wie andere sichere und gottlose Menschen schon vorlängst auch regiert und
besessen hätte. Dem gab Mephistopheles zur Antwort: "Ja, dein Herz
oder vielmehr dein ganzes Leben war von Jugend auf nicht recht beschaffen
noch richtig nach Gottes Wort, daher ward es bald eingenommen;
denn wir sahen deine Gedanken, womit du umgingst, und wie du niemand
sonst zu deinem Vorhaben möchtest gebrauchen können denn den Teufel;
siehe, so machten wir deine Gedanken, womit du umgingest, noch frecher
und kecker, auch so begehrlich, daß du Tag und Nacht nicht Ruhe hattest,
sondern daß dein Dichten und Trachten nur dahin stand, wie du Zauberei
zuwege bringen möchtest: auch da du hernach uns beschwurest, machten
wir dich erst so frech und verwegen, daß du dich eher dem Teufel hättest
hinführen lassen, ehe du von solchem Zauberwerk wärest abgestanden:
hernach verhärteten wir dein Herz noch mehr, bis wir es so weit gebracht,
daß du nunmehr von deinem Vornehmen nimmer würdest abstehen, allezeit
dahin trachtend, wie du einen Geist möchtest herbeilocken, bis es uns
endlich gelungen, daß du dich mit Leib und Seel unserm Fürsten Luzifer
ergeben; was alles dir denn, mein Herr Faust, nicht unbekannt sein
kann!"
"ES ist wahr", sagte hierauf Doktor Faustus, "nun kann ich aber nicht
mehr anders tun, auch habe ich mich selbst gefangen; hätte ich gottseligere
Gedanken gehabt, mit dem Gebet zu Gott gehalten und den Teufel
nicht so sehr bei mir einwurzeln lassen, so wäre mir solches alles nicht begegnet
; ei, was habe ich getan!" Da antwortete der Geist: "Da siehe du
zu."Also stand Doktor Faustus zur Stunde vom Tisch auf und ging traurig
aus dem Haus hin zu guter Gesellschaft; damit er daselbst seine
Schwermut und Melancholie besser vertriebe und die Zeit anders zubrachte.
In Wahrheit hatte aber Faust auch ein herrliches Leben voll zeitlicher
Macht und Wollust. In einem schönen, stattlichen Hause bewohnte er
zwei Säle, dort vernahm man mitten in der Winterszeit den Zusammenklang
eines lieblichen Vogelgesanges; die Amsel, die Wachtel schlug fröhlich,
die Nachtigall tirilierte unvergleichlich; der Papagei, gegenüber hängend,
redete aufs zierlichste: die Zimmer waren mit den schönsten Tapeten
behangen mit herrlichen Gemälden geziert und mit Kostbarkeiten aller
Art ausgestattet. Im Vorhofe des anstoßenden Zaubergartens sah man
mit Lust indianische Hähne und Hennen, Rebhühner und Haselhühner,
Kraniche, Reiger, Schwäne und Störche ohne alle Scheu lustwandeln.
Der Garten selbst war nicht sonderlich groß, aber ausbündig herrlich;
denn da, wiewohl sonst zur Winterszeit in der Stadt alles mit Schnee bedeckt
war, sah man nie Winter, sondern immer nur lustigen, fröhlichen
Sommer mit Gewächsen, Laub und Gras und den buntesten Blumen;
dazu waren schöne Weinstöcke zu sehen, mit mancherlei Trauben behängt,
alle schon reif; bunte Tulpen, gefüllte Josephsstäbe; Narzissen und Mosen
blühten und flammten dazwischen. An den Mauern des Gartens der
Länge nach waren Granaten-, Pomeranzen-, Limonien- und Zitronenbäume
in schnurgeraden Reihen aufgestellt; Kirschen-, Birna und Apfelbäume
standen bunt durcheinander wie ein Wald, und alle hingen immer
voll Früchte. Ja, da mochte man erst Wunder sehen; denn da waren
Birnbäume, die trugen Datteln, uno junge Kirschbaume, daran hingen
Feigen; und wiederum an dichten Apfelbäumen waren zeitige schwarze
Kastanien zu sehen. Zuoberst im Hause, da stand ein schmuckes Taubenhaus
, darin flogen Tauben aller Art und von den seltensten Farben und
nicht nur zahme, sondern auch wilde Feldtauben aus und ein. Unten aber
im Hause, vor einem Stall an der Einfahrt, lag des Doktor Faustus großer
Zauberhund, der ihm, wenn er aus dem Hause ging, nicht von der
Seite wich. Sein Name war Prästigiar oder Hexenmeister; der hatte
Augen ganz feuerrot und graulich, und schwarzes zottiges Haar; wenn
ihm aber Faust über den Rücken fuhr, verwandelte sich seine Farbe und
wurde bald grau, bald weiß, bald gelblich oder braun, und das Tier machte
gar seltsame Sprünge und Gaukeleien, wenn es mit seinem wunderlichen
Herrn, der auch seinen eigenen Schritt hatte, dahinpudelte.
***Nun lasset euch aber auch eins um das andere von den lustigen Stücken
und Teufeleien erzählen, die der Erzschwarzkünstler Doktor Faustus mit
Hilfe seines Geistes Mephistopheles da und dort in der Welt ausübte.
Es studierten zu der Zeit, nämlich Anno 1525, drei junge Freiherren zu
Wittenberg samt ihrem Hofmeister. Diese, als sie erfahren, daß das
Kurfürstlich Bayerische Beilager mit nächstem sollte zu München vollzogen
werden, wie denn bereits dazu allerhand erdenkliche kostbare Zubereitung
mit großer Pracht wäre gemacht worden, ging ihnen dieses alles
mächtig zu Herzen, und sie waren sehr begierig, etwas von solchem zu
sehen, weil allda auf einmal viel zu schauen wäre. Redeten demnach miteinander
und wußten doch nicht, wie sie die Sache angreifen sollten; der
eine wollte, sie sollten mit ihm ziehen, weil übermorgen der Hofmeister
auf eines Freundes Hochzeit, wiewohl nicht weit von der Stadt, verreisen
würde; er wollte schon Rosse zu reiten bekommen, bei dem Hofmeister
wollten sie sich wohl entschuldigen usw. Der andere war mit diesem wohl
zufrieden und verlangte nur die Zeit der Abreise, wiewohl ihm des Hofmeisters
Abwesenheit im Wege stand. Der dritte aber sprach: "Ihr lieben
Herren Vetter, wenn ihr mir folgen wolltet, so wüßte ich wohl zu diesem
Handel einen guten Rat, wobei wir weder Sattel noch Pferde dazu bedürften
; könnten nichtsdestoweniger bald, ehe man es auch allhier unter
andern wahrnähme, wiederum zu Hause sein. Euch ist allensamt wohl
bewußt; wie Doktor Faustus allhier als ein sonderlicher Freund und guter
Gönner der Studenten uns, die wir viel Kurzweil und Ergötzlichkeit
zu verschiedenen Malen in seiner Behausung genossen haben, geneigt und
gewogen sei, auch was er zuwege bringen und vermittelst seiner, wiewohl
in stiller Heimlichkeit gehaltenen, Schwarzkunst verrichten möge. Dieses
nun unser Verlangen, das fürstliche Beilager zu sehen, wollen wir ihm
vortragen, ihn deswegen beschicken und freundlich darum ansprechen, unter
dem Versprechen einer stattlichen Verehrung, so er uns in diesem
Stücke zu Willen sein würde."Solcher Rat mißfiel den zweien andern
nicht; es wurde beschlossen, eine stattliche Zusammenkunft zu veranstalten,
, zu der sie auch den Doktor Faustus beriefen. Nach einem kleinen
Umtrunke gaben sie ihm ihr Verlangen und die Ursache seines Beschikkens
zu verstehen; darein er denn alsobald willigte und ihnen aufs möglichste
zu dienen zusagte, nur daß sie solches in der Stille halten möchten.
Den Abend nun zuvor, als morgenden Tags darauf das fürstliche Beilager
seinen Anfang nehmen sollte, beruft Faustus die drei Freiherren
in seine Behausung, befiehlt ihnen, sie sollen sich aufs schönste ankleiden,
was denn zur Stunde geschah; bedeutet ihnen zugleich, er wolle gern ihres
Willen sein und sie in gar kurzer Zeit nach München bringen; aber sie
sollten ihm treulich verheißen und zusagen, daß keiner unter ihnen während
dieser Fahrt ein Wort reden, auch, ob sie schon in den fürstlichen
Palast kämen und man mit ihnen reden würde, daß sie ja keine Antwort
geben sollten; wenn sie solches leisten würden, so wolle er sie sicher und
ohne Gefahr dahinführen und von da wiederum nach Hause bringen; wo
sie aber dem nicht würden nachkommen, sondern während der Zeit etwas
reden und sich versehen, so wollte er außer der Schuld sein, und solle alle
Gefahr alsdann auf ihrem Halse liegen. Darauf sie denn solches ihm
zu tun zusagten und mit aller Pünktlichkeit einhalten zu wollen versprachen
.
Vor Tages nun richtete Doktor Faustus seine Fahrt also zu: er legte
seinen Nachtmantel ausgebreitet auf ein Beet im Garten seines Hauses,
setzte die drei jungen Baronen darauf, sprach noch einmal ihnen tröstlich
zu, sie sollten unerschrocken sein und sich nicht fürchten und nur ihres
Versprechens eingedenk sein, nicht zu reden; sie würden bald an verlangten
Ort sein; und siehe, da erhob sich bald ein Wind, der schlug den
Mantel zu, daß sie zusamt dem Faustus darin wohlgeborgen lagen, und
so hob der Wind den Mantel empor und fuhren sie miteinander in des
M Namen, den Doktor Faustus beschworen, fort, erschienen auch nach
Verfluß etlicher Stunden, bei schon hellem Tage, in dem Vorhofe des
fürstlichen Palasts zu München, ohne daß jemand ihrer gewahr geworden,
wie und welchergestalt sie dahingekommen. Nachdem sie sich aber dem
Palaste genähert und der Hofmarschall ihrer ansichtig geworden, empfing
dieser sie gar höflich und ließ sie, als Fremde, durch andere, weil erselbst
sehr beschäftiget war, in den obern Saal begleiten. Es kam aber zuerst
dem Hofmarschall und nachmals dem Hofjunker, der sie begleitete, wunderseltsam
vor, daß sie so gar auf keine Frage, woher und von wannen sie
wären und kämen, etwas antworteten, sondern, gleich als ob sie stumm
wären, mit tiefster Reverenz ihre Gegenehrerbietung zu verstehen gaben.
Und weil mehr zu tun und nicht Zeit war, der Sache ferner nachzudenken,
wurden die Freiherrn dagelassen, bis die Trauung geschehen und es nun
an dem war, daß man bei herannahendem Abend zur Tafel sitzen wollte.
Nachdem nun die fürstlichen Personen ihre Stelle an der Tafel genommen
und man auch mit dem Handwasser auf Befehl des Kurfürsten (dem
indessen der Hofmarschall von diesen drei stummen Herren einige Meldung
getan, daß sie sich nicht zu erkennen geben wollten) bis zu ihnen
gelangt war, spricht der eine von ihnen, seines Versprechens vergessend,

er bedanke sich wegen solcher hohen Ehren zum allerhöchsten. Nun muß
man wissen, daß Doktor Faustus, wie oben gedacht ihnen ausdrücklich
befohlen, sie sollten nicht ein Wort reden, und wenn er würde zweimal
sprechen: "Wohlauf, wohlauf", so sollten sie alsobald nach seinem Mantel
greifen, sodann würden sie alsbald wieder den Weg unsichtbar fahren,
den sie hergekommen; diesem zufolge hatten nun sofort die beiden auf
das an sie ergangene Wort des Faustus den Mantel ergriffen und fuhren
miteinander unsichtbar dahin; der dritte aber, der sich wegen des gereichten
Handwassers und der Berufung zur Tafel bedankt, ist ganz erschrocken
dahintengelassen worden.
Es ist leicht zu ermessen, wie diesem Hinterlassenen müsse zumut gewesen
sein, zumal es ja nicht lang verschwiegen bleiben mochte, und
einer dem andern von dem Handel etwas in die Ohren lispelte, bis es endlich
vor die Ohren des Kurfürsten selbst gelangte, der denn bald Nachfrage
halten ließ, wie es mit solchem allen eigentlich beschaffen wäre.
Wie sollte aber dieser Halbgefangene auf ein und anderes Ausfragen
besser antworten als mit Verschwiegenheit; weil er leichtlich erachten
konnte, wenn er seine Herren Vetter verraten und den gangen Verlauf
entdecken würde, dieses gar bald ihren Eltern und ihnen selbst zu großer
Beschimpfung kundgetan werden dürfte? Er getröstete sich dabei, als er
auf Befehl des Kurfürsten sofort an einen wohlverwahrten Ort, gleich als
in Gefangenschaft; geführt wurde, daß seine Vettern ihn nicht lassen würden
, sondern den Doktor Faust vermögen, daß er aus seiner Gefangenschaft
wiederbefreiet werden möchte. Welches denn auch nicht lange nachher
geschehen: denn ehe der folgende Tag recht angebrochen, machte sich
Doktor Faustus auf, kam an den Ort, wo der junge Freiherr gefangenlag,
und als er sah, daß das Gemach mit etlichen von der Leibwache des Fürsten
verwahrt war, bezauberte er sie als mit einem süßen Schlaf, eröffnete
mit seiner Kunst Schloß und Türe, schlug seinen Mantel um den Freiherrn,
der noch gar sanft schlief, und brachte ihn also unvermerkt zu seinen
beiden Vettern nach Wittenberg. Darüber waren sie denn sehr erfreuet;
, bedankten sich aufs höchste und beschenkten den Doktor mit einer
ansehnlichen Verehrung.
Wahr ist es, daß der Geist Mephistopheles eben genug zu tun hatte,
Geld und Mittel zu verschaffen, daß sein wollüstiger und verschwenderischer
Herr genug zu bankettieren und zu verschlemmen hatte; er wollte
daher dieses so sehr nicht mehr tun, sondern warf ihm einst mit allem,
Ernst vor, er wäre nun schon eine lange Zeit her mit aller Kunst und Geschicklichkeit
versehen und begabt worden, daß er sich deren wohl bedienen
und sich wohl selbst ernähren könnte, ohne daß er, der Geist, hinfort etwas
mehr dabei täte; dawider denn Doktor Faustus sich nicht wohl setzen
durfte, weil er bei sich bedachte: "ES ist wahr, was soll mir meine Kunst
und Geschicklichkeit, wenn ich deren nicht gebrauche? Wie will denn mein
Name ausgebreitet werden?" Er ließ es demnach dabei beruhen. Damit
er nun beizeiten Geld überkommen möchte auch solches mit guten Gesellen
zu verspielen hätte, wollte er ein Stücklein seiner Kunst seine guten
Freunde sehen lassen; er verfügte sich daher mit ihnen zu einem sehr reichen
Juden, um bei ihm Geld aufzubringen, obwohl er nicht im Sinn
hatte, dasselbe wiederzugeben: er begehrte deswegen von dem Juden sechzig
Taler auf einen Monat lang, die wolle er ihm alsdann mit Dank
wiederum bezahlen, oder aber sollte er ihm ein Bein statt des Unterpfands
abnehmen (welches er selbst nur scherzweise redete, der Jud ' aber für
Ernst aufnahm); und so leihet ihm denn der Jud ' — nachdem er die
andern Anwesenden zu Zeugen angerufen — die Summe.
Als nun die Zeit bereits verflossen, und der Jude, der nichts Gutes
ahnte, sich in Doktor Fausts Behausung verfügte, allda sein Geld samt
den Zinsen zu holen, empfing dieser ihn aufs freundlichste und sprach zu
ihm: "Lieber Jud ', ich weiß mich gar wohl zu entsinnen, daß ich dir nach
Verfluß dieser Zeit dein Geld samt dem Interesse wiederzugeben versprochen
, allein wer kann dafür, daß ich anjetzo nicht bei Geld bin? Willst du
nicht länger borgen, so magst du laufen, ich gönne dir eher keine Bratwurst
Leicht ist zu erachten, daß dieses dem Juden die Galle überlaufen
machte, und weil noch zwei andere Juden mit ihm erschienen waren, brach
er ganz entrüstet in Drohworte gegen Doktor Faustus aus: er sollte ein
für allemal anderen Sinnes werden, oder er wollte sich mit Gewalt an
sein versprochenes Unterpfand halten, und das sei einer von seinen Füßen
l Doktor Faust stellte sich, als wüßte er nichts hievon, und begehrte
von ihm, solches auf seiner Obligation zu lesen, weil er's nicht glauben
könnte; als er's nun gelesen, sagte er: "Mein Mausche, es ist wahr, ich
hab ' verloren, weiß dich auch so bald nicht zu bezahlen, deswegen magst du
dich an dein Unterpfand halten, und hiermit hast du deinen Bescheid."
Der Jude, ganz rasend, dachte: "Ich habe wohl schon ein mehrers als sechzig
Taler auf einmal verloren!" wollte sich auch kurzweg an sein Unterpfand
halten und den Fuß haben; er stellte sich aber nur so, um dem Doktor
Faust einen nicht geringen Schrecken einzujagen.
Aber was geschieht? Doktor Faustus tut, als sei ihm bei der Sache
ganz wohl, nimmt eine Säge, legt sich auf das Faulbett, gab jene dem
Juden und sprach, er sollte nun in aller Henker Namen sein Unterpfand
hinnehmen, jedoch mit dieser ausdrücklichen Bedingung, daß ihm der Fuß
innerhalb solcher seit, und sobald er die ganze Summe würde entrichten
wollen, wiederum alsobald zuhanden möchte gestellt werden: welches
nicht allein der Jude ihm zusagte, sondern stracks darauf als ein rechter
Christenfeind über den Schenkel herfuhr, den Fuß mit jüdischer Begierde
absägte, das Blut mit einer aufgelegten Salbe stopfte, den guten Faustus
aber, seiner Meinung nach halbtot, hinter sich ließ. Der Jude zog samt
seinen Gesellen mit dem Fuß fort, dachte unterwegs und sagte zu den
andern, was ihm jetzt dieser Stümmel frommen möchte. Der Fuß könnte
ihn noch teuer genug zu stehen kommen, wenn Doktor Faust deswegen
sterben sollte; deswegen warf er ihn, weil die andern gleiches sagten, als
er über eine Brücke nach Hause ging, in ein fließendes Wasser und zog
seinen Weg, an nichts anders denkend, als daß er nimmermehr bezahlt
wäre.
Mittlerweile, als es dem Doktor Faust Zeit dünkte, sein Unterpfand zu
lösen, beruft dieser seinen Gläubiger, den Juden, durch etliche Studenten,
seine vertrauten Freunde, wie auch zween Gerichtsbediente, in seine Behausung
auf einen bestimmten Tag, wo er dem Juden gegen Zurückgabe
seines Unterpfands seine Schuld abstatten wollte. Wer erschrak mehr als
der Jude, da er diese unverhoffte Post überkam, und noch viel mehr, da
er mit Gewalt mitzugehen gezwungen ward l Faustus aber stellte sich auf
des Juden Ankunft sehr verdrießlich und dabei recht ungeduldig, daß der
Jude mit dem Fuß so lange ausgeblieben wäre, da er doch schon vor
etlichen Tagen das Geld beisammengehabt und nun nichts anders zu erhalten
verlange als sein Unterpfand. Der Jude, weil er's nicht mehr
beihanden hatte, konnte dieses (wie dem Faustus keineswegs verborgen
war) nicht mehr herbeischaffen; er stand deswegen in nicht geringen
Sorgen und erbot sich, er wolle die Schuldverschreibung wiedereinhändigen
und hinfüro der Schuldforderung nicht mehr gedenken, sondern sie
als bezahlt unterschreiben, nur sollten sie ihm das Unterpfand erlassen.
Das war eine angenehme Zeitung für unsern Faustus; der Jude aber
machte sich hierauf bald zur Türe hinaus und war froh, daß er so gut
davongekommen: Faust indessen stand wohlbehalten und mit beiden Beinen
vom Bett auf, machte sich mit den Studenten nach seiner Weise mit
des Juden Geld recht lustig, und alle konnten über den Possen, den Doktor
Faust dem Juden angetan, nicht genug lachen.
Gleicherweise spielte er auch einem Roßtäuscher bald nachher auf einem
Jahrmarkte mit, der zu Pfeiffering gehalten wurde. Denn Faust richtete
sich durch seine Kunst ein schönes lichtbraunes Pferd zu, mit welchem er
auf den Markt geritten kam, eben zu der Zeit, da es am meisten Käufer
gab. Er fand ihrer viel, die das Pferd feilmachten, und weil es von
schöner Höhe, dazu hübsch proportioniert aussah, trieben die Käufer
einander hinauf, bis letzlich Doktor Faust mit einem übereinkam, der
ihm vierzig Gulden bar bezahlte, dazu sich nicht anders einbildete, als er
hätte einen sehr guten Kauf gemacht. Ehe nun Faustus das Geld zu sich
zog, bittet er den Roßtäuscher; er sollte das Pferd unter zweien Tagen
nicht in die Schwemme reiten, welches ihm der Roßtäuscher versprach und
so groß eben nicht auf dies Versprechen achtete, also davonritt und voller
Hoffnung war, ein Ansehnliches dabei zu gewinnen. Dem Roßtäuscher
fällt unterwegs, da er an ein fließendes Wasser kam, ein, was doch
sein Verkäufer damit möchte gemeint haben, daß er das Pferd unter
zweien Tagen nicht in die Schwemme reiten solle; wollte es demnach
versuchen und also den nächsten Weg durchs Wasser fortreiten: als er
nun aber fast in die Mitte des Wassers kam, siehe, da verschwand das
Pferd, der Roßtäuscher aber saß auf einem Büschel Stroh, und hätte es
leicht geschehen können, er wäre in Gefahr geraten.
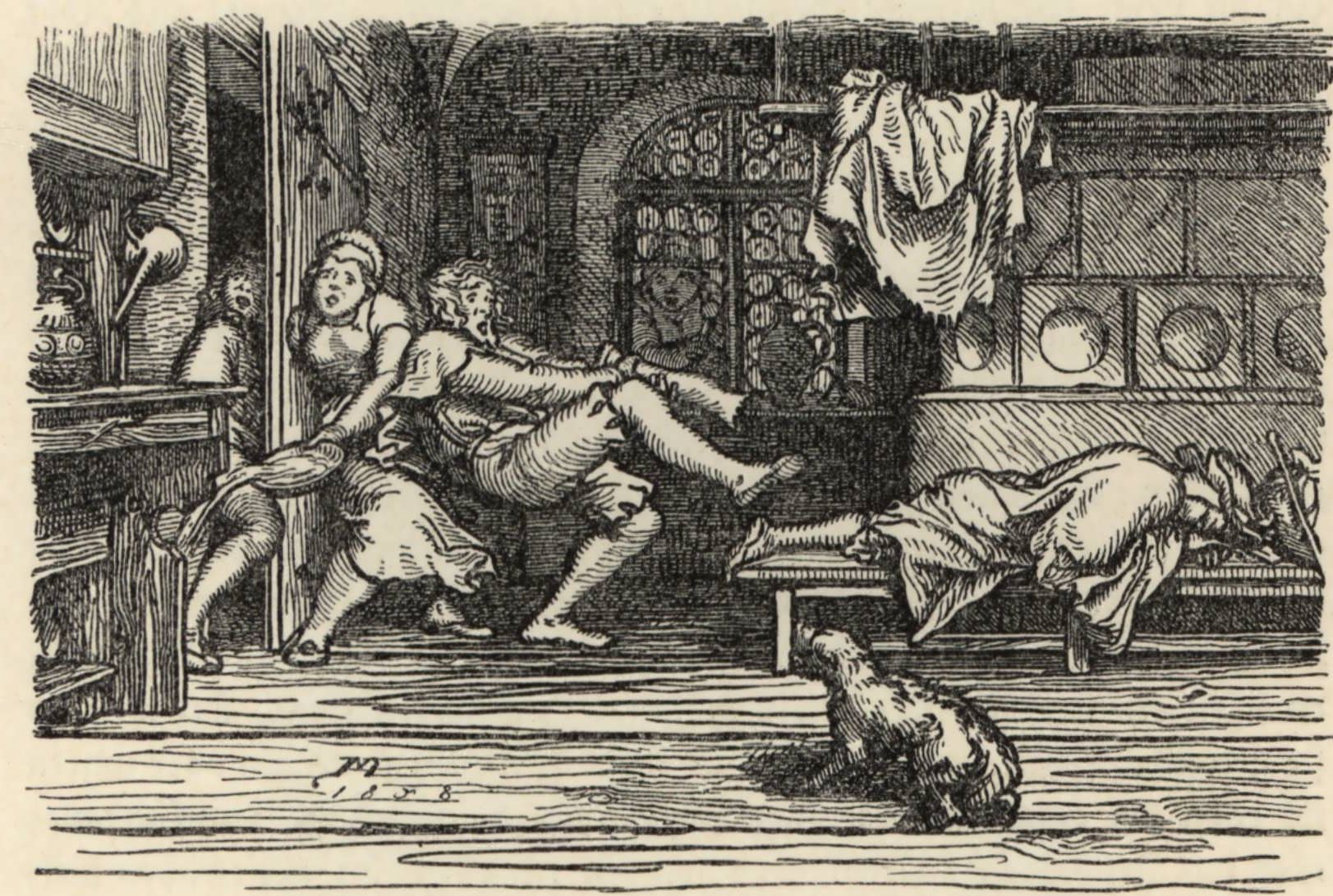
Der Mann, der vor Erstaunen und Schrecken nicht gewußt, was er tat,
nachdem er aus dem Wasser gewatet, lauft spornstreichs zurück in den
Flecken, wo der Markt gewesen, gleich dem Wirtshause zu, wo vorher sein
Verkäufer gesessen, zur Zeit aber eben auf der Bank lag und tat; als ob
er fest schliefe. Der Roßtäuscher; ganz ergrimmt, da er Fausten also liegen
und schlafen sieht, erwischt ihn beim Fuß und wollt' ihn von der Bank
herabziehen, damit er ihm sein Geld wiedergebe; aber da ging jenem der
Schenkel gar aus, und fiel der Roßtäuscher mit demselben rücklings in
die Stube, darauf denn Doktor Faustus zetermordio zu schreien anhub,
daß die Leute herbeiliefen; der Roßtäuscher aber lief über Hals und Kopf
davon, nicht anders meinend, als er hätte dem Faustus den Fuß ausgerissen
.
***Es studierten damals zu Wittenberg einige vornehme polnische Herren
von Adel, welche mit Doktor Faust viel umgingen und gute Kundschaft bei
ihm hatten. Nun war eben zu dieser Zeit die Leipziger Messe; sie verlangten
daher sehr, dieselbe einmal zu besuchen, teils weil sie von ihr oft und
viel gehört, teils weil etliche gedachten, allda von ihren Landsleuten Geld
zu erheben. So baten sie denn den Doktor, er wollte doch, wie sie wohl
wüßten, daß er's könnte, mit seiner Kunst so viel zuwegen bringen, daß
sie dahingelangen möchten. Doktor Faustus wollte sie keine Fehlbitte tun
lassen und schaffte durch seine Kunst, daß des andern Tages vor der Stadt
draußen ein mit vier Pferden bespannter Landwagen stand, auf welchen
sie getrost aufsaßen und in schnellem Laufe fortfuhren. Kaum aber waren
sie etwa bei einer Viertelstunde fortgerückt, da sahen sie sämtlich quer
über das Feld einen Hasen laufen, was sie für ein böses Reisezeichen hielten
, wie sie denn mit diesen und andern Gesprächen etliche Stunden zubrachten
, so daß sie noch vor abends zu ihrer großen Verwunderung in
Leipzig ankamen.
Folgenden Tages besahen sie die Stadt, verwunderten sich über die Kostbarkeiten
der Kaufmannschaft, verrichteten ihre Geschäfte, und als sie wieder
nahe zu ihrem Wirtshaus kamen, nahmen sie wahr, daß gegenüber in
einem Weinkeller die sogenannten Wein- und Vierschröter allda ein Faß
Wein, sieben oder acht Eimer haltend, aus dem Keller schroten oder bringen
wollten, vermochten aber doch solches nicht, wie sehr sie sich auch deswegen
bemühten, bis etwa ihrer noch mehr dazukämen. Doktor Faustus
und seine Gesellen standen da still und sahen zu; da sprach Faust (der
auch hier seiner Kunst wegen wollte bekanntwerden) fast höhnisch zu den
Schrötern: "Wie stellet ihr euch doch so läppisch dazu, seid eurer so viel
und könnet ein solches Faß nicht zwingen, sollte es doch einer wohl allein
verrichten können, wenn er sich recht dazu schicken wollte! ' Die Schröter
waren über solcher Rede recht unwillig und warfen, dieweil sie ihn nicht
kannten, mit herben Worten um sich, unter andern: "Wenn er denn besser
als sie wüßte, solch Faß zu heben und aus dem Keller zu bringen, so
sollte er's in aller Teufel Namen tun, was er sie viel zu vexieren hätte?"
Unter diesem Handel kommt der Herr des Weinkellers herzu, vernimmt
die Sache, und sonderlich, daß der eine gesagt, es könnte das Faß einer
wohl allein aus dem Keller bringen; deswegen spricht er halbzornig zu
ihm: "Wohlan, weil ihr denn so starke Riesen seid, welcher unter euch das
Faß allein wird herauf und aus dem Keller bringen, dessen soll es sein!"
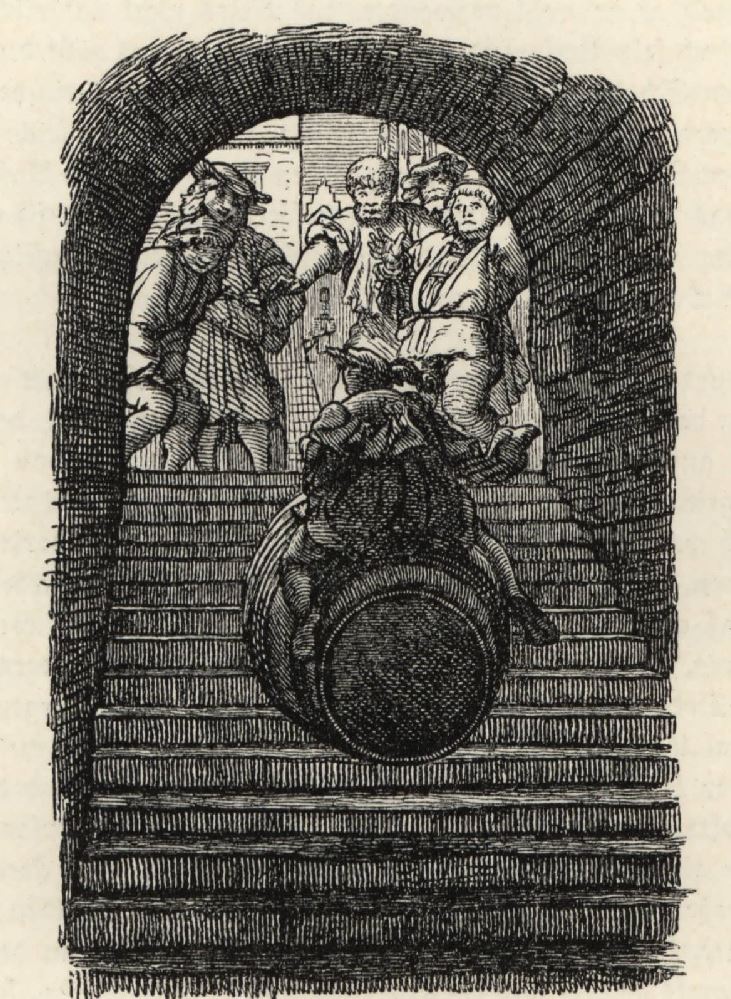
Doktor Faustus aber war nicht faul, und weil eben etliche Studenten dazugekommen,
ruft er diese an zu Zeugen dessen, das vom Weinherrn versprochen
worden, ging also hinab in den Keller; setzte sich recht breit auf
das Faß, gleich als auf einen Bock, und ritt, so zu reden, das Faß nicht
ohne jedermanns Verwundern herauf: darüber denn der Weinherr sehr
erschrak; und ob er wohl vorwandte, daß dieses nicht natürlich zuginge,
mußte er doch sein Versprechen halten, wollte er anders nicht den Schimpf
zusamt dem Schaden haben. Also ließ er das Faß mit Wein dem Doktor
Faustus verabfolgen, der es denn seinen Gesellen, zugleich auch den
Zeugen, den Studenten, zum besten gegeben, welche alsbald Anstalt machten
, daß das Faß in das Wirtshaus geliefert wurde, wohin sie noch mehr
andere gute Freunde baten, und sich etliche Tage davon lustig machten,
solang ein Tropfen Wein darin war.
***Einst wurde zu Wittenberg bei einer fröhlichen Gesellschaft von einem
Studenten des vortrefflichen Poeten Homer Meldung getan, der ebenselbiger
Zeit auf der Hohen Schule gelesen wurde, welcher von vielen berühmten
griechischen Helden handelt und deren rühmliche Taten erzählt,
namentlich von Menelaus, Achilles, Hektor, Priamus, Paris, Ulysses,
Agamemnon, Ajax; und lobte einer des Poeten zierliche Redeweise, der
andere, daß er darin jene Personen so schön vorgemalt, als wenn sie zugegen
wären, und so rühmte der eine dies, der andre ein andres. Alsbald
erbot sich Doktor Faustus, die oben aufgeführten Helden morgenden Tags
im Hörsaal in ihrer eigenen Person vorstellig zu machen: welches denn
mit höchster Danksagung von allen angenommen wurde. Und da sie deswegen
Doktor Faust des andern Tags mit sich in den Hörsaal führten,
fing dieser also an zu reden: "Ihr lieben Herren und gute Freunde, weil
ihr ein großes Verlangen traget, die trojanischen Kriegshelden und etwa
noch andere, deren der Poet Homer sonderlich gedenket, in der Person,
wie sie damals gelebet und einhergegangen sind, anzuschauen, so soll euch
solches anjetzt gewähret werden; nur daß keiner ein Wort rede oder jemand
zu fragen begehre"; welches sie ihm auch sofort zusagten. Darauf
klopfte Doktor Faust mit dem Finger an die Wand, alsobald traten jene
griechischen Helden in ihrer grauen zu jener Zeit üblichen Rüstung einer
nach dem andern in den Hörsaal herein, sahen sich zur Rechten und Linken
mit halbzornigen und strahlenden Augen um, schüttelten die Köpfe und
gingen wiederum wie zuvor nacheinander zur Türe hinaus.
Doktor Faust wollte es dabei nicht bewenden lassen, sondern noch einen
kleinen Schrecken hinzufügen, klopfte deshalb noch einmal; bald tat sich
die Tür auf, zu welcher halbgebückt der ungeheure greuliche Riese Polyphemus
eintrat, der an der Stirne nur ein Auge hatte, mit einem langen
zottigen feuerroten Bart, der hatte ein Kleinkind, das er gefressen, noch
mit dem Schenkel am Maul hangen und war so grausam und schrecklich
anzusehen, daß ihnen allen miteinander die Haare zu Berge standen: worüber
denn Doktor Faustus genug lachte; auch wollte er seine Zuschauer
noch mehr ängstigen und schaffte, daß, als Polyphemus wiederum wollte
zur Tür hinausgehen, er sich zuvor noch einmal umsah mit seinem erschrecklichen
Gesichte und sich nicht anders gebärdete, als wollte er nach
etlichen greifen; stieß zugleich mit seinem großen ungeheuren Spieß wider
den Erdboden, daß das gange Gemach zu schüttern begann. Doktor Faustus
aber winkte ihm mit dem Finger, da trat auch er hinaus, und so hatte
denn Doktor Faustus seine Zusage erfüllt. Die Studenten waren es alle
wohl zufrieden, doch hatten sie genug und begehrten hinfüro keine solche
Vorstellung mehr von ihm.
***In der Schlossergasse Erfurt stand ein Haus, zum Anker genannt;
darin wohnte damals ein Stadtjunker, bei welchem als einem Liebhaber
der Schwarzkunst sich Doktor Faustus oftmals aufhielt; welchen auch dieser
Junker stets hochachtete. Es begab sich aber auf einen Tag, daß Doktor
Faust, der auch auf der Hohen Schule zu Erfurt in großem Ansehen
stand, einem andern zu Gefallen nach Prag verreist war; der Junker aber
beging eben seinen Namenstag, wozu er denn etliche gute Freunde, allesamt
Gönner Doktor Fausts, berufen: diese nun waren bis in die späte
Nacht recht lustig und wünschten sämtlich nichts mehr, als daß nur ihr
guter Freund Faustus dabei und gegenwärtig wäre, sie wollten noch viel
fröhlicher sein.
Einer aber unter ihnen, der bereits einen guten Rausch hatte, nahm ein
Glas mit Wein, streckte das in die Höhe und sprach: "O guter Gesell
Fauste, wo steckest du jetzund, daß wir deiner also entbehren müssen?
Wärest du allhier, wir würden ohne Zweifel etwas von dir sehen, das unsere
Fröhlichkeit vermehren sollte; weil es aber für diesmal nicht sein kann,
so will ich dir dies zur Gesundheit gebracht haben: kann es aber sein, so
komm zu uns und säume dich nicht!" darauf tat er einen Jauchzer und
trank das Glas aus.
Nach etwa einer Viertelstunde aber pocht jemand an die Haustüre gar
stark; ein Diener laust an das Fenster schauen, wer da wäre; da stieg
eben Doktor Faustus von seinem Pferd ab, führte solches bei dem Zügel
und gab sich dem Diener, der die Türe öffnen wollte, zu erkennen mit der
Bitte, dem Junker und gesamten Gästen zu sagen, wie der zur Stelle und
gegenwärtig wäre, nach dem sie allesamt so sehr verlanget hätten. Der
Diener, voll Erstaunens, lauft eilends und zeiget solches dem Junker und
gesamter Gesellschaft an; diese lachen und sagen, ob er ein Tor oder voll
Weins wäre. Doktor Faust sei ja verreist und könne nicht über die Mauern
herfliegen, nicht er werde es, sondern ein anderer sein. Indessen klopfte
Faustus noch einmal stark an, daß also der Junker genötigt ward, von der
Tafel aufzustehen; er sah aber kaum zum Fenster hinaus, da ward er
den Doktor Faust beim Mondschein gewahr und schenkte also des Dieners
Anbringen Glauben; alsbald ward die Tür eröffnet Doktor Faustus
aber von allen freundlich empfangen und sein Pferd durch den Knecht in
den Stall geführt und gefüttert. Die erste Frage war, daß die gesamten
Gäste zu wissen verlangten, wie er doch so bald; und ehe sie sich
dessen versehen hätten, von Prag wiederkäme. Er antwortete kurz hierauf:
"Da ist mein Pferd gut dazu. Weil mich die sämtlichen Herren so
sehr herbeigewünscht, mir auch zum öftern mit Namen gerufen, hab '
ich ihnen willfahren und bei ihnen allhier erscheinen wollen, wiewohl ich
nicht lang verbleiben kann, sondern bei anbrechendem Tag, der angefangenen
Geschäfte wegen, wiederum zu Prag sein muß!" Darüber wunderten
sich alle nicht wenig, fingen inzwischen das Spiel wieder an, wo
sie es gelassen, waren fröhlich und guten Mutes, dabei nun auch Doktor
Faustus das Seinige tun wollte; deswegen spricht er zu den Gästen, ob
sie nicht auch einmal von fremden und ausländischen Weinen einen
Trunk versuchen möchten: es wäre gleich, Rheinwein, Malvasier, spanischer
oder Franzwein. Worauf sie bald mit lachendem Munde sprachen:
"Ja, ja, sie sind alle gut."Zur Stund fordert Doktor Faustus von dem
Diener einen Bohrer; fängt an, auf die Seiten des Tischblatts vier
Löcher nacheinander zu bohren, verstopft solche mit vier Zäpflein und hieß
alsdann ein paar schöne Gläser schwenken und herbringen; da diese gebracht
waren, ziehet er ein Zäpflein nach dem andern aus: da sprangen die
genannten Weine heraus in die Gläser, dessen sich die Gäste höchlich verwunderten
, lachten und waren recht guter Dinge, versuchten auch die
Weine und genossen derer auf Zusprechen und Versichern Fausts, daß
es natürliche Weine wären, mit großer Begierde.
Während solcher Kurzweil, nach Verfluß von drei Stunden, kommt des
Junkers Sohn, der spricht zum Doktor Faust: "Herr Doktor, wie muß
man das verstehen? Euer Pferd frißt so unersättlich, daß der Stallknecht
beteuert, er wollte wohl zwanzig Pferde mit dem, das es bereits gefressen
hat, füttern; gleichwohl will dieses alles nicht flecken, ich glaube,
der Teufel frißt aus ihm, es stehet noch immer und siehet sich um, wo
mehr sei." Über diese recht ernstlichen Worte, wie sie der junge Mensch
vorbrachte, lachten sie alle, Faust aber am meisten, der darauf antwortete:
er sollte es nur dabei verbleiben lassen, das Pferd hätte diese Art;
es hätte für diesmal genug gefressen; denn sonst würde es wohl allen
Haber auf dem Boden hinwegfressen, wenn man seinen unersättlichen
Magen füllen wollte. Es war aber dieses unersättliche Pferd sein Geist
Mephistopheles. Mit solchen und dergleichen andern Kurzweil brachten
sie die Nacht hin, daß der frühe Morgen bald begann anzubrechen, da
tat Fausts Pferd einen hellen lauten Schrei, daß man es in dem ganzen
Haus hören mochte. "Nun", sagte alsbald Doktor Faustus, "bin ich zitiert;
ich muß fort!" und wollte also Abschied nehmen: aber die Gäste
hielten ihn auf; da machte er an seinen Gürtel einen Knoten, den Aufbruch
nicht zu vergessen, und sagte ihnen noch ein Stündlein zu; nach
Verfluß dessen aber fing das Pferd an zu wiehern, da wollte er wieder
kurzweg fort doch ließ er sich erbitten, weil er von einem magischen
Stück zu erzählen angefangen, noch ein halbes Stündlein zu verbleiben.
Jetzt tat das Pferd aber den dritten Schrei, da wollte sich Faust nicht länger
aufhalten lassen und nahm seinen Abschied von ihnen allen; diese bedankten
sich bei ihm der unverhofften Einsprache wegen und gaben ihm
das Geleite bis zur Haustüre, da er sich denn auf sein Pferd setzte und
immer die Schlossergasse hinaufritt bis zum Stadttor, das noch nicht geöffnet
war; dessenungeachtet schwang sich sein Pferd mit ihm in die Luft,
daß, die ihm nachsahen, ihn bald aus dem Gesicht verloren: Faust aber
kam noch bei frühem Tage in sein voriges Haus, in der Stadt Prag.
***Einst reisten einige Kaufleute mit Doktor Faust hinab gen Frankfurt
auf die Messe und kamen im Odenwald abends in ein Städtlein, Vorberg;
nun lag auf einem Berge daselbst ein Schloß, auf welchem ein Vogt
hauste, der der Verwandte eines Kaufmanns unter der Gesellschaft war;
dieser, da er gerne seinem Vetter eine Ehre erweisen wollte, berief die
ganze Gesellschaft folgenden Tags zu sich auf das Schloß, das hoch lag,
und traktierte sie nach bestem Vermögen. Da sie nun einander mit dem
Trunk ziemlich zugesetzt und allbereits Abschied nehmen wollten, weil
es aussah, als ob ein ander Wetter kommen wollte, spricht einer unter
der Gesellschaft der indessen zum Fenster hinausgesehen: "Nein, nein,
es hat keine Not des Regenwetters halber, es stehet ein schöner Regenbogen
am Simmel!" Da Doktor Faustus das vernahm, stand er vom
Tisch auf, ging zum Fenster, sah hinaus und sagte: "Was soll es gelten,
ich will mit meiner Hand diesen Regenbogen ergreifen?" Die andern,
denen die Kunst Doktor Fausts nicht so gar bekannt war liefen sämtlich
vom Tisch, diesem unmöglichen Ding zuzusehen; denn der Regenbogen
stand noch weit von da, um die Gegend Boxbergs herum. Bald
aber strecket Doktor Faustus seine Hand aus, und siehe, da ging der Regenbogen
über dem Städtlein her, gegen dem Schloß zu, bis an das
Fenster, so daß er den Regenbogen mit der Hand augenscheinlich faßte
und gleichsam hielt. Er sagte auch darauf, so die Herren möchten zusehen,
so wollte er auf diesen Regenbogen sitzen und davonfahren: aber sie wollten
nicht und verbaten sich's. Zur Stund zog Faust die Hand ab, da schnellte
der Regenbogen hinweg und stand wiederum wie zuvor an seinem Ort.
***In der Stadt Braunschweig wohnte ein Vornehmer von Adel, der an
der Schwindsucht lange Zeit krank darniedergelegen; und ob er wohl
alle in und außer der Stadt befindliche Arzte zu sich gefordert, so wollte
doch nichts helfen. Weil denn alle natürlichen Mittel vergebens waren,
wollte er sich endlich auch der magischen Kur des damals in der Nähe auf
einem Schlosse sich aufhaltenden Doktors Faust, auf den Rat eines guten
Freundes, unterwerfen, berief daher diesen schriftlich und unter dem
Versprechen einer reichlichen Belohnung, wo er ihm helfen werde, zu sich.
Doktor Faustus sandte den Boten gleich wiederum zurück und versichert
den Herrn, daß er bald kommen und nicht säumen wollte: und ob er
wohl gute Gelegenheit von dem Herrn des Schlosses sowohl zu reiten als
zu fahren hatte, wollte er doch lieber, weil es auch sonst seine Gewohnheit
war, zu Fuß gehen. Als er nun von ferne die Stadt erblickte, ward
er gleich hinter sich eines Bauern gewahr, der mit einem leeren wagen,
mit vier Rossen bespannt, gerade der Stadt zufahren wollte; diesen
sprach Doktor Faust mit guten Worten an, er sollt' ihn auf den Wagen
sitzen lassen und ihn, weil er sehr müde wäre, führen bis an das Stadttor
. Der Bauer aber schlug es rund ab und meinte, er würde ohne das
genug aus der Stadt zu führen haben, könnte nicht erst sich mit ihm verweilen
und ihn aufsetzen; wiewohl es dem Doktor Faust nicht Ernst war;
sondern er machte nur einen Versuch, ob der Bauer so dienstwillig sein
würde. Nun tat ihm die grobe Weise und unbillige Antwort des Bauern
sehr weh, und er gedachte bei sich selbst: "Wart, du grober Esel, du mußt
mir herhalten, ich will dich mit gleicher Münze bezahlen; tust du solches
einem Fremden, was wirst du sonst tun?" Alsobald spricht er etliche
Worte, da sprangen die vier Räder zugleich vom Wagen und fuhren
zusehend in die Luft hinweg; gleichermaßen fielen auch die Pferde nieder
, als wären sie vom Hagel getroffen worden, und regten sich nicht
mehr. Als der Bauer dies sah, erschrak er, wie leicht zu glauben, von
Herzen, weinte und bat mit aufgehobenen Händen den Doktor Faust,
er solle ihm Gnade erweisen; er wisse wohl, daß er sich grob an ihm,
als einem Fremden, versündigt hätte; er wolle es gewiß nicht mehr tun!
Was sollte nun Doktor gauss machen? Er sagte: "Ja, du grober
Gesell, tue es hinfüro keinem mehr, was du mir getan hast; ich will
diesmal deiner verschonen: damit du aber nicht gar leer ausgehst und
zugleich ein Andenken haben mögest, andere Fremde nicht solcher Gestalt
zu traktieren: so nimm immerhin das Erdreich unter deinen Rossen
und wirf es auf sie!" Der Bauer gehorcht dem Faust und wirft die Erde
auf sie; alsobald richteten sie sich wieder auf. "Aber", fuhr Doktor Faustus
fort, "deine Räder wiederum zu bekommen, gehe der Stadt zu; bei
den vier Toren wirst du ein jegliches Rad finden und antreffen!" Der
Bauer brachte also den halben Tag zu, bis er seine Räder wiederbekam.
Als nun Doktor Faust mit obgedachten Kaufleuten gen Frankfurt gekommen,
wurde er — wie bei solcher Meßzeit allerhand Gaukler und
Abenteurer gemeiniglich erscheinen und zusammenkommen, — von seinem
Geist Mephistopheles berichtet, daß in einem Wirtshaus bei der
Judengasse vier verwegene Gaukler und Schwarzkünstler seien, darunter
der eine der Meister; die andern seine Knechte. Diese hieben einander
die Köpfe ab, ließen den abgeschlagenen Kopf durch einen dazu bestellten
Barbier waschen und säubern und setzten den dem Leibe wieder auf, zu
jedermanns Verwundern, welches denn auch diesen Schwarzkünstlern ein
großes Geld eintrug, weil viel Herren und reiche Kaufleute der Stadt sich
dahin verfügten und zuschauten. Solches verdroß den Doktor Faust nicht
wenig; denn er meinte, er wäre allein des Teufels Hahn im Korb; deswegen
nahm er sich gleich vor, seine Kunst auch hier sehen zu lassen, und
ging dahin, nebst andern dem Handel zuzuschauen. Er sah aber daselbst
bald eine rote Decke auf der Erde ausgebreitet liegen, auf der Seite des
Zimmers stand ein Tisch und auf demselben ein verglaster Hafen, darin,
wie sie vorgaben, ein destilliertes Wasser wäre, in welchem Wasser vier
grüne Lilienstengel standen: die nannten sie die Wurzeln des Lebens.
Nun war es mit dem Handel also beschaffen, daß, wenn einer von
den Gauklern niederkniete auf die rote Decke, ging bald der andere her-
bei und hieb mit einem breiten Schwert diesem den Kopf ab und gab ihn
dem Barbier, der ihn zwagen 1 und sogar barbieren mußte. Wenn dieses
verrichtet war, gab alsdann der Barbier dem Meister den Kopf, der solchen
den Anwesenden zu beschauen darreichte: inzwischen setzte man den
Körper auf einen Stuhl, und wenn es Zeit war; so setzte je einer nach dem
andern den Kopf mit vielen seltsamen Worten und Zeremonien wieder auf:
sobald aber dieses geschehen, sprang eine Lilie aus den vieren in dem Hafen
auf dem Tisch in die Höhe, und wurde sobald auch der Leib wiederum
ganz; und dieses trieben sie immer so fort, bis es auch an den Meister
kam. Diesem nun, ob ihn schon vorher Doktor Faustus sein Leben lang
nicht gesehen hatte, wollte er eines versetzen und solchem Gaukelwerk
ein Ende machen. Daher, als sie zum andernmal das Kopfabhauen anhuben
und die Reihe nun an dem Meister war, beobachtete er genau, welcher
Lilienstengel in dem Hafen dem Meister zugehörte, und als dieser
eben niederknien wollte, geht Doktor Faustus unsichtbar hin zu dem Tisch,
auf welchem der Hafen mit dem Lilienstengel stand, und schlitzte mit einem
Messer des Meisters Lilienstengel voneinander, machte sich hierauf wieder
unsichtbar von dannen und zur Türe hinaus, welches auch die Anwesenden
nicht gewahr wurden. Der Knecht schlägt indessen dem Meister; wie
vorhin mehr geschehen, das Haupt ab, läßt es waschen und barbieren und
will es nun wieder auf den Körper setzen; aber sieht, da fiel es wieder
herab. Alle Anwesenden, besonders aber die Knechte des Schwarzkünstlers
, erschraken in ihre Seele hinein, und noch mehr entsetzten sie sich,
als sie entdeckten, daß des Menschen Lilie oder Wurzel des Lebens in dem
Hafen voneinander geschlitzt war und der Meister tot auf der Erde lag.
***Doktor Faustus kam auf eine Zeit Geschäfte halber, die er für andere
dort zu verrichten hatte, in die Stadt Gotha, etwa um die Zeit des Brachmonats
wo man allenthalben mit dem Heumachen und Einführen beschäftiget
war. Eines Tags nun war er seiner Gewohnheit nach ziemlich
bezecht und ging abends mit etlichen seiner Zechgenossen spazieren vor
das Tor hinaus; indem begegnet ihm ein Wagen, wohlbeladen mit Heu;
Doktor Faustus aber ging mitten im Fuhnwege, daß ihn also der Bauer,
der das Heu einführte, notwendig ansprechen mußte, er solle ihm aus
dem Weg weichen und seinen Weg nebenhin nehmen. Faust aber zögerte
mit der Antwort nicht: "Ich will bald sehen", sprach er, "ob ich dir, oder
du mir weichen müssest; höre, Bruder, hast du niemals gehört, daß
einem vollen Mann ein geladener Wagen ausweichen solle?" Der Bauer
war über die Verzögerung recht unwillig, gab dem Faust viel unnütze
Worte, und wenn er nicht gehen wolle, werde er ihm den Weg weisen;
Faust aber erwiderte ihm auf der Stelle: "Wie, Bauer, wolltest du erst
noch pochens Mache mir nicht viel Umstände; oder ich fresse dir beim
Element deinen Wagen samt dem Heu und den Pferden!" Der Bauer
sagte darauf: "Ei, so friß auch noch etwas anders dazu!" Doktor Faustus
, nicht unbehende, rückt mit seiner Kunst hervor, verblendet den
Bauern dergestalt, daß er nicht anders meinte, denn jener habe ein Maul
groß wie ein Zuber, und daß er bereits seine Pferde samt dem Wagen
und Heu verschlungen und gefressen hätte. Der Bauer erschrak heftig
hierüber und entlief eilends; denn er meinte, wenn er lang allda verharren
würde, möchte es letztlich auch an ihn selber kommen; eilet deswegen
der Stadt und dem Bürgermeister zu, klagt ihm seine Not, wie
ihm ein ungeheurer und doch dem Ansehen nach nicht großer Mann begegnet
sei, der hab ' ihm nicht aus dem Fuhrwege wollen weichen, da
er ihn doch darum gütlich angesprochen; darauf habe er ihm bald gedroht,
er wolle ihm den Wagen mitsamt den Pferden fressen, wenn er ihm, als
einem Trunkenen, nicht ausweichen wolle: wie denn alsdann auch geschehen
; er bitte um Rat und um Hilfe.
Der Bürgermeister, als erdas vernahm, lachte und spottete noch des
Bauern dazu, sagte, das wäre ja nicht möglich: er sei entweder trunken
oder nicht bei sich selbst. Der Bauer beteuerte hoch, daß dem also sei,
wie er erzähle, berief sich auf seine Nachbarn und andere, die hinter ihm
hergefahren wären. Wollte anders der Bürgermeister Ruhe haben, mußte
er sich mit dem Bauern dahin verfügen und dieses Wunder anschauen:
als sie beide aber etwa einen Bogenschuß fern von da ankamen, siehe,
da standen wie zuvor Rosse, Heu und Wagen unverletzt und unverrückt
allda; Faust aber hatte indessen einen andern Weg genommen. —
***Als aber Doktor Faust einst wieder auf Wittenberg zu reiste kam er
auf den Abend unterwegs in ein Wirtshaus; darinnen traf er Kaufleute
und andere Reisende an; da sie nun Nacht miteinander gespeiset hatten
und mit dem Trunk einer dem andern ziemlich zugesprochen, dastand
der Wirtsjunge jederzeit hinter Doktor Faust, und weil er ihn für einen
Abenteurer (das er auch war) ansah, schenkte der Junge ihm allemal das
Glas ganz voll ein, womit denn Doktor Faustus nicht zufrieden war;
drohete ihm auch, wenn er's noch einmal tun würde, so wollte er ihn mit
Haut und Haar fressen. Da nun der Junge seiner spottet und sagte:
"Jawohl, fressent" und ihm darauf abermal zu voll einschenkte, sperrte
Doktor Faustus sein Maul auf und schluckte ihn zum Erstaunen aller,
die an dem Tisch waren, hinunter, erwischte darauf den Schwenkkessel
mit dem Kühlwasser und sagte: "Auf einen guten Bissen gehöret ein
guter Trunk", und soff den rein aus. Der Wirt, der indessen abwesend
gewesen und nichts von allem, was geschehen war, wußte, aber mit
Schrecken solches vernahm, redete deswegen dem Doktor Faust ernstlich zu,
er solle ihm seinen Jungen wiederherschaffen, oder er wolle etwas anderes
mit ihm anfangen. Da sagte Faustus ganz ruhig: "Herr Wirt,
gebt Euch zufrieden und sehet hinter den Ofen!" Da fand man dort in
dem Schwenknapf den Jungen tropfnaß, voller Schrecken und Zittern,
worüber denn die ganze Gesellschaft herzlich lachen mußte.
II.
Doktor Faustus war jetzt nicht allein in der Stadt Wittenberg, sondern
auch im ganzen Land wegen Schwarzkunst und Zauberei verrufen.
Deswegen ließen ihn gottesfürchtige und gelehrte Leute durch andere zu
unterschiedenen Malen erinnern und warnen, von solchem teuflischen
Leben und Wandel abzustehen; unter andern ließ sich eines Tags ein
Nachbar desselben, ein frommer alter Mann, die Mühe nicht dauern,
sein Heil zu versuchen, ob er diesen elenden Menschen bekehren möchte,
zumal er fast täglich wahrnehmen mußte, wie die jungen Bursche und
fürwitzigen Studenten in seiner Behausung aus- und eingingen, da sie
ja nichts Gutes sehen und lernen würden. Er verfügte sich deswegen an
einem Nachmittag zu Doktor Faust, und als er ihm mit freundlichen Worten
die Ursache seines Einkehrens zu erkennen gegeben, wurde er auch
von diesem gütig empfangen; und es gehet die Sage, als sei dieser alte
Warner der getreue Eckhard gewesen, der schon seit vielhundert Jahren
zum Wächter am Venusberge bestellt ist und die unwissenden Menschen
warnt und abmahnt, daß sie nicht zu den teuflischen Unholdinnen in
den Berg hineingehen: wie denn ein Sprichwort ist, daß man zu einem,
der andere getreulich warnet und hütet, gemeiniglich spricht: "Du bist
der getreue Eckhard, du warnest jedermann."
Leicht ist zu glauben, daß jener dem Doktor Faust allerhand Lehren
und Ermahnungen aus Gottes Wort werde vorgebracht und recht unter
Augen gestellt haben, welche auf Abmahnung von seinem bisher so
ärgerlich geführten Leben und Anweisung zu einem bessern Wandel werden
gerichtet gewesen sein; wie denn dieser fromme Alte dem Ansehen
nach auch wirklich so viel ausrichtete, daß ihm bei seinem Abschied Doktor
Faustus gelobte, er wolle seiner heilsamen Lehre und Ermahnung nachkommen
. Auch ist es ihm denn, da er jetzt allein war, solchergestalt zu
Herzen gegangen, daß, indem er bei sich selbst erwog, was er doch gedacht
habe, daß er sich um nichtiger Wollust willen dem leidigen Teufel
ergeben habe, er sich entschloß, Buße zu tun, weil noch Zeit vorhanden,
und sein Versprechen dem Teufel wieder zurückzuziehn. Unter solchem
Vorhaben erscheint ihm der Teufel, tappt nach ihm, stellt sich nicht anders,
als ob er ihm den Kopf umdrehen wollte, warf ihm bald vor, was ihn
so ernstlich dazu bewogen hätte, daß er sich dem Teufel ergeben, nämlich
sein frecher, stolzer und sicherer Mutwille. Er, Faustus, sei ihm, dem
Teufel, nachgegangen, und nicht er, der Teufel, ihm; er habe ihn zu
vielen und unterschiedlichen Malen mit Charakteren, Beschwörungen und
andern Sachen angerufen und seiner eifrigst begehrt. Zudem so hab ' er
ja ungezwungen und freiwillig die fünf Artikel angenommen, sich auch
hernach mit seinem eigenen Blut verschrieben und verpflichtet, daß er
Gott und Menschen feind sein wolle. Diesem Versprechen nun komme er
nicht nach, wolle eigenmächtig umkehren, da es doch schon allzuspät und
er nunmehr des Teufels eigen sei, der ihn zu holen und anzugreifen gute
Macht habe. So wolle denn der Satan Hand an ihn legen, oder aber er
soll sich wieder von neuem verschreiben und solches mit seinem Blut bekräftigen,
daß er sich hinfüro von keinem Menschen mehr wolle abmahnen
und verführen lassen: wo nicht, so wolle er ihn in Stücke zerreißen.
Doktor Faustus, ganz voll Erstaunens bei Anhörung dieser schrecklichen
Drohworte, bewilligte alles mit bebenden Lippen von neuem, setzte sich
nieder und schrieb mit seinem Blute die zweite Teufelzverschreibung,
welche nach seinem Tode in seiner Behausung gefunden wurde. —
***Nachdem er sich also dem Teufel aufs neue mit seinem Blute verschrieben,
schlug er alle treue, wohlgemeinte und seiner armen Seele ersprießliche
Warnung jenes gottesfürchtigen Nachbarn in den Wind und geriet, auf
Anstiften des verbosten Geistes, gegen diesen alten, ehrlichen Mann in einen
solchen Haß, daß er auch nicht ruhen und rasten wollte, bis er sein Mütlein
an ihm gekühlet und ihn womöglich an Leib und Leben gefährdet hätte.
Wie nun dem Sprichwort nach ehrlicher Leute wohlgemeinte Straf' und
Ermahnung gemeiniglich schlechten Lohn erwirbt, also erging es auch
dem ehrlichen Nachbarn: denn etwa nach zweien Tagen, als er nach dem
Nachtessen zu Bette gegangen und sich allbereit nach gesprochenem Abendgebet
schlafen gelegt: siehe, da rüstet ihm Doktor Faustus ein solch Poltern
und Rumpeln vor der Kammer an, als ob alles über einen Haufen fallen
wollte, welches der gute Mann vorher niemal gehört; jedoch ermunterte
er sich bald und gedachte bei sich, dies werde gewiß eine Versuchung des
Teufels sein, vielleicht, weil er Nachbar Faust gutherziger Meinung
seiner Seelen Wohlfahrt zu bedenken ermahnt habe. In diesen Gedanken
kommt das Teufelsgespenst gar zu ihm in die Kammer hinein, grunzt
wie ein Schwein und treibt es so lang, daß dem guten Mann angst und
bang darüber wird. Allein er erholt sich endlich, gedenkt bei sich selbst:
"Ich werde doch solch Gespenst nicht leicht von mir treiben als mit Verspotten
und Verachten", fängt deswegen an und sagt herzhaft: "Ei, eine
solche schöne Musik ist mir mein Lebtag nicht vorgekommen, die lieblicher
zu hören gewesen denn diese; ich glaube, du hast sie in einem Wirtshaus
bei den vollen Bauern und Zechbrüdem oder, welches glaublicher, bei
dem Schweinehirten gelernet; wie ist sie doch so trefflich angestellt, ist
sie vielleicht ein höllisches Konzerts Nun wohlan, sing du die Noten, so
will ich den Text dazu singen!"
Und so fing der fromme Mann an, mit heller Stimme ein geistliches
Lied zu singen. Auf der Stelle schwieg der Teufelsspuk. Jener aber sagte:
"Meister Satan, wie gefällt dir dieses Lied? Ich hätte vermeint, du
solltest dich mit deiner lieblichen Musik etwa an einen fürstlichen Hof begeben
haben, da man vielleicht mehr darauf würde geachtet haben als
bei mir! Packe dich von hier und spare solchen Gesang bis zur Auferstehung
der Toten und Erscheinung des allgemeinen Richters; wo du
alsdann ohne Zweifel in einen Himmel kommen wirst, wo die Flammen
zum Loch ausschlagen!" Mit solchem Gespötte hat der Nachbar das Gespenst
vertrieben, und es ist hinfort nicht mehr gehöret worden.
Des andern Morgens fragte Faust seinen Geist, was er bei dem Alten
ausgerichtet habe. Da gab ihm der Geist die Antwort: er hätte ihm nicht
beikommen können; denn er wäre geharnischt gewesen.
***Um diese Zeit geschah es, daß Doktor Faust zu besserer Betreibung seines
Zauberhandwerks sich einen Famulus beigesellte. Es kam nämlich zur
rauhen Winterszeit eines Tags ein junger Schüler vor Fausts Behausung,
der sang, selbiger seit Gebrauch nach, das Responsorium; diesem
hörte eine Weile Doktor Faustus zu, und weil er sah, daß der arme
Mensch übelgekleidet und fast erfroren war, erbarmte er sich seiner, forderte
ihn hinauf in seine Stube, sich zu wärmen, besprach sich mit ihm,
fragte, woher er wäre, und wer seine Eltern seien. Worauf der Junge
bald antwortete, er wäre eines Priesters Sohn zu Wasserburg, hätte
seines Vaters täglichen ungestüm nicht länger ertragen können usw. Als
nun Doktor Faust aus seinen Reden und allen Anzeichen abnahm, daß
er eines gelernigen und zugleich verschmitzten Kopfes sei, nahm er ihn
zu einem Famulus an und hatte ihn hernach sehr lieb, hauptsächlich da
er nach und nach an ihm wahrgenommen, wie er ganz verschwiegen war
und keine Schalkheit seines Herrn offenbarte, ja selbst voll böser Lüste
steckte. Darum eröffnete er ihm einst alle seine Heimlichkeit und ließ
ihn überdies eines Tags seinen Geist in der gewöhnlichen Mönchsgestalt
sehen, worüber jener nicht erschrak, sondern die Erscheinung bald gewohnt

wurde. Ja, er verrichtete hernach alle Sachen, wie ihm der Geist befahl
, so wohl und mit solchem Fleiß; daß ihn sein Herr, Doktor Faustus,
so liebgewann, daß er ihm vor seinem Tod in seinem Testament alle seine
Verlassenschaft vermachte.
Nun Faust einen menschlichen Aufwärter bekommen, konnte er seinen
schwarzen Zauberhund Präsitgiar; der auch ein Geist war, entbehren und
schenkte ihn einem Abte zu Halberstadt; der selber ein Kristallseher war.
Dieser Hund war nun in allem dem Abt gehorsam, deswegen er ihn auch
sehr liebhatte; nach Verfluß eines Jahrs aber verfiel er in ein großes
Winseln und Seufzen, wollte sich nicht sehen lassen und verbarg sich, wo
er nur konnte; der Abt fragte ihn deswegen, wie es doch käme, und wie
er's meine. Da gab ihm der Geisterhund zur Antwort: "Ach, lieber Abt;
ich habe vermeinet, ich wolle sehr lang in deinem Dienst verharren,
aber ich sehe es leider und weiß es, daß es nicht sein kann und ich also
vor der bestimmten Zeit von dir scheiden werde, das wirst du bald und in
kurzem erfahren, die Ursach ' aber verschweig ' ich für dieses Mal!"Wie dem
allen sein mochte: ehe acht Tage um waren, fiel der Abt in eine hitzige
Krankheit und starb im Aberwitz.
***Einsmals besuchte Doktor Faustus wieder mit einigen Studenten, seinen
vertrauten, guten Freunden, die Leipziger Messe. Es kam aber ebendamals
auch daselbst ein vornehmer Kardinal, namens Campegius, an,
dem erwies der Magistrat der Stadt alle Ehre. Dieser fuhr des andern
Tags aus der Stadt mit seinen Leuten an einen nahe gelegenen lustigen
Ort, frische Luft zu schöpfen; weil nun Faust solches erfuhr, und er ihn
auch gerne sehen wollte, ging er mit seiner Gesellschaft zu Fuß hin an
denselbigen Ort.
Doktor Faustus gedachte bald bei sich, wie er auch hier sich mit seiner
Kunst zeigen und diesem Herrn etwas zu Gefallen tun möchte, damit er
von ihm bei seiner Heimkunft zu Rom etwas zu sagen hätte. So sprach
er denn zu seinen Gesellen: "Liebe Herren und Freunde, in Ermanglung
anderer Kurzweil will ich diesem Fürsten zu Ehren eine sonderbare Jagd
anstellen, die doch dem Landesfürsten in seinem Gebiet und den daran
haftenden Rechten nicht nachteilig sein soll; ihr aber bleibet allhier
stehen und sehet zu."
Bald darauf zog daher sein Mephistopheles, mit vielen Hunden begleitet
, und auch er ging einher wie ein Jäger; Doktor Faustus setzte sein
Hörnlein an und blies: zur Stunde sah man in der Luft daherfahren bald
einen Fuchs, bald einen furchtsamen Hasen, welche denn, beide gleichfalls
in der Luft, Mephistopheles mit den Hunden, Doktor Faust aber
mit seinem Hörnlein immer nachfolgten. Die Hunde ängstigten und
trieben die Füchse und Hasen bald so weit in die Höhe, daß man sie
kaum mehr sehen konnte, bald kamen sie wieder herab, und hatte der
Kardinal, der ohnedies dem Jagen sehr ergeben war, darob eine sonderliche
Freude; dies währte fast eine Stunde, alsdann verschwanden die
Jäger, die Hunde, die Füchse, die Hasen, und Doktor Faust fuhr wie
aus der Luft herab an den Ort, wo seine Gesellen standen und zuschaueten
Dies sah auch der Kardinal, ließ seiner Diener einen dahineilen, um
zu fragen, wer doch diese Person wäre. Da ihm nun hinterbracht wurde,
daß es der Doktor Faustus wäre, von welchem er bereits viele wunderliche
Abenteuer erzählen gehört, erfreute er sich uno ließ ihn durch einen
Edelmann bitten, daß er auf den Abend sein Gast sein und mit seiner
Tafel fürliebnehmen wolle.
Als Doktor Faust erschienen, erzeigte ihm der Kardinal allen geneigten
Willen, versprach ihm, wenn er mit ihm nach Rom kommen wolle,
daß er ihn allda zu einer hohen Würde befördern wollte; denn er gedachte
sich seiner als Wahrsagers zu bedienen. Faust aber bedankte sich
höflich und setzte stolz hinzu, er habe Guts und Hoheit genug; denn ihm
sei der höchste Fürst der Welt untertänig. Und damit nahm er unter vielen
Reverenzen Abschied von dem Kardinal.
***Der löbliche Kaiser Maximilian kam auf einige Zeit mit seiner gan-
zen Hofhaltung nach Innsbruck, willens, eine Zeitlang da zu verharren
und frische Luft zu schöpfen. Weil nun Doktor Faustus auch dazumal
seiner Kunst wegen bei Hof sich aufhielt und ein anderer Probe halber
bei Ihrer Kaiserlichen Majestät in besonderen Gnaden war, geschah es
einst im Sommer nach Jakobitag, da der Kaiser das Nachtessen eingenommen
hatte und in seinem Zimmer auf und ab spazierte, daß erden
Doktor Faust allein zu sich kommen ließ und begehrte er soll ihm vermittels
seiner Kunst etwas zu Gefallen ausrichten, es werde ihm, bei
seinem Kaiserlichen Wort, nichts Arges deswegen widerfahren, sondern
er wolle es noch mit allen Gnaden erkennen.
Doktor Faustus konnte und wollte ein solches Ihrer Kaiserlichen Majestät
nicht abschlagen, und der Kaiser sprach hierauf weiter: "Ich saß
neulich in meinen Gedanken und betrachtete in meinem Gemüte, wie
meine Vorfahren so hoch in der kaiserlichen Würde und Hoheit gestiegen
und zu einem solchen Ansehen bei der Nachwelt gelangt sind, daß ich
billig Sorge trage, ob die nachfolgenden Kaiser gleicher Ehre möchten
teilhaftig werden; aber was ist dieses alles gewesen gegen die Hoheit
und das Glück Alexanders des Großen, der fast die ganze Welt in so
kurzer Zeit unter sich gebracht hat? Nun möchte ich herzlich gern den
Geist dieses unüberwindlichen Helden, wie auch seiner schönen Gemahlin,
wie sie in dem Leben gewesen, sehen und kennen." Doktor Faust antwortete
nach einem kleinem Bedacht; er wolle dieses alles bewerkstelligen
ohne einen Betrug, nur dieses bäte er Ihre Kaiserliche Majestät,
daß sie ja während der Zeit dieser Vorstellung nichts reden sollten, welches
jener auch versprach. Faustus gehet indessen vor das Gemach hinaus
, erteilt seinem Mephistopheles Befehl, diese Personen vorstellig zu
machen, und geht wiederum hinein. Bald klopfet er an die Türe, da tat
sich diese von selbst auf, und herein schritt der Große Alexander, wiewohl
nicht groß von Person, jedoch strengen Ansehens; dazu hatte er einen
falben Bart; er trat herein in einem ganz vollkommenen köstlichen Harnisch
und machte dem Kaiser Reverenz, dieser aber wollte sofort dem
Herrn Bruder die Hand bieten und sprang deswegen von seinem Stuhl
auf. Faust aber trat eilig dazwischen und verhinderte es.
Als nun Alexanders Geist wieder von dannen gegangen, kam alsobald
der Geist der Königin, seiner Gemahlin, herein. Diese machte ebenfalls vor
dem Kaiser eine tiefe Reverenz, war angetan mit himmelblauem Samt,
über und über mit orientalischen Perlen besetzt; sie war dabei eine über
alle Maßen schöne Frau, lieblichen Ansehens und holdseliger Gebärden,
daß sich der Kaiser recht über solcher Schönheit verwunderte. Zugleich
fiel ihm ein, wie er öfters von dieser schönen Königin gelesen, daß sie
hinten an dem Nacken eine Warze gehabt haben sollte. Er stand daher
auf, die Wahrheit dessen zu erfahren, und ging hin zu ihr, und als er
die Warze gefunden, ist auch der Geist hinausgegangen: also ist dem
Kaiser hierin ein völliges Genüge geschehen, und er bedachte den Schwarzkünstler
mit einem recht kaiserlichen Geschenke. Dieses nun wollte Doktor
Faust mit Dankbarkeit erwidern und Ihrer Majestät noch eine besondere
Ergötzlichkeit verschaffen. Nachdem kurz hierauf eines Abends der
Kaiser Maximilian zur Ruhe gegangen und sich in sein gewöhnliches
Schlafgemach verfüget, konnte er sich frühmorgens, da er erwachte, nicht
besinnen, wo er doch wäre: denn das Schlafgemach war durch Doktor
Fausts Kunst zugerichtet als ein schöner Saal. in welchem viel schöne
lustige Bäume von grünen Maien zu beiden Seiten standen, neben andern,
die behängt waren mit zeitigen Kirchen und anderem Obst; der
Boden des Saals war anzusehen als eine grüne Wiese von allerlei bunten
Blümlein; um des Kaisers Bettstatt aber standen noch edlere Bäume,
als Pomeranzen, Granaten, Feigen und Limonien, mit ihren Früchten:
auf dem Gesims waren zu sehen die allerwohlriechendsten Blumen, und
an den Wänden hingen bereits zeitige Trauben.
Leicht ist zu glauben, daß solche unverhoffte Veränderung seines Schlafzimmers
den löblichen Kaiser werde haben recht verwundern gemacht,
welches denn auch Ursache war, daß er etwas länger als sonst in
Bette verharret. Er stand aber hernach auf, tat seinen Nachtpelz um
sich und setzte sich nahe bei dem Bett auf einen Sessel: indem hörte er
lieblichen Gesang der Nachtigall, den anmutigen Zusammenklang anderer
singenden Vögel, die denn immer von einem Baum auf den andern
hüpften; auch sah er von ferne zu Ende des Saals schneeweiße Kaninchen
und junge Hasen laufen, und bald darauf überzog das obere Tafelwerk
ein Gewölk. Als nun der Kaiser diesem allem begierig zusah und
solchergestalt im Saal sich verweilete, gedachten die Kammerdiener, wie
es doch kommen möge, daß ihr allergnädigster Herr vom Bett nicht aufstehe;
es müsse ihm etwa eine Unpäßlichkeit zugestoßen sein; sie erkühnten
sich deswegen und öffneten sittiglich die Türe des Schlafgemachs:
allwo sie denn nicht allein ihren Herrn, den Kaiser; bei guter Gesundheit
antrafen, sondern aus der herrlichen Luft allda abnehmen mußten,
was die Ursache des Verweilens gewesen: der Kaiser aber ließ alsobald
die Vornehmsten am Hof zu sich berufen, die sich denn ebenfalls ob der
Zierlichkeit und Lustbarkeit des Saals nicht genugsam verwundern konnten
Allein nach etwa einer Stunde, und ehe sie sich dessen versahen, fingen
die Blätter an den Bäumen an welk zu werden und zu verdorren,
wie auch die Früchte und Blumen; bald aber kam ein Wind zum Gemach
herein, der wehete alles ab so gar; daß der ganze Zauber in einem Augenblick
vor ihren Augen verschwunden und ihnen nicht anders war, als hätte
es ihnen geträumt. Dem Kaiser hatte die Lustbarkeit dieses zugerichteten
Saals so wohlgefallen, daß er eine gute Weile in Gedanken sitzend nachdachte,
wer doch solche zugerichtet haben möge, und als, wie natürlich,
sein Verdacht auf Doktor Faustus fiel, ließ er ihn zu sich berufen, und.
fragte ihn, ob er der Meister dieses Werkes gewesen. Doktor Faust demütigte
sich und sprach: allergnädigster , Euer Kaiserliche Majestät
hat mich kürzlich wegen eines erwiesenen Kunststücks mit einer ansehnlichen
Verehrung begnadigt, dagegen ich mich denn auch, wiewohl
schlecht genug, habe müssen dankbar erweisen" Darob der Kaiser ein
gnädiges Wohlgefallen getragen.
Nun ward eines Tages Doktor Faust inne, daß der Kaiser einigen
fremden Gesandten und andern Herrn zu Ehren ein kostbares Bankett
auf den Abend zugerichtet hatte, wobei auch das Frauenzimmer zugegen
sein mußte. Es wollte aber bei solcher Fröhlichkeit Doktor Faustus seine
Kurzweil auch miteinmengen, wohl wissend, daß es hoher Orten nicht
mißliebig sein würde. Er brachte es deswegen durch seine Kunst dahin,
daß in dem großen Saal, wo das Mahl gehalten wurde, dem Ansehen
nach ein Gewölk hineinrauschte, etwas trüb, gleich als wenn es bald
regnen wollte; bald aber darauf trennte sich dieses Gewölk, mit Weiß
und Blau gemischt, also daß es herrlich anzusehen war; der Himmel stund
da ganz blau, und ließen sich die Sterne daran in voller Klarheit sehen,
auch nahm man den Mond in vollem Scheine wahr: etwa eine Viertelsende
hernach überlief das Gewölk wieder, und die Sonne tat einen
starken Blitz, daß sich alle versammelten Gäste kreuzigten, bald aber
einen schönfarbigen Regenbogen der kaiserlichen Tafel zugehen sahen,
der jedoch bald wieder verging. Als nun Doktor Faustus vermerkt; daß
bereits der Kaiser und mit ihm die vornehmsten Herren von der Tafel
aufgestanden, die Damen aber, und die sie bedient und ihnen aufgewartet,
sich noch etwas aufhielten, siehe, da überlief das Gewölk durch
einen starken Wind abermal und erschien sehr trübe, da es denn bald
anfing zu blitzen und zu donnern, ja zu kieseln ' und stark zu regnen, so
daß alle, die in dem Saal zugegen waren, davonlaufen mußten; welches
denn dem Kaiser alsobald angedeutet wurde, der nach einigem Schrecken
wohl inneward, daß das Wetter ohne Schaden abgegangen und nur ein
durch Kunst des Doktor Faust zugerichtetes Gewitter gewesen. Und so
hatte er ein besonderes Wohlgefallen auch an dieser Kurzweil.
***Einst kam einer von Adel nach Leipzig, und als ihm in dem Wirtshaus
über der Tafel von andern erzählt wurde, wie Doktor Faustus, der berühmte
Schwarzkünstler, verstorben, und zwar ein erbärmliches Ende
genommen hätte, da erschrak hierüber dieser Edelmann von Herzen und
sprach: "Ach, das ist mir sehr leid, er war dennoch ein guter dienstfertiger
Mann, und mir hat er eine Wohltat erzeigt, deren ich die Zeit
meines Lebens nimmermehr vergessen kann. Es war dazumal mit mir so
beschaffen: als ich vor sieben Jahren noch ledigen Standes und unverheiratet
war, auch zur selbigen Zeit zu Wittenberg Studierens wegen mich
aufhielt, lernte ich unter andern Freunden auch Doktor zaust kennen;
und zwar so, daß er mich, ohne Ruhm zu reden, vor andern recht liebte
und mir wohlwollte. Nicht lang hernach wurde ich auf den Ehrentag eines
Verwandten nach Dresden eingeladen, auf welchem ich auch erschien,
aber ich weiß nicht, zu meinem Glück oder Unglück; denn ich kam in ein
Verhältnis mit einer adeligen, schönen, tugendbegabten Jungfrau, die
mich auch in Züchten ihre Gegenliebe merken ließ, so daß nach der Einwilligung
unserer beiderseitigen Verwandten in kurzem daraus eine Heirat
ward. Als ich nun etwa ein Jahr in aller Vergnüglichkeit, in friedsamer
Ehe lebte, da ward ich einst von zweien meiner Vetter verführt;
die Lust hatten, das Heilige Land zu besehen, daß ich trunkenerweise, jedoch
bei Edelmannswort zusagte, daß ich mit ihnen und anderen Gesellen
dahinreisen wollte; ich hielt auch dies Versprechen unverbrüchlich,
und meine Hausfrau, wie sehr sie sich auch dawidersetzte, mußte
solches endlich geschehen lassen.
Es starben aber nach kaum halb vollbrachter Reise etliche von uns,
und kamen, kurz zu sagen, mit Mühe und Arbeit nur unser drei an den
verlangten Ort; um nun in der Welt auch noch mehr zu sehen, wurden
wir darüber einig, unsern Weg über Griechenland nach Konstantinopel
zu nehmen, um des Türken Wesen desto besser einzusehen; allein bei
einem Engpaß, durch den wir reisen mußten, wurden wir für Kundschafter
angesehen, darüber gefangen, und mit einem Wort: wir mußten unser
hartseliges Leben in schwerer Dienstbarkeit fünf ganze Jahre zubringen.
Der eine meiner Vettern starb hierüber, und kam über Venedig die Sage
nach Deutschland zu den Ohren meiner Freunde, wie auch meiner
frau, daß ich gewiß gestorben wäre. Nun fanden sich, wie leicht zu glauben,
bald Freier, die sich um meine Frau bewarben, und ließ sich auch
diese nach halb geendigter Trauer von einem wackern Edelmann aus der
Nachbarschaft bereden, daß sie das Jawort gab und also zur andern Ehe
schreiten wollte, wie denn bereits zur hochzeitlichen Feier Anstalt gemacht
wurde. Allein was geschiehet?
Diesem meinem alten guten Freund und Bekannten, dem Doktor
Faust, kommt beides zu Ohren, daß ich nämlich wäre in der Türkei verstorben,
und daß daher meine Ehefrau sich wieder in ein anderes Eheverlöbnis
mit einem von Adel eingelassen hätte; er hatte nun meines
vermeinten Todes wegen mit mir ein großes Mitleiden, zumal daß ich
in so schwerer Dienstbarkeit solle verstorben sein: fordert deswegen seinen
Geist zu sich, fragt ihn, ob dem also wäre, wie die Sage von mir
ginge; ob ich tot oder noch am Leben wäre. Und als er von dem Geist
vernommen, daß ich nicht tot sei, jedoch noch immer in harter Dienstbarkeit
lebe, daraus ich ohne Zweifel so bald nicht würde erlöst werden, befahl
er von Stund an diesem seinem Geist; daß er sich aufmachen, mich
von da erlösen und wieder in mein Vaterland bringen sollte; melches
alsobald Mephistopheles zu leisten zusagte und auch redlich gehalten.
Denn er kam in Fausts Gestalt, eben um die Mitternachtsstunde, da ich
wachend auf der Erde (denn dieses war mein Bett) gelagert war und
mein Elend betrachtete, zu mir hinein, und es war um ihn gar helle; ich
erschrak und fürchtete mich, den Mann recht anzusehen, erkühnte mich
doch dessen einmal, und es dünkte mich, ich sollte diesen Mann zuvor
mehr gesehen haben. Er fing aber mit mir an zu reden, darüber ich mich
erfreute, weil ich ihn für ein Gespenst hielt, und sprach: ,Kennest du deinen
alten Freund, den Doktor Faust, nicht mehr? Wohlauf, du mußt mit
mir und dich nach ausgestandenem Leid wiederum ergötzen. ' Ich kam also
von da schlafend getragen in des Doktor Fausts Behausung nach Wittenberg,
der empfing mich mit Freuden, zeigte mir zugleich an, wie sich
meine Ehefrau bereits vor einem halben Jahr mit einem andern Edelmann
verlobet und am dritten Tage die Hochzeit sein sollte; es wäre demnach
große Zeit, mich eilig bei derselben einzustellen, wie ich denn auch
folgenden Tags getan. Meine Ehefrau erschrak nun zwar bei meiner Am
kunst nicht wenig und wußte nicht, ob ich ihr leibhaftiger Mann oder aber
sein Geist wäre, weil jedermann glaubte, daß ich vorlängst schon der Würmer
Speise worden. Weil ich aber meiner Liebsten genugsame Anzeichen
sehen ließ, obschon die Menge der Trübsale meine Gestalt um ein Merkliches
verändert; ihr auch den ganzen Verlauf meiner fünfjährigen Gefangenschaft
sowie die erfreuliche Erlösung aus derselben erzählte, so fiel
sie mir zu Füßen, bat demütig um Verzeihung, ließ alsbald unser beider
Verwandtschaft berufen und entdeckte ihr meine Wiederankunft, erklärte
auch darauf selbst, daß sie das zweite Verlöbnis für nichtig und ungültig
erkenne. Diesem Ausspruche fiel die ganze Sippschaft bei, und weil der
Edelmann an das Gericht appellierte, so bestätigte denselben auch der
Richter. Eine solche Wohltat nun, ihr Herren, hat mir der gute Doktor
Faustus erzeigt, welche ich ihm die Zeit meines Lebens nicht werde genugsam
verdanken noch rühmen können."
Als einst die erfreuliche Fastnachtszeit herbeigekommen, berief Doktor
Faust etliche Studenten, seine vertrauten Brüder und Freunde, traktierte
sie aufs beste, und dieses währte bis in die Nacht hinein. Obwohl nun für
diesesmal kein Mangel an irgendeinem Getränk erschien, gelüstete doch
den Doktor Faust, eine kurzweilige Fahrt anzustellen, und weil ihm nicht
unbewußt war, daß zu jener Zeit der Keller des Bischofs zu Salzburg mit
den besten und delikatesten Weinen vor andern versehen wär', richtete er
seine Gedanken gleich dahin und eröffnete deswegen solch Vorhaben den
andern mit der Bitte, sie sollten mit ihm in jenen Keller fahren und allda
nur die besten Weine, gleichsam zu einer Ablöschung und Abkühlung, versuchen:
er wolle ihnen für alle Gefahr gutstehen.
Den Herren Studenten ging dieses, weil sie Doktor Faust schon lange
kannten, daß er's nicht bös mit ihnen meinte, desto eher ein; sie ließen
sich leichtlich bereden und waren damit zufrieden. Alsobald führte sie Doktor
Faustus hinab in seinen Garten am Hause, nimmt eine Leiter, setzt
einen jeglichen auf einen Sprossen und fuhr also mit ihnen davon; und
sie kamen gleich nach Mitternacht in dem bischöflichen Keller zu Salzburg
an; da sie denn bald ein Licht schlugen und also ungehindert die besten und
herrlichen Weine auszapften und versuchten. Als sie nun sämtlich fast bei
einer Stunde gutes Mutes waren, lustig einer dem andern auf die Gesundheit
des Bischofs ein Glas nach dem andern zubrachte, siehe da
kommt der Kellermeister und eröffnet ohne an etwas anders zu denken,
die Türe des Kellers; will, weil ihn und seine Gesellen der Durst nicht
schlafen ließ, noch einen Schlaftrunk holen: findet also die nassen Bursche
allda zechen, die an nichts wenigers gedachten, als wie sie einen guten
Rausch so wohlfeilen Kaufs möchten mit sich nehmen. Es war nun beiderseits
Entsetzen und Furcht; der Kellermeister erkühnte sich jedoch letztlich
und schalt sie Diebe, denen ihr Lohn bald werden sollte: wollte auch
gleich zurücklaufen und ein Geschrei machen, daß Diebe vorhanden wären.
Dieses verdroß nun den Doktor Faust gar sehr, und noch mehr, da er sah,
daß seine Mitgesellen gar kleinmütig zu werden begannen wegen der
ihnen drohenden Strafe; er ermahnte sie daher zum eiligen Aufbruch und
befahl, es sollte ein jeder seine Flasche, die er vorher schon mit gutem
Wein gefüllt hatte, mit sich nehmen und die Leiter ergreifen, er aber nahm
den Kellermeister bei dem Haar und fuhr mit allen zugleich davon. Sie
zogen aber (wie nachmals der Kellermeister ausgesagt) aus dem Keller
in die Höhe, und da sie kurz hierauf über einen Wald hinführen, ersah
Doktor Faust einen hohen Tannenbaum; auf diesen nun wurde der vor
Furcht und Schrecken halbtote Kellermeister gesetzt; Faust aber kam mit
seinen Burschen und dem Wein wieder nach Hause, da sie denn erst recht
herumzechten, bis der Tag anbrach.
Wie dem guten Kellermeister indessen, bis der Tag angebrochen, auf
seinem Baum müsse zumut gewesen sein, ist leichtlich zu erachten, zumal
er nicht gewußt, wo und in welcher Gegend er wäre, dazu schier erfroren
war: als aber der sehnlich verlangte Morgen anbrach und er nun augen-
scheinlich sah, daß er ohne Lebensgefahr nicht von dem hohen Baum kommen
würde, rief er ohne Unterlaß mit heller Stimme so lang und viel,
bis zwei vorübergehende Bauern, welche in die Stadt gehen und etwas
von Schmalz und Käse verkaufen wollten, solches vernahmen und also mit
höchster Verwunderung diesen Vogel in den Tannenzweigen pfeifen hörten
. Die Bauern, weil der Kellermeister ihnen eine gute Verehrung zu
geben versprach, eilten desto mehr der Stadt zu, wo sie solches verkündigten
, bis sie letztlich gar nach Hofe kamen, allwo sie denn zuerst keinen
Glauben fanden, bis man ihnen wegen der Abwesenheit des Kellermeisters
, auch der noch halb geschlossenen Tür im Keller, Glauben geben
mußte; weswegen eine große Menge Volks sich aus der Stadt mit den
Bauern dorthin verfügte, wo der Kellermeister saß, welcher denn mit
großer Mühe und Arbeit herabgebracht werden mußte. Sosehr man aber
mit Fragen ihm zusetzte, so vermochte er doch nicht zu sagen, wer die Diebe
gewesen, so er im Keller angetroffen, noch denjenigen zu nennen, der ihn
auf den Baum geführt und in solcher Gefahr daselbst gelassen hatte.
Es verfügten sich auch genannte Studenten in der Fastnacht am Dienstag
in des Doktor Faust Behausung und hatten sämtlich sich vorgenommen,
der Zeit das Recht zu tun und die Fastnacht in aller erdenklichen
Lust und Freude zu halten; wozu denn ihnen ohne allen Zweifel Doktor
Faustus jeglichen Vorschub tun würde; denn sie wußten wohl, daß er gar
freigebig war, wenn er nur selbst hatte, und sich freute, wenn jemand
in solchem Vorhaben zu ihm kam: allein sie wurden in ihrer Meinung
gar sehr betrogen, weil sie bei dem Nachtessen nichts anders als eine
Schüssel mit gesottenem Rindfleisch, auch keinen Wein sahen, ja gar
nichts, was man sonst bei solcher Fastnachtszeit Gutes zu speisen und den
Gästen aufzutragen pflegte. Es sah immer einer den andern an und konnten
nicht begreifen, wie solches gemeint wäre, gedachten aber wohl, daß
es Doktor Faust auf eine Schalkheit abgesehen habe, welches auch bald
sich auswies. Denn er ließ kurz hierauf den Tisch aufheben, einen neuen
bereiten und sprach zu ihnen: "Ihr, meine lieben Herren und angenehmen
Gäste, ich bitte, ihr wollet mir zugut halten, daß ich euch zum Nachtessen
nicht bessere Gerichte hab ' lassen vortragen, nichts anders als ein Stück
Rindfleisch und einen schlechten Trunk; das ist aber die Ursache gewesen,
daß dieses von dem Meinigen und aus meinem Beutel gegangen. Nun
aber wollen wir erst recht lustig sein und die liebe Fastnacht einweihen
und der Gebühr nach halten, und dieses soll nicht aus meinem Beutel
gehen, sondern, weil jetzund zu dieser Zeit große Potentaten und Herren
Gastereien und herrliche Mahle halten, also will ich meinen Teil auch
dabei haben, es sei ihnen lieb oder leid." Darauf stellte Doktor gauss
drei Flaschen, eine zu fünf, die zwei andern jede zu acht Maß in seinen
Garten und befahl seinem Geist Mephistopheles, daß er darein ungarischen,
welschen und spanischen Wein füllen solle; desgleichen setzte er fünf
platte Schüsseln hinaus, darin brachte der Geist nach etwa einer halben
Stunde Wildbret und Gebratenes noch fein warm herein: also setzten sie
sich sämtlich zu Tische, und sprach ihnen Doktor Faustus zu, sie sollten
fröhlich und guter Dinge sein; denn es sei keine Verblendung, sondern
seien recht natürliche Speisen und Getränke, wie sie es denn auch gefunden
haben; denn sie verfuhren mit Wein und Speisen dergestalt, daß nicht
viel von allem übergelassen wurde und sie ganz toll und voll fast gegen
den Tag erst nach Hause gegangen.
Am folgenden Aschermitwoch, als der rechten Fastnacht, kamen diese
guten Brüder abermal zu Doktor Faust, gaben vor, sie müßten der Zeit
ihr Recht tun und also wiederanfangen, wo sie es gestern gelassen hätten;
und weil Doktor Faust sich recht fröhlich noch einmal erzeigen wollte,
ließ er den Tisch decken, mit Bitte vorliebzunehmen, was man auftragen
würde. Nebst zwei Braten wurde auch in die Mitte ein schöner, großer
gebratener Kalbskopf aufgesetzt und der Studenten einer gebeten, solchen
zu zerlegen. Als aber dieser das Messer ansetzte, fing der Kalbskopf mit
lauter Stimme an zu rufen: "Mordio, Helfio, Auweh, was hab ' ich dir
getan!"daß die Studenten recht von Herzen darüber erschraken; weil sie
aber sahen, daß Doktor Faust schier vor Lachen ersticken wollte, konnten
sie bald erraten, wie es damit beschaffen sein müsse, und lachten deswegen
auch mit.
Indessen fing Doktor Faust sein Gaukelspiel an, die Gemüter seiner
Gäste zu erlustigen: erstlich hörten sie in der Stube allerhand musikalische
Instrumente, da man doch nicht sehen noch wahrnehmen konnte, wo es
herkäme; ja, sobald ein Instrument aufgehört; kam ein anderes; wenn
dann die Violin' etwa einen lustigen Tanz machte, da sprangen und
hüpften die Gläser und Becher auf dem Tisch, und so einer oder der andere
den Becher, damit der Wein, seiner Meinung nach, nicht verschüttet
würde, mit der Hand festhalten wollte, mußte er auch mithüpfen, so daß
ein großes Gelächter entstand. Nach solcher Kurzweil nahm Doktor Faustus
zehn irdene Häfen, die stellte er mitten in die Stube: da buben die
an zu tanzen und aneinander zu stoßen, daß sie in Stücke verbrachen.
Zum dritten ließ er einen Haushahn im Hofe fangen, den stellte er auf
den Tisch; als er ihm aber zu trinken gab, hub er an, ganz natürlich
zu pfeifen und Tänze zu machen. Darnach richtete Doktor Faust wieder
eine Kurzweil an und legte eine Harfe auf den Tisch; da kam ein alter
Aff ' in die Stube herein, der machte viel gute Possen darauf und tanzte
dazu sehr zierlich.
Weil nun mit solchen und andern Späßen etliche Stunden von dem
Mittag an verlaufen, die Zeit aber zum Abendessen bereits vorhanden
war, so wurden sie zu solchem berufen, da doch der Gäste keinen hungerte,
außer daß zwei oder drei nach einem Gerichte Vögel gelüstete: da nahm
Doktor Faust eine Stange, die reichte er zum Fenster hinaus, pfiff zugleich
aus einem Pfeiflein; alsbald kamen viele Trofteln und Krammetsvögel
hergeflogen, welche auf die Stange saßen, und die mußten bleiben;
; diese nahm er denn herein, und die Studenten halfen solche würgen

und rupfen, der Famulus aber briet sie. Nach dem Nachtessen, und als
die Küchlein aufgetragen, beschlossen sie, daß sie miteinander in die
Mummerei gehen wollten, wie denn gebräuchlich war, und zog ein jeder
auf Geheiß Doktor Fausts ein weißes Hemd an: als aber die Studenten
einander ansahen, bedünkte einen jeden, er habe keinen Kopf; gingen
also miteinander in etliche vornehme Häuser, Fastnachtküchlein zu holen;
darob denn die Leute sehr erschraken: nachdem man aber solche Gäste,
der Gewohnheit nach, zu Tische gesetzet, hatten sie ihre erste Gestalt wieder
, und man kannte sie; bald aber wurden sie abermal verändert und
bekamen rechte Eselsohren, großmächtige Nasen u. s. f. Das trieben sie
bis in die Mitternacht hinein, da sie dann voll und toll nach Hause
zogen.
Als am Donnerstag, den folgenden Tag, Doktor Faust noch immer
seine Fastnacht hielt und die Studenten wieder beieinander versammelt
waren, traktierte er sie wie des vorigen Tags, fing auch seine Gaukelei
wieder an, und so kamen in die Stube herein dreizehn Affen; diese gaukelten
so wunderbarlich, daß dergleichen nie gesehen worden: denn sie
sprangen immer einer auf den andern und tanzten darnach in einer Reihe
um den Tisch herum, dann sprangen sie zum Fenster hinaus und verschwanden.
Weil es aber damals fast den ganzen Tag über geschneit hatte und
also ein dicker Schnee lag, rüstete Doktor Faust mit Zauberei einen schönen,
großen Schlitten zu; der hatte eine Gestalt wie ein Drache, auf dessen
Haupt saß Faust selber und mitteninnen die Studenten; dabei waren
vier Affen, auf dem Schwanz des Drachen sitzend, die gaukelten aufeinander,
ganz lustig zu sehen, unter welchen einer auf der Schalmei
pfiff; der Schlitten aber lief von sich selbst, wohin sie wollten; dies währte
lang in die Nacht hinein mit solchem Klappern, daß einer vor dem andern
nicht hören konnte, und sie gedachten sämtlich, sie hätten in der Luft gewandelt.
***Doktor Faustus verbrachte indessen, je näher das Ende seines Bündnisses
herzunahete, je mehr und mehr nach Sankt Epikurs Regel ein
rohes, sicheres und wüstes Leben, daß er das tägliche Vollsaufen, Spielen
und Buhlen für seine höchste Ergötzlichkeit hielt. Er sah aber zu dieser
Zeit in seiner Nachbarschaft eine schöne, doch arme Dirne, welche vom
Land herein in die Stadt gekommen und sich in Dienste bei einem Krämer
begeben hatte; diese gefiel nun Doktor Faust über die Maßen wohl, daß
er nach ihr auf allerlei Weise und Wege trachtete und sie zu eigen haben
wollte. Die Jungfrau aber wollte niemals, was man ihr auch versprechen
mochte, in seinen sündlichen Willen sich fügen, sondern sie blieb ehrlich
und wollte nur von der Ehe hören. Dazu rieten dem verliebten Faustus
denn endlich auch seine guten Brüder und Freunde: der Geist Mephistopheles
aber, als er dieses vermerkte, sprach unverzüglich zu Doktor Faust,
was er nunmehr, da die versprochenen Jahre bald zu Ende sein würden,
aus sich selbst machen wolle. Er solle gedenken an seine Zusage und sein
Versprechen, zudem, so könne er sich in keinen Ehestand einlassen, dieweil
er nicht zwei Herren zugleich dienen könne: "Denn der Ehestand ist
ein Werk des Höchsten, den wir Teufel aufs höchste hassen und verfolgen.
Derohalben, Fauste, siehe dich vor: wirst du dich versprechen zu
verehelichen, so sollst du gewiß von uns zu kleinen Stücken zerrissen werden.
Denke doch bei dir selbst, wie der Ehestand eine so große und schwere
Last auf sich hat, und was jederzeit für Unlust daraus ist entstanden,

Unruhe, Widerwillen, Zorn, Neid, Uneinigkeit, Sorge, Zerstörung der
fröhlichen Herzen und Gemüter, und was dessen mehr ist."
Dem allen gedachte zwar Doktor Faustus eine Weile nach, er wollte
aber doch auf seiner Meinung verharren, wendete auch das Rauhe heraus
und sagte dem Geist: "Kurzum, ich will mich verehelichen, es folge gleich
daraus, was da wolle", gehet damit hinweg und in seine obere Stube.
Was folgte aber hierauf? Alsbald gehet ein großer Sturmwind seinem
Hause zu, als wollte er's zugrunde werfen; es sprangen inwendig alle
Angel der Türen auf, und ward das Haus voller Feuer. Doktor Faust lief
die Stiege hinab, wollte die Haustüre suchen und davonlaufen, da erhaschet
ihn ein Mann, der warf ihn zurück wie ein' Ballen in die Stube
hinein, daß er weder Hände noch Füße regen konnte; um ihn her ging
allenthalben Feuer auf, gleich als ob er jetzt verbrennen sollte; er schrie
in diesen Nöten zu seinem Geist um Hilfe, er sollte die Gefahr nur diesmal
von ihm abwenden; dann wolle er versprechen, hinfort in allem
nach seinem Willen zu leben.
Da erschien ihm der Fürst Luzifer ganz schrecklich und leibhaftig, so
grausam anzusehen, daß Faust auch seine Augen vor ihm zuhielt und
seines elenden Endes gewärtig war. Darauf ließ sich Luzifer also vernehmen:
"Sage nun an, wes Sinnes bist du?" Doktor Faustus, ganz
kleinmütig und erschrocken, auch mit zugetanen Augen, antwortet: "Oh,
du gewaltiger Fürst dieser Welt, verlängere mir meine Taget Du siehest,
daß ich ein verkehrtes, wankelmütiges Menschenherz habe, daß ich auf
andere Gedanken, welche dir zuwider sind, gefallen bin, hab ' aber das
Werk noch nicht erfüllt; deswegen bitte ich dich, du wollest noch zur Zeit
nicht Hand an mich legen; ich kann bald andern Sinnes werden." Der
Satan gab hierauf die Antwort mit kurzen Worten: "Wohlan, siehe zu,
daß dem also sein möge, und beharre darauf, das sage ich dir bei meiner
Gewalt", und also verschwand er samt dem Feuer.
***Damit nun der elende Doktor gauss seinen Lüsten genugsamen Raum
sehen und er also des Verheiratens ganz und gar vergessen möchte, gibt
ihm der Satan den Gedanken ein, wie er doch die schöne Helena aus
Griechenland, von welcher noch heutigestags die Welt so viel zu sagen
weiß, nicht allein sehen, sondern gar zu einer Liebsten bekommen möchte.
Eines Morgens frühe forderte er deswegen seinen Geist zu sich und entdeckte
ihm sein Vorhaben mit der Bitte, es dahin zu bringen, daß hinfüro
die schöne Helena, Königs Menelaus ' Gemahlin, um welcher willen
die herrliche Stadt Troja zugrunde gegangen, in ebender Gestalt, wie sie
im Leben gewesen, sein eigen werden möchte: welches denn der Geist zu
tun versprach.
Des andern Tags meldet Mephistopheles dem Doktor Faust an, daß
er nun seinem Begehren ein Genüge zu tun bereit wäre und ihm die
schönste Griechin selbiger Zeit herbeischaffen wollte, mit welcher er die
folgende Zeit seines Lebens in aller Ergötzlichkeit zubringen möchte: und
folgte ihm also die Königin auf dem Fuße nach, so wunderschön, daß Doktor
Faust nicht wußte, ob er bei sich selbst wäre oder nicht. Diese Helena
erschien denn in einem köstlichen Purpurkleid, ihr Haar hatte sie herab
hängen, welches herrlich goldfarb schien, auch so lang war, daß es ihr bis
in die Kniebeuge herabhing, mit schönen, kohlschwarzen Augen, holdseligem
Angesicht und lieblichen Wangen; sie war eine schöne, länglichte,
gerade Gestalt; und war kein Tadel an ihr zu finden. Als nun Doktor
Faustus solches alles sah und wohl betrachtete, hat diese verzauberte Helena
ihm das Herz dermaßen eingenommen und gefangen, daß er zur
Stunde in heftiger Liebe gegen sie entzündet wurde und mit ihr bald
anfing zu scherzen, ja nachgehends sie wie sein eigenes Weib hielt und
sie so liebgewann, daß er schier keinen Augenblick von ihr sein konnte
noch wollte und also dabei alles Verehelichens vergaß. Etliche Monate
strichen indessen vorbei, als ihm einst von ihr berichtet wurde, daß sie
ihm ein Kind gebären würde. Faust hielt dieses für unmöglich; denn er
wußte ja, daß sie keine natürliche leibhafte Person wäre.

Nachdem er aber gesehen, daß sie fast zu Ende des Jahrs von Geburtsschmerzen
überfallen wurde, auch bald darauf eines Sohns genesen,
erfreute er sich höchlich darüber und nannte ihn Justus Faust. Welcher
aber hernach, nach seines Vaters elendem Tode, zugleich mit seiner vermeinten
Mutter verschwunden.
III.
Oben ist erzählt worden, wie Doktor Faustus einen jungen Menschen
der damals um Brot sang, jedoch eines fähigen, verschmitzten Kopfes
war, mit Namen Christoph Wagner, zu einem Famulus angenommen,
dem er auch, weil er seine Verschwiegenheit mehr als einmal erfahren,
seine meisten heimlichen Sachen, Schriften und Bücher nach der Zeit
anvertraute; und weil jener sich allewege wohl in seines Herrn Kopf zu
schicken wußte, ja zu dieser und jener Schalkheit seinem Herrn treulich
half, hat ihn dieser sein Herr sehr geliebt und ihn als seinen Sohn gehalten
.
Als sich nun die Zeit mit dem Doktor Faust ändern wollte, weil bald
das vierundzwanzigste Jahr seiner Verschreibung zu Ende ging, berief er
einen bekannten Notarius, daneben etliche gute Freunde aus den Herrn
Studenten und vermachte in deren Gegenwart seinem Famulus Wagner
Haus und Garten bei dem Eisentor in der Schergasse an der Ringmauer:
item, was an Barschaft, liegender und fahrender, an Hausrat, silbernen
Bechern, Büchern u. s. f. da war. Nachdem nun das Testament aufgerichtet
und bekräftiget worden, berief er nochmal seinen Famulus
zu sich, hielt ihm vor, wie er ihn in seinem Testament wohlbedacht hätte,
dieweil er sich, solang er nun bei ihm gewesen, wohlverhalten und sonderlich
seine Heimlichkeit nicht geoffenbaret hätte. Jedoch solle er noch
überdies von ihm etwas bitten, er wolle ihm's gewiß nicht abschlagen.
Da begehrte der Famulus seines Herrn Kunst und Geschicklichkeit, und
daß er ein solches Leben, wie Doktor Faustus geführt, auch zu führen
möchte in den Stand gesetzt werden. Darauf antwortete ihm Doktor Faustus:
"Wohlan, lieber Sohn, ich habe viel Bücher und Schriften, die ich
mit Mühe und großem Fleiß zusammengebracht, diese nimm in acht, doch
behalte sie bei dir und schaffe damit deinen Nutzen, studiere fleißig darin,
so wirst du außer allem Zweifel das lernen und bekommen, was ich habe
gekonnt und zuwege gebracht. Denn diese nekromantischen Bücher und
Schriften sind nicht zu verwerfen, sondern in hohem Wert zu halten,
obschon die Geistlichen solche verwerfen und nennen sie die Schwarzkunst
und Zauberei, ein Teufelswerk: daran kehre du dich nicht, mein
Sohn, brauche dich der Welt und laß die Schrift fahren. Denn die Nekromantie
ist eine hohe Weisheit und ist im Anfang der Welt aufgekommen,
ja, nur von den Allergelehrtesten getrieben und geübt worden, die
auch dadurch bei aller Welt in großes Ansehen gekommen sind; forsche
nur fleißig darin, die werden dich schon unterrichten, wie du auch zu
solcher Kunst kommen und gelangen mögest. Darnach sollst du, mein
lieber Sohn, wissen, weil meine versprochene vierundzwanzig Jahre nach
weniger Zeit werden zu Ende gelaufen sein, daß alsdann mein Geist Mephistopheles
mir weiter zu dienen nicht schuldig ist; derohalben kann ich
auch dir solchen nicht verschaffen, wie gern ich's gleich täte; jedoch will
ich dir einen andern Geist, so du einen verlangest, zuordnen: halte dich
nur nach meinem Tod fein bescheiden, sei verschwiegen und still, und ob
man schon bei dir meine hinterlassene Zauberbücher und Schriften von
Obrigkeits wegen suchen wollte, so werden doch alle diejenigen, die solche
zu suchen gesendet werden, also verblendet werden, daß sie deren keines
nimmer finden."
Nach dreien Tagen fragte Doktor Faust seinen Famulus, den Wagner,
ob er noch willens wäre, einen Geist zu haben, der um und bei ihm
wohnen sollte, und in welcher Gestalt er ihn gern haben möchte. Wagner
antwortet hierauf mit Ja: "Mein Verlangen", spricht er, "ist nach einem
sittsamen und unbetrüglichen Geist; auch daß er die Gestalt eines Affen
an sich haben möchte.""Wohlan", sprach Doktor Faustus, "so sollst du
den bald sehen."
Zur Stund erschien ein Affe mittlerer Größe, der sprang behende zur
Stube herein; da sprach Doktor Faust zu dem Famulus: "Siehe, da hast
du ihn, nimm ihn hin, doch wird er dir noch zur Zeit nicht zu Willen
werden, bis erst nach meinem Tod, und diesem gib den Namen Auerhahn;
denn also heißet er. Daneben bitte ich dich, daß du meine Kunst, Taten
und wunderliche Abenteuer, die ich bisher getrieben, wollest fleißig aufzeichnen,
sie zusammenschreiben und in eine Historie bringen, dazu denn
dir dein Geist Auerhahn treulich helfen wird: was du etwa vergessen haben
möchtest, dessen wird er dich fleißig erinnern und in allem dir behilfliche
Hand leisten. Allein offenbare solches eher nicht denn nach meinem
Tod; ich weiß gar wohl, daß man meine Geschichten und Taten von
dir allerortenher wird haben wollen."
Doktor Faustus konnte leichtlich erachten, daß seine Abenteuer nach
seinem Tod beschrieben und der Nachwelt überlassen würden, wodurch er
denn einigermaßen in seiner Betrübnis wegen seines herannahenden erbärmlichen
Endes getröstet wurde, daß er also doch einen Namen möchte
überkommen. Solchen noch ansehnlicher zu machen, berief er seine
Freunde, etliche Studenten: denen prophezeite er in Kraft seines Geistes
von allerlei Veränderungen in geist- und weltlichen Ständen, welche
inskünftig, nach seinem Tode, geschehen würden.
Solche Prophezeiung haben sie fleißig und mit Verwunderung angehöret,
auch durch den Famulus Doktor Fausti von Wort zu Wort aufschreiben
lassen, wie sie dieselbe denn auch hernach unter sich ausgeteilt
und an andere Orte verschickt haben.
***Die Glocke war nun einmal gegossen, und das Stundenglas Doktor
Fausts lief nunmehr aus; denn er hatte nur noch einen Monat vor sich,
nach welchem seine vierundzwanzig Jahre zu Ende waren. Über dieser
Rechnung brach ihm der bittere Angstchweiß aus, und war ihm alle
Stund und Augenblick gleich als einem Mörder, der der Strafe des
Todes, die ihm bereits in dem Gefängnis ist angekündigt worden, gewärtig
sein muß: indem er nun solches beherzigte, gehet seine Stubentür auf,
und tritt herein Luzifer in selbsteigner Person, so ganz schwarz und zottig,

gleich als ein Bär, der erhub seine gräßliche Stimme und sprach zu ihm:
"Fauste; du weißt dich noch wohl zu erinnern, wie verstockt, ehrgeizig, auch
gottesvergessen du im Anfang gewesen, und hast dich an Gottes Gaben
nicht lassen begnügen, sondern hifi oben hinausgefahren, hast mir auch
keine Ruhe gelassen, bis du mich beschworest; dir in allem zu Willen zu
sein; da mußt du nun selbst sagen und bekennen, daß solches dein Begehren
dir durch mich ganz reichlich sei erfüllet worden, ja, daß ich dir
ganz keinen Mangel gelassen, alle Wollust nach deines Herzens Begierde
dir verschafft habe; ich bin dir in aller Gefährlichkeit beigestanden, du
hast mehr gesehen und erfahren, denn je einer erfahren hat: ich habe
dich hervorgezogen bei männiglich, hohen und niedern Standes, daß du
allenthalben wert und angenehm warest, das alles mußt du selbst sagen
und bekennen. Weil nun aber deine bestimmte Zeit der vierundzwanzig
Jahre bald wird aus sein, wo ich mein Pfand nehmen und holen will,
also kündige ich anjetzo dir meinen Dienst auf, den ich dir doch jederzeit
treulich habe geleistet; so halte du mir auch treulich, was du mir versprochen
hast. Dein Leib und Seele ist nun mein, darein gib dich nur
willig; und ob du schon wolltest hierüber unwillig werden, so beschwerest
und kränkest du nur dein Herz desto mehr. Und so lade ich dich denn vor
das Gericht Gottes, da gib du Rede und Antwort; weil ich an deiner
Verdammnis nicht schuld habe; und wenn die bestimmte Zeit sich wird
verlaufen haben, will ich mein Pfand hinwegnehmen und holen."
Doktor Faustus konnte vor Schrecken und Herzensbangigkeit nicht wissen
, wo er daheim wäre; und als er wieder zu sich kam, hub er mit leiser
Stimme, als ein verzweifelter Mensch, an zu reden und sprach: "Ich
hab ' solches alles gefürchtet, also wird es mir auch gehen; ach, ich bin
verloren, meine Sünden sind größer, denn daß sie mir könnten vergeben
werden." Als nun inzwischen der Teufel verschwunden und sein Famulus,
der Wagner, solches alles gesehen und mit angehört hatte, sagte dieser
zu seinem Herrn, er sollte nicht so kleinmütig sein und verzagen, es wäre
noch wohl Hilfe da; er sollte seine vertrauten Freunde, die um ihn schon
eine geraume Zeit gewesen, beschicken, ihnen die Sache, wie sie wäre, entdecken,
damit er von ihnen, oder so sie nach Bedarf in der Stille einen
gelehrten Magister mitbrächten, Trost aus der Heiligen Schrift haben und
nehmen möchte, und, ob ja der Leib müßte eingebüßt werden, die Seele
wenigstens erhalten würde. Dem antwortete der geängstigte Doktor Faustus
bitterlich weinend und sprach: "Ach, was hab ' ich getan, wohin hab '
ich gedacht, daß ich wegen einer so kurzen Zeit, gleich als wegen eines
Augenblicks, die Seligkeit habe verscherzt, da ich doch vielleicht auch mit
adern Auserwählten der Himmelsfreude hätte genießen können! Wie
hab ' ich doch so schändlich von wegen einer so kurzwährenden Wollust der
Welt die unaussprechliche Herrlichkeit der ewigen Freude verscherzte Es
ist nunmit aus." Und so wollte der elende Mensch verzweifeln, jedoch richtete
ihn aufs möglichste sein Famulus auf und getröstete sich des bald
ankommenden Beistandes der Studenten.
Als nun der Famulus zu einem und andern von den Studenten gegangen,
ihnen in höchster Stille den ganzen Handel erzählt, sind sie darüber
von Herzen erschrocken, und hat keiner sich mehr zu Doktor Faust verfügen
wollen, damit ihnen nicht auch ein Abenteuer begegne; denn sie
wußten wohl, daß mit dem Teufel nicht zu scherzen wäre. Der Famulus
aber hielt inständig an; damit nun der trostlose Doktor Faustus nicht gar
ohne Trost gelassen würde, nahmen sie zu sich einen gelehrten Geistlichen,
dem sie alles offenbarten, und baten ihn, daß er dem Doktor Faust, von
welchem sie etliche Jahre her viel Freundschaft genossen hätten, recht
gründlich aus der Heiligen Schrift zusprechen und also dem Teufel begegnen
möchte. Da diese nun, miteinander kommend, den Doktor Faust in
der Stube auf seinem Sessel sitzend sahen, wo er wie ein wilder Stier sie
ansah, die Hände zusammendrückte und oft seufzte, hatten sie alle ein herzliches
Mitleiden mit ihm, und nachdem sie Sitze genommen, sprach der
Magister zu ihm, er solle solche Schwermüthigkeit seines Herzens ablegen,
es wäre ihm noch wohl zu helfen und zu raten; er solle nur mit festem
Glauben und Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und Christi teures
Verdienst hoffen und also dem Satan Widerstand tun, weil Gott ja niemand
ausschließe, sondern wolle, daß eben allen Menschen geholfen werde.
Und sprach ferner zu ihm, er solle sich fein vor Gottes Angesicht demütigen
, sich für einen armen, großen Sünder bekennen und herzliche wahre
Reue über die begangenen Sünden zeigen, und wenn denn gleich der Teufel
käme: "Wie er gewißlich nicht lang außenbleiben wird, und Euch, Herr
Doktor, anklaget und spricht: ,Siehe, Fauste, du bist ein gar großer Sünder,
du hast es mit deinen mutwilligen Sünden gar zu grob gemacht,
darum mußt du verdammt sein und bleiben '; so begegnet ihm und antwortet
getrost: Ja Satan, ebendarum daß du mich für einen so großen Sünder
anklagest und kurzum verdammen willst, will ich nicht verdammt,
sondern vielmehr selig werden; denn ich halte mich an Christum, der sich
selbs für meine und der Welt Sünde dargeboten hat; darum wirst du,
Satan, hier nichts ausrichten, wenn du mir die Menge und Größe meiner
Sünden so genau vorhältst, mich damit zu schrecken und in Verzweiflung
zu stürzen. Denn eben mit dem, was du sagst, wie ich ein allzugroßer
Sünder sei, gibst du mir Waffen und Schwert in die Hand, womit ich dich
gewaltig überwinden und alle deine Streiche vernichten will. Denn kannst
du mir vorhalten, daß ich ein großer Sünder bin und Gott schwer und hoch
beleidiget habe, so kann ich dir hinwiederum sagen, daß Christus für die
Sünder gestorben ist, ja, der ganzen Welt Sünde, also auch die meinige;
auf sich geladen hat: denn der Herr hat alle unsere Sünden und Ungerechtigkeit
auf ihn gelegt und um der Sünde willen, die sein Volk getan, hat
er ihn geschlagen; wie geschrieben stehet bei dem Propheten Esaja im dreiundfünfzigsten
Kapitel.'"
Diese und andere Tröstungen mehr hielt der Geistliche dem Doktor
Faust fleißig vor, mit Anführung anderer Sprüche mehr, aus dem Alten
und Neuen Testament; sonderlich stellte er ihm die Eggel der verrufensten
Sünder, welche doch auf ihre Reue wieder bei Gott zu Gnaden gekommen
, beweglichst vor: wofür ihm denn Doktor Faust fleißig dankte,
mit der Zusage, daß er dem allen wolle nachkommen, sich damit zu trösten;
zugleich bat er, daß der Magister und die andern Herren öfters einkehren
möchten, ihn zu trösten, wo es anders bei ihm noch möglich wäre.
***Als Doktor Faustus also wiederum in seinem Herzen Trost gefunden in
Erwägung der treuherzigen Vermahnung aus Gottes Wort, legte er sich
damit zur Ruhe nieder, und sein Famulus blieb bei ihm in der Kammer.
Indem kommt der Teufel zu ihm vor das Bett, schlug gleich anfangs ein
großes Gelächter auf und sagte mit lauter Stimme: "Mein Fauste; bist
du einmal fromm geworden, ei, so beharre darauf, schaue nur zu, was
deine Frömmigkeit dir helfen werde! Lieber, ziehe zu solcher deiner Frömmigkeit
eine Mönchskappe an und tue stets Buße, es wird dir wohl not
sein; denn du hast es zu grob gemacht, und deiner Sünden sind mehr als
der Sandkörnlein am Meer. Lieber, wie magst du dich der Seligkeit trösten,
der du aller Sünden, Büberei und Schalkheit voll bist? Willst dich
trösten der Zuversicht auf Christum, so du doch jederzeit diesen gelästert
hast: stelle gleich alle Zuversicht zu Gott, so wirst du dennoch verdammt
und fährst hinunter in die Hölle, das ist dein rechter Lohn, und warten
bereits viel Teufel auf dich; wo bleibet deine Hoffnung auf Gott? Du
heuchelst dir selber und dichtest dir eine nichtige Hoffnung; während doch
alles umsonst und vergebens ist, es wird nichts daraus, hoffe, solang du
willst. Kannst du dich auch deiner guten Werke rühmen? Linksum, es ist
zu spät mit deiner Buße. —Noch eines, Fauste, sage mir die Wahrheit:
was gilt s, es ficht dich deine Seligkeit nicht so viel an, als wenn du bedenkest,
daß du bald sterben mußt und mußt die angenehme Wohnung der
Welt verlassen und mußt verlassen gute Freunde und Gesellen: sollte es
dich nicht betrüben und bekümmern, daß du von hinnen scheiden sollst?
Sage, ist dem nicht also?"
Doktor Faustus schwieg still und gab darauf keine Antwort, brachte die
Nacht zu mit schwermütigen Gedanken, und als es Tag ward, befahl er
seinem Famulus, daß er den Geistlichen wieder mit sich brächte, welcher
denn bald mit zwei Studenten kam. Als ihm nun Doktor Faustus, nachdem
sie Sitze genommen, angesagt, was der Teufel in der vergangenen
Nacht für ein Gespräch mit ihm gehabt, antwortete der Geistliche: "Ja,
es ist wahr, der Teufel kann solche Stücke hervorbringen und will sich helfen.
Wenn er denn wieder zu Euch kommt, so sprecht getrost: ,Hörest du,
Satan, diese und jene Beschwerungen, meiner Seligkeit halber, hast du
mir vorgehalten; ich bekenne, daß ich ein armer Sünder bin, daß ich ein
schwer gefallener Sünder bin, aber die Barmherzigkeit Gottes, so er durch
die Liebe seines Sohnes über alle hat reichlich ausgeschüttet, ist weit größer.
Gott hat nie einen Sünder verstoßen, der ernstliche Buße getan hat,
auch in der Stunde seines Todes nicht, wie den Schächer am Kreuz. So
hab ' ich auch einen guten Herrn, einen solchen Richter, dem wohl abzubitten
ist, einen getreuen Fürsprecher, Jesum Christum, den Seligmacher,
der wird mich vertreten bei seinem himmlischen Vater. Und daß du mir
die Verdammnis vorwirfst, das ist bei dir nichts Neues, das ist dein altes
Liedlein; du hifi ein Lästermaul und kein Richter, ein Verdammter und
kein Verdammer. Du wirfst mir auch meine bösen Werke vor: das bekenne
ich, daß nichts Gutes um und an mir ist, aber von meiner Ungerechtigkeit
fliehe ich zu meinem Gerechtmacher Jesu Christo, ja zu meinem
Gnadenthron; in seine Hände und Barmherzigkeit befehle ich meine
Seele. ' Und darum, mein Herr Doktor Faust", sagte endlich der Geistliche,
"seid ohne Sorge, und wenn der Teufel mit Disputieren wieder an
Euch will, so haltet ihm mit dem Wort Gottes diese Streiche auf."
Doktor Faustus hatte nun etliche Tage lang Ruhe vor dem Teufel; einst
aber zur Nachtzeit kam ihn in dem Bette eine Angst an, daß er nicht wußte,
wo er bleiben sollte: es kamen ihm allerhand verzweifelte Gedanken in
das Herz (ohne Zweifel aus Eingeben des bösen Geistes) als: "Es wird
doch damit nichts sein, daß Gott mir sollte barmherzig und gnädig werden
, ich hab ' es allzugrob gemacht mit meinen Sünden: Gott kann nicht
gleich Sünde vergeben, wie wir meinen, es ist zu spät mit meiner Buße
und Bekehrung; komme ich zur Vergebung meiner Sünde und zur Gnade
Gottes, so werden gewiß auch die Teufel selig, zumal ich ja nicht geringere
Stücke getan, denn was die Teufel selbst tun: zudem so ist das Büßen ja
nicht wohl möglich, weil ich Gott meinen Schöpfer hab ' aufgegeben und
alles himmlische Heer; denen habe ich abgesagt, dagegen mich versprochen,
daß ich dem Teufel eigen sein wolle mit Leib und Seel; dies ist nun
eine Sünde gegen den Heiligen Geist, die nimmermehr kann und mag vergeben
werden; darum kann ich nicht glauben, daß ich bei Gott wieder zu
Gnaden könne kommen."
Mit solchen verzweifelten Gedanken schleppte er sich die ganze Nacht,
und als er früh aufstand, schickte er zum drittenmal nach dem Geistlichen,
meldete ihm, sobald er in die Stube getreten, die Ursache solches frühen
Berufene und sprach: "ES ist mir leid, daß ich Euch, Herr Magister, so
viel bemühe; denn ich besorge, daß keine Hilfe noch Rat bei mir wird statthaben
, daß ich doch verdammt sein und bleiben werde." Der Geistliche,
von Herzen erschrocken, erinnerte ihn viel aus der Heiligen Schrift, legte
ihm nochmals die Exempel derer vor die Augen, welche Gott, obgleich sie
sich schon schwer versündiget, wieder zu Gnaden angenommen; solche verzweifelte
Gedanken, sagte er, wären lauter giftige Pfeile des leidigen Teufels:
"Solchergestalt hat er Euch gleichsam Tür und Tor zur Verzweiflung
aufgetan; wo Ihr nun diesen unseligen Gedanken Raum gebet, so
stehet die ewige Verdammnis und Hölle für Euch schon offen. Darum beileibe
nicht also, verbannet vielmehr solche Gedanken aus Eurem Herzen
und lasset solche bei Euch nicht einwurzeln; denn sie rühren vom Teufel
her, der machet Euer Herz betrübt und ängstiget es, gleich als hättet Ihr
einen unerbittlichen Gott. Demnach, wenn solche Gedanken bei Euch aufsteigen,
, als wolle sich Gott Euer nimmer erbarmen, so sprecht: ,Teufel,
siehe, kommst du abermals Ich hab ' forthin nichts mehr mit dir zu schaffen;
; denn Gott betrübet nicht, schrecket nicht, tötet nicht, sondern ist ein
Gott der Lebendigen, hat auch seinen eingebornen Sohn in diese Welt gesandt
, daß er die Sünder nicht schrecken, sondern trösten solle; auch ist
Christus darum gestorben und wiederauferstanden, daß er des Teufels
Werk zerstörete, ein Herr darüber würde und uns lebendig machte. ' Derohalben
sollet Ihr in solcher Schwermut und Anfechtung einen Mut fassen
und gedenken: ,Ich bin forthin nicht mehr eines Menschen, viel weniger
des Teufels, sondern Gottes Kind durch den Glauben an Christum, in
welches Namen ich mich meiner heiligen Taufe erinnere: ich hab ' mir gicht
Leib und Seele gegeben, sondern der allmächtige Schöpfer hat sie mir gegeben;
darum hab ' ich auch nicht Macht, mich des Bundes meiner heiligen
Taufe zu verzeihen. ' Auf diese tröstliche Erinnerung pochet, Herr Doktor,
unverzagt, denket nicht zurück, was Ihr getan, sondern nehmet Euch vor,
wie Ihr dem Teufel und seinem Eingeben möget kräftigen Widerstand tun
mit dem Wort Gottes; und wenn Ihr zu Bette gehet; so sprecht: ,Ach, lieber
Gott, ich bin freilich ein armer großer Sünder und finde nichts denn
Ungerechtigkeit bei mir; aber dein lieber Sohn hat mehr Gerechtigkeit mir
und allen bußfertigen Sündern mitzuteilen, als wir alle von ihm nehmen
und begehren können, um welches willen du, getreuer Gott und Vater;
mir wollest gnädig und barmherzig sein, Amen!"'
***Doktor Faustus legte sich nun von der Zeit an ziemlich wider den Teufel
; denn ihm ward von einem seiner guten Freunde, der ein großes Mitleiden
mit ihm hatte, die Heilige Bibel in die Hand gegeben, ja darin die
vornehmsten Machtsprüche bemerkt, daß er sie bald aufschlagen und daraus
Trost schöpfen möchte. Dieses nun war dem Teufel nicht angenehm,
und weil er ihm nicht anders beikommen konnte, versuchte er, ihn davon
abwendig zu machen; kommt deswegen nach etlichen Tagen auf einen
Abend zu ihm und spricht: "ES ist nicht zu leugnen, daß dein Herz jetzt anders
gerichtet ist, als es je gewesen; es fehlet auch nicht weit, du möchtest
die Barmherzigkeit Gottes, und was sein Wille ist; ergreifen und zu solcher
Erkenntnis kommen, aber eines fehlt dir noch sehr, dahin du nimmer
denken wirst. Denn Gott hat Gute und Böse erschaffen, also bleibet es
vom Anfang bis zum Ende der Welt. Denn du hifi nicht erwählet zur
Seligkeit, sondern bist ein Stück vom bösen Baum, und wenn du gleich
alle Tugend und Frömmigkeit dieser Welt an dir hättest; so bist du doch
nicht zum ewigen Leben versehen. Dagegen die, so auserwählet sind, ob
sie schon Sünde getan und also sterben, so sind sie doch gute Bäume und
im Anfang zu dem ewigen Leben versehen. Denn Gott hat Gute mit den
Bösen erschaffen, dabei lässet er's auch bleiben und nimmt sich der Menschen
weiter nicht an, wie sie auch leben und sterben, bis zu dem allgemeinen
Gerichte: wer denn zu dem ewigen Leben erkoren ist, der kommt darein,
also ist es auch mit den Verdammten; darum ist es nichts mit deinem Vorhaben,
daß du allererst um dich sehen willst, wie du möchtest in das ewige
Leben kommen, so du doch von Anfang nicht dazu versehen bist." Dieses
war nun dem Doktor Faust eine seltsame Predigt und dachte solchem eine
gute Weile nach, so daß er auch endlich sagte: "Es mag wahrlich wohl also
sein. Ich werde zu dem ewigen Leben nicht geboren sein, dieweil doch
Firmament und Gestirn des Himmels ausweiset, was dem Menschen Gutes
und Böses begegnen solle, und solche Exempel ereignen sich täglich,
daraus geschlossen werden kann, wie Gott im Anfang sein Werk, alle
Kreaturen, hat verordnet, daß solcher Lauf werde fortgehen bis an der
Welt Ende. Nun ist der Mensch auch Gottes Kreatur, zum Bösen und
Guten geneigt; wie ihn Gott dazu hat erschaffen, darüber ich jetzt nicht
weiter reden will. Bin ich zum ewigen Leben versehen, so wird es sein
müssen; wo nicht, so muß ich wohl, wie andere, dahinfahren."
Als nun gleich des andern Tags, vielleicht aus Gottes Schickung, der
Geistliche samt drei andern Studenten Doktor Faust besuchte, fand er denselben
etwas freudiger in seinem Mut als früher, vermeinte demnach, der
Trost aus dem Wort Gottes habe ein solches verursacht; allein er fand
sich in seinem Wahn betrogen, da er vernahm, daß solches aus dem Gespräche,
so der Teufel mit dem armseligen Faust von der ewigen Versehung
gehalten, herrührte: daher der gute Geistliche wohl einsah, daß es fast
mißlich sein würde mit dem Doktor Faust seiner Bekehrung halber; denn
er gebe seiner Vernunft zuviel Raum und Statt, daß ihn daher der Teufel
leichtlich gefangennehmen könnte. Darum sagte er, nachdem er Sitz
genommen, zu Doktor Faust, er sollte seine Vernunft in solchen hohen Artikeln
der Vorsehung Gottes nicht urteilen lassen, sondern sie unter den
Glauben gefangennehmen und alles das aus seinem Sinne verbannen,
was ihm der Teufel vorgeschwätzet habe. "Denn", fährt er fort, "menschliche
Vernunft und Natur kann Gott in seiner Majestät nicht begreifen;
darum sollen wir nicht weiter suchen noch erforschen, was Gottes Wille in
diesem sei. Sein Wort hat er uns gegeben, darin er reichlich geoffenbaret
hat, was wir von ihm wissen, halten, glauben und uns zu ihm versehen
sollen; nach demselben sollen wir uns richten, so werden wir nicht irren;
wer aber von Gottes Willen, Natur und Wesen Gedanken hat außer dem
Wort will mit menschlicher Vernunft und Wissenschaft aussinnen, der
macht sich viel vergebliche Unruhe und Arbeit und fehlet sehr weit. ,Denn
die Welt', spricht St. Paulus, ,erkennet durch ihre Weisheit Gott nicht in
seiner Weisheit'; auch werden diese nimmermehr lernen noch erkennen,
wie Gott gegen sie gesinnet sei, die sich darüber vergeblich bekümmern, ob
sie versehen oder auserwählet seien. Welche in diese Gedanken geraten,
denen gehet ein Feuer im Herzen an, das sie nicht löschen können, also daß
ihr Gewissen nicht zufrieden wird, und müssen endlich verzweifeln. Wer
nun diesem Unglück und ewiger Gefahr entgehen will, der halte sich an
das Wort, so wird er finden, daß unser lieber Gott einen starken, festen
Grund geleget, darauf wir sicher und gewiß fußen mögen, nämlich Jesum
Christum, unsern Herrn, durch welchen allein und sonst durch kein
anderes Mittel wir in das Himmelreich gelangen mögen: denn er und
sonst niemand ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sollten wir
nun Gott in seinem Wesen, und wie er gegen uns gesinnet sei, recht und
wahrhaftig erkennen, so muß es durch sein Wort geschehen; und eben
darum hat Gott der Vater seinen eingebornen Sohn in die Welt gesandt,
daß er sollte Mensch werden, allerdings uns gleich, doch ohne
Sünde, unter uns zu wohnen und des Vaters Herz und Willen uns zu
offenbaren."
Dieser Trost des Magisters, nachdem er mit den andern Abschied von
Doktor Faust genommen, wollte ebensowenig bei dem Armen fruchten
als die vorigen, und mit bekümmerten Gedanken legte er sich damals auf
den Abend ungegessen und ungetrunken zu Bette. Er hatte zwar bei sich
in der Kammer seinen getreuen Famulus, den Wagner, aber tausenderlei
Gedanken betrübten seine Seele, die ihn denn so bald, ob er's schon
wünschte, nicht einschlafen ließen, noch ihm Ruhe gönnten. "Ach", sprach
er ganz wehmütig, "du armseliger Mensch, du hifi wohl mit allem
Recht mit unter den Unseligen, da du alle Stunden den Tod erwarten

mußt; während du doch noch viel gute Zeit und Stunden hättest erleben
können t Ach, Vernunft Mutwill, Vermessenheit und freier Will'! Oh,
du Blinder und Unverständiger, der du deine Glieder, Leib und Seele
so blind machest, blinder als blind ! O zeitliche Wollust, in was Verderben
hast du mich geführt daß du mir meine Augen so gar verdunkelt
Bastl Ach, schwaches Gemüt, betrübte Seele, wo ist, wo bleibet deine Erkenntnis?
O verzweifelte Hoffnung, da deiner nimmermehr gedacht wird!
Ach Leid über Leid, Jammer über Jammer, wer wird mich daraus erlösens
Wo soll ich mich verbergend Wohin soll ich mich verkriechen oder
fliehen? Ja ja, ich sei gleich, wo ich wolle, so bin ich gefangen."
In solchen bekümmerten Herzensgedanken und Klagen genoß Doktor
Faustus doch die Gnade, daß er einschlummerte und endlich recht einschlief;
er schlief aber nicht so gar lange, als er von einem bösen Traum beunruhiget
und wieder aus dem Schlaf gebracht wurde. Es träumte ihm,
als sähe er in seine Kammer einhertreten mehr denn tausend böse Geister
, welche sämtlich feurige Schwerter in den Händen hatten und ihn
zu schlagen droheten, unter denen aber einer als der vornehmste sich hervortat
und mit erschrecklicher Stimme zu ihm sprach: "Nun, Fauste,
sind wir bereit dich einmal an den Ort zu bringen, von welchem du oft
mehrere Wissenschaft zu haben verlangt hast, wir aber haben solches bis
anher versparen wollen. Nun wirst du selbst sehen, was für ein mächtiger,
großer Unterschied sein wird unter den Verdammten und den Auserwählten,
welches dir etwa vor diesem ist gleich einer Fabel und einem Märlein
gewesen." Doktor Faust erwachte darob zur Stund und grämte sich
heftig ob diesem Gesicht; denn er konnte sich leicht die Rechnung machen,
was des Traumes Bedeutung sein werde.
Indessen vermehrte sein herannahendes elendes Ende von Stund zu
Stunde seine Herzensbangigkeit, daß er ganz still und einsam blieb, und
war ihm nichts lieber als solche Einsamkeit, so daß er auch nicht mehr
zugeben wollte, daß der Magister mit den andern Studenten, die alle ein
herzliches Mitleiden mit ihm hatten und aufs wenigste seine Seele zu
erhalten suchten, zu ihm kommen und ihn trösten sollten: und ob er schon
zu unterschiedlichen Malen Trostsprüche aus dem Alten und Neuen Testament;
welche der Geistliche vor etlichen Tagen ihm bemerkt hatte, aufschlug
, so konnte er sich doch damit nicht trösten, noch darauf ein einiges
Wörtlein sich zu Herzen führen, sich damit zu stärken; sondern wenn ihm
gleich ein Blick eines Trostspruchs vorleuchtete, so sagte er denn bei sich
selbst: "Ach, ach, das gehet mich nicht an." Nun begegnete ihm, auch
etlichemal, weil er sich in die Einsamkeit zu sehr vertieft, voller Schwermut
und Herzensbangigkeit war, auch keines Trostes fähig werden konnte,
daß er nach Messern griff, sich damit zu entleiben; allein der Teufel ließ
es nicht zu, und wenn Doktor Faust den Selbstmord ins Werk richten
wollte, so war er an den Händen gleich als lahm, daß er nichts vollführen
konnte: und war ihm also in solcher seiner Einsamkeit wie einem Übeltäter
oder Mörder, der in dem Gefängnis alle Stunden und Augenblicke
erwarten muß, wann und zu welcher Zeit er seiner Übeltat Endurteil
ausstehen solle.
***Doktor Faustus hatte nur noch zehen Tage zu seinem erschrecklichen
Ende, weswegen er an einem Morgen seinen Famulus, weil er bisher
andere Gesellschaft nicht leiden mochte, zu sich vor sein Bett berief, gleich
als wenn er nur von ihm Trost und Erquickung haben könnte, und ganz
zaghaft und erschrocken zu ihm sprach: "Ach, lieber Sohn, was hab ' ich
mir bereitet, daß ich so roh gelebt und mein gottloses Leben bisher also
geführet habel Was habe ich jetzt davon? Ich bringe nicht allein einen
bösen Namen davon, sondern auch einen nagenden Wurm und böses Gewissen
; ach, ich sollte zeitiger an das Ende, an mein Ende gedacht haben!
Und wenn ich an solches gedenke, das nun nicht mehr ferne ist, so überläuft
meinen Leib ein eiskalter Schweiß, ein Zittern und Zagen meines
Herzens ist da, und wenn ich nun bald davon muß, und mein Leib und
Seele den Teufeln zuteil werden, so sehe ich alsdann vor mir das strenge
Gericht Gottes, ich weiß nicht, wo ich aus oder ein soll: es wäre mir
tausendmal besser, daß ich als ein unvernünftiges Tier wäre geboren
worden oder doch in meiner zarten Kindheit gestorben! Nun aber, ach,
nun ist's aus, Leib und Seele, die fahren dahin, wohin sie geordnet
sind.
Auf solches Wehklagen und Seufzen sprach sein Famulus, den seines
Herrn jammerte: "Ach, Herr Doktor, warum seid Ihr doch fort und fort
so schwermütig und kränket Euer Herz stets? Schaffet Euch einmal Ruhe,
tut dem Satan Widerstand; denn dieser peiniget und martert Euch also:
ich will's nicht mehr zugeben, daß Ihr so allein seid, sondern Ihr müsset
entweder Leute um Euch haben, daß Ihr Euch mit ihnen ergötzet und sie
Euch die melancholischen Gedanken vertreiben, oder Ihr müsset den Magister
wieder zu Euch berufen, damit Ihr völligen Trost bekommet. Denn
es ist ja kein Sünder so groß, er kann durch seinen Widerruf, herzliche
Reue, Bekehrung und Buße zur Gnade Gottes kommen." Doktor Faustus
antwortete: "Mein lieber Christoph, schweige nur, ich bin nicht wert,
daß gute, ehrliche Leute mehr zu mir kommen sollen, ich, der ich ein
Leibeigner des Teufels bin; so will ich auch von keinem Trost aus der
Schrift mehr hören noch wissen, sintemal es doch damit alles vergebens
und verloren ist; mich zu bekehren: ich will mein Leben vollends mit
Trauern, Seufzen und Wehklagen zubringen."
***Das Stundenglas hatte sich nunmehr umgewendet; war ausgelaufen,
die bestimmten vierundzwanzig Jahre Doktor Fausts oder die Endschaft
seiner Verschreibung war nun am nächsten: deswegen erschien ihm der
Teufel abermal, und zwar in ebendieser Gestalt; wie er damals den verdammlichen
Bund mit ihm aufgerichtet hatte, zeigte ihm seine Handschrift
; darin er ihm mit seinem eigenen Blut seinen Leib und seine Seele
verschrieben hatte, mit der Weisung, daß er auf folgende Nacht sein verschriebenes
Unterpfand holen und ihn hinwegführen wollte, dessen er sich
denn gänzlich versehen sollte: darauf der Teufel verschwand.
Wie dem Doktor Faust hierüber müsse zumut gewesen sein, läßt sich
leichtlich denken; es kam das Bereuen, Zittern, Zagen und seines Herzens
Bangigkeit mit aller Macht an ihn; er wandte sich hin und wider,
klagte sich selbst an ohne Unterlaß wegen seines abscheulichen und greulichen
Falls, weinte, zappelte, focht, schrie und grämete sich die ganze
Nacht über. In solchem erbärmlichen Zustand erschien ihm sein bisheriger
Hausgeist Mephistopheles zur Mitternachtszeit, sprach ihm freundlich
zu, tröstete ihn und sprach: "Mein Fauste, sei doch nicht so kleinmütig
, daß du von hinnen fahren mußt, gedenke doch, ob du gleich deinen
Leib verlierest, ist's doch noch lang dahin, daß du vor dem Gericht Gottes
erscheinen wirst; du mußt doch ohnedas sterben, es sei über kurz oder
über lang, obschon du etliche hundert Jahr, so es möglich wäre, lebtest: und
ob du schon als ein Verdammter stirbst, so hifi du es doch nicht allein, bist
auch der erste nicht; gedenke an die Heiden, Türken und alle Gottlosen,
die in gleicher Verdammnis mit dir sind und zu dir kommen werden.
Sei beherzt und unverzagt, denke doch an die Verheißung unsers Obersten,
der dir versprochen hat, daß du nicht leiden sollest in der Hölle wie die
andern Verdammten." Mit solchen und andern Worten wollte der Geist
ihn beherzt machen und ihn etwas aufrichten.
Da nun Doktor Faustus sah, daß dem ja nicht anders sein konnte, und
daß der Teufel sicher sein Unterpfand nicht würde dahintenlassen, sondern
auf die folgende Nacht es gewiß holen, stehet er frühmorgens auf, spaziert
etwas vor die Stadt hinaus, und nach Verfluß von etwa anderthalb
Stunden, nachdem er wieder nach Haus gekommen, befiehlt er seinem
Famulus, daß er die Studenten, ehedessen seine vertrauten Freunde, noch
einmal zu ihm in das Haus berufen sollte: er hätte ihnen etwas Notwendiges
anzukünden.
Weil nun diese vermeinten, Doktor Faust würde sich vollends bekehren,
nahmen sie den Magister mit sich. Als sie aber angekommen, bat
er sie, daß sie sich doch sämtlich wollten gefallen lassen, mit ihm noch
einmal in das Dorf Rimlich zu spazieren; denn daselbst wolle er sich
mit ihnen lustig erzeigen, welches er etliche Zeit bisher unterlassen
hätte.
Der Geistliche verließ auf diese Worte die Behausung des Doktors;
denn es hatte ihn ein Schauder bei seiner Rede ergriffen. Die Studenten
aber waren dessen zufrieden und spazierten miteinander dahin, hatten
unterwegs allerlei Gespräche, und nachdem sie daselbst angelanget; ließ
Doktor Faust ein gutes Mahl zurichten und stellte sich auf das möglichste
mit ihnen fröhlich, daß sie also beisammen recht lustig waren bis
auf den Abend, da sie alle, ausgenommen Faustus, wieder nach Hause
begehrten. Doktor Faustus aber bat sie gar freundlich, daß sie doch wollten
nur noch dieses einzige Mal die Nacht über in dem Wirtshaus bei
ihm verharren; es wäre doch schon die Zeit zur Heimkunft zu spät, er
müsse ihnen nach dem Nachtessen etwas Besonderes vorhalten. Welches
sie denn, weil es doch nicht anders sein können, ihm zusagten.
***Als nun das Mahl und der Schlaftrunk vorbei waren, bezahlte Doktor
Faustus den Wirt und bat die Gäste, sie sollten ein kleines mit ihm
in die nächste Stube gehen; er hätte ihnen etwas Wichtiges zu sagen,
welches er bisher hätte verborgen gehalten, das betreffe sein Heil und
seine Seligkeit; mit solcher Vorrede, ohne ferneren Umschweif, fing er an
und sprach: "Wohlgelehrte, ihr meine liebe, vertraute Herren, daß ich
euch heute morgen durch meinen Famulus habe ersuchen lassen, einen
Spaziergang hieher zu machen, und ihr mit einer schlechten Mittagmahlzeit
vorliebgenommen, auch auf mein Anhalten bei mir als auf die
Nacht anjetzo verharret, dafür sage ich euch schuldigen Dank; wisset aber
zugleich, daß es um keiner andern Ursache willen geschehen, als euch zu
verkündigen, daß ich mich von meiner Jugend an, während ich von Gott
mit einem guten Verstand bin begabt gewesen, jedoch mit solcher Gabe
nicht zufrieden war, sondern viel höher steigen und über andere hinauskommen
wollte, mit allein Fleiß und Ernst auf die Schwarzkunst gelegt,
in welcher ich mit der Zeit so hoch bin gekommen, daß ich einen unter
den allergelehrtesten Geistern, namens Mephistopheles, erlangt: jedoch
solche Vermessenheit geriet mir bald zum Bösen und zu einem solchen
Fall, wie er dem Luzifer selber widerfahren, da er um seiner Hoffart
aus dem Himmel verstoßen worden. Denn als der Satan mir willig
in allem meinem Vorhaben war, setzte er zuletzt mir zu, daß, so ich würde
einen Bund mit ihm aufrichten und mich mit meinem eigenen Blut verschreiben,
ich nach Verfluß von vierundzwanzig Jahren sein wollte sein
mit Leib und Seele, dazu Gott, der Heiligen Dreifaltigkeit und allem
himmlischem Heer absagen, denselben nimmermehr in Nöten und Anliegen
anrufen, auch alle diejenigen anfeinden, so mich von meinem Vorhaben
abwendig machen und bekehren wollten: daß ich alsdann nicht
allein mit hohen trefflichen Künsten begabt sein, sondern auch Geister
um und neben mir haben sollte, die mich in aller Gefährlichkeit schützen
und meinen Widerwärtigen zuwider sein müßten; dazu, und welches eben
das meiste war, was ich auch in diesem Leben verlangte, Geld, gutes
Essen und Trinken und tägliches Wohlleben, das sollte mir nimmermehr
mangeln, ja er wollte mich so hoch ergötzen nach allen meines Herzens
Begierden, daß ich das Ewige nicht für das Zeitliche nehmen würde. Mit
solchen übergroßen Verheißungen erfüllte er mir das Herz, daß ich bei
mir gedachte: dieses Freudenleben ist gleichwohl nicht zu verwerfen, obschon
der Bund gottlos und verdammlich ist; so darf ich auch den Satan
nicht länger aufhalten; denn sonst möchte ich um alle meine Kunst kommen,
und er möchte von mir weichen: dazu so bin ich vorhin geneigt zum
müßigen Leben; Fressen, Saufen und Spielen ist meine Lust, allein die
Mittel dazu hab ' ich nicht: allhie könnte ich alles ohne Mühe überkommen
. Käme es denn einmal dahin, daß der Teufel sein Unterpfand holen
und haben wollte, müßte ich's wohl geschehen lassen; ich würde doch über
die bestimmte Zeit nicht viel länger leben können. ,Zudem, so kann doch
wohl die Zeit kommen', dachte ich, ,daß ich mich möchte bekehren, Buße
tun und also die Barmherzigkeit Gottes ergreifen. ' Da denn ohne Zweifel
der Teufel nicht wird gefeiert haben, sondern mich regieret und getrieben,
, daß ich also den Bund mit ihm aufgerichtet; Gott und der Heiligen
Dreifaltigkeit abgesagt und mich ihm mit Leib und Seele verschrieben
habe.
Es hat aber der Teufel, wie ich's bekennen muß, anfänglich mir eine .
geraume Zeit Glauben gehalten, mir alles dasjenige erfüllt und geleistet;
was mein Herz begehrt hat; doch aber hat er zuweilen gefehlt und
mich in etlichen Sachen stecken lassen, mit Vorwänden, ich sollte selbst
durch meine Kunst mich fortbringen; und da ich mich darüber beklagte;
so hat er nur ein Gespött mit mir getrieben: bin also aus Vermessenheit
und Wollust in solchen Jammer geraten zum ewigen Schaden meiner
armen Seele, daraus mir nimmermehr kann geholfen werden. Nun aber
sind solche Jahre auf diese Nacht aus und verlaufen; da wird denn der
Teufel sein Unterpfand holen und mit mir ganz erschrecklich umgehen;
das alles wollte ich doch gerne ausstehen, wenn nur die Seele erhalten
würde. Ich bitte euch nun, günstige liebe Herren, ihr wollet nach meinem
Tod alle diejenigen, so mich geliebet und wegen meiner Kunst im Wert
gehalten haben, freundlich grüßen und von meinetwegen ihnen viel Gutes
wünschen: was ich auch diese vierundzwanzig Jahr über für Abenteuer getrieben,
und meine anderen Geschichten, die werdet ihr in meiner Behausung
aufgeschrieben finden, und mein Famulus soll sie euch nicht vorenthalten.
Ihr wollet euch anjetzt miteinander zur Ruhe begeben, sicher
schlafen und euch nichts anfechten lassen, auch so ihr ein Gepolter und
ungestümes Wesen im Haus hören und vernehmen werdet, wollet ihr
euch darob nicht entsetzen noch euch fürchten; denn euch soll kein Leid
widerfahren, wollet auch vom Bette nicht aufstehen; allein dieses möchte
ich zu guter Letzt von euch erbeten haben, daß, so ihr meinen Leib findet;
ihr solchen zur Erde bestatten lasset. Gehabt euch ewig wohl, ihr Herren,
und nehmet ein Exempel an meinem Verderben. Gute Nacht, es muß
geschieden sein!"Auf solches Lebewohl traten die Gäste, einer nach dem
andern, zu Doktor Faust, hatten ein herzliches Mitleiden und sprachen
mit erschrockenen Herzen: "Herr Doktor, hiermit wünschen wir Euch auch
eine gute Nacht, und zwar eine bessere, als Ihr vermeinet; wir bitten
sämtlich nochmals, Ihr wollet Eures Heils und Eurer Seelen Wohlfahrt
bei jetziger letzten Zeit wahrnehmen; und weil Ihr nicht anders glaubet,
denn der Teufel werde diese Nacht Euren Leib hinwegnehmen, so rufet
den Heiligen Geist um Beistand an, damit er Eure Seele möge regieren
und zu einem unzweifelhaften Glauben an Christum bringen: diesem befehlet
alsdann, wenn es je nicht anders wird sein können, Euren Geist in
seine barmherzige Hände mit reuigem Herzen, sprecht mit dem König
David: ,Ich harre des Herrn, meine Seele harret; und ich hoffe auf sein
Wort; denn bei dem Herrn ist die Gnade, und viel Erlösung ist bei ihm."'
Darauf sagte Doktor Faustus ganz weinend: "Ach, liebe Herren, ich will
in meinem Herzen seufzen und ächzen, ob etwa mich Verlornen Gott
wieder möchte zu Gnaden aufnehmen; aber ich besorge leider, daß nichts
daraus werden dürfte; denn meiner Sünden sind zuviel." Unter solchen
Reden sank er gleich einem Ohnmächtigen hin auf die nächste Bank, darüber
sie alle erschraken und sich bemüheten, ihn aufzurichten. In solchem
Schrecken hörten sie im Haus ein großes Poltern, darob sie sich noch mehr
entsetzten und zueinander sprachen: "Laßt uns von dannen weichen,
damit uns nicht etwas Arges widerfahre l Lasset uns zu Bette gehen",
wie sie denn auch solches taten. Da sie nun dahin gegangen waren,
konnte keiner aus Furcht und Entsetzen einschlafen, zudem, so wollten
sie doch vernehmen, was es für einen Ausgang mit dem Doktor Faust
nehmen würde.
***Als nun die Mitternachtsstunde erschienen, da erhub sich plötzlich ein
großer ungestümer Wind, der riß und tobte, als ob er das Haus zugrund
stoßen wollte. Wem war nun ängster und hänger als den Studenten?
Sie wünschten zehn Meilen von da zu sein und sprangen aus
den Betten mit großer Furcht; da sie denn kurz darauf in der Stube, in
welcher Doktor Faustus liegengeblieben, ein greuliches Zischen und Pfeifen
, als ob lauter Schlangen und Nattern zugegen wären, vernommen:
noch mehr aber wurden sie bestürzt, da sie das Stoßen und Herumwerfen
in der Stube hörten, den armseligen Faust zetermordio schreien, bald
aber nichts mehr. Und es verging der Wind und legte sich, und ward
alles wieder ganz still. Kaum hatte es recht getagt und das Tageslicht
in alle Gemächer des Hauses geleuchtet, da waren die Studenten auf,
gingen miteinander ganz erschrocken in die Stube, um zu sehen, wo
Doktor Faustus wäre, und was es für eine Bewandtnis diese Nacht über
mit ihm gehabt hätte. Sie kamen aber kaum dahin, so sahen sie bei Eröffnung
der Stube, daß die Wände, Tisch und Stühle voll Blutes waren;
ja, sie sahen mit Erstaunen, daß das Hirn Doktor Fausts an den Wänden
anklebte, die Zähne lagen auf dem Boden; und also mußten sie augenscheinlich
abnehmen, wie ihn der Teufel von einer Wand zu der andern
müsse geschleudert und daran zerschmettert haben. Den Körper suchten
sie allenthalben im Hause, fanden ihn zuletzt außerhalb des Hauses auf
einem nahe gelegenen Misthaufen liegen: er war aber ganz abscheulich
anzusehen; denn es war kein Glied an dem Leichnam ganz, alles schlotterte
und war ab; der Kopf war mitten voneinander, und das Hirn war
ausgeschüttet. Sie trugen also den Leichnam in aller Stille in das Haus.
und beratschlagten sich, was ferner anzufangen sei.
Als die Studenten des Doktor Fausts Leichnam gefunden und beiseits
gelegt hätten, gingen sie zu Rat; wie es nun anzugreifen wäre, daß seiner
letzten Bitte ein Genügen getan und sein Leichnam zur Erde möchte
bestattet werden, und beschlossen zuletzt; daß sie dem Wirt ein Geschenk
machen wollten, damit er schwiege und mit ihnen übereinstimmte, daß
Doktor Faustus eines schnellen Todes wäre verstorben. Demnach naheten
sie mit Beihilfe des Wirts den zerstümmelten Leichnam in ein Leintuch
ein und meldeten dem Pfarrherrn des Orts, wie sie einem fremden Studenten
hätten das Geleite gegeben, welchen diese Nacht ein schneller
Schlagfluß getroffen, der ihn auf der Stelle seines Lebens beraubt; sie
bäten den Herrn Pfarrer er wolle es bei dem Schultheißen anbringen
und um die Erlaubnis bitten, solchen allhier zu begraben, sie wollten alle
Unkosten auslegen: wie sie denn auch dem Pfarrherrn einen Goldgulden
gaben, die Sache zu befördern, weil sie sich allda nicht lang aufzuhalten
hätten. Dieses wurde denn auch am selbigen Nachmittag ins Werk gesetzt.
Es hat aber der Wind damals, als man den Leichnam begrub, sich so
ungestüm erzeigt, als ob er alles zu Boden reißen wollte, da doch weder
vor noch nach dergleichen verspürt worden. Woraus denn die Studenten
schließen mochten, welch ein verzweifeltes Ende Doktor Faust müsse genommen
haben.
Aber nachdem Doktor Faustus tot und begraben war hatte seine arme
Seele auf Erden noch keine Ruhe. Sein Geist regte sich, erschien zum
öfteren seinem Diener Christoph Wagner und hielt mancherlei Gespräche
mit ihm. demselben kam auch Justus Faustus, des Doktor Faust und
der schönen Helena Sohn, der selbst ein bildschöner Mensch war, der
sprach ganz freundlich zu dem Famulus: "Nun, ich gesegne dich, lieber
Diener, ich fahre dahin, weil mein Vater tot ist; so hat meine Mutter
auch hie kein Bleibens mehr, sie will auch davon; darum so sei du Erbe
an meiner Statt, und wenn du die Kunst meines Vaters hast recht ergriffen,
so mache dich von hinnen, halte die Kunst in Ehren; du wirst
dadurch ein hohes Ansehen überkommen." Als er solches geredet trat
auch die schöne Helena herein, nahm ihren Sohn bei der Hand, und beide
verschwanden also vor des Wagners Augen, der nicht wußte, was er dazu
sagen sollte; so daß man sie hernach nimmer gesehen hat. Die Nachbarn
aber gewahrten den Geist des Doktor Faustus bei Nacht oftmals in seiner
Behausung im Fenster liegend, sonderlich wenn der Mond schien. Er
ging auch in dem Hause herum, ganz leibhaftig, in Gestalt und Kleidung,
wie er auf Erden gegangen war; denn Doktor Faustus war ein höckerige
Männchen, von dürrer Gestalt und hatte ein kleines, graues Bärtlein.
Zuzeiten fing sein Geist im Hause ganz ungestüm an zu poltern, was
viele Nachbarn mit erschrockenem Herzen hörten. Sein Famulus Wagner
aber beschwur den Geist und verhalf ihm auf Erden zu seiner Ruhe. Und
jetzt ist es in diesem Hause ganz friedlich und still.
Fortunat und seine Söhne
Mit Bildern von Oskar Pletsch
Auf der Insel Zypern liegt eine Stadt, Famagusta genannt. In dieser
war ein edler Bürger, namens Theodor, ansässig, von alter löblicher Herkunft,
dem seine Eltern großes Gut hinterlassen hatten. So war er reich
und gewaltig, dazu jung und freien Mutes; dachte nicht viel daran, wie
seine Eltern zuzeiten das Ihrige gespart und gemehrt hatten; denn sein
Gemüt war ganz und gar auf zeitliche Ehre und irdische Lust gerichtet. Er
führte deswegen auch ein köstliches Leben mit Stechen, Turnieren, den
Königen Zuhofereiten und vertat damit viele Habe. Dies verdroß seine
Freunde, und er wurde ihnen unwert. Deswegen dachten sie darauf, ihm
ein Weib zu geben, weil sie hofften, ihn dadurch von seiner unordentlichen
Lebensweise abziehen zu können. Sie machten ihm diesen Vorschlag, der
ihm wohlgefiel, und er verhieß wirklich, ihnen in dieser Hinsicht Folge zu
leisten. Die Freunde sahen sich um und stellten allenthalben Nachfrage
an; auch fanden sie endlich in Nikosia, der Hauptstadt der Insel, wo die
Könige gewöhnlich hofhielten, einen Edelmann, der eine schöne Tochter
hatte, mit Namen Gratiana: diese wurde ihm vermählt, ohne daß weiter
darnach gefragt worden wäre, was für ein Mann Theodor sei; sondern
nur auf den Ruf hin, daß er so groß und mächtig wäre, wurde ihm vergönnt,
, die Jungfrau heimzuführen. Es ward eine köstliche Hochzeit gefeiert,
wie es denn gewöhnlich ist, daß reiche Leute ihre Herrlichkeit besonders
bei solchen Gelegenheiten beweisen. Als nun das Fest vorüber
war und jedermann sich wieder zur Ruhe begab, da fing Herr Theodor
an, tugendlich mit seiner Frau zu leben, so daß es den Freunden der Braut
gar wohlgefiel; denn sie meinten ein gutes Werk vollbracht zu haben, weil
sie den Theodor, der so wild gewesen, mit einem Weibe so zahm gemacht
hätten. Leider aber wußten sie nicht, daß, was die Natur einmal getan
hätte, nicht leicht zu wenden sei.
Inzwischen gebar Gratiana, noch ehe das erste Jahr nach ihrer Vermählung
umwar, dem Herrn Theodor einen Sohn, über dessen Geburt
die beiderseitigen Verwandten und Freunde hocherfreut wurden, und der
in der Taufe den Namen Fortunatus erhielt. Theodor war hierüber auch
in großen Freuden; doch fing er bald darauf sein altes Wesen mit Stechen
und Turnieren aufs neue an, hielt viel Knechte und köstliche Rosse,
ritt dem Könige zu Hof, ließ Weib und Kind daheim und fragte nicht,
wie es zu Hause gehe. Heute verkaufte er einen Zins, morgen den andern,
und das trieb er so lange, bis er nichts mehr zu verkaufen und zu versehen
hatte. So kam er bald in Armut, hatte seine jungen Tage unnütz verzehrt
und ward am Ende so arm, daß er weder Knechte noch Mägde zu halten
vermochte und die gute Frau Gratiana zuletzt selber kochen und waschen
mußte wie die ärmste Taglöhnerin. Als sie nun einmal zu Tische saßen
und essen wollten, hätten sie sich gerne gütlich getan und gut gelebt,
wenn sie es nur gehabt hätten. Der Vater sah seinen Sohn gar ernstlich
an und seufzte von Herzens Grund. Fortunatus, sein Sohn, sah dieses.
Er war nun achtzehn Jahre alt; dennoch konnte er noch nichts als seinen
Namen schreiben und lesen; aber aufs Weidwerk und Federspiel verstand
er sich trefflich: denn das war sein Kurzweil. Dieser nun fing an und
sprach zu seinem Vater: "Lieber Vater, sage mir, was liegt dir doch auf
dem Herzen? Ich habe gar wohl an dir gemerkt, wenn du mich ansiehst,
daß du da betrübt wirst; so bitte ich dich, sage mir, habe ich dich denn auf
irgendeine Weise erzürnt? Laß es mich wissen; denn ich bin ja doch willens,
ganz und gar nach deinem Gefallen zu leben!" Der Vater antwortete:
"D lieber Sohn, um was ich traure, daran hast du keine Schuld;
auch sonst niemand kann ich darum beschuldigen; denn die Angst und Not,
in der ich schwebe, die habe ich mir selbst gemacht. Wenn ich daran denke,
wieviel Ehre ich genossen, wie viele Güter ich besessen habe, und auf wie
unnütze Weise ich dessen losgeworden bin, was mir meine Voreltern so
treulich erspart haben; was ich von Rechts wegen auch hätte tun und meiner
Vorfahren Würde hierin bewahren sollen: wenn ich alsdann dich ansehe
und daran denke, wie ich dir weder raten noch helfen kann: so empfinde
ich großes Herzeleid und habe Tag und Nacht keine Ruhe. Auch
schmerzt es mich, daß alle diejenigen mich verlassen haben, mit denen ich
einst mein Gut so mildiglich teilte, und denen ich jetzt ein unwerter
Gast bin."
Fortunat antwortete auf diese Klagen: "Liebster Vater, laß ab von
deinem Trauern und sorge nur gar nicht für mich; ich bin tung, stark und
gesund, ich will in fremde Lande gehen und dienen; es ist noch viel Glück
in dieser Welt; ich hoffe zu Gott, mir werde auch noch ein gutes Teil davon.
Auch hast du ja einen gnädigen Herrn an unserem König; gib dich
untertänig in seine Dienste; er verläßt gewiß dich und meine Mutter nicht
bis an euer Ende. Wegen meiner aber sei unbekümmert, ich bin erzogen
und sage euch dafür großen Dank!" Damit stand er auf und ging mit
seinem Federspiel, das ihm auf der Faust saß, aus dem Hause dem Meergestade
zu, indem er daran dachte, was er anfangen sollte, damit er seinem
Vater nicht mehr vor die Augen käme und dieser durch seinen Anblick
nicht länger beschwert würde. Als er nun so am Meere hin und her
ging, da sah er im Hafen eine venezianische Galeere liegen, die von Jerusalem
gefahren kam. Auf dieser befand sich ein Graf von Flandern,
dem zwei Knechte gestorben waren, und weil nun der Graf kein Geschäft
mehr beim König hatte und der Schiffspatron auch fertig war, so blies
man eben, daß alles zu Schiffe gehen sollte, damit man die Anker lichten
könnte: und der Graf mit vielen andern Edelleuten kam, das Schiff zu
besteigen. Fortunat sah dem allen mit großer Betrübnis zu. "Ach",
dachte er, "dürfte ich doch ein Knecht des Herrn werden und mit ihm fahren
, so weit weg, daß ich gar nie mehr nach Zypern käme!" Mit diesen
Gedanken trat er dem Grafen unter den Weg und machte ihm eine tiefe
Reverenz. Der Graf merkte bei seinem Gruße wohl, daß er nicht eines
Bauern Sohn war; Fortunat aber hub an und sprach: "Gnädiger Herr,
wenn ich recht gehört habe, so sind Euer Gnaden Knechte mit Tod abgegangen
, und könnten dieselben wohl eines andern bedürfen." — "Was

kannst du denn?"fragte der Graf. Er antwortete: "Ich kann jagen, beizen
und was zum Weidwerke gehört; dazu, wenn es nötig ist, die Dienste
eines reisigen Knappen versehen." Der Graf erwiderte hierauf: "Du
wärest mir eben gefüge: aber ich bin von fernen Landen, und ich fürchte,
du ziehest nicht gerne mit mir so weit von dannen!" — "Oh, gnädiger
Herr", antwortete Fortunat, "und wenn Ihr noch so ferne zöget, ich
wollte viermal so weit mit Euch fahren!" — "Was muß ich dir zu Lohne
geben?" sprach darauf der Graf. Fortunat sagte: "Ich begehre keinen
Lohn, gnädiger Herr! Je nachdem ich diene, so lohnet mir!" Dem Grafen
gefielen die Worte des Jungen wohl, er sagte: "Aber die Galeere will
gleich abfahren! Bist du fertig?" — "Ja Herr", erwiderte jener, warf
das Federspiel, das er auf der Hand trug, in die Lüfte, ließ es fliegen und
ging ungesegnet, und ohne Urlaub von Vater und Mutter genommen zu
haben, mit dem Grafen in die Galeere als sein Knecht. So fuhren sie
vom Lande, ohne daß Fortunat viel Geld in der Tasche gehabt hätte, und
kamen glücklich nach Venedig.
***Als sie in Venedig angekommen waren, hatte der Graf kein Gelüste,
länger da zu verweilen; denn er hatte die Herrlichkeit dieser Stadt schon
zuvor gesehen; seine Begierde stand wieder nach seinem Lande und seinen
guten Freunden. Denn er war entschlossen, wenn ihm Gott aus
Heiligen Lande wieder heim helfe, eine Gemahlin zu nehmen. Dies war
die Tochter eines Herzogs von Kleve, eine junge und gar schöne Fürstin;
auch war alles verabredet bis auf seine Zurückkunft. Um so sehnlicher begehrte
er nach Hause, ließ sich kostbare Pferde kaufen und rüstete sie sich
zu, erstand zu Venedig Kleinodien und herrliche Gewande von Gold und
Seide, und was sonst zu einer köstlichen Hochzeit gehört. Wiewohl er
nun viel Knechte hatte, so verstand doch keiner die welsche Sprache außer
Fortunat; der war denn gar geschickt zu reden und einzuhandeln, weswegen
der Graf ein großes Wohlgefallen an ihm hatte und ihn liebgewann
. Das merkte Fortunat und befleißigte sich, je länger; je besser
seinem Herrn zu dienen. Immer war er abends der Letzte und morgens
der Erste bei ihm; und dies merkte sein Herr wohl. Als man nun dem
Grafen viel Rosse gekauft hatte, worunter auch etliche Schelmen waren,
wie man sagt, -wie dies nicht fehlen kann, wo viele Rosse beieinander
stehen, da mußte man dem Grafen alle mustern, und er teilte sie unter
seine Diener; Fortunat aber erhielt eines der besten. Dies verdroß die
andern Knechte, und sie fingen gleich an, ihn zu hassen. "Sehet", sagte
einer zu dem andern, "hat uns nicht der Teufel mit dem Welschen betrogen?
" Nichtsdestoweniger mußten sie es geschehen lassen, daß er mit
seinem Herrn ritt, und keiner durfte ihn bei dem Grafen verlästern oder
verunglimpfen.
So kam der Graf von Flandern mit Freuden heim und wurde von all
seinem Volke gar herrlich empfangen: denn sie hatten ihn lieb; es war
ein frommer Herr, der seine Untertanen auch wert hielt. Als er angekommen
war, versammelten sich die Umfassen und seine guten Freunde
und begrüßten ihn aufs beste. Sie lobten Gott, daß er seine Reise so
glücklich vollbracht hätte, und fingen auch an, sich mit ihm von seiner
Vermählung zu unterreden; das gefiel dem Grafen gar wohl; er bat sie
deswegen, die Sache schnell zu Ende zu führen. Dies geschah auch, und in
wenigen Tagen hielt er Hochzeit mit der Tochter des Herzogs von Kleve.
Diese Festlichkeit wurde sehr herrlich begangen; es ward scharf gerannt,
turniert, Ritterspiel aller Art getrieben, alles unter den Augen der schönen
und edeln Frauen. Soviel Fürsten und Herren aber Edelknechte oder
sonstige Diener mit auf die Hochzeit gebracht hatten, so war doch keiner
unter ihnen, dessen Dienst und ganzes )Wesen Frauen und Männern besser
gefallen hätte als Fortunats. Alle fragten den Grafen, von wannen ihm
denn der höfliche Diener käme. Er sagte ihnen, wie er zu demselben gekommen
wäre auf der Rückfahrt von Jerusalem, und wie derselbe ein so
trefflicher Jäger sei; kein Vogel in der Luft und kein Tier im Walde sei
vor ihm sicher; auch verstehe er sonst wohl zu dienen und wisse, jedermann
zu behandeln, je nachdem er wäre. Weil ihn nun sein Herr so sehr
liebte, so erhielt Fortunat viel Geschenke von Fürsten und Herren, auch
von den edeln Frauen.
Als nun die Herren und Edeln gestochen hatten, wurden der Herzog von
Kleve und der Graf sein Tochtermann, einig, auch den Dienern der Herren,
die aus der Hochzeit zugegen waren, zwei Kleinode, die bei zweihundert
Kronen wert, vorzusetzen; um die sollten sie siechen, und wer es am
besten machte, der sollte eines der Kleinode davontragen. Darüber waren
die Diener alle froh; denn jeder gedachte sich am ritterlichsten zu halten.
Wie sie nun den ersten Tag stachen, da gewann auf der einen Seite der
Diener des Herzogs von Brabant den Preis, auf der andern Seite gewann
ihn Fortunat. Dem größern Teile der Diener mißfiel dieses; alle
baten den Knecht des Herzogs von Brabant, der Timotheus hieß und das
eine Kleinod gewonnen hatte, daß er den Welschen herausfordern möchte,
mit ihm zu siechen, und sein Kleinod an das seine setzen sollte; das wollten
sie ihm alle und jeder insonderheit danken. Timotheus konnte die
Bitte, die an ihn gerichtet war, um so vieler guten Gesellen willen nicht
wohl ausschlagen und bot Fortunat den Kampf an. Der bedachte sich nicht
lange, obwohl er noch wenig gestochen hatte. Die Herren, vor welche die
Märe kam, vernahmen es auch gerne. So rüsteten sich denn beide, kamen
auf den Plan und ritten mannlich gegeneinander; jeder hätte gern das
Beste getan; aber beim vierten Ritt rannte Fortunat den Timotheus eine
ganze Lanzenlänge hinter sich vom Gaule und gewann so die zwei Kleinodien,
die wohl zweihundert Kronen wert waren. Jetzt erhob sich erst recht
großer Neid und Haß, am allermeisten unter den Dienern des Grafen von
Flandern. Dieser aber sah es sehr gerne, daß einer seiner Diener die
Kleinodien gewonnen hatte mit den zweihundert Kronen an Wert. Von
dem Unwillen jedoch, den seine Knechte gegen Fortunat gefaßt hatten,
wußte er nichts, und es wagte auch kein Diener, ihm davon zu sagen.
Nun war ein alter listiger Reiter unter ihnen, der sich Rupert nannte;
der sprach, hätte er zehn Kronen bar, so getraute er sich, den Welschen
dahin zu bringen, daß er, ohne Urlaub von seinem Herrn und sonst jemand
zu nehmen, eilends von hinnen ritte; dies wolle er so zustande bringen
daß keiner unter ihnen dadurch beargwöhnt werden könne. Alle sagten
zu ihm: "O lieber Rupert, wenn du das kannst, warum feierst du
denn?" —"Ohne Geld", erwiderte er, "kann ich nichts zuwege bringen;
gebe jeder eine halbe Krone: und wenn ich ihn nicht vom Hofe wegbringe,
so will ich jedem eine ganze Krone dafür geben." Alle zeigten sich willig;
wer das Geld nicht bar hatte, dem liehen die andern; so brachten sie fünfzehn
Kronen zusammen, die gaben sie dem Rupert, und dieser sprach:
"Nun rede mir niemand in meine Sache, und tue jedermann in allen
Dingen wie zuvor!"Hierauf gesellte sich Rupert zu Fortunaten und tat
freundlich gegen ihn; er erzählte ihm von den alten Geschichten, die sich
in dem Lande ereignet hatten; das hörte Fortunat gar gerne. Da sandte
Rupert auf der Stelle nach Wein und köstlichen Speisen aus; denn er
wußte wohl, was zu solchem Leben gehört; auch lobte er den Jüngling
sehr, pries seine Schönheit und edle Geburt: dem Fortunat behagte solches
ganz gut, doch wollte er zuweilen auch etwas auftischen, aber Rupert ließ
es nie zu; er versicherte ihm, daß er ihm lieber sei als ein Bruder; was
er ihm tue, das würde er keinem andern tun; und solcher guten Worte
gab er ihm viel.
Dies lustige Leben trieben sie so lange, bis es die übrigen Diener verdroß
und sie endlich sprachen: "Meint Rupert, den Fortunat mit solchem
Leben wegzubringen? Fürwahr, wenn er noch jenseits des Meeres wäre
Zypern und wüßte solches Leben hier: er dächte darauf so bald als
möglich herzukommen l Rupert hat nicht vollbracht, was er uns verheißen
hat; er muß uns dreißig Kronen geben, und sollte er nichts weiter auf
Erden besitzen!" Rupert erfuhr das, spottete seiner Gesellen und sprach:
"Ich versichere euch, ich weiß sonst keinen guten Mut zu haben als mit
eurem Geld!" Als sie aber das Geld ganz verbraucht hatten, an einem
Abende ganz spät, da der Graf mit seiner Gemahlin sich zur Ruhe begeben
und niemand mehr auf den Dienst warten durfte, kam Rupert zu Fortunat

auf sein Zimmer und sprach: "Ach, lieber Fortunat, mir ist von
meines Herrn Kanzler, der mein insonders guter Freund ist, ingeheim
etwas gesagt worden; wiewohl er mir aufs ernstlichste verboten hat, so
lieb mir seine Freundschaft sei, es wieder zu sagen, so mag ich es doch
dir, meinem guten Gönner, nicht verbergen: denn es ist ein Handel, der
dich besonders betrifft. Du weißest doch, daß der Herr, unser Graf, von
der Eifersucht geplagt ist; und daß dich unsere Gräfin nicht haßt, das ist
auch ausgemacht. Hat sie doch eine besondere Freude an deinem hellen
Gesang und hat dir manchmal deswegen freundlich zugenickt. So hat nun
der Graf geschworen, und der Kanzler hat es gehört, er wolle dir einen
eisernen Vogelbauer machen lassen, da sollst du drin gefangen sitzen wie
ein Kanarienvogel oder eine Nachtigall und sollst nichts als Zuckerbrot
zu essen kriegen; auch wird er es schon zu machen wissen, das deine Stimme
hübsch fein bleibt; und da will er dich aufhängen lassen, zuoberst auf dem
Boden des Schlosses, und sollst da singen dürfen Tag und Nacht und
sollst im übrigen es herrlich haben! Und das soll morgen in aller Frühe
geschehen. Denn der Käfig ist fertig; heute mittag hat der Kanzler, mein
Freund, ihn gesehen!"
Als Fortunat diese Worte hörte, zitterte er am ganzen Leibe und fragte
ihn, ohne sich lange zu besinnen, ob er nirgends einen Ausgang aus der
Stadt wüßte; wüßte er einen, so wollte er ihn bitten, ihm den zu weisen.
"Von Stund an will ich hinweg", sagte er, "und meines Herrn Vorhaben
nicht warten, und gäbe er mir all sein Gut, und könnte er mich zum König
von England machen, und ich sollte dabei ein Vogel sein, im Käfig
gefangen, so will ich ihm keinen Tag mehr dienen! Darum, lieber Rupert,
hilf und rate mir, daß ich hinwegkomme!" — "Lieber Fortunat",
sprach Rupert, "wisse, daß die Stadt an allen Orten beschlossen ist und
niemand weder aus noch ein kommen kann bis morgens frühe, wenn man
zur Mette läutet: da schließt man zuerst das Törlein, das die Kuha
pforte heißt, auf. Aber bedenke, Fortunat, wenn es so um dein Schicksal
steht, so hast du es am Ende doch gut, du wirst besser gehalten als alles
Gesinde im ganzen Haus. Der Vogelbauer ist so hoch und lang, daß du
bequem darin stehen, sitzen und liegen kannst; es ist dir auch, der Kanzler
hat mir's anvertraut, ein feines Bett von Eiderdunen drin zugerichtet,
und ein schönes Gewand bekommst du auch, aus lauter gelben und blauen
Vogelfedern niedlich zusammengeleimt!" — "Eher wollte ich betteln
gehen", rief Fortunat, "und eine Nacht nicht liegen da, wo ich die andere
gelegen!" —Rupert sprach: "Mir ist leid, daß ich dir diese Dinge geoffenbart
habe; denn ich sehe wohl, daß du von hinnen willst l Hatte ich doch
all mein Hoffen auf dich gesetzt, daß wir wie Brüder miteinander leben
wollten! Ja, der Kanzler hatte mir schon heimlich versprochen, daß dir
niemand anders dein Essen und Trinken in dein Vogelhaus sollte bringen
dürfen denn ich. Wenn du aber durchaus von hinnen willst, so darf ich
dich nicht halten!" —"Freilich will ich", sprach Fortunat ganz ängstlich,
"und versprich mir nur, Rupert, daß du meine Abreise nicht offenbaren
willst, bis ich drei Tage hinweggeritten bin!" Rupert verhieß ihm dies
und nahm einen ganz kläglichen Abschied von ihm, küßte und segnete ihn
und wünschte ihm das ganze himmlische Heer zum Schutz. Judas war
ein frommer Mann gegen diesen Rupert.
Inzwischen war es Mitternacht geworden, wo gewöhnlich jedermann
schläft. Nur unserm Fortunat kam kein Schlaf in den Sinn; tede Stunde
deuchte ihm von Tageslänge; immer besorgte er, der Graf möchte nach
ihm schicken und ihn noch vor Tagesanbruch in den Vogelbauer stecken.
Mit Angst und Not wartete er, bis der Himmel sich rötete. Ehe die Sonne
aufging, war er gestiefelt und gespornt, nahm sein Federspiel und seinen
Hund, als ob er auf die Jagd gehen wollte, und ritt so spornstreichs hinweg:
wäre ihm ein Auge entfallen, er hätte sich nicht die Zeit genommen,
es aufzuheben.
***Als Fortunat bei zehn Meilen Weges geritten war; kaufte er ein anderes
Pferd, setzte sich darauf und ritt eilends weiter. Jedoch sandte er
dem Grafen sein Roß, seinen Hund und sein Federspiel alles wieder
heim, damit dieser keine Ursache hätte, nach ihm zu senden. Als der Graf
erfuhr, daß Fortunat ohne Urlaub fortgegangen war, während er selbst
ihm doch weder einigen Unwillen bewiesen noch ihm seinen Sold ausbezahlt
hatte, befremdete ihn dies sehr; er fragte alle seine Diener und
jeden insbesondere, ob keiner wüßte, was doch die Ursache seines Entweichens
sei. Aber alle sagten, sie wüßten es nicht, und schwuren, daß sie ihm
kein Leid getan hätten. Der Graf ging selbst zu seiner Gemahlin in die
Frauengemächer und fragte sie und alle andere Hoffrauen, ob ihm jemand
irgendeinen Verdruß gemacht. Die Gräfin und andere sagten: "Sie wüßten
, daß ihm nie ein Leid geschehen wäre, weder mit Worten noch mit
Werken; nie sei er fröhlicher gewesen, als wenn er am Abend von ihnen
gegangen; er habe ihnen von seinem Lande erzählt, wie da die Frauen bekleidet
gingen, und von andern Sitten und Gewohnheiten. Das alles",
erzählten sie, "sagte er in so bösem Deutsch, daß wir das Lachen nicht
verhalten konnten; und da er uns lachen sah, fing er auch an zu lachen,
und so ist er mit lachendem Munde von uns geschieden." Darauf sprach
der Graf: "Kann ich's jetzt nicht innewerden, warum Fortunat so heimlich
entflohen ist, so erfahre ich es doch später; und fürwahr, wird mir
kund, daß einer der Meinen schuld an seiner Entfernung der soll es
mir entgelten. Ich weiß, daß er bei fünfhundert Kronen gutstehen hatte,
solang er hier gewesen; und hätte ich geglaubt, er würde sein Leben lang
nicht von mir wegbegehren. Ich merke aber wohl, daß er den Mut nicht
gehabt hat wiederzukommen, wenn er seine Kleinode, und was er sonst
Guts hat, mit sich genommen."
Da nun Rupert merkte, daß es seinem Herrn so leid um Fortunat sei,
befiel ihn eine Furcht, und er besorgte, einer seiner Gesellen möchte verraten,
wie er denselben hinweggeschafft hätte: er ging daher zu jedem besonders
und bat sie alle, daß sie doch nirgends melden sollten, wie er der
eigentliche Urheber seiner Entweichung sei; sie gelobten ihm auch, das
getreulich zu tun. Doch hätten sie gerne gewußt, mit was für List er ihn
dazu gebracht habe, daß er so eilig und ohne Urlaub — als hätte er ein
Verbrechen begangen — davongeflohen sei. Da war einer unter ihnen,
der vor allen andern gut mit Rupert stand; dieser lag ihm mit Fragen an
und hätte gerne erfahren, wie er ihn hinweggebracht hätte. Wie nun dieser
mit Fragen nicht ablassen wollte, sagte ihm Rupert, Fortunat habe
ihm das Schicksal seines Vaters anvertraut, wie dieser in Armut gekommen
sei und an dem Hofe des Königs von Zypern diente: "Dann", sprach
Rupert, "hab ' ich ihm gesagt, daß ein reitender Bote zum König von
England eile, ihm zu sagen, wie der König von Zypern tot sei; denn sie
wären Geschlechtsfreunde; der habe mir gesagt, daß der König, solang er
noch bei Leben und gesundem Leib gewesen, seinen Vater Theodor zum
Grafen gemacht und ihm die Herrschaft eines andern ohne Leibeserben
verstorbenen Grafen geschenkt habe. Als ich das sagte, schenkte mir jener
Fortunat nicht viel Glauben; nur sprach er: ,Ich wollte wohl, daß es
meinem Vater wohl erginge', und damit ist er weggeritten." Als die andern
Diener diese Worte vernahmen, sprach einer zu dem andern: "Wie
ist doch Fortunat so unweise gewesen, wenn ihm wirklich ein solches Glück
zugefallen, daß er es unserm Herrn nicht gesagt hat! Der hätte ihn wohl
ehrlich ausgerüstet und unser drei oder vier mit ihm gesandt; so wäre er
mit großen Ehren von hinnen gekommen und hätte sein Leben lang einen
gnädigen Herrn gehabt!"
***Wir lassen nun den Grafen mit seinen Dienern, der nicht ahnte, mit
welchen Lügen Rupert umgegangen war, und vernehmen, wie es Fortunat
weiter ergangen ist. Als er ein anderes Roß kaufte und seinem Herrn das
alte wiedersandte, hatte er immerdar noch Sorge, man möchte ihm nachreiten,
und sputete sich daher, so gut er konnte, bis er nach Calais kam.
Hier fand er ein Schiff, mit dem er nach England fuhr; denn er fürchtete
den Verlust seiner Freiheit so sehr, daß er nirgends sicher zu sein glaubte
als jenseits des Meeres, und erst, als er auf englischem Boden war, fing
er an, wieder guten Mutes zu werden. So kam er gen London, in die
Hauptstadt Englands, wo Kaufleute aus allen Gegenden der Welt am
gesessen sind und ihr Gewerbe treiben. Da war denn auch eine Galeere
aus Zypern angekommen mit köstlichem Kaufmannsgut und viel Hanselsleuten;
darunter waren zwei Jungen, die reiche Väter in Zypern hatten,
und denen viel treffliche Waren anbefohlen waren. Dieselben waren
früher nie außer Lands gewesen und wußten nicht viel, wie man sich in
fremden Landen zu verhalten hätte, außer soviel sie von ihren Vätern gehört.
Als nun die Galeere die Güter ausgeladen hatte und dem Könige
der soll entrichtet war, damit jeder kaufen und verkaufen könnte, fingen
die zwei Jungen an, ihr Gut zu verkaufen, und lösten viel Geld, was
ihnen große Freude machte; denn sie waren nicht gewohnt, mit barem
Geld umzugehen. Zu denen kam Fortunat, und sie empfingen einander
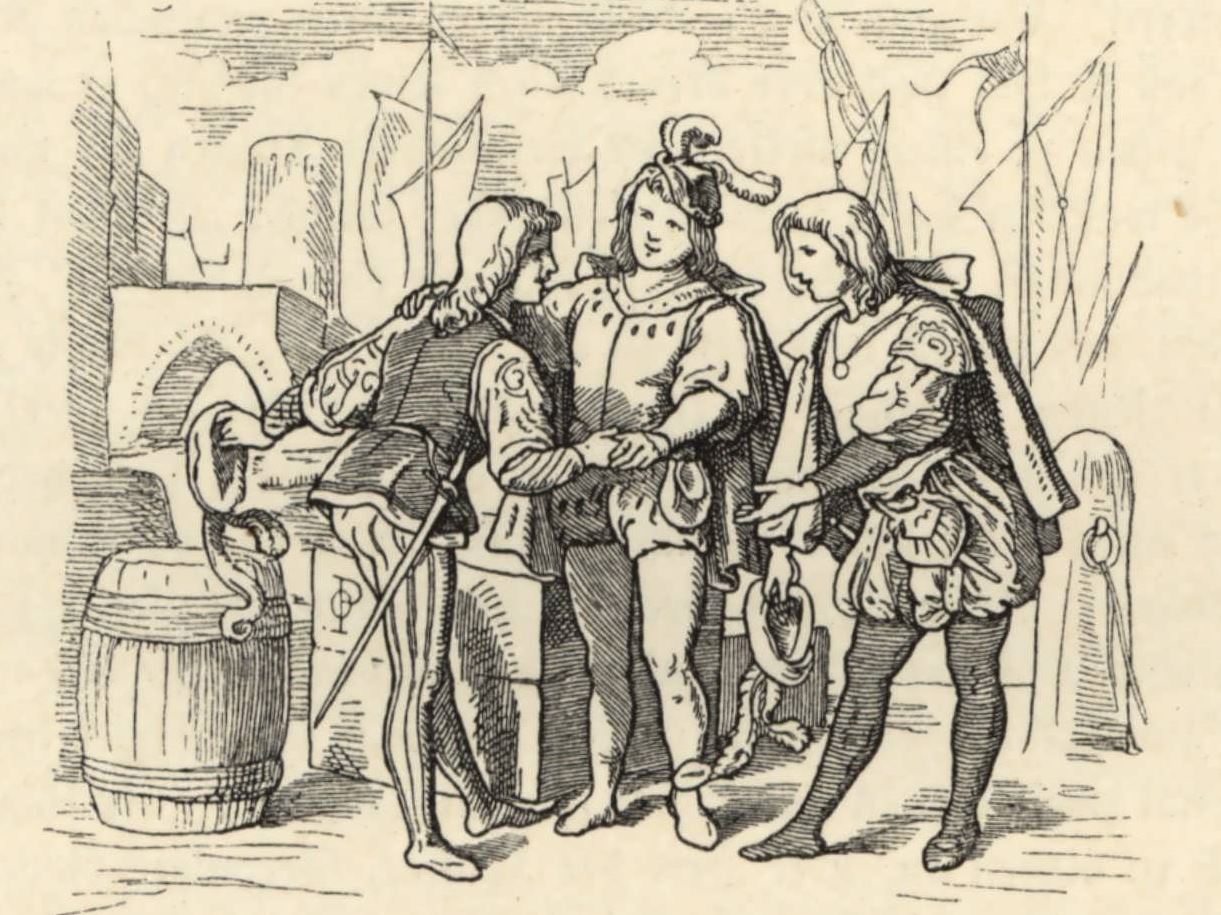
gegenseitig als Landsleute gar herzlich in dem fremden Lande und wurden
gute Freunde. Leider aber fanden sie auch gleich eine Rotte unnützer Buben,
zu welchen sie sich gesellten, und die ehrliche Leute in schlechte Gesellschaft
zu locken und mit Wohlleben und Spielen zu körnen wußten, und
wenn einer etwas Schönes überkam, so wollte der andere noch Schöneres
haben, es koste, was es wolle. Das trieben sie bis zu einem halben Jahr;
da kam es allmählich so weit, daß sie nicht mehr viel Bargeld hatten.
Doch war einer desselben mehr entblößt worden als der andere.
Fortunat, der hatte am wenigsten und ward auch am ersten fertig;
ebenso geschah es den andern; was sie in London gelöst hatten, war alles
bald vertan; als sie nun nichts mehr hatten, war auch die Liebe ihrer
englischen Freunde aus, ja, sie spotteten ihrer und sprachen: "Fahret hin
und holet mehr!" Die andern Kaufleute von Zypern waren auch mit
Kaufen und Verkaufen fertig, und der Patron schickte sich an, wiederabzufahren
. So gingen auch die zwei jungen Kaufleute in ihre Herberge und
fanden wohl, daß sie viel Geldes gelöst hätten, aber nicht viel darum gekauft
, wie ihr Vater doch vorgeschrieben. Vielmehr war alles, wie man
sagt, um nassen Zucker gegeben; und wär ' es auch noch mehr gewesen,
es wäre alles davongegangen. Doch setzten sie sich auf die Galeere und
fuhren ohne Kaufmannsgut wieder heim. Wie sie aber von ihren Vätern
empfangen worden, dafür lassen wir sie sorgen.
Als Fortunat wieder allein war ohne Geld, dachte er bei sich selber:
"Hätte ich nur zwei, drei Kronen, so wollte ich wohl in Frankreich einen
Herrn finden!" So ging er zu einem seiner alten englischen Kumpane
und bat, daß er ihm zwei oder drei Kronen leihen möchte er wolle nach
Flandern gehen zu einem Vetter, der vierhundert Kronen für ihn aufbewahre;
die wolle er holen. Der Geselle aber sprach: "Weißest du Geld
zu holen, das magst du immerhin tun, nur mir ohne Schaden!" Fortunat
merkte wohl, daß er hier kein Geld zu erwarten hätte. Da dachte er: "Ich
muß wohl dienen, so lange, bis ich zwei oder drei Kronen überkomme!"
So ging er des Morgens auf den Platz, den man die Lombarderstraße
nennt, wo alles Volk sich versammelt, und fragte da, ob jemand einen
Knecht bedürfte. Da war ein steinreicher Kaufmann von Venedig, der sich
einen köstlichen Hof von Knechten hielt; denn er brauchte sie alle in seinem
Gewerbe und Handel, der dingte unsern Fortunat und verhieß ihm je für
einen Monat zwei Kronen und führte ihn mit sich heim. Hier fing er früh
über Tisch zu dienen an. Der Herr des Hauses, Geronimo Roberto, sah
ihm wohl an, daß er schon mehr bei ehrsamen Leuten gewesen war; er
verwandte ihn daher dazu, das Gut auf die Schiffe zu führen und ebenso
es, wenn die Schiffe ankamen, zu entladen; denn die großen Schiffe konnten
bis auf eine Entfernung von zwanzig Meilen nicht zu der Stadt
kommen. Was nun sein neuer Herr Fortunaten befahl, das richtete er
wohl aus.
***Nun gab es damals einen Florentiner, eines reichen Mannes Sohn,
mit Namen Andreas, dem sein Vater großes Gut gegeben und ihn damit
nach Brügge in Flandern gesandt hatte. Der junge Mann verschleuderte
dieses in kurzer Zeit und begnügte sich nicht damit, sondern nahm Wechsel
auf seinen Vater auf, indem er demselben schrieb, er wolle ihm großes
Gut senden. Der gute Vater glaubte das und bezahlte also für den Sohn
so lange, bis er nichts mehr hatte, indem er fest auf die Kaufmannsgüter
wartete, die ihm sein Sohn schicken sollte. Als nun der Bube gar nichts
mehr hatte, sein Kredit bei den Kaufleuten verloren war und ihm niemand
mehr borgen wollte, da gedachte er, nach Florenz heimzugehen, ob er nicht
etwa eine alte reiche Witwe fände, die ihn aus der Not reißen und ehelichen
wollte. Auf dem Heimwege kommt er in eine Stadt in Welschland,
Turin genannt; hier lag ein reicher Edelmann gefangen, der aus England
und gerade aus London war, das hörte Andreas von seinem Wirt.
"Mein Lieber", sprach er zu diesem, "könnte ich nicht zu dem gefangenen
Mann kommen?" — "Ich kann Euch wohl zu ihm führen", sagte der
Wirt, "er liegt aber gar hart eingeschmiedet, daß es Euch erbarmen
wird!" Als Andreas zu dem Gefangenen kam, redete er ihn auf Englisch
an. Des ward dieser froh und fragte jenen, ob er nicht zu London den
Geronimo Roberto kenne. — Ja, den kenne ich gar wohl", sprach
Andreas, "er ist mein guter Freund." — "Lieber Andreas", erwiderte
der Gefangene, "tut mir den Gefallen, ziehet hin gen London zu Roberto
und sagt ihm, er soll helfen und raten, daß ich ledig werde; er kennt
mich und weiß wohl, was ich vermag; ich will ihm das Geld, das er für
mich anwenden wird, dreifältig wiedergeben. Darum, lieber Andreas,
befleißige dich und sei mir hilfreich in meiner Lage; ich will dir für
deine Mühe fünfzehn Kronen geben, die Reise bezahlen und noch überdies
dir ein gutes Amt schaffen; sag auch meinen Freunden, daß du hier
bei mir gewesen seiest, und daß sie Bürge für mich bei Geronimo werden
sollen."
Andreas versprach dem Gefangenen, getreulich in seiner Sache zu arbeiten,
zog nach London und brachte seinen Auftrag vor Roberto. Dem
Kaufmann hätte die Sache ganz wohl gefallen, wenn er nur gewiß gewußt
hätte, daß er drei Kronen für eine erhalten werde. Aber den Andreas
kannte er als einen bösen Buben. Nichtsdestoweniger sagte er zu
ihm: "Gehe hin zu seinen Freunden und an des Königs Hof; findest du
Mittel und Wege, mir Bürgschaft zu verschaffen, so will ich das Geld darleihen."
Andreas fragte nach des Gefangenen Freunden und sagte ihnen,
wie es um ihn stehe, wie er so hart in Banden liege. Ihnen aber machte
das wenig Kummer; sie wiesen ihn an den König oder dessen Räte: diesen
sollte er es vorhalten; denn der Engländer sei in seines Königs Dienste
versendet gewesen. Als Andreas an den Hof kam und mit seiner Sache
nicht gleich vorkommen konnte, hörte er sagen, daß der König von England
seine Schwester an den Herzog von Burgund verheiratet habe und
diesem noch schuldig sei, die Brautkleinodien zu senden; selbige habe er
auch mit Mühe zusammengebracht; denn es seien gar köstliche Kleinode,
und sie einem frommen Edelmann aufzubewahren und zu überbringen gegeben,
der zu London mit Weib und Kind ansässig sei.
Dieses ließ sich Andreas nicht zweimal sagen; er eilte hin zu dem Edelmann
, den er am Hofe antraf, und sagte, wie er vernommen hätte, daß
der König dem Herzog von Burgund durch ihn köstliche Kleinode senden
wollte; er bäte ihn daher gar freundlich, daß er ihn, wo es möglich wäre,
die Kostbarkeiten sehen ließe; denn er sei ein Goldschmied, der mit solchen
Kleinodien umgehe, und habe schon zu Florenz gehört, daß der König solchen
Köstlichkeiten nachfrage. Deswegen sei er aus so großer Ferne hergekommen
in der Hoffnung, der König werde ihm auch einige Stücke abkaufen.
Der fromme Edelmann erwiderte: "Wartet nur, lieber Herr, bis
ich gerichtet bin; dann kommet mit mir, ich will sie Euch sehen lassen."
Und als er fertig war zu gehen, führte er den Andreas mit sich heim. Es
war eben Mittag, daher sagte der Edelmann: "Laßt uns zuvor speisen, so
wird meine Frau nicht unwillig!" So aßen sie zusammen; der Edelmann
tischte dem Florentiner tapfer auf, und sie saßen lange miteinander über
der Tafel. Als sie satt gegessen hatten und fröhlich gewesen waren, führte
der Edelmann den Gast in seine Schlafkammer und schloß einen schönen
Kasten auf; daraus zog er eine Lade mit den Kleinodien hervor und hieß
ihn dieselbe zu Genüge sich beschauen. Es waren fünf Kleinode, fünfzigtausend
Kronen an Wert; je länger man sie besah, desto besser gefielen sie
einem. Andreas lobte sie nicht wenig und sprach: Ich habe wohl auch
einige Stücke; wären sie so gefaßt, sie sollten etliche von diesen hier beschämen!"
— Der Edelmann hörte dies gar gerne. "Hat der Welsche",
dachte er, "so köstliche Kleinode, so muß unser Herr König noch mehr kaufens
" So gingen beide wieder gen Hof. Andreas aber sprach: "Morgen
zu Mittag, edler Herr, sollet Ihr mit mir essen im Hause des Geronimo
Roberto; dann will ich Euch meine Kleinode sehen lassen." Das gefiel
dem Edelmann wohl.
Nun ging Andreas zu Geronimo Roberto und sprach zu diesem: "Ich
habe meinen Mann gefunden an des Königs Hof, der wird mir helfen,
daß wir den Gefangenen ledig machen, und wird Euch für gute und gewisse
Bürgschaft sorgen auf des Königs Zölle." Geronimo Roberto war
damit zufrieden. Da sprach Andreas weiter: "Bereitet morgen nur eine
stattliche Mahlzeit, so bringe ich ihn, daß er mit uns ißt!" Dies geschah,
und zur Mittagszeit brachte Andreas den Mann; ehe sie jedoch zu Tische
saßen, flüsterte Andreas dem Roberto ins Ohr, man sollte nicht viel pou
dem gefangenen Manne reden; denn die Sache müßte geheimbleiben. So
aßen sie und waren fröhlich, waren lang über Tische, und als die Mahlzeit
vorüber war, ging Geronimo wieder auf seine Schreibstube. Jetzt
sagte Andreas zu dem Edelmann: "Kommt mit mir hinauf in meine Kammer,
, so will ich Euch meine Kleinode auch sehen lassen." So gingen sie
miteinander in eine Kammer, die war gerade über dem Saal, in dem sie
gesessen hatten; und als sie in die Kammer eingetreten, stellte sich Andreas
an, als wollte er eine große Truhe aufschließen, zückte ein Messer
und stach nach dem Edelmann mit solcher Macht, daß dieser zu Boden
fiel; dann schnitt er ihm die Gurgel ab, zog ihm den goldenen Siegelring,
den er am Daumen hatte, vom Finger, nahm die Schlüssel aus seinem
Gürtel, ging eilends in des Edelmanns Haus und zu seiner Frau und
sprach zu ihr: "Edle Frau, Euer Gemahl sendet mich zu Euch, daß Ihr
ihm die Kleinodien schicket, die er mich gestern sehen ließ; zum Wahrzeichen
sendet er Euch hiebei Ring und Siegel und die Schlüssel zu dem Kästchen,
darin die Kleinode liegen." Die Frau glaubte diesen Worten und schloß
das Kämmerlein auf, in welchem das Kästchen sich sonst befand. Sie fanden
jedoch die Kleinode nicht. Der Schlüssel waren drei, aber an diesem
Bunde fanden sie auch keinen, der für das Kästchen bestimmt war. Die
Frau gab dem Welschen alles wieder und sagte: "Gehet hin, Herr, und
saget meinem Mann, wir können Schlüssel und Kasten nicht finden, er
solle selbst kommen und sehen, wo beide seien."
Während nun Andreas in des Edelmanns Haus gegangen war, floß
das Blut durch die Dielen in den Saal und von da hinunter in Robertos
Schreibstube. Das sah der Herr, rufi auf der Stelle seinen Knechten und
spricht: "Von wannen kommt das Blut?" Diese liefen und sahen nach
und fanden endlich den frommen Edelmann zuoberst in der Kammer tot
liegen. Da erschraken sie sehr und wußten vor großem Schrecken nicht,
was sie anfangen sollten. Wie sie nun so dastanden, kommt der Schalk
Andreas daher. "Was hast du getan", schrien sie auf ihn zu, "daß du
diesen Mann ermordet hast?"Er sprach kaltblütig: "Der Bösewicht wollte
mich ermorden; denn er glaubte, Kostbarkeiten bei mir zu finden; so ist es
mir lieber, daß ich ihn ermordet habe als er mich! Darum schweiget still
und macht kein Geschrei, so will ich den Mann in den Hausbrunnen werfen,
und wenn jemand nach ihm fragt, so saget: ,Als die Herren gegessen
hatten, gingen sie hinweg; seither haben wir keinen gesehen. ' Damit warf
er den Leichnam in den Brunnen und eilte Tag und Nacht, daß er aus
dem Lande kam; an keinem Orte durfte er bleiben; denn immer meinte
er, es wären Boten nach ihm geschickt und die Strafe seines Mordes werde
ihn ereilen. So kam er nach Venedig, verdingte sich dort als Ruderknecht
auf eine Galeere und fuhr nach Alerandrien. Kaum dort angekommen,
verleugnete er den christlichen Glauben; dafür wurde der Schalk gut gehalten
und war auch sicher vor der Missetat, die er getan; ja, hätte er hundert
Christen ermordet, so wäre er geborgen gewesen.
***Der Tag, an dem der Mord geschehen, ging zu Ende, als Fortunat von
der Stätte, wo er seines Herrn Gut in ein Schiff geladen hatte, nach London
zurückkam. Als er auch hier das ihm anbefohlene Geschäft wohl verrichtet
hatte und in seines Herren Haus kam, da wurde er nicht so schön
begrüßt und empfangen als die andern Male, die er ausgewesen war.
Auch dünkte ihm, Herr, Gesellen, Knechte und Mägde seien nicht so fröhlich,
wie er sie verlassen hatte. Es bekümmerte ihn dieses nicht wenig, und
er fragte die Kellnerin des Hauses, was sich denn während seiner Abwesenheit
begeben hätte, daß sie alle so traurig wären. Die gute alte Haushälterin
, die auch dem Herrn sehr lieb war, sagte zu ihm: "Fortunat, laß
dich's nicht bekümmern; denn unserm Herrn ist ein Brief aus Florenz gekommen,
daß ihm ein so gar guter Freund dort gestorben sei; darüber ist
er sehr ,betrübt; doch ist derselbe ihm nicht so nahe verwandt, daß er sich
deswegen schwarz tragen dürfte; es wäre ihm aber lieber ein Bruder gestorben
als jener werte Freund." Dabei ließ es Fortunat bewenden, fragte
nicht weiter und half seinem Herm auch traurig sein.
Aber der fromme Edelmann kam des Nachts nicht in sein Haus zurück
und ließ auch seiner Frau nichts sagen; denn er war tot und lag im Brunnen.
Die Frau nahm es wunder, daß er nicht kam; doch schwieg sie stille.
Als er aber am andern Morgen noch immer nicht zurückkehrte, schickte sie
Anverwandte an des Königs Hof; ihrem Manne nachzufragen, ob etwa
der König ihn in seinem Dienste ausgesandt hätte oder er sonst irgendwo
wäre. Sobald man nun am Hofe hörte, daß nach ihm gefragt werde, da
wunderten sich die Räte des Königs erst, daß der Mann nicht nach Hofe
gekommen war. So kam die Kunde vor den König, und dieser sagte:
"Gehet doch alsbald in sein Haus und sehet, ob er die Kleinodien nicht
hinweggebracht habel"Denn dem Herrn kam ein Argwohn, er möchte sich
mit den Kostbarkeiten entfernt haben, wiewohl er ihn für einen Biedermann
hielt; dennoch dachte er, das große Gut und die Versuchung könnten
ihn zu einem Bösewicht gemacht haben. So kam es, daß je einer den
andern fragte, ob er nicht wüßte, wo der Edelmann hingekommen wäre;
niemand aber wußte etwas von ihm zu sagen. Der König sendet gar
eilends in das Haus der Frau, daß man fragte und nachsähe, wo die
Kleinode wären. Wiewohl ihm der Edelmann lieb war, so ließ er doch den
Kleinodien viel eifriger nachfragen als dem frommen Mann; woraus man
wohl erkennen kann, daß, wenn es an Hab und Gut geht, bei vielen Menschen
alle Liebe aus ist. Als man die Frau fragte, wo ihr Mann wäre
und die Kostbarkeiten, sprach sie: "ES ist heute der dritte Tag, daß ich ihn
nicht gesehen habe." — "Was sagte er aber", fragten die Leute, "als er
zuletzt von Euch ging?"Sie sprach: "Er wollte mit den Florentinern essen
und schickte mir einen mit seinem Siegel und den Schlüsseln, ich sollte ihm
die Kleinode senden; er wäre in Geronimo Robertos Hause, dort habe
man auch viele Kostbarkeiten, die wollten sie gegeneinander schätzen. So
führte ich denn jenen in meine Kammer und tat ihm den Behälter auf, zu
dem er auch den Schlüssel hatte; aber die Kleinode fanden wir nicht, und
so ging der Mann ohne dieselben hinweg, was er sehr ungerne tat. Auch
ließ er mich recht ernstlich darnach suchen, wir konnten sie aber nicht finden
den." Die Männer fragten, ob der Edelmann denn nicht seinen besondern
Verschluß dafür hätte. "Nein", sagte sie, "er hatte keinen andern; was er
Gutes hatte, Brief und Siegel, das legte er alles in diesen Kasten, und da
standen auch die Kleinodien; sie waren aber nicht mehr da. Wären sie dagewesen
, ich hätte sie ihm gewiß durch den Fremden gesandt!"
Als die Boten dies hörten, ließen sie alle Kisten, Behälter und Truhen
aufbrechen, fanden aber die Kostbarkeiten nirgends. Die Frau erschrak
sehr, daß man in ihrem eigenen Hause solche Gewalttätigkeiten sich erlaubte
; die Boten aber erschraken ebenfalls, als sie nichts fanden. Der
König, dem dies gemeldet wurde, ward traurig, mehr um die schönen
Kleinode als um das Geld, das sie gekostet; denn solche Dinge findet man
nicht leicht zu kaufen; man mag soviel Geld haben, als man will. Weder
der König noch seine Räte wußten, was in der Sache zu tun wäre. Nur
so viel beschloß man, den Roberto und all sein Gesinde zu verhaften, damit
sie Rechenschaft ablegten wegen des Edelmanns. Es geschah dies am
fünften Tage, nachdem der Mann ermordet worden war. Die Knechte des
Richters warteten die Zeit ab, wo bei Roberto alles am Mahle saß; dann
fielen sie ins Haus und fanden alle beieinander, den Herren, zween Schreiber
, einen Koch, einen Stallknecht, zwo Mägde und — Fortunat, so daß
ihrer acht Personen waren; die führte man ins Gefängnis, jeden besonders,
und fragte auch jeden insbesondere, wo die zwei Männer hingekommen
wären. Alle sagten einstimmig aus, nachdem sie gegessen hätten,
seien sic hinweggegangen, und nachher hätten sie sie nicht mehr gesehen
noch von ihnen gehört. Doch begnügten sich die Richter damit nicht: sie
nahmen dem Herrn und den andern allen ihre Schlüssel, gingen in das
Haus und durchsuchten alle Ställe, Keller und Gewölbe, wo Roberto seine
Kaufmannsgüter aufbewahrt hatte, kurz allerorten, ob der Edelmann
nicht irgendwo begraben läge; aber sie fanden nichts. Eben wollten sie
hinweggehen, als einem, der eine große brennende Kerze oder ein Windlicht
in der Hand hatte, womit er alle Winkel durchsuchte, der Brunnen
hinter dem Hause ins Auge fiel. Dieser eilt ins Haus zurück, zieht aus
einer Bettstatt eine Handvoll dürres Stroh, geht hinaus, zündet's an seinem
Licht an und wirft es in den tiefen Schöpfbrunnen. Schnell blickt er
nach und sieht den Fuß eines Mannes aus der Tiefe emporragen. Mit
lauter Stimme rief der Knecht: "Mord und wieder Mord, hier im Brunnen
liegt der Mann." Sofort ward der Brunnen gebrochen und der Mann,
dem die Kehle durchstochen und der schon halb verwest war, herausgezogen,
auf die offene Straße vor Robertos Haus gebracht und dort niedergelegt.
Als die Engländer den großen Mord innewurden, entstand Entrüstung
gegen die Florentiner und alle Lombarden, so daß sie sich verbergen und
einsperren mußten; denn hätte man sie auf offener Straße gefunden, so
wären sie von dem Volke alle erschlagen worden. Die Geschichte kam
schnee vor den König und den Oberrichter. Da ward befohlen, daß man
Herrn und Knechte martern solle, damit man den rechten Hergang der
Sache erführe; besonders aber solle den Kleinodien nachgefragt werden.
So kam denn der Henker, nahm zuerst den Herrn, legte ihm Daumenschrauben
an und peinigte ihn, daß er bekennen sollte, wer den Edelmann
ermordet hätte, und wo die Kostbarkeiten des Königs wären. Wohl konnte
der gute Geronimo an dem großen Ungestüm und der furchtbaren Marter
merken, daß der Mord kundbar geworden war, wiewohl derselbe in seinem
Hause ohne sein Wissen verübt worden und ihm selbst am meisten leid
tat. Doch konnte er es nicht ändern und erzählte seinen Peinigern, wie
alles gegangen war; wie Andreas ihn gebeten, ein gutes Mahl zuzubereiten;
er wollte einen Edelmann mitbringen, der ihm einen andern englischen
Edeln, der zu Turin gefangenliege, der Bande zu erledigen helfen
wolle. "Dies tat ich", sprach Roberto, "in allem Guten, meinem gnädigen
Herrn, dem König, und dem ganzen Land zulieb, und dachte nichts anders.
Als die Mahlzeit vollbracht und schon von mir vergessen war, auch ich in
meiner Schreibstube saß, schrieb und unter dem Schreiben aufblickte, da
sah ich, wie durch die Decke meiner Kammer ein Schweiß herabfloß. Ich
erschrak und sandte meine Knechte, daß sie sehen sollten, was es wäre.
Die sagten mir, wie die Sachen stehen. Ich konnte mir nicht denken, wie
es zugegangen war: indem kam der Schalk Andreas gelaufen, und ich
setzte ihm hart wegen des Mordes zu. Er aber sagte, der Mann habe ihn
ermorden wollen, nahm den Leichnam und warf ihn in den Brunnen;
dann ging er weg; wo er hingekommen, weiß ich nicht." Wie Roberto
sagte, so sagten die andern alle, so arg man sie peinigte; nur Fortunat;
der auch gemartert wurde, bekannte nichts; denn er war nicht zu Hause
gewesen, als der Mord sich ereignete.
Da man auf diese Weise nichts erfuhr und die Kleinode nicht zum Vorschein
kamen, wurde der König sehr zornig und befahl, daß man sie alle miteinander
an einen neuen Galgen hängen und mit Ketten wohl anschmieden
solle, damit sie niemand herabnehme und sie nicht so bald herabfallen,
sondern jedermänniglich zur Warnung hängen bleiben sollten. So
wurden sie nacheinander gehenkt, bis nur noch der Koch und Fortunat
übrig waren. "Ach", dachte dieser, "wäre ich bei meinem frommen Herrn
und Grafen geblieben und hätte mich lieber zum Sangvögel machen lassen,
so wär' ich doch jetzt nicht in diese Angst und Not gekommen t" Als
man aber den Koch, der ein Engländer war, henken wollte, schrie dieser
mit lauter Stimme, daß es jedermann hören konnte, Fortunat wisse nichts
von all diesen Dingen. Der Richter glaubte selbst an seine Unschuld, doch
wollte er ihn mit hängen lassen, gleichsam aus Mitleid, weil er doch als
Welscher zu Tod geschlagen werden würde. Dennoch handelte man mit
dem Richter, weil Fortunat kein Florentiner und überdies unschuldig sei,
so daß dieser endlich zu dem Jüngling sprach: "Nun mach dich auf der
Stelle aus dem Lande; denn die Weiber auf der Straße würden dich zu
Tode schlagen!" Damit gab er ihm zwei Knechte bei, die ihn bis an die
Themse führten. Fortunat schiffte sich ein, so geschwind er konnte, fuhr
den Strom hinab und war froh, als er auf der offenen See war und das
englische Land hinter sich hatte, wo man so schnell mit dem Henken bei
der Hand ist.
***Nachdem Geronimo Roberto mit seinem Gesinde gehenkt war, gab der
König sein Haus der Plünderung preis, doch hatten des Königes Räte
vorher das Beste wegbringen lassen. Die Florentiner und alle Lombarden
aber, als sie dies hörten, trugen Sorge um Leib und Gut und sandten dem
Könige eine große Summe Geldes, damit er ihnen frei Geleite gäbe, weil
sie ja doch keine Schuld an dem Morde hätten. Der König gewährte ihnen
dieses von Rechts wegen. Aber wo seine Kleinodien hingekommen, wußte
er immer noch nicht; daher ließ er öffentlich ausrufen, wer Nachricht darüber
zu erteilen vermöchte, dem sollte man tausend Nobel geben; auch
wurde an vieler Könige, Fürsten und Herren Höfe geschrieben, ebenso an
mächtige und reiche Städte: wenn jemand käme, der dergleichen Kostbarkeiten
feilböte, so sollte man Beschlag darauf legen. Dennoch konnte man
nichts davon erfahren, so gern jedermann das Geld gewonnen hätte.
Dies stand so lange an, bis des Edelmanns Frau dreißig Tage um ihren
Eheherrn getrauert hatte; dann legte sie das Leid von Tag zu Tag mehr
beiseite und lud ihre Gespielen und Nachbarinnen zu Gaste. Unter diesen
fand sich eine, die auch erst kürzlich zur Witwe geworden war; diese sprach:
"Wenn Ihr mir folgen wollet, so will ich Euch lehren, wie Ihr den übermäßigen
Kummer um Euren toten Eheherrn bald loswerden könnet.
Schlaget nur Euer Bett in einer andern Kammer auf oder, wenn Ihr das
nicht möget, so rücket wenigstens die Bettstatt an einen andern Ort, und
wenn Ihr Euch zu Bette leget, so denkt fein hübsch an die Lebendigen und
sprechet: ,Die Toten zu den Toten, und die Lebenden zu den Lebenden!
Also tat ich auch, als mir mein Ehegemahl gestorben war." Die Frau
aber erwiderte: "O liebe Gespiele, mein Mann ist mir so recht lieb gewesen,
ich kann seiner so bald nicht vergessen!" Doch hatte sie sich die
Worte der Freundin gemerkt, und als sie wieder allein war, dachte sie:
"Das kann ja dem Andenken an den Seligen nichts schaden!" und fing
gleich an, ihre Schlafkammer aufzuräumen, ihres Mannes Kisten und
Geräte aus dem Zimmer zu tragen, die ihrigen an deren Stelle zu setzen,
endlich auch die Bettstatt zu verrücken. Als aber dieses geschah, siehe da
stand die Lade mit den Kleinodien unter dem Bette an einem der Bettstollen.
Gleich erkannte die Frau das Lädchen, griff mit Hast darnach und
nahm es zu sich. Im übrigen ließ sie die Kammer scheuern und ausrüsten;
dann berief sie ihre nächsten Verwandten, erzählte ihnen alles und begehrte
ihren Rat, wie sie es mit den Kleinodien halten sollte. Als ihr
ältester Verwandter sich von dem Staunen über den herrlichen Fund erholt
hatte, sprach er zu ihr: "Wenn Ihr meines Rates begehrt, so sage ich
Euch, daß mir das beste scheint, auf der Stelle mit den Kleinodien vor
den König zu gehen, ihm die ganze Wahrheit zu sagen und ihm dieselben
zu überantworten. Überlässet seinem Edelmut, ob er Euch etwas davon
schenken will. Wolltet Ihr so große Kostbarkeiten verheimlichen oder in
ein fremdes Land verkaufen, so wäre das übelgetan und könnte doch nicht
verborgen bleiben; denn dieselben sind nach des Königs Ausschreiben in
allen Orten bekannt. Würde man es inne, so kämen alle, die damit umgegangen
sind, und zuerst Ihr selber um Leib und Gut, und der König
erhielte doch wieder sein Eigentum."

Dieser Rat gefiel der ehrlichen Frau ganz wohl; sie legte ihre schönsten
Kleider an, doch waren es Trauergewande, wie sie es ihrem Manne
schuldig war; ihr Verwandter begleitete sie, und so kam sie mit diesem
in des Königs Palast und begehrte vorgelassen zu werden. Der König
vergönnte ihr dieses, und so trat sie in den Audienzsaal, und als sie
vor den König kam, kniete sie nieder, bewies ihm alle Ehrfurcht und
sprach: "Gnädigster König und Harrt Ich komme vor Eure Majestät, um
Euch kundzutun, daß ich die Kleinode, die Ihr meinem seligen Ehemann
der Frau Hezogin von Burgund zu überantworten anbefohlen habt,
dieses Tages in meiner Schlafkammer hinter einem Bettstollen gefunden
habe, als ich meine Lagerstatt verändern wollte. Darum habe ich mich
beeilt, dieselben Euch, als dem rechtmäßigen Herm, zuhanden zu geben."
Damit reichte sie ihm die Lade, die sie in den Armen trug, dar. Der
König nahm das Kistchen, öffnete es und fand zu seiner großen Freude
die fünf köstlichen Kleinode darin unversehrt. Er betrachtete sie mit
vielem Wohlgefallen; auch freute es ihn, daß die Edelfrau so ehrlich war,
und er fand es billig, sie zu begaben, weil ihr armer Mann um dieser
Kleinode willen sein Leben hatte lassen müssen. Er rief daher einen jungen
Edelmann seines Hofes, der recht hübsch und wohlgestaltet war, und
sprach: "Lieber Sohn, ich will eine Bitte an dein Herz legen, die sollst
du mir nicht versagen." Der Jüngling sprach: "Herr, Ihr sollt nicht
bitten, sondern gebieten, und ich muß allen Euren Geboten gehorsam
sein."
Sofort ließ der König einen Priester kommen, und sogleich in seiner
Gegenwart gab er der Witwe den Jüngling zum Gemahl und begabte
sie reichlich. Beide lebten auch wirklich in Frieden und Freuden miteinander;
die Frau ging zu ihrer Gespiele und dankte ihr herzlich für den
Rat, den sie ihr gegeben, und auf den sie ihre Bettstätte verändert hatte:
"Denn", sprach sie, "wäre ich Eurem Rate nicht gefolgt; so hätte unser
Herr König seine Kleinode nicht, und ich nicht einen hübschen, jungen
Mann. Darum ist es gut, wenn man weiser Leute Rat befolgt."
***Nun höret, wie es Fortunaten weiter ergangen ist, als er des Galgens
erledigt war! Er hatte gar kein Geld mehr, als er in französischen Landen
in der Pikardie ankam. Gern hätte er gedient, aber er wußte nicht; wie
an einen Herrn kommen. So ging er weiter nach der Bretagne. Dort
kam er in einen wilden Wald, in welchem er den ganzen Tag fortwandelte
und als es Nacht wurde, kam er zu einer alten Glashütte, in welcher
man vor vielen Jahren Glas gemacht hatte. Da wurde er froh; er
meinte, hier Leute zu finden, aber da war keine Seele. Die Nacht über
blieb er jedoch in der ärmlichen Hütte unter großem Hunger und sehr
bekümmert, denn die wilden Tiere durchstreiften den Wald. Ihn verlangte
sehr nach dem Tag; da, hoffte er, sollte Gott ihm aus dem Walde
helfen, daß er nicht Hungers stürbe. Am andern Morgen nahm er seinen
Weg quer durch den Wald; aber je mehr er ging, je weniger konnte er
aus dem Holze kommen, und so verstrich auch der Tag zu seinem großen
Herzeleid. Als es Nacht zu werden anfing, wurde er ganz kraftlos; denn
er hatte in zweien Tagen nichts gegessen. Von ungefähr kam er an einen
Brunnen, aus dem er mit großer Begierde trank. Dies gab ihm wieder
Kraft, er setzte sich bei dem Brunnen nieder und ließ den hellen Mond
auf sich niederscheinen. Auf einmal vernimmt er ein Prasseln im Walde
und hört einen Bären brummen. "Das lange Sitzen", dachte er, "ist aus,
das Fliehen frommt auch nichts mehr; denn die wilden Tiere überholen
die Menschen bald." So bestieg er einen großen vielästigen Baum zunächst
an dem Brunnen; von dem herab sah er zu, wie mancherlei Geschlechte
wilder Tiere kamen zu trinken, einander stießen und bissen und
wilden Lärm untereinander verführten. Unter diesen war auch ein halberwachsener
Bär, der bekam Fortunats Spur auf dem Baum und fing
an, an diesem hinaufzuklettern. Fortunat, in großer Furcht, stieg je
länger, je höher auf den Baum hinauf; der Bär ihm immer nach. Auf
dem letzten Ast blieb Fortunat reiten, zog seinen Degen und stach dem
Bären verzweifelt zu wiederholten Malen in den Kopf. Der Bär wurde
zornig, ließ seine Vordertatzen vom Baume los und schlug nach Fortunat
so hitzig, daß ihm auch die Hinterbeine entwischten und er mit
großem Gerassel hinter sich vom Baume herabfiel, daß es durch den
Wald erschallte und die andern Tiere, so schnell sie konnten, davonflohen.
Fortunat aber saß noch immer auf dem Baume und wagte sich nicht
herab; endlich aber, da es ihn so gar schläferte und er unversehens von
dem Baume herabzustürzen und zu Tode zu fallen fürchtete, stieg er
mit großer Angst leise herunter, durchstach den Bären, der noch immer
halbtot unter dem Baume lag, legte seinen Mund auf die Wunde und
sog etwas von dem warmen Bärenblut in sich, wodurch er wieder zu
Kräften kam. Doch bedurfte er so sehr des Schlafes, daß er sich ohne
Bedenken neben dem toten Bären hinlegte und bis gegen Morgen einen
guten Schlaf tat.
Als Fortunat erwachte, staunte er nicht wenig; denn er sah ein gar
schönes Weibsbild vor sich stehen. Er fing an, Gott recht inniglich zu
loben. "Oh, wie danke ich dir, allmächtiger Gott", sprach er, "daß ich
vor meinem Tode doch noch einen Menschen zu sehen bekommet Liebe
Jungfrau, ich bitte Euch, wollet mir helfen und raten, daß ich aus diesem
Walde komme; denn heute ist der dritte Tag, daß ich durch denselben
gehe ohne alle Speise!" Darauf erzählte er, was ihm widerfahren war.
"Von wannen bist du denn ?" hub die Jungfrau an zu sprechen. "Ich
bin aus Zypern!"sagte Fortunat. "Was gehest du denn hier in der Irre
um?"fragte sie weiter. "Mich zwingt Armut dazu", antwortete er, "ich
gehe um und suche, ob mir Gott soviel Glücks verleihen wolle, daß ich
meine tägliche Notdurft habel" — Da sprach die Jungfrau: "Fortunat;
erschrick nicht! Ich bin Fortuna, die Herrin des Glückes, und unter
Einfluß des Himmels, der Sterne und der Planeten sind mir sechs Tugenden
verliehen, die ich forthin wieder verleihen kann, eine oder mehr
oder alle miteinander; diese sind: Weisheit, Reichtum, Stärke, Gesundheit
, Schönheit und langes Leben. Wähle dir eins unter den sechsen und
bedenke dich nicht lange; denn die Stunde, wo das Glück dir geben kann,
ist nächstens abgelaufen!"
Fortunat bedachte sich nicht lange, er sprach: "Nun, wenn es sein
muß, so begehre ich Reichtum, damit ich immerdar Geldes genug habe."
Von Stund an zog jene einen Säckel heraus, gab ihn dem Jüngling und
sprach: "Nimm diesen Säckel; sooft du dareingreifest, in welchem Lande
du immer sein magst, und was für Geld in demselben landläufig sein
mag, so findest du darin zehn Goldstücke nach des Landes Währung.
Dieser Beutel soll solche Tugend haben für dich und deine Kinder und
für jeden andern, der ihn besitzt, solange du und deine Kinder leben; aber
wenn ihr gestorben seid, hat seine Tugend und Eigenschaft ein Ende.
Darum laß dir ihn lieb sein und trage Sorge dafür!"Obgleich Fortunat
in seinem Hunger nach nichts anderem verlangte als nach Speise; so
gab ihm doch der Säckel und die Hoffnung, die sich daran knüpfte, einige
Kraft, und er sprach: "O tugendreichste Jungfrau, da Ihr mich mit einer
so trefflichen Gabe erfreut habt; so ist es doch billig, daß ich auch um
Euretwillen etwas tue und der Wohltat nicht vergesse, die Ihr mir
erwiesen habt!" Die Jungfrau sprach gar gütig zu Fortunat: "Weil du
so willig bist; mir meine Guttat zu vergelten, so befehle ich dir folgendes,
das du auf den heutigen Tag, solange du lebest, um meinetwillen leisten
sollst: du wirst diesen Lag jährlich feiern, mit nichts an demselben dich
verunreinigen, und wo in der Welt du dich befinden magst, darnach forschen,
wo etwa ein armer Mann eine erwachsene Tochter habe, der er
gern einen Mann gäbe und dies doch vor Armut nicht vermöchte. Diese
sollst du samt Vater und Mutter schmuck bekleiden und mit vierhundert
Goldstücken erfreuen; zum Gedächtnis dessen, daß du heute von mir erfreut
worden hifi, erfreue du alle Jahre eine arme Jungfrau!" —"Ja",
rief Fortunat voll Freuden, "edle Jungfrau, ich will diese Dinge unvergeßlich
in meinem Herzen bewahren und redlich halten; denn ich habe
sie demselben zu ewigem Gedächtnis eingedrückt!"Bei alledem jedoch war
es Fortunat sehr angelegen, aus dem Walde zu kommen, und er sprach
weiter: "Schöne Jungfrau, ratet und helfet mir nun auch, wie ich aus
diesem Walde kommet" —"Diese Irrfahrt war dein Glück", erwiderte
das Glück, "folge nur mir nach!" Mit diesen Worten führte ihn Fortuna
mitten durch den Wald auf einen angetriebenen Weg und sprach
weiter: "Geh nur hier gerade fort und kehre dich nicht um; sieh mir
auch nicht nach, wohin ich gehe! Wenn du dieses tust, so wirst du bald
aus dem Walde kommen."

Fortunat befolgte den Rat der Jungfrau, eilte auf dem Wege hin,
kam an des Waldes Ende und sah da ein großes Haus vor sich stehen,
das eine Herberge war, wo die Leute, die durch den Wald reiseten, gewöhnlich
Mittag zu halten pflegten. Als er in die Nähe des Hauses gekommen
war, zog er den Geldsäckel aus dem Busen und griff darein,
ihn zu probieren. Alsbald zog er zehn blanke Goldkronen hervor. Darum
ward er gar froh, ging mit großen Freuden in das Wirtshaus und
sagte zu dem Wirte: "Gib mir zu essen, Freund; denn mich hungert sehr;
ich will dir alles gut bezahlen!" Diese Sprache gefiel dem Wirte sehr
wohl, und er trug ihm das Beste auf, das im Hause zu finden war.
Da ergötzte sich Fortunat; sättigte seinen Hunger und blieb zwei Tage
lang in der Herberge. Dann kaufte er dem Wirt einen Reiterharnisch ab,
damit er desto eher zu einem Herrn käme, bezahlte den Wirt nach
Wunsche und machte sich weiter auf den Weg. Zwo Meilen von der
Straße befand sich ein kleines Städtchen mit einem Schlosse, auf dem
ein Waldgraf wohnte, dessen Amt war, den Forst zu beschirmen, und der
diesen Auftrag von dem Herzog in Bretagne erhalten hatte. In dieser
Stadt ging Fortunat zu dem besten Wirt und fragte ihn, ob es nicht
hübsche Rosse zu kaufen gäbe. Der Wirt sprach: "Ja, erst gestern ist ein
fremder Kaufmann hier angekommen, wohl mit fünfzehn hübschen Pferden;
er geht auf die Hochzeit; die der Herzog mit der Tochter des Königs
von Aragonien halten will; der hat unter diesen fünfzehen drei Rosse,
für die ihm unser Herr Waldgraf dreihundert Kronen geben wollte; er
aber verlangt dreihundertundzwanzig; so stößt es sich nur um zwanzig
Kronen." Fortunat verließ den Wirt, ging in aller Stille in seine Kammer,
zog da aus seinem Säckel auf sechzig Griffe sechshundert Kronen
und steckte sie in seinen alten Beutel. Dann ging er getrost zu dem
Wirt und sagte: "Wo ist der Mann mit den Rossen? Hat er deren wirklich
so hübsche, so möchte ich sie gerne besehens" —"Ich fürchte, er läßt
sie Euch nicht sehen", sprach der Wirt, "denn kaum hat unser Herr, der
Graf, ihn dahin vermocht, sie ihm zu zeigen."Fortunat aber sagte: "Nun,
wenn mir die Rosse gefallen, ich kann sie eher kaufen als der Graf!"
Dem Wirt kam es spöttisch vor, daß er so großsprecherisch redete und doch
nicht Kleider darnach anhatte, auch zu Fuße ging. Doch führte er ihn zu
dem Roßtäuscher und redete diesem so lange zu, bis er ihn die Rosse
sehen ließ. Fortunat musterte sie, und alle gefielen ihm wohl. Doch wählte
er nur die drei, die der Graf gerne gehabt hätte, zog seinen Beutel und
zählte die dreihundertundzwanzig Kronen, um die es sich handelte, auf
der Stelle hin. Dann hieß er die Rosse ins Wirtshaus führen, schickte
nach einem Sattler und hieß ihn Sattel und Zeug aufs köstlichste verfertigen;
dem Wirt aber gab er den Auftrag, ihm zu zween reisigen
Knechten zu verhelfen, denen er guten Sold bezahlen wollte.
Während Fortunat diesen Handel abschloß, erfuhr der Graf den Kauf
und wurde darüber nicht wenig griesgrämlich; denn er hatte im Sinne
gehabt, die Rosse um armer zwanzig Kronen willen am Ende doch nicht
dahintenzulassen; er hatte mit ihnen auf der Hochzeit prunken wollen und
sollte sie jetzt in eines andern Händen sehen! Im Zorn sendet er einen
Diener zu dem Wirt und läßt ihn fragen, was denn das für ein Mann
sei, der die Rosse ihm aus den Händen weggekauft habe. Der Wirt antwortet,
er kenne ihn nicht; denn er sei zu Fuß in seine Herberge gekommen,
jedoch als reisige Knecht und mit einem Harnisch. "Dem Ansehen
nach", sprach er, "hätte ich ihm nicht auf eine einzige Mahlzeit trauen
mögen, aus Furcht, er möchte ohne Bezahlung davonlaufen." Der Knecht
des Grafen wurde zornig und fragte, warum er denn mit ihm gegangen
sei, die Pferde zu kaufen. — "Ei', sprach der Wirt, "ich habe getan,
was jeder brave Wirt seinem Gaste tun soll. Er bat mich, mit ihm zu
gehen. Aber, redlich gesagt, ich meinte, er wäre nicht imstande, auch nur
einen Esel zu bezahlen!"
Der Knecht kam zu seinem Herm zurück und sagte ihm, was er vernommen
hatte. Als nun vollends der Graf hörte, daß der Käufer kein geborner
Edelmann sei, sprach er voll Zorn zu seinen Dienern: "Gehet hin
und sahet mir den Mann! Gewiß hat er das Geld gestohlen oder gar
geraubt und den rechtmäßigen Besitzer ermordet!" So griffen sie den
Fortunat und führten ihn in ein böses Gefängnis. Dann fragten sie ihn
erst, von wannen er wäre. "Er sei von der Insel Zypern", erwiderte Fortunat
, "aus einer Stadt, Famagusta genannt."Auf die Frage, wer sein
Vater sei, antwortete er: "Ein armer Edelmann!" Das hörte der Graf
gerne, daß er aus so fernen Landen war, und fragte ihn weiter, woher
er denn das bare Geld hätte, daß er so reich wäre. Zuversichtlich sagte da
Fortunat: "Er glaubte, nicht schuldig zu sein, zu sagen, woher sein Geld
komme. Wenn jemand aufstände und ihn eines Unrechts oder einer Gewalttat
zeihete, dem wollte er vor jedermann zu Rechte stehen!" — Der
Graf aber sprach: "Dich hilft dein Schwatzen nicht; du wirst mir bald
sagen, woher du dein Geld hast!" Und nun befahl er, ihn auf die Stätte
zu führen, wo die Verbrecher gefoltert werden. Da erschrak Fortunat;
doch setzte er sich vor, eher zu sterben, als die Eigenschaft des Säckels zu
verraten. Wie er nun auf der Folterbank hing, mit schwerem Gewichte
beladen, rief er, man sollte ihn ablösen, so wolle er sagen, wonach man
ihn frage. Als er herabkam, sprach der Graf: "Nun sage mir, woher
kommen dir soviel guter Kronen?" Da erzählte Fortunat, wie er im
Walde verirrt wäre, ungegessen bis an den dritten Tag. "Wie mir
nun", schloß er, "Gott die Gnade erwies, daß ich aus dem Walde entkam,
da fand ich einen Säckel, in dem sechshundertundzehn Kronen
waren." — "Wo ist der Säckel?" rief der Graf. "Eh' ich das Geld gezählt",
sprach jener, "tat ich's in meinen eigenen Beutel und warf den
leeren Säckel in das Wasser, das an dem Wald vorüberfließt." — Da
sprach der Graf: "Et, du Schalk, wolltest du mir entfremden, was mein
ist? Wisse, daß mir dein Leib und Gut verfallen ist; denn was sich in
dem Walde findet, das gehört mir zu und ist mein eigent" —"Gnädiger
Herr", antwortete Fortunat, "ich wußte von diesem Eurem Rechte ganz
und gar nichts; ich lobte Gott um das Geld und hielt es für eine Gottesgabe!"
—"Hast du nicht gehört", schrie der Graf, "wer nicht weiß, der
soll fragen! Und kurzum, richte dich darnach: heute nehme ich dir dein
Gut und morgen dein Leben!" —"Ich Armer", dachte Fortunat bei sich,
"da ich die Wahl hatte unter den sechs Gaben, warum erwählte ich nicht
die Weisheit für den Reichtum; so wäre ich jetzt nicht in der großen Angst
und Not!"
Da fing er an, Gnade zu begehren, und rief: "Gnädiger Herr, habt
Barmherzigkeit mit mir! Was würde Euch mein Tod nützen? Nehmet
das gefundene Gut, wenn es Euer ist, und laßt mir nur das Leben; so
will ich Gott getreulich für Euch bitten alle Tage meines Lebens!" Es
wurde dem Grafen schwer, ihn leben zu lassen; denn er fürchtete, der
Fremde würde das Vorgefallene erzählen, wo er hinkäme, und es dürfte
dies ihm selbst von frommen Fürsten und Herren übel verdacht werden.
Doch ließ er sich von seinen Dienern erbitten, nahm ihm nur das Geld
und die Rosse und gab ihm seine Rüstung wieder und noch überdies
ein paar Kronen zur Zehrung. Aber morgens in aller Frühe ließ er ihn
aus der Stadt führen und allda schwören, sein Lebtag nicht mehr des
Grafen Gebiet zu betreten.
***Fortunat war froh, so davongekommen zu sein, aber er wagte nicht,
über seinen Säckel zu gehen; denn er fürchtete, wenn man Geld bei ihm
fände, so möchte man ihn abermals sahen. So ging er wei Tagereisen
mit geringer Zehrung, bis er in die große bretagnische Stadt Andegavis
kam, die am Meere liegt; hier war viel Volks von Fürsten und Herren
versammelt; denn alle warteten auf die Königin, bei deren hochzeitlichem
Ehrenfeste jeder mit Stechen, Tanzen und andern Lustbarkeiten das
Beste tun wollte. Fortunat sah dieses wohl gerne, doch dachte er bei sich:
"Soll ich das auch mitmachen, wie ich es denn wohl vermag, so möchte
es mir ergehen wie bei dem Waldgrafen!"Doch kaufte er sich zwei schöne
Rosse und dingte einen Knecht; kleidete diesen und sich aufs schönste, ließ
auch die Pferde trefflich zurichten und ritt in die beste Herberge, die es
in der Stadt gab, und so wollte er die Festlichkeiten daselbst abwarten.
Die Königin kam über das Meer her, und man sandte ihr viel köstliche
Schiffe entgegen, sie würdig zu empfahen. Noch herrlicher war der
Empfang, als sie ans Land stieg und ihr Gemahl nebst vielen Fürsten
und Herren ihr entgegenging. So währte die königliche Hochzeit sechs
Wochen und drei Tage. Fortunat sah alles und hatte daran sein Wohlgefallen;

er ging und ritt gen Hof und ließ nie Geld und Geräte in der
Herberge liegen. Dem Wirte gefiel dieses nicht; denn er kannte ihn nicht
und fürchtete, der Fremde möchte ohne Bezahlung von dannen reiten,
wie ihm schon früher geschehen war und auf solchen Hochzeiten manchmal
noch geschieht. Darum sprach er zu Fortunat: "Mein lieber Freund, ich
kenne Euer nicht; seid so gut und bezahlt mich alle Taget" Jener aber
lachte und sprach zu ihm: "Lieber Wirt, ich will nicht unbezahlt hinwegreiten
Damit zog er aus seinem Säckel hundert guter Kronen, gab sie
dem Wirt und sprach: "Nehmet dies Geld, und wenn Euch bedünkt, daß
ich, oder wer mit mir kömmt, mehr verzehrt habe, so will ich Euch mehr
geben, und Ihr dürft mir keine Rechnung darüber stellen." Der Wirt
griff mit beiden Händen nach dem Geld und fing an, Fortunat in großen
Ehren zu halten; sooft er vor ihn trat, griff er an die Mütze, setzte ihn
zu den Vornehmsten oben an die Tafel und gab ihm ein besseres simmer
zu bewohnen, als er bisher eingenommen hatte.
Wie nun einmal Fortunat bei andern Herren zu Tische saß, kamen
mancherlei Sprecher und Spielleute vor der Herren Tisch, den Leuten
Kurzweil zu machen, damit sie Geld verdienten. Unter andern erschien
auch ein armer Edelmann, der klagte den Herren seine Armut und sagte,
er sei aus Hibernien, sei sieben Jahre in der Welt herumgezogen, habe
zwei Kaisertume und zwanzig Königreiche durchfahren, soviel ihrer in
der Christenheit wären; auf diesen Fahrten habe er sich aufgezehrt und
begehre eine Beisteuer, um wieder heimzukommen. Ein Graf, der längeres
Gespräch mit dem Alten pflegte, und dem dieser alle Länder nannte,
wo er gewesen war, reichte ihm über den Tisch vier Kronen und sagte:
"Wenn es sein Belieben wäre, so könnte er dableiben, solange die Feste
dauerten; er wollte für ihn bezahlen." Jener aber dankte und sprach:
"Mich verlanget heim nach meinen Freunden; ich bin gar zu lang ausgewesen!"
Fortunat, der auch auf die Reden des alten Edelmanns gemerkt hatte,
dachte in seinem Herzen: "Möchte es mir doch so gut werden, daß mich
der Alte durch alle die Länder führte; ich wollt' ihn reichlich begaben!"
Als nun die Mahlzeit aus war, sandte er nach ihm und fragte, wie er
mit Namen heiße. "Leopold", erwiderte der Edelmann. "Hab ' ich recht
gehört", sprach Fortunat, "so seid Ihr weit gewandert und an vielen
Königshofen gewesen! Nun bin ich jung und möchte gern in meinen
rüstigen Tagen wandern. Wolltest du mich führen, so würde ich dir ein
Pferd untergeben und einen eigenen Knecht dingen, dich wie meisen
Bruder halten und dir einen guten Sold geben." Auf dieses sagte der
alte Leopold: "Ich für mein Teil möcht ' es wohl leiden, daß ich so
ehrlich gehalten würde; aber ich bin alt, habe Weib und Kind, die wissen
nichts von mir, und die herzliche Liebe zwingt mich, wieder zu ihnen zu
kommen." — "Höre, Leopold", sprach Fortunat, "tu mir meinen Willen!
Dann will ich mit dir nach Hibernien gehen, dir Weib und Kind,
wenn sie am Leben sind, reichlich beschenken, und wann die Reise vollbracht
ist, und wir nach Famagusta auf die Insel Zypern kommen, so
will ich dich, wenn du dort wohnen magst, mit Knechten und Mägden
versehen dein Leben lang!" Leopold dachte: "Der junge Mann verheißt
mir viel; wäre die Sache gewiß, so wäre es ein rechtes Glück für mein
Altert"Daher sagte er zu ihm: "Herr, ich will Euch zu Willen werden,
doch nur insoferne Ihr Euer Vorhaben nicht eher ins Werk setzet, als
bis Ihr mit barem Gelde versehen seid. Denn ohne Geld vollführet Ihr
es nicht!" — "Sorge nicht", sprach Fortunat, "Geld weiß ich in jedem
Lande genug aufzubringen. Drum versprich du mir, bei mir zu bleiben
und die Reise mit mir zu vollendens" So gelobten sie sich einer dem
andern gute Treue, und daß sie einander in keinen Nöten verlassen wollten.
Alsobald zog Fortunat zweihundert Kronen heraus und gab sie dem
Ritter Leopold. "Gehe hin", sprach er, "und kaufe davon zwei hübsche
Pferde! Spare kein Geld; dinge dir einen eigenen Knecht, und wenn er
dir nicht gefällt, so dinge einen anderen. Wenn du kein Geld mehr hast;
will ich dir mehr geben. Du sollst nie ohne Geld sein!"
Das gefiel dem Leopold wohl. Er dachte: "Das ist ein guter Anfang",
und rüstete sich nach Herzenslust. Dasselbe tat Fortunatus; doch nahm
er nicht mehr als zween Knechte und einen Knaben, so daß ihrer sechse
waren. Dann wurden sie miteinander einig, in welcher Ordnung sie
Länder und Königreiche durchfahren, und daß sie zuvörderst das Heilige
Römische Reich besehen wollten. So ritten sie zuerst gen Nürnberg, von
da nach Donauwörth und Augsburg, dann auf Nördlingen und nach
Ulm; gen Kostnitz, Basel, Straßburg, Mainz und Köln. Von Köln zogen
sie gen Brügge in Flandern, von da über die See nach London; dann gen
Edinburg in die Hauptstadt Schottlands, das da neun Tagreisen von
London liegt.
***Als sie dahingekommen waren, hatten sie nur noch sechs Tagreisen
nach Hibernien und in die Stadt, die Leopolds Heimat war. Da erinnerte
Leopold seinen Herrn an dessen Versprechen, und Fortunat war willig,
mit ihm nach Hibernien zu reiten. So kamen sie endlich in die Stadt
Baldric, wo Leopold zu Hause war. Dieser fand Weib und Kind, wie er
sie gelassen hatte: nur hatte einer seiner Söhne ein Weib genommen
und eine der Töchter einen Mann; die alle waren seiner Heimkunft froh.
Weil nun Fortunat wußte, daß in der Haushaltung nicht viel übrig war,
so gab er dem Leopold hundert Nobel, um damit alles reichlich und gut
einzurichten, dann wollte er zu ihm kommen und sein Gast sein. Leopold
machte die nötigen Vorbereitungen, lud seine Kinder mit Mann und
und Weib, auch andere gute Freunde und hielt eine so köstliche Mahlzeit,
daß die ganze Stadt einen Genuß davon hatte. Fortunat war fröhlich
mit ihm, nach dem Mahle jedoch nahm er seinen Freund beiseite und
sprach zu ihm: "Leopold, jetzt nimm Urlaub von Weib und Kind, empfange
hier diese drei Beutel; in jedem sind fünfhundert Nobel, deren jeder
mehr gilt als dritthalb Gulden rheinisch; von diesen Beuteln laß den
einen deinem Weibe, den andern deinem ältesten Sohn, den dritten
deiner ältesten Tochter zur Letze, damit sie Zehrung haben!" Leopold
war dessen sehr froh, dankte ihm und erfreute damit Weib und Kinder.
***Nun hatte Fortunat gehört, daß es nur noch zwei Tagreisen bis nach
der Stadt sei, wo Sankt Patricius ' Fegfeuer ist, die auch in Hibernien
liegt. Das wollte er auch schauen; sie ritten daher mit Freuden nach der
Stadt Bernie. In dieser ist eine große Abtei, und hinten in der Kirche
hinter dem Fronaltar befindet sich eine Türe, durch die man in die finstere
Höhle geht, die des Sankt Patricius ' Fegfeuer genannt wird. In
dieses wird niemand eingelassen ohne des Abts Erlaubnis. Von dem ließ
sich Leopold Urlaub geben; und als der Abt von ihm erfuhr, daß sein
Herr und Begleiter ein Edelmann aus Zypern sei, lud er die beiden zu
Gaste. Fortunat wußte diese große Ehre wohl zu schätzen; er kaufte aus
seinem Säckel ein Faß mit dem besten Weine, den er dort finden konnte;
und schickte dasselbe dem Abt. Denn der Wein ist dort sehr teuer, und
es wurde sonst wenig Wein im Kloster verbraucht, außer zum Gottesdienste
, daher der Abt das Geschenk mit großem Dank aufnahm. Als die
Mahlzeit vollbracht war, fing Fortunat an und sprach: "Gnädiger Herr,
wenn es nicht wider Eure Würde ist, so möchte ich wohl von Euch erfahren,
warum gesagt wird, daß hier des Sankt Patricius ' Fegfeuer sei."
Der Abt sprach: "Das will ich Euch gerne sagen. Es ist vor vielhundert
Jahren da, wo jetzt diese Stadt und dieses Gotteshaus steht, eine wilde
Wüste gewesen. Nicht ferne von hier lebte damals ein Abt, Patricius .
genannt, ein gar andächtiger Mann, der oft in diese Wüste ging, um
der Buße zu leben; da fand er einmal unerwartet diese Höhle, die sehr
lang und tief ist. Er ging in sie hinein so weit, daß er sich in ihren
Gängen verirrte und nicht mehr herauszukommen wußte. Da fiel er auf
die Knie nieder und flehte zu Gott wenn es nicht wider seinen heiligen
Willen wäre, ihm aus dieser Höhle zu helfen. Während er so betete,
hörte er aus der Tiefe der Höhle ein klägliches Geschrei. Ihm aber half
Gott, daß er wieder aus der Höhle kam. Nun dankte er Gott, wurde
noch frömmer als zuvor und seitdem ist durch andächtige Leute an dieser
Stelle das Kloster erbaut worden." — "Was sagen denn die Pilger, die
aus der Höhle kommen?" sprach Fortunat. — Der Abt erwiderte: "Ich
frage ihrer keinen; doch sagen einige, sie haben ein jämmerliches Rufen
gehört; andere erzählen, sie haben nichts gesehen und nichts gehört,
nur daß es ihnen sehr gegrauset habe." Hierauf sprach Fortunat: "Ich
komme aus weiter Ferne; ginge ich nicht in diese Höhle, von der man
soviel erzählt, so wäre es mir ein Schimpf. Daher will ich nicht von
hinnen, ehe ich in dem Fegfeuer gewesen bin."
***Der Abt wollte seinem Verlangen nichts in den Weg legen; nur warnte
er ihn, nicht zu weit in die Höhle hineinzugehen, weil viel Abwege in
derselben seien, wie denn seit seinem eigenen Gedenken es mehreren Besuchern
widerfahren sei, daß sie sich verirrt hätten, deren einige erst
am vierten Tage wiedergefunden werden konnten. Fortunat blieb jedoch
bei seinem Entschluß und fragte seinen Freund Leopold; ob er mit ihm
wolle. "Ja", sprach dieser, "ich gehe mit Euch und will bei Euch bleiben,
solang mir Gott das Leben verleiht." So schickten sie sich des andern
Morgens früh, empfingen das heilige Sakrament und ließen sich
die Höhlentüre aufschließen, die hinter dem Fronaltar im Kloster befindlich
ist. Durch diese traten sie ein, der Priester segnete sie und schloß
hinter ihnen ab. Dann gingen sie hinein in die Finsternis und wußten
nicht; wo aus, noch ein; denn bald waren sie verirrt; sie hörten gegen
Morgen nur das Rufen der Priester bei der Türe, darauf verließen sie
sich und gingen desto kecker hinein. Zuletzt aber wußten sich die beiden nicht
mehr zu helfen, Stunden um Stunden gingen vorüber; sie waren sehr
hungrig und fingen an, ganz zu verzagen, und begaben sich schon ihres
Lebens. "Oh, komm du uns zur Hilfe, allmächtiger Gottl" rief Fortunat
in seiner Herzensangst, "denn hier hilft weder Gold noch Silber,
und ganz umsonst trage ich den Säckel Fortunas in der Tasche!" Und so
saßen sie nieder als aufgegebene Leute, hörten und sahen nichts. Die
Priester, nachdem sie lange gewartet, gingen zu dem Abt und sagten ihm,
daß die Pilger noch nicht herausgekommen. Das war ihm leid, besonders
uni Fortunat, der ihm so guten Wein geschenkt hatte. Auch liefen
die Knechte der Fremden herbei und gebärdeten sich ganz trostlos um
ihre Herren.
Nun kannte der Abt einen alten Mann, der vor vielen Jahren die
Höhle mit Schnüren abgemessen hatte. Nach diesem schickte er und gab
ihm auf, dazu behilflich zu sein, die Männer wieder herauszubringen.
Die Knechte aber verhießen ihm aus ihrer Herren Beutel hundert Nobel.
"Sind sie noch bei Leben", sprach der Alte, "so bringe ich sie heraus",
rüstete sein Zeug und ging hinein. Hier legte er seine Instrumente an und
durchsuchte einen Höhlengang um den andern, bis er sie endlich fand.
Beide waren ganz ohnmächtig und schwach; er befahl ihnen, sich an ihm
zu halten wie ein Blinder an einem Sehenden; dann ging er seinem
Instrumente nach, und so kamen sie mit Gottes und des alten Mannes
Hilfe wieder zu den Menschen. Darüber war der Abt gar fröhlich; denn
er hatte gefürchtet, wenn die Fremden verlorengingen, so möchten keine
Pilger mehr kommen und seinem Kloster dadurch großer Gewinn entgehen.
Der Alte erhielt seine hundert Nobel aus Fortunats Säckel, und

dieser richtete in der Herberge ein köstliches Mahl an, zu welchem er den
Abt und alle Brüder einlud. Er lobte Gott um seine Rettung und hinterließ
dem Abt und Konvent zu guter Letzt hundert Nobel, daß sie Gott für
ihn bitten sollten.
***Nachdem sie sich von dem Abte beurlaubt, ritten Fortunat und seine
Begleiter wieder rückwärts, bis sie über Meer nach Calais kamen, um
die übrige Reise zu vollbringen. Nun zogen sie durch die Pikardie nach
Paris und durch ganz Frankreich, durch Spanien, durch Neapel, durch
Rom bis gen Venedig. Daselbst hörten sie, daß der griechische Kaiser
zu Konstantinopel einen Sohn habe, den er zum Kaiser krönen lassen
wolle, weil er selbst schon bei Jahren war. Davon hatten die Venezianer
gewisse Kunde und hatten deswegen eine Galeere zugerichtet und eine
ehrwürdige Botschaft mit viel köstlichen Kleinodien, die sie dem neuen
Kaiser senden wollten. Nun mietete sich Fortunat mit seinen Begleitern
auf der Galeere ein und fuhr mit den Venezianern nach Konstantinopel.
Dort war soviel fremdes Volk zusammengekommen, daß man nicht Herbergen
genug auftreiben konnte. Den Venezianern wurde daher ein eigenes
Haus eingeräumt; diese aber wollten niemand Fremdes unter sich
haben. So suchte Fortunat mit seinem Gefolge lange eine Herberge und
fand auch zuletzt eine, die freilich keine gute war; denn der Wirt war
ein Dieb.
Fortunat ging nun alle Tage mit den Seinigen den Festlichkeiten
nach. Sie hatten ihre eigene Kammer, welche sie sorgfältig verschlossen;
dadurch glaubten sie ihre Habseligkeiten hinlänglich gesichert. Der Wirt
aber hatte einen heimlichen Eingang in diese Stube; denn da, wo die
größeste Bettstatt an einer hölzernen Wand stand, konnte er ein Brett
herausnehmen und wiedereinsetzen, ohne daß es jemand merkte. Dadurch
ging er ab und zu, während sie bei dem Feste waren, und untersuchte
alle ihre Säcke und Felleisen, aber er fand kein Geld darin; es wunderte
ihn dieses, und er meinte, die Fremden trügen das Geld in ihre Wämser
eingenäht.
Als sie aber einige Tage bei ihm gezehrt hatten, rechneten sie mit dem
Wirt; da wurde dieser erst gewahr, daß Fortunat das Geld unter dem
Tisch hervorbrachte und es seinem Freunde Leopold gab, der alsdann den
Wirt bezahlte. Dieser war auch mit der Bezahlung ganz zufrieden; denn
Fortunat hatte den Ritter angewiesen, keinem Wirte etwas abzubrechen,
sondern immer gerade soviel zu geben, als er verlangte. Doch war es
dem Wirte noch nicht genug, sondern weil er ein Dieb war, hätte er lieber
alles, ja den Säckel selbst zu dem Gelde gehabt.
***Indessen nahte der Tag heran, an dem Fortunat versprochen hatte,
einer armen Tochter für einen Mann besorgt zu sein und sie mit vierhundert
Goldstücken nach Landeswährung zu begaben. Er wandte sich
daher an den Wirt mit der Frage ob er nicht einen armen Mann wüßte,
der eine fromme mannbare Tochter hätte, die er nicht auszusteuern vermöchte
; diesem wollte er die Tochter recht ehrlich begaben. Der Wirt
sprach: "Ja! Ich weiß mehr als eine! Morgen will ich Euch einen braven,
ehrbaren Mann bringen, der seine Tochter mit sich führen soll!"
Dies gefiel unserm Fortunat gar wohl. Was dachte aber der Wirts
"Noch diese Nacht", sprach er zu sich selbst, "will ich das Geld stehlen,
solange sie es noch haben; warte ich länger, so geben sie es aus!"
Und in der Nacht stieg er durch das Loch, als sie in bestem Schlaf lagen,
durchsuchte alle ihre Kleider und hoffte, große Flecke mit Gulden unter
ihren Wämsern zu finden; hier aber fand er nichts; da griff er nach
Leopolds Gürtel und schnitt den Beutel ab, der daran festgenäht war;
darin waren bei fünfzig Dukaten; dann ging er hinter Fortunats Wams
und fand da den Zaubersäckel und schnitt diesen auch ab; als er ihn aber
angegriffen und leer fand, schmiß er den Säckel unwillig unter die Bettstätte
. Dann ging er zu den drei Knechten und schnitt ihnen allen die
Beutel ab, darin er nur wenig Geld fand; alsdann öffnete er Türe und
Fenster, als ob Diebe von der Straße hereingestiegen wären.
***Wie nun Leopold erwachte und Tür und Fenster offen sah, fing er an,
die Knechte zu schelten, und fragte sie, warum sie heimlich bei Nacht
ausgingen und ihren Herrn auf diese Weise beunruhigten. Die Knechte
aber, die schliefen, fuhren halb im Schlafe auf, und jeder versicherte, daß
er es nicht getan habe. Da erschrak Leopold und sah sogleich nach seinem
Beutel, der war ihm abgeschnitten, und der Rumpf hing noch an dem
Gürtel. Jetzt erweckte er auch den Fortunat und rief: "Herr, unsere Kammer
steht an allen Orten offen; Euer Geld, soviel ich noch hatte, ist mir
gestohlen!" Als die Knechte dies hörten, schauten sie nach ihren Beuteln:
da war es ihnen nicht besser gegangen. Schnell schlüpfte Fortunat in sein
Wams, an welchem er den Glückssäckel trug, und fand, daß er ihm auch
abgeschnitten war. Da erschrak er so sehr, daß er niedersank, ihm die
Sinne schwanden und er für tot da lag. Leopold und die Knechte wußten
von der Ursache seines großen Schreckens nichts, sie rieben und labten
ihn, bis sie ihn wieder zur Vernunft brachten. Während sie noch in der
Angst waren, kam der Wirt, stellte sich sehr verwundert, fragte, was sie
denn für ein Leben hätten. Sie sagten ihm, all ihr Geld sei ihnen gestohlen
Da sprach der Wirt: "Was seid ihr nicht für Leute? Habt ihr
nicht eine wohlversperrte Kammer: warum habt ihr euch nicht besser vorgesehene"
— "Wir haben", erwiderten sie, "Fenster und Türen beim
Schlafengehen versperrt, und doch haben wir alles offen gefunden!" Der
Wirt sprach ganz barsch: "Sehet zu, ob ihr es nicht untereinander selbst
euch gestohlen habt! Es ist so viel fremdes Volk hier, ich kann für niemand
stehen!"
Da sich aber so gar übel gebärdeten, ging er auch zu Fortunat; und
als er dessen Gestalt ganz verwandelt sah, fragte er: "Ist des Geldes
denn soviel, das Ihr verloren habt?" Sie sagten ihm, es wäre nicht so
gar viel. "Wie möget Ihr denn so jämmerlich tun um ein weniges Geld",
sagte der Wirt, "gestern noch wolltet Ihr einer armen Tochter einen
Mann geben! Sparet das Geld und verzehret es!" Halbohnmächtig antwortete
Fortunat dem Wirte: "Mir ist mehr um den Säckel leid als um
das Geld, das ich verloren habe. Es ist ein kleiner Wechselbrief darin, der
niemand einen Pfennig nütz ist als mirl" Wiewohl nun der Wirt ein
Schalk war, so wurde er doch durch die Betrübnis Fortunats zur Barmherzigkeit
bewegt und sprach: "Laßt uns doch suchen, ob man den Säckel
nicht wiederfinden kann!"und hieß die Knechte suchen. Da schlüpfte einer
unter das Bett, fand ihn und rief: "Hier liegt ein leerer Säckel!"brachte
ihn auch seinem Herrn vor und fragte ihn, ob das der rechte wäre. —
"Laß mich ihn besehen", sprach Fortunat hastig; da fand er, daß es wirklich
sein Glückssäckel war, der ihm abgeschnitten worden. Nun fürchtete
Fortunat, durch das Abschneiden möchte er seine Kraft verloren haben,
und doch durfte er vor den Leuten nicht darein greifen; denn es wäre ihm
leid gewesen, wenn eine Seele von den Eigenschaften des Säckels gewußt
hätte; auch fürchtete er sich, er möchte mit dem Säckel um das Leben kommen.
Da man wohl sah, daß er vom Schrecken noch ganz blöde war, so
legte er sich wieder zu Bette; hier, unter der Decke tat er endlich seinen
Säckel auf und einen Griff darein. Seine Hand füllte sich mit Gold, und
so ward er zu seiner großen Freude inne, daß der Säckel noch in vollen
Kräften stand wie zuvor. Die Angst hatte ihn aber so mitgenommen, daß
er den ganzen Tag zu Bette bleiben mußte. Leopold wollte ihn trösten
und sagte: "Ach, Herr, gebärdet Euch doch nicht so jämmerlich; wir haben
noch schöne Rosse, silberne Ketten, goldene Ringe und andere Kleinode.
Und wenn wir auch kein Geld mehr haben, so wollen wir Euch doch mit
Gottes Hilfe in die Heimat bringen; bin ich doch auch durch manches Königreich
gezogen ohne Geld!" Leopold meinte nämlich, sein Herr und
Freund besitze in der Heimat große Reichtümer, so daß kein Verlust ihm
etwas schaden könne. "Ach", seufzte Fortunat mit schwacher Stimme,
"wer das Gut verliert, der verliert die Vernunft! Weisheit hätte ich erwählen
sollen, mehr als Reichtum, Stärke, Gesundheit, Schönheit und
langes Leben! Das kann man keinem stehlen!" Und damit schwieg er. Leopold
verstand die Worte nicht, konnte sich auch nicht denken, wie sein Herr
die Wahl unter diesen Stücken allen sollte gehabt haben. Er fragte ihn
auch nicht weiter; denn er glaubte, Fortunat rede im Fieber und wisse
nicht, was er sage. Doch gaben sie sich alle Mühe, bis er ganz wieder zu
sich selbst kam, ass, seine rechte Farbe wiedergewann und anfing, fröhlich
zu werden. Aber weil die Nacht einbrach, befahl er seinen Knechten, Lichter
zu kaufen und die ganze Nacht Kerzen zu brennen, und ein jeder sollte
sein bloßes Schwert zu sich nehmen, daß sie nicht mehr so beraubt werden
könnten. Und sie taten dies.
Am selben Tage noch machte Fortunat, was an dem Glückssäckel aufgetrennt
worden war, aufs sorgfältigste wieder zurecht und ließ denselben,
solang er lebte, nicht mehr an dem Wamse hängen, sondern verwahrte ihn
alle Zeit so gut, daß ihm niemand mehr ihn stehlen konnte. Des andern
Morgens stand er mit seinem Gefolge auf und ging in die Sophienkirche.
In dieser ist eine schöne Kapelle, die zu Unsrer Lieben Frauen heißt. Hier
gab er den Priestern zwei Goldstücke, daß sie Gott, dem Allmächtigen, zu
Ehren eine Predigt halten und den Lobgesang absingen sollten. Als beides
vollbracht war und Fortunat mit seinen Dienern sich in Andacht erbauet
hatte, besuchten sie den Platz, wo die Käufer und Wechsler waren;
als Fortunat da stand, hieß er die Knechte heimgehen, um die Mahlzeit zu
rüsten und die Rosse zu versehen. Seinem Freunde Leopold gab er Geld
und sagte: "Siehe zu, kauf uns fünf gute neue Beutel; inzwischen will ich
zu meinem Wechsler gehen und Geld bringen; ich habe keine Freude, solang
wir ohne Geld sind!" Der Alte tat, wie ihm befohlen war, und
brachte fünf leere Beutel; inzwischen hatte Fortunat, sooft er mochte, in
seinen Säckel gegriffen und tat in einen der Beutel hundert Dukaten; diesen
reichte er dem alten Leopold für alle nötigen Ausgaben; er sollte auch
sich versehen und niemand Mangel leiden lassen; wenn er nichts mehr
hätte, so wollte er ihm mehr geben. Auch jedem der Knechte gab er einen
neuen Beutel und zehn Dukaten darein. Sie sollten fröhlich sein, sagte er
zu ihnen, jedoch Sorge tragen, daß ihnen kein Schaden mehr widerführe.
Sie aber dankten voll Freuden und versprachen es. In den fünften Beutel
tat Fortunat vierhundert Dukaten und sandte nach dem Wirte, damit
er sein Versprechen hielte, ihm eine arme Tochter zum Aussteuern herbeizuschaffen.
***Der Wirt hatte bald eine solche gefunden. Der Tochter Vater war ein
Schreiner, ein frommer, aber grober Mann. Der sagte: "Ich will meine
Tochter nicht hinführen, wer weiß, ob Euer Herr nicht Unehrliches mit
ihr vorhat. Wenn er ihr auch einen Rock kauft, damit ist weder mir noch
ihr gedient! Will er ihr etwas Gutes tun, so komme er zu uns!" Den
Wirt verdroß das; er hinterbrachte es Fortunaten wieder und meinte, den
müßte es auch verdrießen. Diesem aber gefiel die Sprache des Mannes
gerade wohl, und er sagte: "Führet mich zu dem Mannel" Sie gingen in
des Schreiners Haus, und Fortunat sprach zu ihm: "Ich habe vernommen,
daß du eine großgewachsene Tochter hast; laß sie herkommen und
ihre Mutter mit ihr." "Was soll sies"fragte der Mann. "Heiß sie kommen",
sprach Fortunat, "es ist ihr Glück!" Der Mann ruft Mutter und
Tochter; diese kamen beide, aber sie schämten sich sehr; denn sie hatten so
schlechte Kleider an, und die Tochter stellte sich hinter die Mutter, damit
man ihren zerlumpten Anzug weniger bemerken sollte. Da sprach Fortunat:
"Jungfrau, tretet hervor!" Sie war schön und gerade. Er fragte
den Vater nach ihrem Alter. "Zwanzig Jahre", sagten die Eltern. "Wie
habt ihr sie so alt werden lassen, ohne ihr einen Mann zu geben?"fragte
er weiter. Die Mutter konnte nicht warten, bis der Vater sich auf eine
Antwort besonnen. "Sie wäre vor sechs Jahren schon groß genug gewesen,
aber wir haben nichts gehabt, sie auszusteuern!" Darauf sprach
Fortunat: "Wenn ich ihr eine gute Aussteuer gebe, wisset ihr dann einen
braven Mann für sie?" —"Genug ihrer weiß ich", rief die Mutter, "unser
Nachbar hat einen Sohn, der ist ihr hold; hätte sie etwas Geld, er
nähme sie gern!" — "Wie gefiele Euch Eures Nachbars Sohn?" fragte
Fortunat die Jungfrau. "Ich will nicht wählen", sagte diese, "welchen
mir Vater und Mutter geben, den will ich haben; eher wollte ich ohne
Mann sterben als selbst einen nehmen!" Die Mutter konnte nicht schweigen;
"Herr, sie lügt", sagte sie. "Ich weiß, daß sie ihm ganz hold ist, und
daß sie ihn von ganzem Herzen gern haben möchte!"
Jetzt sandte Fortunat nach dem Jüngling, und als dieser kam, gefiel er
ihm sehr wohl. Er nahm deswegen den Beutel, in den er die vierhundert
Dukaten getan hatte, und schüttete sie auf den Tisch. Dann sagte er zu
dem Jungen, der auch nicht viel über zwanzig Jahre zählen mochte:
"Willst du diese Jungfrau zur Ehe? — Und Ihr; Jungfrau, wollet Ihr
den Jüngling zur Ehe? So will ich euch dies wenige Geld zu einer Mitgift
geben!" Der Jüngling sagte: "Wenn Euch die Sache ernst ist, meinethalben
ist sie recht!" Die Mutter aber antwortete schnell: "So ist es
meiner Tochter auch halbrechts" Da sandte Fortunat nach dem Priester
und ließ sie vor Vater und Mutter zusammentrauen. Dann händigte er
ihnen das Geld ein und gab außerdem der Braut Vater noch zehn Dukaten
zu einem Festkleide für sich und sein Weib und ebensoviel, Hochzeit
zu halten. Da war nichts als Freude und Dank. Sie lobten Gott und
sprachen: "Er hat uns den Mann vom Himmel gesandt!"
Jene gingen wieder in ihre Herberge. Leopold verwunderte sich im stillen
, daß sein Herr so freigebig war und das Geld zu Haufen wegwarf, sich
aber doch vor kurzem noch so kläglich angestellt hatte über das wenige, das
ihm gestohlen worden war; dem Wirte machte es großen Kummer, daß er
den Beutel mit den vierhundert Dukaten nicht gefunden, während er doch
alle Säcke und Taschen ausgesucht hatte. "Wenn der Mann so viel auszugeben

hat", murrte er bei sich selbst, "so werde ich ihm doch auch noch
die Taschen leeren können!" Nun wußte er, daß sie des Nachts ein großes
Kerzenlicht brennen ließen, das sie eigens zu diesem Gebrauche hatten
machen lassen. Als sie nun einmal wieder bei des Kaisers Festen waren,
schlich sich der Wirt abermals in ihre Kammer, bohrte Löcher in die Kerze,
tat Wasser hinein und überklebte sie wieder, so daß die Kerze, wenn sie
zwei Stunden gebrannt hatte, von selber wiedererlöschen mußte. Um die
Zeit aber, wo die Feste des Kaisers beinahe zu Ende waren, dachte der
Wirt, Fortunat würde nicht länger zu Konstantinopel bleiben, glaubte,
nicht mehr säumen zu dürfen, und gab seinen Gästen daher beim Nachtessen
den besten Wein, den er bekommen konnte, zu trinken; er selbst war
auch fröhlich mit ihnen und meinte, sie sollten tüchtig darauf schlafen. Sie
aber, als sie zu Bette gingen, ihr Nachtlicht geordnet hatten, und jeder sein
bloßes Schwert an der Seite liegen hatte, glaubten, ohne alle Sorge einschlafen
zu können, und taten es auch.
Aber der Wirt schlief nicht; sondern da er das Licht erlöschen sah, kroch
er wieder durch das Loch, kam vor Leopolds Bett und fing an, ihm unter
dem Kopf zu knistern. Nun schlief aber Leopold in diesem Augenblicke
nicht; er hatte sein scharf schneidendes Schwert bei sich auf der Decke liegen;
schnell erwischte er es und hieb nach dem Wirte; dieser aber bückte
sich nicht tief genug, und so verwundete ihn Leopold so tief in den Hals,
daß er weder ach noch wehe sprach, sondern tot dalag. Leopold rief den
Knechten voll Zorn: "Warum habt ihr das Licht ausgelöschte" Aber alle
und jeder sagten, daß sie es nicht getan. "Geh ' einer", sprach er, "und
zünde ein Licht an, die andern aber sollen mit bloßen Schwertern unter
die Türe stehen und niemand hinauslassen; denn es ist ein Dieb in der
Kammer." Der eine Knecht lief alsbald und brachte ein Licht. "Verschließet
die Türe wohl", rief er seinen Kameraden, "daß der Dieb nicht entrinne
Nun fingen sie an zu suchen; da fanden sie den Wirt mit dem
verwundeten Halse tot liegen bei Leopolds Bettstatt.
Als Fortunat das hörte, erschrak er, wie er sein Leben lang kaum erschrocken
war. "O Gott", sprach er, "bin ich nur nach Konstantinopel gekommen
, daß ich um ein kleines all mein Gut verloren hätte und jetzt gewiß
mit allen den Meinigen das Leben verlieren O Leopold, hättest du ihn
doch nur verwundet und nicht gar zu Tode geschlagen, dann könnten wir
mit Gottes Hilfe und barem Gelde doch noch unser Leben fristen!" — "Es
ist ja Nacht gewesen", erwiderte der alte Ritter, "ich wußte nicht, wieviel
ich tun darf, ich schlug eben nach dem Dieb, der mir unter dem Kopfe knisterte
und uns schon früher bestohlen hatte; den hab ' ich getroffen. Wollte
Gott, man wüßte, über welcher Untat er zu Tode geschlagen worden ist, so
dürften wir gewiß nicht besorgt sein, weder um Leib noch um Gut." —
"Nein", sprach Fortunat, "wir bringen es ewig nicht dahin, daß wir den
Wirt zu einem Diebe stempeln; das lassen seine Freunde nicht geschehen;
da hilft weder Rede noch Geld!" — Fortunat dachte in seiner Angst:
"Wenn ich nur einen Freund hätte, dem ich meinen Säckel anvertrauen
könnte und ihm seine Kraft kundtun. Wenn wir dann gefangensäßen und
sagten, wie es gegangen ist, vielleicht nähmen doch die Richter eine Summe
Geldes von dem guten Freunde für uns!" Dann dachte er wieder: "Aber
wem ich den Säckel gebe, dem wird er so lieb, daß er mir ihn nicht wiedergibt
Deswegen wird er dem Richter raten, daß er den großen Mord nicht
ungerächt lassen solle; er wird sagen: Schande und Schimpf wäre es, daß
man in Konstantinopel sagte: ,Gäste haben ihren Wirt umgebracht, und
sollen nicht geradebrecht werden!"' So wurde er zuletzt bei sich einig, daß
es nicht tunlich wäre, den Säckel aus den Händen zu lassen; nichtsdestoweniger
zitterte sein ganzer Leib, und er war zum Tod erschrocken.
Der alte Leopold allein behielt noch einige Fassung. "Wie seid Ihr so
verzagt", sprach er, "da hilft kein Trauern; die Sache ist geschehen; wir
können den Dieb nicht wieder lebendig machen; laßt uns Vernunft brauchen,
wie wir uns aus der Sache helfen könnens" Fortunat antwortete
ihm, daß er nicht zu raten wüßte; nur dachte er wieder, warum er doch
nicht Weisheit statt Reichtum erwählt habe; dann könnte er jetzt wohl
seine Vernunft brauchen l Leopold aber sprach er: "Weißest du, etwas
Gutes zu raten, so tue es jetzt; denn es ist Notwerk!" —"So folget mir",
erwiderte Leopold, "und tut, was ich heiße; ich denke, Euch mit Gottes
Hilfe ohne alles Hindernis mit Leib und Gut von hinnen zu bringen."
Diese Worte des alten Leopold machten alle froh. Er aber sprach weiter:
"Nur seid fein still! Niemand rede! Verberget auch das Licht!" Und jetzt
nahm er den toten Wirt auf seinen Rücken, trug ihn hinter die Herberge
an einen Stall, wo ein tiefer Ziehbrunnen war, und warf ihn kopfüberwärts
hinein, so tief, daß ihn niemand sehen konnte. Dann kam er wieder
zu Fortunat und sagte: "Nun habe ich uns den Dieb vom Halse geschafft,
so daß man eine gute Weil' nicht wissen wird, wo er hingekommen. Auch
wird er's ja niemand gesagt haben, daß er uns bestehlen wolle; daher
kann auch niemand wissen, daß ihm von uns ein Leid geschehen sei. Darum
seid fröhlich!" Zu den Knechten sprach er: "Gehet ihr zu den Rossen,
rüstet die zu, fanget an zu singen, sprechet von lustigen Dingen, sehet
daß keiner eine traurige Gebärde habe; so wollen wir es auch machen: sobald
es aber Tag werden will, lasset uns sechs Stunden weit reiten."
Diese Worte hörte Fortunat gerne; er fing an, fröhlich zu tun, mehr
als ihm zu Sinne war. Auch die Knechte stellten sich heiter an, und als sie
die Rosse zugerüstet hatten, riefen sie den Hausknechten und Hausmägden,
schickten nach Malvasier, den man da leicht haben konnte, sagten,
jedermann müsse voll sein, ließen den Knechten einen Dukaten zu guter Letzt
und den Mägden auch einen und waren guter Dinge. "Ich hoffe, wir
kommen in einem Monat wieder", sagte Leopold, "dann wollen wir erst
guten Mut haben." Fortunat sprach zu den Knechten und Mägden:
"Grüßet mir den Wirt und die Frau Wirtin; sagt ihnen, ich hätte ihnen
Malvasier an das Bett gebracht, aber ich dachte: ,Ruhe tut ihnen bessert"'
Mit so glimpflichen Reden saßen sie auf und ritten hinweg von Konstantinopel
, dem Lande des Türkensultans zu. So kamen sie in eine türkische
Stadt, die Karofa heißt, wo der Sultan einen Amtmann hatte, dem befohlen
war, den christlichen Kaufleuten und Pilgern frei Geleite durch das
Land zu geben. Leopold wußte das wohl; sobald sie angekommen waren,
ging er zu dem Amtmann und sagte, ihrer seien sechs Waldbruder, die
begehrten Geleite und einen Dolmetscher, der mit ihnen ritte. "Geleits
mögt ihr haben genug", sprach der Amtmann, "doch will ich vier Dukaten
von jedem haben, und dem Dolmetscher sollt ihr alle Tage einen Dukaten
geben und die Zehrung." Leopold wehrte sich ein wenig, doch machte
er nicht viel Worte und gab ihm das Geld. Der Türke schrieb ihm darauf
einen Geleitsbrief und schickte sie zu einem wegekundigen Manne, damit
sie wohlversorgt wären. Und so ritten sie durch die Türkei.
Erst als Fortunat sah, daß er keine Furcht mehr zu haben brauche, und
der Schrecken, der ihn zu Konstantinopel überfallen hatte, vergangen war,
fing er an, wieder lustig zu werden und Scherzreden zu treiben. Und nun
ritten sie an des türkischen Sultans Hof, sahen seinen großen Reichtum
und die Menge seines Kriegsvolkes; nur das gefiel ihnen übel, daß so viele
Christen unter dem Volke waren, die ihren Glauben verleugnet hatten.
Fortunat blieb nicht lange an diesem Hof: er zog durch die große und
kleine Walachei, durch Kroatien, Dalmatien, Ungarn und Polen, dann gen
Dänemark, Norwegen und Schweden; dann wieder durch Deutschland
nach Böhmen und von da durch Sachsen-, Franken- und Schwabenland,
und von Augsburg aus mit einigen Kaufleuten, denen er große Freundschaft
erwies, durch die welschen Lande bis Venedig. Als er zu Venedig
war, freute er sich; er dachte: "Hier sind viel reiche Leute; hier darfst du
dich's endlich auch merken lassen, daß du Geld hast." Er fragte nach allen
möglichen Kostbarkeiten und ließ sie sich zeigen. Viele waren darunter, die
ihm gefielen; und so hoch der Preis war, um welchen man sie ihm bot, nie
ging er ungekauft von dannen. Weil die Venezianer dadurch keine kleine
Summe baren Geldes lösten, so wurde er überall in hohen Ehren .
gehalten.

Bri allem dem hatte Fortunat nicht vergessen, in welcher Armut er zu
Famagusta seinen Vater Theodor und seine Mutter Gratiana zurückgelassen
hatte. Darum ließ er schöne Gewande anfertigen, Hausrat kaufen,
alles gedoppelt, verdingte sich auf eine Galeere, fuhr nach Zypern und
kam in seine Heimat nach Famagusta. Es waren nun fünfzehn Jahre, daß
er ausgewesen war, und als er in die Stadt kam, erfuhr er gleich zum
Empfang, daß sein Vater und seine Mutter gesiorben seien. Dies betrübte
ihn von Herzen. Doch mietete er ein großes Haus, ließ alle seine Habe
dorthin führen, dingte noch mehr Knechte und Mägde und fing an, herrlich
zu hausen. Jedermann wurde aufs beste von ihm empfangen und behandelt
, doch wunderten sich die Leute, woher sein großer Reichtum komme;
denn noch viele von ihnen wußten, daß er in großer Armut von hinnen
gegangen war.
Zu Famagusta war Fortunats nächste Sorge, das Haus seines Vaters
nebst andern Nebenhäusern zu kaufen; dann brach er die alten ab und
baute an deren Stelle einen köstlichen Palast, den er aufs zierlichste herstellen
ließ; denn er hatte auf seinen weiten Reisen gar viele herrliche Gebäude
gesehen. der Nähe des Palastes ließ er eine schöne Kirche bauen
und in derselben zwei kostbare Gräber für seine Eltern errichten. Als
alles fertig, sprach er zu sich selbst: "Zu einem solchen Palaste ziemt auch
ein ehrsames Leben!" Und von Stunde an nahm sich Fortunat vor; ein
Gemahl zu nehmen. Als die Einwohner davon Kunde erhielten, daß er
willens sei, ein Weib zu nehmen, waren sie alle froh: ein jeder putzte seine
Tochter aufs schönste und dachte bei sich: "Wer weiß, ob meiner Tochter
nicht das Glück vor einer andern wird?"So wurden manche Töchter schön
bekleidet, die sonst noch lange ohne gute Kleider geblieben wären.
Aber nicht weit von Famagufta war ein Graf, Nimian mit Namen, der
drei Töchter hatte, die schöner waren als andere Mädchen. Diesem riet
der König von Zypern selbst, daß er suchen sollte, Fortunat zum Eidam
zu erhalten, und er selber bot sich an, für ihn den Freiwerber zu machen.
Der Graf war nicht reich, gleichwohl sagte er: "Herr Königl Wenn er
eine meiner Töchter begehrt, könnt Ihr dieser dazu raten? Er hat ja
weder Land noch Leute; mag er immerhin viel baren Geldes gehabt haben:
so sehet Ihr ja, wieviel er verbaut hat, was keine Zinsen trägt. Ebenso
kann er es auch mit dem andern machen, und wie sein Vater in Armut
geraten ist, so kann es auch ihm ergehen; bar Geld ist geschwind vertan!"
Der König sprach zu dem Grafen: "Ich habe von Leuten, die es gesehen
haben, vernommen, daß er viel köstliche Kleinode hat, so daß man eine
ganze Grafschaft damit kaufen könnte, und dennoch ist ihm keines feil;
und weil er so viele Länder durchreiset hat, wird auch seine Klugheit und
Erfahrung nicht gering sein; wenn er seine Sachen nicht zu gutem Ende
zu bringen wüßte, hätte er gewiß keinen so herrlichen Palast samt Kirche
erbauen lassen, sie nicht so reichlich begabt und auf ewige Zeiten mit Zinsen
versehen. Mein Rat ist noch immer: gefällt es ihm, so gibst du ihm
eine deiner Töchter, und wenn es dir recht ist, so will ich ins Mittel treten
Fortunat gefällt mir, und ich würde es lieber sehen, er hätte ein
edles Gemahl als eine Bäurin; ja, es würde mich verdrießen, wenn ich
ein unadeliges Weibsbild diesen Palast besitzen und bewohnen sehen
müßte!"
Sobald der Graf merkte, daß dem Könige das Wesen Fortunats so
wohl gefiel, fing er an und sprach: "Gnädiger Herr König, ich kann an
Eurer Rede wohl abnehmen, daß Ihr ein Gefallen daran hättet, wenn
ich dem Herrn Fortunat eine meiner Töchter gäbe. So sei Euch denn die
Sache völlig überlassen!" Wie der König dies hörte, sagte er zu dem
Grafen Nimian: "Gut, schicke deine Töchter meiner Gemahlin, der Königin
, so will ich sie ausrüsten lassen, in Hoffnung, es werde ihm eine davon
gefallen; die Wahl will ich ihm lassen; ein Heiratgut darfst du nicht geben,
und wenn je eins erfordert würde, so will ich es bestreiten, weil du
mir in der ganzen Sache freie Gewalt gegeben hast." Der Graf dankte
dem König und beurlaubte sich; er ritt nach Hause zu seiner Gemahlin
und erzählte ihr alles, was sich zwischen ihm und dem Könige zugetragen
habe. Der Gräfin gefiel dieses wohl; nur deuchte ihr Fortunat nicht edel
genug; auch das wollte ihr nicht gefallen, daß Fortunat die Wahl unter
den drei Jungfrauen haben sollte; denn eine der drei Töchter war ihr
gar lieb. Der Graf fragte, welche dieses wäre; sie wollte es ihm aber
nicht sagen. Doch folgte sie seinem Willen und rüstete die Töchter zu, gab
ihnen eine Hofmeisterin, Diener und Dienerinnen, wie es solchem Adel
ziemt, und so kamen sie an den Hof des Königs von Zypern. Hier wurden
alle drei, und wer mit ihnen gekommen war, von dem König und der Königin
mit Ehren empfangen und wurden in aller Hofzucht, und was sonst
zu adeligem Wesen gehörte, unterwiesen, nachdem sie auch zuvor schon
guten Unterricht genossen hatten. So schön sie waren, so nahmen sie doch
von Tag zu Tage noch zu und wurden immer lieblicher, und als dem König
die rechte Zeit zu sein schien, schickte er eine ehrsame Botschaft zu Fortunat,
welche ihn an den Hof bescheiden mußte. Doch wurde demselben nicht bedeutet,
warum der König nach ihm frage. Weil er inzwischen wußte, daß
er bisher einen gnädigen Herrn an dem König gehabt, so rüstete er sich
in aller Eile und ritt ganz fröhlich zu Hofe, wo er aufs beste empfangen
ward.
Nun trat der König zu ihm und sprach: "Fortunat; du hifi mein Hintersaß
; ich meine, du solltest mir in dem folgen, was ich dir rate; denn ich
gönne dir alles Gute! Mir ist nicht entgangen, wie du einen köstlichen
Palast und eine Kirche bauen lassen und nun im Sinne hast, eine Frau
zu nehmen. Ich sorge aber, du möchtest eine wählen, die mir nicht gefällig
wäre, deswegen möchte dir gern ein Gemahl geben, das deiner
würdig wäre, und durch das du und deine Erben geehrt werden sollen."
Hierauf erwiderte Fortunat: "Gnädiger Herr, es ist wahr: ich bin willens,
eine Gemahlin zu nehmen; da ich aber merke, daß Eure Majestät selbst
so herablassend ist, mir mit Rat und hoher Vorsorge entgegenzukommen,
so will ich auch ferner ohne Sorgen bleiben und mein ganzes Vertrauen
auf die Gnade meines Herrn setzen." —"Nun", dachte der König bei sich
selber, "hier habe ich gut eine Ehe schließen!" Und laut sprach er zu Fortunat:
weiß drei schöne Töchter, alle drei von Vater und Mutter her
Gräfinnen: die älteste ist achtzehn Jahr alt und heißt Gemiana; die andre
siebzehnjährig, und ihr Name ist Marsepia; die dritte, die dreizehn
Jahre alt ist, heißt Kassandra. Unter diesen dreien will ich dir die Wahl
lassen; zu dem Ende sollst du eine nach der andern sehen, oder willst du
sie lieber alle drei auf einmal schauens"Fortunat bedachte sich nicht lange.
"Großmächtiger König", sagte er, "wenn Ihr mir die Wahl gebet, so begehre
ich, sie alle drei nebeneinander stehen zu sehen und eine tede reden
zu hören."
Alsbald ließ der König seiner Gemahlin entbieten, sie sollte ihr ganzes
Frauenzimmer bereit halten: er selbst werde unter ihnen erscheinen und
einen Gast mitbringen. Die Königin tat dies alles mit Eifer; denn sie
wußte wohl, warum es geschah. Wie es Zeit war, nahm der König Fortunaten
zu sich und wollte mit ihm gehen. Dieser aber bat sich die Gnade
aus, seinen alten Freund und Diener Leopold mit sich nehmen zu dürfen,
und so gingen alle drei miteinander und betraten das Frauengemach. Die
Königin mit allen ihren Jungfrauen erhub sich und empfing den König
mit allen Ehren, ebenso die Gäste, die er mitbrachte. Dann setzte sich der
König nieder, und Fortunat trat neben ihn. Der König sprach: "Stellet
mir die drei Jungfrauen Gemiana, Marsepia und Kassandra vor!" Alle
drei standen auf, gingen durch den Saal und neigten sich dreimal, ehe sie
vor den König traten; endlich knieten sie nieder, und stand ihnen dieses
gar wohl an. Der König hieß sie aufstehen, wandte sich zu der ältesten
Jungfrau und fragte sie: "Gemiana, sage mir, hifi du lieber bei der Königin
oder bei Graf Nimian, deinem Vater, oder bei der Gräfin, deiner
Mutter?" Sie sprach: "Gnädiger König und .Herr! Auf diese Frage ziemet
mir nicht zu antworten; ich habe keinen eigenen Willen; was Eure
Majestät und mein Vater mir befehlen, dem werde ich gehorsam nachkommen
!"
Hierauf richtete der König seine Frage an die zweite Jungfrau und
sprach: "Marsepia, sage du mir die Wahrheit! Wer ist dir am liebsten,
der Graf, dein Herr und Vater, oder die Gräfin, deine Frau Mutter?"
Sie antwortete: "O gnädiger Herr, mir ziemt keine Entscheidung; ich habe
beide von ganzem Herzen lieb; wenn ich aber auch eins lieber hätte als
das andere, so wäre es mir doch leid, daß mein Herz es wissen und mein
Mund verkünden sollte; denn ich genieße von beiden gleich viel Treue und
Liebe!"
Endlich sprach der König zu der dritten und jüngsten: "Sage du mir,
Kassandra, wenn jetzt ein schöner Tang wäre auf unserer Hofburg, von
Fürsten und Herren, von viel edlen Frauen und Jungfrauen, und es wäre
hier der Graf und die Gräfin, dein Vater und deine Mutter, und das eine
spräche: ,Gehe zum Tanzt 'und das andere: ,Gehe nicht! ' welchem Geste
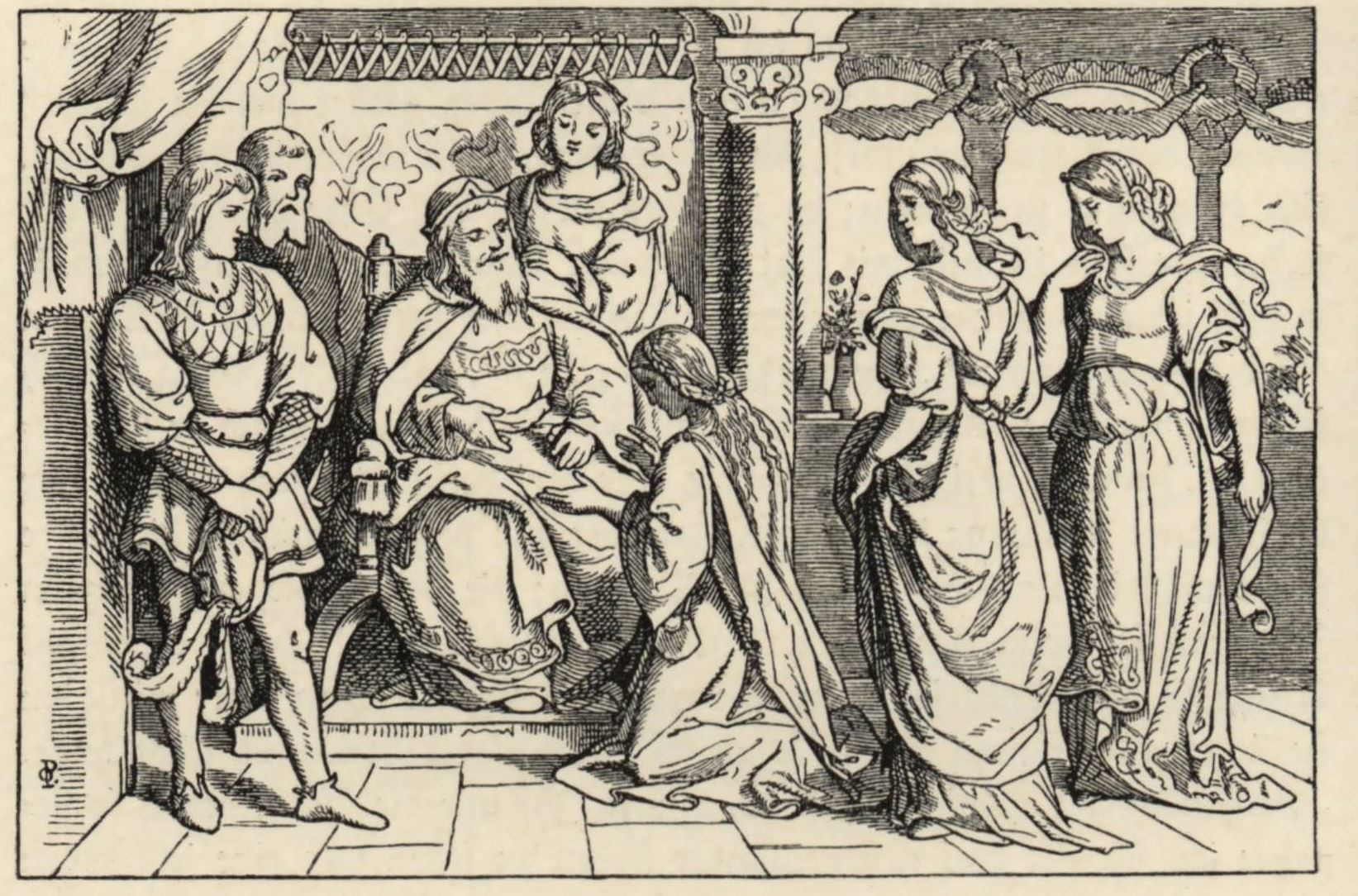
wolltest du folgen?" — "Allergnädigster Herr König", sprach sie, "Ihr
wisset ja, daß ich noch jung bin; Vernunft kommt vor den Jahren nicht;
ermesse Eure hohe königliche Vernunft die Liebe der Kinder! Ich weiß
nicht zu wählen; wenn ich je wählte, so würde ich ja eins von beiden erzürnen
" — "Wenn aber eines sein müßte?"fragte der König. — "So
begehrte ich Jahr und Tag Bedenkzeit, um weiser Leute Rat zu vernehmen,
ehe ich eine Antwort gäbet" Hiermit ließ der König Kassandra frei
und fragte sie nicht weiter. Er beurlaubte sich von der Königin und den
übrigen Frauenzimmern und ging, gefolgt von Fortunat und Leopold, in
seinen Palast. Als sie in des Königs Zimmer zurückgekommen waren,
sprach der König zu Fortunat: "Dein Wunsch ist erfüllt worden; du hast
alle drei stehen, gehen, lang und langsam reden gesehen und gehört; ich
habe dir mehr getan, als du begehrt hast; nun erwäge bei dir selbst:
welche gefällt dir zum ehelichen Gemahl?" — "Ach, gnädigster Herr",
sprach Fortunat, "sie gefallen mir alle drei so wohl, daß ich nicht weiß,
welche ich erkiesen soll; gönnet mir eine kleine Weile, mich mit meinem
alten Diener Leopold zu bedenken!" Der König beurlaubte ihn gern, und
beide traten ab, sich an einem heimlichen Platze zu bedenken.
Hier sagte Fortunat zu Leopold: "Du hast die drei Töchter so gut als
ich gesehen und gehört! Nun weißest du wohl, niemand ist in seinen
eigenen Sachen so weise, daß er nicht immerhin gut täte, fremden Rat zu
hören. So rate denn du mir hierin so getreulich, als ob es deine eigene
Seele beträfe." Leopold erschrak über diese feierliche Ermahnung: "Herr",
sagte er, "in dieser Sache ist nicht gut raten; denn dem einen gefällt oft
ein Ding gar sehr, und seinem leiblichen Bruder gefällt es nicht. Der
eine ißt gern Fleisch, der andere Fisch. Drum kann in dieser Sache Euch
niemand gerne raten als Ihr selber. Seid doch Ihr es auch, der die Bürde
tragen muß!" — "Das alles weiß ich wohl", erwiderte Fortunat, "auch
daß nur ich mir das Gemahl nehme und sonst niemand. Da wollte ich, du
erschlössest mir deines Herzens Heimlichkeit, weil du so viele Menschen
kennengelernt hast und gewiß schon an ihrer Gestalt merken kannst, was
getreu ist; und was ungetreu!" Leopold riet ungerne zu der Sache: er
fürchtete, Fortunats Huld zu verlieren, wenn er zu einer riete, die ihm
nicht gefiele. Er sprach: "Herr, auch mir gefallen sie alle drei wohl, ich
habe eine um die andere sorgfältig betrachtet; ihrer Gestalt nach sind es
gewiß Schwestern oder Geschwisterkinder; auch kann ich an ihrem Aussehen
durchaus keine Untreue merken!" — Fortunat drang weiter in ihn
und fragte: "Zu welcher rätst du mir denn aber?" — "Ich mag nicht
zuerst raten", sprach Leopold, "es wäre Euch unleidlich, wenn mir wohlgefiele,
was Euch mißfiele!" — mag auch nicht", sagte Fortunat.
Endlich sprach Leopold: "Nun, so nehmet eine Kreide und schreibet auf
den Tisch an Eurer Ecke; so will ich auf der andern Ecke meine Meinung
hinschreiben!"
Fortunat war es zufrieden; jeder schrieb seine Meinung, und als sie es
getan, und jeder des andern Schrift las, da hatten sie beide Kassandra geschrieben.
Nun war Fortunat erst froh, daß seinem Leopold gefallen hatte,
was ihm gefiel, und noch fröhlicher war Leopold, daß Gott ihm in den
Sinn gegeben, gerade auf diejenige zu raten, die seinem Herrn am allerbesten
gefallen hatte. Jetzt eilte Fortunat wieder zu dem Könige und
sprach: "Gnädiger Herr Königl Mein untertäniges Begehren ist; daß Ihr
mir Kassandra gebet!" — "Dir geschehe nach deinem Willen", sprach der
König und sandte von Stund an zu der Königin, daß sie zu ihm käme und
die Jungfrau auch mit sich brächte.
***Also kam die Königin und brachte Kassandra mit. Der König aber
schickte auf der Stelle nach seinem Kaplan und ließ das Paar zusammen;
trauen. Kassandra war wohl ein wenig unmutig darüber, daß sie so ohne
Wissen ihres Vaters und ihrer Mutter vermählt werden sollte, und daß
dieselben nicht gegenwärtig sein dürften; doch wollte es der König so
haben. Als die Trauung vorüber war, kamen alle Frauen und Jungfrauen
, auch der Braut Schwestern, und legten die zwo letzteren unter
herzlichem Weinen ihre Glückwünsche ab. Durch diese Tränen erfuhr Fortunat
erst, daß es leibliche Schwestern der Braut seien; er ging daher zu
ihnen hin und tröstete sie freundlich, indem er sagte: "Trauert nicht so
sehr um eure Schwester; ich habe etwas, das euch ergötzen soll!" Und sogleich
schickte er in die Stadt Famagusta nach den Herrlichkeiten, die er
von Venedig mitgebracht hatte; davon schenkte er die zwei besten Kleinode
dem König und der Königin, dann beschenkte er Braut und Schwestern,
zuletzt begabte er alle Frauen und Jungfrauen der Königin aufs köstlichste
und erntete großen Dank ein.
Darauf sandte der König nach dem Grafen Nimian und seiner Gemahlin
. Fortunat, der dieses hörte, sprach mit seinem Freund, ordnete ihn
ab und übergab ihm tausend Dukaten; diese sollte er der Gräfin in den
Schoß schütten und sprechen, es sei ein kleines Geschenk von ihrem neuen
Tochtermann, daß sie fröhlich zur Hochzeit kommen möchte. Aber die
Gräfin war nicht vergnügt darüber, daß Fortunat die jüngste ihrer
Töchter, die ihr gerade die liebste war, zur Frau erwählt hatte. Als jedoch
Leopold ihr die tausend Dukaten in den Schoß schüttete, ließ sie
ihren Unmut fahren, rüstete sich mit dem Grafen aufs beste mit Wagen,
Hofgesinde und allem Nötigen, und so kamen sie zu dem König, der sie
mit allen Ehren empfing und sich bereit erklärte, die Hochzeit auf seine
Kosten abzuhalten. Aber Fortunat bat sich die Ehre aus, dieselbe zu
Famagufta in seinem neuen Palaste, den er noch nicht eingeweiht hatte,
feiern zu dürfen. Ja, er wagte es, den König und die ganze königliche
Familie zu dem Feste in aller Bescheidenheit einzuladen. Der König erfüllte
seinen Willen, und Fortunat ritt eilends nach Famagusta, dort
alles zuzurichten.
Nach acht Tagen kam der König, und brachte ihm Gemahlin Schwäher
und Schwäger und Volks genug. Die Freude, die sie hatten mit Tangen,
Singen und köstlichem Saitenspiel, war groß, bis endlich die schöne Jungfrau
Kassandra bei ihrem Gemahl in dem neuen Palaste zurückgelassen
wurde, der so herrlich erbaut war, daß sich jedermann über seine Zierde
verwunderte. Obwohl nun der Braut Mutter sah, daß alles köstlich zuging,
wollte es ihr doch nicht recht gefallen, daß Fortunat kein Land und
Leute habe; der Graf beruhigte sie, und am andern Morgen früh stellte
sich der König, sein Schwiegervater und seine Schwiegermutter bei Fortunat
ein und forderten die Morgengabe für die Braut. Da sagte Fortunat:
"Land und Leute habe ich nicht, aber fünftausend bare Dukaten
will ich ihr geben: dafür mag sie eine Burg mit Gebiet kaufen, darauf
sie dereinst versorgt ist." — "Hier ist leicht Nat zu schaffen", sprach der
König. "Weiß ich doch, daß der Graf von Ligorna des Geldes sehr benötigt
ist und Schloß und Flecken Lorgano, drei Meilen von hier; verkaufen
muß mit Leuten, Land und allen Liegenschaften." Bald wurde auch
der Kauf richtig gemacht, und Fortunat erhielt Schloß, Flecken und Land
um siebentausend Dukaten. Er gab Leopold den Schlüssel, der das Geld
aus einem Kasten holte, und Fortunat machte seine Gemahlin zur einigen
Besitzerin der Herrschaft. Jetzt fing der Braut Mutter erst an fröhlich
zu werden und rüstete sich, zur Kirche zu gehen, die neben dem Palaste
herrlich erbaut stand. Nachdem das Hochamt vollbracht war, setzte sich
der König, die Königin, das junge Paar und die ganze Gesellschaft ans
Mahl, das recht königlich zubereitet worden.
Wie man am fröhlichsten war, stellte Fortunat eine Kurzweil an und
gab drei Kleinodien heraus. Das erste war sechshundert Dukaten wert;
um das sollten die Herren, Ritter und Edelleute drei Tage stechen; wer
das Beste täte und den Prels erhielte, sollte auch das Kleinod davontragen
Weiter gab er ein Kleinod aus, das vierhundert Dukaten wert
war, um das auch drei Tage lang die Bürger und ihre Genossen stechen
sollten; endlich eines von zweihundert Dukaten, um das sollten die
Knechte stechen.
Solches Freudenspiel trieb man vierzehn Tage; immer wurde zwei oder
drei Stunden gestochen, dann wieder getanzt und dann ebensolange geschmaust.
Endlich zog der König und alles mit ihm hinweg. Fortunat
hätte gerne gesehen, daß sie länger geblieben wären, besonders der Graf
und die Gräfin; sie willigten aber nicht ein; denn sie sahen den großen
Aufwand und fürchteten, er möchte dadurch in Armut geraten, worüber
Fortunat in seinem Herzen lachen mußte.
Nachdem er nun dem Könige das Geleit gegeben und sich demütig
für die Ehre seines Besuchs bedankt hatte, ritt er wieder heim zu seiner
schönen Kassandra und stellte für die Bürger von Famagitfia ein zweites
Hochzeitfest an. Und als endlich auch dieses Wohlleben ein Ende hatte,
sehnte sich Fortunat nach Ruhe. Er ließ seinem alten Reisegefährten Leopold
eine dreifache Wahl: "Willt du heim, lieber Freund", sprach er zu
ihm, "so will ich dir vier Knechte zugeben, die dich redlich geleiten und
dich dazu mit soviel Geld versehen, daß du zeitlebens dein Auskommen
hast. Oder willst du hier zu Famagufta bleiben, so kaufe dir ein eigenes
Haus und gebe dir so viel, daß du drei Knechte und zwo Mägde halten
kannst und nie keinen Mangel leiden darfst. Oder endlich: willst
du bei mir in meinem Palaste sein und an allem überfluß haben, so
gut wie ich selber — welches von diesen dreien du ewählest, das soll
dir zugesagt und redlich gehalten werden."
Der alte Leopold dankte ihm mit Rührung; er meinte, er habe
weder um Gott noch um Fortunat verdient, daß ihm in seinen alten
Tagen soviel Ehre und Glück widerfahre. "Mir ziemt", sprach er, "nicht
heimzureiten; ich bin alt und schwach und möchte unterwegs sterben.
Käme ich aber auch heim: Hibernia ist ein rauhes Land, wo weder Wein
noch edle Früchte wachsen; die bin ich jetzt schon gewöhnt. Vielleicht würde
ich drum dort bald sterben! Daß ich meine Wohnung bei Euch nehmen
soll, darf mir auch nicht in den Sinn kommen. Ich bin alt und ungestalt;
Ihr aber habt ein junges schönes Gemahl, viel hübsche Jungfrauen und
schmucke Knechte, die Euch alle viel Kurzweil machen können. Diesen
allen würde ich unwert; denn alten Leuten gefällt nicht immerdar dag
Wesen der Jungen. Darum, sowenig ich an Eurer tugendreichen Güte
zweifle, so erwähle ich doch, wenn es Euch nicht zuwider ist; das zweite,
nämlich daß Ihr mir mein eigen Wesen bestimmen möget, darin ich mein
Leben beschließen kann. Doch bitte und begehre ich, daß ich damit nicht
ganz aus Eurem Rate entfernt werde, solange uns Gott miteinander das
Leben gönnt." Fortunat sagte dem Alten dies gerne zu und nahm auch
wirklich seinen Rat an, solange er lebte; er kaufte ihm ein eigenes Haus,
gab ihm Knechte und Mägde, dazu alle Monate hundert Dukaten. Dem
Leopold tat es auch wohl, daß er des Dienstes nicht mehr zu warten hatte.
Er ging jetzt zu Bette und stand auf, ass und trank, früh oder spät, wie
es ihm beliebte. Nichtsdestoweniger ging er alle Tage zur selben Stunde
in die Kirche wie Fortunat und erschien fleißig bei seinem jungen
Freunde. So trieb er es ein halbes Jahr; dann wurde er krank, und es
ging mit ihm dem Tode zu. Wohl wurde von Fortunat nach vielen
Ärzten gesendet, aber niemand konnte ihm helfen. Und also starb der
gute Leopold. Das tat Fortunat gar leid; er ließ ihn mit vielen Ehren
in seine eigene Kirche begraben, die von ihm gebaut und gestiftet worden
war.
***Fortunat, der mit seiner Gemahlin Kassandra in großer Freude und
Genüge lebte, bat Gott inbrünstig um einen Erben. Er wußte wohl, daß
die Tugenden seines Glücksäckels ein Ende hätten, wenn er keine Kinder
bekäme. Doch sagte er dies Kassandra nicht. Weil aber Gott alle ziemlichen
Gebete erhört, so wurde auch Fortunat bald mit einem Sohne erfreut
und das ganze Haus mit ihm. Dieser wurde in der heiligen Taufe
Ampedo geheißen. Und nach Jahresfrist gebar ihm Kassandra einen
zweiten Sohn, der auch mit Freuden getauft und Andolosia genannt
wurde; so daß Fortunat jetzt zwei wohlgeschaffene, hübsche Knaben hatte;
die er und seine liebe Kassandra mit großem Fleiß erzogen; doch war
Andolosia kecker als sein Bruder Ampedo, und dies wird sich nachher
zeigen. Fortunat hätte gerne noch weitere Leibeserben gehabt, aber Kassandra
gebar ihm nicht mehr; was ihm sehr leid war; denn er hätte gar
gerne eine Tochter dazu gehabt oder zwei.
Zwölf Jahre hatte Fortunat mit seiner Gemahlin Kassandra in Liebe
und Ruhe verlebt; eines weitern Erben versah er sich nicht mehr; da
fing ihn der Aufenthalt in Famagusta an zu verdrießen, wiewohl er alle
Kurzweil hatte mit Spazierengehen, Reiten, schönen Rossen, Federspiel,
Jagd; Hetze und Beize. Er nahm sich vor, nachdem er alle christlichen
Königreiche durchzogen, auch vor seinem Tode die Heidenschaft, das Land
des Priesters Johannes und alle drei Indien zu beschauen. Daher sprach
er zu seinem Weibe Kassandra: "Ich habe eine Bitte an dich, die sollst du
mir nicht abschlagen. Ich wollte, du erlaubtest mir hinwegzureisen."
Sie fragte ihn, wonach ihm doch sein Gemüt stände. Da entdeckte er ihr
sein ganzes Vorhaben; weil er den halben Teil der Welt gesehen, so
wollte er den andern Teil auch durchfahren: "Und sollte ich mein Leben
darum verlieren", setzte er hinzu.
Als Kassandra merkte, daß es ihm Ernst sei, erschrak sie zuerst sehr
und suchte ihn von seinem Vorsatz abzubringen. Es würde ihn gereuen,
meinte sie; wo er bisher umhergezogen, das wäre alles durch Christenlande
gegangen; auch er selbst sei noch jung und stark gewesen und hätte
vieles ertragen können; das sei jetzt nicht mehr so; das Alter vermöge
nicht mehr, was der Jugend leicht zu tun sei. "Jetzt habt Ihr Euch gewöhnt,
ein ruhiges Leben zu führen; und höret Ihr denn nicht alle Tage,
daß die Heiden einem Christen weder treu noch hold sind, daß sie von
Natur nur darauf denken, wie sie dieselben um Gut und Leib bringen
mögend" Dazu fiel sie ihm um den Hals, bat ihn gar freundlich und
sprach: "O allerliebster Fortunat, teuerster und getreuester Gemahl,
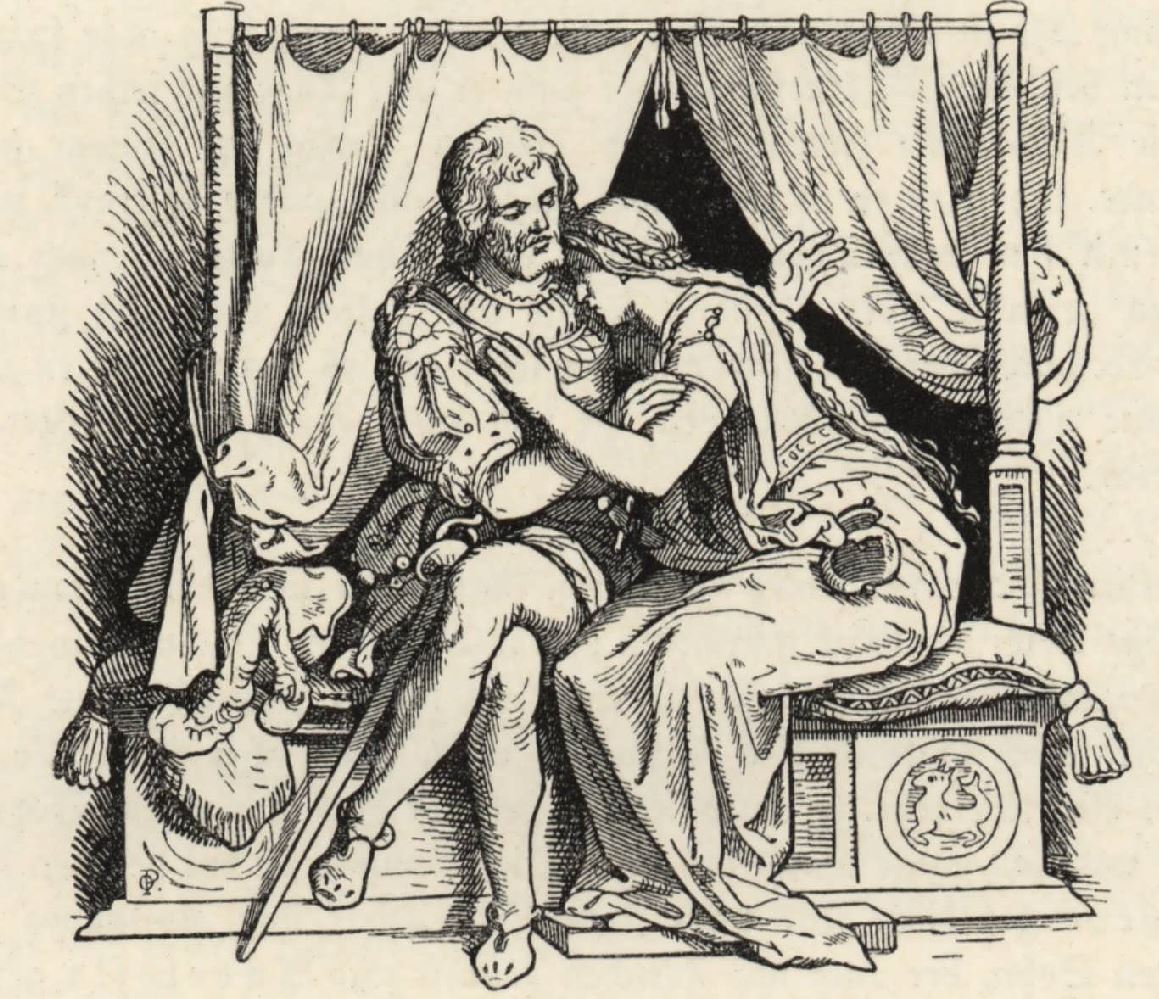
auf den ich meine ganze Hoffnung gebaut habe; ich bitte Euch um Gottes
willen, ehret mich armes Weib und Eure lieben Kinder, schlaget die
vorgesetzte Reise aus Eurem Herzen und bleibet hier bei uns l Habe ich
Euch denn mit irgend etwas erzürnt oder etwas getan, das Euch mißfallen
hätte? Saget mir's doch, es soll hinfort gewiß vermieden bleiben
und nicht mehr geschehen." Kassandra weinte zu diesen Worten inniglich
und war sehr betrübt. Fortunat hing am Halse seiner Gemahlin und
sprach: "O liebes Weib, verzweifle nur nicht! Es ist ja nur von einer
ganz kleinen Zeit die Rede; dann komme ich wieder heim; und ich verheiße
dir jetzt feierlich, daß ich alsdann nimmermehr von dir scheiden
will, solang uns Gott das Leben verleiht!" — "Ach ja", sagte Kassandra
, "wenn ich deines Wiederkommens gewiß wäre, so wollte ich deine
Zurückkunft mit Freuden erwarten, wohin du dann ziehen wolltest: nur
müßte es unter gläubige Christen sein und nicht zu den Heiden, dem treulosen
Geschlechte, das nichts als Christenblut begehrt; ja, dann sollte es
mir nicht schwer werden!" Aber Fortunat blieb bei seinem Entschlusse.
"Diese Reise", sprach er, "kann niemand wenden als Gott und der Tod
allein. Sollte ich aber von hinnen scheiden, so will ich dir so viel Barschaft
hinterlassen, daß du, wenn ich auch nicht mehr wiederkehrte, mit deinen
Kindern dein Leben in Ruhe zubringen kannst!"
Kassandra merkte wohl, daß hier kein Bitten helfen mochte. Sie nahm
daher ihre Kräfte zusammen und sprach: "O geliebter Herr, wenn es
nicht anders sein kann, so kommet desto eher wieder, und die Liebe und
Treue, die Ihr uns bisher erwiesen habt, die lasset aus Eurem Hergen
nicht entschwinden! Dann wollen wir Gott Tag und Nacht für Euch bitten
, daß er Euch Gesundheit, Frieden und günstiges Wetter verleihe und
Euch vor allen behüte, in deren Hand und Gewalt Ihr kommen könntet!"
— "Wolle Gott, daß dies Gebet an mir vollbracht werde", sagte Fortunat
, "ich hoffe aber zu ihm, daß ich früher wiederheimkomme, als ich
mir vorgenommen habe!"
***Mit diesen Worten segnete Fortunat Weib und Kind und fuhr, als ein
reicher Mann, in seiner eigenen Galeere davon, die er sich zu diesem
Zwecke hatte bauen lassen. Nach einer glücklichen Fahrt kam er zu Ale
andria in Ägypten an. Sobald er sicher Geleite hatte, ans Land zu fahren,
stieg man aus dem Schiffe. Die Heiden wollten wissen, wer der Herr
der Galeere sei. Fortunat, hieß es, von Famagusta aus Zypern sei Besitzer
des Schiffs. Zugleich bat er, daß man ihm Zutritt zu dem Heidenkönige
verschaffte, damit er ihm sein Geschenk überreichen könnte; jeder
Kaufmann nämlich pflegt dem Sultan eine Verehrung zu bringen. Als
nun Fortunat in des Königs Palast kam, hieß er sogleich, einen Kredenztisch
aufzuschlagen, und stellte seine Kleinodien aus, die gar schön und
köstlich anzusehen waren, und die er auch sofort dem Sultan anbieten
ließ. Der Sultan kam in Person herbei und nahm die Kostbarkeiten in
Augenschein. Er wunderte sich und glaubte, der Fremde habe sie ihm gebracht
, um sie sich abkaufen zu lassen; er ließ ihn daher fragen, wie hoch
er den Kredenztisch voll Kleinodien schätze. Darauf fragte Fortunat nur,
ob die Kleinode des Sultans Beifall hätten, und als dies bejaht wurde;
zeigte er sich ausnehmend froh und ließ den Sultan bitten, sie nicht zu
verschmähen, sondern als ein Geschenk gnädig aufzunehmen. Den König
von Ägypten befremdete es nicht wenig, daß ein einziger Kaufmann ihm
so viel verehren wollte; denn er schätzte das ganze Geschenk wohl auf
fünftausend Dukaten und meinte, es wäre wohl für eine ganze Stadt
wie Venedig, Florenz oder Genua viel zuviel. Doch nahm er es auf, wie
es war, glaubte jedoch, für eine so große Schenkung dem Darbringer
eine Gegengabe zusenden zu müssen. Daher schickte er hundert Zentner
Pfeffer, die so viel wert waren als Fortunats sämtliche Kleinode.
Als die Lagerherren aus Venedig, Florenz, Genua und Katalonien, die
sich dazumal in Alexandrien aufhielten, von der großen Gegengabe des
Königs vernommen, dabei daran dachten, daß sie selbst, die stets in seinen
Landen lägen, des Jahrs zwei-; dreimal Geschenke darbrachten und dazu
ihm und dem Lande von großem Nutzen wären, und daß sie gleichwohl
noch nie eines solchen Geschenkes gewürdigt worden seien: da empfanden
sie großen Verdruß über das Betragen Fortunats. Überdies kaufte dieser
immer mehr Waren an sich; sie fürchteten daher, er möchte ihnen auch
noch in ihrer Kaufmannschaft Schaden tun und das Land mit Waren
überführen, so daß sie genötigt wären, das Ihrige wohlfeiler zu geben;
daher waren sie beständig darauf bedacht, wie sie ihm Verdruß bei dem
Sultan anrichten könnten. Sie machten daher zu dem Ende dem Admiral,
welcher der Oberste nach dem König im Lande war, ein großes Geschenk,
damit er Fortunat und den Seinigen nicht so günstig wäre. Aber Fortunat
wußte es und schenkte noch einmal soviel. Dem Admiral war das
eben recht; er nahm das Geld von beiden Parteien und tat, was er
mochte. Er erwies nämlich dem Fortunat nun um so mehr Dienste; denn
sein Wunsch war, daß nur recht viele, wie er, nach Alexandrien kommen
möchten.
Sa war Fortunat schon einige Tage daselbst, als er gar von dem Sul
tan zu Gaste gebeten wurde und mehrere Kaufleute von der Galeere
mit ihm. Dies verdroß die andern Kaufherren noch mehr, besonders da
ihn bald darauf auch der Admiral zum Essen einlud und sie sahen, daß
ihre Schenkung so übel angelegt war. Inzwischen erschien die Zeit, wo die
Galeere von Alexandria wegfahren mußte; denn es war gebräuchlich,
daß kein Schiff mit Kaufmannswaren länger als sechs Wochen daselbst
verweilen durfte, mochte es nun verkauft haben oder nicht. Fortunat wußte
dieses wohl. Er richtete sich darnach und setzte an seiner Statt einen andern
Schiffspatron ein, dem er befahl, mit der Galeere, den Kaufleuten
und allem Gute in Gottes Namen nach Spanien, Portugal, zuletzt nach
England und dann nach Flandern zu fahren, da zu kaufen und zu verkaufen
, von einem Lande zum andern, und ihren Gewinn zu mehren, was
nicht fehlen könne, weil sie bedeutende Güter mit sich führten. Nach zwei
Jahren sollte der Patron gewiß mit seiner Galeere wieder in Alexandria
sein und diesen Zeitpunkt ja nicht versäumen. Er selbst sei willens, noch
zwei Jahre in der Fremde zu bleiben und seine Sachen darnach einzurichten,
damit er auf die bestimmte Zeit auch wieder in Alexandria sein könnte.
Träfen sie ihn da nicht, so sollten sie sich nur keine Rechnung auf ihn
machen, sondern annehmen, daß er nicht mehr am Leben sei. Dann sollte
der Patron die Galeere samt dem Gute seiner Gemahlin Kassandra und
seinen Söhnen nach Famagusta liefern. Dies versprach ihm der neue
Schiffskapitän. Und so traten diese in Gottes Namen ihre Reise an.
Sobald sich Fortunat allein sah, besuchte er den Admiral und bat ihn,
daß er ihm zu einem sicheren Geleite durch des Sultans Land behilflich
sein möchte, und dann zu einem Empfehlungsschreiben an die Fürsten und
Herren der Länder, die er zu sehen begehrte. Das verschaffte ihm der
Admiral ohne Mühe vom Sultan, alles auf Kosten Fortunats, was diesem
große Freude machte, weil er das Geld nicht sparen durfte. Er rüstete
sich daher mit seinen Begleitern aufs allerbeste und trat dann seine weite
Reise an.
Zuerst durchwanderten sie das Land des Königs von Persien, dann das
Gebiet des großen Khans von Chaltei; von da ging es durch die indischen
Wüsten in das Land des Priesters Johannes, der über viel Inseln und
feste Lande regiert und in allem zweiundsiebzig Königreiche beherrscht.
Diesem schenkte Fortunat die seltensten Kleinode, ebenso allen denjenigen,
die ihm auf seiner Reise förderlich gewesen. Dann kam er nach Kalekut, in
das Land, wo der Pfeffer wächst wie kleine grüne Trauben. Dort regierte
ein mächtiger König, das Land aber ist von großer Hitze geplagt. Als
Fortunat dies alles gesehen, jammerte ihn endlich seiner Gemahlin Kassandra
und seiner beiden Söhne, und es kam ihn eine zärtliche Lust an,
sie wiederzusehen. Er richtete daher seinen Lauf heimwärts und kam
zur See nach der Stadt Lamecha. Dort kaufte er sich ein Kamel und
ritt auf demselben durch die Wüste gen Jerusalem, in die Heilige Stadt.
Nun hatte er noch zween Monate Frist bis zu dem Zeitpunkt wo er versprochen
hatte, zu Hause einzutreffen. Deswegen eilte er auf Alexandria
zu, dem Sultan für alle Beförderung Dank zu sagen, besuchte den Admiral
wieder, freute sich des Wiedersehens, und überall ward ihm große
Ehre angetan. Acht Tage blieb er zu Alexandria stilleliegen; siehe, da kam
auch seine Galeere dahergefahren, mit köstlichen Waren beladen, dreimal
so voll, als da sie Fortunat von sich ausgesandt hatte. Er freute sich über
die Maßen, als er alle seine Leute wieder frisch und gesund sah, vor allem
aber, daß sie ihm Briefe von seiner geliebten Gemahlin Kassandra mitbrachten
.
Fortunat hatte nun keine Ruhe mehr; er ermunterte seine Leute, fein
wohlfeil zu verkaufen, um recht bald mit ihren Gütern aufzuräumen;
"denn", sagt man, "wer wohlfeil gibt, dem hilft Sankt Niklas verkaufen
, und wer kauft, wie man ihm ein Ding beut, der ist auch bald fertig."
Während daher andre Kauffahrteischiffe sechs Wochen lang zu Alexandria
lagen, schafften sie alles in drei Wochen fort nach ihres Herrn Willen
. Aber der Sultan, der von ihrer Eile hörte, wollte nicht haben, daß
Fortunat hinwegreise, er speise denn vorher mit ihm. Er lud ihn daher
noch am letzten Abend ein, bevor er am andern Morgen absegeln wollte.
Dies konnte Fortunat nicht abschlagen; jedoch befahl er, daß sich jedermann
auf die Galeere begeben sollte: sobald die Mahlzeit vorbei wäre,
wollte er sich noch am selben Abende bei ihnen einfinden. Indem kam
sein Freund, der Admiral, nahm ihn beim Arm, und beide gingen miteinander
auf des Königs Palast zu.
***Der Sultan von Ägypten empfing Fortunaten aufs beste. Dieser stattete
ihm seinen ehrfurchtsvollen Dank für den Geleitsbrief ab und unterhielt
ihn von allen Merkwürdigkeiten, die er in den fremden Landen gesehen
hatte. Nach der Mahlzeit wünschte Fortunat, das Hofgesinde beschenken
zu dürfen, und der König vergönnte es ihm. Da tat er unter dem Tische
seinen Glückssäckel auf, daß es niemand sähe, und niemand die Kraft des
Säckels erführe. Und nachdem er jedermann schwer Geld gegeben, so
der Sultan sich wunderte, wie er soviel nur tragen könnte, sagte dieser,
ver sich besonders freute, daß sein Leibmameluck so reichlich beschenkt
worden war, zu Fortunat: "Ihr seid ein wackerer Mann; es ziemt sich
wohl, daß man Euch eine Ehre antut: kommt mit mir; ich will Euch
etwas sehen lassen, was ich habe."Mit diesen Worten führte er ihn durch
einen Turm, der ganz von Stein und rundum gewölbt war, zuerst in ein
Gemach, in welchem sich viele Juwelen und Silbergeräte befanden, auch
große Haufen silberner Münzen, wie Korn aufgeschüttet. Dann öffnete
er ihm ein zweites Gewölbe, das voll goldener Kleinode war; in diesem
stand auch eine große Truhe voll gemünzter Goldgulden. Dann betraten
sie ein drittes, gar sorgfältig verwahrtes Gewölbe, in welchem gewaltige
Kästen voll kostbarer Kleider und Leibleinwand standen, was der
Sultan antat wenn er sich in seiner königlichen Majestät zeigen wollte.
Alles ohne Zahl; so hatte er namentlich auch zwei goldene Leuchter, auf
welchen zwei große Karfunkel prangten. Als nun Fortunat diese beiden
Kleinode zu bewundern nicht aufhörte, sprach zu ihm der Sultan: "Ich
habe noch eine Seltenheit in meiner Schlafkammer; die ist mir lieber als
alles, was Ihr bisher bei mir gesehen habt." — "Was mag das sein",
fragte Fortunat, "das so köstlich wäre?" —"Ich will es dich sehen lassen"
, erwiderte der König und führte ihn in sein Schlafzimmer, das
groß, hell und freundlich war; und alle Fenster sahen in das weite Meer.
Hier ging der Sultan an einen Kasten, langte ein unscheinbares Filzhütchen,
dem die Haare schon ausgegangen waren, hervor und sprach zu
Fortunat: "Dieser Hut ist mir lieber als alle Kleinode, die Ihr gesehen
habt, darum: wenn einer jene Kostbarkeiten auch nicht besitzt, so gibt es
doch Mittel, sich dieselben zu verschaffen; aber einen solchen Hut kann
sich kein Menschenkind zuwege bringen."Fortunat fragte recht neugierig:
"Oh, gnädigster Herr König, wenn es nicht wider die Ehrfurcht ist, die
ich Euch schuldig bin, so möchte ich gerne erfahren, was das Hütlein vermag,
das Ihr so hoch schätzet." — "Das will ich dir sagen", sprach der
König. "Das Hütlein hat die Tugend, wenn ich oder ein anderer es aufsetzt
, wo er alsdann begehrt zu sein, da ist er. Damit habe ich viel Kurzweil,
mehr als mit meinem ganzen Schatze; denn wenn ich meine Diener
auf die Jagd sende, und mich verlangt, auch bei ihnen zu sein, so setze
ich nur mein Hütchen auf und wünsche mich zu ihnen: so bin ich auf der
Stelle bei ihnen. Und wo ein Tier in dem Walde ist, und ich möchte dabei
sein, so bin ich's und kann es den Jägern in die Hände treiben. Habe
ich einen Krieg, und meine Söldner sind im Felde, so kann ich wieder
bei ihnen sein, sobald ich will. Und wenn ich genug habe, so bin ich
wieder in meinem Palast, wohin mich alle meine Kleinode nicht hinzubringen
vermöchten." — "Lebt der Meister noch, der es gefertigt hat?"
fragte Fortunat. Der König antwortete: "Das weiß ich nicht." — "Oh,
möchte mir der Hut werden!" dachte Fortunat; "er paßte gar zu gut zu
meinem Säckel!" Da sprach er weiter zu dem König: "Ich halte dafür,
da der Hut eine so große Kraft hat, so muß er auch recht schwer sein und
den, der ihn auf dem Kopfe hat, nicht übel drücken!" — "Nein", antwortete
der König, "er ist nicht schwerer denn ein anderer Hutl" Der
Sultan hieß ihn sein Barett abziehen, setzte ihm das Hütchen selbst aufs
Haupt und sagte: "Nicht wahr, es ist nicht schwerer als ein anderer Hut?"
— "Wahrlich", antwortete Fortunat, "ich hätte nicht geglaubt, daß der
Hut so leicht sei, und Ihr so töricht, ihn mir aufzusetzenl" — Und in
diesem Augenblick wünschte er sich auf seine Galeere, darin er auch auf
der Stelle saß. Kaum war er darin, so ließ er die Segel aufziehen; denn
sie hatten starken Nordwind, so daß sie schnell von hinnen fuhren.
***Als der König merkte, daß ihm Fortunat sein allerliebstes Kleinod abgeführt,
und er zugleich, am Fenster stehend, die Galeere wegfahren sah,
wußte er im Zorne nicht, was er tun sollte; doch bot er all sein Volk auf,
Fortunaten nachzueilen und ihn gefangen zu bringen; denn der Räuber
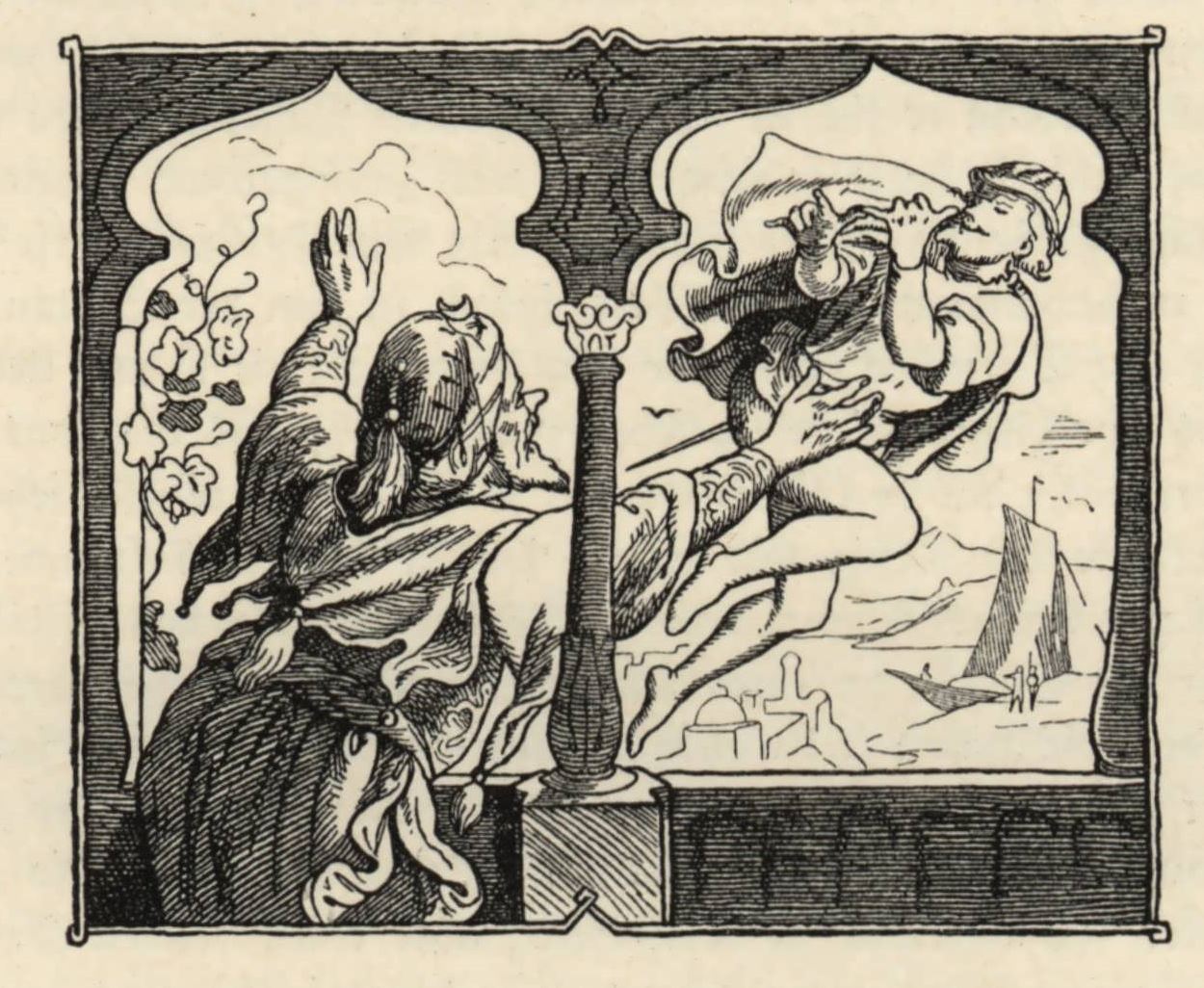
sollte sein Leben verlieren. Seine Leute fuhren ihm auch auf der Stelle
nach, aber die Galeere war schon so ferne, daß sie kein Auge mehr erreichen
konnte. Nachdem sie ihr einige Tage nachgefahren, kam sie eine
Furcht an, sie möchten auf katalonische Seeräuber stoßen, und da sie nicht
gerüstet waren zu streiten, kehrten sie wieder um und sagten dem Sultan,
es sei nicht möglich gewesen, die Galeere zu erreichen. Da wurde
dieser sehr traurig. Aber die Venezianer, Florentiner und Genuesen, die
freuten sich, als sie erfuhren, daß Fortunat mit des Sultans liebstem
Kleinod davongefahren sei. "Recht so", sprachen sie untereinander, "der
König und der Admiral wußten nicht, wie sie diesen Fortunat genug ehren
sollten: nun hat er ihnen den rechten Lohn gegeben, und jetzt sind wir
sicher vor ihm; er wird nicht wiederkommen und uns nicht noch einmal
so großen Schaden mit Kaufen und Verkaufen zufügen!"
Der Sultan hätte sein Kleinod gar zu gerne wiedergehabt, und doch
wußte er nicht, wie er es angreifen sollte. "Wenn ich auch", dachte er,
"den Admiral oder einen meiner Fürsten zu ihm sende, so sind sie den
Christen nicht angenehm; auch könnten sie unterwegs gefangen werden."
So entschloß er sich am Ende, eine feierliche Botschaft an Fortunat nach
Zypern zu schicken, und bat den Vorsteher der Christen, daß er ihm zu
Willen würde und sich zu dieser Reise verstünde, teilte ihm auch die Ursache
mit. Dieser sagte es ihm zu und erklärte bereit zu sein, in des Sultans
Dienst zu fahren, wohin er wollte. Alsbald ließ ihm der Sultan
ein Schiff zurüsten und es mit Christenschiffleuten bemannen; dann befahl
er ihm, nach Famagusta in Zypern zu segeln und Fortunat anzugehen,
daß er dem Sultan sein Hütlein wiederschicke. Denn er hätte es ihn in
treuem sehen lassen; wollte es auch von ihm zu Danke wiederannehmen
und ihm dafür eine Galeere voll edlen Gewürzes senden. Wenn er es
aber nicht tun wollte, so sollte der Schiffshauptmann es dem Könige
von Zypern klagen, der ja sein Oberherr wäre, und diesen bitten, daß er
den Fortunat zwinge, dem Sultan sein geraubtes Kleinod zurückzuschicken.
— Der Hauptmann war ein Venezianer und hieß Marcholandi; dieser
sagte dem Sultan zu, die Botschaft treulich auszurichten und allen Fleiß
darauf zu verwenden. Dazu gab ihm jener großes Gut, rüstete ihn herrlich
aus und verhieß ihm noch mehreres, wenn er ihm sein Hütlein wiederbrächte.
Denn der Herr war so betrübt über seinen Verlust, daß er keine
Ruhe hatte; alle seine Mamelucken mußten auch traurig sein. Vorher
hatten sie alle den Fortunat gelobt; nun er aber ihren König betrübt
hatte, erklärten sie ihn für den größten Bösewicht, den das Erdreich trüge.
So fuhr Marcholandi gen Zypern und kam zu Famagusta in den Hafen,
aber Fortunat war wohl zehn Tage vor ihm eingetroffen. Wie zärtlich
Fortunat von seiner liebsten Gemahlin Kassandra empfangen wurde,
möget ihr leicht denken; auch wie große Freude er selbst empfand, als er
so glücklich wiederheimgekommen war. Die ganze Stadt war froh mit
ihm; denn es war viel Volks dort, die alle viel Freunde hatten, welche
mit Fortunat wiedergekommen waren, und über deren glückliche Rückkehr
jetzt alles fröhlich war.
Marcholandi wunderte sich nicht wenig, als er mit seiner Galeere ans
Land kam und die gange Stadt in solchem Vergnügen sah. Fortunat
aber, sowie er hörte, daß eine Botschaft des Königs von Alexandrien nach
Famagusta gekommen sei, versah sich ihres Inhalts wohl. Er ließ daher
sogleich für den Schiffshauptmann eine gute Herberge bestellen, ihm
alles in dieselbe führen, was er bedurfte; und was er sonst verbrauchte;
das bezahlte alles Fortunat. So hatte Marcholandi wohl drei Tage zu
Famagusta gelegen; da schickte er endlich zu Fortunat mit der Erklärung,
er habe ihm eine Botschaft auszurichten. Jener zeigte sich ganz bereitwillig
, ihn anzuhören, und nun kam der Schiffshauptmann zu ihm in
seinen schönen Palast und richtete den Inhalt seiner Sendung aus. "Der
König, Sultan von Babylon, zu Alkairo und Alexandria", sprach er,
"mein allergnädigster Herr, entbeut dir, Fortunat, seinen Gruß durch
mich, den Hauptmann der Christen zu Alerandrien, Marcholandi; er verlangt
von dir, du wollest so gutwillig sein und mich als gütlichen Boten
betrachten, ihm selbst aber sein bewußtes Kleinod durch mich zurücksenden."
Auf diese Anrede antwortete Fortunat und sprach: "Mich nimmt wunder,
daß der König und Sultan nicht weiser war, als er mir sagte, was
für eine Eigenschaft das Hütchen habe, und daß er mir dasselbe so unbedenklich
auf mein Haupt setzte. übrigens bin ich durch jenes Kleinod in
große Angst und Not gekommen, die ich mein Lebtag nicht vergessen will;
denn meine Galeere stand auf der offenen See, in diese wünschte ich mich
hinein; hätte ich dieselbe nur eines Fußes breit verfehlt, so wäre ich um
mein Leben gekommen, und dies ist für mich doch noch ein köstlicherer
Schatz als des Sultans ganzes Königreich. Und darum bin ich gesonnen,
das Wünschhütlein zu einer geringen Vergütung für die ausgestandene
Todesangst zu behalten und nicht von mir zu lassen, solange ich lebe."
Marcholandi gab auf diese Rede die Hoffnung, ihn in Güte zur Herausgabe
zu bewegen, noch nicht auf. Er sprach: "Fortunat; lasset Euch raten!
Wozu kann Euch dies Kleinod nutzens Ich will Euch etwas dafür schaffen,
.das Euch und Euren Kindern viel nützlicher sein soll als das abgeschabte
Hütlein. Ja, hätte ich einen Sack voll solcher Hüte, und jeder
Hut hätte die Tugend, die jenes Hütlein hat; so wollte ich sie alle um
das Dritteil des Guts geben, das ich Euch schaffen will. Darum laßt
mich einen guten Boten sein, so will ich Euch versprechen, daß der Sultan
Eure Galeeren mit dem besten Gewürz, Pfeffer, Ingwer, Muskatnüssen
und Zimmetrinden beladen muß, bis auf hunderttausend Dukaten an
Wert. Auch sollt Ihr das Hütchen nicht aus den Händen geben bis die
Galeere mitsamt dem Gut Euch in sichere Hand überantwortet ist. Behagt
dies Eurem Sinne, so will ich selbst auf Eurer Galeere nach Alerandrien
fahren und sie Euch geladen wiederbringen, und dann erst gebet mir
meines gnädigen Sultans Kleinod wieder zurück. Gewiß gilt dasselbe
in der ganzen Welt kein Dritteil von dem, was Euch der Sultan darum
geben will. Er würde auch nicht so sehr darnach verlangen, wenn es
nicht zuvor sein gewesen wäre."
Auf diese lange Rede antwortete Fortunat ganz kurz: "Mir ist nichts
werter als des Sultans Freundschaft und die Eure; aber das Hütlein hoffe
niemand aus meiner Gewalt zu bringen. Ich habe auch sonst noch ein
Kleinod, das mir sehr lieb ist, und beide müssen mein bleiben, solange
ich lebel" Mit dieser Antwort verfügte sich Marcholandi zum Könige von
Zypern, der Fortunats Oberherr war, und bat ihn, mit diesem zu unterhandeln;
denn er sorge, wenn Fortunat das Wünschhütlein nicht herausgebe
, so möchte daraus ein ernstlicher Krieg entspringen. Der König
antwortete dem Schiffshauptmann: "Ich habe Fürsten und Herren unter
mir, die, so ich gebiete, tun, was sie sollen. Hat nun der Sultan etwas
gegen Fortunat zu klagen, so mag er ihn vor Gericht belangen; alsdann
soll ihm alle Genugtuung widerfahren." Marcholandi merkte wohl, daß
die Heiden hier nicht viel Rechts gewinnen würden, rüstete seine Galeere
wieder zu und wollte davon. Aber Fortunat erzeigte sich sehr gütig
gegen ihn, lud ihn noch einmal zu Gaste und beschenkte ihn mit vielen
Kostbarkeiten, ließ auch seine Galeere mit Speise und Trank reichlich versehen
. Dann sprach er: "Saget Eurem Herrn, dem Sultan, wenn das
Hütlein mein gewesen wäre, und er hätte mir's entführt, so sendete er
mir es gewiß nicht wieder, und es würde ihm auch von den Seinigen
nicht geraten werden, mir dasselbe wiederzuschicken." Marcholandi versprach,
solches dem Sultan wörtlich zu hinterbringen, dankte für alle
Ehre, die ihm Fortunat erwiesen, und fuhr so unverrichteterdinge wieder
hinweg.
Nachdem Fortunat auf oben erzählte Weise die ganze Welt durchfahren
und der Welt Glück in Fülle gewonnen hatte, begann er, ein ruhiges
Leben zu führen, ließ seine zwei Söhne erziehen mit Ehren und großem
Aufwand und hielt ihnen Edelknechte, welche sie in allem Ritterspiel
unterrichteten, wozu besonders der jüngere Sohn, Andolosia, große Neigung
zeigte. Denn Fortunat gab ihnen manches Kleinod auszuspielen, und
wenn um dieselben zu Famagufta gestochen wurde, so tat jedesmal dieser
jüngste Sohn das Beste und gewann den Preis, so daß jedermann sprach:
"Andolosia bringt das ganze Land zu Ehren!" Darüber empfand Fortunat
große Freude, auch machte ihm sein Säckel und Wünschhütlein, sein
Federspiel und der Umgang mit seinen Söhnen und seiner Gemahlin
alles mögliche Vergnügen.
Viele Jahre lebten sie in solcher Eintracht; da verfiel endlich die schöne
Kassandra in eine solche Krankheit, daß sie trotz aller ärztlichen Hilfe
sterben mußte. Fortunat bekümmerte sich hierüber so sehr, daß auch er in
eine tödliche Krankheit verfiel und ein solches Siechtum empfand, daß
von Tag zu Tag seine Kräfte abnahmen. Vergebens suchte man die besten
Arzte in der Welt auf und versprach ihnen die herrlichste Belohnung,
wenn sie helfen könnten. Sie gaben keinen Trost, ihn je wieder ganz
gesund zu machen, aber sie wollten wenigstens ihr Bestes tun, sein Leben
so lange wie möglich zu fristen. Sowenig aber Fortunat auch sein Geld
sparte, so empfand er doch keine Besserung. Daraus schloß er, daß das
Ende seines Lebens nicht mehr ferne sei. Er ließ daher seine beiden
Söhne Ampedo und Andolosia vor sich kommen und sprach zu ihnen:
"Ihr wisset, lieben Söhne, daß eure Mutter, die euch mit großem Fleiß
erzogen, mit Tod abgegangen ist. Ich selbst empfinde, daß ich diese Zeitlichkeit
verlassen muß. Darum will ich euch sagen, wie ihr euch nach meinem
Tode verhalten sollt, damit ihr bei Ehre und Gut bleibet, wie ich auch
bis an mein Ende geblieben bin." Dann offenbarte er ihnen den Besitz
seiner zwei Kleinode und erzählte ihnen von dem Glückssäckel und der
Eigenschaft, die er hätte, nicht länger, als solange sie beide lebten; ebenso
teilte er ihnen das Geheimnis von der Tugend des Wünschhütleins mit,
sagte ihnen, wie großes Gut der Sultan ihm dafür geben wollte, und
befahl, diese Kleinode nicht voneinander zu trennen, auch niemand etwas
von dem Säckel zu sagen, er wäre ihnen so lieb, als er wollte. "Denn
also", sprach er, "habe ich den Säckel sechzig Jahre lang gehabt und keinem
Menschen davon je ein Wörtlein gesagt denn jetzt euch. Noch will
ich euch eines befehlen, lieben Söhne; ihr sollt zu Ehren einer Jungfrau,
von welcher ich mit diesem glückhaften Säckel begabt worden bin, hinfüro
alle Jahr auf den ersten Tag des Brachmonats einer annen Tochter, welcher
Vater und Mutter nicht helfen können, vierhundert Goldstücke nach
des Landes Währung zur Brautgabe schenken, an dem Orte, wo sich der
eine von euch gerade mit dem Säckel befindet. Denn dies habe auch ich
getan, solange ich denselben besessen habe." Dieses waren die letzten
Worte Fortunats, nach welchen er seinen Geist aufgab. Die Söhne bestatteten
ihn mit großen Ehren in der Kirche, die er selbst gebaut hatte,
und ließen viele Messen zum Heil seiner Seele lesen.
Während Fortunats jüngerer Sohn Andolosia das Trauerjahr über
stilleliegen mußte, und sich nicht mit Stechen und anderem adeligen Zeitvertreib
erlustigen durfte, war er über seines Vaters Büchern gesessen
und hatte darin gelesen, wie dieser so viele christliche Königreiche durchzogen
hatte, und durch wie vieler Heiden Länder er gefahren war. Das
gefiel ihm auch wohl und erweckte in ihm eine solche Begierde, daß er sich
ernstlich vornahm, ebenfalls auf die Wanderung zu gehen. Er sprach daher
zu seinem Bruder Ampedo: "Mein liebster Bruder, was wollen wir
anfahen? Laß uns wandern und nach Ehren trachten, wie unser Herr Vater
auch getan hat. Oder hast du nicht gelesen, wie er so weite Lande

durchfahren? Wenn du es noch nicht gelesen, so lies es jetzt!" Ampedo
erwiderte seinem Bruder ganz gütlich: "Wer wandern will, der wandre!
Mich lüstet es gar nicht darnach; ich könnte leicht an einen Ort kommen,
wo mir nicht so wohl wäre wie hier. Laß mich nur hier in Famagusta
bleiben und mein Leben in dem schönen väterlichen Palaste beschließen!"
Andolosia sprach: "Wenn du dieses Sinnes bist, so laß uns die Kleinode
teilen." "Willst du jetzt schon das Gebot unsers Vaters übertreten?"
fragte Ampedo betrübt. "Weißt du nicht, daß sein letzter ernstlicher Wille
gewesen ist; daß wir die Kleinode nicht voneinander trennen sollen?" Andolosia
erwiderte: "Was kehre ich mich an diese Redel Er ist tot, ich aber
lebe noch und will teilen." Ampedo sprach: "So nimm du das Hütlein
und ziehe, wohin du willst!" — "Nein, nimm du es selbst", sprach Andolosia,
"und bleib hier!" So konnten sie nicht einig über die Sache
werden; denn jeder wollte den Säckel haben. Endlich sagte Andolosia:
"Jetzt weiß ich, wie wir das Ding machen wollen, daß des Vaters Wille
doch erfüllt wird. Laß uns aus dem Säckel zwei Truhen mit Goldgulden
füllen, die behalte du hier für dich; du magst leben, so herrlich du willst;
so kannst du sie dein Leben lang nicht verzehren. Dazu behalte auch das
Hütlein bei dir, damit du Kurzweil haben magst. Mir aber laß den Säckel
; ich will wandern und nach Ehren trachten. Wenn ich sechs Jahr ausgewesen
bin und wiederkomme, so will ich dir den Säckel auch sechs Jahre
lassen. Auf diese Weise haben wir ihn ja doch gemeinschaftlich und benützen
ihn miteinander."
Ampedo war ein gütiger Mensch; er ließ sich den Vorschlag seines Bruders
gefallen. Als nun Andolosia den Säckel hatte, war er von ganzem
Herzen froh und wohlgemut; er rüstete sich mit guten Knechten und hübschen
Pferden stattlich aus, nahm Urlaub von seinem Bruder und verließ
Famagusta mit vierzig wohlgerüsteten Mannen und auf seiner eigenen
Galeere. Als er in dem Hafen von Aiguesmortes angekommen war, stieg
er dort ans Land und ritt zuallererst an den Hof des Königs von Frankreich
. Hier gesellte er sich zu den Edeln des Landes, den Grafen und Freiherrn;
denn er war freigebig und ließ seinen Reichtum jedermann genießen,
deswegen er auch bei aller Welt beliebt war. Und zugleich diente
er dem König so eifrig, als wäre er sein besoldeter Diener. Indem begab
es sich, daß ein scharfes Stechen, Ringen, Nennen und Springen angestellt
werden sollte. In diesem tat er es auch allen andern insgesamt zuvor.
Nach dem Stechen wurden gewöhnlich große Tänze mit den edeln Frauen
gehalten. Auch zu diesen wurde er berufen und überall herangezogen. ,Die
Frauen fragten, wer denn der mutige Ritter sei. Da ward ihnen gesagt,
er heiße Andolosia, sei aus Famagusta in Zypern und von edelm Geschlecht.
So gefiel er auch den Weibern sehr wohl; sie unterhielten sich
gern mit ihm, und er ließ sich solches auch gefallen. Der König lud ihn
zu Gast, und den Edeln war seine Gesellschaft angenehm. Er selbst lud
auch die Edeln und ihre Frauen zu Gast und gab ihnen ein gar köstliches
Mahl; dadurch wurde er beiden wohlgefällig, und sie glaubten ihm jetzt
erst recht, daß er von edlem Geschlechte sei.
Hier erfuhr Andolosia von einer schönen, aber falschen Frau viel Liebe
und zuletzt große Untreue, so daß er mit Unlust vom Hofe des Königes
von Frankreich hinwegritt und sich nur damit tröstete, daß er dachte: "Es
ist noch gut, daß mich die falschen Weiber nicht auch um den Glückssäckel
betrogen haben t" Und damit schlug er sich die Sache aus dem Herzen und
sann darauf, wie er jetzt anheben wollte, recht fröhlich zu sein und
immer einen guten Mut zu haben. Er ritt deswegen in einem fort, bis er
an den Hof des Königs von Aragonien kam. Dann zog er zu dem Könige
von Navarra, dann zu dem von Kastilien, dann gen Portugal, darnach zu
dem Könige von Hispanien. Allda gefielen ihm Volk und Sitten so wohl,
daß er sich und seine Knechte nach des Landes Art kleidete. Auch hier
wurde er des Königs Diener und gesellte sich zu den Edeln, trieb alle
möglichen Ritterspiele, gab Kleinode zu Preisen her und lud die edeln
Frauen mit ihren Männern zu Gaste. Wenn der König wider seine Feinde
auszog, bestellte er zu seinem Gefolge noch hundert weitere Söldner,
alles auf eigene Kosten, und mit diesen diente er dem Könige so gut, daß
dieser ihn ganz liebgewann. Und da er in allen Kämpfen vorn an der
Spitze sein wollte und viel männlicher Taten verrichtete, so schlug ihn zuletzt
der König zum Ritter. An dem Hofe war auch ein alter Graf vom
edelsten Stamme, der hatte einige Töchter. Der König von Hispanien
wünschte, daß Andolosia eine Tochter dieses Grafen zur Ehe nehmen sollte,
und er war bereit, den Ritter in den Grafenstand zu erheben. Aber dem
Andolosia gefiel des Grafen Tochter nicht, auch achtete er keines Reichtums
und keiner Grafschaft; denn sein Glückssäckel war mehr als beides.
Als er nun etliche Jahre bei dem Könige von Hispanien gewesen war beurlaubte
er sich im guten, mietete sich mit seinem ganzen Gefolge auf ein
Schiff ein und fuhr nach England. Einige Herren am hispanischen Hofe
waren über seine Abreise ganz froh, darum, daß sie jetzt doch nicht mehr
das köstliche Leben sehen müßten, das er führte; dagegen waren viele andere
sehr traurig, die von ihm Gutes genossen hatten.
Andolosia kam inzwischen glücklich nach England in die große Stadt
London, wohin vor vielen Jahren sein Vater aus Flandern geflohen war.
Hier bestellte er ein großes schönes Haus, ließ darein kaufen, was er zum
Hauswesen bedurfte, in allem überfluß und fing an hofzuhalten, als ob
er ein Herzog wäre. Er lud die Edeln an des Königs Hof zu Gast und
machte ihnen die köstlichsten Geschenke. Diesen gefiel sein Umgang ausnehmend
wohl, und alle turnierten mit ihm; aber so ritterlich sie waren,
so wurde doch immer von Männern und Frauen dem Andolosia der Preis
zuerkannt. Als dem Könige von England dieses zu Ohren kam, fragte er
ihn, ob er denn nicht auch an seinem Hofe zu sein begehrte. —Andolosia
erwiderte, er wollte solches mit Freuden tun und dem Könige gern mit
Leib und Gute dienen. Nun begab es sich gerade jener Zeit, daß der
König von England einen Krieg mit dem Könige von Schottland führte.
Da zog Andolosia auf seine eigene Kosten mit ihm nebst einem großen
Gefolge und verrichtete so manche ritterliche Tat, daß er vor allen andern
gepriesen ward, obgleich er kein englischer Mann war.
***Der Krieg war zu Ende; Andolosia kam wieder nach London zurück und
wurde überall von dem Könige, von den Edeln, dem Frauenzimmer und
allem Volk aufs glänzendste empfangen. Der König selbst lud ihn zu
Gaste an seinen Tisch, zu der Königin, seiner Gemahlin, und zu seiner
Tochter Agrippina, welche die schönste Jungfrau in ganz England war. Da
wurde Andolosia von so inbrünstiger Liebe zu der Königstochter entzündet
, daß er weder essen noch trinken mehr mochte. Als die Mahlzeit vollbracht
und er wieder zu Hause war, sprach er zu sich in schwermütigen Gedanken:
"Oh, wollte Gott; daß ich von königlichem Stamme geboren wäre;
wie wollte ich da dem Könige von England so treulich dienen, bis er mir
die schöne Agrippina vermählte. Was könnte ich dann noch mehreres
wünschen?" Nun fing er erst recht an zu stechen, der Königin und ihrer
Tochter zu Ehren. Alsdann lud er auf einmal die Königin, ihre Tochter
und alle edle Frauen, die an dem Hofe waren, in seinen Palast und gab
ihnen ein so herrliches Mahl, daß sich jedermann darüber verwunderte.
Überdies schenkte er der Königin und der Prinzessin Agrippina jeder ein
köstliches Juwel, und auch die Obersthofmeisterin der Königin und alle die
Hoffräulein und Kammerfrauen bedachte er aufs reichlichste; um desto besser
empfangen zu werden, wenn er zu ihnen käme.
Solches alles erfuhr der König. Als nun Andolosia wieder einmal an
den Hof kam, sprach der König zu ihm: "Mir sagt die Königin, daß du
ihr ein so köstliches Mahl gegeben habest. Warum ludest du mich nicht
auch dazu ein?" — "O allergnädigster Herr König, wenn Eure Königliche
Majestät mich, Euren Diener, nicht verschmähen wollte, wie eine
große Freude müßte mir das sein!" — "So will ich morgen kommen",
sprach der König, "und zehn mit mir bringen." Darüber war Andolosia
gar froh, eilte heim und rüstete sich aufs kostbarste. Und als der König
mit Grafen und Herren kam, da war die Mahlzeit so reichlich und prachtvoll,
daß der König und alle andern, die mit ihm gekommen waren, sich
nicht genug verwundern konnten. Der König aber dachte: "Ich muß doch
diesem Andolosia seine Pracht ein wenig niederlegen und ihn zuschanden
machen." Deswegen ließ er heimlich verbieten, daß den Leuten Andolosias
ferner Holz zum Kochen verkauft werde. Alsdann lud er sich wieder
bei ihm zu Gaste. Andolosia war darüber sehr vergnügt; als aber alles
an Speisen und Getränken eingekauft war, erschrak er nicht wenig; denn
es mangelte an Holz. Er wußte nicht, was das für ein Handel wäre, und
womit er kochen sollte. Endlich kam ihm ein guter Einfall. Er schickte eilig
zu den venezianischen Kaufleuten zu London und ließ ihnen Nägelein,
Muskaten, Sandelholz und Zimmetrinden die Hülle und Fülle abkaufen;
das alles ward auf die Erde geschüttet und angezündet, und über dem
herrlich dampfenden Feuer kochte und bereitete man die Speisen, als ob
es gemeines Holz wäre.
Die seit des Mahles war herbeigekommen, und der König, obwohl er
darauf gefaßt war zu hungern, freute sich nicht wenig darauf, saß auf,
nahm die Herren, die schon das erstemal mit ihm gewesen waren, wieder
mit sich und ritt nach Andolosias Herberge. Als sie nun in der Nähe des
Hauses waren, duftete ihnen ein so köstlicher Wohlgeruch entgegen, daß
sie gar nicht begreifen konnten, woher das käme; und je näher sie dem
Hause ritten, lieblicher und stärker wurde der Duft. Der König ließ
fragen, ob das Essen bereitet wäre. Man sagte ihm: "Ja, und zwar mit
lauter Spezerei gar gekocht." Da wunderte sich der König über die Maßen.
Die Mahlzeit selbst aber war noch viel herrlicher, als die erste gewesen
war. Und als nach vollbrachtem Mahle die Diener ankamen, ihren
Herrn, den König, abzuholen, beschenkte Andolosia sie alle, jeden mit zehn
Kronen, und machte sie gar fröhlich mit dem Gelde. Wie nun alles vorüber
war, ritt der König wiederum heim. Als er in seinen Palast trat,
kam ihm die Königin entgegen. Der erzählte er, wie ihm Andolosia ein
so herrliches Mahl gegeben hätte, bei dem mit eitel Gewürz statt des
Holzes gekocht worden sei, und wie freigebig er seine Diener beschenkt
habe. Ihn wunderte, von wannen ihm soviel Geld käme; denn da würde
an kein Sparen gedacht; länger es währe, je köstlicher sei es. Die Königin
sprach: "Ich wüßte niemand, der das besser erfahren könnte als unsere
Tochter Agrippina. Der ist er so hold, und ich bin überzeugt; was
sie ihn auch fragen mag: er versagt es ihr nicht." — "Nun, so wende
Fleiß darauf, daß es geschieht!"sagte der König. Sobald nun die Königin
in ihre Frauengemächer kam, beruft sie ihre Tochter allein zu sich, schilderte
ihr das kostbare Leben, das Andolosia führe: "Des verwundert
sich der König", sprach sie, "und ich mich selber, von wannen ihm so
großes Gut komme, da er doch weder Land noch Leute hat. Nun ist er
dir gar hold, das spüre ich an seinem ganzen Wesen; wenn er das nächstemal
zu uns kommt; so will ich ihm mehr Weile als sonst lassen, mit
dir zu reden. Vielleicht könntest du von ihm erfahren, woher ihm das
viele Geld komme." Agrippina erwiderte: "Ja, Mutter, ich will es versuchen!"
Sowie nun Andolosia wieder zu Hofe kam, wurde er gar schön empfangen
und bald in die Frauengemächer gelassen. Er empfand darüber große
Freude, und die Sache war so eingeleitet, daß er allein mit der schönen
Agrippina zu reden kam. Da fing Agrippina an und sprach: "Andolosia,
man rühmt überall von Euch, daß Ihr dem Könige eine so köstliche Mahlzeit
gegeben, auch alle seine Diener mit großen Gaben beehrt habt: nun
saget mir doch, habt Ihr nicht Sorge, daß Euch das Geld gebrechen
möchte?" Er antwortete: "Gnädigste Frau, mir kann kein Geld zerrinnen,
solange ich lebe." —"Nun", sagte Agrippina, "da dürftet Ihr billig den
Himmel für Euren Vater bitten, der Euch solche Genüge gönnet!" —Andolosia
sprach: bin so reich als mein Vater, und mein Vater war nie
reicher, als ich jetzt bin. Aber er hatte ein anderes Gemüt als ich; ihn
freute es nur, fremde Lande zu sehen, mich aber erfreuet nichts, als schöne
Frauen und Jungfrauen, wenn ich deren Liebe und Gunst erlangen könnte."
— "Soviel ich höre", sagte Agrippina, "seid Ihr an der Könige Höfen
gewesen; habt Ihr denn nichts gesehen, das Euch gefallen hätte?" —
"Ja", sprach er, "ich habe an sechs Königshofen gedient, habe manche
schöne Frauen und Jungfrauen gesehen, aber; gnädigste Prinzessin, Ihr
übertreffet sie alle weit an Schönheit, würdigem Wandel und lieblichen
Gebärden, womit Ihr mein Herz also in Liebe entzündet habt, daß ich
Euch nicht lassen kann. Ja, ich muß Euch die große unselige Liebe, die ich
zu Euch trage, bekennen. Ich weiß, es ist ein Unsinn, Eure Liebe zu begehren
da ich von Adel nicht so hoch geboren bin wie Ihr. Aber eine übermenschliche
Gewalt zwingt mich, Euch doch darum zu bitten; ja, ich flehe,
wollet sie mir nicht versagen; was Ihr alsdann von mir bitten möget,
das soll Euch auch gewähret werden."
Darauf sprach Agrippina: "Andolosia, so sage mir die lautre Wahrheit
, daß ich wissen möge, woher dir dieser Reichtum und das viele bare
Geld komme. Wenn du mir dieses sagst, so wird sich dir mein Herz zuneigen!"
Andolosia war unbeschreiblich froh; mit frohem Mute und aus
freudenreichem Herzen sprach er ihr: "Allerliebste Agrippina, ich will
Euch mit ganzen Treuen die Wahrheit berichten; aber gelobet mir auch,
das, was Ihr mir zugesagt, mit aller Treue zu halten!" —"Oh, du liebster
Andolosia", antwortete sie, "du sollst an meiner Liebe nicht zweifeln;
was ich dir mit dem Munde verhieß, soll alles mit der Tat gehalten werden
." Auf diese gütigen Worte der Jungfrau zögerte Andolosia nicht länger
mit seiner Entdeckung. "Macht einen Schoß mit Eurem Kleide",

sprach er, zog seinen glückhaften Säckel heraus, ließ ihn Agrippinen sehen
und sagte: "Solange ich diesen Säckel habe, gebricht es mir an Gelde
nicht!" Und unter diesen Worten fing er an, ihr tausend Kronen in den
Schoß zu zählen, und sprach: "Die seien Euch geschenkt, und wollt Ihr
mehr haben, so zähle ich noch weiter." Agrippina rief: "Ja, ich sehe und
erkenne die Wahrheit. Jetzt wundert mich Euer kostbares Leben nicht
mehrt Und nun soll Euch mein Wort gehalten sein. Der König und die
Königin sind diesen Abend nicht im Schlosse. So will ich es mit meiner
Kämmrerin, ohne welche ich nichts tun kann, verabreden, daß ich Euch bei
mir in meinem Gemache empfange, da wollen wir eine Stunde in lieblichen
Gesprächen verbringen. Aber der Kämmrerin müßt Ihr auch ein
schönes Geschenk machen, damit es fein verschwiegen bleibt."
Andolosia versprach dies unter dem Jauchzen seines Herzens und entfernte
sich. Sobald er hinweggegangen war, lief Agrippina zu der Königin,
ihrer Mutter, und sagte ihr mit großem Jubel, was sie erfahren
hatte. Sie erzählte ihr auch, wie sie dem Andolosia verheißen hätte, ihn
diesen Abend zu empfangen. Das alles gefiel der Königin wohl; sie fragte
ihre Tochter: "Weißest du wohl noch, Kind, was für eine Gestalt, Farbe
und Größe der Säckel hat?" Sie sprach: "O ja." Und auf der Stelle
schickte die Königin nach einem Säckler und ließ einen Säckel verfertigen
ganz nach ihrer Tochter Beschreibung; das Leder machten sie recht linde,
wie wenn der Beutel schon alt wäre. Alsdann sandte die Königin auch
nach einem Doktor der Arzneikunde und hieß ihn ein starkes Getränke bereiten,
dessen Genuß in einen so tiefen Schlaf versenkte, als ob der Mensch,
der es getrunken, tot wäre. Als der Trunk bereitet war, trugen sie ihn
in das Frauengemach Agrippinas und unterwiesen die Kammermeisterin,
wenn des Abends Andolosia vor die Pforte käme, ihn aufs schönste zu
empfangen und in der Prinzessin Zimmer einzuführen. Hier sollte ihm
köstliche Speise vorgesetzt und zuletzt der Trank in seinen Becher geschüttet
werden.
Andolosia kam in der Abenddämmerung aufs heimlichste herbeigeschlichen
und wurde sofort in Agrippinas Zimmer geführt. Diese kam, grüßte
ihn holdselig und setzte sich neben ihn. Da sprachen sie die liebreichsten
Worte miteinander; süsse Speisen in Fülle wurden aufgetragen und ein
goldener Pokal voll eingeschenkt. Diesen ergriff Agrippina, hub ihn auf,
neigte sich gegen Andolosia und sprach zu ihm: "Andolosia, ich bringe Euch
einen freundlichen Trunk." Er erhub sich, faßte den Becher mit Begierde
und trank nach Herzenslust, um der Geliebten recht zu Willen zu sein. So
brachte sie ihm einen Trunk nach dem andern dar, bis er den ganzen Trank
des Doktors ausgetrunken hatte; sobald er aber fertig war, mußte er sich
niedersetzen und verfiel in einen so tiefen Schlaf, daß er gar keine Empfindung
mehr hatte, wie man mit ihm umging. Als Agrippina dieses sah,
ergriff sic ihn ohne Bedenken, riß ihm das Wams vom Leibe, trennte ihm
seinen glückhaften Säckel ab und nähte den andern, nachgemachten an seine
Stelle hin.
Am andern Morgen frühe brachte Agrippina den Säckel der Königin,
und sie versuchten ihn, ob er auch der rechte wäre. Mit dem ersten Griffe
zogen sie zehn Goldkronen aus dem Ledersack, und nun zählten sie soviel
Goldgulden heraus, als sie wollten; da war kein Mangel. Die Königin
brachte dem König einen Schoß voll Gulden und erzählte ihm, wie sie mit
Andolosia verfahren seien. Der König hatte ein großes Verlangen nach
dem Säckel und bat seine Gemahlin, die Tochter dahin zu bewegen, daß
sie denselben ihrem Vater einhändige, auf daß er nicht verlorengehe. Die
Königen tat dies, aber Agrippina wollte ihn ihrem Vater nicht geben. Da
bat die Mutter sie, wenigstens ihr den Säckel anzuvertrauen. Aber Agrippina
wollte auch dieses nicht tun. Sie habe ihr Leben daran gewagt, erklärte
sie; denn wenn er erwacht wäre, so würde er sie erschlagen haben.
Darum gehöre der Glückssäckel auch billig ihr selber.
***Als Andolosia ausgeschlafen hatte und erwachte, war es heller Morgen.
Er sah niemand um sich als die alte Kammermeisterin. Diese fragte er,
wo denn Agrippina hingekommen wäre. "Sie ist eben erst aufgestanden",
erwiderte die Alte, "meine gnädige Frau, die Königin, hat nach ihr gesendet
. Aber, mein Herr, wie habt Ihr so hart geschlafen? Ich habe lange
an Euch geweckt, damit Agrippina sich noch Eures holden Gespräches erfreuen
könnte, aber ich konnte Euch nicht aufwecken. Wahrhaftig, Ihr
habt so fest geschlafen, daß ich gar nicht empfand, ob Euch der Atem noch
ging. Mir war ganz bange, Ihr möchtet gar tot sein!" Als Andolosia
hörte, daß er die Gegenwart der schönen Agrippina verschlafen, fing er an
zu schwören und sich selbst zu fluchen. Die Kammermeisterin wollte ihn
beruhigen und sprach zu ihm: "Gebärdet Euch doch nicht so trostlos; es
ist ja der letzte Abend nicht gewesen, und es wird wohl wieder eine ruhige
Stunde kommen, wo Ihr Eure Geliebte sprechen könnet!" Aber Andolosia
verwünschte sie. "Ich schlafe niemals so fest", sagte er, "wenn man
mich nur mit dem Ellbogen anstößt, so wache ich auf." Sie aber schwur
ihm, daß sie ihn nicht habe erwecken können, und gab ihm die besten
Worte; denn er hatte ihr am Abende zweihundert Kronen geschenkt. Und
so führte sie ihn besänftigend aus Agrippinas Zimmer und aus des Königs
Palaste.
Nun hätte der König auch gerne einen solchen Säckel gehabt; denn er
meinte, Andolosia müßte deren mehrere besitzen; er wäre sonst doch ein
gar zu großer Narr gewesen, wenn er ihn nicht besser verwahrt hätte.
Er wollte daher wieder bei Andolosia speisen und lud sich bei demselben
zu Gaste. Als dieser es vernahm, gab er seinem Diener von dem vorhandenen
Gelde drei- oder vierhundert Kronen, um das Haus mit dem Notwendigen
zu versehen, und befahl ihm, ein köstliches Mahl zuzubereiten;
denn der König wolle abermals mit ihm essen. Der Diener sagte: "Herr,
ich sehe voraus, daß ich nicht Geldes genug haben werde; denn es kostet
viel." Andolosia, der nicht guten Mutes war, riß sein Wams auf und zog
seinen Säckel heraus, wollte seinem Diener noch vierhundert weitere Kronen
geben. Aber als er nach seiner alten Gewohnheit in den Säckel griff,
spürte er nichts in seiner Hand. Er sah gen Himmel auf, dann von einer
Wand zu der andern; er kehrte dem Geldsäckel das Innere nach außen:
da war kein Geld mehr. Nun kam er in Angst und Not und gedachte an
die Lehre, die sein Vater Fortunat ihm und seinem Bruder so treulich auf
dem Todbette gegeben hatte, daß sie, solange sie lebten, niemand von dem
Säckel sagen sollten. Aber es war versäumt; alle seine Hoffart war jetzt aus.
Da berief er alle seine Knechte, gab ihnen Urlaub und sprach: "Es ist
wohl nun bald zehn Jahr, daß ich euer Herr bin; ich habe euch auch alle
ehrlich gehalten und keinem je mangeln lassen, bin keinem etwas schuldig;
ihr seid ja alle vorausbezahlt. Nun ist die Zeit gekommen, daß ich nicht
mehr hofhalten kann, wie ich bisher getan habe; ich sage euch deswegen
des Gelübdes, das ihr mir getan, ledig und los; tue ein jeder, was ihm
das beste dünkt; ich kann hier nicht mehr bleiben, ich habe kein Geld mehr
außer hundertundsechzig Kronen! Davon schenke ich jedem von euch zwei;
überdies mag jeder Roß und Hamisch zu eigen behalten!" Über diese Rede
erschraken die Diener allzumal sehr; einer sah den andern an; es nahm sie
groß wunder, wohin die Pracht ihres Herrn auf einmal gekommen wäre.
Doch sagte einer: "Getreuer, lieber Herr! Hat jemand Euch etwas Widriges
getan, so gebt es uns zu erkennen. Wer es getan hat, der müsse
sterben, und wäre es der König selbst, und sollten wir unser Leben darüber
verlieren!" —"Nein", sprach Andolosia, "um meinetwillen soll niemand
fechten!" — "So wollen wir nicht von Euch scheiden; sondern wir
wollen Rosse, Harnische und alles, was wir haben, verkaufen und Euch
nicht verlassen, lieber Herr!" —"Ich danke euch allen für eure Anerbietungen,
ihr frommen Diener", antwortete Andolosia; "wenn sich das
Glück wieder zu mir kehrt, soll euch das alles reichlich vergolten werden.
Jetzt aber tut, wie ich euch gesagt habe, und sattelt mir von Stund an
mein Pferd; ich will nicht, daß einer von euch mit mir reite oder gehe!"
Die Knechte waren traurig, es war ihnen leid um ihren braven Herrn,
bei dem sie soviel guten Mut eingenommen hatten. Doch brachten sie ihm
sein Pferd, und er nahm von ihnen allen Urlaub, saß auf und ritt fürbaß
und reiste über Land und Meer den nächsten Weg nach Famagusta zu
seinem Bruder Ampedo.

|
***Als er vor den schönen Palast zu Famagusta
kam, klopfte er an und ward auf
der Stelle eingelassen. Und wie Ampedo
vernahm, daß sein Bruder Andolosia gekommen
sei, so wurde er froh; meinte
nicht anders, als er dürfe nun auch seine
Freude an dem Säckel haben und brauche
forthin nicht mehr zu sparen, wie er zehn
Jahre lang getan hatte. Er ging deswegen
dem Bruder entgegen und empfing
ihn mit herzlicher Freude; fragte
ihn jedoch, warum er so allein käme, und
wo er sein Volk gelassen habe. Er sagte:
"Ich habe sie alle entlassen, und gott
|
lob, daß ich selbst wiederheimgekommen bin!" — "Lieber Bruder", sprach
Ampedo, "wie ist es dir doch ergangen? Sage mir; denn das gefällt mir
übel, daß du so allein gekommen biss!" — "Laß uns vorher essen", antwortete
Andolosia. Nachdem sie nun die Mahlzeit vollbracht hatten, gingen
sie miteinander in eine Kammer; da blickte Andolosia seinen Bruder
Ampedo mit trauriger Gebärde an und sprach: "Oh, allerliebster Bruder,
ich muß dir leider viel böse Mär verkünden; ich bin übel gefahren; ich bin
um den Glückssäckel gekommen. Ach Gott, jetzt ist mir's herzlich leid;
aber ich kann es nicht anders machen!"
Ampedo erschrak aus dem ganzen Grunde seines Herzens und fragte mit
großem Jammer: "Ist er dir mit Gewalt genommen worden, oder hast
du ihn verloren?" Er antwortete: "Ich habe das Gebot, das uns unser
treuer Vater als Vermächtnis hinterließ, übergangen und einer geliebten
Frau davon gesagt; und sobald ich ihr's geoffenbart, so hat sie mich darum
gebracht; dessen ich mich doch nicht zu ihr versehen hatte!" —"Ach, hätten
wir das Gebot unsers Vaters gehalten!" sprach Ampedo, "so wären
die Kleinode nicht voneinander gekommen. Du aber wolltest durchaus
fremde Lande versuchen; sieh nur, wie gut du es mit dir selber gemeint
hast, und wie sie dir bekommen sind!" Andolosia aber seufzte und sprach:
"O lieber Bruder, es ist mir ein so großes Herzeleid, daß ich meines Lebens
überdrüssig bin!" Als Ampedo diese Worte hörte, wollte er ihn trösten
und sagte: "Lieber Bruder, laß es dir nicht so hart zu Herzen gehen;
wir haben noch zwei Truhen voller Dukaten; dann haben wir ja auch das
Hütlein. Laß uns darum dem Sultan schreiben; er gibt uns gewiß noch
immer großes Gut dafür; dann haben wir genug, solange wir leben;
darum, Bruder, schlage dir den Säckel aus dem Sinn!" Aber Andolosia
sprach: "Von gewonnenem Gut ist schwer scheiden; mein Begehren wäre,
du gäbest mir das Hütlein; dann lebte ich der Hoffnung, den Säckel auch
damit wiederzugewinnen!" — Ampedo machte große Augen zu diesem
Vorschlag und sagte: "Im Sprichwort heißt's: ,Wer sein Gut verliert;
der verliert den Sinn. ' Das spüre ich an dir wohl, Bruder! Denn nachdem
du uns um das Gut gebracht hast; möchtest du uns auch gern um
das Hütlein bringen. Wiewohl, mit meinem Willen laß ich es dich nicht
hinwegführen. Kurzweil magst du immerhin damit haben!" — "Gut",
dachte Andolosia, "ich sehe schon, daß ich es anders angreifen muß!" —
"Nun, mein getreuer, lieber Bruder", sprach er, "habe ich auch vorhin
übelgetan, so will ich doch von nun an deinem Willen leben!"
Darauf schickte er des Bruders Knechte in den Forst, ein Jagen anzurichten
; er selbst wollte ihnen bald nachkommen. Als sie weg waren, sagte
Andolosia: "Lieber Bruder, leih mir das Hütlein; ich will in den Forst."
Der Bruder war willig und brachte das Hütlein. Aber sobald Andolosia
dieses auf dem Kopf hatte, ließ er Forst Forst und Jäger Jäger sein und
wünschte sich stracks nach Genua. Hier fragte er nach den besten und köstlichsten
Kleinoden, die zu finden waren, und hieß sie in seine Herberge
bringen. Da man ihm nun deren viele brachte, marktete er lang darum;
endlich legte er sie in ein Tuch zusammen, als wollte er proben, wie schwer
sie wären. Dann setzte er sein Hütlein auf und fuhr mit ihnen davon, unbezahlt
. "Ich will sie schon bezahlen, wenn ich den Säckel wiederhabe", ,
dachte er. Und wie er es in Genua gemacht hatte, so machte er es zu Florenz
und nachher zu Venedig. So brachte er die köstlichsten Kleinode der
drei Städte zusammen ohne Geld. Und als er sie alle hatte, zog er gen
London in England.
Andolosia wußte, von welcher Seite her die Prinzessin Agrippina zur
Kirche kam. Er bestellte daher eine Bude an derselben Straße und legte
da seine Kostbarkeiten aus. Auch währte es nicht lange, so erschien die
Prinzessin und viele Mägde und Knechte vor und hinter ihr, auch die alte
Kammermeisterin, die ihm den Schlaftrunk gereicht hatte. Andolosia erkannte
die wohl, sie aber nicht ihn; das machte: er hatte eine andere Nase
auf die seinige gesetzt, die war so abenteuerlich gemacht, daß ihn niemand
erkennen konnte. Als nun Agrippina vorüber war, nahm Andolosia zwei
schöne Ringe und beschenkte die alten Kammermeisterinnen, die stets um
Agrippina waren, und bei denen sie sich Rats erholte. Er bat sie, es doch
zuwege zu bringen, daß man nach ihm sende; dann wolle er so köstliche
Kleinode mitbringen, wie sie gewiß noch keine gesehen hätten. Sie sagten
ihm zu, solches zu vermitteln. Und wie die Prinzessin aus der Kirche kam,
zeigten sie ihr die zwei hübschen Ringe und erzählten ihr, der Edelsteinkrämer,
, der vor der Kirche gestanden, habe sie ihnen geschenkt, mit der
Bitte, ihn zu beschicken; denn er habe eine Auswahl der köstlichsten Juwelen.
"Das will ich wohl glauben", sagte die Prinzessin, "wenn er euch
zwei so gute Ringe umsonst gegeben hat! Heißet ihn nur herkommen;
mich verlanget sehr, seine Schätze zu schauen."
***Auf der Stelle wurde Andolosia beschieden, kam und legte seine Kleinode
in einem Saale vor Agrippinas Zimmer aus. Sie gefielen der Prinzessin
gar sehr, und sie fing an, um diejenigen zu feilschen, die ihr am
meisten in die Augen leuchteten. Nun waren Juwelen darunter; die tausend
Kronen wert waren und noch viel mehr. Sie bot ihm aber nicht das
halbe Geld darum. Der verkappte Juwelier sprach: "Gnädige Prinzessin,
ich habe oft gehört, daß Ihr die reichste Königstochter auf der ganzen Erde
seid, und darum habe ich die schönsten Kleinode ausgesucht; die man finden
mag, um sie Eurer Königlichen Hoheit bringen; aber Ihr bietet
mir viel zu wenig darum; sie kosten mich sicher mehr; ich bin Euch mit
denselben so lange nachgereist mit großen Sorgen; denn ich fürchtete wegen
der Schätze, die ich bei mir trug, ermordet zu werden! Leget doch zusammen
, was Euch gefällt, gnädigste Frau, ich will es dann so billig machen,
als ich es erleiden kann." So las sie denn aus, was ihr am besten
gefiel, große und kleine, wohl zehn Stück. Der Juwelier rechnete zusammen;
es machte bei fünftausend Kronen; aber so viel wollte sie ihm nicht
geben. Andolosia dachte: "Nun, ich will mich nicht mit ihr herumstreiten
, brächte sie nur den Säckel!" und so wurden sie des Kaufes eins um
viertausend Kronen.
Die Prinzessin nahm die Kleinode in ihren Schoß, ging in ihre Kammer
über ihren Kasten, wo der Glückssäckel aufgehoben war, und steckte ihn
vorsichtig in ihren Gürtel; dann kam sie heraus und wollte die Edelsteine
bezahlen: da wußte es der falsche Juwelier so einzurichten, daß sie neben
ihn zu stehen kam, und als sie anhub zu zählen, umfing er sie und faßte sie
mit starkem Arm; das Wünschhütlein hatte er auf dem Kopf; so wünschte
er sich mit ihr in eine wilde Wüste, wo gar keine Wohnung wäre.

|
aum hatte er den Wunsch gedacht;
so waren sie durch die Luft geflogen
und kamen auf einer armseligen
Insel, die am hibernischen
Gestade liegt, unter einem Baume
an, der voll schöner Apfel hing.
Und als die Fürstin unter dem
Baume saß, und die Kleinode, die
sie gekauft hatte, noch in ihrem
Schoße lagen und der Glückssäkkel
in ihrem Gürtel, so sieht sie
über sich und sieht so viele schöne
Apfel zu ihren Häupten. Da sprach
sie zu dem Juwelier: "Ach Gott,
sage mir, wo sind wir, und wie
sind wir hierhergekommen? Ich
bin so schwach; gäbest du mir doch
einen von diesen Äpfeln, daß ich
mich erlaben möchte!" Sie wußte
aber noch immer nicht; daß es Andolosia
sei, mit dem sie sprach.
Nun legte dieser auch die Kleinode, |
die er selbst bei sich hatte, ihr in den Schoß, und das Wünschhütlein
setzte er ihr auf den Kopf, damit es ihn am Besteigen des Baumes nicht
hindern sollte. Während er den Baum hinaufkletterte, um zu sehen, wo
.besten Apfel hingen, saß Agrippina unter dem Baume und wußte
nicht, wo sie war, noch was ihr geschehen; sie fing an zu seufzen und
sprach: "Ach, wollte Gott; daß ich wieder in meiner Schlafkammer wäre!"
Sobald sie dieses Wort gesprochen, fuhr sie durch die Lüfte und kam ohne
allen Schaden wieder in ihre Schlafkammer. Der König und die Königin
samt allem Hofgesinde wurden froh und fragten, wo sie denn gewesen,
und wo der Juwelier sei, der sie entführt habe. Sie antwortete: "Ich
habe ihn unter einem Baume gelassen; fraget mich nicht mehr; ich muß
ruhen; denn ich bin ganz blöd und müde geworden."
Als Andolosia auf dem Baume saß und sehen mußte, wie Agrippina
mit dem Hütlein und allen Kleinodien dazu, die er in den großen Städten
aufgebracht, durch die Lüfte dahinfuhr, verfluchte er den Baum, die Früchte
darauf und den, der ihn gepflanzt; und sprach weiter: "Verwünscht sei die
Stunde, darin ich geboren ward, ja alle Tage und Stunden, die ich gelebt
habe! O grimmer Tod, warum hast du mich nicht erwürgt, ehe ich
in diese Angst und Not gekommen bin? Verflucht der Tag und die Stunde,
wo ich Agrippina zuerst gesehen habe. Wollte Gott, daß mein Bruder in
dieser Wildnis bei mir wäre: so wollte ich ihn erwürgen, und mich selbst
an einen Baum hängen. Wenn wir dann beide tot wären, so hätte doch
der Säckel keine Kraft mehr, und die Königin, die alte Unholdin, und das
falsche und ungetreue Herz, Agrippina, könnte keine Freude mehr daran
haben." Als er nun hin und her ging, wurde es so finster, daß er nicht
mehr sah; da legte er sich unter den Baum und ruhte eine kleine Weile;
er konnte aber vor Angst nicht schlafen und erwartete nichts anderes, als
daß er in der Wildnis würde sterben müssen. So lag er da wie ein Verzweifelter,
der lieber tot gewesen wäre, als länger gelebt hätte.
***Sowie es Tag wurde, stand er auf und ging notdürftig vorwärts,
konnte aber niemand sehen noch hören. Da kam er an einen Baum, auf
welchem schöne rote Apfel hingen. Nun hungerte ihn sehr und in der
Not warf er einen Stein nach dem Baum, daß zwei große Apfel herabfielen
, die ass er behende. Aber kaum hatte er sie gegessen, siehe, da wuchsen
ihm zwei große Hörner; wie eine Ziege hat. Er lief mit den Hörnern
wider die Bäume und wollte sie abstoßen, aber es war alles vergebens.
Deswegen schrie er mit lauter Stimme: "Oh, ich armer, elender Mensch,
wie kommt's, daß so viele Leute auf der Welt sind, und doch niemand hier
ist der mir helfe, daß ich wieder zu Menschen kommen könnte! O allmächtiger
Gott, komm du mir in meinen großen Nöten zu Hilfe !"
Wie er so jämmerlich schrie, hörte ihn ein Einsiedler, der wohl schon
dreißig Jahre in dieser Wildnis gewohnt und seither keinen Menschen
gesehen hatte. Der ging dem Geschrei nach, kam zu Andolosia und sprach:
"Du armer Mensch, wer hat dich hergebracht, oder was suchst du in
dieser Einsamkeit?" — "Lieber Bruder", antwortete jener, "mir ist wohl
leid, daß ich hergekommen bin!" Der Bruder aber sprach: habe in
dreißig Jahren keinen Menschen gesehen noch gehört; ich wollte, du wärest
auch nicht hiehergekommen." Andolosia war halb ohnmächtig; er fragte
den Waldbruder, ob er nichts zu essen hätte. Der Einsiedler führte ihn
in seine Klause, aber da war weder Brot noch Wein; er hatte gar nichts
als Obst und Wasser, davon lebte er. Das war keine Speise für Andolosia
. Jener aber sprach zu ihm: "Ich will dich an einen Ort weisen,
wo ou Speise und Trank genug findest." Bald darauf fragte Andolosia:
"Lieber Bruder; was soll ich denn mit den Hörnern anfangen, die ich
habe? Man wird mich für ein Meerwunder ansehen!" Der Einsiedler
aber führte ihn wenige Schritte Wegs von seiner Klause, brach von einem
andern Baum zwei Apfel und sprach: "Lieber Sohn, nimm hin und iss
diese!" Sobald Andolosia die Apfel gegessen, waren die Hörner gänzlich
verschwunden. Als er dies sah, fragte er, wie es denn gekommen, daß

er so schnell Hörner gekriegt und ihrer so schnell wieder losgeworden
sei. Da sprach der Bruder: "Der Schöpfer, welcher Himmel und Erde
geschaffen, und alles, was darin ist, hat auch diese Bäume gemacht und
ihnen die Natur gegeben, daß sie solche Frucht bringen müssen, und ihresgleichen
ist auf der ganzen Erde nicht; sie wachsen nur in dieser Wildnis."
"O lieber Bruder", sagte Andolosia, "erlaubt mir, daß ich einen und
den andern von diesen Äpfeln mit mir nehmen und hinwegtragen darf!"
Der Waldbruder erwiderte: "Lieber Sohn, nimm dir, soviel dir beliebig
ist; frage mich nicht; sie sind nicht mein, ich habe gar nichts Eigenes denn
meine arme Seele; wenn ich diese dem Schöpfer, der sie mir gegeben hat;
wieder überantworten kann, so habe ich wohl gestritten in dieser Welt.
Ich kann an dir wohl merken, daß dein Sinn und Gemüt schwer beladen
und mit zeitlichen und vergänglichen Sachen umfangen ist; schlage
sie aus und kehre dich zu Gott; es ist ein großer Verlust um eine kleine
Wollust, die einer an diesem vergänglichen Leben hat!"
Diese Worte des heiligen Mannes gingen Andolosia gar nicht zu Herzen
; er dachte nur an seinen großen Schaden und pflückte mehrere
Apfel, welche Hörner wachsen machten, und auch etliche, von welchen sie
vergingen. Dann sprach er zu dem Bruder: "Jetzt weiset mich auf den
Weg zu Menschenkindern." Da führte ihn der Einsiedler auf einen Pfad
und sagte: "Gehet gerade vorwärts, so kommt Ihr zu einem Dorfe, wo
Ihr zu essen und zu trinken findet!" Er dankte dem Bruder von Herzen,
beurlaubte sich von ihm und kam zu dem Dorfe. Dort ass und trank er
und gelangte wieder zu Kräften. Dann fragte er nach dem Wege gen
London in England, aber es wurde ihm gesagt, daß er noch in Hibernien
oder Irland sei; er müßte erst nach Schottland hinüber, dann weit zu
Lande reisen, dann käme erst England, und es sei noch gar weit von
der Grenze bis London.
Als Andolosia hörte, daß er so fern von der Stadt London war, wurde
er unmutig, daß er so lang unterwegs sein sollte; er fürchtete, die Apfel
möchten Schaden leiden. Da nun die Leute merkten, daß er gern bald
nach London gekommen wäre, zeigten sie ihm eine große Stadt, die ein
Seehäfen war, wohin Schiffe aus England, Flandern und Schottland
kämen. Er machte sich auf der Stelle nach der Stadt auf; daselbst fand
er ein Schiff, das nach London fuhr, und kam schnell und mit gutem
Glücke hin. Zu London ließ er sich ein Auge verkleistern und setzte falsches
Haar auf, so daß er ganz unkenntlich ward. Dann nahm er ein Tischchen
und setzte sich vor die Kirche, wieder an die Seite, von der er wußte, daß
Agrippina, die junge Fürstin, vorbeikommen würde. Da legte er die
Apfel auf ein schönes weißes Tuch und rief: "Wer kauft Apfel aus Damaskus?"
und wenn ihn jemand fragte, wie teuer er einen gebe, so sagte
er: "Um drei Kronen!" Da ging jedermann vorüber, und es wäre ihm
auch leid gewesen, wenn sie jemand gekauft hätte. Indem kommt die
Königin mit ihren Jungfrauen und Dienern, auch ihrer Kammermeisterin
Da ruft er abermals: "Kauft Apfel aus Damaskust" Die Prinzessin
fragte: "Wie gibst du einen?" Er sagte: "Um drei Kronen!" —
"Was haben sie doch für eine Kraft, daß du sie so teuer bietest?"
fragte sie. "Sie geben einem Menschen Schönheit", sagte er, "und helle
Vernunft!" Als die junge Königstochter dies hörte, befahl sie ihrer Kammermeisierin
, zwei zu kaufen. Darauf legte Andolosia seinen Kram wieder
zusammen; denn niemand wollte ihm mehr abkaufen.
Sobald die Prinzessin heimgekommen war, wartete sie nicht lange, sondern
ass die zwei Apfel. Aber sobald sie sie gegessen hatte, von Stund
an wuchsen ihr zwei große Hörner unter heftigem Kopfweh, so daß sie
sich auf ihr Bett legen mußte. Als die Hörner geschossen waren, ließ der
Schmerz nach; sie stand auf und trat vor einen Spiegel. Da sie nun sah,
daß sie so ungestalt war und zwei hohe Hörner hatte, faßte sie dieselben
mit beiden Händen und wollte sie herunterreißen. Da dies aber nicht
ging, rief sie zwei edle Jungfrauen vom Hofe. Wie diese ihre Herrin
so sahen, entfernten sie sich und gesegneten sich, als ob sie der böse Geist
wäre. Die Prinzessin aber war so erschrocken, daß sie nicht reden konnte.
Jene sprachen: "O gnädigste Frau, wie ist das ergangen, daß Eure adelige
Person solche Mißgestalt empfangen hat?" Sie antwortete ihnen, daß sie
es nicht wüßte; es sei wohl eine Plage von Gott. "Oder aber", sagte
sie, "es kommt von den Äpfeln aus Damaskus, die mir der ungetreue
Krämer zu kaufen gegeben hat. Nun helfet und ratet, ob ihr mich nicht
der Hörner entledigen könnt!" Die jungen Mägdlein zogen nach Leibeskräften
daran, und Agrippina litt es geduldig; es half aber nichts. Darüber
wurde sie, je länger, je mehr bekümmert und sprach: "Ich elende
Kreatur, was nützt es mir nun, daß ich eine Königstochter bin und die
reichste Jungfrau, die auf Erden lebt; daß ich den Preis der Schönheit
vor andern Weibern habe? Sehe ich doch jetzt einem unvernünftigen
Tiere gleich. Wehe, daß ich geboren ward! Kann mir niemand von meiner
Mißgestalt helfen, so will ich mich selbst in der Themse ertränken!"
Eine ihrer obersen Jungfrauen tröstete sie und sprach: "Gnädigste Prinzessin,
Ihr sollt nicht so verzagen. Habt Ihr die Hörner können bekommen,
so müssen sie auch wieder verschwinden können! Schicket darum
nach hochgelehrten Ärzten; es kann sein, die wissen und finden es geschrieben,
aus welcher Ursache solches Gewächs entspringe, und womit
es vertrieben werden mag."
Diese Rede gefiel der Prinzessin wohl, und sie sprach: "Saget nur niemand
davon, und wenn jemand nach mir fragt, so saget, ich sei nicht
wohl. Auch sollt ihr niemand zu mir lassen als die alte Kammermagd."
Dann ließ sie eine besondere Umfrage bei den Ärzten tun und legte ihnen
den Fall vor, daß einer Verwandten und Freundin der Prinzessin zwei
Hörner gewachsen seien; ob diese zu vertreiben wären oder nicht. Die
Arzte, die dies hörten, nahm es groß wunder, daß einem Menschen Hörner
wachsen sollten; ein jeder begehrte mit großer Neugierde, die Person
zu sehen. Die alte Kammermeisterin aber, die zu den Ärzten gesendet
war, sprach: "Ihr könnet die Frau nicht sehen, es wäre denn, daß Ihr
zu helfen wisset. Wer das kann, dem soll wohl gelohnet werden." Aber
ihrer keiner war so beherzt, daß er es unternommen hätte, die Hörner
zu vertreiben; denn sie hatten nie etwas der Art gehört, gelesen oder gesehen
. Als die Arzte auf diese Weise die Sache ganz abschlugen, wurde
die Botin verdrießlich und machte sich auf den Rückweg nach dem
Unterwegs begegnet ihr Andolosia, der hatte sich als einen Doktor
angekleidet mit einem roten Scharlachrocke und einem großen roten
Barett; auch hatte er sich durch eine große Nase entstellt. "Liebe
Schaffnerin", sprach er zu ihr, "ich sehe, daß Ihr in drei Doktorshäuser
gegangen seid. Habt Ihr ein Anliegen, so gebt mir's zu erkennen
; denn ich bin auch ein Doktor in der Arzneikunde; es müßte
gar ein fremdes, großes Gebrechen sein, daß ich es mit Gottes
Hilfe nicht zu vertreiben und den Menschen wieder gesund zu machen
wüßte." Die Hofmeisterin dachte, Gott sei es, der ihr den Doktor zugewiesen
habe, fing an und sagte ihm, daß einer namhaften Person das
Unglück begegnet sei, zwei lange Hörner zu bekommen, die ihr aus dem
Kopf herausgewachsen, Ziegenhörnem gleich. "Wisset Ihr der Person zu
helfen", sprach sie, "so wird Euch wohl gelohnt werden; denn sie hat an
Geld und Gut keinen Mangel." Der Doktor fing an, ganz freundlich zu
lächeln, und sprach: "Die Sache kenne ich, verstehe auch die Kunst, Hörner
ohne alles Weh zu vertreiben; — aber Geld kostet es. Ich weiß nämlich
auch die Ursache, woher diese Hörner entspringen." — "Lieber herr
Doktor", fragte die alte Kämmrerin, "woher kommt dies wunderliche Gewächs ?"
Der Doktor antwortete: "Es kommt daher, wenn ein Mensch
dem andern große Untreue tut und sich solcher Bosheit erfreut, diese
Freude aber nicht öffentlich äußern darf. Dann muß es auf einem andern
Wege ausbrechen, und ein solcher Mensch hat von Glück zu sagen,
wenn es sich auf diese Weise nach oben ausstößt. Wäre es der Frau
nicht ausgebrochen, so hätte sie sterben müssen; die Hörner wären nach
innen gewachsen und hätten ihr das Herz abgestoßen. Es ist noch nicht
zwei Jahre, daß ich an des Königs von Hispanien Hofe war; da hatte
ein mächtiger Graf eine schöne Tochter von ganz zarter Komplexion, der
waren zwei große Hörner geschossen, die ich ihr gänzlich vertrieben habe."
Als die Hofmeisterin die Rede von dem Doktor vernommen hatte, fragte
sie ihn, wo er wohne; sie wolle bald wieder ihm kommen. "Ich habe
noch kein Haus bestanden", erwiderte er, "ich bin erst seit drei Tagen hergekommen
und wohne in der Herberge zum Schwan, dort möget Ihr
nachfragen. Man nennt mich nur den Doktor mit der langen Nase, und
wiewohl ich einen andern Namen habe, so kennt man mich doch am besten
unter diesem." —

Mit unaussprechlicher Freude ging die Hofmeisterin zu ihrer betrübten
Fürstin nach Hause. "Gnädigste Frau", rief sie ihr entgegen, "seid
fröhlich und wohlgemut; Eure Sache wird sich bald zum besten wenden!"
Dann erzählte sie ihr, wie die drei Doktores sie ungetröstet hätten gehen
lassen; darnach aber hätte sie einen gefunden, der habe sie wohl getröstet.
Damit sagte sie ihr alle Dinge, die der Doktor mit ihr geredet, und wie
er ihr zu helfen wisse, und wie er auch einer Gräfin geholfen habe.
"Er hat mir auch gesagt", sprach die alte Kammermeisierin, "aus welcher
Ursache solche Hörner entspringen, und ich mag's ihm wohl glauben!"
Die traurige Prinzessin lag auf dem Bett und sprach zu der hofmeisterin:
"Warum hast du den Doktor nicht gleich mit dir hergebracht? Du
weißt ja, daß ich, je eher, je lieber der Hörner loswäre! Geh wieder bald
und führ mir ihn her; sag ihm, daß er alles mitbringen soll, was zur
Sache gehört, und ja nichts spare; bring ihm auch die hundert Kronen
da, und bedarf er mehr, so gib ihm, soviel er von dir begehrt!" Die Hofmeisterin
tat alles dies, ging hin zu dem Doktor und sprach zu ihm: "Nun
brauchet Euren Fleiß l Denn zu der Person, zu der ich Euch führen will,
könnet Ihr nur bei nächtlicher Weile kommen und dürfet auch niemand
davon sagen; denn ihre eigenen Eltern wissen es nicht." Der Doktor
sprach: "Was dies betrifft, so seid ruhig; von mir soll es nicht auskommen;
ich will mit Euch gehen, nur muß ich vorher in die Apotheke und
kaufen, was zu der Operation vonnöten sein wird. Darum möget Ihr
meiner hier harren oder in zwei Stunden wiederkommen." So ging der
Doktor mit der großen ungestalten Nase in eine Apotheke; dort ließ er
sich einen halben Apfel mit Zucker und Rhabarber überziehen, fügte wohlschmeckende
Dinge hinzu, kaufte auch in eine Büchse ein wenig wohlschmeckender
Salbe, nahm guten Bisam zu sich und kam wieder zu der
Hofmeisterin, die sein auf der Straße wartete. Diese führte ihn bei Nacht
zu der Prinzessin.
Agrippina lag auf ihrem Bette hinter den Umhängen und empfing ihn
gar ohnmächtiglich, als ob sie nicht bei Kräften wäre. Der Doktor sprach:
"Gnädige Frau, seid getrost, mit Gottes und meiner Kunst Hilfe soll
Eure Sache bald gut werden. Nur richtet Euch auf und lasset mich Euren
Schaden sehen und anfühlen, so kann ich Euch um so besser helfen!"
Agrippina schämte sich sehr, daß sie die Hörner sehen lassen sollte. Doch
setzte sie sich aufrecht im Bette hin. Der Doktor rührte die Hörner keck
an und sprach: "Man muß um jedes Horn ein Säcklein aus einem warmen
Pelz von einer Affenhaut binden, die will ich dann salben, und so
muß man die Hörner fein warm halten." Alsbald bestellte die Kammermeisterin
, daß ein alter Affe am Hof abgeschlachtet und die Haut gebracht
würde; da wurden die zwei Säcklein nach des Arztes Rat gemacht. Dann
fing dieser an, die Hörner mit dem Affenschmalz zu salben, zog ihr die
pelzenen Säcklein über und sprach: "Gnädige Frau, was ich jetzo den
Hörnern getan habe, das wird sie bald lind machen; sie müssen aber
auch durch innerliche Mittel vertrieben werden; deswegen habe ich eine
Latwerge mitgebracht, die werdet Ihr essen und ein Schläflein darauf
tun; so werdet Ihr gewahr werden, daß die Sache sich gar bald zur Besserung
schicken wird."Agrippina tat wie eine Kranke, die gerne genesen
wäre. Was ihr der Doktor gab, war jener halbe Apfel, der die Kraft
hatte, die Hörner zu vertreiben. Die Beimischung aber wirkte in ihrem
Leibe wie bei andern Kranken. Als sie nun wieder in ihrem Bette war,
sprach der Doktor: "Lasset uns sehen, ob die Arznei schon gearbeitet habe",
und griff nach dem Ende der Hörner, an die Pelzsäcklein; da waren jene
um ein Vierteil geschwunden. Agrippina war den Hörnern so feind, daß
sie dieselben nicht angreifen mochte; doch als man ihr sagte, wie sie geschwunden
wären, griff sie daran und fand wirklich, daß sie kleiner geworden
waren. Darüber freute sie sich sehr und bat den Doktor, eifrig
fortzufahren. "Noch heute nacht komme ich wieder", sagte er, "und
bringe, was not tut." Er beurlaubte sich und ging in die Apotheke, ließ
wieder einen halben Apfel überziehen und ihm einen andern Geschmack
geben; diesen brachte er bei Nacht der Prinzessin, salbte ihr die Hörner,
ließ die Säcklein kleiner machen, daß sie recht anliegend wurden,
und gab ihr den Apfel, worauf sie einschlief. Als sie wieder aufwachte;
wurden die Hörner besehen; da waren sie abermals geschwunden und
beinahe hinweggegangen. Hatte sie sich vorher gefreut, so war sie jetzt
noch viel froher und bat den Doktor, nicht abzulassen, sie wollte ihm
seine Arbeit gut belohnen. Er versicherte, das Beste tun zu wollen, und
wie er die zwei Nächte getan hatte, so tat er auch die dritte.
***Während sie nun schlief und er bei ihr saß, da dachte er: "Zwei- oder
dreitausend Kronen wären für einen andern Arzt ein großer Lohn, und
doch ist es für gar nichts zu schätzen gegen das, was sie von mir hat.
Darum, ehe ich ihr die Hörner vertreibe, will ich anders mit ihr reden
und ihr meine Meinung ehrlich sagen; will sie es nicht tun, so irret sie
sich, wenn sie glaubt, ich werde ihr die Hörner vertreiben. Dann will
ich ihr eine Latwerge machen, daß sie ihr wieder so lang werden wie zuvor;
und alsdann will ich gen Flandern fahren und ihr entbieten, wenn sie
die Hörner loswerden wolle, so soll sie zu mir kommen und mitbringen,
was ich von ihr verlange, nämlich mein Wünschhütlein, und überdies mir
alle Jahre so viel geben, daß ich einem Herren gleich leben kann."
Während er dies dachte, kam die Hofmeisterin mit einem Licht und wollte
sehen, was die Prinzessin mache. Da schlief sie. Der Doktor hatte sein
Barett abgezogen, da entfiel es ihm. Wie er sich nun bückte und dasselbe
aufheben will, sieht er vorn unter der Bettstatt das Wünschhütlein auf
der Erde liegen, auf das niemand achthatte, weil niemand seine Tugend
kannte. Die Fürstin wußte auch nicht, daß sie durch die Kraft des Hütleins
wiederheimgekommen sei, sonst würde sie es an einen andern Nagel
gehenkt haben. Auf der Stelle schickte der Doktor die Kammermeisterin
nach einer Arzneibüchse, und während sie diese holte, hub er das Hütlein
im Augenblick auf, behielt es unter seinem Rock und dachte: "Nun
könnte mir der Säckel auch werden!"Indem erwachte die Prinzessin und
richtete sich auf. Der Doktor zog ihr die Säcklein von den Hörnern, da
waren sie ganz klein, worüber die Prinzessin große Freude empfand. Die
Kammermeisterin sagte: "ES ist noch um eine Nacht zu tun, so seid Ihr
genesen; dann werden wir auch den mißgeschaffenen Doktor los mit seiner
häßlichen Nase; der könnte einem alle Männer entleiden!"
Weil nun der Doktor das Hütlein hatte, dachte er, es wäre Zeit; mit
Agrippina zu reden, und ließ die Worte fallen: "Gnädige Frau, Ihr
sehet wohl, wie sehr sich Eure Sache gebessert hat. Nun kommt es hauptsächlich
darauf an, die Hörner aus der Hirnschale zu treiben; dazu gehören
köstliche Sachen, und wenn ich diese hier nicht finde, so muß ich
selbst reisen oder einen Doktor darnach senden, der sich auf die Sache versteht
; darauf geht aber viel Geld, auch möchte ich gerne wissen, was Ihr
mir zu Lohne geben wollet, wenn Ihr der Hörner ganz ledig werdet und
Euer Kopf so glatt wird, als er je gewesen ist."Die Prinzessin sprach: "Ich
finde wohl, daß Eure Kunst die rechte ist; ich bitte Euch, helfet mir und
sparet kein Geld!" Der Doktor sprach: "Ihr sagt mir wohl, ich soll
kein Geld sparen! Wenn ich aber keins habe?"Agrippina war karg, wiewohl
sie den Säckel hatte, der nicht zu erschöpfen war; sie ging gemachsam
über die Truhe, die bei ihrer Bettlade stand, und in der ihre liebsten
Kleinode und auch der Säckel war, an einen starken Gürtel gebunden;
den gürtete sie um den Leib, und ging zuvor zu einem Tische, der an einem
schönen Fenster stand. Hier fing sie an zu zählen, und als sie bei dreihundert
Kronen gezählt hatte, suchte der Doktor unter seinem Rock, als
wenn er einen Beutel hervorholen wollte, darein er das Geld tun könnte,
tat mit der einen Hand, als wenn er das Geld fassen wollte, mit der
andern aber, die er im Rock hatte, erwischte er das Hütlein, warf das
Barett von sich und setzte das Wünschhütlein auf den Kopf. Dann faßte
er die Prinzessin und wünschte sich mit ihr in einen wilden Wald, wo
keine Leute wären, und wie er solches wünschte, so geschah es von Stund
an durch die Kraft des Hütleins.
Als Agrippina hinweggeführt war, lief die alte Kammermeisterin zu
der Königin und erzählte ihr den Vorfall. Die Königin erschrak, doch
dachte sie: "Wie meine Tochter das letztemal bald wiedergekommen, so
wird es wohl jetzt auch geschehen. Überdies hat sie ja den Säckel mit sich
genommen, so daß sie jedermann genug lohnen kann, daß man ihr wieder
heimhilft!" So warteten sie den Tag und die Nacht. Als sie aber nicht
wiederkam, fiel es der Königin auf ihr Mutterherz, daß sie um ihre schöne
Tochter sollte so elendiglich gekommen sein; sie ging daher mit trauriger
Gebärde zu ihrem Gemahl und erzählte ihm, wie alles ergangen,
und wie der Doktor die Jungfrau hinweggeführt habe. Der König sprach:
"Ja, freilich, das ist ein weiser Doktor; der kann mehr als andere Doktores;
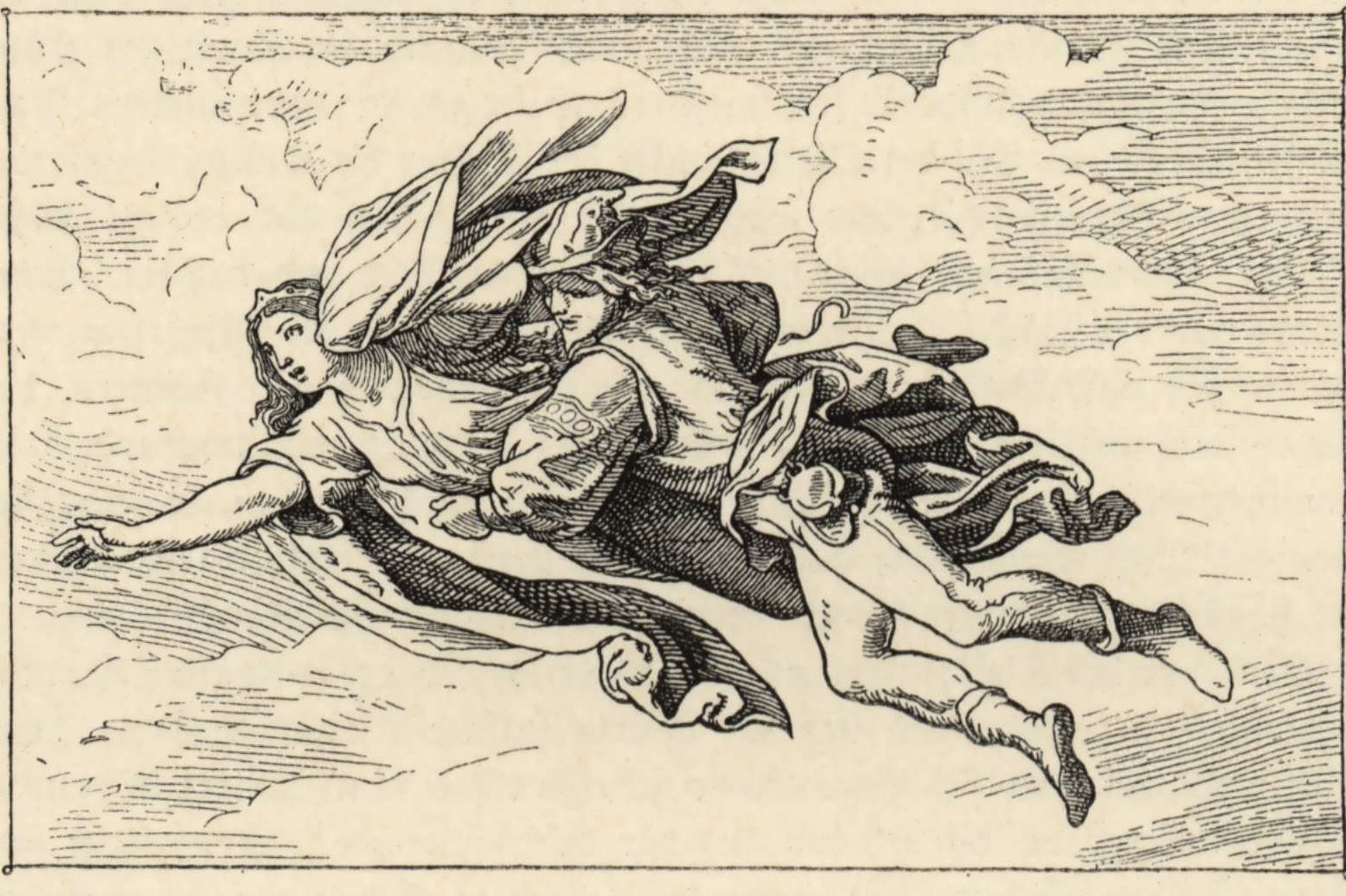
es ist niemand anders als Andolosia, welchen ihr so fälschlich betrogen
habt! Ich hätte mir wohl denken können, wenn ihm der Himmel
solches Glück verliehen hat, daß er ihm auch Weisheit verliehen haben
werde. Das Glück will einmal, daß er den Säckel habe und sonst niemand;
hätte das Glück es anders gewollt, so hätte ich oder sonst einer
auch einen solchen Säckel. Viele Leute sind in England, und ist nur
ein König darunter, das bin ich, weil solches mir von Gott und dem
Glücke verliehen ist. Und ebenso ist es dem Andolosia allein verliehen,
einen solchen Säckel zu haben, und sonst niemand. Hätten wir nur unsere
Tochter wieder!" Die Königin sagte: "Herr, sende doch Boten aus, ob
man sie nicht irgendwo erhaschen möchte, damit sie nicht in Armut und Elend
komme." — "Boten sende ich keine aus", erwiderte der König, "denn
es wäre eine Schande für uns, wenn es ruchbar würde daß wir sie nicht
besser versorgt hätten"
***Als Andolosia mit Agrippina in der wilden Wüste allein war warf
er den Doktorsrock gar untugendlich vor sich nieder, zog die häßliche Nase
ab und trat gleich vor die schöne Agrippina. Diese erkannte ihn auf der
Stelle und von ganzem Herzen, so daß sie kein Wort vorbringen konnte;
denn er hatte die Augen im Kopfe verdreht, machte ein zornig Gesicht
und gebärdete sich, als würde er sie alsbald umbringen. Auch zog er ein
Messer hervor und schnitt ihr den Gürtel vom Leib, riß sein Wams auf
und steckte den Säckel an den Ort, wo er ihn vorher gehabt hatte. Das
alles sah die arme Jungfrau; vor Not und Angst erzitterte ihr schöner
Leib wie ein Lindenlaub, mit dem der Wind spielt. Andolosia aber fing
aus großem Zorn zu reden an und sprach: "Du falsches, ungetreues Weib,
jetzt bist du mir zuteil geworden; jetzt will ich mit dir die Treue teilen,
wie du sie mit mir geteilt hast, als du mir den Säckel abtrenntest und
einen tugendlosen an die alte Stelle setzest. Du siehst, daß ich jetzt den
rechten wieder an der alten Stelle habe. Jetzt helfe und rate dir deine
Mutter und deine alte Kammermeisterin und heiße dich mir ein gut Getränke
geben, damit du mich betrügest. Ja, und wären jene Unholdinnen
beide bei dir, all ihre Kunst verhälfe ihnen doch nicht zu dem Säckel.
O Agrippina, wie konntest du es übers Herz bringen, mir solche Untreue
zu erzeigen, da ich dir so treu war! Ich hätte mein Herz und meine Seele,
Leib und Gut mit dir geteilte Wie mochtest du einen so tapfern Ritter;
der alle Tage dir zu Ehren turnierte und alles männliche Ritterspiel
trieb, in so großes Elend bringen, ohne Erbarmen mit ihm zu haben!
Ja, der König und die Königin haben mit mir ihren Fastnachtsschimpf
getrieben; das hat mein Herz noch nicht vergessen. Hätte ich mich aus
Verzweiflung erhenkt, so wärest du die Ursache gewesen, daß ich um
Seele und Leib gekommen wäre. Nun sprich dir selbst dein Urteil; ist es
nicht billig, daß ich mit dir dasselbe Erbarmen habe, das du mit mir
gehabt hast?"
Agrippina war voll Schrecken und wußte nicht, was sie sagen sollte;
sie sah gen Himmel auf und fing endlich mit bangem Herzen zu reden
an: "O tugendreicher, strenger Ritter Andolosia! Ich bekenne, daß ich
übel und unedel an Euch gehandelt habe; ich bitte Euch, wollet den Um
verstand und Leichtsinn ansehen, der von Natur mehr den Weibern, jungen
und alten, als dem männlichen Geschlechte eigen ist; wollet mir die
Sache nicht zum schlimmsten kehren und Euren Zorn nicht an einer armen
Tochter auslassen; tut Gutes für übels, wie sich für einen ehrsamen
Ritter geziemt."Doch jener sprach: "Nein, der Schaden ist noch zu frisch
in meinem Herzen, als daß ich dich ungewitzigt lassen könnte." Sit antwortete:
"Ach, Andolosia, bedenket doch, was würde man von Euch sagen,
wenn Ihr ein armes Weib, die mit Euch als Eure Gefangene in der
Wildnis ist, bestrafen wolltet; das würde ein Flecken an Eurer strengen
Ritterschaft sein!" Andolosia sprach: "Wohlan, ich will meinem Zorne
widerstehen und gebe dir mein Ritterort; daß ich dich nicht verletzen will;
aber ein Zeichen hast du noch von mir, das mußt du, soviel an mir liegt,
bis in dein Grab behalten, damit du meiner eingedenk seiest!"Agrippina
hatte bisher in solcher Angst um ihr Leben geschwebt, daß sie die Hörner,
die ihr noch auf dem Kopfe standen, ganz vergessen hatte. Jetzt, als
Andolosia sie der Sorge für ihr Leben enthoben hatte; kam sie wieder
zu sich und sprach: "Oh, wollte Gott; daß ich meiner Hörner ledig und
in meines Vaters Palast wäre!" Als Andolosia sie so wünschen hörte,
lief er heran und zog das Wünschhütlein an sich, das nicht ferne von ihr
auf der Erde lag; denn hätte sie es aufgehabt so wäre sie abermals heimgekommen.
Er nahm das Hütlein und knüpfte es fest an seinen Gürtel.
So konnte Agrippina wohl merken, daß sie das erstemal durch die Kraft
des Hütchens gerettet worden war. Mit Seufzen dachte sie: "Nun hast
du die beiden Kleinode in deiner Gewalt gehabt und nicht behalten können!"
Doch durfte sie Andolosia ihren Zorn nicht merken lassen, sondern
sie fing wieder an, ihn freundlich zu bitten, daß er sie der Hörner ganz
entledigen und zu ihrem Vater bringen möchte. Er sprach aber kurzweg:
"Du mußt die Hörner haben, dieweil du lebest! Aber ich will dich gerne
so ,nahe an deines Vaters Palast führen, daß du ihn sehen kannst. Hinein
jedoch komme ich nicht mehr!" Sie bat ihn zum andern und zum dritten
Mal; es half aber alles nicht.
***Als Agrippina sah, daß kein Bitten bei Andolosia fruchtete, sprach sie:
"Muß ich denn meine Hörner haben und so mißgestaltet bleiben, so begehre
ich auch nicht, wieder nach England zurückzukehren, sondern ich
wünsche, daß mich kein Mensch wiedersehe, selbst Vater und Mutter nicht.
Darum führet mich an einen fremden Ort, wo mich kein Mensch erkenne
." — Andolosia aber sagte: "Dir wäre nirgends besser denn bei
Vater und Mutter." Aber dies wollte sie nicht und sprach: "Führet mich

in ein Kloster, daß ich von der Welt geschieden seil" Da fragte er: "Begehrest
du das, und ist dir die Rede Ernst?" Sie antwortete: "Ja!"
So rüstete er sich und führte sie gen Hibernien, ganz nah ans Ende der
Welt; nicht weit von Sankt Patricius ' Fegfeuer, in ein großes und
schönes Frauenkloster, in welchem nichts als Edelfrauen sind; hier ließ er
sie auf offenem Felde sitzen, ging ins Kloster zu der Äbtissin und sagte
zu ihr, er habe eine edle und ehrsame Tochter mitgebracht, die schön und
gesund sei, außer daß ihr etwas an dem Kopfe angewachsen sei, dessen
sie sich schäme, und weswegen sie nicht bei ihren Freunden bleiben wolle.
"Sie begehrte an einem Orte zu sein", sprach er, "wo sie nicht bekannt
wäre; wolltet Ihr sie aufnehmen, so würde ich Euch die Pfründe dreifach
bezahlen."Hierauf erwiderte die Äbtissin: "Wer die Pfründe haben will,
der muß zweihundert Kronen darum geben; denn ich halte einer jeden
Pfründnerin eine Magd und gebe ihnen, was sie bedürfen. Wolltet Ihr
nun wirklich die Pfründe dreifach bezahlen, so bringet mir die Tochter
her!"
Andolosia ging hin und brachte Agrippina herbei. Die Äbtissin empfing
sie, und die Fürstin dankte ihr gar züchtiglich; sie neigte sich so schön,
daß die Äbtissin wohl sah, daß sie von edlem Stamm geboren wäre; auch
ihre Gestalt gefiel ihr wohl; es erbarmte sie, daß eine so wohlgestaltete
Tochter so verfluchte Hörner auf dem Haupte haben sollte. Sie sprach
daher: "Agrippina, begehrest du hier in diesem Kloster deine Wohnung
aufzuschlagen?" Sie antwortete gar demütig: "Ja, gnädige Frau Äbtissin!"
Darauf sprach diese: "So wirst du mir gehorsam sein zur Mette
und zu allen Zeiten in das Chor gehen und lernen, was du kannst?"
Agrippina antwortete: "Was Eures ehrsamen Klosters Sitte, Gewohnheit
und altes Herkommen ist, soll von mir alles gewissenhaft beobachtet
werden." So zählte Andolosia der Äbtissin sechshundert Kronen
dar und bat sie, sich die Jungfrau anempfohlen sein zu lassen. Diese
sagte willig zu; denn sie war froh, soviel baren Geldes empfangen zu
haben.
Andolosia nahm alsbald Urlaub von der Äbtissin, und diese sprach
zu Agrippina: "Gehe, Kind, und gib deinem Freunde das Geleit." So
ging sie mit ihm hinaus, und als sie an die Pforte kamen, sagte er zu
ihr: "Nun segne dich Gottl Er erhalte dich gesund und lasse dich in diesem
Kloster die ewige Freude erwerben!" Sie sprach amen; dann aber
fing sie jämmerlich an zu weinen und sagte unter Schluchzen: "O strenger
Ritter, denket doch mein in kurzer Zeit und erlediget mich; denn so
lange ich die Hörner habe, bin ich weder tauglich der Welt noch Gott zu
dienen!" Dem Andolosia gingen die Worte wohl zu Herzen; doch gab er
ihr keine Antwort, als daß er sagte: "Was Gott will, das geschehe!"
und ging damit seine Straße. Agrippina schloß betrübt die Pforte zu
und kehrte zu der Äbtissin zurück; diese räumte ihr eine Kammer ein und
eine Magd, ihr zu dienen. In dieser Zelle war die Jungfrau fast immer
allein und diente Gott, so gut sie konnte, wiewohl ihr Gemüt nicht bei
dem Gebete war.
***Als der Ritter von Agrippina geschieden war, fühlte er sich gar fröhlich,
setzte sein Hütlein auf und wünschte sich von einem Lande zum andern
, bis er gen Brügge in Flandern kam. Hier erholte er sich in fröhlicher
Gesellschaft von seinen Drangsalen und rüstete sich wieder recht
kostbar zu; er kaufte vierzig schöne Pferde, dingte viel guter Knechte, kleidete
die alle in eine Farbe und fing wieder an, Ritterspiel zu treiben;
er fuhr durch Deutschland und besah die schönen Städte, die im Römischen
Reiche liegen. Dann eilte er nach Venedig, Florenz und Genua. In
allen drei Städten sandte er nach den Kaufleuten, denen er die Kleinode
weggenommen hatte, und bezahlte sie alle bar. Darnach setzte er sich mit
Pferden und Knechten in ein Schiff und fuhr mit Freuden wieder nach
Hause gen Famagusta zu seinem Bruder.
Wie Ampedo seinen Bruder so herrlich daherreiten sah, gefiel es ihm
gar wohl. Und als sie miteinander in Freude getafelt hatten, nahm er
seinen Bruder Andolosia, führte ihn in eine Kammer und fragte ihn,
wie es gegangen wäre. Da erzählte ihm dieser alle Umstände, wie er zu
dem Verluste des Säckels auch noch um das Hütlein gekommen sei. Ampedo
erschrak so sehr, daß ihm die Sinne schwanden, ehe sein Bruder
ausgesprochen hatte. Dieser brachte ihn aber wieder zur Besinnung und
erzählte ihm dann weiter, wie er durch List wieder in den Besitz beider
Kleinode gekommen sei. "Darum sei nicht traurig, Bruder", sagte er
und band den Säckel vom Wamse ab, zog das Hütlein aus seinem Kleidersack
legte ihm beide vor und sprach: "Lieber Bruder, nun nimm die
Kleinode beide und laß dir damit wohl sein; habe deine Freude damit
nach Herzenslust; ich will es dir von ganzem Herzen gönnen und nichts
darein reden." Ampedo aber sprach: "Den Säckel begehre ich ganz und
gar nicht. Ich sehe wohl: wer ihn hat, der muß zu aller Zeit Angst und
Not haben; auch habe ich wohl gelesen, wie es unserm Vater löblichen
Gedächtnisses gegangen ist." Als Andolosia diese Worte hörte, war er
des Säckels gar froh und dachte: "Ich will ihm von meinem andern Unglück
lieber gar nichts sagen, sonst möchte er gar zu Tode erschrecken!"
***Und nun fing er an, einen guten Mut zu zeigen mit Stechen, Rennen
und Tanzen. Als er sich aber eine Weile zu Famagusta aufgehalten,
ritt er mit seinem Zeug zu dem Könige von Zypern, um auch hier Kurzweil
zu haben. Daselbst wurde er von dem Fürsten und seinem Hofe gar
wohl empfangen. Der König fragte ihn, wo er so lange gewesen wäre.
Er erzählte ihm, wie viele Königreiche er durchfahren. Da erkundigte sich
der König, ob er nicht auch kürzlich in England gewesen sei. " , gnädigster
König", sagte er. — "Der König von England", sprach der König
von Zypern weiter, "hat eine schöne Tochter (ein einziges Kind, sie heißt
Agrippina), die möchte ich meinem Sohne zur Gemahlin gönnen. Aber
nun ist mir die Märe gekommen, daß die Tochter verlorengegangen sei.
Sage mir, hast du nichts von ihr gehört, ob das wahr sei, oder ob sie
wieder gefunden worden ist?" — "Gnädigster Herr", sagte Andolosia,
"davon weiß ich Euer Gnaden wohl zu sagen. Es ist wahr, er hat eine
schöne Tochter, eine sehr schöne Tochter. Aber durch Schwarzkunst ist sie
nach Hibernien versetzt worden; dort lebt sie in einem Frauenkloster, und
ich habe mit ihr geredet vor kurzer Zeit." —"Wäre es nicht möglich, daß
sie wieder zu ihrem Vater käme?" fragte der König, "ich bin alt und
möchte meinen Sohn und mein Königreich gerne versehen, ehe denn ich
sterbe." Darauf antwortete Andolosia: "Gnädiger Herr König, Euch und
Eurem Sohn zuliebe, der aller Ehren wohl wert ist, will ich in der Sache
arbeiten und mit Gottes Hilfe die Königstochter bald wieder in ihres Vaters
Palast schaffen." Der König bat ihn dringend, es zu tun und es sich
Geld kosten zu lassen. Er wollte ihm und den Seinigen allen königlichen
Dank zu erkennen geben. "Nun, gnädigster König", sagte Andolosia, "so
rüstet eine ehrsame Botschaft aus und sendet sie vierzehn Tage nach mir
ab. Gewiß findet diese die Jungfrau zu London in ihres Vaters Palast.
Hat er sie Euch dann verheißen, so sendet er sie Euch redlich." Der König
sprach: "Andolosia, guter Freund, so vollende deine Sache, daß kein Fehl
daran sei; ich will eine prächtige Gesandtschaft abschicken; mache du nur;
daß sie nicht vergebens seil" "Habt keine Sorge", sprach Andolosia,
"aber lasset Euren Sohn abkonterfeien und sendet das Bild mit der Botschaft
dahin! Ihr werdet sehen, der König und die Königin haben daran
eine große Freude und werden um so begieriger sein, ihre schöne Tochter
einem so schmucken Jünglinge zu geben!"
Als der junge König vernahm, daß Andolosia ausgesendet werden sollte,
für ihn um eine Gemahlin zu werben, verfügte er sich zu ihm und bat ihn
aufs inständigste, recht ernstlich in der Sache zu wirken, damit er keine abschlägige
Antwort erhielte; denn er hatte viel von der Schönheit und Vollkommenheit
gehört, die an Agrippinen zu schauen wäre. Andolosia versprach
es ihm willig, nahm Urlaub, ritt nach Famagusta zurück und bat
seinen Bruder, ihm das Hütlein noch einmal leihen zu wollen; er werde
bald wieder da sein. Ampedo war willig und ließ sich das Hütlein wieder
nehmen. Seinem Zahlmeister aber befahl Andolosia, allen seinen Knechten
gütlich zu tun; er selbst reise in die Fremde; wolle aber bald wiederkommen.
Also nahm er das Hütlein und wünschte sich in die Wildnis, wo
die Apfel standen, von denen die Hörner wuchsen und wieder verschwanden.
Augenblicks war er dort und fand die Bäume voll schöner Apfel
stehen. Nun wußte er nicht mehr, welches der schädliche, welches der heilsame
Baum war; er kam ungerne daran, einen zu essen, und doch wollte
er auch nicht ohne die Apfel wieder davon. Endlich nahm und ass er einen
Apfel von dem einen Baume, da wuchs ihm ein Horn; dann einen vom
andern, da verschwand es wieder. Von diesem nun nahm er etliche und
fuhr mit ihnen hinweg nach Irland vor das Kloster. Hier klopfte er an,
ward eingelassen, ließ sich vor die Äbtissin führen und fragte nach Agrippina
; denn er hätte etwas Heimliches mit ihr zu reden.
Die Äbtissin erkannte Andolosia beim ersten Gruße und sendete nach
Agrippinen. Als diese kam, empfing sie den Ritter schlecht; denn sie wußte
nicht, warum er gekommen war, und erschrak über seiner Erscheinung.
Andolosia aber sagte: "Erlaubet, gnädige Frau, daß die Jungfrau ein
weniges allein mit mir rede." Jene erlaubte es gerne; so ging er mit ihr
an eine einsame Stelle und sagte zu ihr: "Agrippina, sind dir die Hörner
noch ebenso zuwider, wie da ich von dir schied?-—"Ja", sprach sie, "und
je länger, je mehr." —"Wohin stünde dir dein Sinn", fragte er, "wenn
du ihrer quitt und ledig wärest?" — Sie sprach: "Wo sollte ich anders
hin begehren als nach London zu meinen herzlieben Eltern?" — Darauf
sprach Andolosia freundlich zu ihr: "Agrippina, Gott hat dein Gebet erhört;
; was du begehrst, wird dir gewähren'; damit gab er ihr einen Apfel
zu essen, hieß sie ein wenig ruhen und dann wiederaufstehen; da ward sie
der Hörner ganz ledig.

|
***Die Magd, die ihr zugegeben war, konnte ihr
nun zum erstenmal die Locken flechten und
das Haupt zieren; so geschmückt kam sie vor
die Äbtissin, und da diese die Jungfrau so
schön und schmuck sahe, rief sie den Frauen
allen im Kloster, daß sie wundershalber die
Novize sehen sollten, wie sie in kurzer Zeit
also schön geworden und ihr die leidigen
Hörner vergangen seien. Jedermann verwunderte
sich. Da sprach Andolosia, der zugegen
war: "Laßt es Euch nicht so groß
wundernehmen; Gott vermag alle Dinge;
wem er wohl will, wider den mag niemand
sein. Wisset, Agrippina ist eine Fürstin und
von königlichem Stamme geboren. Ich werde
sie jetzt ihrem Vater und ihrer Mutter wieder
überantworten. Ehe ein Monat vergeht;
wird sie an einen Königssohn vermählt, und
zwar an einen so schönen Jüngling, wie
einer jetzt auf Erden nur leben mag."
|
Hierauf zahlte Andolosia der Äbtissin hundert Kronen aus, die er ihr
und ihren Klosterfrauen zu guter Letzt hinterließ, dankte ihnen, daß sie Agrippinen
so ehrlich gehalten; so dankte auch Agrippina gar züchtiglich; dann
beurlaubten sie sich und verließen das Kloster. Sobald Andolosia ins
Feld , rüstete er sich mit seinem Hütchen und führte die Prinzessin nach
London vor des Königs Palast. Dann fuhr er selber wieder seiner Straße;
denn er scheuete den Palast, in welchem ihm so große Untreue widerfahren
war, und kehrte nach Famagusta zu seinem Bruder und seinen Dienern
zurück.
***Der König und die Königin waren unglaublich froh, als sie Agrippinen
wieder vor sich sahen, auch alle andere im Schlosse freuten sich mit großer
Freude; es wurde ein herrliches Fest gegeben, daß die verlorene Tochter
wiedergefunden war; und sie zierten die Prinzessin auf das allerköstlichste.
Während sie nun so in Fröhlichkeit lebten, wurde dem Könige
gemeldet; daß Boten kämen, vom Könige von Zypern ausgesendet; mit
großem Gefolge, ihn um die Hand der jungen Fürstin Agrippina für seinen
Sohn zu bitten. Diese wurden aufs schönste empfangen, und als sie vier
Tage in der Stadt gewesen, sandte der König nach ihnen. Da erschienen
sie, köstlich angetan feder nach seinem Stande, ein Herzog, zween Grafen
und viele Ritter und Knechte; die fingen an, von der Heirat zu handeln.
Als die Königin vernahm, daß man wegen Agrippinens fragte, fiel es ihr
schwer aufs Herz, daß sie ihre Tochter so fern vom Lande entlassen sollte
und noch dazu sie einem geben, von dem man nicht wüßte, ob er hübsch
oder häßlich wäre. Da langte eben die Botschaft wieder am Hofe an; sie
kamen vor den König und begehrten, auch bei der Königin vorgelassen zu
werden. Und als sie vor sie kamen, zogen sie das Konterfei ihres jungen
Königssohns hervor und zeigten seine Gestalt. Wie der König seine
Schönheit sah, fragte er, ob er auch wirklich so wäre. Da schwuren sie
dem König und der Königin einen Eid, daß er noch viel schöner gestaltet
sei, recht schlank und gerade und nicht älter denn vierundzwanzig Jahre.
Das gefiel ihnen beiden gar wohl. Die Königin nahm das Bild und
brachte es ihrer Tochter Agrippina; sie sagte ihr, wie man sie einem jungen
Königssohn geben wolle, der noch viel hübscher sei, als sie hier seine
Gestalt sehe, wie sie es ja auch früher von Andolosia gehört hätte. Agrippina
glaubte dieser Versicherung und willigte ein. Als ihre Eltern dies vernommen,
redeten sie mit den Boten aus Zypern weiter, und so wurde die
Heirat ganz abgeschlossen.
Hierauf ließ der König viel Schiffe zurichten mit Leuten, Speise, und
was dazu gehöret; die junge Prinzessin wurde mit köstlichen Gewanden
und Kleinoden nach allen Ehren ausgerüstet; auch ihr ein schönes Gefolge
von Frauen und Jungfrauen beigegeben, und als die Schiffe ganz bereit
und geladen waren, nahm die junge Fürstin Abschied von dem König,
ihrem Herrn Vater, und der Königin, ihrer Frau Mutter, kniete vor ihnen
mit großem Seufzen und weinenden Augen nieder und begehrte ihren Segen,
da sie jetzt scheiden mußte. Da segnete sie der König und empfahl sie
der ewigen Dreifaltigkeit, die sie vor allem Herzleid behüten und ihr alle
Genüge verleihen wolle. Die Königin, ihre Mutter, konnte gar nicht mehreres
sprechen als nur weinend ihr Amen zu dem Wunsche sagen.
So erhub sich Agrippina und ging mit all ihrem Volk zu Schiffe. Jedermann
war es leid, daß die schöne junge Prinzessin von ihnen scheiden sollte;
sie aber fuhr in Gottes Namen dahin, und dieser verlieh ihr günstiges
Wetter, so daß die Fahrt glücklich vonstatten ging und sie mit all ihrem
Gefolge frisch und gesund nach Famagusta in Zypern gelangte. Dort hatte
der König von Zypern eine Herzogin, vier Gräfinnen und viele edle Frauen
aufgestellt; welche die junge Königin gar ehrenvoll empfingen. Köstliche
Speisen und Getränke waren bereitet; man gab jedermann genug, Fremden
wie Heimischen, und jung und alt war froh, daß ihrem jungen König
eine so schöne Gemahlin gekommen war. Da standen viel Rosse und Wagen
in Bereitschaft, und jedermann wurde nach Ehren befördert. So kamen
sie nach Medusia, wo der König hofhielt, und wie köstlich der Empfang
zu Famagusta auch gewesen war, so wurden sie doch daselbst noch
zehnmal prächtiger aufgenommen. Denn der König hatte die Edelsten und
Besten aus seinem ganzen Königreich hier versammelt, die alte Königin
mit ihrem ganzen Frauenzimmer harrte ihrer auch, und endlich kam der
junge König mit seinem Gefolge. Diesem dankte Agrippina inniglich mit
fröhlichem Angesicht und holdseligen Gebärden für den köstlichen Empfang
. So ritten sie herrlich bis an den königlichen Palast, der aufs schönste
gerüstet war. Hier begann erst recht das köstliche Leben. Alle Fürsten
und Herren, die dem Zepter des Königs von Zypern gehorchten, kamen
zierlich geritten und brachten köstliche Gaben dar, jeder nach seinem Vermögen
Die Hochzeit wurde begonnen und dauerte sechs Wochen und drei
Tage, und jedermann hatte während dieser Zeit genug. Unter anderm
schenkte Andolosia dem jungen Könige ein ganzes Schiff mit Malvasier
und Muskatellerwein, der wurde getrunken, als ob es Apfelmost gewesen
wäre; da war kein Mangel, solange die Hochzeit währte.
Die Herren und Fürsten aber hielten während all dieser Zeit nichts denn
Rennen und Turnier und andere derlei Kurzweil, und alle Abende gab
man dem den Preis, der am Tage das Beste getan hatte, und geschah dieses
beim Tanze, da setzte die junge Königin jedesmal dem Sieger ein
Kränzlein auf. Um das warben alle, damit sie Ehre von der schönen Königin
Agrippina erjageten. In diesem Turniere warb auch Andolosia und
tat in allen ritterlichen Spielen allweg das Beste, so daß Frauen und
Männer ihm oft den Preis zuerkannten. Als aber zuletzt derselbe wirklich
erteilt werden und ihn billigerweise Andolosia davontragen sollte, da
wurde er ehrenhalber dem Grafen Theodor von England gegeben. Andolosia
achtete jedoch nicht darauf, sondern gönnte ihm die Ehre wohl. Doch
sprach alles Volk: "Andolosia hätte es besser verdient." Das hörte auch
Graf Theodor, und es verdroß ihn nicht wenig; ihn plagte der Neid; deswegen
schloß er einen Bund mit dem Grafen von Limosi, der ein Raubschloß
auf einer kleinen Insel hatte, nicht fern von Famagusta. Beide dachten
darauf, wie sie dem Andolosia Schande zufügen oder gar ihn umbringen
könnten, damit sie ihn vom Hofe los wären und er nicht mehr den
Grafen und Edelleuten gegenüber pochen könnte. Jeder verstand die Absicht
des andern; sie machten einen gemeinschaftlichen Anschlag auf ihn
und warteten nur, bis die Hochzeit zu Ende wäre.

|
***Als nun die ganze Festlichkeit
vorüber war und
Andolosia heim gen Famagusta
reiten wollte,
hatten die beiden Grafen
eine Schar bestellt;
diese fing den Andolosia
aus einem Hinterhalt,
erstach ihm seine Diener
alle und führte ihn selbst
auf die Insel nach Limosi
in ein festes Schloß,
wo er wohl gehütet
|
wurde, so daß er nicht hoffen durfte zu entkommen. Zwar bot er seinen
Wächtern großes Gut, wenn sie ihm von dannen hälfen; aber sie trauten
ihm nicht und meinten, wenn er davonkäme, so würde er ihnen nichts geben.
Andolosia aber durfte ihnen den Säckel nicht zeigen; denn er fürchtete,
sie nähmen ihn und hälfen ihm doch nicht. So war er in großen
Nöten.
***Inzwischen kam die Märe vor den König, daß Andolosias Diener alle
erstochen seien und von ihm selbst niemand wisse, ob er tot oder lebendig
sei, auch den Täter nicht erraten könne. Denn die zwei Grafen, die es
getan hatten, ritten wieder an des Königs Hof und hielten sich stille, als
ob sie nichts darum wüssten.
Jetzt kam auch zu Ampedo die Kunde, daß sein Bruder verlorengegangen
sei. Auf der Stelle sandte er Boten zu dem König und ließ ihn bitten,
ihm doch wieder zu seinem Bruder zu verhelfen. Der König versprach,
alles anzuwenden, um seinen Aufenthalt zu erfahren; werde er es inne,
wo Andolosia festgehalten werde, so wolle er es sich kein Geld dauern
lassen; ja, sollte es sein halbes Reich kosten, so müßte er ledig werden.
Ampedo aber dachte, er sei um seinen Bruder gekommen wegen des Säckels,
und nun würde auch er gemartert werden, damit er von dem Hütlein,
das er besäße, Kunde geben müßte. "Nein, das soll nimmermehr
geschehen!"sprach er bei sich selbst, und im Zorne nahm er das köstliche
Hütlein, zerhackte es in Stücke, warf es in das Feuer und blieb dabeistehen,
bis es zu Asche verbrannte, daß niemand seine Freude mehr damit
haben sollte. Er hatte stets Boten auf den Beinen zu dem Könige, aber
soviel ihrer zurückkamen, so brachte doch keiner gute Botschaft, und er
konnte nichts vom Schicksal seines Bruders erfahren; das machte ihm großes
Herzeleid, er verfiel in tiefen Kummer und endlich in eine tödliche
Krankheit, so daß ihm kein Arzt helfen konnte, und also starb er.
***Etliche Tage waren verflossen, da hörten die Grafen, daß es dem König
so leid tue um seinen wackern Ritter Andolosia; sie stellten sich daher, als
trauerten auch sie um ihn. Der König ließ ausrufen, wer gewisse Kundschaft
brächte, wo Andolosia hingekommen wäre, dem wolle er tausend
Dukaten bar geben, möchte jener lebendig sein oder tot. Aber jedermann
hielt reinen Mund. Inzwischen nahm der Graf von Limosi Urlaub von
dem König und kam in sein Schloß, wo Andolosia gefangensaß, und fand
diesen in einem tiefen Turme sitzen. Andolosia freute sich, als er den
Grafen sah; denn er hoffte auf Barmherzigkeit. Er bat denselben, ihn des
Gefängnisses zu entledigen; wußte aber dabei nicht wessen Gefangener
er wäre, oder warum er in so harter Haft gehalten würde; wenn er jemand
ein Unrecht getan hätte, so wollte er ihm gern Genüge tun mit Leib
und Gut. Aber der Graf sprach: "Andolosia, du bist nicht darum hergeführt;
daß man dich wiederhinwegläßt; du hifi mein Gefangener und
wirst mir sagen, von wannen dir das viele Geld komme, das du das ganze
Jahr über ausgibst; und mach deine Aussage nur kurz, sonst will ich dich
also martern, daß du froh wirst, wenn du es mir nur sagen darfst!" Da
Andolosia das hörte, erschrak er sehr, und aller Trost entfiel ihm; er
wußte nicht, was er sagen sollte; endlich gab er an: "Zu Famagusta in
seinem Hause, da wäre eine heimliche Grube, die habe ihm sein Vater gezeigt;
als er am Sterben gewesen; wieviel Gelds er daraus nehme, so sei
immer noch mehr darin. Wollte der Graf ihn also gefangen gen Famagusta
führen, so sei er bereit, ihm die Grube zu zeigen." Dem Grafen
wollte dieses nicht genügen; er nahm ihn aus dem Kerker und marterte
ihn. Andolosia erduldete es lange und blieb auf seiner Aussage. Wie der
Graf merkte, daß er nicht bekennen wollte, fuhr er mit der Folter fort
und ließ ihn so grausam peinigen, daß Andolosia vor großen Schmerzen
nicht länger schweigen konnte, sondern von der Kraft des tugendreichen
Säckels zu bekennen anfing. Als der Graf dieses hörte, nahm er den Säckel
von ihm, versuchte ihn und fand ihn ergiebig. Nun ließ er den armen
Andolosia wieder in den Kerker setzen und befahl ihn seinen vertrautesten
Dienern; dann versah er sein Schloß und kam ganz vergnügt wieder an
des Königs Hof zu seinem Gesellen, dem Grafen Theodor. Dieser empfing
ihn mit Freuden, und sie hielten viel Gesprächs untereinander, wie
er mit Andolosia umgegangen, wie er ihm den Säckel mit so großer Marter
abgezwungen, und wie hart er ihn gefangenhielte. Da sprach Graf
Theodor: "Es gefällt mir so nicht, er wäre besser tot denn lebendig; ich
habe an des Königs Hof vernommen, er sei ein Schwarzkünstler und könne
durch die Lüfte fahren. Wenn er ledig wird, so ist zu besorgen, man vernehme
von ihm, wie wir mit ihm gehandelt; dann gewinnen wir die Ungnade
des Königs, oder jener nimmt uns gar das Leben." —Darauf erwiderte
der Graf von Limosi: "Er liegt so hart gefangen, daß er uns keinen
Schaden zufügen kann." Dann traten sie zusammen und nahmen aus dem
Säckel, soviel sie wollten, und jeder hätte gerne den Säckel in seiner Gewalt
gehabt. Endlich wurden sie darüber eins, daß ihn jeder ein halbes
Jahr haben sollte; der aber, der den Säckel hätte, sollte dem andern an
Geld nichts mangeln lassen. Nun war Graf Limosi der Altere, der sollte
den Säckel das erste halbe Jahr haben. Soviel die beiden Grafen jetzt
Gelds hatten, so durften sie es doch nicht brauchen, damit kein Argwohn
auf sie fiele; und wiewohl sie herrlich und in Freuden lebten, so lag doch
Graf Theodor seinem Gesellen immer im Ohr und meinte, Andolosia
wäre besser tot denn lebendig. Seine Furcht war immer, er möchte um
den Säckel kommen. Auch hatte er die Absicht wenn er von dem Grafen
von Limosi denselben überantwortet bekäme, sich mit dem Säckel davonzumachen
, so weit weg, daß er sowohl vor dem König als vor seinem
Raubgenossen sicher wäre. Deswegen bewog er jenen, ihm einen seiner
Knechte beizugeben und ihn mit einer schriftlichen Ermächtigung zu versehen,
das Gefängnis Andolosias öffnen zu dürfen.
Nun beurlaubte sich Graf Theodor von dem König unter dem Vorgeben
, er wolle fremde Länder besehen, was ihm auch von dem Könige
gestattet wurde. Er aber zog von dannen und nach der Insel Limosin; hier
ließ er sich in das Schloß führen und in den Kerker, in welchem Andolosia
gefangen lag. Dieser saß elendiglich und trostlos im Stock: Arme und
Beine waren ihm abgefault; als er aber den Grafen Theodor erblickte,
empfing er einen starken Trost und vermeinte, der Graf von Limosi habe
den Grafen Theodor damm gesandt, daß er ihn ledig lassen solle. Er
dachte: "Weil sie den Säckel haben, so fragen sie nicht mehr viel nach
mir." Da fing aber der Graf an und sprach: "Sag an, Andolosia, hast
du nicht noch so einen Säckel, wie du meinem Gesellen einen gegeben hast?
Auf, gib mir auch einen!" —"Gnädiger Herr Graf", sagte er, "ich habe
keinen mehr; hätte ich aber noch einen, er wäre Euch unversagt." Jener
sprach: "Man sagt, du seist in der Schwarzkunst erfahren und könnest in
den Lüften fahren, und den Teufel beschwören, daß er mit dir von dannen
fahre. Warum beschwörest du ihn denn nicht jetzt, daß er dir von dannen
helfe ?" Da sprach jener: "Ach, gnädiger Graf, das kann ich nicht und
habe ich noch nie gekonnt; nur allein mit dem Säckel, den Ihr jetzt in
Händen habet, habe ich Kurzweil gehabt: der sei Euch und Eurem Gesellen
vor Gott und der Welt geschenkt; ich will nimmermehr keinen Anspruch
daran machen. Aber um Gottes willen bitte ich Euch, laßt mich armen
Mann aus diesem Gefängnis los, daß ich nicht so elendiglich hier umkomme
Der Graf sprach höhnisch: "Willst du jetzt an deiner Seele Heil
denken, warum hast du es nicht getan, solange du Hochmut und Hoffart
vor dem König und der Königin triebest und uns alle Unehre beweisest?
Wo sind nun die schönen Frauen, denen du so wohl gedienet hast? Die,
welche dir alle den Preis gaben, die laß dir jetzt helfen! Ich merke wohl,
daß du gern aus dem Gefängnis wärest; laß dich's nicht bekümmern, ich
will dir bald davonhelfen!"
***Mit diesen Worten führte er den Knecht, der des Gefangenen Hüter
war, beiseite und wollte ihm fünfzig Dukaten geben, daß er Andolosia
erwürgte. Aber der Hüter wollte dies nicht tun: "ES istein braver Mann",
sagte er, "und gar schwach; er stirbt von selbst bald: ich will die Sünde
nicht auf mich laden!" Der Graf sprach: "So gib mir einen Strick, ich
will ihn selbst erwürgen und will nicht von hinnen, er sei denn tot."Aber
auch das wollte der redliche Knecht nicht tun. So nahm der Graf Theodor
seinen Gürtel, den er umhatte, legte ihn dem Andolosia um den Hals
und wirbelte den Gürtel mit seinem Dolche zu: so erwürgte er den Armen
sitzend und gab dem Knechte Geld, daß er den Leichnam hinwegschaffte.
Dann weilte er nicht lange mehr im Schlosse, sondern ging den nächsten
Tag nach Zypern an des Königs Hof. Hier kam er zu seinem Gesellen,
dem Grafen von Limosi. Der empfing ihn öffentlich und fragte ganz
lustig, wie ihm die Insel und die fremden Länder gefallen hätten. "Gar
wohl", erwiderte dieser. Dann fragte ihn der Graf heimlich, wie es um
Andolosia stehe. "So steht es um ihn", sprach Theodor, "daß wir keinen
Schaden mehr von ihm zu gewarten haben. Ich habe ihn mit meinen
eigenen Händen umgebracht; ich hatte keine Ruhe, bis ich wußte, daß er
gewiß tot sei, wie ich es jetzo weiß."
So sprach der Bösewicht und meinte, er habe alles gut ausgerichtet. Er
wußte aber nicht, wie übel er getan hatte. Drei Tage stand es an, daß sie
nicht über den Säckel gingen; mit ihnen war auch das halbe Jahr aus,
und der Säckel sollte auf den Grafen Theodor übergehen. Daher ging

dieser ganz vergnügt zu dem Grafen Limosi und bat ihn, ihm den Säckel
zu überreichen; vorher könne er Geld herausnehmen, soviel er wolle, damit
er das halbe Jahr über zu zehren hätte. Der andere zeigte sich willig
dazu. Doch sprach er: "Ich weiß nicht, wie mir geschieht, aber wenn ich
den Säckel in die Hand nehme, so erbarmt mich Andolosia; ich wollte, du
hättest ihn nicht getötet; er wäre selbst bald gesiorben!" Graf Theodor
sprach: "Ein Toter macht keinen Krieg!"Also gingen beide miteinander
in die Kammer, wo jener den Säckel hatte; den holte er aus einer Truhe
hervor und legte ihn auf einen Tisch. Theodor nahm den Säckel in die
Hand und wollte zu zählen anfangen, wie er früher oft getan hatte. Beide
wußten nicht, daß der Säckel die Kraft verloren hatte, weil beide Brüder,
Ampedo und Andolosia, gestorben waren. Da sie aber kein Geld aus dem
Säckel zu bringen vermochten, sah einer den andern an.
Endlich sprach Graf Theodor mit grimmigem Zorn: "Oh, du falscher
Graf, wolltest du mich also betrügen und mir für den tugendreichen Säckel
einen andern armen geben? Das leide ich keineswegs von dir! Darum
zögere nur nicht lang und bring mir den reichen Säckel!" Der andere
versicherte ihn, daß dies der rechte sei und er keinen andern habe. Wie es
zuginge, daß er nicht mehr täte wie vor, das begreife er nicht. Aber diese
Antwort genügte dem Theodor nicht; er wurde, je länger, je zorniger und
warf jenem vor, er wolle als Bösewicht an ihm handeln, das solle ihm
nimmer guttun! und zückte vom Leder. Der Graf von Limosi, als er das
sah, war auch bei der Hand. Beide machten ein Gepolter, daß die Knechte
zusammenliefen, die Kammer aufstießen und, als sie ihre Herren im Gefechte
miteinander trafen, diese voneinander schieden.
Aber der Graf Limosi war bis auf den Tod verwundet, dies sahen seine
Diener und griffen den Gegner.
***Auf diese Weise kam die Märe vor den König und den Hof, daß die
zwei Grafen, die sonst immer innig miteinander gewesen waren, sich auf
Leben und Tod geschlagen hätten. Der König befahl, man solle beide unverzüglich
gefangen vor ihn bringen. Er wolle den Ursprung ihrer Uneinigkeit
kennenlernen. Als man des Königs Gebote gehorsam sein wollte
und ihm die beiden Grafen bringen, da war es nicht mehr möglich, den
todwunden Limosi von der Stelle zu schaffen. So wurde allein Graf
Theodor vor den König gebracht.
Als man diesen fragte, warum sie beide, sonst so innig, sich auf den
Tod geschlagen hätten, so wollte er anfangs nicht mit der Wahrheit heraus.
Bald aber zwang ihn die Folter dazu, und so gestand er den ganzen
Handel, wie sie mit Andolosia umgegangen waren. Da der König hörte,
wie übel sie mit dem armen Andolosia gefahren, ward er von Herzen betrübt
und erzürnt über die Mörder. Und sonder langes Bedenken fällte
er das Urteil, man sollte sie mit dem Made hinrichten. Und wenngleich der
Graf von Limosi auf den Tod krank liege, so solle man ihn doch auf die
Richtstatt tragen; wäre er tot, so sollte man ihn tot noch rädern und auf
das Mad flechten.
Dieses Urteil ward an den beiden Mördern vollzogen, und war es ihr
gerechter Lohn; denn sie hatten es an dem guten Andolosia verschuldet.
Nachdem nun jene Verbrecher um des Säckels willen, mit dem sie doch
nur kurze Zeit ihre Lust gehabt hatten, hingerichtet und aufs Rad gelegt
waren, schickte der König von Stund an in die Insel Limosi all sein Volk
und ließ Schloß, Städte, Dörfer und die ganze Insel einnehmen und sonderlich
in dem Schlosse, in welchem der arme Andolosia gefangengesessen,
ließ er Mann und Weib sahen; und alle, die um den Mord gewußt schuld
daran gehabt oder ihn verschwiegen hatten, ließ er ohne alle Barmherzigkeit
zu dem Schlosse heraushenken. Er erfuhr auch, daß sie den Leichnam
Andolosias in eine Wassergrube nicht fern von dem Schlosse geworfen
hatten. Den befahl er herauszuziehen und gen Famagusta zu führen, wo
er ihn mit großer Feierlichkeit begraben ließ, in die schöne Domkirche, die
sein Vater Fortunat gestiftet und gebaut hatte. Es war dem alten König
und seiner Gemahlin, auch dem jungen König und der jungen Königin
Agrippina gar leid um den getreuen Andolosia. Weil sie aber alle beide,
Ampedo und Andolosia, keine Erben hinter ihnen gelassen, so nahm der
König den köstlichen Palast selbst ein und fand darin großes Gut und
kostbaren Hausrat, Kleinode und Barschaft. In diesen Palast zog der
junge König selbst mit seiner Gemahlin Agrippina und hielt daselbst so
lange Hof, bis sein Vater, der alte Konig von Zypern, mit Tod abgegangen
war. Alsdann nahm er das Königreich ganz zuhanden.
Nachwort
Gustav Schwabs Deutsche Volksbücher erschienen zuerst 1836 und 1837
unter dem Titel "Buch der schönsten Geschichten und Sagen, für jung und
alt wiedererzählt". den nächsten drei Jahren folgten die "Schönsten
Sagen des klassischen Altertums". Beide Werke stellen die eigentliche Leistung
Schwabs dar. Jede gerechte Darstellung seines Schaffens muß sie in
den Mittelpunkt rücken. Alles andere, was Schwab gedichtet, übersetzt,
besprochen und herausgegeben hat, erscheint nur als eine Vorbereitung zu
diesen glänzenden Nacherzählungen, in denen seine Veranlagung des Sicheinfühlens
und Nachschaffens auf den Gipfel gelangte. Während das
Genie plötzlich in einer Familie auftaucht und von der Lebensstellung der
Eltern vollkommen unabhängig zu sein scheint, entstammen fast alle großen
Umwandler und Übersetzer einer geistig gehobenen Schicht. So ist
auch Gustav Benjamin Schwab, wie sein voller Name lautet, ein Professorensohn
Sein Vater, Johann Christoph Schwab, lehrte an der Hohen
Karlsschule, die Schiller besucht hat, Logik und Metaphysik. Daher empfängt
Gustav Schwab von Jugend auf reiche Anregungen, arbeitet unermüdlich
an seiner eigenen Ausbildung, begeistert sich für jeden Großen,
mit dem er zusammentrifft, und versucht, Ähnliches zu leisten wie dieser.
Wenn ihm das nicht ganz gelingt, dann ist er aber, im Unterschiede z. B.
von August Wilhelm Schlegel und selbst von Herder, völlig frei von
Arger und Verbitterung. Er ist durchaus nicht ohne Selbstbewußtsein,
aber er hat die glückliche Gabe, mit der Adjutantenrolle zufrieden zu sein.
Er weiß, daß er vieles kann, was andere nicht können, und sieht nicht ein,
warum er sich darüber grämen soll, daß es Aufgaben gibt, die andere
besser lösen als er. Man hat Schwab bisweilen einen Vorwurf daraus
gemacht, daß er sich nicht in seelischen Kämpfen aufgerieben hat. Man
sollte sich lieber über seine geistige Gesundheit freuen und seine Neidlosigkeit
bewundern. Gerade bei Schriftstellern findet sie sich selten.
Schwabs stete Bereitschaft, die Leistungen anderer anzuerkennen und zu
rühmen, erinnert unmittelbar an die des alten Gleim, der im achtzehnten
Jahrhundert so viele Dichter freundlich gefördert hat, und ist menschlich
eine außerordentlich wertvolle Eigenschaft. Sie ist aber auch den Volksbüchern
zugute gekommen, weil sie Schwab das Sicheinfühlen in die
Schöpfungen anderer gewaltig erleichterte. Er hatte außerdem den Drang,
andern seine Begeisterung mitzuteilen, sie liebevoll in die von ihm entdeckten
Schönheiten einzuführen, namentlich die Jüngeren freundlich an
der Hand zu nehmen und zu leiten. Man findet diese Neigung nicht selten
bei Söhnen von Lehrern und Pastoren. Schwab hat diese ererbte Fähigkeit
in eigener Tätigkeit als Lehrer und Seelsorger weiter entwickelt und
daher in seinen Hauptwerken echte Jugendbücher geschaffen.
In Stuttgart am 19. Juni 1792 geboren, besuchte Schwab das dortige
Gymnasium und studierte von 1809 bis 1814 in Tübingen Philologie,
Philosophie und Theologie. Die Altertumswissenschaft und das Christentum
sind ihm immer gleich teuer geblieben; die Philosophie, die seinem
Vater die Hauptsache gewesen war, lag ihm dagegen weniger und spielte
in seiner Entwicklung keine entscheidende Rolle. Schwab blieb aber auch
dem gesellschaftlichen Leben nicht fremd. Seine Mitstudenten nannten ihn
den Abbe, weil er einem gewandten Weltabt des achtzehnten Jahrhunderts
in Kleidung und Auftreten ähnlicher war als einem schwäbischen
Theologen. Freundschaft schloß er mit Justinus Kerner (1786 —1862),
dem Lyriker, Arzte und Geisterseher, der zwanzig Jahre später das Spiritisienbuch
"Die Seherin von Prevorst" veröffentlichte, und mit Ludwig
Uhland, der 181s mit den "Gedichten"seinen Ruhm begründete. Schwab
bewunderte Uhlands Balladen rückhaltlos und betrachtete sich zeitlebens
als den Gefolgsmann des Dichters, der nur sechs Jahre älter war als er.
Zu der Entstehung des Namens der "Schwäbischen Schule"hat die Bereitwilligkeit,
mit der sich Schwab unterordnete, sehr wesentlich beigetragen
. Er rief Uhland zu:
| Mich laß immer froh gestehen,
Daß ich dein ält'ster Schüler bin:
Will den in mir die Nachwelt sehen,
So zieht mein Schatten aufrecht hin. |
***Das Leben Schwabs verlief nach dem Abschluß seiner Studien in geregelten
Bahnen. Nachdem er ein halbes Jahr als Vikar in Bernhausen
gewirkt hatte, unternahm er 181S eine Reise nach Norddeutschland. Er
wurde in Weimar von Goethe freundlich aufgenommen und lernte in
Berlin Schleiermacher, Chamisso und E. T. A. Hoffmann, in Kassel die
Brüder Grimm kennen. Nach der Rückkehr wurde er Repetent am Tübinger
Stift und 1817 Professor am Obern Gymnasium in Stuttgart.
Im nächsten Jahre heiratete er Sophie Karoline Gmelin, mit der er sich
in Tübingen verlobt hatte. Sie war eine ebenso gesellige Natur wie er
und übte eine ausgedehnte Gastfreundschaft. Als Lehrer gewann Schwab
rasch die Zuneigung seiner Schüler, weil er außerordentlich lebendig vortrug
und namentlich auf die Begabten anregend wirkte. Die Hauptsache
war ihm aber doch das literarische Schaffen, das ihn bereits von Zeit zu
Zeit auf das Gebiet der Volksbücher führte. Uhland hatte 1810 Robert
den Teufel zum Helden eines Balladenzyklus machen wollen, ließ den
Plan aber bald fallen. Schwab nahm ihn 1820 auf mit der Erklärung:
| Und was der Meister nicht schaffen will,
Das schaffet der Gesell. |
***Er benutzte Uhlands Aufsatz "wer das altfranzösische Epos" und lieh
sich von ihm auch das französische Volksbuch von Limoges "Das schreckliche
und entsetzliche Leben Roberts des Teufels", das er damals seinen
Romanzen und später seiner Prosaerzählung zugrunde legte. Ebenso trat
ihm Uhland den Stoff für die "Griseldis"(1829) in zehn Romanzen ab.
Schwabs Quelle war Martinus von Kochem, dessen Erzählung er in den
Romanzen mit sentimentalen Zusätzen ausschmückte. Als Schwab denselben
Stoff 183s für die Volksbücher behandelte, tilgte er gerade diese Zutaten
wieder und hielt sich viel enger an Kochem. Man sieht hier ganz
deutlich, wie die Romanzen, in denen Schwab so viele Stoffe behandelt
hat, nur erste Versuche sind, denen dann die endgültige Gestaltung in
den Volksbüchern folgt.
Ihrem Stoffkreis gehört auch die Legende von den Heiligen Drei Königen
an, durch die Schwab in engere Beziehungen zu dem greisen Goethe
kam. Der Vermittler war Sulpiz Boisserée (1783 —1854), der Erforscher
der Gotik, und besonders der Geschichte des Kölner Doms, der Gatte
Mathilde Rapps, einer Kusine Schwabs. Boisserée war eng mit Goethe
befreundet und hat sich viel Mühe gegeben, den Olympier in einen Verehrer
der altdeutschen Kunst zu verwandeln. Zu seiner Betrübnis ging
Goethe aber immer nur eine Weile mit ihm und kehrte dann hartnäckig
zum Kultus der antiken Baukunst zurück. Goethe besaß eine lateinische
Handschrift der Legende von den Heiligen Drei Königen von Johannes
von Hildesheim. Er schrieb 1819 an Boisserée: wüßte kein Volksbuch,
neben dem dieses Büchlein nicht stehen könnte." Zu seiner Freude
übernahm, wie er in seinen "Annalen" unter dem Jahre 1821 berichtet,
"ein geistreicher junger Mann, Dr. Schwab", die Üersetzung. Sie erschien
1822, und Goethe steuerte das Motto bei:
| Wenn was irgend ist geschehen,
Hört man's noch in späten Tagen;
Immer klingend wird es wehen,
Wenn die Glock ' ist angeschlagen.
Und so laßt von diesem Schalle
Euch erheitern, viele, viele!
Denn am Ende sind wir alle
Pilgernd' Könige zum Ziele. |
***Goethe erkannte damals bereits Schwabs Fähigkeit, sich dem Erzählerton
einer Vorlage aufs glücklichste anzupassen. Er schrieb an Boisserée: "Herrn
Schwab grüßen Sie zum allerschönsten; der frühere Eindruck sowohl des
Originals als seiner Übersetzung bleibt immer ebenderselbige. Der Ton
ist ihm glücklich gelungen, worauf bei solchen Dingen immer alles ankommt
." In seiner Zeitschrift"Sunst und Altertum"rühmte Goethe 1822
die der Übersetzung beigefügten zwölf Romanzen, in denen Schwab den
Stoff dichterisch geformt hatte, als "ein angenehmes Geschenk". Vom
Stile des jungen Dichters sagte Goethe, er sei, "obgleich einige Jahrhunderte
rückwärts gebildet, doch ohne Zwang und Unnatur; das Vorgetragene
liest sich gut und leicht". Dieses Urteil würde Goethe auch über
die Deutschen Volksbücher gefällt haben, wenn er ihr Erscheinen erlebt
hätte.
Seine Besprechung lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit auf Schwab,
der nun erst berühmt zu werden anfing. 1823 veröffentlichte er die lateinische
Übersetzung der vaterländischen Gedichte seines Meisters Uhland
in Horazischen Versmaßen und das Reisebuch "Die Neckarseite der
Schwäbischen Alb". Man hielt damals die Dichter für die berufenen
Landschaftskünder und ließ mit Vorliebe die Reiseführer von ihnen verfassen
. Schwabs Wanderbücher sind von besonderer Bedeutung, weil er
die Mehrzahl seiner Balladen als Einlagen für sie gedichtet hat. Die
Stoffe entnahm er teils den alten Chroniken, aus denen er sich über die
örtliche Geschichte unterrichtete; teils fing er sie aus der mündlichen Überlieferung
auf. Als Schwab sich 182s zu solchen Studien an den Bodensee
begab, empfahl ihn Uhland dem Freiherrn Joseph von Laßberg (1770
bis 1855), der damals noch zu Eppishausen im Thurgau lebte und dort,
wie später auf der Meersburg, deutsche Altertümer und Handschriften
sammelte. Laßberg schrieb an Uhland: "Ich betrachte den Tag, an dem
ich mit diesem wackern Manne zusammentraf, als einen, den man mit
einem weißen Steine bezeichnen muß." Schwab und der romantische
Germanist blieben Freunde. Durch die vielen Mitteilungen, die ihm der
Freiherr von Laßberg machte, wurde der geschichtliche Teil in Schwabs
Reisebuch "Bodensee nebst dem Rheintale von St. Luziensteig bis Rheinegg"
(1827) die Hauptsache. In ihm finden wir Schwabs bedeutendste
Ballade "Der Reiter und der Bodensee". Die mündliche Mitteilung, die
Schwab als Quelle angibt, kam sicher aus Laßbergs Munde.
Ein Jahr vor diesem Reisewerk veröffentlichte Schwab seine Übersetzung
der "Poetischen Gedanken" des französischen Romantikers Alphonse de
Lamartine (1790 —1869). Daher fand er in Paris, wohin er 1827 reiste,
sofort Fühlung mit allen berühmten Zeitgenossen. Er leitete von 1827
bis 1837 den poetischen Teil von Cottas Morgenblatt, half Chamisso bei
der Redaktion seines Musenalmanachs, entdeckte und förderte junge Dichter
und schrieb unermüdlich, ohne daß seine Lehrtätigkeit, die ein anderer
längst aufgegeben hätte, darunter litt. Sein Haus in Stuttgart wurde
nicht leer von Besuchern. Es war das literarische Zentrum Süddeutschlands.
Man könnte von einem Schwabschen Salon reden, aber der gemütvolle
und herzliche Ton, der dort herrschte, war viel zu echt schwäbisch,
um diese Pariser Bezeichnung zuzulassen. Ein packendes Bild von
dem Leben des Schwabschen Hauses gibt der Brief, den der sonst so
schwermütige Dichter Nikolaus Lenau am s. Oktober 1831 an seinen
Schwager Schurz schrieb: "Ich lebe jetzt in Stuttgart im Hause meines
innigen Freundes, Professors Schwab, und meiner innigen Freundin,
dessen Gemahlin. Vielbereichert an schönen Erfahrungen über den wahren
Menschenwert, reicher an manchem Freunde und an Lebensmut und
an Selbstvertrauen bin ich geworden seit unserer Trennung. Bruder l Ich
habe eine poetische Wallfahrt gemacht zu Uhland, Mayer, Justinus Kerner,
habe Ebert hier getroffen, mein ganzes Leben war ein höchst poetisches
. Die lebhafteste Teilnahme, die feurigste Ermunterung wurde mir
zuteil von allen, die ich hier genannt habe. Aber enthusiastisch war schon
bei unserer ersten Begegnung Schwab von meiner Poesie ergriffen. Ich
muß Dir gestehen, daß es mir unendlich behaglich war, zu sehen, wie jeder
Gedanke sogleich zündete in dem empfänglichen Gemüte dieses Mannes;
eine solche Wirksamkeit hätte ich meinen Leistungen nicht zugetraut, ist
auch vieles davon auf die große Lebhaftigkeit Schwabs zu sehen. Am ersten
Tage meines Hierseins führte mich Schwab abends in einen Leseverein
und trug hier mehrere meiner Gedichte selbst vor mit großem Feuer. Als
sich die Gesellschaft getrennt hatte, blieben nur Schwab, ich und ein junger
Dichter, Gustav Pfizer, zurück. Da wurde noch gelesen, getrunken,
Bruderschaft getrunken, geraset auf mancherlei Art bis spät nach Mitternacht
."
Die gesunde Lebensfreude Schwabs muß sehr groß gewesen sein, wenn
sie einen solchen Melancholiker ohne weiteres mitriß. Im übrigen sehen
wir ihn wieder in der Rolle des Bannerträgers, obwohl Lenau zwölf
Jahre jünger ist und seinen Ruhm erst noch erwerben soll. Er hat Schwab
dann die erste Ausgabe seiner "Gedichte" (1832) gewidmet. Auch Ferdinand
Freiligrath ist erst durch Schwab der Öffentlichkeit bekanntgeworden.
Und das alles leistet ein Mann, der zugleich Schriftleiter und Gymnasialprofessor
ist
Schwab führte dieses an Anregungen und Arbeiten überreiche Leben bis
zum Jahre 1837, also bis zum Erscheinen der Deutschen Volksbücher.
Dann erst machte sich bei dem Fünfundvierzigjährigen eine gewisse Ermüdung
bemerkbar. Er machte ganz unvermittelt einen Kopfsprung in
die Einsamkeit, indem er sich die Landpfarre zu Gomaringen, südlich von
Tübingen, übertragen ließ. Sein Amt ließ ihm zwar die ersehnte Muße
zu literarischen Arbeiten, aber auf die Dauer genügte die beschauliche Tätigkeit
seinem rastlosen Temperament nicht. Schon 1841 kehrte er als
Pfarrer und Amtsdekan nach Stuttgart zurück und hielt dort Vorlesungen
über deutsche Literatur. 1845 wurde er Oberkonsifiorialrat und Oberstudienrat
. Ohne vorher krank gewesen zu sein, wurde Schwab am 4. November
1850 durch einen Schlaganfall aus seinem arbeitsreichen Leben
gerissen, das sicher glücklicher gewesen ist als das manches genialer Veranlagten.
Seine Deutschen Volksbücher sind zwar zeitlich durch mehrere Jahrzehnte
vom "Wunderhorn" (1806 —1808) und den "Kinder- und Hausmärchen
"(1812 —1815) der Brüder Grimm getrennt, gehören aber mit
ihnen zu den bleibenden Schöpfungen der deutschen Romantik, die dem
Worte Volk überhaupt erst die Bedeutung, in der wir es heute gebrauchen,
verliehen hat. Schwab gab seiner Ausgabe die ganz im Sinne Arnims,
Brentanos und der Brüder Grimm geschriebenen Worte mit: "Die Sagen
unserer Volksbücher sind Ausfluß und Quelle der reichsten Poesie.
Entsprungen großenteils aus dem alten Born germanischer Nationaldichtung
, blieben sie dem Volke teuer, auch als die Verbildung der höhern
Stände in späteren Jahrhunderten ihrer spottete." In der Tat hat man
jahrhundertelang überhaupt nicht gewußt, daß die Volksbücher Kulturwerte
sind, sondern sie gewissermaßen zum Unterholz im Walde der Dichtung
gerechnet. Die ersten Volksbücher entstanden im fünfzehnten Jahrhundert,
als das ritterliche Epos in Versen aus der Mode kam. Während
die alten Dichtungen vorher viel häufiger vorgetragen und angehört als
gelesen wurden, löste man sie damals in Prosa auf, damit sie jeder lesen
könne. Zunächst bedeutete das eine gewaltige Erweiterung des Kreises der
Genießenden. Die Volksbücher waren für das gange Volk, für alle, die
lesen konnten, gedacht. Der Vorgang beschränkt sich auch keineswegs auf
Deutschland. Vielmehr sind gerade unter den deutschen Volksbüchern anfangs
die übersetzungen aus dem Italienischen und dem Französischen besonders
zahlreich. Es ist aber dann eine gründliche Eindeutschung erfolgt,
so daß man beispielsweise in der "Schönen Melusina" nur mit einiger
Mühe die Stammessage der französischen Grafen von Lusignan erkennt.
Um einen verhältnismäßig widerstandsfähigen Handlungskern haben sich
allmählich die verschiedenartigsten Bestandteile gelagert. Karl der Große
wird in den "Vier Haimonskindern" der ohnmächtige Herrscher des späten
Mittelalters, der weniger zu sagen hat als seine mächtigen Vasallen. Die
alten Kreuzzüge verschmelzen mit den noch im Gange befindlichen Türkenkriegen
zu einer Einheit. Zu dieser Angleichung und Vereinfachung
historischer Geschehnisse treten Wandlungen der Sprache. Sie wird nicht
etwa naiver und einfacher, sondern prunkvoll und geziert, weil das im Zeitalter
des Barocks für vornehm gilt. Namentlich die Reden der Personen
von hoher Abkunft nehmen den komplimentreichen und bisweilen schwülstigen
Stil der "Haupt- und Staatsaktion" an. Andrerseits aber treten
den vom ritterlichen Epos abstammenden Volksbüchern solche zur Seite,
die ihren derben Charakter bewahren, weil sie einer ganz andern Welt
entstammen, nämlich dem Denken der Bürger und Bauern des fünfzehnten
und sechzehnten Jahrhunderts. Nach der komischen Seite vertreten diese
Gattung die "Schildbürger", nach der tragischen der "Doktor Faustus".
Der verbildete Geschmack der Leser wandte sich aber im siebzehnten
Jahrhundert überhaupt von den Volksbüchern ab und bevorzugte eine
an den Fürstenhöfen gepflegte, von ausländischen Vorbildern abhängige
Kunstpoesie. So trat der sonderbare Zustand ein, daß die Volksbücher, in
denen die ritterliche Überlieferung fortlebte, nicht mehr von den Adligen
gelesen wurden, sondern nur vom Volke, d. h. von den Schichten, die an
der höheren Bildung keinen Anteil hatten, und allenfalls noch von Kindern
Dem entsprach, wie Goethe berichtet, die äußere Ausstattung der
Volksbücher: "Sie wurden wegen des großen Abgangs mit stehenden
Lettern auf das schrecklichste Löschpapier fast unleserlich gedruckt. Wir
Kinder hatten also das Glück, diese schätzbaren Überreste der Mittelzeit
auf einem Tischchen vor der Haustüre eines Büchertrödlers täglich zu
finden und sie uns für ein paar Kreuzer zuzueignen... Der größte Vorteil
dabei war, daß, wenn wir ein solches Heft zerlesen oder sonst beschädigt
hatten, es bald wieder angeschafft und aufs neue verschlungen werden
konnte."
Die Erlösung aus diesem Aschenbrödeldasein erfolgte erst im Anfange
des neunzehnten Jahrhunderts. Sieht man von Goethes Erneuerung und
gewaltiger Ausgestaltung des Faust-stoffes ab, dann war Ludwig Tieck
der erste, der die deutschen Volksbücher wieder erstehen ließ. Er verwandelte
die "Schildbürger" in eine Satire auf die Aufklärung, spann die
"Genoveva" und den "Kaiser Oktavianus" zu endlosen Dramen aus und
dichtete einige seiner schönsten Lieder als Einlagen zu der "Wundersamen
Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter aus der Provence"
. Aber hier wie überall waren Tieck seine eigenen Zusätze die
Hauptsache und das alte Werk nur eine Art von Anregungsmittel, das
Stimmungen und Einfälle auslöste. Daher sind von seiner Erneuerung,
überladung und Verzerrung der Volksbücher nur die Magelone-Lieder,
die Brahms komponiert hat, lebendig geblieben. Im übrigen versanken
seine Schnörkel mit dem Geschmack für die romantische Ironie, die mit
allem nur spielt und nichts ernst nimmt. Viel näher kam die Heidelberger
Romantik, die das deutsche Volkstum über alles schätzte, dem wirklichen
Geiste der Volksbücher. Joseph Görres, der mit Achim von Arnim
und Clemens Brentano die "Einsiedlerzeitung"herausgab, veröffentlichte
1807 sein Buch "Die teutschen Volksbücher", das als Grundlage der
Forschung auf diesem Gebiete gilt. Als Gustav Schwab 1836 seine Nacherzählungen
herausgab, nannte er Görres "seinen Führer zu diesen alten
Schätzen".
Die sachliche Bescheidenheit, mit der er — im Gegensatze zu Tieck —
völlig in den Hintergrund tritt, und die warme Herzlichkeit, mit der
Schwab jede Erzählung durchdringt, sind hundertmal wertvoller als eine
geistreiche Willkür, die fortwährend zu sagen scheint: "Seht, was ich daraus
mache!" Schwab trifft den Märchenton im "Gehörnten Siegfried"
und im "Schloß in der Höhle Xa Xa'' ebenso sicher wie den des ritterlichen
Epos im "Armen Heinrich", den der Chronik in der "Schönen Melusina"
und den der frommen Legende in der "Genoveva", in "Robert
dem Teufel" und im "Kaiser Oktavianus". Beim "Doktor Faustus"liegt
die Versuchung, sich an Goethe zu halten, außerordentlich nahe, aber
Schwab überwindet sie und folgt dem Widmannschen und dem Pfizerschen
Faustbuche Er behält aber nicht die den Leser nur verwirrende Namensform
Mephostophiles bei, sondern setzt an ihre Stelle das durch Goethe
in der Weltliteratur eingebürgerte Mephistopheles. In solchen Einzelheiten
zeigt sich eben ein sicherer Takt, der genau fühlt, wann das Alte
und wann das Neue am Platze ist.
Wirklich vollendet wurde Schwabs Werk aber erst 1859, also fast ein
Jahrzehnt nach seinem Tode. Damals erschien die vierte Auflage, illustriert
von einer Gruppe von Zeichnern, die zur Düsseldorfer Historienmalerei
gerechnet werden und sich um Eduard Bendemann, den Illustrator
der Nibelungen scharten. Die Führung haben unter diesen Künstlern
Adolf Ehrhardt und Oskar Pletsch, die zusammen über hundert Zeichnungen
für die "Deutschen Volksbücher" geliefert haben. Vor den unzähligen
Melusinen, die uns die deutschen Maler geschenkt haben, zeichnet
sich die Ehrhardts durch Schwung und leidenschaftliche Bewegtheit glänzend
aus. Im "Kaiser Oktavianus"hat Ehrhardt die grotesken Episoden
besonders liebevoll behandelt und namentlich den Gegensatz zwischen ängstlichen
Bürgern und kriegerischen Adligen famos herausgearbeitet. Dazu
gesellt sich Theodor Grosses Turnierbild, das sofort ahnen läßt, wie viele
Schlösser dieser Maler mit seinen Fresken geschmückt hat. Die gestaltenreichen
Bilder Anton Dietrichs zeigen, daß er auch hier mit seinem Meister,
Schnorr von Carolsfeld, wetteifert. Dagegen ist Wilhelm Camphausen
, der so gern kämpfende Ritter und stolze Rosse gemalt hat, der
berufene Zeichner für die nie endenden Raufhandel der "Vier Haimonskinder"
und für "Robert den Teufel". Sogar wenn der gewalttätige
Robert reuig vor seiner Mutter steht und sein Schicksal hört; blickt sein
treues Roß verwundert zum Fenster herein. Camphausen fühlt sich aber
auch in das Legendarische ein und stellt prachtvoll den Erzengel Michael
mit dem Flammenschwerte über den besiegt in den Abgrund stürzenden
Satan. Man hebt heute gern hervor; daß die Düsseldorfer Historienmaler
ihr Bestes nicht in Wandgemälden, sondern in der Buchillustration
geleistet haben. Dann ist es aber an der Zeit, diese Leistungen wieder zugänglich
zu machen, wie das in dieser Ausgabe der "Deutschen Volksbücher"
geschieht. In ihr finden sich nicht nur Bilder von Festen und Turnieren,
Kämpfen und Schlachten, sondern der bürgerlich-bäuerliche Teil
der Erzählungen kommt genau so schön zur Darstellung. Der Humor,
über den Oskar Pletsch verfügte, zeigt sich in gleicher Drolligkeit im Bilde
des alten Zauberers, der sich des Schlosses aus der Höhle Xa Xa wieder
bemächtigt hat, wie in der Begegnung der beiden Schweinehirten in den
"Schildbürgern". Man merkt hier und in den amüsanten Bildern zum
"Fortunat"besonders deutlich, wie nahe Pletsch der Kunst Ludwig Richters
, den er verehrte, in seinen besten Leistungen gekommen ist. Besonders
begabt als Jugendzeichner war Theobald von Oer, der Freund Robert
Reinicks. Er hat die Kämpfe Herzog Ernsts gegen Riesen und Kranichköpfe
kindlich gemütvoll illustriert.
So macht das Gesamtwerk durchaus den Eindruck, als ob es die Künstler
unter sich aufgeteilt hätten, damit jeder das ihm Zusagende schaffen
könne. Trotz aller Verschiedenheiten im einzelnen ist aber doch ein einheitlicher
Stil da, der eben in der allen Romantikern gemeinsamen liebevollen
Achtung vor der Vorstellungswelt des ausgehenden Mittelalters
wurzelt. In dieser warmherzigen Auffassung sind sie völlig einig mit
Gustav Schwab, so daß nichts in den Volksbüchern störend oder erzwumgen
wirkt. Unsere Ausgabe folgt daher im Text und in den Illustrationen
genau der Ausgabe von 1859, die als die klassische Gestalt der Deutschen
Volksbücher gelten muß.