|
Deutsche Kinder- und Hausmärchen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bearbeitet und mit einer Einführung versehen
von Karl Rauch |
Lizenzausgabe mit Genehmigung von Interbooks, Zürich
für Verlag Olde Hansen, Hamburg
für Bertelsmann Reinhard Mohn OHG. Gütersloh
die Europäische Bildungsgemeinschaft Verlags-GmbH, Stuttgart
und die Buchgemeinschaft Donauland, Kremayr & Scheriau, Wien
Diese Lizenz gilt auch für die Deutsche Buch-Gemeinschaft
C. A. Koch's Verlag Nachf., Berlin -Darmstadt -Wien
Schutzumschlag- und Einbandgestaltung R. Merke
Gesamtherstellung Mohndruck Reinhard Mohn OHG, Gütersloh
Printed in Germany Buch-Nr. 08692 6 |
DEUTSCHE MÄRCHEN
VOR DEN BRÜDERN GRIMM
Das Erdkühlein
Ein guter armer Mann hatte ein Frau und von ihr zwei Töchterlein, und ehe diese Kindlein, deren das kleinere Margaretlein und das größere Annelein hieß, erwachsen waren, starb ihm die Frau, und er nahm eine andere. Nun warf diese Frau einen Neid auf das Margaretlein und hätte gerne gewollt, daß es tot wäre gewesen, doch es selbst umzubringen däuchte sie nicht gut, und so zog sie mit Listen das ältere Maidlein an sich, daß es ihr hold und der Schwester feind ward.
Und einmal begab sich, daß die Mutter und die ältere Tochter beieinander saßen und beratschlagten, wie sie ihm doch tun wollten, daß sie des Maidleins abkämen, und beschlossen endlich, daß sie miteinander wollten in den Wald gehen und das Maidlein mitnehmen, und in dem Wald wollten sie das Maidlein verschicken, daß es nicht mehr zu ihnen kommen könnte.
Nun stand das Maidlein vor der Stubentür und hörte alle die Worte, so seine Mutter und Schwester wider es redeten und Ursach zu seinem Tod suchten; da war es sehr betrübt, ohn alle Ursach so jämmerlich zu sterben und von den Wölfen zerrissen zu werden. Und also betrübt ging es zu seiner Dotten oder Göttel, die es aus der Taufe gehoben hatte, und klagte ihr die große Untreu und das mörderische Urteil, so über sie von der Schwester und Mutter geschehen. »Nun wohlan«, sprach die gute alte Frau, »mein liebes Kind, dieweil dein Sach ein solche Gestalt hat, so gehe hin und nimm Sägemehl
und, wenn du deiner Mutter nachgehst, streue es vor dir anhin! Laufen sie hernach schon vor dir, so geh du der selbigen Spur nach, so kommst du wieder heim.«Die gute Tochter tat, wie ihr die alte Frau befohlen hatte. Und wie sie hinaus in den Wald kamen, setzte sich ihre Mutter nieder und sagte zum ältern Maidlein: »Komm her, Annelein, und such mir ein Laus! So geht dieweil das Gretlein hin und klaubt uns drei Bürden Holz; so wollen wir hier seiner warten, danach gehn wir miteinander heim.«
Nun das gute arme Töchterlein zog hin und streute vor sich anhin das Sägemehl (denn es wußte wohl, wie es ihm gehen würde) und sammelte drei Bürden Holz. Und als es diese gesammelt, nahm es sie auf den Kopf und trug sie an das Ende, da es seine Stiefmutter und Schwester gelassen hatte. Als es aber hin kam, fand es sie nicht; es behielt doch seine drei Büschlein auf dem Kopf, zog seinem gemachten Weg nach wieder heim und warf die drei Büschlein ab. Und als es die Mutter sah, sprach sie zum Maidlein: »Annelein, unsere Tochter ist wiedergekommen, und all unsere Kunst ist umsonst gewesen. Drum wollen wir morgen an eine andere Stelle gehen und das Maidlein wieder von uns schicken; so wird es nicht mehr mögen heimkommen, dann sind wir hernach sein ledig.«
Nun hatte das gute Margretlein diese Wort abermals gehört, lief wieder zu seiner Göttel und zeigte ihr die Handlung an. »Wohlan«, sprach die Frau, »ich sehe wohl, daß sie dir nach deinem Leben stellen und nicht Ruh haben werden, bis sie dich umbringen. Darum so geh jetzt hin und nimm Spreu und streu diese abermals vor dir hin, wie du mit dem Sägemehl getan hast! So kannst du wieder heimkommen.«
Als nun das Maidlein wieder heim kam, sagte seine Mutter: »Kommet her, Gretlein und Annelein! Wir wollen in den Wald gehn.«Das ältere Maidlein, als das um alle Sach gar wohl wußte, auch Hilfe und Rat dazu getan hatte, zog ganz fröhlich, Gretlein dagegen ganz traurig hinaus. Und als sie in den Wald kamen, setzte sich die böse, arglistige,
zernichtige Frau nieder und sagte zum Annelein: »Komm her, Annelein, und fang mir ein Laus! Da geht das Gretlein hin und sucht dieweil jeglichem eine Bürde Holz; danach gehn wir wieder heim.« Das arme Gretlein ging hin und suchte Holz, und ehe es wieder kam, waren Mutter und Schwester hinweg. Nun ging das gute Gretlein mit seinem Holz der Spreu nach, bis es wieder daheim ankam. Und als es von seiner Mutter gesehen ward, sagte diese zum Annelein: »Unser elend Maidlein kommt wieder. Nun wollen wir sehen, wie wir sein abkommen, und sollt es uns auch etwas Großes kosten. Und wir wollen morgen wieder in den Wald; da wollen wir sehen, daß es dahinten bleib.«Solche Rede hatte das Maidlein abermals gehört und ging zum drittenmal zu seiner Basen, fragte um Rat, was es tun sollte. »Nun wohlan, liebs Kind«, sagte die Frau, »so geh hin und nimm Hanfsamen, säe den vor dir anhin, darnach geh dem selbigen nach wieder heim!«
Das gute Maidlein zog abermals mit seiner Mutter und Schwester in den Wald und säte den Hanfsamen vor sich hin. Nun sagte die Mutter abermals, wie sie schon zweimal gesagt hatte: »Annelein, such mir ein Laus! So muß das Gretlein Holz suchen.«
Das arme Gretlein zog hin und suchte Holz, gedachte dabei: Bin ich vor zweimal wieder heim kommen, so will ich das drittmal auch wieder heim kommen. Und als es das Holz gesucht hatte und wieder zu der Stelle kam, da es seine Mutter gelassen, waren sie abermals hinweg. Und als das arme Maidlein seinem Weg nach wollte heimgehn, da hatten die Vögel den Samen allensammen aufgefressen. Ach Gott, wer war da trauriger denn das arme Maidlein! Es lief den ganzen Tag im Wald herum mit Weinen und Schreien und Gott sein Leid klagen, konnte keinen Weg finden, der es möchte aus dem Wald bringen, war auch in den Wald so fern hinein kommen, da ohne Zweifel nie kein Mensch gewesen. Als nun der Abend herzu kam und das arme verlassene Maidlein an aller Hilf verzweifelt hatte, stieg es auf einen sehr hohen Baum, um auszuschauen, ob es
doch irgendwo eine Stadt, ein Dorf oder Haus erkennen möchte, darein es ginge, damit es nicht also jämmerlich den wilden Tieren zur Speis gegeben würde. In solchem Umsehen begab sich, daß es ein kleines Räuchlein erspähte; stieg behende ab von dem Baum und ging demselbigen Rauch zu und kam in wenig Stunden an die Stelle, von da dann der Rauch ausging. Das war ein kleines Häuslein, darin niemand wohnte denn nur ein Erdkühlein.Das Maidlein kam vors Türlein, klopfte an und begehrte, man möge es einlassen. Das Erdkühlein antwortete: »Ich lass' dich wahrlich nicht herein, du versprichst mir denn, dein Lebtag bei mir zu bleiben und mich nimmermehr zu bereden und zu verraten!« Das gelobte ihm das Maidlein, und alsbald ward es von dem Erdkühlein eingelassen. Und das Erdkühlein sagte: »Wohlan, du darfst nichts tun, als mich des Abends und Morgens melken. Darnach issest du die selbige Milch von mir, so will ich dir Seiden und Sammet genug zutragen: davon mach dir schöne Kleider, wie du sie begehrest! Gedenk aber und siehe, daß du mich nicht verratest! Wann schon deine eigne Schwester zu dir kommt, so laß sie nicht herein, damit ich nicht verraten werd, daß ich an diesem End sei! Sonst hätt ich das Leben verloren.«
Dann ging es nach solchen Worten an seine Weide und brachte dem Maidlein des Abends, wann es heim kam, Seiden und Sammet, davon sich das gute Gretlein so schön kleidete, daß es sich wohl einer Fürstin hätte vergleichen mögen.
Als sie nun bis in das andere Jahr also beieinander gewesen waren, begab es sich, daß dem größern Maidlein, so daheim blieben war und das junge Gretlein, sein Schwesterlein, ohn alle Schuld hatte helfen in das Elend verjagen, in Gedanken darüber kam, wie es wohl seinem Schwesterlein gehen möge, das sie hatte helfen ins Elend verjagen; es hub kläglich an zu weinen und die große Untreu zu bedenken, die sie ihr ohn alle Schuld bewiesen hatte, kam in Summa in ein solche Reue, daß sie nicht mehr bleiben konnte oder mochte, sondern sehen wollte, ob sie doch irgendein Beinlein von ihrem Schwesterlein
finden möchte, damit sie das selbige heim trüge und es in Ehren hielte.Und eines Tags ging sie morgens früh hinaus in den Wald und suchte und trieb solch Suchen mit kläglichem Weinen so lang, bis sie sich im Wald ganz und gar verlaufen und verirret hatte und nun die finstere Nacht ihr auf dem Hals lag. Wer war da trauriger denn das Annelein? Da mußte es gedenken, daß es solches wohl an seiner Schwester verdient hatte, weinte kläglich, rief Gott um Gnad und Verzeihung an und bat. Doch war da nicht lang zu warten oder zu klagen, sondern sie stieg zunächst auf einen sehr hohen Baum, zu besichtigen, ob es doch irgendein Haus sehen möchte, darin es über Nacht bliebe, damit es nicht also jämmerlich von den wilden Tieren zerrissen würde. Und in solchem Umsehen ersah es einen Rauch aus dem Häuslein gehn, darin seine Schwester war; von Stund an ging sie dem Haus zu und meinte nicht anders, denn daß es eines Hirten oder Waldbruders Häuslein wäre.
Und als es zu dem Haus kam, klopfte es an; wo es bald von seiner Schwester, wer da wäre, gefragt ward. »Ei«, sprach das Annelein, »ich bin ein armes Maidlein und im Wald verirret und bitte, daß man mich durch Gottes Willen über Nacht behalte.« Das Gretlein sah durch ein Spältlein hinaus und erkannte, daß es seine untreue Schwester war, hub bald an und sprach: »Wahrlich, liebs Maidlein, ich darf dich nicht herein lassen; denn es ist mir verboten. Wann sonst mein Herr käm und ich jemand Fremdes hätte einher gelassen, so würde er mich schlagen. Drum ziehe fort.« Das arme Maidlein wollte sich nicht lassen abreden noch vertreiben, sondern lag mit Bitten seinem unerkannten Schwesterlein an, daß es ihm die Tür auftäte und es hinein ließ.
Und als es hinein kam, erkannte es seine Schwester, fing an heiß zu weinen und Gott zu loben, daß es sie noch lebendig gefunden hatte, fiel nieder auf seine Knie und bat sie, daß sie ihm verzeihen möge alles das, so es wider sie getan. Darnach bat sie freundlich, daß sie ihr doch sagen möge, wer bei ihr wär, daß sie so schön und wohl
gekleidet ginge. Das gute Gretlein, dem verboten war, zu sagen, bei wem es wäre, erfand mancherlei Ausred; einmal sagte es, es wäre bei einem Wolf, das andermal, bei einem Bären. Welches alles das Annelein nicht glauben wollte und dem Gretlein, seinem Schwesterlein, süß zuredete, ihr die Wahrheit zu sagen. Und das Maidlein war nun auch (wie denn aller Weiber Brauch und Gewohnheit ist, daß sie mehr schwätzen, als ihnen befohlen ist) sehr geschwätzig und sagte zu seinem Schwesterlein: »Ich bin bei einem Erdkühlein. Aber lug, verrat mich nicht!«Als solches das Annelein gehört, welches seiner Untreu an der Schwester noch kein Genügen getan hatte, sagte es: »Wohlan, führ mich wieder auf den rechten Weg, damit ich heim komme!« Das tat das Gretlein bald. Und da mein guts Annelein heim kam, sagte es seiner Mutter, wie sie ihre Schwester bei einem Erdkühlein gefunden hätte und wie die so köstlich gekleidet ginge. »Wohlan«, sprach die Mutter, »so wollen wir die zukünftig Wochen hinaus ziehen und das Erdkühlein samt dem Gretlein heim führen; so wollen wir das Kühlein metzgen und essen.«
Alles das wußt das Erdkühlein wohl, und als es des Abends spät heim kam, sagt es weinend zum Maidlein: »Ach, ach, mein allerliebsts Gretlein, was hast du getan, daß du dein falsche Schwester hast eingelassen und ihr gesagt, bei wem du bist? Und nun siehe, deine zernichte Mutter und Schwester werden die zukünftige Woche heraus kommen und mich und dich heim führen. Mich werden sie metzgen und essen, dich aber bei sich behalten, wo du übler gehalten werden wirst denn zuvor.«
Nach solchen Reden stellte sich das Erdkühlein so kläglich, daß das arme Maidlein anfing zu weinen und vor Traurigkeit zu sterben vermeinte und bitter bereute, daß es seine Schwester hatte eingelassen. Doch tröstete es das Erdkühlein und sprach: »Nun wohlan, liebs Maidlein, dieweil es je geschehen ist, so kann es nicht wieder zurückgetrieben werden. Darum tu ihm also: Wann mich der Metzger jetzt geschlagen hat, so stehe und weine! Wann er dich dann fragt,
was du willst, so sprich: >Ich wollt gern meins Kühleins Schwanz.< Den wird er dir geben. Wann du den hast, so fang aber an zu weinen und begehre das eine Horn von mir! Wann du das selbige auch hast, so weine aber! Wann man dich dann fragt, was du willst, so sprich: >Ich wollt gern meins Kühleins Schühlein.<Wann du das hast, so geh hin und setz den Schwanz in die Erden, auf den Schwanz das Horn, und auf das Horn setz das Schühlein und geh nicht wieder hinzu bis an den dritten Tag! Und am dritten Tag wird ein Baum daraus worden sein; er wird Sommer und Winter die schönsten Äpfel tragen. Und niemand wird sie können abbrechen denn du allein, und durch den selbigen Baum wirst du zu einer großen mächtigen Frauen werden.«Als man nun das Kühlem geschlachtet, stund das Margaretlein und begehret die Ding alle, wie ihm sein Kühlem befohlen hatte, und die wurden ihm auch gegeben. Und es ging hin, stecket's in die Erden, und am dritten Tag war ein schöner Baum daraus gewachsen. Nun begab es sich, daß ein gewaltiger Herr vorbei ritte; der selbige führte seinen Sohn mit sich, der das Fieber oder kalte Wehe hatte. Und als der Sohn die schönen Äpfel sah, sprach er: »Mein Herr Vater, lasset mir Äpfel bringen von diesem Baum; mir ist, ich würde gesund davon werden.« Von Stund an rief der Herr, man sollt ihm Äpfel bringen, er wollt sie teuer genug bezahlen.
Die ältere Tochter ging zunächst zum Baum und wollte Äpfel davon brechen. Da zogen sich die Äst alle zusammen in die Höhe, also daß sie keinen erlangen konnte. Da rief sie der Mutter und sprach, sie sollte Äpfel abbrechen und sie dem Herrn geben; als aber die arge Frau Äpfel abbrechen wollt, zogen sich die Äst noch viel höher auf. Der Herr hatte das alles wohl gesehen und verwunderte sich heftig. Und zuletzt kam das Margretlein zum Baum, Äpfel zu brechen, zu dem sich die Äste neigten und es willig Äpfel abbrechen ließen; das verwunderte den Herren noch viel mehr, und er meinte, sie wäre vielleicht ein heilige Frau, rief sie und fragte sie des Wunders. Dem erzählte die gute Tochter die ganze Handlung, was sich ihrer Mutter,
Schwester und des Erdkühleins halber begeben hatte, von Anfang bis zu End.Der Herr, als er die Sach vernommen hatte, fragte die Jungfrau, ob sie mit ihm davon wollte. Das war die gute Tochter wohl zufrieden, grub ihren Baum aus und setzte sich samt ihrem Vater auf den Wagen zudem Herrn; von dem wurden sie freundlich und ehrlich empfangen, fuhren hin und ließen ihr schalkhaftige Mutter und Schwester sitzen.
Die Padde
Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne; es lebte aber zur selben Zeit eine alte Frau, die hatte nur ein Töchterlein, das Petersilie hieß. Der König schickte seine Söhne aus, um sich in der Welt umzusehen, seine und fremde Lande kennenzulernen, um so weise genug zu sein, dereinst ihr Erbteil beherrschen zu können; die alte Frau aber lebte still und zurückgezogen mit ihrem Töchterlein, das ihren Namen davon hatte, daß es Petersilie lieber als alle andere Speise aß, ja einen rechten Heißhunger danach hatte. Die arme Mutter hatte nicht Geld genug, immer und immerfort Petersilie für die Tochter zu kaufen, und es blieb ihr daher nichts übrig, da das Töchterlein gar zu schön war und sie auf keine Weise ihrer Schönheit nachteilig sein wollte, als nächtlich aus dem Garten des gegenüberliegenden Jungfrauenklosters die schönsten Petersiienwurzeln zu entwenden und das Töchterchen damit zu füttern. Das Gelüst der schönen Petersilie war aber keineswegs unbekannt, ebensowenig blieb der Diebstahl verborgen, und die Äbtissin war über ihre schöne Nachbarin nicht wenig erzürnt.
Die drei Prinzen kamen auf ihrer Wanderung auch in das Städtchen, wo Petersilie mit ihrer Mutter wohnte, und gingen gerade durch die Straße, als das schöne Mägdlein am Fenster stand und ihre langen, wunderprächtigen Haare kämmte und flocht. Entzündet von Liebe,
stieg in einem jeden der Wunsch auf, die Schöne zu besitzen, und kaum war der Wunsch über die Lippen gekommen, als auch ein jeglicher in blinder Eifersucht seinen Säbel zog und auf seinen brüderlichen Mitbewerber losging. Der Kampf ward nicht wenig heftig, auch die Äbtissin trat an die Pforte, und kaum hatte die fromme Frau gehört, daß ihre Nachbarin die Ursache sei, als aller Grimm, früherer und späterer, sich in ihr zu der Verwünschung sammelte: sie wünschte, daß Petersilie in einen häßlichen Frosch verwandelt werde und unter einer Brücke am entferntesten Ende der Erde sitze. Kaum ausgesprochen, ward Petersilie ein Frosch und war verschwunden. Die Prinzen, die nun keinen Gegenstand des Kampfes hatten, steckten ihre Degen ein, umarmten sich wieder brüderlich und zogen heim zu ihrem Vater.Der alte Herr merkte indessen, daß er stumpf und schwach in den Regierungsgeschäften ward, und wollte daher das Reich abtreten; aber wem? Dazu konnte sich sein väterliches Herz nicht entschließen, unter den drei Söhnen zu wählen; das Schicksal sollte es bestimmen, und er ließ sie daher vor sich kommen. Meine lieben Kinder, sprach er, ich werde alt und schwach und will meine Regierung niederlegen, kann mich aber nicht entschließen, einen von euch zu wählen, da ich euch alle drei gleich zärtlich liebe und denn doch auch dem Besten und Klügsten von euch mein Volk übergeben möchte. Ihr sollt mir daher drei Aufgaben lösen, und wer sie mir löst, der soll mein Erbe sein. Das erste ist: ihr müßt mir ein Stück Leinewand von hundert Ellen bringen, das man durch einen goldenen Ring ziehen kann. —Die Söhne verneigten sich, versprachen, ihr möglichstes zu tun, und machten sich auf die Reise.
Die beiden ältern Brüder nahmen viel Gefolge und viel Wagen mit, um alle die schöne Leinewand, die sie finden würden, aufzuladen; der jüngste ging ganz allein. Bald kamen drei Wege, zwei lustig und trocken, der dritte düster, feucht und schmutzig. Die beiden ältern Brüder nahmen die beiden ersten Wege; der jüngste nahm Abschied von ihnen und schlenderte den düstern Weg entlang. Wo nur schöne
Leinewand war, besahen sie die ältern Brüder und erstanden sie, ihre Wagen krachten unter der Last, und wo nur irgend der Ruf sie hinwies, dahin eilten sie auch und kauften; sie kehrten reich versehen zurück. Der jüngste dagegen ging mehrere Tagereisen auf seinem unwirtlichen Wege fort. Nirgend wollte ihm ein Ort erscheinen, in dem er auch nur eine erträglich feine Leinewand gefunden, und so reiste er lange und ward immer mißmutiger.Einst kam er an eine Brücke, setzte sich an dem Rande nieder und seufzte recht tief über sein böses Schicksal. Da kroch eine mißgestaltete Padde aus dem Sumpf hervor, stellte sich vor ihn und fragte mit nicht ganz übel tönender Stimme, was ihm denn fehle. Der Prinz, unwillig, antwortete: »Frosch, du wirst mir nicht helfen.« — »Und doch«, erwiderte der Frosch, »sagt mir nur Eure Leiden.« — Nach mehrern Weigerungen erklärte endlich der Prinz die Ursache, warum ihn sein Vater ausgesendet habe. »Dir soll geholfen werden«, sagte die Padde, kroch in ihren Sumpf zurück und zerrte bald ein Läppchen Leinewand, nicht größer als eine Hand und nicht eben zum saubersten aussehend, hervor, das sie vor den Prinzen niederlegte und ihm andeutete, er solle es nur nehmen. Der Prinz hatte gar keine Lust, ein so übel scheinendes Läppchen anzunehmen, doch lag etwas in den Zuredungen der Padde, das ihn bereitwillig machte, und er dachte: Etwas ist immer noch besser als gar nichts, steckte daher sein Läppchen ein und empfahl sich dem Frosche, der mühsam sich wieder ins Wasser schob.
Je weiter er ging, je mehr merkte er zu seiner Freude, daß ihm die Tasche, in der er das Läppchen gesteckt hatte, immer schwerer ward, und er wanderte daher mutvoll auf den Hof seines Vaters zu, den er auch in kurzem erreichte, als eben auch seine Brüder mit ihren Frachtwagen wieder anlangten. Der Vater war erfreut, seine drei Kinder wiederzusehen, zog sogleich seinen Ring vom Finger, und die Probe begann. Auf all den Frachtwagen war auch nicht ein Stück, das nur zum zehnten Teile durch den Ring gegangen wäre, und die beiden ältern Brüder, die erst ziemlich spöttisch auf ihren Bruder,
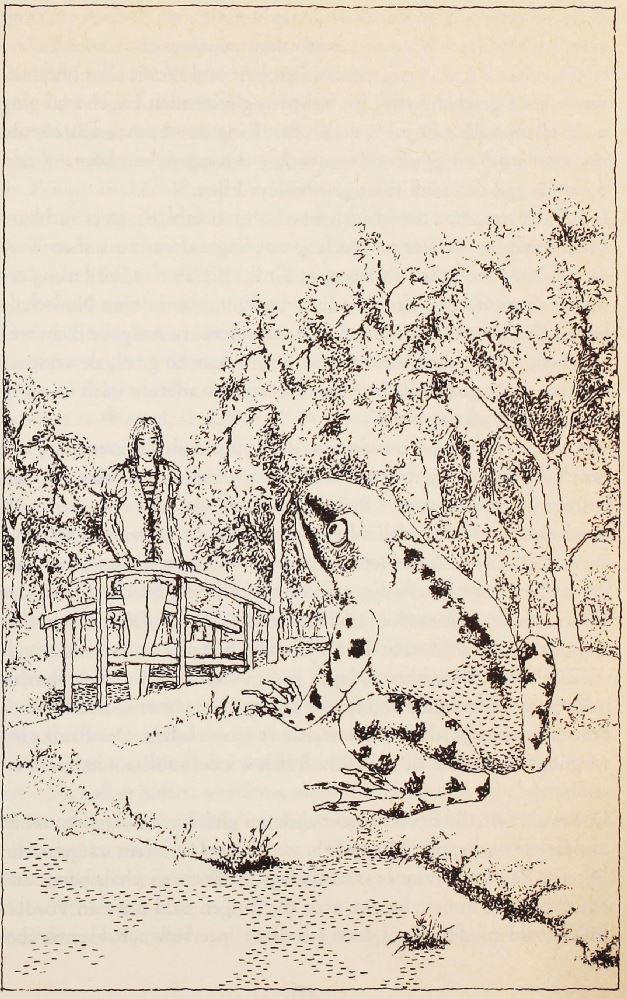
Der Vater umarmte den glücklichen Sohn, befahl, die unbrauchbare Leinewand ins Wasser zu werfen, und sagte dann zu seinen Kindern: »Nun, ihr lieben Prinzen, müßt ihr die zweite Forderung erfüllen; ihr müßt mir ein Hündlein bringen, das in eine Nußschale paßt.«Die Söhne waren über eine so wunderbare Aufgabe nicht wenig erschrocken, aber der Reiz der Krone war zu groß, sie versprachen, auch dies zu erfüllen zu suchen, und wanderten nach wenigen Tagen Ruhe wieder aus.
Am Scheidewege trennten sie sich; der Jüngste ging seinen feuchten, unscheinbaren Weg, er hatte schon bei weitem mehr Mut. Kaum hatte er einige Zeit an der Brücke gesessen und wieder geseufzt, so kroch auch die Padde wieder hervor, setzte sich ihm wie das erstemal gegenüber, öffnete den weiten Mund und fragte, was ihm denn fehle. Der Prinz setzte diesmal keinen Zweifel in die Macht der Padde, sondern gestand ihr gleich sein Bedürfnis. »Dir soll geholfen werden«, sagte wiederum die Padde, kroch in den Sumpf und brachte ein Haselnüßlein hervor, legte es ihm vor die Füße, sagte ihm, er solle es nur mitnehmen und seinen Herrn Vater bitten, die Nuß sauber auf zuknacken, das andere werde er schon sehen. Der Prinz ging vergnügt fort, und die Padde schob sich wieder mühsam in das Wasser hinab.
Daheim waren die Brüder auch schon zu gleicher Zeit angekommen und hatten eine große Menge sehr zierlicher Hündlein mitgebracht. Der alte Vater hatte eine beträchtlich große Walnußschale bereit und schob jedes Hündlein hinein, aber die hingen bald mit den Vorderfüßen, bald mit dem Kopf, bald mit den Hinterfüßen, bald ganz über
die Walnußschale fort, so daß gar nicht daran zu denken war, daß ein Hündlein hineingepaßt hätte. Als nun kein Hund mehr zu proben übrig war, überreichte der Jüngste mit einer zierlichen Verbeugung dem Vater seine Haselnuß und bat, sie auf das behutsamste auf zuknacken. Kaum hatte der alte König es getan, als aus der Haselnuß ein wunderkleines Hündlein sprang, das gleich auf der Hand des Königs umherlief, mit dem Schwänzlein wedelte, ihm schmeichelte und gegen die andern auf das zierlichste bellte.Die Freude des Hofes war allgemein, der Vater umarmte wieder den glücklichen Sohn, befahl abermals, die andern Hunde ins Wasser zu werfen und zu ersäufen, und sagte dann zu seinen Söhnen: »Liebe Kinder, die beiden schwierigsten Bedingnisse sind nun erfüllt; hört nun mein drittes Verlangen: wer die schönste Frau mir bringt, der soll mein Erbe und Nachfolger sein.« Die Bedingung war zu nahe, der Preis zu reizend, als daß die Prinzen nicht sogleich, jeder auf seinem gewohnten Wege, wieder hätten aufbrechen sollen.
Dem Jüngsten war diesmal gar nicht wohl zumute. Er dachte: Alles andere hat der alte Frosch wohl erfüllen können, aber nun wird's vorbei sein; wo wird er mir ein schönes Mädchen und noch dazu das schönste herschaffen können! Seine Sümpfe sind fern und breit menschenleer, und nur Kröten, Unken und anderes Ungeziefer wohnt dort. Er ging indessen doch fort und seufzte diesmal aus schwerem Herzen, als er wieder an der Brücke saß. Nicht lange danach stand die Padde wieder vor ihm und fragte, was ihm fehle. »Ach, Padde, diesmal kannst du mir nicht helfen; das übersteigt deine Kräfte.« — »Und doch«, erwiderte der Frosch, »sagt mir nur Euer Leiden.« —Der Prinz entdeckte ihm endlich seine neuen Leiden. »Dir soll geholfen werden«, sagte wieder der Frosch, »gehe du nur voran, die Schöne wird dir schon folgen; aber du mußt über das, was du sehen wirst, nicht lachen.« —Darauf sprang er, wider seine Gewohnheit, mit einem herzhaften Sprunge weit ins Wasser hinein und verschwand.
Der Prinz seufzte wiederum recht tief, stand auf und ging fort; denn
er erwartete nicht viel von dem Versprechen. Kaum hatte er einige Schritte gemacht, so hörte er hinter sich ein Geräusch; er blickte sich um und sah sechs große Wasserratzen, die in vollem Trabe einen Wagen, von Kartenpappe gemacht, hinter sich herzogen. Auf dem Bocke saß eine übergroße Kröte als Kutscher, hinten auf standen zwei kleinere Kröten als Bediente und zwei bedeutend große Mäuse mit stattlichen Schnurrbärten als Heiducken, im Wagen selbst aber saß die ihm wohlbekannte dicke Padde, die im Vorbeifahren etwas ungeschickt, aber doch möglichst zierlich ihm eine Verbeugung machte.Viel zu sehr in Betrachtungen vertieft von der Nähe seines Glückes und wie ferne er nun sei, da er die schönste Schöne nicht finden würde, betrachtete der Prinz kaum diesen lächerlichen Aufzug; noch weniger hatte er gar Lust, zu lachen. Der Wagen fuhr eine Weile vor ihm her und bog dann um eine Ecke. Wie ward ihm aber, als bald darauf um dieselbe Ecke ein herrlicher Wagen rollte, gezogen von sechs mächtigen schwarzen Pferden, regiert von einem wohigekleideten Kutscher, und in dem Wagen die schönste Frau, die er je gesehen und in der er sogleich die reizende Petersilie erkannte, für die sein Herz schon früher entbrannt war. Der Wagen hielt bei ihm stille. Bediente und Heiducken, aus der Tiergestalt entzaubert, öffneten ihm den Wagen, und er säumte nicht, sich zu der schönen Prinzessin zu setzen.
Bald kam er in der Hauptstadt seines Vaters an, mit ihm seine Brüder, die eine große Menge der schönsten Frauen mit sich führten; aber als sie vor den König traten, erkannte sogleich der ganze Hof der schönen Petersilie den Kranz der Schönheit zu. Der entzückte Vater umarmte seinen Sohn als Nachfolger und seine neue Schwiegertochter; die anderen Frauen wurden aber alle, wie der Leinewand und den Hündlein geschehen war, ins Wasser geworfen und ersäuft. Der Prinz heiratete die Prinzessin Petersilie, regierte lange und glücklich mit ihr, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch.
Der Riesenwald
Schon seit zehn Jahren hatte König Johannes auf einen Sohn gehofft, der den Glanz seines Thrones erhalten und noch mehr befestigen möchte; aber alle seine Wünsche, seine Hoffnungen waren umsonst: die sonst so schöne, kluge und tugendhafte Mathilde, seine geliebte Gemahlin, blieb unfruchtbar. Jeder Tag machte das königliche Ehepaar unglücklicher; jeder Abend fand die holde Frau in Tränen, und um ihre Leiden zu vermehren, erhielt der König die Nachricht, daß die Gemahlin seines Bruders von einem Prinzen entbunden sei. Seit dieser Stunde entfloh aller Friede aus der königlichen Burg: hart behandelte er die Liebenswürdigste ihres Geschlechtes, seine Vorwürfe zerrissen täglich ihr Herz mehr, und sie entschloß sich endlich, eine Wallfahrt nach Palästina zu tun und durch prächtige Opfer und demütige Gebete das Herz der heiligen Jungfrau zu erweichen. Sie eröffnete dies kaum ihrem Gemahl, als er auch voller Freuden seine Einwilligung dazu gab und ihr alles zu ihrem Bedarf aufs prachtvollste einrichten ließ. Sie bekam ein großes glänzendes Gefolge und königliche Geschenke, und so reiste sie, mit den besten Segnungen ihres alten Gemahls reichlich versehen, schon nach einigen Wochen ab.
Glücklich und ohne alle Fährlichkeiten langte sie nach einer langen Reise zu Ende des Jahres in Loretto an. Ihre Schönheit und Demut gewann ihr gleich in den ersten Tagen ihres Aufenthalts aller Herzen, und die schlauen Priester merkten nicht sobald die kostbaren Geschenke, als man sie auch schon von dem großen Haufen der versammelten Pilger und Pilgerinnen unterschied und ihre frommen Gebete nach allen Kräften unterstützte. Gewöhnlich brachte sie die erste Morgenstunde, ehe noch ein anderer Pilger erwachte, vor dem Bilde der hochgelobten Jungfrau zu. Hier ergoß sie ihr Herz in Seufzern und Tränen, und hier war es, wo ihr die heilige Jungfrau mit sanfter Stimme Erhörung ihrer Bitte versprach. Sie brachte seit dieser Erscheinung auch täglich abends eine Stunde in der einsamen
Kapelle zu und schied mit vielem Kummer von einem jungen Geistlichen, der ihr Begleiter bei den Morgen- und Abendandachten gewesen war. Mit voller Gewißheit, daß ihr Gebet erhört sei, trat Mathilde ihre Rückreise an.Schon unterwegs empfand sie die Wahrheit der Gewährung; sie reiste daher mit verdoppelter Eile, sandte ihrem Gemahl diese so hochbeglückende Botschaft zum voraus und gebar ein paar Tage nach ihrer Rückkehr in seinen Armen eine Tochter, schön wie der junge Tag und lieblich wie die Morgenröte. Dieser neue Donnerschlag würde ohne allen Zweifel beide Eltern auf das tiefste gebeugt haben, wenn sie nicht sogleich sich durch die Hoffnung erheitert hätten, ihre Tochter mit dem Sohne ihres Bruders, des Königs Philipp, zu verbinden und so beide Reiche miteinander zu vereinigen. Sobald sie hierüber ganz einverstanden waren, wurde eine Gesandtschaft an König Philipp geschickt, die ihm die Entbindung seiner Schwägerin bekannt machte und zugleich den Antrag tat, diese beiden jungen Kinder miteinander zu verloben. Der König nahm die Gesandten sehr gnädig auf, er beschenkte sie sehr reichlich und gab ihnen ein versiegeltes Schreiben mit, worin er förmlich für seinen Sohn Friedrich um die kleine Aurora warb. Sobald die beiderseitigen Eltern alles hierzu Erforderliche unter sich abgemacht hatten, herrschte die größte Ruhe in der königlichen Burg, die zärtlichste Liebe und Einigkeit bei dem erhabnen Ehepaare, und die kleine Aurora wuchs ein ganzes Jahr zur größten Zufriedenheit ihrer Eltern auf.
Aber ein neuer Unfall zerrüttete diese Glückseligkeit auf lange Zeiten. Unfern dem Schlosse des Königs Johannes floß ein großer Strom in majestätischen Wellen dahin, seine diesseitigen Ufer waren reizend und einladend, und eine Insel dicht dem Ufer, vorzüglich grün und verlockend; angenehmer war kein Plätzchen im ganzen Königreich. Oft war der König schon mit seinem Gefolge nach diesem lieblichen Ort auf kleinen Kähnen gefahren. Schöner dünkte ihm hier der Gesang der Vögel, süßer dufteten die Blumen, und die kühlenden Lüfte glichen leichten Zephyrwinden. Das jenseitige
Ufer konnte niemand erblicken, die Entfernung war zu groß, und noch hatte es kein Sterblicher gewagt, die Wellen dieses reißenden Stroms mit einem kleinen Fahrzeuge zu durchschneiden. So blieb es unentdeckt, und da die Bewohner diesseits bei sehr hellem Wetter außerordentlich hohe Bäume zu sehen glaubten, nannten sie es scherzweise den Riesenwald und lebten unbekümmert um dessen Bewohner ruhig fort.An einem schönen, doch etwas schwülen Sommertag veranstaltete der König abermals eine kleine Wasserfahrt. Er bat die Königin, auch Teil daran zu nehmen, und fand sie um so williger dazu, da er ihr den Vorschlag machte, die kleine reizende Aurora und ihre Amme mit einzuschiffen. Gegen Abend begab sich das königliche Ehepaar in ein schön verziertes Fahrzeug, dann folgte in einem zweiten die Amme mit der Kleinen, und so kam das ganze Gefolge in mehr denn zwanzig Kähnen nach. Sie landeten glücklich und genossen mit vollen Zügen die erquickende Kühlung, die duftenden Schatten dicht verwachsener Bäume. Doch plötzlich mußten sie aufbrechen: der Himmel bezog sich mit düsteren Wolken, aus der Ferne hörte man das Rollen des Donners, der bläuliche Blitz war schon von Zeit zu Zeit sichtbar, und da die Schiffer des immer stärker werdenden Windes wegen besorgt waren, bestieg man rasch die Fahrzeuge und überließ sich etwas ängstlich dem schon unruhig wogenden Strom.
Vergebens strengten die Ruderer ihre Kräfte an, vergebens bot der König ansehnliche Belohnungen: noch ehe sie das Ufer erreichen konnten, erhob sich ein fürchterlicher Wirbelwind, der alle Kähne zerstreute, so daß der eine hier-, der andre dorthin flog. Das Fahrzeug des Königs landete zuerst, und nach Verlauf einer Stunde waren alle beisammen; nur das eine, das die Prinzessin und ihre Amme an Bord hatte, fehlte, und die Hofleute versicherten, daß sie das Fahrzeug hätten umstürzen sehen, worauf ihnen die Wiege mit der kleinen Aurora im Nu aus den Augen gewesen sei. Die arme Mutter war besinnungslos vor Schmerz, und der betrübte König wandte jedes
Mittel an, um sein geliebtes Kind den Wellen zu entreißen. Aber alles war umsonst! Die tiefe Dunkelheit der Nacht und der immer stärker werdende Orkan machten jedes Rettungsmittel unanwendbar, und der heftige Platzregen nötigte bald jedermann, in seine Wohnung zu flüchten.Indes die Stadt und das Schloß von Jammergeschrei und Wehklagen erscholl, trieb der Wind die Wiege der kleinen Aurora an das jenseitige Ufer, und eine Welle warf sie sonder Schaden ans Land. Wahrscheinlich wäre das süße Kind eine Speise der wilden Tiere geworden, wenn nicht in ebendem Augenblick die Riesenkönigin Tertulla am Ufer spazieren ging. Sie eilte auf das Geschrei der Kleinen herbei, und da sie und ihr Volk zu der menschenfressenden Gattung gehörten, schickte sie sich gerade an, ihren Kindern diesen Fund hinzutragen; aber indem sie Aurora betrachtete, öffnete sich ihr Herz dem Mitleid, und das liebliche Lächeln des Kindes gewann ihm vollends Tertullens Herz: sie nahm es in ihre Arme, liebkoste es und suchte das furchtsame Wesen zu beruhigen, das ängstlich umherblickte, aber weder seine liebenden Eltern noch seine gute Amme gewahr wurde.
Sie trug das Kind und seine Betten in ihre Höhle, und als am andern Tage der Riesenkönig mit seinen acht Söhnen von der Jagd zurückkehrte, bat sie ihn und diese flehentlich um Aurorens Leben, das man ihr um so leichter gewährte, da sie acht Söhne, aber keine Tochter hatte, und von diesem Augenblick an pflegte sie des Kindes als ihres eignen. Tertulla war zwar ein Riesenweib, aber ein gutes Weib, die nicht am glücklichsten mit ihrem Enakssohn lebte und die sich in Auroren eine Stütze für ihr Alter zu erziehen glaubte.
Die Kleine lohnte ihr täglich mit tausend Liebkosungen für ihre Mühe und hing so ganz allein an Tertullen, daß diese sie nur dann und wann bereden konnte, ihren Mann und ihre Söhne freundlich zu behandeln. Sie vermochte dies aber nur selten über sie; denn Aurora hatte einen so heftigen Abscheu gegen die Bewohner des Riesenwaldes, daß sie jede Gemeinschaft mit ihnen vermied. An dem
Ufer des für sie so unglücklichen Stroms hatte sie sich unter einigen schattigen Bäumen eine Hütte gebaut, worin sie manchen Tag zubrachte. Sehnsuchtsvoll sah sie nach dem jenseitigen Ufer, ohne zu ahnen, daß dort ein liebender Vater, eine zärtliche Mutter um sie trauerten; denn Tertulla ließ sie noch immer in dem Wahn, daß sie die Tochter einer armen Riesin sei, die sterbend sie ihr empfohlen habe, und wähnte, sie dadurch sehr zu beglücken, daß sie ihr den jüngsten ihrer Söhne zum Manne geben wollte, der ihr Liebling und, nach der Sitte des Landes, der Kronerbe war. Sosehr Aurora ihre Pflegemutter liebte, so schauderte sie doch jedesmal bei dem Gedanken zusammen, mit Oglu durch nähere Bande vereinigt zu werden. Sie war jetzt fünfzehn Jahre alt, und ihr Herz klopfte oft so unruhig, sie empfand ein ewiges Sehnen; aber noch war kein Gegenstand gefunden, der es nur verringern, geschweige denn stillen konnte.So ward sie jeden Tag tiefsinniger: Sie floh oft tagelang in die tiefste Einsamkeit des Waldes, erkletterte Felsen, durchkroch Höhlen und Strauchwerk und war endlich so glücklich, eine tief im Felsen verborgne Höhle zu entdecken, wo sie sich, vor jedem menschlichen Auge sicher, ganz ihren Empfindungen überlassen und weinen konnte.
Schon oft war Oglu ihr nachgeschlichen; er liebte das reizende Mädchen. Jedesmal hatte er sie entdeckt, aber hier blieb sie ungestört; in diese einsame Freistätte folgte ihr weder sein Tritt noch sein ihr so verhaßtes Auge. In Gedanken erkor sie diesen Ort zu ihrer Wohnung, wenn der Tag da wäre, an dem sie Oglus Frau werden sollte; hierher wollte sie fliehen, und sie richtete sich nach und nach völlig dort ein. So rauh und wild die Gegend um diese Höhle war, so angenehm und freundlich hatte Aurora das Innere ausgeputzt; jeden Tag schmückte sie die kahlen Felsenwände mit Blumenketten und bestreute ihr Lager mit weichem Moos. Einige Tierhäute, einen Vorrat von getrockneten Wurzeln schaffte sie unbemerkt hin, und sobald sie mit diesen Zubereitungen fertig war, nahm ihre Heiterkeit wieder zu. Sie war mehr um Tertullen, weilte öfter in ihrer Hütte am
Ufer des Stroms und verzögerte mit möglichster Klugheit ihre Heirat von einem Tage zum andern.Tertulla schüttelte zwar den weißen Kopf, aber sie konnte unmöglich ihrer geliebten Tochter etwas zuleid tun; sie bat Oglu selbst, Geduld zu haben, und besuchte Aurora häufiger in ihrer kleinen Hütte, die sie immer mit Blumen geschmückt und worin sie das Mädchen gleich einer Nymphe des Waldes auf wohlriechenden Kräutern ruhend fand. Gern verweilte sie bei ihr und unterrichtete sie in den geheimen Künsten der Zauberei: sie lehrte ihr, aus dem Lauf der Sterne künftige Dinge vorherzusehen, und zeigte ihr den Ort, wo das Wünschhütchen verborgen lag, zu dem sie aber nur dann ihre Zuflucht nehmen dürfte, wenn die höchste Not es ihr geböte. Das Mädchen war gelehrig: Sie faßte den Unterricht der alten Fee recht gut und schnell und setzte sie durch die Frage über ihr Schicksal in keine kleine Verlegenheit. Längst schon hatte Tertulla ihre Wissenschaft hierzu angewandt; aber sie sah jedesmal viele Gräber, Aurora in eines schönen Mannes Armen und sich selbst, mit fremden Gegenständen umgeben, als segnende Mutter. Sorgfältig verbarg sie dies ihrer Tochter und versicherte ihr, daß man nie die Schicksale seiner nahen Lieben erfahre und daß die Klugheit befehle, nie danach zu forschen; sie verbot es ihr nochmals aufs strengste und legte ihr zuletzt noch die Bitte ans Herz, recht bald die Gattin ihres Oglu zu werden. Aurora warf sich ihr mit Tränen an den Hals, und Tertulla schwieg, um sie nicht weiter zu kränken. Mehr denn je entzog sie sich Oglus und seiner Brüder Umgang, teils aus Ekel vor ihm selbst, teils aus Abscheu gegen ihre Lebensart.
Ein sehr heftiger Sturm hatte mehrere Tage gewütet; der Strom war so fürchterlich, wie ihn Aurora noch nicht gesehen, und die hohen wogenden Wellen warfen viele Menschen ans Land, welche die Riesen unter gräßlichem Frohlocken verzehrten. Eines Tages feierten die Riesen ein solches wildes Fest. Aurora ging nachdenklich am Ufer des Stroms auf und ab; sie beweinte die Unglücklichen, die ihren Tod in den Wellen fanden und dann zu einem Mahl dieser Unmenschen
dienten, als plötzlich die Wellen einen toten Körper zu ihren Füßen warfen. Sie erschrak anfangs heftig; aber als sie den Toten näher betrachtete und an ihm einen blassen, jedoch sehr schönen Jüngling fand, zog und trug sie ihn, so gut es gehen wollte, in ihre kleine Hütte, die zum Glück ziemlich nahe war, und empfand eine unendliche Freude, da ihm nach der heftigen Bewegung das Wasser stromweis aus dem Munde stürzte und nach einem Weilchen ein Paar große Augen sie mit sanfter Ermattung ansahen.Aurora kniete, vor Entzücken außer sich, neben ihm, drückte seine Hände an ihr Herz und rieb Wangen und Schläfen so lange, bis das Blut in seinen gehörigen Umlauf kam und ihr Feuer den blassen Jüngling ins Leben völlig zurückbrachte. Sobald er sich einigermaßen erholt hatte, stand er auf, kniete vor Auroren nieder und bemühte sich, ihr durch Mienen seine Dankbarkeit zu bezeigen. Froh über diese Erscheinung, glücklich durch den Besitz eines schönen lieben Wesens, zu dem sich ihr Herz so sehr hingezogen fühlte, sprang Aurora mit der lauten Freude eines Kindes um ihn her; aber sobald ihr einfiel, daß auch ihn die Riesen fressen würden, ward sie totenblaß: Ihre Freude war am Ende, und sie stand mit Tränen in den Augen, mit allem Ausdruck der Angst und des Schmerzes vor ihm. Durch Bewegungen suchte sie sich ihm verständlich zumachen: Sie führte ihn vor die Hütte und zeigte ängstlich, daß er den Weg in sein Land zurücknehmen möchte; er hingegen zeigte ihr den unruhigen Strom, die grauen hochsteigenden Wellen, und indem er schaudernd zurückbebte, fuhr ein Gedanke durch Aurorens Kopf, der ihre ganze Munterkeit wiederherstellte. Sie hängte sich rasch ihren Bogen um, faßte zutraulich seine Hand, und indem sie ihn durch Gebärden bat, ihr zu folgen, führte sie ihn auf entfernten gefährlichen Wegen in ihre kleine verborgene Höhle.
Froher kann kein Mensch der Erde sein, als Aurora war, da sie ihren Schatz in Sicherheit wußte. Sie zog ihn auf eine Bank von weichem Moos; sie streichelte seine brennende Wange, verschwand auf einen Augenblick und brachte ihm Früchte und in einer Muschel schönes
kühles Wasser zum Trinken mit. Nachdem sie den geliebten Jüngling gestärkt sah, gab sie ihm zu verstehen, daß sie ihn auf einige Zeit verlassen müsse, er sich aber ja nicht aus der Höhle entfernen dürfe. Der Jüngling verstand sie, und obwohl er nicht wußte, welche Gefahr seiner harrte, warum das holde Mädchen seinetwegen so sehr in Angst war, gelobte er ihr doch zu bleiben und drückte gerührt ihre Hände an seinen Mund.Als Aurora fort war, besah er das Innere seiner neuen Wohnung; er bewunderte den einfachen und doch so richtigen Geschmack der schönen Wilden, wofür er Aurora ansah, als er unter den verwelkten und frischen Blumengewinden, die die Wände der Höhle zierten, ein langes, veraltetes seidenes Band hängen sah, an dessen einem Ende noch Spuren von goldnen Buchstaben waren. Voll Begierde zog er es hervor; aber wer beschreibt sein Erstaunen, seine Freude, als er an der einen Seite, von dem Zahn der Zeit noch unversehrt, den vollen Namen seiner sechzehn Jahre lang betrauerten Braut und Verwandtin fand! Denn er selbst war Friedrich, Aurorens Verlobter; er befand sich auf einer Reise zu seinem Onkel, als ein heftiger Sturmwind das Schiff gegen die Felsen warf, die ganze übrige Mannschaft ihren Tod in den Wellen fand und er allein an dem Gestade des Riesenwaldes so wunderbar gerettet ward.
Ein hohes Entzücken bemächtigte sich seiner; er sank auf die Rasenbank zurück und war so tief in seinen Gedanken verloren, daß er Aurora nicht eher bemerkte, bis sie lächelnd vor ihm stand und in seiner Muttersprache ihn anredete. Sie hatte ihn zuvor nur verlassen, um sich durch den Gebrauch des Wünschhutes die Kenntnis seiner Sprache zu verschaffen. Wer war zufriedener als Friedrich! Er betrachtete sie mit dem höchsten Ausdruck der Liebe, und indem er sie sanft in seine Arme zog, indem er den ersten Kuß auf die Lippen des hoch errötenden Mädchens drückte, sagte er mit bebender Stimme: »Aurora, Geliebte! Du bist keine Wilde; du bist meine nahe Verwandtin, meine schon in der Wiege mir verlobte Braut!« — Er drückte sie von neuem an sein Herz; seine Lippen waren stumm,
aber seine Liebkosungen überzeugten Aurora, wie groß sein Entzücken sei, wie innig er sie liebe. Endlich wand sie sich aus seinen Armen; sie setzte sich neben ihn und sagte lachend: »Deine Worte habe ich gehört; aber ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich bin die Tochter einer Riesin, die längst tot ist; unsre Königin Tertulla hat mich aus Erbarmen erzogen. Jetzt soll ich aber ihren Sohn Oglu heiraten, und da er mir gar nicht gefällt, so habe ich mir diese Höhle gesucht; sie ist jedem menschlichen Auge verborgen: Hierher will ich mich flüchten, wenn ich dem schrecklichen Tage, da ich Oglus Weib werden soll, nicht mehr entfliehen kann.«Friedrich überschaute mit einem Blick die ganze Größe seines Unglücks; indes, um seine frohe Geliebte nicht zu betrüben, ließ er es sie nicht merken, sondern erzählte ihr bloß ihre Herkunft, das Unglück ihrer Jugend, und zugleich erklärte er ihr die Nähe seiner Verwandtschaft mit ihr und welche heiligen Rechte er seit der Wiege und dem Wickelbande auf sie habe. Er nannte sie bei ihrem wahren Namen, Aurora, und hatte das Vergnügen, zu bemerken, daß ihr dieser Name bekannt schien, und wirklich knüpften sich beim Hören dieses Namens eine Menge Ideen bei ihr an, die bisher in ihrer Seele geschlummert hatten. Sie fuhr wie aus einem Traume auf: »Ja«, sagte sie voll Freude, »du bist mein Verwandter, und ich hatte Eltern! Oh, leben sie noch? Ach, laß uns entfliehen; dein teures Leben ist in Gefahr. Ich will dir alles erzählen; aber jetzt muß ich eilen, um meiner Pflegemutter keinen Anlaß zum Verdacht zu geben.« — Sie entriß sich nur mit Mühe seinen Armen, und indem sie ihn bat, flehentlich bat, die Höhle nicht zu verlassen, reichte sie ihm Früchte und Pflanzen zu seinem Abendbrot und floh mit der Eile und Behendigkeit einer Gemse von Felsen zu Felsen ihrer kleinen Hütte am Gestade zu.
Schon aus der Ferne vernahm sie Tertullas Stimme, die sie laut bei Namen rief, den das Echo in den Tälern zehnfach zurückgab; sie eilte um so schneller und langte ganz atemlos bei Tertullen an, die ihr die bittersten Vorwürfe machte, daß sie sich so weit entfernt und
ihr so vielen Kummer dadurch bereite. Leicht besänftigte das liebliche Mädchen die alte Fee, die ihr auch alsdann erzählte, daß die Familie einstimmig beschlossen habe, beim nächsten Menschenopfer die Hochzeit ihres Sohnes zu feiern. Jede Einwendung wurde verworfen, alle Liebkosungen waren umsonst: Zum erstenmal war Tertulla ernstlich böse, zum erstenmal unerbittlich; sie verließ Aurora in einer Lage, die entsetzlich war, mit Äußerungen von Wut, die sie beben machten. Tief in Kummer versunken, fand sie die Mitternacht, als plötzlich ein Strahl von Hoffnung ihre Seele erquickte. Sie suchte einige gedörrte Fische aus ihrer Hütte, faßte in ein Gefäß etwas Most, und da sie die Riesin mit ihren Söhnen in tiefem Schlafe fand, so eilte sie zu ihrem Geliebten, der noch wachend auf seinem Lager saß. Sie teilte ihm die Nähe und Größe ihrer beiderseitigen Gefahr mit, aber sie verbarg ihm auch nicht, wie sie ihn durch Hilfe des Wünschhutes, dem sie auch die schnelle Erlernung seiner Sprache verdankte, zu retten dächte. Der Prinz fand, ohne lange nachzudenken, dieses Mittel auch sehr sicher, und nachdem sie sich noch einige Zeit lang ihrem süßen Geschwätz überlassen hatten, ging Aurora zu Tertullen zurück; zuvor aber schärfte sie ihrem Geliebten noch die größte Vorsicht ein.Ermüdet von den vielen Begebenheiten des vorigen Tages, fiel Aurora in einen tiefen Schlaf, aus dem erst gegen Mittag Oglus Freudengeschrei sie erweckte. Tertulla kniete neben ihrem Lager, als sie erwachte; in ihrem Gesicht las die Unglückliche eine Botschaft, und voll Entsetzen vernahm sie, daß heute früh tief in den Felsen Oglu einen schlafenden Weißen gefunden habe, der nun gleich heute zum Opfer dienen solle, um ihren Hochzeitstag dabei zu feiern. So tiefen Eindruck diese schreckliche Nachricht auf Aurora machte, nahm sie doch alle ihre Kräfte zusammen und gelobte mit großer Fassung, Oglus Weib zu werden, wenn er zu ihr käme und die Gewährung einer sehr geringen Bitte ihr nicht versage. Tertulla eilte sogleich mit dieser frohen Nachricht zu ihrem Sohn, und dieser junge Riese, der Aurora mit aller Leidenschaft liebte, der ein rohes Herz fähig ist, begab
sich unverzüglich zu ihr. Kaum sah sie ihn in ihre Hütte treten, als sie sich ihm zu Füßen warf und mit aller Holdseligkeit, die ihr so sehr zu Gebot stand, ihr Versprechen wiederholte, wenn nämlich Oglu ihr die einzige Bitte gewähre und den Gefangenen und seine Verpflegung ihr bis zu dessen Tode überließe. Oglu hob die Bittende auf, küßte ihre Stirn und gab sogleich Befehl, den Gefangenen mit Fesseln beladen in die Hütte seiner Geliebten zu führen, damit sie ihn den Tag über füttre und morgen das erste Menschenfleisch von ihm esse. Auch das gelobte Aurora, und in wenigen Minuten war der Unglückliche in ihrer Hütte.Er hatte in der Frühe des Morgens die Höhle verlassen, war neben einer Quelle eingeschlafen und so von Oglu mittels einer Schlinge gefangengenommen. Sobald sie ihn erblickte, sagte sie ihm einige Worte in seiner Sprache, die ihm Verstellung anrieten; dann behandelte sie ihn wie einen Gefangenen und scherzte den ganzen Tag mit so viel Heiterkeit, daß selbst die alte schlaue Tertulla irre ward und ihre List als Wahrheit aufnahm.
Erst als der Abendstern am Himmel stand, als die Männer, berauscht vom süßen Most, auf ihrem Lager schnarchten, verließ sie Tertulla, an deren Seite sie auf einem gemeinschaftlichen Lager schlief, und eilte zu ihrem Geliebten, der sie voll Verzweiflung an sein Herz drückte. Aber Aurora war stark, sie teilte ihm ihre Pläne mit; sie erfüllte seine Seele mit Hoffnungen, als in dem Augenblick, da sie seine Fesseln löste, Tertulla in die Hütte trat. Erschrocken fuhren die Liebenden auseinander; aber die listige Alte tat nicht, als bemerkte sie es, sie gebot bloß Auroren, den Gefangenen mit auf das gemeinschaftliche Lager zu führen und ihm seinen Platz neben ihren Söhnen anzuweisen. Mit zitternden Knien befolgte Aurora ihren Befehl; sie erriet in dem Augenblick die Absicht ihrer Pflegemutter und beschloß in halber Verzweiflung, jedes Mittel anzuwenden, um ihren Liebling zu retten. Sie sprach ihm mehr Mut ein, als sie selbst hatte, und indem er sich neben den tiefschlafenden Unmenschen niederlegte, nahm sie die steinerne Krone, die alle Söhne der Riesin
Tag und Nacht trugen, von dem Kopfe des ältesten Sohnes, drückte sie ihm geschwind auf und legte sich neben die Alte, wo sie sich fest schlafend stellte.Was sie geahnt hatte, ging wirklich in Erfüllung. Als Tertulla glaubte, das Mädchen schlafe fest, stand sie leise auf, tappte im Finstern auf die Köpfe ihrer Söhne und ermordete mit einigen Stichen ins Herz den Menschen, auf dessen Haupte keine Krone war. Friedrich erschrak, als er neben sich das Ächzen eines Sterbenden hörte. Da aber bald darauf alles stille ward, so war er im Begriff einzuschlafen, als ihn Aurorens Silberstimme leise bat, ihr ohne Geräusch zu folgen. Sie führte ihn tiefer als zuvor in ihre Felsenhöhle und floh dann zurück an Tertullens Seite, die noch fest schlief.
Kaum hatte sie sich aber niedergelegt und die ersten Strahlen der Morgenröte fielen in die Höhle, als ein lautes Wehklagen entstand. Die Riesen klagten um ihren Bruder, den Tertulla an Friedrichs Stelle umgebracht hatte. Die Mutter war außer sich: Sie erklärte sich selbst als Mörderin ihres Sohnes; sie ahnte Aurorens Verwechselung und würde sich ohne Zweifel blutig an ihr gerächt haben, wenn nicht Oglu die Zitternde in seinen Schutz genommen hätte. Indes stürmten die andern fort, um den Fremdling zu suchen, und nachdem Oglu Mutter und Geliebte versöhnt, eilte er seinen Brüdern nach, um den unglücklichen Jüngling die ganze Größe seines Schmerzes empfinden zu lassen. Aurora zitterte vor der Rückkehr der Riesen. Sie bemächtigte sich, während Tertulla an der Leiche ihres Sohnes weinte, des Wünschhutes, und sie hatte ihn kaum in Sicherheit gebracht, als die Enakssöhne zurückkehrten, mit fürchterlichem Geheul um ihren Bruder klagten und Auroren andeuteten, noch heute ihres Bruders Weib zu werden oder das Schrecklichste von ihrer Wut zu erwarten. Solche gräßliche Stimmen, solche feurige Augen hatte sie während der sechzehn Jahre ihres Aufenthalts im Riesenwalde nicht gesehen. Sie schmiegte sich zitternd an Oglu, der ihr, durch ihre tränenden Augen versöhnt, allen Schutz gegen seine Brüder und Frist bis morgen zur Heirat versprach.
In den ersten Augenblicken, wo sie ohne Zeugen war, machte sie Gebrauch von ihrer erlernten Zauberei; sie beschwor einen Rosenstock, der an ihrer Schlafstelle stand, ihre Stimme anzunehmen und auf Tertullens Fragen zu antworten. Sobald sie dies Geschäft vollbracht hatte, das ihr wegen ihrer Unerfahrenheit ziemlich schwer ward, eilte sie in ihre Hütte zurück, wo sie bis zum Abend verweilte, und erst spät, begünstigt von dem Schatten der Nacht, floh sie in Begleitung ihres Wünschhutes zu ihrem sie schon längst mit Sehnsucht erwartenden Geliebten. Um und neben sich hatte er das Wüten der Riesen gehört, und wenn er schon ihre Sprache nicht verstand, so hatte er doch aus ihrem Geheul und Ungestüm sehr richtig geschlossen, daß die ganze Nachsuchung ihm gelte. Sobald sie sich beide einigermaßen erholt hatten, wünschten sie sich viele tausend Meilen von dem Riesenwalde fort und befanden sich im Nu in einer sehr reizenden Gegend, wo ein dunkelgrüner Pomeranzenwald sie einlud, in seinem Schatten zu ruhen, mit seinen lieblichen Früchten sich zu erquicken.Indes die Liebenden in voller Sicherheit hier ausruhten, sich tausend angenehme Sachen sagten, erwachte Tertulla. Sie faßte neben sich, und da sie Aurorens Stelle leer fand, so rief sie mit heller Stimme: »Mein Töchterchen, wo bist du?« —Und ebenso laut antwortete der Rosenstock: »Ich sitze am Feuer und wärme mich.« —Völlig beruhigt durch diese Antwort und an Aurorens nächtliche Streifereien gewöhnt, schlief sie wieder ein. Als aber die Strahlen der Morgensonne sie von neuem weckten und Aurora noch nicht an ihrem Platz war, da sprang sie hastig auf und rief mit ängstlichem Ton: »Mein Töchterchen, wo bist du?« Und genauso ruhig wie zuvor gab der Rosenstrauch dieselbe Antwort. Vergebens rannte sie zum Feuer; vergebens suchte sie an allen Orten die Verlorene: Aurora war fort, und Tertulla zitterte für ihr eignes Leben, da sie die Wut ihrer Söhne kannte. Sie eilte nach dem geheimen Ort, der ihren Wünschhut verbarg, diesen Schatz, womit sie bis jetzt allen Stürmen Trotz geboten hatte; welch ein Schrecken! Auch er war fort. Was blieb ihr nun übrig?
Ihre einzige und letzte Zuflucht war ein Paar Feenstiefel, womit man auf jeden Schritt eine Meile zurücklegte. Sie fuhr ohne lange Überlegung hinein, und ehe noch ihre Söhne erwachten, war sie schon viele tausend Meilen von ihnen entfernt.Ein geheimer Zug von Sympathie, denn sie liebte Aurora noch immer, oder der Zufall führte sie denselben Weg, den die Liebenden genommen; sie hatte diese schon fast erreicht, als Aurora die Nähe der Alten ahnte. Sie benachrichtigte ihren Geliebten gleich davon und wünschte sich zu einem Pfirsichbaum voll schöner lachender Früchte, den Wünschhut in ihren Gipfel und ihren Geliebten zu einer Biene. Kaum war auch diese Verwandlung geschehen, als Tertulla schnaubend bei ihnen vorbeischritt und sogleich aus ihren Augen war. Aber in demselben Augenblick erhob sich auch ein Wirbelwind, faßte den wunderbaren Hut und führte ihn mit sich fort. Vor dem Fenster einer liebenswürdigen Königstochter, der Besitzerin dieses Parks, blieb er liegen, und die Königstochter, schon bekannt mit dergleichen wunderbaren Sachen, nahm sogleich den Hut zu sich herein und verwahrte ihn sorgfältig, bis sich der rechtmäßige Besitzer finden würde. Das Schicksal der Liebenden war indes entsetzlich; Aurora war ganz leblos und Friedrich mit seiner wenigen Lebenskraft ohne Sprache nicht imstande, weder ihr noch sich zu helfen.
Der Zufall tat auch hier das Beste. Am Abend desselben Tages ging die Königstochter, um den Duft der Bäume zu genießen, in ihren Park. Der vorzüglich schöne Pfirsichbaum fiel ihr auf, und sie näherte sich ihm, um von seinen Früchten zu essen, als sie plötzlich den heftigen Schmerz eines Bienenstichs auf ihrer schönen Hand empfand. Unwillig jagte sie die Biene fort, die aber nur so lange wich, bis sie sich dem Baum wieder näherte; aber alsdann war sie auch unersättlich in ihrer Rache, und binnen ein paar Augenblicken hatte die Prinzessin mehrere Stiche bekommen. Voll bittern Unmuts riß sie endlich ein Blatt ab; da diesem aber große Blutstropfen folgten und sie hieraus eine Bezauberung ahnte, eilte sie schnell nach

Die Schmerzen der empfangenen Stiche wurden weggewünscht, und so gingen sie alle drei sehr vergnügt zu dem Vater der schönen klugen Erretterin. Die Liebenden erzählten ihm ihre wunderbare Geschichte; diese machte ihm unendliches Vergnügen, besonders die Beschreibung des Riesenwaldes. Er erinnerte sich aus seinen Jugendjahren, daß Aurorens Vater sein Freund gewesen, und als am nächsten Tage die Liebenden sich zu ihren Eltern wünschen wollten, trug er ihnen viel herzliche Grüße auf und versprach, mit seiner Tochter ihren Hochzeitstag zu besuchen, wenn sie ihn früh genug davon benachrichtigten und vermöge ihres Hutes ihm eine recht bequeme Reise verschafften.
Unaussprechlich groß war die Freude bei Aurorens Eltern, als ihnen Friedrich die geliebte, so lange betrauerte Tochter zuführte. Sein Vater wurde sogleich herbeigeholt, der gute König und seine Tochter waren auf die bequemste Art zur Hochzeit angelangt, alles war voll Freude und Jubel, die Burg erscholl von Freudengeschrei, von Pauken und Trompeten. Schon waren die Hände der früh Verlobten, früh Getrennten und durch das Schicksal wieder Zusammengeführten fest verbunden, als sich plötzlich die Türen öffneten und Tertulla atemlos hereintrat; sie sank in Aurorens Arme und bat sie um Schutz gegen ihre bösen Söhne, um ein stilles Plätzchen, wo sie ihre wenigen Tage noch verleben könnte. Aurora war sehr gerührt; sie zeigte die Pflegerin ihrer zarten Jugend ihren Eltern, die dieser herzlich für alle die Güte dankten, womit sie Aurora beglückt hatte. Sie war von jedermann geachtet, das Brautpaar nahm sie in seine Mitte, und sobald die Flitterwochen vorbei waren, zog Friedrich mit einem ansehnlichen Heere aus, er bekriegte die bösen Söhne Tertullens, rottete sie fast ganz aus, und die wenigen, die dem Schwert entkamen, flohen in die tiefsten Felsen, wo sie niemand erreichen
konnte und wovon noch jetzt dann und wann ein Nachkömmling zu sehen ist. Tertulla blieb bei Auroren; sie liebte sie mehr als alle ihre Söhne und wiegte Aurorens Kinder auf ihrem Schoße groß.
Hans Dudeldee
Es ist nun schon lange her, wohl viel hundert Jahr, da lebte ein Fischer mit seiner Frau, der hieß Dudeldee. Sie waren aber so arm, daß sie kein recht Haus hatten, und wohnten in einer bretternen Hütte und hatten kein Fenster daran; sie schauten durch die Astlöcher hinaus. Dudeldee war doch zufrieden; seine Frau aber war nicht zufrieden. Sie wünschte sich bald das, bald jenes und quälte immer ihren Mann, weil er ihr's nicht geben konnte. Da schwieg aber Dudeldee gewöhnlich und dachte nur bei sich: Wär ich nur reich! oder: Wär nur alles gleich da, wie ich's wünsche!
Einmal abends stand er mit seiner Frau vor der Haustüre, und sie sahen umher in der Nachbarschaft. Da standen etliche schöne Bauershäuser. Da sagte seine Frau zu ihm: »Ja, wenn wir nur so eine Hütte hätten wie die schlechteste unter diesen Nachbarshäusern! Wir könnten sie wohl noch kriegen, aber du bist zu faul, du kannst nicht arbeiten, wie andere Leute arbeiten.« Aber Dudeldee fragte: »Wie? Arbeite ich nicht wie andere Leute? Steh ich nicht den ganzen Tag und fische?« —»Nein!«widersprach seine Frau ihm, »du könntest früher aufstehen und vor Tag schon so viele Fische fangen, wie du sonst den ganzen Tag bekommst. Du bist aber zu faul, du magst nicht schaffen.« Und so zankte sie ihn fort.
Darum stand er des andern Morgens früh auf und ging hinaus an den See, zu fischen. Er sah die Leute kommen aufs Feld und schaffen, und er hatte noch nichts gefangen. Und es war Mittag geworden, und die Schnitter saßen im Baumschatten und aßen ihr Mittagsbrot, und er hatte noch nichts gefangen und setzte sich traurig hin und zog
sein schimmelig Brot aus seiner Tasche und aß es. Dann fischte er wieder. Und die Sonne neigte sich, und die Schnitter gingen heim, und der Schäfer trieb die Herde in den Pferch, und die Kuhherde zog heim, und stiller ward's auf dem Felde. Aber Dudeldee stand noch immer, und noch hatte er kein Fischlein.Da war es dämmerig geworden, und er dachte ans Heimgehen. Einmal wollte er noch sein Netz eintauchen, ob er nicht jetzt noch etwas fange. Er tauchte es ein, und als wollte er die Fische locken, rief er:
»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Hans Dudeldee?« |
fragte ihn da ein Fischlein, das herzugeschwommen war und den Kopf ein wenig über das Wasser hervorstreckte.
Der arme Hans Dudeldee war zwar erstaunt über das Fischlein, doch besann er sich und dachte: Hm, wenn's da nur darauf ankommt, etwas zu wollen, da sollst du mich nicht lang fragen müssen. Er sah umher, was er wohl gleich wünschen sollte. Drüben, jenseits des Sees, stand ein schönes Lustschlößchen, aus dem eine schöne Hörnermusik herüberklang; auch fiel ihm der Wunsch seiner Frau ein, die ein besseres Haus haben wollte. Drum sagte er: »Ich möchte gern so ein Landhaus wie jenes da drüben; so ein Schloß möchte ich gern haben statt meines bretternen Hüttleins.«
»Geh nur hin«, sagte das Fischlein, »deine bretterne Hütte ist ein solches Lustschloß.«Und Hans Dudeldee lief mehr, als er ging, nach Hause und sah schon von ferne an der Stelle, wo sonst sein Haus stand, ein prächtiges Schloß mit erleuchteten Zimmern. Und als er erst hineinkam, da war alles so prächtig, daß er sich vor Freude nicht zu lassen wußte. Der Hausgang war mit Marmor geplattet, die Stubenböden eingelegt und mit Wachs gebohnert, die Wände tapeziert, herrliche Kronleuchter hingen da in den hohen Sälen; kurz, es war alles so schön, daß Hans Dudeldee nicht das Herz hatte, recht darin herumzugehen. Er konnte gar nicht glauben, daß das jetzt sein
Eigentum sei; er meinte, er sei irre, und wäre beinahe wieder weggegangen, wenn ihm seine Frau nicht wie durch Zufall auf der Treppe begegnet wäre.Kaum hatte er sie erblickt, fragte er sie: »Nun, bist du jetzt zufrieden mit dem Hause?« und erzählte ihr, wie er dazu gekommen sei. »Was?« antwortete sie, »man meint Wunder, was das jetzt wäre! Da hab ich in der Stadt schon viel schönere Häuser gesehen, wie ich noch dort diente. Es geht zwar an; aber wie kannst du so dumm sein? Das Beste hast du vergessen: Sieh einmal jetzt unsere Kleider gegen das hübsche Haus! Was die für einen Abstand machen! Hättest du mir und dir nicht auch gleich schöne Kleider wünschen können? Du bist aber wirklich zu dumm und träg. Du magst auch dein kleines bißchen Verstand, das du hast, nicht einmal gebrauchen.«
So ging das Schelten und Keifen wieder fort, bis sie einschlief. Und Hans Dudeldee ging des andern Morgens mit dem Tage wieder hinaus an dieselbe Stelle, tauchte sein Netz ein und rief wieder:
»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Hans Dudeldee?« |
So fragte ihn das Fischlein wieder, und Dudeldee besann sich nicht lang und sagte, er wünsche seiner Frau und sich recht schöne Kleider, die auch zu ihrem neuen Hause paßten.
»Ihr habt sie«, sagte das Fischlein, und Dudeldee stand da in einem feintuchenen Rocke mit goldenen Tressen, in seidenen Strümpfen und Schuhen, mit gestickter Weste, alles nach damaliger Mode. Und als er nach Hause kam, hätte er beinahe seine Frau nicht mehr erkannt in den seidenen Kleidern. Sie guckte aber zum Fenster heraus und fragte: »Bist du's, Hans?«
»Ja, ich bin's«, antwortete er; »nun, bist du jetzt zufrieden?« »Will mal sehen!« antwortete sie.
So lebten sie eine Zeitlang ruhig fort. Drauf, als ihr Mann wieder einmal fischen gehen wollte, sagte sie: »Geh, was brauchst du zu fischen?
Laß das doch bleiben und wünsch dir statt dessen lieber eine rechte Kiste voll Geld.«Hm, das ist wahr! dachte Dudeldee und ging hinaus an den See und tauchte sein Netz wieder auf derselben Stelle ein und rief:
»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Hans Dudeldee?« |
fragte ihn das kleine Fischlein wieder. »Ach, eine rechte Kiste voll Geld«, sagte er. »Gehe nur hin«, sagte das Fischlein, »in deinem Schlafzimmer steht sie.« Und wie er heimkam, stand in seinem Schlafzimmer eine ganz große Kiste voll Goldstücken.
Nun ging alles hoch her bei ihnen, und die Frau kaufte sich Kutsche und Pferde und ihrem Mann ein Reitpferd, und so fuhren sie oft in die Städte und hielten sich einen Koch und Bediente. Da schalten sie die Nachbarinnen immer die hochmütige Fischerin. Das verdroß sie gar sehr, und sie lag ihrem Manne wieder an, er sollte machen, daß sie über die Nachbarinnen alle zu befehlen habe, und er ging wieder mit seinem Netze hinaus, tauchte es ein und rief:
»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Hans Dudeldee?« |
fragte ihn das Fischlein. »Ich wäre gern ein Edelmann oder Graf und möchte, daß ich über alle meine Nachbarn zu befehlen hätte.« Da sprach das Fischlein: »Geh nur hin, es ist so.«Und als er heimkam, da hatten die Nachbarsleute schon seiner Frau gehuldigt, und sie hatte schon ein paar von ihren Nachbarinnen einsperren lassen, die sie sonst hochmütige Fischerin gescholten hatten.
Und jetzt fuhren sie oft in die Hauptstadt, wo der König wohnte, und wollten sich in die Gesellschaft anderer Grafen mischen. Aber sie wußten sich dort nicht nach deren Sitte zu betragen und wurden von allen verlacht, und einige Gräf innen nannten sie nur die Fischgräfin
und ihn den Fischgrafen Dudeldee. Da sprach sie wieder zu ihrem Mann: »Geh hinaus und laß dich zu einem König machen; denn ich will nicht mehr Fischgräfin heißen; ich will Königin sein.« Aber Hans Dudeldee riet ihr ab und sagte: »Bedenke doch, wie wir arm waren und uns nur ein Hüttlein wünschten wie das schlechteste von unsern Nachbarshäusern; jetzt haben wir alles im Überflusse, nun laß uns auch genug haben.« Die Frau aber wollte nicht genug haben und sprach: »Was: Ich soll mich Fischgräfin schelten lassen? Ich soll den Hochmut der Stadtweiber ertragen? Nein, sie müssen wissen, wer ich bin; ich will's ihnen zeigen! Und du willst auch so einfältig sein und willst dir's gefallen lassen?« So zankten sie fort, bis er ihr versprach, sie zur Königin zu machen.Darum ging er hinaus an den See und sagte wieder sein altes Sprüchlein, und das Fischlein kam wieder: »Was willst du, lieber Graf Dudeldee?« Er brachte sein Anliegen vor, daß er gern König wäre; das Fischlein sagte: »Du bist's!«, und er kam heim und fand sein Lustschloß ganz prächtig verändert und viel größer. Marschälle und Minister mit goldenen Schlüsseln und Sternen empfingen ihn mit tiefen Verbeugungen. Sein Kopf wurde ihm ganz schwer; er wollte den Hut abziehen, aber siehe da! Statt des Hutes hatte er eine schwere goldene Krone auf dem Haupte. Und als er seine Frau sah, erkannte er sie fast nicht mehr, so glänzte ihr Gewand von Gold und Juwelen. Aber als er sie fragte, ob sie jetzt zufrieden sei, sagte sie: »Ja, bis ich wieder etwas Besseres weiß; ich wäre ja eine Närrin, wenn ich's besser haben könnte und nähm's nicht an.«
So lebten sie jetzt aber doch eine Weile zufrieden, und Dudeldees Frau wünschte sich nichts mehr; denn sie hatte ja alles, was sie sich nur hätte wünschen können, hatte sich auch gerächt an den Gräfinnen, die sie die Fischgräfin geheißen hatten. Aber endlich fehlte ihr doch wieder einmal etwas. Sie vernahm aus der Zeitung von der Pracht und dem Aufwande, der an andern Königshofen herrschte, und hörte auch, daß es andere Könige und Kaiser gebe, die über weit mehr Leute und über weit mächtigere Reiche zu befehlen hätten als
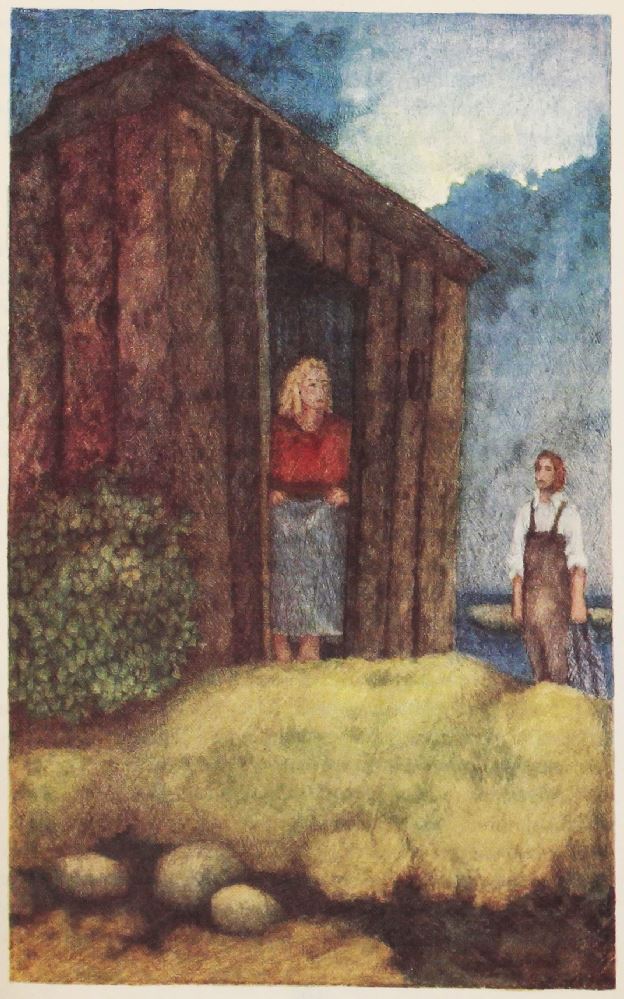
»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, König Dudeldee?« |
fragte das Fischlein, und Dudeldee sagte: »Mach mich doch gleich zum mächtigsten König oder Kaiser auf Erden.«Und gleich war er's auch; denn als er heimkam, da waren schon Gesandte und Deputierte aus allen Reichen und Weltteilen da, arme Poeten warteten mit Gedichten auf Atlas auf ihn, Schulmeister, die bessere Besoldungen brauchten, waren da mit Suppliken, Kammerherren, mit dem Hute unter dem Arm, gingen hin und her, Bauern, die Prozesse hatten, wollten zu ihm, Schildwachen gingen auf und ab, eine Kutsche mit zehn Pferden und zwanzig Vorreitern und sechs Läufern stand immer zum Wegfahren bereit, Pfauen und Perlhühner waren in einem Nebenhofe: Kurz, es war da alles, was einen so großen Kaiser nur ergötzen konnte, ja sogar zwei Hofnarren waren immer um ihn. Der neue Kaiser Dudeldee war freilich im Anfang darüber böse, daß ihn die zwei närrischen Menschen immer verfolgten, wohin er gehen mochte, und beschwerte sich darüber bei seiner Frau, weil er denn doch lieber in der Gesellschaft von vernünftigen Leuten als bei Narren sein wollte. Sie sagte ihm aber, das verstehe er nicht, das müßte so sein: Alle sehr großen Herren hätten's lieber mit Narren zu tun; er werde denn doch da kein Narr sein und eine Ausnahme machen wollen.
Endlich ließ er sich's gefallen und war nur froh, daß seine Frau zufrieden war; aber die Freude dauerte nicht lange. Er kam einmal zu ihr und traf sie ganz traurig an. »Was fehlt dir?« fragte er sie. — »Ach«, sagte sie, »ich bin verdrießlich über das Regenwetter. Das dauert nun doch schon vier Tage lang, und ich möchte so gerne Sonnenschein haben. Oberhaupt, ich wollte, ich könnte alles machen,
was der liebe Gott kann, daß ich Frühling haben könnt und Sommer und Herbst und Winter, gerade wann ich wollte. Geh hin und mache, daß ich's kann.« So sagte sie, und ihm gefiel es selber. Wie, dachte er, wenn du jetzt im Regen hinausgingst und kämst heim im Sonnenschein, den deine Frau gemacht hätte? Da könntest du auch die Narren wieder loswerden. So dachte er bei sich und schlich sich gleich mit seinem Fischernetze zu einer Hinterpforte im Regen hinaus, ging an den See, tauchte sein Netz ein und rief wieder wie sonst:»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Kaiser Dudeldee?« |
fragte ihn das Fischlein. »Ach«, sagte er, »weiter nichts, als meine Frau möchte gern können, was Gott kann: Regen und Sonnenschein machen und Frühling und Sommer und Herbst und Winter, wann sie gerade will.« — »So! Und weiter nichts?«fragte das Fischlein. »Nein, nein, Kaiser Dudeldee, ich sehe, daß an deiner Frau und dir nichts gut angelegt ist, darum sei du wieder der alte Fischer Dudeldee; denn damals warst du nicht so übermütig und ungenügsam wie jetzt.«
Und das Fischlein verschwand, und er rief wohl oft: »Fischlein, Fischlein in dem See!«, aber kein Fischlein fragte mehr: »Was willst du, lieber Dudeldee?« Und er stand wieder da wie das erstemal, ohne Wams, nur in seinen schmutzigen ledernen Hosen und war wieder der alte Fischer Dudeldee.
Und als er heimkam, da war wieder das Schloß fort, und da stand wieder seine kleine bretterne Hütte, und seine Frau saß darin in ihren schmutzigen Kleidern und schaute wieder heraus durch ein Astloch wie vormals und war wieder die Frau des Fischers Dudeldee.
Die sieben Schwäne
Der Graf Carolus hatte mit seiner Gemahlin in hohem Frieden bis an das Ende ihrer Tage gelebt und durch sie die Idee bekommen, daß es lauter gute und gar keine bösen Weiber geben könne. Ihre fast zwanzigjährige Ehe war mit sieben Söhnen und einem Töchterchen, welches viel jünger als seine Brüder war und der kleine Spätling genannt ward, gesegnet. Diese Söhne waren schon stattliche Buben und die ältesten sogar mannhafte Ritter, als ihre Mutter an einem Schlagflusse starb und sie alle in die größte Betrübnis versetzte. Der jüngste der Söhne war im dreizehnten Jahre, Kunigunde im zehnten, und es sah äußerst betrübt aus, den gebeugten Vater mit seinen tief trauernden acht Kindern der geliebten Leiche folgen zu sehen. Es herrschte auch eine lange Zeit nachher die tiefste Trauer im ganzen Schlosse, bis die Söhne, die sich alle zärtlich liebten, die Burg auf einige Zeit verließen und der Graf mit seiner Kunigunde allein blieb.
So gut und liebenswürdig dies Kind auch war und zu so großen Hoffnungen sie den Vater auch berechtigte, so war sie doch leider jetzt noch nicht in dem Alter, wo der Graf Pflege und Zeitverkürzung von ihr fordern konnte; und er, der durch die Verstorbene an weibliche Pflege und liebende Sorgfalt gewöhnt war, wünschte sich oft eine Gefährtin, welche ihn trotz seines Alters lieben, ihm die Stelle der Verstorbenen ersetzen und eine gute Mutter für seine Kinder sein möchte. Er sah sich lange unter den Töchtern des Landes nach einer Gehilfin um, aber die eine war zu jung, die andre zu alt; die ihn genommen hätten, mochte er nicht, und die er gern erwählt hätte, lachten seines grauen Kopfes und wünschten, daß er das Heiraten seinen wackern Söhnen überlassen möchte. So freite er beinahe drei Jahre umher, holte sich eine Menge Körbe zusammen, ward immer älter und schwächer, und war im Begriff, das Suchen nach einer Gehilfin zu unterlassen, als er eine Frau kennenlernte, welche fern von dem Geräusche der Welt auf einem entlegenen Schlosse
wohnte und mit der ihn das Ohngefähr zusammenführte. Noch nie hatte er die Frau von West - so hieß diese Dame -gesehen; sie lebte in der größten Eingezogenheit und war in der Gegend, wo sie wohnte, nur unter dem Namen der Einsamen bekannt; denn auf ihrem Schlosse war nie einer ihrer Nachbarn gewesen, und niemand kannte die innere Beschaffenheit ihrer Wohnung, noch viel weniger ihre Art zu leben.Eines Tages hatte sich der Graf auf der Jagd verspätet; er war von seinen Leuten fortgekommen, und die Nacht überraschte ihn bei Verfolgung einer schönen weißen Hindin, welche sich auf einmal in einem schönen Park verlor, der immer dichter und dichter ward und in dessen dunkelsten Schatten ein nettes Landhaus stand. Er ließ sogleich von der fernern Nachsuchung der Hindin ab und näherte sich behutsam dem Landhause, wo ihm eine Dame entgegentrat, die, wennschon das Stufenjahr der weiblichen Schönheit hinter ihr lag, dennoch so blendende Reize hatte, daß der Graf ganz erstaunt zurücktrat und durch einige tiefe Bücklinge seine Verwirrung ihren Augen entziehen wollte; aber sie war ihr dennoch nicht entwischt, und sie fragte ihn mit einer Art, die ihm Zutrauen machte, ob er sich etwa verirrt habe oder was ihn sonst in dieses einsame Gehölze führe.
Er entdeckte ihr den Zufall, daß er durch Verfolgung einer weißen Hindin so weit von seinem Wege abgekommen sei, daß er nun aber zeitlebens das Ohngefähr segnen werde, das ihn eine so reizende Nachbarin kennengelehrt habe. Frau von West verneigte sich sehr artig und bat ihn, in ihrer Einsiedelei sich es auf einige Augenblicke, die er doch gewiß zu einer Erholung bedürfe, gefallen zu lassen. Diese Bitte war dem ermüdeten Grafen sehr willkommen; er folgte ihr in einen allerliebsten Saal, wo ihm der schönste Wohlgeruch entgegenduftete, und ließ sich mit Vergnügen neben seiner reizenden Nachbarin auf einem weichen Sofa nieder. Sie schellte, worauf sogleich ein paar schöne krausköpfige Buben einen Tisch mit Erfrischungen hereinbrachten, worauf neben den schönsten Früchten
und leckerstem Gebacknen eine Flasche des lieblichsten Tokaier nebst zwei Gläsern vom reinsten Kristall standen. Die Dame schenkte ein, wobei der Graf ihre Hand und den runden elfenbeinernen Arm bewunderte; sie kredenzte den Wein und gab ihn mit einer freundlichen Miene dem liebetrunkenen Grafen, welcher die Stelle suchte, die ihre schönen Lippen berührt hatten und mit großer Schnelle das Glas und mehrere hintereinander hinunterstürzte. Sie bat ihn, nun auch vom Gebacknen zu versuchen, und legte ihm sowohl Früchte als Backwerk vor; er fand alles schön, und nachdem er den Rest der Flasche noch geleert hatte und ein heftiges Feuer in seinen Adern zu toben anfing, so rückte er näher zu seiner schönen Nachbarin, bedeckte ihre Hände und Arme mit glühenden Küssen und fragte, sie zärtlich betrachtend, wer sie denn sei und warum so viele Schönheit so unbewundert in dieser Einsamkeit verblühen solle.Sie schlug über diese Frage ihre Augen bescheiden nieder und sagte ihm, sie sei die Witwe eines Herrn von West, der vor drei Jahren in dieser Gegend auf einer Reise, die sie zusammen gemacht hätten, gestorben sei. Untröstlich über seinen Verlust, habe sie dies Landgut gekauft, ihn hier beerdigen lassen und sich seit dieser Zeit von aller Gesellschaft ferngehalten. Diese Erzählung erinnerte den Grafen an seinen Verlust; er teilte ihr seine ganze Lage mit, und durch den Tokaier mit doppeltem Mute beseelt, trug er sich ihr sofort zum Freier und, wenn sie wollte, augenblicklich zum Ehemann an. Die schöne Witwe errötete, aber der Graf ward nun dringender und sagte ihr so oft, daß man im Herbste des Lebens jeden Augenblick festhalten müsse, daß sie endlich, sanft widerstrebend, was den halbtrunknen, von Wein und Liebe berauschten Grafen nur noch heftiger machte, nachgab und ihm gelobte, seine Gattin zu werden. Hoch entzückt schloß sie der Graf in seine Arme; bald teilte sie, glühender noch als er, ihm das Feuer ihrer Empfindungen mit. Das Sofa ward ihr Brautbett, und Frau von West erwachte in den Armen des Grafen Carolus. Zwar wollte sie ihn mit Tränen und Vorwürfen
überhäufen, aber der Graf wußte sie zu trösten, und sie fuhr gegen Mittag auf das Schloß ihres Liebhabers, wo Kunigunde, voll hoher Freude über die Ankunft ihres Vaters, um den sie so sehr gesorgt hatte, die fremde Dame ganz übersah und wie vom Blitze getroffen dastand, als ihr Vater ihr in der Frau von West ihre neue Mutter vorstellte und ihr Liebe und Gehorsam gegen solche gebot. Ehrerbietig küßte sie ihr die Hand; aber Frau von West nahm sie in ihre Arme und gewann durch innige Liebkosungen das Herz des holden unbefangenen Mädchens nur zu bald.Der Graf veranstaltete ein glänzendes Hochzeitsfest und entbot dazu seine sieben Söhne, die er nun schon drei Jahre nicht gesehen hatte; sie gehorchten auch pünktlich seinem Befehl und trafen am Abend vor der Vermählung alle sieben bei ihm ein. Kunigunde saß unter den hohen Linden im Schloßhofe, als ihre Brüder auf sieben weißen Pferden angeritten kamen, sie eilte frohlockend in ihre Arme, und die Brüder konnten sich nicht satt an ihr sehen: Ein Kind hatten sie verlassen, eine holde mannbare Jungfrau stand vor ihnen. Im Triumph führte Kunigunde ihre Brüder zu dem Brautpaar; sie fanden ihren Vater, der sehr alt geworden war, an der Seite einer reizenden Frau, deren Auge nur zu deutlich Begierden verriet und deren wollüstiger Körper in einem so leichten Anzuge sich befand, daß die Ritter ihre Augen von diesem unangenehmen Anblick abwandten: ihren alten Vater mit der Verliebtheit eines Jünglings in den Armen eines verbuhlten Weibes! Frau von West merkte die Verwirrung ihrer Söhne recht gut; aber statt sie auf die richtige Art auszulegen, schrieb sie diese auf Rechnung ihrer Reize und bot den Jünglingen Wange und Mund, als der Vater sie zum Handkuß herbeirief.
Cölestin, der älteste der Brüder, ging am Abend des Beilagers mit den übrigen sechsen in ein entlegenes Kämmerlein, zog sein Schwert und bat die Brüder mit ernster Stimme, auf dieses Schwert ihm zu schwören, daß keiner sich von den Liebkosungen der Gräfin wolle verführen lassen, das Bett ihres alten Vaters zu beflecken.
Alle schworen einen gräßlichen Eid mit feierlicher Stimme und gelobten sich von neuem Treue und Liebe bis in den Tod. Hierauf fragten sie Cölestin, was er für Gründe zur Forderung dieses Schwures gehabt habe, worauf er ihnen entdeckte, daß ihn ein Zwerg gebeten habe, diese Nacht am innern Schloßtor seiner zu harren. »Ich glaube, er ist von unserer reizenden Mutter abgesandt; denn nicht umsonst kredenzte sie mir heute den Becher so fleißig«, setzte er zähneknirschend hinzu; »wenn sie nun sieht, daß ich standhaft auf die Ehre meines alten Vaters halte, so wird sie sich gewiß an einen von euch wenden, und da bitte ich euch, meine teuren Brüder, gedenkt dieses Schwurs! Rache sei dem geschworen, der ihn bricht!« Alle sechs Brüder wiederholten dies Gelübde, und sie gingen auf verschiedenen Seiten in den Saal zu den Tanzenden, wo sie ihren Vater taumelnd dem bräutlichen Gemache zuwanken sahen, ohne daß ihm seine Vermählte folgte, die in einem lustigen Reihentanze begriffen war. Cölestin folgte unmerkbar seinem Vater und ergrimmte, als er in dem Gemach ein paar fremde krausköpfige Buben fand, welche ihren Spott mit dem alten Mann trieben. Er jagte die Buben mit einigen derben Hieben von dannen, entkleidete sorgfältig den alten trunkenen Vater, legte ihn zur Ruhe und rief dann einen der älteren Bedienten, dem er die Sorge für den Vater übertrug, und da die Glocke bereits auf Mitternacht zeigte, begab er sich an das innere Tor des Schlosses, wo der Zwerg bereits seiner harrte und ihn durch einen unterirdischen Gang in einen Saal führte, wo Üppigkeit und Schwelgerei sich schwesterlich die Hand boten.
Als er so dastand und schon ärgerlich war, dies Abenteuer eingegangen zu sein, öffnete der Zwerg eine Seitentür, winkte ihm, näher zu treten, und verschwand in einem Gange. Der mißmutige Cölestin näherte sich dem Zimmerchen, woraus ihm der Duft des lieblichsten Rauchwerks entgegenschlug, und sobald er auf die Schwelle trat, hub eine sanfte schmelzende Musik an, die ihn von allen Seiten zu umgeben schien. Er sah sich schnell um, aber vergebens: Sein forschendes Auge entdeckte nichts, und er begab sich vollends in das
Kabinett hinein, wo in einer Nische auf einer weißseidnen Ottomane Frau von West in einer der reizendsten Lagen von der Welt und in einem leichten, mehr entblößenden als bedeckenden Anzug lag.Der bescheidene Sohn blieb wie vom Blitz gerührt stehen und fragte steif und hölzern wie ein preußischer Soldat: »Madam! Sie haben mich hieher beschieden; was befehlen, was wünschen Sie von mir?« —»Welch eine kalte Frage«, rief Frau von West, »verstelle dich nicht, mein Teurer! Dein Auge hat mir längst die Wünsche deines Herzens verraten, und ich dächte, du müßtest mir es Dank wissen, daß ich dich über alle Verlegenheit hinweg sogleich zum Ziel führe.« — »Sie irren sich, Madam!« antwortete der Ritter, ohne sie nur eines Blickes zu würdigen. »Es war von jeher die Pflicht der Ritter, die Ehre und das Eigentum anderer in Ehren zu halten und zu schützen; aber doppelt heilig sind diese Pflichten gegen einen geliebten Vater. Ja, noch mehr: Ich gestehe Ihnen, Sie waren mir zuwider im ersten Augenblick, als ich Sie sah; denn in Ihren Zügen las ich Wollust und Verschlagenheit.« —»Halt!«, rief die Zauberin, »nicht weiter in deinen Schmähungen! Und damit du deine Tugend immer so rein und unsträflich erhaltest, so werde sofort zu einem weißen Schwan und flattre in die fernste Wildnis, auf den einsamsten mit Schilf bewachsenen See!«Ehe Cölestin noch ein Wort antworten konnte, ging der grausame Wunsch schon in Erfüllung, und er verließ tief seufzend das Zimmer der Zauberin, welche sich voll Unmut nach dem Schlosse begab, über Cölestins Starrsinn wütete und tobte und sich endlich an die Seite ihres alten Gemahls legte.
Vergebens hatten die übrigen Brüder auf Cölestin geharrt; als es aber Tag ward und er nicht zurückkehrte, erfüllten sie das Schloß mit ihren Wehklagen, drangen in das Zimmer ihres Vaters und forderten den geliebten Bruder von der Hand der Frau von West, die aber die Verstellung so weit zu treiben verstand, daß der alte Vater seinen Söhnen befahl, das Zimmer zu verlassen und ihrer neuen Mutter das angetane Unrecht abzubitten. Er ward bei diesen Worten abgerufen,
und da nur seine Gegenwart dem Zorn der Brüder Einhalt getan hatte, so brach dieser jetzt ohne Rückhalt los, und sie drangen mit Drohungen, die sie gewiß erfüllt haben würden, auf sie ein. Aber wütend erhob sich die Zauberin und rief mit grimmiger Gebärde: »Folgt ihm nach, dem argen Bösewicht! Werdet, was er ist, ihr Unsinnigen, und teilt sein Schicksal!« Sofort wurden die sechs Brüder zu weißen Schwänen und verschwanden auf den das Schloß umgebenden See. Als der Graf zurückkehrte, fand er seine Gemahlin in Tränen und mußte viele Bitten anwenden, sie zu besänftigen und Verzeihung für die raschen Jünglinge zu erhalten. Ach, hätte er das Schicksal dieser geliebten Kinder und die Teufelei seines Weibes gekannt! Er würde der Zauberin den Dolch in ihr verräterisches Herz gestoßen haben.Als die Brüder am Abend nicht wiederkamen, war Kunigunde ganz untröstlich; sie weinte so kläglich die ganze Nacht, daß ihre alte Amme bittere Tränen vergoß und auf tausenderlei Pläne sann, wie sie doch erfahren wolle, wo die sieben Brüder geblieben seien. Die neue Gräfin war bei ihr in großem Verdacht; denn der Alten waren die Blicke nicht entgangen, womit sie die kraftvollen Jünglinge gemustert hatte. Noch weniger aber gefielen ihr die schändlichen Erzählungen, womit sie Kunigundens reines Herz zu vergiften dachte; aber sie verbarg ihren Argwohn dem holden Mädchen noch und riet ihr, die Götter zu bitten, ihre Brüder aus einer Bezauberung, worein sie gewiß gefallen seien, zu erretten.
Als die Sonne mit ihren ersten Strahlen die Welt begrüßte, verließ Kunigunde, ohne geschlafen zu haben, ihr Bette und wanderte nach einem entlegenen Teile des Gartens, um dort in der Einsamkeit um so andächtiger für ihre Brüder zu beten. Sie sank auf ihre Knie nieder, faltete die Hände und wollte eben ein Gebet beginnen, als sieben weiße Schwäne sie umringten, die sie an der Sprache sogleich für ihre Brüder erkannte, daher sie sie mit Tränen bat, ihr doch zu sagen, wie sie in diesen Zustand gekommen seien.
Die Schwäne erzählten ihr, was sie, ihrer Schamhaftigkeit unbeschadet,
von der schändlichen Geschichte hören konnte, worüber die arglose Kunigunde so heftig erschrak, daß sie durchaus nicht wieder zu ihrer ruchlosen Stiefmutter zurückkehren, sondern viel lieber das Schicksal ihrer Brüder teilen wollte. »Du kannst uns erlösen«, hub Cölestin zudem weinenden Mädchen an, »wenn du Mut und Standhaftigkeit genug hast, in sieben Jahren kein Wort zu reden, keine Träne zu weinen und alle Jahre ein Mannshemde zu verfertigen, welches aber deine einzige Arbeit sein muß, sehen wirst du uns in diesen ganzen sieben Jahren nicht, und erst am letzten Tage im siebenten Jahr werden wir, wenn du kein Wort gesprochen, keine Träne geweint hast, als vollkommene Männer wieder vor dir stehen.« Kunigunde ging sogleich diese Forderung ein. Die sieben Jahre dünkten sie gar nicht lang, und sie begab sich mit Freuden zu einem hohlen Baume, worin sie sieben zugeschnittne Mannshemden fand, sagte ihren Brüdern ein trauriges Lebewohl und fing sogleich ihre Arbeit an.Vier Jahre hatte sie schon in dem Baume zugebracht, vier Hemden waren fertig, und sie hatte in dieser ganzen Zeit kein lebendiges Wesen um sich her wahrgenommen als ein Vögelchen, welches ihr täglich Speise und Trank brachte und bei ihrer einfachen Mahlzeit sie mit seinem Gesang belustigte, als eines Tages Hörnergetön und Hundegebell aus der Ferne sich hören ließ; sie merkte die Annäherung einer großen Jagd und saß noch einmal so still, weil sie sich fürchtete, entdeckt zu werden. Aber ihre Vorsicht half diesmal nichts. Die Hunde umgaben den Baum und bellten so unaufhörlich, daß der König, der hier jagte, neugierig ward und einem Jäger befahl, hinaufzusteigen und zu sehen, was in dem Baume befindlich sei. Der Jäger stieg hinauf und meldete seinem Herrn, daß ein wunderschönes Frauenzimmer darin sitze, welche aber stumm zu sein scheine; denn sie antworte auf alle Fragen kein Wort und schüttle immer mit dem Kopfe. Der König ward durch diese Erzählung neugierig; er stieg selbst an dem Baume hinauf, und da ihn Kunigundens Schönheit in Erstaunen setzte, so befahl er ihr, gutwillig hervorzukommen,
sonst werde er Gewalt brauchen. Als sie sah, daß es Ernst war, so fügte sie sich in die Notwendigkeit, packte ihre Hemden zusammen und verließ mit der größten Behendigkeit den Baum. Ihre schlanke edle Gestalt entsprach dem schönen Gesicht, und da ihre Kleider ein vornehmes Frauenzimmer verrieten, so ließ ihr der König mit aller Achtung begegnen und sie in seinem eignen Wagen nach dem Schlosse fahren, wo er ihr ein paar hübsche Zimmer zu ihrer Wohnung anweisen ließ.Als er sie aus dem Holze mit nach dem Schlosse nahm, hatte er gar keinen Plan mit ihr, als daß sie besser und bequemer leben solle. Als er sie aber täglich sah, zog ihn ihre Schönheit sehr an; selbst ihr Stummsein und die hohe Sanftmut, mit der sie sich betrug, machte sie ihm reizend, und er faßte den Entschluß, sie zu seiner Gemahlin zu erheben. Sobald er hierüber mit sich ganz einig war, ließ er ihr eine schöne Wohnung dicht an der seinigen bereiten und gab ihr Kleider, die ihrem neuen Stande angemessen waren. Dann schrieb er an seine Mutter, die verwitwete Königin, machte ihr seinen Entschluß bekannt und bat sie, zu ihm herüberzukommen und seine Braut kennenzulernen. Die Königin-Mutter war eine hochfahrende und stolze Frau, die der Plan ihres Sohnes mit dem größten Ärger erfüllte; denn sie hatte ganz andere Pläne mit ihm, und es war ihr gar nicht gelegen, daß eine unbekannte stumme Person die Mutter des künftigen Königs werden und ihr auf einem Thron folgen sollte, den sie selber mit so vielem Glanze bekleidet hatte. Indes sie alle diese Überlegungen anstellte, sagte der König Kunigunden auf eine feine und zärtliche Art, daß er sie liebe und sie, wenn sie ihn nicht hasse, bitte, seine Gemahlin zu werden. Sie reichte ihm mit einem freundlichen Kopfnicken ihre Hand; denn sie liebte den schönen guten König, und ihr edles Herz war über alle weibliche Ziererei weit erhaben. Sie wähnte sich in diesen Tagen der ersten Liebe unaussprechlich glücklich, und aus ihren herzlichen Liebkosungen konnte der Geliebte nur zu deutlich sehen, daß sie, inniger Empfindungen fähig, ihn aus voller Seele liebte.
Mit der Ankunft der Königin-Mutter verschwand die Heiterkeit der schönen Braut, und da diese sie wirklich stumm glaubte, also von dieser Seite ganz sicher war, daß ihr Sohn nichts wieder erfahren konnte, so behandelte sie die Arme vor seinen Augen äußerst freundlich, aber sobald er den Rücken wandte, fiel sie mit aller Wut eines erbitterten Herzens über sie her und fügte ihr durch die schrecklichsten Schmähungen und Verwünschungen großen Kummer zu. Bald nach der Vermählung bemerkte der König den Widerwillen, den Kunigunde gegen seine Mutter hatte, und da er nur immer sah, wie gütig diese seine Gemahlin behandelte, so war ihm der Haß unerklärlich, der unverkennbar in ihrem schönen Gesicht herrschte, wenn die Mutter sie liebkoste. Da seine Mutter bald nachher abreiste, so ließ er die Sache ganz auf sich beruhen und lebte ein halbes Jahr mit seiner Gemahlin, welche ihr fünftes Hemd jetzt fertig hatte, sehr vergnügt.
Aber wie nichts in der Welt vollkommen ist, so war es auch das Glück dieser Ehe nicht; der König mußte in den Krieg ziehen, gerade als seine Gemahlin noch einige Wochen bis zu ihrer ersten Entbindung hatte. Da er nun nicht die Sorgen des Reichs, die Geschäfte der Krone einer stummen Frau übertragen konnte, so ersuchte er seine sich zu Anfang sehr weigernde Mutter, in das Schloß zu ziehen und nicht allein die ganze Regierung zu übernehmen, sondern auch bei der Entbindung seiner Gemahlin gegenwärtig zu sein. Diese Bitten paßten ganz in die boshaften Pläne der alten Königin, und sie eilte mit hoher Freude in die Residenz, wo sie triumphierend ihrer Schwiegertochter den Befehl des Königs bekannt machte, worein sich diese auch mit ihrer gewöhnlichen Sanftmut ergab.
Als die Stunde ihrer Entbindung kam, gebar sie einen wunderschönen Knaben, den sie voll Freude und Wonne an ihr Herz drückte. Aber wie ward ihr, als des Nachts die alte Königin kam, den Kleinen aus ihren Armen riß und vor ihren Augen ihn in den breiten Graben, der das Schloß umgab, warf! Schon wollte sie schreien; da gedachte sie ihrer Brüder: Sie schwieg, aber eine helle Träne rann über ihre
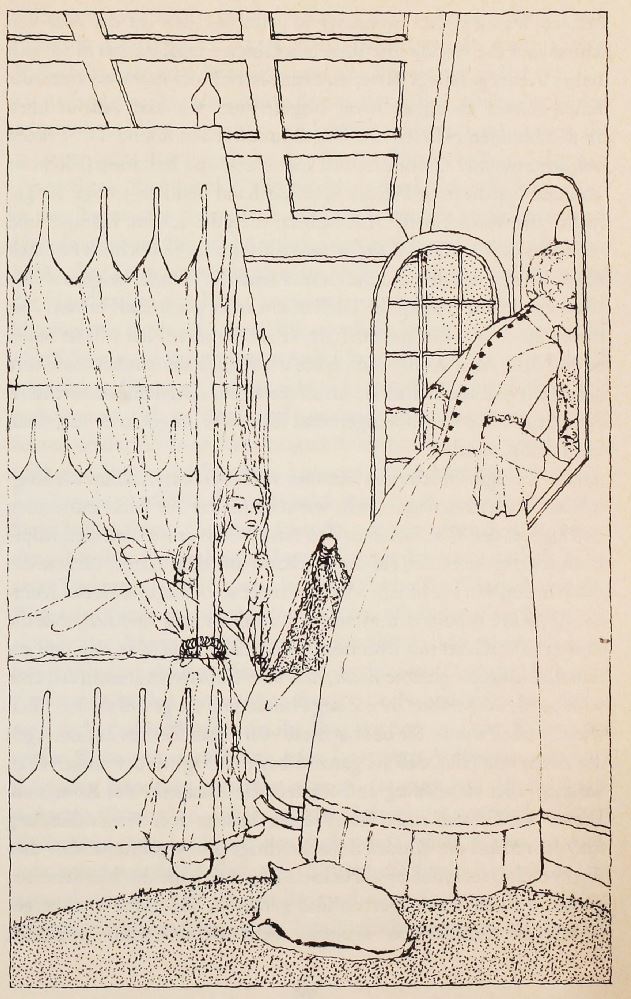
Als die Königin-Mutter das Zimmer verlassen hatte, nahm die klügste der Wärterinnen ein Tuch, wickelte es wie ein Kind zusammen und legte es der Wöchnerin in den Arm; dann setzte sie einen Kopfschmuck der Alten auf, riß ihr das Kind aus dem Arme, öffnete das Fenster und warf es hinab. »War es nicht so?«fragte sie leise. Kunigunde nickte bejahend und zeigte nun noch sehr deutlich, daß die Mutter sie nachher mit Blut beschmiert habe. Die Wärterin war getreu und klug; sie glaubte nicht, daß ihre Gebieterin stumm sei, aber wohl, daß ein Gelübde ihre Zunge binde und sie gewiß zu ihrer Zeit wieder reden werde. Sie beobachtete von dieser Zeit an das Betragen der Alten und fand, daß sie ganz unbarmherzig mit der jungen Frau umging; aber sie schwieg und wartete die Rückkehr des Königs ab. Dieser ward durch einen Brief seiner Mutter von der Entbindung und dem Mord des Kindes benachrichtigt und ergrimmte über diesen Frevel so sehr, daß er zurückschrieb, man solle die Mörderin sogleich in einen Turm sperren und gebieten, daß jeder Vorübergehende die Schändliche anspeie. Sein Befehl ward pünktlich
vollzogen, und die unglückliche Kunigunde vollendete ihr sechstes Hemd in dem feuchten ungesunden Turme, wo sie den täglichen Mißhandlungen und Schmähungen des Pöbels ausgesetzt war.Zu Anfang des siebenten Jahres kehrte der König zurück; er wollte seine unschuldige Gemahlin sogleich hinrichten lassen, aber die Wärterin teilte ihm insgeheim ihre Mutmaßungen mit, und der König erschrak über die bloße Möglichkeit dieser Idee. Er begab sich in den Turm, wo Kunigunde blaß und entstellt an ihrem letzten Hemde arbeitete. Bei dem Anblick ihres geliebten Gemahls hatte sie Mühe, ihre Tränen zurückzuhalten; sie ließ die Arbeit sinken, schlug die Hände über der Brust zusammen und blickte wehmütig gen Himmel, als wolle sie sagen: Dieser allein kennt meine Unschuld! Der König ward durch ihren Anblick erschüttert; er nahm sie in seine Arme, führte sie auf das Schloß in ihre Wohnung zurück, und nachdem sie sich gebadet und gereinigt hatte, setzte er sie zum Schrecken der Alten in ihre vorigen Rechte wieder ein, welche auch bald, vor Ärger und Ingrimm zitternd, das Schloß verließ.
Kunigunde ward bald darauf wieder schwanger und nähte mit großem Fleiß an ihrem siebenten Hemde, um es noch vorher zu vollenden; aber ihre Niederkunft überraschte sie dennoch, und sie gebar zwei Töchter, die, schön wie der Tag, ein holdes Gemisch von den Zügen des Vaters und der Mutter in ihren reizenden Gesichtern vereinten. Der König verließ seine Gemahlin keinen Augenblick; er freute sich der lieblichen Kinder und der innigen Zärtlichkeit, womit Kunigunde beiden ihre schöne Brust zur Nahrung reichte. Schon verließ die holde Wöchnerin ihr Bett wieder, und der König, der weder Wahnsinn noch Härte oder Lust zum Auffressen an seiner Gemahlin bemerkte, war sehr geneigt, sie ganz von der ihr angedichteten Ermordung ihres ersten Sohnes freizusprechen, und glaubte, auf gute Art hinter den Aufenthalt seines Sohnes zu kommen, wenn er recht kindlich seine Mutter, die ihn doch immer geliebt hatte, darum bäte. Er schrieb ihr zu diesem Ende die Entbindung seiner Gemahlin und lud sie ein, herüberzukommen und als Pate bei
der Taufe seiner Töchter gegenwärtig zu sein. Die alte Mutter erschien, Bosheit im Herzen, Freundlichkeit in ihren Mienen, und freute sich ihrer Enkelinnen mit einer solchen Verstellung, daß der König selber nicht wußte, was er denken sollte. Er sprach mit ihr über den Tod seines Sohnes und freute sich, daß seine Gemahlin diesmal doch gar keine Anwandung gehabt habe, den Kindern ein Leid zuzufügen, sondern ihrer im Gegenteil mit großer und wahrer mütterlicher Zärtlichkeit warte und pflege.Die Königin-Mutter lächelte höhnisch und bat ihren Sohn, nicht zu früh zu richten; denn nichts könne sie von dem Glauben abbringen, daß seine Gattin eine Zauberin sei und gewiß noch ihn und das ganze Land unglücklich machen werde, und er könne sie sicher darnach beurteilen, ob sie die Taufe der Kinder nicht hindern und sie lieber ihren verfluchten Mitgenossen geben werde, um sie ihren Götzen zu opfern oder in den geheimen Künsten der Zauberei zu erziehen. Der König nahm sich vor, die ganze Nacht über die Sicherheit der Kinder zu wachen, aber kaum hatte er den letzten Bissen bei der Abendtafel genossen, so entschlief er sanft, und die Grausame behielt freie Hand, der unglücklichen Kunigunde den letzten und ärgsten Possen zu spielen; denn auch diese lag kraft eines ähnlichen Schlaftrunks, wie ihn der König bekommen hatte, mit ihrer treuen Wärterin in einem tiefen Schlafe. Die holden Kinder folgten ihrem Bruder in den Schloßgraben, und ihre Stelle ersetzten ein paar häßliche graue Katzen. Als sie diese Untat ausgeführt hatte, begab sie sich voll höllischer Freude in ihr Schlafgemach und erwartete den Ausgang ihres höllischen Werkes.
Gegen Morgen stürzte der König totenblaß zu ihr hinein und erzählte ihr, daß die Kinder fort seien und statt ihrer ein paar scheußliche Katzen auf dem Bette seiner festschlafenden Gattin herumkröchen. »Siehst du meine Prophezeiung bestätigt?«rief die Alte. »Laß die Zauberin heute am Tage verbrennen, bevor sie sich an deine Person und Reich wagt. Der Zorn des Königs fand diesen Vorschlag sehr gerecht; er ließ schnell einen Scheiterhaufen errichten, und als
die unglückliche Königin erwachte, waren bereits alle Anstalten zu ihrer schleunigen Hinrichtung gemacht. Sie suchte ihre holden Kinder; aber sie schrak arg zusammen, als der König ihr im heftigsten Zorn ihr Verbrechen vorwarf und den augenblicklich zu erwartenden schmählichen Tod ankündigte. Sie ergriff augenblicklich ihr siebentes Hemde, an dem nur noch wenige Stiche zu nähen waren, und ging mit einer Gelassenheit, die die Stifterin ihres Unglücks nur noch mehr empörte, den Weg ihres Todes.Auf der letzten Stufe zum Scheiterhaufen schnitt sie den Faden des eben vollendeten Hemdes ab, und in demselben Augenblicke sprengten sieben stattliche Ritter auf weißen Pferden einher, umringten den Scheiterhaufen, nahmen die froh verwunderte Kunigunde herab und drangen durch das Volk mit ihr zum König, der weinend in seinem Zimmer saß und es nicht über sich vermochte, die ihm so teuer gewesene Gattin leiden und sterben zu sehen. Er hörte das Getümmel im Schlosse schon von ferne und war ganz starr vor Freude, als sich die Tür öffnete und seine Gemahlin mit ihren Kindern im Arm hereintrat. Vor ihr lief ein schöner Knabe, und hinter ihr folgten die sieben Ritter, die alle gesund und wohl waren; nur dem sechsten der Brüder fehlte ein Auge, das er durch jene Träne verlor, die Kunigunde um den Verlust ihres Sohnes weinte. »Meine Gattin! Meine Kinder!«rief der erstaunte König, und seine Freude vermehrte sich noch, da Kunigunde zu reden anfing und, von Cölestin unterstützt, ihm die ganze Geschichte ihrer Leiden und ihres Gelübdes erzählte. »Oh, du treue, treue Schwester«, rief der glückliche Mann und Vater, »du bist eine seltene Perle! Ich will dich bewahren wie den Apfel meines Auges!« Er umarmte die Brüder und fragte, wie sie zu den Kindern gekommen seien, worauf sie ihm sagten, daß sie immer unsichtbar ihre gute Schwester umschwebt hätten und also auch zugegen gewesen seien, als seine Mutter die Kinder nach ihrer Meinung in den Schloßgraben, tatsächlich aber ihnen in die Arme geworfen habe.
»Man suche meine Mutter!« rief er erzürnt, ihres Verbrechens und
boshaften Rats gedenkend. Aber während Kunigunde sich bemühte, die Liebe ihres Gemahls zum Besten ihrer Peinigerin zu benutzen, erfuhr diese nicht nur die Rettung der Unschuldigen, sondern auch die Anwesenheit der von ihr getöteten Kinder und sieben fremder Ritter. Gefoltert von der Angst vor ihrem Sohn und von ihren eigenen Gewissensbissen gequält, stürzte sie sich aus dem hohen Fenster in den Schloßgraben hinab, wo sie auch gleich ihren Tod fand und jede Rettung zu spät kam. Der Leichnam ward seinem Stande gemäß mit aller Pracht beigesetzt, und die glücklichen Menschen freuten sich, von dieser bösen und ohne Ursach hassenden Frau erlöst zu sein.Als der erste Rausch der Freude vorüber war, gedachten sie auch ihres alten Vaters und reisten nach einigen Tagen sämtlich nach seinem Schlosse, wo sie ihn in einem hohen Alter, aber fast in dem Zustande eines Kindes fanden. Er erinnerte sich ihrer nur mit Mühe und schauderte zusammen, als sie nach seiner Frau fragten. Das Schloß war wie ausgestorben, der Hof mit hohen Nesseln bewachsen, und ein treuer Diener gab ihnen folgende traurige Auskunft: daß bald nach dem gänzlichen Verschwinden seiner acht Kinder der alte Herr wie sinnlos geworden sei; er habe seine Gemahlin mit Vorwürfen überhäuft und sie so gequält, daß sie endlich das Schloß verlassen, alle Schätze und zugleich seine Bewohner mitgenommen habe und nur er allein bei seinem alten Herrn zurückgeblieben sei. Sie dankten dem guten Alten für seine Treue und nahmen ihn und seinen kindischen Herrn mit fort. An dem Park, wo das Landhaus der Frau von West lag, stieg Cölestin vom Pferde und wollte dorthin gehen; aber er fand einen wüsten leeren Fleck, und sie kamen dahin überein in ihren Vermutungen: daß eine gottlose Fee unter der Maske der Frau von West gesucht habe, sie alle unglücklich zu machen, daß aber ihre Tugend den Sieg davongetragen habe. Sie machten in der Folge nur eine Familie aus, und die guten Ritter wiegten mit Vergnügen die schönen Kinder Kunigundens auf ihren Knien.
Der Popanz
Es war einmal ein König, der hatte eine sehr schöne Tochter, die schönste Prinzessin, die man jemals mit Augen gesehen; schon als Kind verliebten sich alle in sie. Ihr Vater und ihre Mutter hatten sie mit einem benachbarten Königssohn versprochen, der sehr häßlich und bucklicht, dessen Mutter aber eine Zauberin war.
Inder Nachbarschaft der Prinzessin wohnte ein Pastetenbäcker, der so schöne Pasteten backte, daß der König und der ganze Hof von keinem andern Pasteten nahm als von ihm. Daher kam es, daß er die Prinzessin einst sah und sie ihn. Beide verliebten sich ineinander und so heftig, daß sie eins ohne das andere nicht mehr leben zu können glaubten. Da nun die Prinzessin immer größer ward und endlich die Zeit herannahte, daß sie mit dem bucklichten Prinzen Hochzeit machen sollte, wußte sie sich nicht mehr zu helfen vor Schmerz. In ihrer Angst des Herzens wendete sie sich an ihre Amme und entdeckte ihr ihre Liebe zu dem Pastetenbäcker. Die Amme war sehr erschrocken hierüber und ermahnte sie, diese Liebe fahrenzulassen, da sie doch den Pastentenbäcker nie heiraten könne und dürfe, und dagegen ihre Gedanken auf den Prinzen, ihren künftigen Gemahl, zu richten. Die Prinzessin aber weinte und schluchzte und versicherte ihrer Amme, daß sie nicht eher essen und trinken werde, bis sie ihr in ihrer Liebe Rat gegeben habe. Die Amme, die wohl wußte, daß die Prinzessin hielt, was sie sagte, war sehr bestürzt und bat sie, nur ruhig zu Bett zugehen und versprach ihr, auf morgen nachzusinnen, was sie für sie tun könne. Diese Amme verstand auch etwas von Feerei und der geheimen Wissenschaft und riet am folgenden Tage der Prinzessin, ihren Vater zu bitten, daß er die Hochzeit noch ein Jahr aufschiebe; unterdessen würde sich Rat finden und könne sie so lange nach wie vor ihren Pastetenbäcker sehen. Dies geschah, und da die Amme um das Geheimnis wußte, so konnte er täglich die Pasteten in ihr Zimmer bringen und beide sich ungestört sprechen, so lange sie wollten. Auch vergaß derselbe niemals, etliche Pasteten für
die Amme mitzubringen, die mit Gold gefüllt waren; so gewann ihn diese sehr lieb und versprach ihm, alles zu tun, was möglich wäre, ihnen zu helfen.Da die beiden Verliebten aber täglich vertrauter wurden und oft halbe Tage lang zusammensaßen, ohne Vorsicht zu gebrauchen, so geschah es, daß es, als sie einst wieder so recht traulich beisammen saßen, dem Prinzen, ihrem Bräutigam, einfiel, den König zu bitten, mit ihm zu seiner Braut zu gehen. Aber welch Erstaunen ergriff sie, als sie beim Eintritt die schöne Prinzessin in den Armen des Pastetenbäckers sahen! Der Vater wollte fast vor Schrecken in Ohnmacht fallen, der Prinz aber vor Wut zergehen. Der Pastetenbäcker benutzte die Verwirrung und lief davon. Der Prinz, im Übermaß seiner Wut, verwünschte sie alle, da er von seiner Mutter die Feerei gelernt hatte, daß sie in derselben Stellung unbeweglich blieben, bis er sie wieder aufweckte; dies geschah auch sogleich. Ober die Amme aber hatte er keine Macht, da sie selber eine Fee war. Sie war sehr betroffen über den Vorfall; da sie nicht mächtig genug war, den Zauber zu vernichten, so bedachte sie sich kurz, ging zum Pastetenbäcker und sagte ihm alles. Dieser war sehr betrübt darüber; die Amme tröstete ihn aber und sagte ihm, wenn er wirklich die Prinzessin so sehr liebte, wie er zeige, so könne er ihr noch helfen und den Zauber auflösen. Er beteuerte seine Liebe und war sogleich bereit, alles zu tun und auch sein Leben dafür hinzugeben.
»Nun gut«, sagte die Amme, »so sollst du dich anschicken, eine weite Reise zu machen. In einem Lande, viele tausend Meilen von hier, wohnt ein Popanz, der oberste aller Popanze, dem nichts verborgen ist und der das Größte und Kleinste weiß, was durch die Zauberei geschieht und geschehen kann; zu dem mußt du hin und sieben Federn aus seinem Schwanz zu kriegen suchen.«Als dies der Pastetenbäcker hörte, war er sehr erschrocken und antwortete der Amme, daß solches unmöglich wäre, da er wisse, daß alle Menschen, die zu dem Popanz kämen, von ihm aufgefressen würden. Die Amme eröffnete ihm aber, der Popanz habe eine schöne Frau, die
keine Menschen fresse; diese müßte er zu sprechen suchen und sie bitten, ihm zu helfen. Sie wisse durch ihre Kunst, daß der Popanz alle Nachmittage um vier Uhr ausgehe und nicht zu Hause komme vor Abend; unterdessen könne er hingehen und die Frau bitten, ihm die sieben Federn zu verschaffen und sieben Fragen zu beantworten, die sie ihm jetzo sagen wolle: Die erste betreffe die Entzauberung des Schlosses und seiner Bewohner; die zweite: wie eine andere Prinzessin, die schon seit vielen tausend Jahren im Schlaf liege, aufgeweckt werden könne; die dritte, wie der Weinstock in dem Garten eines Königssohns, der sonst so schöne Trauben getragen, nun aber verdorrt und dieser drüber in Krankheit gefallen, wieder zum Grünen zu bringen; viertens: woher es komme, daß der Prinz so häßlich und bucklicht sei, da doch seine Mutter eine Fee sei und ihn so schön, als sie gewollt, hätte schaffen können; fünftens: wo der Mann wohne, der Tag und Nacht auf dem Rücken trägt; sechstens: wo das Schiff zu kriegen, das so gut zu Lande als zu Wasser geht; siebentens: wie die Frau des Popanz zu entführen wäre; denn dazu müßte er sich zur schuldigen Dankbarkeit entschließen. An ihrer Einwilligung wäre nicht zu zweifeln; denn das würde die Bedingung sein, worunter sie ihm die sieben Federn aus dem Schwanz des Popanzes würde verschaffen wollen, indem sie sehr unglücklich mit demselben lebe. Die Amme gab ihm hierauf einen versiegelten Zettel und sagte ihm, er solle ihn nicht eher aufbrechen als in der Nacht um zwölf Uhr vor dem Tore der Stadt, und alsdann solle er die Worte, die darauf geschrieben stünden, dreimal laut ausrufen; sogleich werde er sich in einem dichten Walde befinden, in dem ein großes Schloß stehe. Er solle sich aber in dem Walde verborgen halten, bis die Glocke vier geschlagen habe. Alsdann solle er in das Schloß gehen und mit der Frau des Popanzes sprechen. Dies alles versprach er getreulich zu erfüllen oder zu sterben.Als nun Mitternacht kam und er vor dem Tore die drei Wörter ausgesprochen hatte, befand er sich auf einmal in dem Walde nahe bei dem Schloß des Popanzes. Er verbarg sich, so gut er konnte, in dem
Dickicht, und es währte nicht lange, so sah er den Popanz ausgehen, der fürchterlich umherschnupperte, als röche er Menschenfleisch. Als er ihm aus den Augen war, ging er in das Schloß zu der Frau und bat sie um ein Nachtlager. Sie war sehr verwundert, als sie ein menschliches Wesen zu ihr eintreten sah: »Mein Gott«, rief sie aus, »wie kommst du in diese Gegend? Es ist dein Glück, daß du nicht früher gekommen bist und meinen Mann getroffen hast; er hätte dich gewiß gefressen. Er ist aber auf die Jagd gegangen nach seiner Gewohnheit. Ich will dir zwar etwas zu essen geben, aber mache, daß du rasch wieder fortkommst, sonst frißt dich mein Mann, wenn er zurückkehrt und dich hier trifft; denn er spürt sogleich, wenn ein Mensch im Hause ist.«Der Pastetenbäcker fing aber an, die Frau sehr zu bitten und ihr die ganze Sache vorzutragen: Er wollte weder essen noch trinken und bat sie nur inständig um die sieben Federn und um die sieben Fragen. Die Frau war sehr verwundert darüber und antwortete, solches wäre unmöglich; ihr Mann würde sich weder lassen die Federn ausziehen noch die sieben Fragen beantworten, und wenn er im Hause bliebe, so wäre sein Tod gewiß: Er möge sich verstecken, wo er wollte, ihr Mann fände ihn doch. Er bat aber so dringend und verhieß ihr, alles für sie zu tun, was sie nur verlangte, wenn sie ihm dagegen zu den sieben Sachen verhelfe. Endlich sagte sie ihm zu, mit dem Beding aber, daß er sie mit sich hinwegführe. Darauf überlegten sie miteinander, wie es anzustellen wäre. Indessen sie noch darüber redeten, hörten sie den Popanz kommen. Die Frau wußte in der Geschwindigkeit keinen andern Rat, als ihren Freund unter das Bett zu verstecken, und daß er da bliebe, bis am folgenden Tage der Popanz wieder auf die Jagd ginge.
Kaum war der Freund versteckt, so trat der Popanz schon in die Stube herein, und das erste, was er aussprach, war: »Frau, ich rieche Menschenfleisch.«Und sogleich fing er an zu suchen, daß der armen Frau ganz angst und bange ward. Er befahl ihr, ihm zu sagen, wo der Mensch sei, damit er ihn sogleich fressen könne; denn er sei noch
sehr hungrig und müde von der Jagd, da er nicht viel gefunden. Die Frau versicherte, es sei niemand da; einer sei zwar dagewesen, aber sogleich wieder davongelaufen, als er gemerkt, wo er hingekommen. Dieser werde wahrscheinlich noch im Walde versteckt sein, wo er ihn morgen noch aufspüren könnte. Darauf beruhigte sich der Popanz und legte sich mit seiner Frau zu Bette.Als sie nun merkte, daß er eingeschlafen war, da er laut schnarchte, so faßte sie eine Feder in seinem Schwanz und riß sie mit aller Gewalt heraus. Sogleich wachte der Popanz auf und schrie vor Schmerz: »Weib, bist du toll? Was ist das, daß du mich so am Schwanze rupfst?« —»Ach, lieber Mann«, antwortete die Frau, »verzeihe mir. Ich träumte eben einen fürchterlichen Traum, wie in einem fernen Lande ein Schloß mit allen seinen Bewohnern erstarrt und versteinert worden durch die Macht eines bösen Zauberers, und mir war, als wenn ich auch darin war und mit versteinert wurde. Daher packte ich dich so fest. Könnte so etwas wohl wirklich geschehen?« — »Allerdings«, antwortete er; »neulich hat sich eben dieser Fall ereignet in einem fernen Königreiche.« — »Mein Gott«, sagte die Frau, »ist denn der Zauber nicht wieder aufzulösen?« — »O ja«, erwiderte er, »aber das Mittel dazu ist keinem Menschen bekannt.« — »Nun was ist es dann für eins, lieber Mann?« —»Derjenige, der die Prinzessin liebt und durch den das Unglück geschehen ist, müßte hier in unsern Wald kommen und zu dem Wasserfall gehen, der darinnen ist, und warten, bis ein ganz kleiner unansehnlicher Zwerg erscheint, der ein Felsenstück auf den Schultern trägt und in das Wasser schmeißt. Doch, Weib, laß mich schlafen; was nützt dir diese Erzählung? Ich bin müde.« Sie bat ihn aber so schön, daß er fortfuhr: »Dies alles würde ihm doch noch nichts helfen; denn der Zwerg würde nicht mit ihm gehen wollen, es sei denn, daß er eine von meinen Schwanzfedern hätte und ihm damit ins Gesicht schlüge: dann würde der Zwerg plötzlich zu einem großen Riesen werden und freundlich mit ihm gehen, wohin er wollte. Derselbe müßte dann das verwünschte Schloß emporheben und umdrehen und der Geliebte der Prinzessin
sie mit der Feder berühren, worauf alles wieder wie vorher leben und der Zauber gelöst sein würde. Aber das wird nimmer geschehen; denn wer wollte mir wohl eine Feder ausziehen? Und nun laß mich schlafen.«Die Frau war still; wie sie ihn aber wieder schlafen hörte, riß sie ihm abermals eine Feder aus. Der Popanz fuhr noch heftiger auf als das erstemal. »Ach, Mann, ich bitte dich um Verzeihung; ich habe soeben wieder einen ängstlichen Traum gehabt: Mir träumte, wie eine schöne Prinzessin eines fernen Königreichs schon seit vielen tausend Jahren in einem Zauberschlaf versenkt liege und in dem ganzen Palast keine lebendige Seele mehr sei, da alles schon ausgestorben.« — »Du hast recht, Frau«, erwiderte der Popanz, »es gibt ein solches Schloß, wo eine versteinerte Prinzessin schläft und alles ausgestorben ist bis auf ein kleines Hündlein, das immer vor dem Fenster liegt und ihn bewacht, indem, solange es dies tut, nichts Lebendiges hinein kann; denn sobald sich was nähert, verwandelt es sich in ein fürchterliches Ungeheuer, das alles zerreißt. Es gibt aber eine Stunde des Tages, wo es das Fenster verläßt und zu der Prinzessin geht und sich bei ihr schlafen legt. Diese Stunde ist von eins bis zwei Uhr, und wenn sich alsdann jemand hineinschleichen könnte und sich dem Hündlein näherte, ohne daß es erwachte, und ihm vor den Kopfe schösse, aber gerade in die Mitte des weißen Sterns daselbst und so, daß sein Blut die Prinzessin benetzte, so würde sie aus dem Zauberschlafe erwachen; träfe er aber nicht also, so wäre sein Tod gewiß. Nun rat ich dir, Frau, wecke mich nicht zum dritten Male mit deinen beschwerlichen Träumen.« Damit drehte er sich um und fing bald wieder an zu schnarchen.
Sobald aber die Frau dies hörte, zog sie ihm zum drittenmal eine Feder aus. Jetzt ward der Popanz ganz wütend und wollte sie zum Bette hinauswerfen; er schrie: »Weib, du mußt besessen sein, mich schon wieder so zu rupfen; ich glaube, daß ich blute.«Sie versicherte ihm aber, sie habe sich bloß an ihm festgehalten aus Furcht vor einem Traum, der sie befallen. »Nun, was hast du denn schon wieder ge
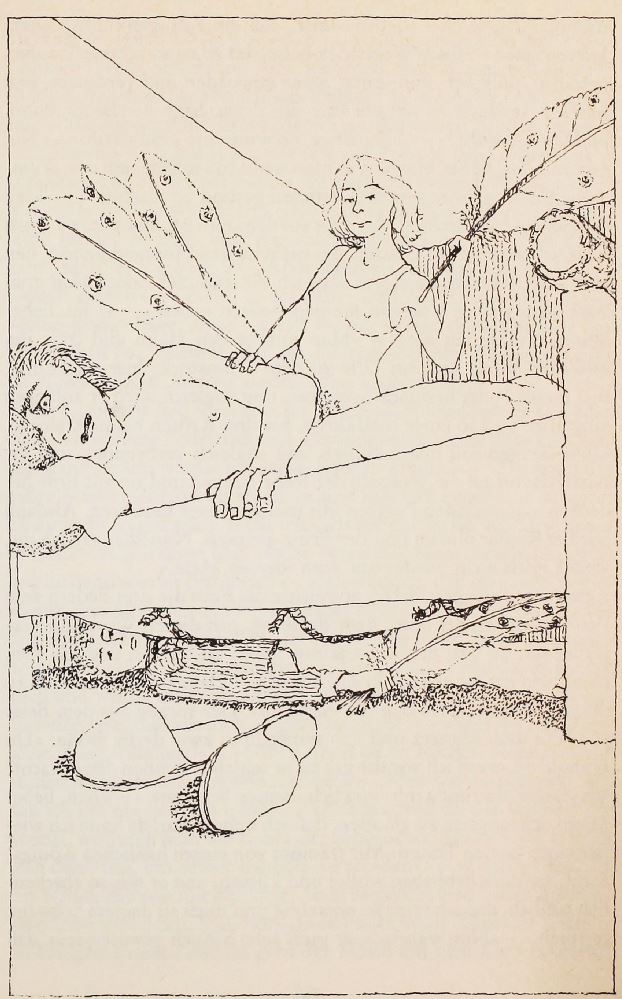
Kaum war er eingeschlafen, so reichte die Frau die drei Federn dem Pastetenbäcker, der unter dem Bette lag, mit diesen Worten: »Verwahre sie; du hast gehört, was mit ihnen zu tun ist, und ich weiß nicht, wie ich die andern kriegen werde.« Damit drehte sie sich zu ihrem Manne und riß ihm die vierte aus. Der sprang aus dem Bette vor Wut und Schmerz und gab seiner Frau zwei derbe Stöße: »Du Unhold du, werd ich vor dir gar nicht schlafen können diese Nacht? Ich glaube, du rupfst mir wirklich meinen Schwanz.« —»Ach, lieber Mann, ich fange an zu glauben, daß ich behext bin; da hatte ich wieder einen fatalen Traum: Mir träumte von einem häßlichen Königssohn, der mich liebhaben wollte und küssen, und er war so abscheulich häßlich, daß ich mich so entsetzte und mich an deinem Schwanz festhielt.« —»Nun wahrlich, er muß sehr häßlich gewesen sein, daß
du mich so gezupft hast!« — »Ach ja, stelle dir vor eine Figur von kaum zwei Fuß, hinten und vorn mit einem Buckel, einem Kopf, der so breit ist, als sein ganzer mißgeschaffner Leib lang ist, und darauf eine Nase, die noch mit drei andern kleinem Nasen besetzt ist, und rote Augen.« —Hierüber konnte sich der Popanz des Lachens nicht enthalten, und er rief aus: »Aha, du hast den Prinzen Kabubulusch gesehen!« —»Ei, lieber Mann, also gibt es solch einen?« — »Ja, und seine Mutter ist dazu eine der schönsten Frauen, die man sehen kann, und Fee zugleich.« — »Aber kann sie ihm denn keine andere Gestalt geben?« — »Nein, es sei denn, daß der Hahn, von dem ich vorhin gesagt habe, seine Gestalt wieder kriegt, dessen Mutter ihn verwünscht hat, dadurch, daß man ihm die Sporen abschneidet und sie in des Prinzen Fersen steckt. Nun aber schlafe.«Er tat's, aber sie ließ ihn nicht lange schlafen, sondern riß mit aller Gewalt noch eine Feder aus und schrie dabei fürchterlich: »Ach, lieber Mann, schon wieder ein schrecklicher Traum!« — »Du hörst die ganze Nacht nicht auf zu träumen und mich zu zupfen; sieh, wenn ich dir nicht so gut wäre, fräße ich dich auf der Stelle: Ich habe heute so nicht viel gefressen und rieche beständig Menschenfleisch. Was hast du denn wieder geträumt?« —»Ich träumte, daß du ausgegangen warest, und plötzlich trat ein Fremder herein, der einen Kasten auf dem Rücken trug, worin Tag und Nacht sein sollte. Ich war neugierig und bat ihn, mich hineinsehen zu lassen, und siehe da, er packte mich und wollte mich in seinen Kasten stecken: Daher muß es gekommen sein, daß ich dich so gezogen habe.« — »Was du für närrisches Zeug träumest!« — »Gibt's denn einen solchen Mann?« — »O ja, den habe ich ja in meinem Lande!« —»Aber wie kommt es denn, daß ich ihn nie gesehen habe?« — »Das ist, weil du das Mittel nicht kennst, wodurch man ihn sieht oder gebrauchen kann.« —»Was muß man denn tun, um seiner habhaft zu werden?« — »Das ist ebenfalls ein Mittel, das von mir abhängt; denn es gehört eine Feder aus meinem Schwanze dazu. Man muß diese Feder in die Ritze des Kastens zu bringen suchen; alsbald geht der Mann mit dem Kasten, wohin
man will, und tut, was man ihm befiehlt. Jetzt aber, hoffe ich, wirst du mich schlafen lassen und nicht mehr träumen; denn die Nacht ist bald zu Ende.«Er entschlief wieder; die Frau, nicht faul, riß ihm die sechste Feder aus. Er schalt fürchterlich: »Verdammtes Weib! Ich glaube wirklich, daß du besessen bist.« —»Ach, lieber Mann, ich weiß nicht, wie ich diese Nacht mit ungeheuern Träumen geplagt bin: Eben träumte ich, daß in deiner Abwesenheit hier Leute hereinkamen, die mir sagten, daß sie ein Schiff hätten, das so gut zu Lande als zu Wasser ginge, und ob ich es nicht sehen wollte. Als ich hinausging, wollte mich einer packen und in das Schiff setzen; daher meine Angst. So ein Schiff gibt es aber wohl nicht?« — »O ja, und es gehört mir, es kann niemand sich desselben bedienen, es sei denn, daß er eine Feder aus meinem Schwanze hätte.« — »Wenn dies nun wäre, würdest du denn nicht mit deinen andern Federn dagegen wirken können?« —»Nein, weil mein Schwanz nur sechzig Federn hat und sie alle sechzig ihre eigene Bestimmung haben; und wenn man mir eine Feder auszöge mit dem Gedanken von einer dieser Bestimmungen, so träfe man immer die dazugehörige, so daß ich alsdann keine Macht mehr darüber hätte.« —»Wie findet man aber das Schiff?« —»Man kann nicht fehlen; man legt die Feder vor sich an die Erde nieder, sogleich erhebt sie sich und fliegt ganz langsam zu dem Ort hin, wo das Schiff steht: Hier läßt sie sich herunter, und man nimmt sie und pflanzt sie als Fahne auf den Mast, worauf es so gut zu Lande als zu Wasser geht. Nun aber sag ich dir, störst du mich noch einmal, so binde ich dich an die Bettstelle, damit ich Ruhe vor dir habe.«
Er drehte sich um und schlief, aber nicht lange; denn die Frau zögerte nicht, ihm auch die siebente und letzte Feder auszureißen, worauf er aufsprang und sie wirklich anbinden wollte. Sie bat und liebkosete ihn aber so viel, daß er sich wieder beruhigte; sie versprach ihm heilig, es nicht wieder zu tun, sie wolle lieber die ganze Nacht wach bleiben, um den bösen Träumen zu entgehen. —»Nun, was hast du denn schon wieder geträumt?« — »Es war mir, als wenn
ich von einem fremden Manne entführt würde, und zwar mit meinem Wissen und Willen; könnte das wohl geschehen, und ohne daß du es merken würdest?« — »Es könnte wohl gehen, aber wehe dir und dem, der es unternähme! Ihr wäret beide des Todes, es wäre denn, daß er die Feder hätte, wodurch ich dich halte, und was freilich nicht gut wäre für mich, wiewohl für viele andere; denn dein Gemahl, der Prinz, welchen du glaubst, daß ich ihn gefressen habe, ist eben der Prinz, der immer krank ist, und dein Sohn, das ist der Weinstock.«Mit diesen Worten schlief er müde von dem vielen Wachen wieder ein. Kaum hörte sie ihn schnarchen, so stand sie leise auf, zog den Pastetenbäcker unterm Bette hervor und schlich mit ihm leise zum Schlosse hinaus. Das erste, was sie taten, war, in dem Wald den Zwerg aufzusuchen und mit ihm zu tun, wie sie von dem Popanz gehört hatten. So taten sie es auch mit dem Kasten, worin Tag und Nacht, und dem Land- und Wasserschiff; sogleich setzten sie sich in dieses und fuhren fort.
Unterdessen war es Tag geworden, und der Popanz erwachte. Als er seine Frau vermißte, fiel es ihm aufs Herz; er besah seinen Schwanz, und da er seine Federn zählte, ward ihm alles klar. Sogleich faßte er die Feder an, die ihm alles offenbarte, und erfuhr dadurch die Flucht seiner Frau mit dem Pastetenbäcker.
Der Popanz war außer sich vor Bosheit und Wut und wollte schier von Sinnen kommen; er schwur, sie zu verfolgen und sich zu rächen, und sollte er auch darüber seinen ganzen Schwanz einbüßen.
Er säumete auch nicht lange und machte sich gleich fertig. Er nahm eine Feder, biß darein, und sogleich waren mehr als hunderttausend Soldaten zu Pferde hinter dem Schiff mit den Flüchtigen her. Aber die Frau, die das merkte, warnte den Pastetenbäcker und ließ sie dem Schiffe ganz nahe kommen; alsdann befahl er dem Riesen, sie alle zu nehmen und hundert Klafter tief in die Erde zu schmeißen. Das geschah auf der Stelle, und alle verschwanden mit Roß und Mann. Als dies der Popanz sah, biß er in eine andere Feder, und sogleich
wurde das Schiff verfolgt von einem Heer Schlangen, Eidechsen, Kröten und anderm giftigen Gewürm. Der Pastetenbäcker steckte in der Angst noch eine von den Federn auf den Mastbaum, und das Schiff flog, wenn es vorher nur ging; das Gewürme aber immer stärker hintendrein. Endlich kamen sie an einen großen See. Hier befahl er dem Schiff, stillzustehen, und sowie das Ungeziefer nahe genug war, ließ er den Kasten drehen und finstere Nacht machen. Kaum war das geschehen, so fuhr das Schiff wieder von dannen; das Gewürm aber verfolgte es und fiel alles in das Wasser.Unterdessen kamen sie in das Königreich; denn der Popanz hatte sie nicht weiter verfolgt, indem er gewiß glaubte, die Tiere würden sie einholen und zu Tode quälen. Der Pastetenbäcker ließ den Riesen das mit seinen Bewohnern versteinerte Schloß umkehren, berührte seine geliebte Prinzessin mit der Feder, und sogleich erwachte sie samt allen aus der Erstarrung. Die beiden Geliebten freuten sich des lebendigen Wiedersehens und umarmten sich inbrünstig.
Der König, gerührt über die treue Liebe und über den Mut und die Standhaftigkeit seines und ihres Erlösers, dagegen aber erzürnt über die Untat des Prinzen, gab sogleich seine Einwilligung in die Vermählung der beiden Geliebten. Sein neuer Eidam dankte für diese Güte, bat aber noch um einen kurzen Urlaub, indem es ihm obliege, noch die andern mit der gegenwärtigen verbundenen Bezauberungen aufzulösen, ehe er würdig wäre, die Hand der geliebten Prinzessin zu empfangen. Es ward ihm, wiewohl nicht zu gern, verstattet. Er reiste weiter, die Frau des Popanzes aber blieb bei der Prinzessin.
Er fuhr beinahe drei Jahre, ehe er in das Königreich kam, in dem sie viel Ungemach von Zauberern und auch vom Popanz zu erdulden hatten. Endlich kam er an das Schloß der Prinzessin, die im tausendjährigen Schlafe lag; er tat, wie ihm gesagt war, und die Prinzessin erwachte. Sie sprach sogleich zu ihm: »Großmütiger Fürst,
wieviel Dank bin ich dir schuldig! Du hast mir das Licht und Leben wiedergegeben, aber zugleich mich nur erweckt, um in den größten Schmerz zu versinken. Das Hündlein, das du getötet hast, ist mein Geliebter, ein edler Prinz von Geburt, und keiner vermag ihm das Leben zu geben als du. Laß dein Werk nicht halb vollendet und erwecke auch ihn.« — »Wie kann ich das?«fragte der Prinz. »Hier«, sagte die Prinzessin, indem sie ihm ein blankes Schwert reichte, »haue dem Hündlein den Kopf ab und lege ihn säuberlich hier aufs Bett.«Und nun entblößte sie ihren schönen Hals, der so weiß wie Alabaster war: »Nun haue auch meinen Kopf ab, und wenn das geschehen ist, setze meinen Kopf auf des Hündleins Rumpf und des Hündleins Kopf auf meinen Rumpf, und du wirst Wunder sehen.« Der Prinz tat, wie sie sagte. Kaum war es geschehen, so sprangen die Köpfe wieder zurück, jeder auf seinen Rumpf, und die Prinzessin steht lebendig und unversehrt da; aus dem Hündlein ist aber plötzlich ein schöner Prinz geworden, der ihr um den Hals fiel und ausrief: »Ja, du liebst mich, und ich werde von nun an mehr Zutrauen zu dir haben.« Hierauf dankten sie ihrem Befreier und erzählten ihm ihre Geschichte.Der junge Held fuhr weiter und gelangte zu dem Prinzen mit dem Weinstock; er tat, wie er vernommen hatte, und beide fingen wieder an zu blühen, aber der Weinstock war noch nicht wieder verwandelt: Dies geschah durch Berührung mit der einen übrigen Feder, und Sohn und Vater erkannten und freuten sich herzinniglich, und noch mehr, als sie von ihrem Befreier vernahmen, daß ihre Gattin und Mutter noch am Leben und ebenfalls erlöst war. Sie setzten sich darauf alle zusammen ins Schiff, nahmen auch den Hahn und brachten ihn der schönen Fee, durch ihn die Verwünschung ihres Sohnes zu lösen und dessen Gestalt zugleich durch die Entzauberung des Hahnes, dessen Mutter unterdessen gestorben war, herzustellen. Die Fee und ihr Sohn, der Nebenbuhler unsers Helden, wurden dadurch mit ihm versöhnt. Dieser kehrte nun mit seinen Gefährten zurück zu seiner geliebten Prinzessin. Alle freuten sich des Wiedersehens, zumal
die gewesene Frau des Popanzes mit ihrem Mann und Sohn. Sie feierten aufs neue ihre Vermählung mit der des Prinzen und der Prinzessin, die herrlich und in Freuden begann und endigte.
Die drei Gürtel
Es war einmal vor Zeiten ein König, der eine schöne, junge und tugendhafte Gemahlin hatte, die ihn, wie er sie, sehr zärtlich liebte. Aber leider blieb dieses Glück nicht von langer Dauer. Der König war ein lebhafter, feuriger Herr von einem etwas unbeständigen Charakter; er hatte den Grundsatz mit allen Männern gemein: Das Einerlei ermüdete ihn, und er empfand in dem Genuß der schönsten und liebenswürdigsten Frau Langeweile. Vergebens bemühte er sich, dies zu verbergen: Seine Gemahlin merkte es nur zu schnell und härmte sich im stillen über die Veränderung in seinem Betragen. Umsonst unterdrückte sie jeden Vorwurf; umsonst war sie zärtlicher, zuvorkommender, liebenswürdiger als je: Seine Unbeständigkeit, sein Hang zur Veränderung war zu groß! Er liebte sie freilich noch immer, er sagte ihr dies auch täglich, aber er nahm doch mit dem größten Vergnügen einen Ruf seines Oheims an, der ihn bat, gegen einen seiner Nachbarn mit zu Feld zu ziehen. Die Königin war untröstlich, als er ihr diese Nachricht hinterbrachte; sie ging weinend zu Bette und stand mit Tränen wieder auf. Der König wandte zwar alle Mittel an, sie zu beruhigen, aber da alles vergebens war, so stahl er sich einst um Mitternacht von ihrer Seite, drückte einen herzlichen Kuß auf ihre blassen Wangen, ließ ihr einen zärtlichen Brief zurück und war, als sie erwachte, schon mehrere Meilen von ihr entfernt.
Die ersten Tage nach seiner Abreise überließ sich die Königin so heftig ihrem Schmerz, daß man für ihre Gesundheit besorgt war; aber die wohltätige Zeit machte ihn nach und nach milder, und die
Königin fing wieder an, ein Segen ihrer Untertanen, die Mutter aller Trauernden und Notleidenden zu werden. Eines Tages war sie in fremder Tracht in der Stadt umhergeschlichen, hatte manche Träne getrocknet, manchen schweren Kummer leichter gemacht, und war schon auf dem Rückweg, da hinkte ihr ein altes, krummes, scheußlich aussehendes Wesen entgegen: Die Gasse war enge, und die holde Königin drängte sich ganz an die Wand, um auch nicht in dem kleinsten Punkt diese entsetzliche Häßlichkeit zu berühren; aber in dem Augenblick, wo die Alte an ihr vorbeiging, glitt sie aus und fiel, so lang sie war, in den Kot. Jeder andre würde hierüber laut gelacht haben, aber die gute Königin lachte nicht: Sie eilte schnell hinzu, überwand all ihren Abscheu und half der Alten in die Höhe. Dies war freilich kein kleines Stückchen Arbeit; denn die Hexe war schwer und mühsam aufzurichten und belegte während des Aufstehens ihre Helferin mit den schändlichsten Namen: Ja, sie vergaß sich so sehr, daß sie, als ihr die Königin gar nicht antwortete und nach vollbrachter Arbeit sich entfernte, mit der Krücke nach ihr schlug, auch so gut gegen die Erde traf, daß sie in zwei Stücke sprang. Dies machte die Alte ganz hilflos, und sie schrie und tobte so lange wechselweise, bis die Königin wieder zurückkehrte und mit einer beispiellosen Geduld die Alte unter den Arm nahm und auf ihr Begehr zu einem kleinen Hüttchen führte, das nicht fern vom Wege ab war.Sobald die Alte in dem engen schmutzigen Stübchen sich gesetzt hatte, eilte Adelheid - so hieß die gute schöne Königin -, ohne ein Wort mit ihr zu reden, aus der Tür. Aber ein plötzlicher Donnerschlag schreckte sie zurück: die alte Hexe war verschwunden, und an ihrer Stelle stand eine große majestätische Fee vor ihr, die sie mit Bewunderung und Vergnügen ansah. »Du bist noch mehr als gut«, hob die Fee endlich an, da sich Adelheid ein wenig erholt hatte; »ich habe dich geprüft, und du stehst von nun an unter meinem Schutz. Zur ersten Probe meiner Gewogenheit nimm diese drei Gürtel von Silber; zwei lege zurück, aber den einen trage: Wenn dieser bricht, so denkt dein Gemahl schon seltener an dich; trage alsdann den
zweiten, und bricht auch dieser, dann lege den dritten an und reise unverzüglich deinem Gemahl nach. Halte dich dann verborgen; aber wenn der dritte Gürtel bricht, dann, Königin, eile, deine Rechte geltend zu machen. Lebe wohl und rechne auf Fatimens Schutz!« Hier verschwand die Fee, und die erstaunte Königin würde alles für Blendwerk gehalten haben, wenn nicht die drei Gürtel in ihrer Hand zurückgeblieben wären.Sobald sie zu Hause ankam, legte sie den ersten wunderbaren Gürtel um, und ob sie gleich befürchtete, daß er brechen möchte, so segnete sie doch dies Geschenk der Fee; denn es gab ihr, solange der Gürtel ganz war, die Beruhigung, daß ihr Gemahl getreu sei und ihrer gedenke. Schon war ein halbes Jahr verflossen, und Adelheid nährte heiße Wünsche für die Rückkehr des geliebten Königs, als plötzlich eines Tages ihr Gürtel in drei Stücke brach. Der Schmerz der Königin kannte lange Zeit keine Grenzen und war um so heftiger, da sie keinen Vertrauten hatte, in dessen Busen sie ihren Kummer niederlegen konnte. Sie fürchtete sich, den zweiten Gürtel umzulegen. Ach! Sie hatte nur zu sehr recht; denn schon in vier Wochen brach er in mehrere kleine Stücke. Diesesmal blieb sie weit gefaßter; sie hatte sich nun schon daran gewöhnt, ihren Gemahl als untreu zu betrachten, und gewissermaßen erwartet, daß der Gürtel brechen werde. Was sie aber noch mehr in Erstaunen setzte, war die Nachricht von dem Tode des Königs, die sich seit diesem Tage allgemein verbreitete. Sie allein wußte, daß er lebte; da sie aber nicht imstande war, es zu beweisen, ohne ihr Geheimnis zu verraten, so schwieg sie, und indem sie die Wahrheit dieses Gerüchts bezweifelte, berief sie ihre treuesten Räte zusammen, empfahl ihnen die Fürsorge für ihre Untertanen auf das angelegentlichste und eröffnete ihnen alsdann, daß sie reisen und ihren Gemahl selber aufsuchen werde, indem er ihr diese Nacht im Schlafe erschienen und ihr entdeckt habe, daß er nicht tot, aber in einer Art von Bezauberung sei, aus der ihn nur ihre persönliche Gegenwart retten könnte.
Damit nun ihr Volk und die übrigen Räte nicht hiervon unterrichtet
würden und wohl gar ein Mißvergnügen darüber entstände, so wolle sie bekanntmachen, daß sie noch heute sich auf ein entlegenes Schloß begebe; hier wolle sie ihrem Schmerz nachhängen und das ganze Trauerjahr niemand als die getreusten Räte sehen. Alle Vorstellungen ihrer Getreuen waren umsonst: Sie war auf alles, auch auf das Ärgste vorbereitet, und da alle Vorstellungen nichts fruchteten, so ergaben sie sich in den Willen ihrer guten Königin, gelobten ihr Treue bis in den Tod und begleiteten sie schon des nächsten Tages auf das ferne Landschloß, von wo sie bald darauf, als eine Pilgerin gekleidet, abreiste. Mehrere Tage waren bereits vergangen, ohne daß irgendein Abenteuer die Reise der schönen Königin aufgehalten hätte. Sie wurde aller Orten gut aufgenommen, es fehlte ihr an nichts; denn die Menschen der alten Zeit waren gastfrei und daran gewöhnt, vornehme Leute in solchen Mummereien reisen zu sehen, um irgendein Gelübde zu erfüllen. Ohne zu wissen, wohin ihr treuloser Gemahl sich gewandt hatte, folgte sie einzig dem Zuge ihres Herzens und hatte einen Weg eingeschlagen, von dem sie erhoffte, daß er sie zum Ziele führen werde.Eines Tages, da sie sehr viel von der Sonnenhitze ausgestanden und fast ermattet war, näherte sie sich gegen Abend einem großen Walde, dessen Dunkelheit sie erschreckt haben würde, wenn nicht das Verlangen nach der darin herrschenden Kühlung alles überwunden hätte. Sie schleppte sich mühsam bis zu seinem Eingange; da warf sie sich in den Schatten der alten hundertjährigen Eichen und beweinte ihr Schicksal mit heißen Tränen. Der brennendste Durst plagte sie; sie sah sich ängstlich nach einer Quelle um, aber die große Ermüdung verbot ihr, danach zu suchen, und sie sank ganz erschöpft auf der Stelle wieder nieder. Schon wollte ihre Geduld, ihre Sanftmut sie verlassen, als sie sich besann, ruhig den Kopf ins Gras legte und im Begriff war, einzuschlummern; da wehte plötzlich ein säuselndes Lüftchen über sie hin, das sie ohne Speise und Trank so sehr erquickte, daß sie nach einigen Minuten völlig stark und wohl genug aufstand, um ihre Reise fortzusetzen. Eine ziemlich große
goldene Nuß, die zu ihren Füßen lag, befestigte sie noch immer mehr in dem Glauben von Fatimens Nähe, und nachdem sie die Nuß verwahrt hatte, trat sie getrost ihren Weg wieder an und verfolgte ihn standhaft, bis mitternächtliches Dunkel alle Gegenstände um sie her verschleierte und sie genötigt ward, bis zur Ankunft des Morgens unter einem Baume Platz zu nehmen.Es war die erste Nacht auf ihrer Reise, wo sie ohne Obdach blieb, und sie wurde doch ein wenig unruhig, wenn sie aus der Ferne das Brüllen der Hyänen, das Jähnen der Tiger und das Geheul der Wölfe hörte. Angstvoll hatte sie ein Stündchen so zugebracht, das ihr dreimal so lang geworden war, als der Mond durch die Wolken brach und mit seinem lieblichen Glanze Adelheidens Herz erfreute. Sie verfolgte nun mutig ihren Weg, und als sie eine Zeitlang geschwind fortgeschritten und dann, um etwas zu ruhen, sich an einen Baum lehnte, war es, als näherte sich der Mond dem Orte, wo sie ruhte, und indem er leicht über sie hinschwand, fiel eine ähnliche goldne Nuß zu ihren Füßen. Froh in dem Besitz dieses zweiten Schatzes, eilte sie freudig vorwärts und ergötzte sich bei der Ansicht der Bäume, an denen sich das blasse Mondenlicht auf eine zauberische Art brach.
Endlich hatte sie das Ende des fürchterlichen Waldes erreicht und trat mit einem Gefühl hoher Freude, das gewöhnlich überstandene Gefährlichkeiten gewähren, aus dem Dunkel hervor. Siehe, da erwartete sie das schönste Schauspiel der Natur, die aufgehende Sonne. Wie angezaubert stand Adelheid; sie hatte nie im Freien einen Morgen so früh gefeiert. Sie wagte nicht, von der Stelle zu gehen, kaum zu atmen, um nur nichts von diesem schönen Anblick zu verlieren. Prachtvoll stieg sie höher und immer höher, die große Königin des Tages, und indem ihre Strahlen mit allem Glanze auf Adelheid fielen, warfen sie zugleich eine noch größere Nuß als die beiden übrigen zu den Füßen der holden Pilgerin, auf der mit deutlichen Worten stand: Du bist am Ziele. Gerührt sank sie auf die Knie, Tränen entstürzten ihr, und indem sie sich langsam erhob, zeigte sich
ihrem Auge eine schöne große Stadt, wovon sie nur noch ein Viertelstündchen entfernt war.Sie legte den kurzen Weg dahin schnell zurück, und da sie vor einer Mühle vorbeikam, deren Bewohner schon aufgestanden waren, so ging sie hinein und bat um ein Frühstück. Gleichsam als hätte man die guten Leute darauf vorbereitet, so freundlich und gut wurde sie empfangen. Es waren ein Paar würdige Alte, die Adelheid in den ersten Augenblicken mit Philemon und Baucis verglich. Nachdem das Mütterchen sie mit einer frischen Milch erquickt hatte, bereitete sie ihr ein Bad, und als die Pilgerin auch dies genommen hatte, so zeigte sie ihr in einem kleinen einsamen Hinterstübchen ein Bett, das mit Blumen bestreut war und worauf sie einige Stunden ruhen sollte. Dankbar drückte sie die Hand der guten Müllerin und warf sich zufrieden auf das duftende Lager, wo der Schlummergott durch holde Träume ihr alles Leid vergessen machte. Reizender und schöner als eine Frühlingsrose erwachte die Pilgerin; ihre Wangen und Lippen glühten von der feinsten Röte, und ihre Augen hatten einen so sanften, unwiderstehlichen Glanz, daß die guten alten Müllersleute nicht aufhören konnten, ihren neuen Gast zu betrachten und ihn zu liebkosen. Die Mühle lag malerisch schön, und Adelheid nahm sich vor, die Entwickelung ihres Schicksals hier abzuwarten. Sie fragte die guten Alten, ob sie es erlaubten, daß sie einige Zeit bei ihnen bleiben dürfe. Hierüber waren sie sehr vergnügt und beteuerten ihr feierlich, daß sie sie in der kurzen Zeit so lieb gewonnen, daß es sie freuen würde, wenn es ihr recht lange oder gar immer bei ihnen gefiele. Sie verabredeten nun zusammen, Adelheid für ihre Verwandtin auszugeben und ihr den Namen Röse beizulegen.
Der Abend dieses Tages war so schön, daß sich Röse, die ein Bauerngewand angelegt hatte, das ihre Reize noch mehr den Augen darstellte, ins Freie geflüchtet hatte, vor der Tür auf einer Bank saß und tiefsinnig in den vorbeirieselnden Bach sah. Ein nahes Pferdegetrappel machte sie aufmerksam; aber man denke sich ihr Erstaunen, als sie ihren Gemahl mit einem großen Gefolge von Pferden angesprengt
kommen sah, an seiner Seite ein mehr schönes als reizendes Mädchen. Der Zug war schon zu nahe, um zu entfliehen; sie sammelte ihre Kräfte zusammen, blieb sitzen und betrachtete von Zeit zu Zeit ihren Ungetreuen, der kein Auge von ihr verwandte und sich noch so lange nach ihr umsah, als ihm irgend möglich war. Das Gefolge des Königs war ihr ganz unbekannt. Sie schlug ihre Augen wieder nieder, sobald der Geliebte entschwunden war, und versank wieder in ein so tiefes Nachdenken, daß sie nichts von den Anmerkungen des ganzen Gefolges hörte, noch weniger sich durch ihr lautes Lachen beleidigt fühlte.Endlich schüttelte die gute alte Müllerin sie aus ihrem Nachdenken auf, erinnerte Röse an die kühle Abendluft und zog sie, ihr die Wange streichelnd, in die Stube, wo ihr kleines ländliches Mahl ihrer harrte.
Röse nahm all ihre Besinnung zusammen und fragte die Müllerin, was denn das für ein Herr gewesen sei mit einer schönen Dame und einer großen Menge Bedienten, der heute abend hier vorbeigefahren. Mit der ganz eignen Redseligkeit, die gewöhnlich allen alten Leuten eigen ist, erzählte ihr diese nun, daß die Dame die Tochter des Königs und der schöne junge Mann ein fremder Prinz sei, der hier durch einen Zufall, den aber niemand wisse, hergekommen sei; er sei die erste Zeit immer sehr traurig gewesen und habe viel geseufzt, aber der König und seine Tochter hätten nicht eher mit ihren Tröstungen nachgelassen, bis er heiter geworden und endlich vor vier Wochen sich verlobt habe. In wenigen Tagen werde die Vermählung sein, und man mache schon die größten Anstalten dazu. Bei diesen Worten erblaßte Röse; sie rief leise: »Ach Gott!« und sank in eine tiefe Ohnmacht. Als sie zu sich selbst kam, und dies geschah durch das viele kalte Wasser, womit man sie begoß, bald, so bat sie die alten Leute recht herzlich um Vergebung wegen des Schrecks, so sie ihnen gemacht, und eilte in ihr Schlafstübchen, wo sie sich ihrem Gram, ihrer hoffnungslosen Liebe überließ. Aber mitten in ihrem Leiden fiel ihr ein, daß der dritte Gürtel noch immer fest ihren Leib
umschloß und daß die Fee ihr gesagt hatte: Erst wenn der dritte Gürtel zerbricht, verleugnet er dich ganz und gar und liebt eine andere. Dieser Trost war nicht klein, und sie legte sich, ihn noch immer entschuldigend, zu Bette, aber leider nicht zur Ruhe.Sobald der Tag in seiner Ordnung vorgerückt war, daß vornehme Leute aufstehen, so erschien der König abermals, aber nur von einem einzigen Jäger begleitet, an der Mühle und traf Röse, die eben im Begriff war, einen Kranz von Vergißmeinnicht in ihr Haar zu flechten; bei seinem Anblick erschrak sie heftig, der Kranz entsank ihren Händen, und der Bach trieb ihn schneller mit fort, als es dem König möglich war, ihn zu erhaschen. Er kehrte, nachdem seine Bemühungen vergebens waren, zu Rösen, die ihre Fassung wieder erhalten hatte, zurück und fragte sie freundlich, wer ihre Eltern seien. Sie heftete ihm das verabredete Märchen auf und war schon im Zurückgehen, als er ihre Hand ergriff und recht zärtlich fragte, ob sie noch keinen Bräutigam habe. Sie antwortete verschämt: »Nein«und wollte abermals gehen, aber der König zog sie neben sich ins weiche Gras und schwatzte ihr von dem Eindruck vor, den sie gestern auf ihn gemacht.
Röse schwieg, und der König, der dies als ein Zeichen ihres Wohlgefallens aufnahm und sie für ein ganz gewöhnliches Bauernmädchen hielt, fing schon aus einem zuversichtlichen Ton an zu reden, als sie schneller, als er es verhüten konnte, aufstand und sich hastig in die Gebüsche und von dort in ihr Stübchen entfernte. Vergebens durchbrach der König die Gesträuche, vergebens wiederholte das ferne Echo ihren Namen; Röse blieb fort und ihm nichts übrig, als mißmutig zurückzukehren. Täglich kam er seit diesem Morgen mehrere Male zur Mühle; war er artig und blieb in gewisser Entfernung, so war Röse für ihn da, ja, sie wurde ihm nach und nach so teuer, daß er sie wirklich innig liebte und ihm seine stolze Braut, in Betrachtung gegen dies anspruchslose Mädchen, immer gleichgültiger ward. Röse nannte sich nur seine Freundin, aber sie war seine Geliebte im vollsten Sinne des Worts, und sie wandte ihre Gewalt über ihn nur an,
um sein Herz zu veredeln, ihn von seiner Unbeständigkeit zu heilen.Indes rückte sein Hochzeitstag immer näher, schon war er nur noch acht Tage entfernt, da ward sein Herz noch einmal zum Verräter, seine Liebe noch einmal sinnlich; er kam spät gegen die Nacht zu Rösen und wandte die süßesten Überredungen, die zärtlichsten Liebkosungen an, um die Holde ganz sein zu nennen. Schon wankte die Arme, nur noch matt verteidigte sie sich gegen den geliebten Verführer, da brach plötzlich ihr dritter Gürtel entzwei. Kalt vor Schrecken, wand sie sich aus den Armen des Königs; sie hatte fast über der Geliebten die Gattin vergessen, und indem sie sich weinend in ein Fenster legte, bat sie ihn flehentlich, die Haustüre zuzumachen, weil das Schlagen davon ihrem Gehör so unangenehm sei.
Der König ging; er war erstaunt und verdrießlich, dem Gegenstand seiner süßesten Wünsche sich auf einmal so entrückt zu sehen. Er schlug die Türe zu, da sprang eine gegenüber sich befindende auf, als er diese zugemacht, eine dritte, und so ward er von einer unsichtbaren Macht genötigt, die ganze Nacht Türen zuzumachen. Verdrießlich über diesen sonderbaren Streich, den er auf Rösens Rechnung schob, eilte er nach seinem Schlosse, und um sie, von der er wußte, sie liebte ihn, recht zu kränken, setzte er seinen Hochzeitstag schon auf den dritten Tag an, tat doppelt schön mit seiner Braut und suchte in einem Schwarm von Lustbarkeiten Röse ganz zu vergessen.
Als es Tag ward und der König nicht wieder zurückkam, so glaubte Röse, daß er, durch ihr Weinen gerührt, sie darum verlassen habe. Als er aber gar nicht zurückkehrte und sie die Beschleunigung seiner Heirat erfuhr, da merkte sie wohl, daß er zürne, und sann hin und her, ihn zu versöhnen, als ihr nach langem Nachdenken ihre goldnen Nüsse einfielen.
Sie eröffnete hurtig und neugierig die kleinste, worin sich zu ihrem Erstaunen ein wunderschönes Nähzeug mit einem Nähkästchen befand. Sie eilte geschwind nach dem Schlosse, setzte sich dem Fenster
der Prinzessin gegenüber und fing an zu nähen. Diese ward bald aufmerksam auf die schöne Nachbarin und ihr noch schöneres Kästchen, worauf sich die Sonnenstrahlen in den prächtigsten Farbenmischungen brachen. Ihr künftiger Gemahl koste mit ihr an demselben Fenster. Er erschrak, da die Näherin ihre Augen aufschlug und er Röse erkannte. Ihr freundlicher Blick machte ihm Mut, und er sandte im Namen der Prinzessin herunter und ließ fragen, ob das Kästchen nicht zu verkaufen sei. »Nein!« entgegnete Röse dem Boten. »Es ist nicht zu verkaufen, aber wohl zu vertauschen.« — »Und wofür willst du es vertauschen?«fragte die Prinzessin heftig, indem sie das Fenster aufriß. — »Für Ihre erste Brautnacht!«entgegnete das Mädchen verschämt und nähte ruhig fort. »Die Kreatur!« war die Antwort, und das Fenster flog zu, daß alle Scheiben klirrten. Hoch schlug dem Könige das Herz; er sah nun wohl ein, daß nicht Röse, sondern eine boshafte Fee ihn gequält hatte, und er nahm geschwind zur List seine Zuflucht. Hastig bat er die Prinzessin, das Kästchen zu vergessen, denn er würde sich nie überwinden, mit dieser Kreatur sein Bett zu teilen. Sobald die Prinzessin von dieser Seite sich sicher glaubte, zog sie andre Saiten auf und ließ den Wunsch, das Kästchen zu besitzen, so deutlich blicken, daß der König endlich halb unwillig nachgab, und der Tausch zwischen der Prinzessin und der Näherin wurde geschlossen.Sobald diese ihr Kästchen angebracht hatte, eilte sie nach Hause und öffnete die zweite Nuß; hier bot sich ihren erstaunten Augen eine Spindel dar, die an Schönheit und Reichtum das Nähkästchen weit übertraf. Die erstaunte Müllerin unterrichtete Röse, mit der Spindel umzugehen, und kaum graute der zweite Tag, als sie schon im Schloßhof saß und einen Faden spann, der noch feiner als das feinste Haar war. Der ganze Hofstaat war starr vor Erstaunen, und kaum erfuhr die Prinzessin dies neue Wunder von ihren Frauen, als sie schnell ihr Bett verließ und ans Fenster lief, um sich mit eignen Augen davon zu überzeugen. »Es ist Wahrheit!«rief sie freudig aus und sandte zu Rösen, um den Preis der Spindel zu erfahren. Sie erhielt
dieselbe Antwort wie zum erstenmal; denn die Spindel war Rösen nur für die zweite Brautnacht der Prinzessin feil. Sogleich ward zum König geschickt; er kam, und die Geliebte ließ nicht eher mit Bitten nach, bis er ihr erlaubte, gegen die zweite Nacht die wunderschöne Spindel einzutauschen.Kaum war auch diese in den Händen der Prinzessin, so war Röse auch schon verschwunden, hüpfte in ihr Kämmerchen und öffnete die dritte Nuß; ein kostbares Geschmeide, das Nähkästchen und Spindel bei weitem übertraf, war darin befindlich. Wie lang dünkte ihr heute der Tag! Endlich war er dahin; auch die langweiligste Nacht ihres Lebens entschwand, und der gefürchtete Hochzeitstag brach heran. Röse zog ihre Pilgerinkleider wieder an, schmückte sich mit einem Kranze und ging, das Geschmeide mit sich tragend, dem Schlosse zu. Sie verlangte die Prinzessin zu sprechen, und man führte sie unbedenklich zu ihr. Die Glückliche war schon unter den Händen ihrer Frauen, die ihre natürliche Schönheit noch mehr zu erhöhen suchten. Die Pilgerin zeigte den Schmuck, und die Prinzessin freute sich so sehr darüber, daß sie, ohne den König zu fragen, ihr die dritte Nacht zusagte und sie noch obenein bat, ihren Hochzeitstag bei ihr zu bleiben und während der drei Tage ein paar Zimmer von den ihrigen zu beziehen. Röse dankte aber für das alles, ging ruhig nach Hause, verbrachte den Tag abwechselnd in Angst und in Freude und eilte dann, als der Abendstern flimmerte, dem Schlosse zu. Lauter Jubel tönte ihr entgegen; sie schlich sich unbemerkt zu den Zimmern der Prinzessin. Hier öffnete ihr eine vertraute Kammerfrau das bräutliche Schlafgemach und entfernte sich dann wieder.
Sobald sie allein war, warf sie die Kleider einer Pilgerin von sich, hüllte ihre zarten Glieder in einen durchsichtigen Schleier, nahm ihre natürliche Stimme wieder an und erwartete so mit Sehnsucht ihren Geliebten, ihren Gatten. Endlich näherte sich die Stunde, die Musik schwieg, und in wenig Augenblicken fühlte sie sich von seinen Armen umfaßt. Er war schon entkleidet und trug das zitternde Weib
zum heimlichen Lager; alle Lichter verlöschten, er stammelte: »Meine Röse!«und ward glücklich, wie es ein liebender Mann werden kann. Sanft entschlummerte er in ihren Armen, und schon begann dem jungen Tage die Nacht Platz zu machen, als Adelheid erwachte. Sie betrachtete mit Zärtlichkeit den geliebten Gatten, als sie ein schwarzes Bändchen auf seiner Brust entdeckte; sie zog leise daran, und siehe, welche Freude, es war ihr eignes Bildnis, das er noch immer auf seinem Herzen trug. Bei Betrachtung dieses Bildes ertappte sie ihr Gemahl; eine hohe Röte flog schnell über seine Wangen, er nahm es ihr weg und gab ihm seinen alten Platz. »Wessen ist das Bildnis?«fragte Adelheid, sich sanft an ihn schmiegend. Er seufzte tief, dann sagte er scherzhaft: »Ach, Röse, was für eine Saite berührst du! Es ist die schmerzhafteste meines Lebens. Ja, wisse es immer, du, nur du ähnelst ihr, es ist das Bildnis meines Weibes, meiner mir noch immer treuen Adelheid.« —Tränen flossen von seinen Wangen; er drückte Röse sanft von sich weg, und indem er aufstand, rief er jammernd: »Oh, meine Adelheid, wie sehr bin ich für meinen Leichtsinn bestraft!« —Länger konnte sich das liebende Weib nicht verhalten. Sie sank in seine Arme, und als die ersten Entdeckungen, die ersten Entzückungen der Liebe vorüber waren, so erzählte sie ihm alle ihre Schicksale von dem Tage ihrer Abreise an bis auf den Augenblick der Wiedererkennung. Gern hätte ihr der König auch seine Begebenheiten erzählt, aber die Zeit war zu kurz; sie versparten es bis auf die nächste Nacht, um nicht von seiner neuen Gemahlin überrascht und in einem vertraulichen Gespräch getroffen zu werden.Kaum hatte er auch das Zimmer verlassen, als die Prinzessin, von den Qualen der Eifersucht getrieben, hereinrauschte; sie fand aber ihren Gemahl nicht mehr und die schöne Pilgerin in Tränen. Freilich waren es nur Freudentränen, die diese weinte, aber die Dame, die dies gar nicht ahnen konnte, hielt es für Tränen der verachteten Liebe und bezeigte der armen Röse ihr Mitleid recht aufrichtig; sie trocknete eigenhändig die Tränen von ihren schönen Augen, und als
sie so manchen noch unverhüllten Reiz der jungen Pilgerin sah, so pries sie sich wegen der Liebe und Enthaltsamkeit ihres Gemahls doppelt glücklich. Sie eilte auch gleich zu ihm, überhäufte ihn mit Lobsprüchen und Zärtlichkeiten und hätte ihn gern für die schlechte Brautnacht, die er nach ihrer Meinung gehabt, schadlos gehalten, wenn der König nur das geringste Gelüsten gezeigt hätte. Dieser aber war einzig mit seinem und Adelheidens Schicksal beschäftigt und dachte so sehr auf Mittel, sich und sein geliebtes Wesen zu retten, daß er sich nur mit Mühe verstellte. Auch dieses Kältersein schrieb die eitle Prinzessin auf Rechnung seiner Liebe und teilte den ganzen Tag ihre Aufmerksamkeit zwischen die Pilgerin und ihren Gemahl, der ihr doch diesen Abend fast zu früh entschlüpfte und dem der Hofnarr noch nachrief: »Prinz, hüte dich: Die Wände haben Ohren; verborgne Türen können reden.«Der König merkte sehr auf diese Warnung: Er wußte, der Narr liebte ihn, und war überzeugt, daß er etwas gehört hatte, worauf sich die Warnung bezog; und es war so. Die eine Kammerfrau der Prinzessin hatte abgebrochene Wörter aus einer kurzen Unterredung der Liebenden am Tage verstanden, und der Narr, der an allen Orten und in allen Ecken war, hatte dies erlauscht und warnte den Prinzen, den er herzlich liebte, davor.
Der König meldete mit leisen Worten seiner Röse den Verdacht; sie sprachen nur durch Blicke, und nachdem Röse im Bette lag, löschte der König die Lichter aus bis auf eins, mit dem er sich an ein kleines Tischchen setzte und las. Schon war es eine Stunde nach Mitternacht, und er hatte große Lust zu Bette zu gehen und die Rede des Narren für Narrheit zu halten, als er plötzlich ein kleines Knistern hörte; er drehte sich nach Rösens Bette um und sah in dem Augenblick seine zweite Gemahlin, blaß, mit der Miene einer Furie, in der einen Hand ein Licht, in der andern einen Dolch haltend, hereintreten. Sie war mit zwei Schritten am Bette. Aber wer malt ihr Erstaunen, als sie Röse fest schlafend dort allein fand und, indem sie sich umsah, ihren Gemahl erblickte, der hinter ihr stand, ihr den Dolch entwand
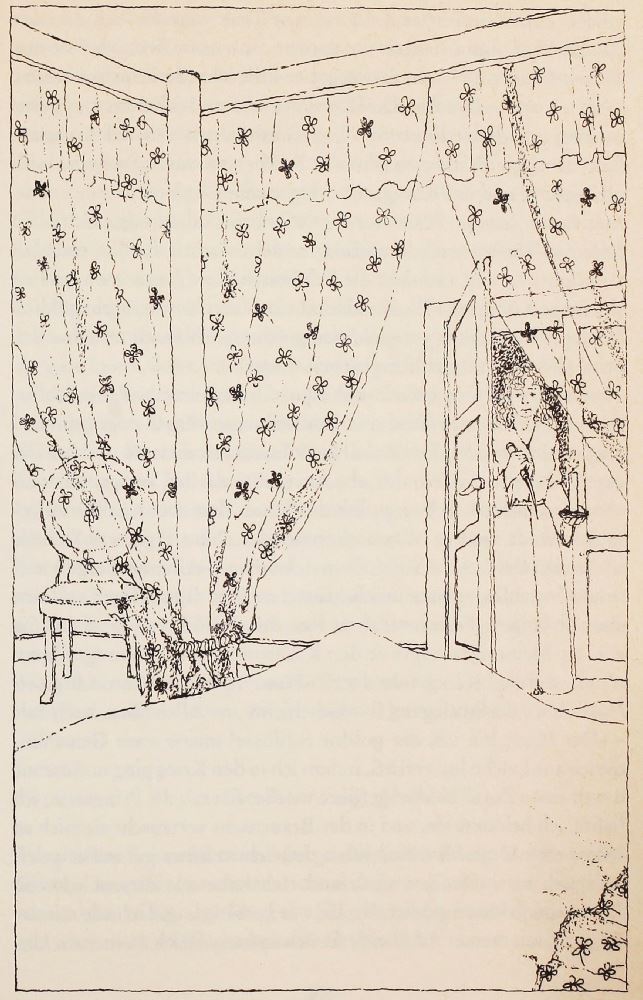
Nach einiger Zeit verlor er durch eigne Unbesonnenheit sein Schlüsselchen, und da er es nicht ernstlich suchte, so vergaß er es ganz und fand es nicht wieder. Der Zufall kam ihm aber zustatten und ließ ihn einen Schlüssel finden, der ebenso schön als der vorige war und ebensogut schloß. Schon wollte der Mann den neuen Schlüssel gebrauchen, da fand er seinen alten wieder. Nun sagt, was soll der Mann mit den zwei Schlüsseln machen?« — »Alberne Frage!« rief seine Gemahlin, »den neuen Schlüssel muß er zurücklegen und den alten so lange gebrauchen, als es ihm möglich ist.« — »Und sind Sie alle der Meinung?«fragte er den Reichsrat. Ein einstimmiges Ja ertönte, und der König fuhr fort: »Nun, so hören Sie noch einen Augenblick die Auslegung der Geschichte.« —Alles hörte hoch auf. — »Der Mann bin ich, der goldne Schlüssel meine erste Gemahlin, die ich aus Leichtsinn verließ, indem ich in den Krieg ging und darauf durch einen Zufall hierher geführt wurde. Ich sah die Prinzessin; ich liebte, ich heiratete sie, und in der Brautnacht vertauscht sie mich an meine erste Gemahlin, die, durch den Schutz einer guten Fee geleitet, mich hier aufsuchte und fand. Ich habe aus diesem schönen Munde mein Urteil gehört; Ihr habt es bestätigt, und ich eile mit der Pilgerin, mit meiner Adelheid, zurück in mein Reich zu meinen Untertanen.«
—Er wollte zur Tür eilen, als die Prinzessin ihm zuvorkam. »Zurück, Verräter«, donnerte sie mit schrecklicher Stimme, »diese Schmach sollst du mir nicht antun; diese Falschheit will ich dir vergelten. Man bemächtige sich der Pilgerin! Ihr Leben ist der Bürge für deine Flucht!« —Bei diesen Worten, die sie mit der größten Wut aussprach, erbebte der Saal. Eine Wolke von Wohlgeruch ließ sich nieder, und aus derselben trat Fatime, Adelheid im königlichen Schmuck an der Hand haltend, hervor. »Steht!«sagte sie mit sanfter Stimme, und alle standen wie angewurzelt, bis auf den König, der freudig zu seiner Gemahlin eilte.Die Fee ergötzte sich an dem Anblick der Liebenden, und indem beide mit ihr ihren luftigen Wagen bestiegen, gab sie der Prinzessin die gute Lehre, ihren künftigen Gemahl nicht aus Geiz und Eitelkeit zu vertauschen und ihm die schönste Gabe, weibliche Sanftmut, mitzubringen. Der Wagen verschwand schnell ihren Augen, und indes jene vor Bosheit mit allen Wesen um sich her schmollte, langten diese unter dem frohsten Gespräche in ihrem Lande an. Sie stiegen bei dem einsamen Landhause ab, und die gute Fee verschwand, ohne ihnen Zeit zum Danken zu lassen. Des andern Tages forderten sie ihre Getreuen heraus, und nachdem sie in jeder Nachricht die Liebe und das Verlangen ihrer Untertanen nach ihnen gesehen, so zeigten sie sich bald darauf öffentlich und wurden mit allgemeiner Freude empfangen.
Nie gab es nachher einen treuern Ehemann; sein Leichtsinn hatte ihn verlassen, und sie lebten bis ins hohe Alter glücklich.
Die drei Königssöhne
Vor uralten Zeiten lebte im Morgenlande ein König; der hatte drei Söhne. Die zwei ältern waren schon in ihrer Kindheit gar ausgelassen und mutwillig, aber klug; der jüngste hingegen war folgsam und gut, aber nicht so klug wie seine Brüder.
Als nun der älteste von den drei Königssöhnen achtzehn Jahre alt war, gab ihm der Vater ein Pferd und ein Ritterkleid und ein Schwert und ließ ihn ausziehen, die Welt zu sehen und sich ritterlich zu erzeigen in fremden Landen. Und er ritt fort und ritt weit und breit umher und lebte ausschweifend und unordentlich und kam nimmer heim, vergaß seinen Vater und schickte nicht Nachricht von sich, wie es ihm ergangen sei.Und der zweite von den Königssöhnen ward auch achtzehn Jahre alt, und sein Vater gab ihm auch ein Pferd, ein ritterliches Kleid und ein Schwert und ließ ihn auch ausreiten in die Welt, um fremde Lande zu sehen und sich ritterlich darin zu erweisen und nach seinem ältern Bruder zu forschen. Und er ritt fort und trieb's wie sein Bruder und kam nimmer heim und schickte nicht Nachricht, wie es ihm ergangen sei.
Da ward der König traurig und meinte, seine Söhne seien beide tot, und härmte sich ab und beklagte ihren Verlust. Aber als der dritte Sohn auch achtzehn Jahre alt war, da ging er eines Tages zu seinem Vater und bat ihn, er möge doch ihm auch ein Pferd und Schwert geben und ihn reiten lassen in die Welt, wie seine Brüder getan hätten.
Da weinte aber der alte König, umarmte seinen Sohn und sprach: »Willst du mich auch verlassen und mir verlorengehen, wie deine Brüder mir verloren sind? Nein, mein einzig Kind, du mußt meine Stütze sein in meinem Alter.«Und sein jüngster Sohn stand ab von seinem Bitten, obgleich er's ungern tat.
Es stand aber an etliche Tag, da hatte der alte König einen wunderbaren Traum: Er stand in seinem Garten, so war's ihm, da wüchsen zwei Oelbäume auf. Und sie waren im Anfange schön und schienen gesund, aber bald fingen sie an zu trauern, und die Früchte fielen ab, und die Blätter wurden gelb, und die Zweige schienen dürr; da wuchs schnell zwischen ihnen auf ein Palmbaum und schoß hoch auf und beschattete die kranken Ölbäume und goß seinen Tau auf sie, und auch sie wurden wieder gesund und frisch.
Da ließ der König morgens seine Traumdeuter und Weisen kommen, daß sie ihm den Traum auslegten, und die Traumdeuter sagten: »Die zwei Ölbäume sind deine zwei alten Söhne, und der Palmbaum ist dein jüngster Sohn. Die zwei Ölbäume wurden bald dürr, so werden deine zwei ältern Söhne bald zugrunde gehen; aber den Palmbaum, deinen jüngsten Sohn, mußt zu ziehen lassen, daß er seinen Brüdern beistehe, sonst sind sie für dich verloren.«
Als der König das hörte, gab er seinem jüngsten Sohn ein Pferd und Schwert und ließ ihn mit Tränen von sich.
Aber der jüngste Königssohn zog aus in die Welt und ritt weit umher, und ihm war es wohl im Freien, und er sah viel Land und erwies sich überall, wo er herbergete, als ein braver Rittersmann und kam so weit fort in ferne, ferne Länder. Es geschah aber eines Abends, da kam er in einen dichten Wald und fand keinen Ausgang. Wie er so ritt, siehe, da standen zwei Männer am Wege, und wie er sie fragte, wo der Weg hingehe aus dem Walde, da erkannte er seine ältern Brüder und freute sich über sie. Sie aber fingen an zu schelten und sagten: »Können wir, die wir klüger sind, kaum durch die Welt uns schlagen, wie willst du durchkommen, der du einfältig bist?« Denn die ältern Königssöhne waren klüger für die Welt, dem jüngern aber fehlte die Weltklugheit.
Jetzt ward es Abend; nur selten fiel am Abhange des Bergwaldes ein Strahl der scheidenden Sonne durch die Fichtenstämme. Da berieten die drei Königssöhne, welchen Weg sie einschlagen wollten, daß sie eine Herberge fänden. Und sie wendeten sich nach der Höhe des Berges, ob sie von oben nicht ein Haus oder nur ein freies Feld erblickten. Da kamen sie vorbei an einem Ameisenhaufen. Den wollten die ältern Brüder zerwühlen, daß sie sehen könnten, wie die Tierlein ihre Eier herumschleppten, aber der jüngste stieg von seinem Pferde und wehrte ihnen, daß sie's nicht täten. Und als sie vorbeigingen, da redete ihn der Ameisenkönig an und sprach: »Wer du auch sein magst, Fremdling, ich danke dir, daß du deinen Reisegefährten wehrtest und so großes Unglück von uns armen Tierlein abwendetest.
Wenn ich dir nützen kann, so komm, und du sollst sehen, daß ich dir alles mit Freuden tue.«Und sie gingen weiter und kamen an einen See, der war bedeckt mit einem ganzen Schwarm Enten. Da wollten die älteren Brüder drüber her und sich einige erlegen, daß sie ein Abendessen hätten; da wehrte aber der jüngste Bruder ab und sagte: »Laßt die armen Tiere; wir werden doch diesen Abend etwas zu essen haben.« Und sie ließen die Enten in Ruhe. Als sie aber vorbeigingen, schwamm der König der Enten herzu und dankte dem jüngsten Königssohn und sagte: »Wenn ich dir in etwas dienen kann, so soll's mit Freuden geschehen.«
Darauf gingen sie weiter und kamen an einen Eichbaum, darin die Bienen ihre Zellen hatten; und es war so viel Honig drinnen, daß er am Stamm heruntertroff. Als die zwei ältern Königssöhne das sahen, wollten sie Feuer in die Baumhöhle machen, daß die Bienen umkämen und daß sie den Honig fassen könnten; da wehrte aber der jüngste wieder ab und sagte: »Laßt die armen Tierlein! Bringt sie nicht um des bißchen Honigs willen um.« Und sie wollten weiterziehen, da flog die Bienenkönigin heraus, dankte ihm und sprach: »Kann ich dir mit etwas dienen, so befiehl nur, ich will's mit Freuden tun.«
So gingen sie weiter und kamen in ein altes Schloß und wollten da herbergen. Das Schloß war aber ganz wundersam gebaut, und nichts Lebendiges war drin. Sie gingen ein durch das Tor, und der jüngste führte sein Pferd in einen Stall; da standen lauter steinerne Pferde. Sie gingen die Stufen hinauf, da kamen sie in einen Vorplatz, der war mit Marmor geplattet, und hohe Säulen bildeten die drei Eingänge: den einen bildeten silberne Säulen, den andern bildeten goldene Säulen, und den dritten Eingang bildeten gar diamantene Säulen. Und sie gingen ein durch den ersten Eingang und kamen in eine Reihe Zimmer, darin alles, Wände und Gerätschaften, von getriebenem Silber war.
Aber sie gingen durch alle Zimmer und fanden am Ende eine Türe,
die verschlossen war durch drei Schlösser; aber durch ein Lädlein konnte man hineinsehen in das Gemach. Und drinnen am Tische saß ein alt eisgrau Männlein, dem der Bart ging bis auf die Füße. Diesem riefen sie zu, aber es hörte nicht. Sie riefen ihn zum zweitenmal, aber es hörte nicht; und sie riefen ihn zum drittenmal, da stand es auf und kam heraus und empfing sie freundlich und bewirtete sie den Abend aufs allerbeste und wies ihnen weiche Betten mit seidenen Vorhängen zu Schlafstätten an. Aber es sprach kein Wort und antwortete auf keine ihrer Fragen. Doch die drei Königssöhne hatten sich's wohl behagen lassen, daß sie in eine so gute Herberge gekommen waren.Als sie aber am andern Morgen erwachten, lag jeder zwar in einem schönen Zimmer, aber alles war so verschlossen, daß keiner von ihnen herauskommen konnte: Und bei dem ältesten stand das eisgraue Männlein mit dem langen Barte und winkte ihm, daß er ihm folge. Dieser folgte ihm, aber ganz ängstlich, und sie gingen ein durch den goldenen Eingang und kamen in einen großen, geräumigen Saal, darin alles von getriebenem Golde gearbeitet war. Und der Alte wies mit seinem schwarzen Stab über die Tür; da standen die Worte:
Da berührte das Männlein mit seinem Stabe die Wand, und es sprang eine Türe auf, und der Königssohn sah ein Gemälde, das stellte die
Gegend dar, wo der Ameisenkönig seinen jüngern Bruder angeredet hatte. Und darunter standen die Worte:Dreitausend Perlen, der Hauptschmuck der Prinzessin Pyrola und ihrer zwei Schwestern, liegen hier im Moose zerstreut. Diese hast du einzusammeln, daß auch die letzte nicht fehlet. |
Den andern Morgen stand das graue Männlein beim zweiten Königssohn und winkte ihm mit seinem schwarzen Stab, daß er ihm folge, und er folgte ihm. Und das Männlein zeigte ihm auch die Überschrift über der Türe im goldenen Saal und zeigte ihm das Gemälde. Da eilte der zweite Bruder auch hinaus und sammelte emsig und sammelte bis an den Abend; aber er hatte keine dreihundert der kleinen Perlen beisammen, da ging die Sonne unter, und er sank nieder und war ein Stein wie sein Bruder.
Nun kam der dritte Morgen. Da stand das eisgraue Männlein bei dem jüngsten Königssohn und führte auch ihn in den Saal und ließ ihn die Schrift lesen über der Türe und zeigte ihm das Gemälde und winkte ihm, hinauszugehen, weil er traurig dastand. Da ging der dritte Königssohn hinaus und sah die kleinen, kleinen Perlen so weit zerstreut und im Moose versteckt, und als er das sah und merkte, daß es unmöglich sei, sie zu sammeln bis auf die letzte, da setzte er sich hin und weinte bitterlich und beklagte seinen armen Vater, der jetzt alle seine Kinder verloren habe. Und wie er so weinte und wehklagte, da hörte er eine Stimme ihm rufen: »Warum weinst du, lieber Fremdling?« Da sah er auf und erblickte den Ameisenkönig und klagte dem seine Not.
Der Ameisenkönig aber sprach: »Ist es weiter nichts? O dann sei nur
ruhig, dann soll dir bald geholfen sein.«Als er dies gesagt, ging er in den Ameisenhaufen und kam bald mit mehr denn fünftausend Ameisen hervor, und alle sammelten an den Perlen und zählten sie dem Königssohn in den Hut; und als er sie alle hatte bis auf die letzte, da sprach der Ameisenkönig: »Gehe hin, du hast sie alle! Und danke mir nur gar nicht, denn du hast noch mehr verdient als diesen kleinen Gefallen.«Da lief der jüngste Königssohn hinein in das Schloß und brachte dem Männlein die Perlen. Und das eisgraue Männlein erstaunte darüber und führte ihn wieder in den goldenen Saal und berührte eine andere Wand. Diese tat sich wieder auf, und es stellte sich ein Gemälde dar, das den See bedeutete, worauf der Entenschwarm sich aufhielt, und darunter standen die Worte:
In der Tiefe des Sees liegt der Schlüssel zu dem Schlafgemach der Prinzessin Pyrola und ihrer zwei älteren Schwestern. Du mußt ihn gefunden haben, ehe die Sonne niedergehet. |
Er eilte sich aber und brachte den Schlüssel dem eisgrauen Männlein, und kaum hatte es den Schlüssel in Händen, da bekam es seine Sprache wieder und dankte dem Königssohn mit Freudentränen und sprach: »Schon zweitausend Jahre muß ich hier lebendig, aber
stumm sitzen in diesem Schlosse und auf Erlösung harren. Nun hast du, glücklicher Fremdling, nur noch ein Geschäft, aber das schwerste; dann ist dein Glück gegründet.«Da fragte der jüngste Königssohn, was das sei. »Drei Töchter habe ich«, sprach das graue Männlein, »ich bin der König von diesem verzauberten Schloß und Lande. Diese drei Töchter sind mir von ihrer eignen Mutter, die eine böse Fee war, verzaubert und liegen nun seit zweitausend Jahren in einem totenähnlichen Schlafe. Die älteste, Rubia genannt, verzauberte sie durch ein Stück Zucker, die zweite, Briza genannt, durch einen Sirup, aber meine jüngste Tochter, Pyrola, durch einen Löffel voll Honig. Eine meiner Töchter sieht der andern völlig gleich, und alle scheinen von gleichem Alter; aber Pyrola, meine jüngste Tochter, ist mir besonders lieb. Und gerade an ihr muß die Erlösung geschehen; an ihrem Hauche muß man erkennen, welche von den dreien den Honig gegessen, obgleich seitdem zweitausend Jahre verstrichen sind.«
Als er dieses gesagt, führte der unglückliche König den Königssohn hinaus und schloß die dritte Säulenpforte auf. Da waren alle Zimmer mit edlen Steinen von allen Farben geziert, Wohlgerüche und sanfte Töne schwebten aus dem Hintergrunde hervor, Kühlung wehte ihnen entgegen; und in einer Bettstätte, die mit Laubwerk von grünen und farbigen Edelsteinen umgeben war, lagen in dem höchsten, mittelsten Saale, wie tote Marmorbilder, Rubia, Briza und Pyrola, alle drei von ausnehmender, aber gleicher Schönheit. Die Pracht des Saales und die Schönheit der Prinzessinnen, die Musik und die Wohlgerüche betäubten ihn ganz, daß er nicht mehr wußte, was er da tun sollte, bis ihn der König des Schlosses daran erinnerte und sprach: »Die Sonne steht im Mittage. Wenn sie niedergeht und du hast noch nicht erkannt, welche die jüngste ist, so trifft dich gleiches Schicksal wie deine Brüder, und ich muß wieder stumm sitzen, wie vorher, bis sich wieder ein anderer Fremdling hierher verirrt. Erkennst du aber, ohne zuraten, meine Tochter Pyrola, so ist sie deine Gemahlin, und du erbst mein Reich.«
Der jüngste Königssohn aber eilte hinaus und jammerte und weinte, und der Wald hallte wider von seinen Klagen. Und wie er so klagte und jammerte, hörte er eine Stimme ihm rufen und zu ihm sagen: »Was klagst du, lieber Fremdling?« Da sah er auf und erkannte die Bienenkönigin auf dem Baumstamm sitzen. »Ach!« sagte er. »Wie kann ich das erkennen, welche von drei Prinzessinnen vor zweitausend Jahren Honig gegessen hat?«
»Was«, fragte die Bienenkönigin, »ist es weiter nichts? Wie magst du darum doch so klagen? Ich will dir eine Biene mitgeben, die soll um alle herumfliegen, aber die ist es, der sie sich auf die Lippen setzt.«Darauf ging die Königin hinein in die Höhle, und eine Biene flog heraus und setzte sich ihm auf die Schulter, und er trug sie in den Saal zu den schlafenden Königstöchtern. Da flog sie zu allen und schwärmte herüber und hinüber und setzte sich endlich auf den Mund der mittelsten.
Da sprach der Königssohn zu dem eisgrauen Könige: »Die mittelste ist Pyrola, deine jüngste Tochter.« Und kaum hatte er das gesagt, da krachte und donnerte und blitzte es, als wollte die Erde zusammenstürzen, und alles war verändert: Das kleine graue Männlein stand da als ein würdevoller, majestätischer alter König, die Prinzessinnen standen in blühender Schönheit da und umarmten ihren Vater, und die jüngste, Pyrola, kam herzu und dankte ihrem Erretter, dem jungen Königssohne, und der junge Königssohn umarmte sie und nannte sie seine Braut. Diener gingen aus und ein, im Schloßhofe war ein Pferdegetrappel, sie gingen ans Fenster, da war um sie nicht mehr die alte Wildnis: Eine prächtige Stadt stand da, und weiterhin sah man auch fruchtbare Felder und viele glückliche Fluren und Dörfer, und in den Straßen war ein Gewühl, und alles ging so ordentlich, als wäre da kein Wunder geschehen, als wäre alles beim alten: Niemand schien davon etwas zu wissen.
Auch in den Saal kamen einige Diener. Da ließ der König den Königssohn nehmen und seine Tochter Pyrola und ließ sie setzen in eine prächtige offene Kutsche, vor die er zwölf Schimmel spannen
ließ, und vierundzwanzig Männer, in Purpur und Gold gekleidet, ließ er vorausreiten mit Posaunen und ließ den Königssohn und seine Tochter Pyrola ausrufen als König und Königin des Landes. Darauf wurde ein köstlich Gastmahl gehalten, wobei es an nichts fehlte, was den Tag verherrlichen konnte. Und wie sie so dasaßen in großem Jubel, ließen sich zwei fremde Ritter melden. Man ließ sie ein, und siehe da, es waren des jungen Königs Brüder. Und abermals wurde ein Fremdling gemeldet, und als er hervortrat, da sprangen die drei Königssöhne von ihren Sitzen und bewillkommneten ihn mit Freudengeschrei: Es war ihr Vater; er hatte sich aufgemacht, seine verlorenen Söhne zu suchen, und war eben in dieser Stadt angekommen.Drei Monate blieb der Vater der Königssöhne da, und so lang er da war, dauerten die Feste, wovon immer eines das andere an Pracht übertraf. Dann zog er mit seinen zwei ältern Söhnen heim. Sie sollen sich von ihren ehemaligen Fehlern gebessert und in des alten Königs Reich geteilt haben; auch soll der ältere die Prinzessin Rubia, der zweite die Prinzessin Briza zur Gemahlin genommen und beide sollen lange und glücklich regiert haben.
Der jüngste aber und Pyrola wurden noch über hundert Jahre alt und beglückten ihre Untertanen. Ein fremder König regierte nach ihm auf seinem Throne, und durch ihn wurden die Menschen wieder so verschlimmert, daß eine große Sündflut über das Land kam. Und seitdem ist jenes Land, das Land der Märchen, versunken, und nur noch diese Sage ist von ihm übriggeblieben.
Der Stein der Weisen oder Silvester und Rosine
In den Zeiten, da Cornwall noch seine eigenen Fürsten hatte, regierte in dieser kleinen Halbinsel des großen Britannien ein junger König namens Mark, ein Enkel desjenigen, der durch seine Gemahlin, die schöne Yselde, auch Yseult die Blonde genannt, und ihre
Liebesgeschichte mit dem edlen und unglücklichen Tristan von Leonnois so berühmt geworden ist.Dieser König Mark hatte viel von seinem Großvater: Er war hoffärtig ohne Ehrgeiz, wollüstig ohne Geschmack und geizig, ohne ein guter Wirt zu sein. Sobald er zur Regierung kam, welches sehr früh geschah, fing er damit an, sich seinen Leidenschaften und Launen zu überlassen und auf einem Fuß zu leben, der ein weit größeres und reicheres Land als das seinige hätte zugrunde richten müssen. Als seine gewöhnlichen Einkünfte nicht mehr zureichen wollten, drückte er seine Untertanen mit neuen Auflagen; und als sie nichts mehr zu geben hatten, machte er sie selbst zu Gelde und verkaufte sie an seine Nachbarn.
Bei allem dem hielt König Mark einen glänzenden Hof und wirtschaftete, als ob er eine unerschöpfliche Goldquelle gefunden hätte. Nun hatte er sie zwar noch nicht gefunden, aber er suchte sie wenigstens sehr eifrig, und sobald dies ruchbar wurde, stellten sich allerlei sonderbare Leute an seinem Hofe ein, die ihm suchen helfen wollten. Schatzgräber, Geisterbeschwörer, Alchymisten und Beutelschneider, die sich Schüler des dreimal großen Hermes nannten, kamen von allen Enden herzu und wurden mit offenen Armen aufgenommen; denn der arme Mark hatte zu allen seinen übrigen Untugenden auch noch die, daß er der leichtgläubigste Mensch von der Welt war und daß der erste beste Landstreicher, der mit geheimen Wissenschaften prahlte, alles aus ihm machen konnte, was er wollte. Es wimmelte also an seinem Hofe von solchem Gesindel, das ihn ausnutzen wollte.
Der eine gab vor, er habe eine natürliche Gabe, alle Schätze zu wittern, die unter der Erde vergraben lägen; ein anderer wußte sie mit Hilfe der Wünschelrute zu entdecken; ein dritter versicherte, daß das eine und das andere vergeblich sei, wenn man nicht das Geheimnis besitze, die Geister, die in Gestalt der Greifen oder unter andern noch fürchterlicheren Larven die unterirdischen Schätze bewachten, einzuschläfern, zu gewinnen oder sich unterwürfig zu machen, und
er ließ sich's auf eine bescheidene Art anmerken, daß er im Besitze dieser Geheimnisse sei.Noch andere sahen auf alle magischen Künste mit Verachtung herab; bei ihnen ging alles natürlich zu. Sie verwarfen alle Talismane, Zauberworte, Kreise, Charaktere und was in diese Rubrik gehört, als eitel Betrügerei und Blendwerk. Was jene durch übernatürliche Kräfte zu leisten vorgaben, das leisteten sie, wenn man ihnen glaubte, durch die bloßen Kräfte der Natur. Wer in das innerste Heiligtum derselben eingedrungen ist, sagten sie, wer in dieser ihrer geheimen Werkstätte die wahren Elemente der Dinge, ihre Verwandtschaften, Sympathien und Antipathien kennengelernt hat, wer den allgestaltigen Naturgeist mit dem allauflösenden Natursalze zu vermählen weiß und durch Hilfe des alldurchdringenden Astralfeuers diesen Proteus festhalten und in seiner eigenen Urgestalt zu erscheinen zwingen kann: Der allein ist der wahre Weise. Er allein verdient den hohen Namen eines Adepten. Ihm ist nichts unmöglich; denn er gebietet der Natur, welcher alles möglich ist. Er kann die geringem Metalle in höhere verwandeln; er besitzt das allgemeine Mittel gegen alle Krankheiten; er kann, wenn es ihm und den Göttern gefällt, Tote ins Leben zurückrufen, und es steht in seiner Macht, selber so lange zu leben, bis es ihm angenehmer ist, in eine andere Welt überzugehen.
König Mark fand dies alles sehr nach seinem Geschmacke; aber weil er sich doch nicht entschließen konnte, nur einen von seinen Wundermännern beizubehalten und die übrigen fortzuschicken, so behielt er sie alle und versuchte es mit einem nach dem andern. Der Tag wurde mit Laborieren, die Nacht mit Geisterbannen und Schatzgraben zugebracht; und wie die Betrüger sahen, daß er kein Freund von Monopolien war, so vertrugen sie sich zu seiner großen Freude gar bald so gut zusammen, als ob alles in einen Beute! ginge. Verschiedene Jahre verstrichen auf diese Weise, ohne daß König Mark dem Ziele seiner Wünsche um einen Schritt näher kam. Er hatte die Hälfte seines kleinen Königreichs aufgraben lassen und
keinen Schatz gefunden, und über der Hoffnung, alles Kupfer und Zinn seiner Bergwerke in Gold zu verwandeln, war alles Gold, das seine Vorfahren daraus gezogen hatten, zum Schornstein hinausgeflogen.Einem andern wären nach so vielen verunglückten Versuchen die Augen aufgegangen; aber Mark, dessen Augen immer trüber wurden, wurde um so hitziger auf den Stein der Weisen, je mehr er sich vor ihm zu verbergen schien. Seine Hoffnung, den allgestaltigen Proteus endlich einmal festzuhalten, stieg in eben dem Verhältnis, wie die Schale seines Verlustes sank; er glaubte, daß er nur noch nicht an den rechten Mann geraten sei, und indem er zehn Betrüger fortjagte, war ihm der elfte neu angelangte willkommen.
Endlich ließ sich ein ägyptischer Adept aus der echten und geheimen Schule des großen Hermes bei ihm anmelden. Er nannte sich Misfragmutosiris, trug einen Bart, der ihm bis an den Gürtel reichte, eine pyramidenförmige Mütze, auf deren Spitze ein goldner Sphinx befestigt war, einen langen, mit Hieroglyphen gestickten Rock und einen Gürtel von vergoldetem Blech, in welchen die zwölf Zeichen des Tierkreises gegraben waren.
König Mark schätzte sich für den glücklichsten aller Menschen, einen Weisen von so vielversprechendem Ansehen an seinem Hofe ankommen zu sehen, und wiewohl der Ägypter sehr zurückhaltend tat, so wurden sie doch in kurzem ziemlich gute Freunde. Alles an ihm, Gestalt, Kleidung, Sprache, Manieren und Lebensart, kündigte einen außerordentlichen Mann an. Er aß immer allein und nichts, was andere Menschen essen; er hatte einige große Schlangen und ein ausgestopftes Krokodil bei sich in seinem Zimmer, denen er mit großer Achtung begegnete und mit welchen er von Zeit zu Zeit geheime Unterredungen zu halten schien. Er sprach die wunderbarsten und rätselhaftesten Dinge mit einer Offenheit und Gleichgültigkeit, als ob es die gemeinsten und bekanntesten Dinge von der Welt wären, aber auf Fragen antwortete er entweder gar nicht, oder, wenn er es tat, geschah es in einem Tone, als ob nun weiter nichts
zu fragen übrig wäre, wiewohl der Fragende jetzt noch weniger wußte als zuvor. Von Personen, die vor vielen hundert Jahren gelebt hatten, sprach er, als ob er sie genau gekannt habe, und überhaupt mußte man aus seinen Reden schließen, daß er wenigstens ein Zeitgenosse des Königs Amasis gewesen sei, wiewohl er sich nie deutlich darüber erklärte. Was ihm bei Mark den meisten Kredit gab, war, daß er viel Gold und eine Menge seltener Sachen bei sich hatte und von sehr großen Summen als von einer Kleinigkeit sprach. Alle diese Umstände schraubten nach und nach die Neugier des leichtgläubigen Königs von Cornwall so hoch hinauf, daß er es nicht länger aushalten konnte; und wie er es nun auch angefangen haben mochte, genug, der weise Misfragmutosiris ließ sich endlich erbitten, oder sein Herz erlaubte ihm nicht länger undankbar gegen die Ehrenbezeigungen und Geschenke zu sein, womit ihn der König überhäufte, und so entdeckte er ihm endlich -doch nicht eher, als bis er ihn mittelst verschiedener Initiationen durch einige höhere Grade des Hermetischen Ordens geführt hatte -das ganze Geheimnis seiner Person.»Die Götter«, sagte Misfragmutosiris, »geben ihre kostbarsten Gaben, wem sie wollen. Ich war nichts weiter als ein Mensch wie andre, noch jung, doch nicht ganz unerfahren in den Mysterien der ägyptischen Philosophie, als mich die Neugier anwandelte, in das Innere der großen Pyramide zu Memphis, deren Alter den Ägyptern selbst ein Geheimnis ist, einzudringen. Eine gewisse hieroglyphische Aufschrift, die ich schon zuvor über dem Eingang des ersten Saales entdeckt und abgeschrieben hatte, brachte mich, nach vieler Mühe, ihren Sinn zu erraten, auf die Vermutung, daß diese Pyramide das Grabmal des großen Hermes sei. Ich beschloß, mich in einer Stunde hineinzuwagen, worin gewiß noch kein Sterblicher sich dessen unterfangen hat, und noch jetzt wäre mir meine Verwegenheit unbegreiflich, wenn ich nicht überzeugt wäre, daß dieser Gedanke, dessen meine eigene Seele nicht fähig war, von einer höhern Macht in mir erschaffen wurde. Genug, ich stieg um Mitternacht, ohne Licht
und mit gänzlicher Ergebung in die Führung desjenigen, der mir ein so kühnes Unternehmen eingegeben, in die Pyramide hinab. Ich war auf einem sanften Abhang eine Zeitlang abwärts- und dann ebenso unvermerkt emporgestiegen, als ich auf einmal ein helles Licht erblickte, das wie eine Kugel vom reinsten gediegenen Feuer vor mir herschwebte. «Hier hielt Misfragmutosiris einige Augenblicke ein. —»Und Ihr hattet den Mut, diesem Lichte zu folgen?«fragte König Mark, der in der Stellung eines versteinerten Horchers, den Leib schräg vorwärtsgebogen, mit straff zurückgezogenen Füßen, beide Hände auf die Knie gestützt, ihm gegenübersaß und furchtsam, nur eine Silbe von der Erzählung zu verlieren, wiewohl unter beständigem Schaudern vor dem, was kommen würde, mit zurückgehaltnem Atem und weit offnen Augen zuhörte.
»Ich folgte dem Lichte«, fuhr der Ägypter fort, »und kam durch einen immer niedriger und enger werdenden Gang in einen viereckigen Saal von poliertem Marmor, dessen Ausgang mich in einen andern Gang leitete. Als ich ungefähr fünfzig Schritte fortgekrochen war, fand ich zwei Wege vor mir: Der eine schien ziemlich steil in die Höhe zu führen, der andere, linker Hand, lief gerade fort. Ich folgte der Lichtkugel auf diesem letztem, bis ich an den Rand eines tiefen Brunnens gelangte. Bei dem sehr lebhaften Lichte, das die Kugel umherstreute, wurde ich gewahr, daß eine Anzahl kurzer eiserner Stangen, eine ungefähr zwei Spannen weit von der andern, von oben bis unten aus der Mauer hervorragten, eine gefährliche Art von Treppe, auf der man zur Not in den Brunnen hinabsteigen konnte. Ohne mich lange zu bedenken, schickte ich mich an, diese schwindlige Fahrt anzutreten, und war schon drei oder vier Stufen hinabgestiegen, als die Lichtkugel plötzlich verschwand und mich in der schrecklichsten Dunkelheit zurückließ.
Ich begreife nicht, wie ich in diesem entsetzlichen Augenblicke nicht vor Schrecken in den Abgrund hinunterstürzte. Genug, ich faßte mich und fuhr mit verdoppelter Behutsamkeit fort, hinabzuklet
tern, indem ich mich mit einer Hand an einer Stange über mir festhielt, während ich eine andere unter mir mit den Füßen suchte. Endlich merkte ich, daß keine Stangen mehr folgten; ich hörte das Wasser unter mir rauschen, aber zugleich ward ich an der Seite, woran ich heruntergestiegen, einer Öffnung gewahr, aus welcher mir ein dämmernder Schein entgegenkam. Ich sprang in diese Öffnung hinein und gelangte auf einem abschüssigen Weg in eine ungeheure Höhle von glimmerndem Granit, die durch einen mitten aus der gewölbten Decke herabhangenden großen Karfunkel erleuchtet war. Wie groß war meine Bestürzung, als ich mich auf einmal an dem Rande eines reißenden Stromes sah, der sich mit entsetzlichem Geräusch aus einer Öffnung dieser Höhle über schroffe Felsenstücke herabstürzte!Indessen bedachte ich mich nur einen Augenblick, was ich zu tun hätte. Ich war schon zu weit gegangen, um wieder zurückzugehen, und ein Genius schien mir zuzuflüstern, daß mir alle diese Schwierigkeiten nur, um meinen Mut zu prüfen, entgegengestellt würden. Ich zog alle meine Kleider aus, band sie in einen Bündel über meinem Kopfe zusammen und stürzte mich in den Strom. In wenigen Augenblicken wurde ich von der Gewalt desselben durch ein dunkles Gewölbe fortgerissen. Nun merkte ich, daß das Wasser unter mir seicht wurde; bald darauf verlor es sich gänzlich und ließ mich in einer großen Höhle auf einem moosigen Grunde sitzen. Eine ungewöhnliche Hitze, die ich hier verspürte, trocknete mich so schnell, daß ich mich sogleich wieder anzog, um zu sehen, wohin mich eine ziemlich enge Öffnung führen werde, aus welcher ein lebhafter Schein in die Höhle eindrang. Sowie ich der Öffnung näher kam, hörte ich ein zischendes Geprassel wie von einem lodernden Feuer. Ich kroch hinein, die Öffnung erweiterte sich allmählich, und ich befand mich am Eingang eines weiten gewölbten Raumes, wo mein Fortschritt durch ein neues Hindernis gehemmt wurde, das noch viel fürchterlicher als alle vorigen war.
Ich sah einen feurigen Abgrund vor mir, der beinahe den ganzen
Raum erfüllte und dessen wallende Flammen wie aus einem Feuersee über die Ufer von Granitfelsen, womit er ringsum eingefaßt war, emporloderten und bis an meine Füße herauf zu zücken schienen. Statt einer Brücke war eine Art von Rost, aus vierfach nebeneinander liegenden schmalen Kupferblechen zusammengefügt, hinübergelegt, der von einem Ufer zum andern reichte, aber kaum drei Palmen breit war. Ich gestehe aufrichtig: Ungeachtet der großen Hitze dieses schrecklichen Ortes lief mir's eiskalt durchs Rückenmark auf und nieder; aber was war hier anders zu tun, als auch dieses Abenteuer zu wagen, ohne mich lange über die Möglichkeit zu bedenken! Wie ich hinübergekommen, weiß ich selbst nicht; genug, ich kam hinüber, und ehe ich Zeit hatte, wieder zu mir selbst zu kommen, fühlte ich mich von einem Wirbelwind ergriffen und mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit durch die grauenvolleste Finsternis fortgezogen. Ich verlor alle Besinnung, kam aber bald wieder zu mir selbst, indem ich mich etwas unsanft gegen eine Pforte geworfen fühlte. Sie sprang auf, und ich befand mich, auf meinen Füßen stehend, in einem hellerleuchteten Saale, dessen gewölbte, mit Azur überzogene Decke die Halbkugel des Himmels vorstellte und mit einer Menge von Karfunkeln, als ebensoviel Sternbildern, eingelegt war. Sie ruhte auf zwei Reihen massiv goldener Säulen, an denen viele Hieroglyphen aus Edelsteinen in allen Farben schimmerten. Ich stand wie geblendet von der Herrlichkeit dieses Ortes.«»Das glaube ich«, rief König Mark, »und nach solchen ausgestandenen Fährlichkeiten! Ich möchte da wohl an Euerm Platze gewesen sein!«
»Als ich mich wieder in etwas gefaßt hatte«, fuhr Misfragmutosiris in seiner Erzählung fort, ohne auf die lebhafte Teilnahme des Königs achtzugeben, »fiel mir eine hohe Pforte von Ebenholz in die Augen, vor welcher zwei Sphinxe von kolossalischer Größe einander gegenüberlagen. Sie waren aus Elfenbein geschnitzt und von wunderbarer Schönheit; aber zu meinem großen Bedauern lagen sie so dicht an der Pforte und so nahe beisammen, daß es schlechterdings für mich
unmöglich schien, sie zu öffnen und die Begierde zu befriedigen, welche mich in ein so gefahrvolles Abenteuer verwickelt hatte.Indem ich nun, der verbotnen Pforte gegenüberstehend, vergebens auf ein Mittel sann, diese Schwierigkeit zu überwinden, erblickte ich über der Tür, in diamantnen Charakteren der heiligen Priesterschrift, die mir nicht unbekannt war, den Namen Hermes Trismegistos. Ich las ihn mit lauter Stimme, und kaum hatte ich ihn ausgesprochen, so öffnete sich die Pforte von selbst, die beiden Sphinxe belebten sich, sahen mich mit funkelnden Augen an und wichen so weit zurück, daß ich zwischen ihnen durchgehen konnte. Sobald ich über die Schwelle der Pforte von Ebenholz geschritten war, schlossen sich ihre Flügel, wie von einem innewohnenden Geiste bewegt, von sich selbst wieder zu, und ich befand mich in einem runden Dome von schwarzem Jaspis, dessen furchtbares Dunkel nur von Zeit zu Zeit, in Pausen von zehn bis zwölf Sekunden, durch eine Art von plötzlichem Wetterleuchten erhellt wurde, das an den schwarzen glattgeschliffnen Wänden herumzitterte und ebenso schnell verschwand als entstand.
Bei dieser majestätischen und geheimnisvollen Art von Beleuchtung erblickte ich in der Mitte des Doms ein großes Prachtbette von unbeschreiblichem Reichtum, worauf ein langer ehrwürdiger Greis mit kahlem Haupte und einem schlohweißen Barte, die Hände auf die Brust gelegt, sanft zu schlummern schien. Zu seinen Häupten lagen zwei Drachen von so seltsamer und schrecklicher Gestalt, daß ich sie noch jetzt, nach so viel Jahrhunderten, vor mir zu sehen glaube. Sie hatten einen flachen Kopf mit langen herabhangenden Ohren, runde gläserne Augen, die weit aus ihren Kreisen hervorragten, einen Rachen gleich dem Krokodil, einen langen äußerst dünnen Schwanenhals und ungeheure lederne Flügel wie die Fledermäuse; der vordere Teil des Leibes war mit starren spiegelnden Schuppen bedeckt und mit Adlersfüßen bewaffnet, und der Hinterleib endigte sich in eine dicke, siebenmal um sich selbst gewundene Schlange. Ich bemerkte bald, daß das Wetterleuchten, das diesen Dom alle zehn Sekunden
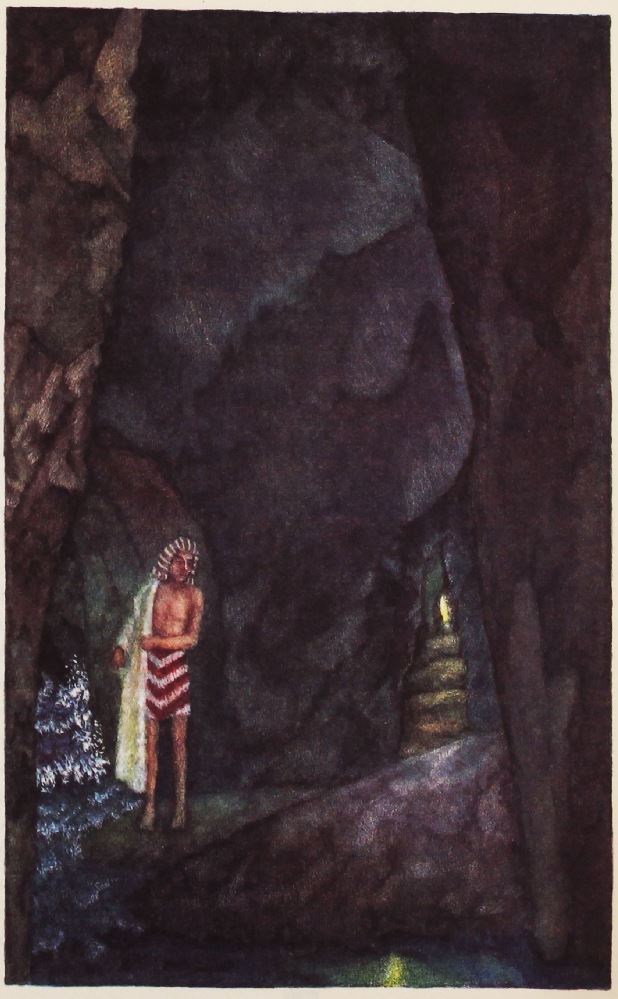
Wie schauderhaft auch der Anblick dieser gräßlichen Ungeheuer war, so schienen sie doch nichts Feindseliges gegen mich im Sinne zu haben, sondern erlaubten mir, den majestätischen Greis, der hier den langen Schlaf des Todes schlief, bei dem flüchtigen Lichte, das sie von sich gaben, so lang ich wollte zu betrachten. Ich bemerkte eine dicke Rolle von ägyptischem Papier, die zu den Füßen des Greises lag und mit Hieroglyphen und Charakteren beschrieben schien. Eine unsägliche Begierde, der Besitzer dieser Handschrift zu sein, bemächtigte sich meiner bei diesem Anblick; denn ich zweifelte nicht, daß sie die verborgensten Geheimnisse des großen Hermes enthalte. Zehnmal streckte ich die Hand nach ihr aus, und zehnmal zog ich sie wieder mit Schaudern zurück. Endlich wurde die Begierde Meister, und meine Hand berührte schon den heiligen Schatz, gegen welchen ich alle Schätze über und unter der Erde verachtete, als mich ein Blitz aus dem Munde eines der beiden Drachen plötzlich zu Boden warf und alle meine Glieder dergestalt lähmte, daß ich unfähig war, wieder aufzustehen. Sogleich fuhr eine kleine geflügelte und gekrönte Schlange, die den hellsten Sonnenglanz von sich warf, aus der Kuppel des Dorns herab und hauchte mich an: Ich fühlte die Kraft dieses Anhauchs gleich einer lieblich scharfen geistigen Flamme, alle meine Nerven dergestalt durchdringen, daß ich etliche Augenblicke wie betäubt davon war. Als ich mich aber wieder aufraffte, sah ich einen Knaben vor mir, der auf einem Lotusblatte saß und, indem er den Zeigefinger der rechten Hand auf den Mund drückte, mir mit der Linken die Rolle darreichte, die ich zu den Füßen des schlafenden Greises gesehen hatte. Ich erkannte den Gott des heiligen Stillschweigens und warf mich vor ihm zur Erde, aber er war wieder verschwunden, und nun wurde ich erst gewahr, daß ich mich, ohne zu begreifen, wie es damit zugegangen, anstatt in der großen Pyramide bei Memphis in meinem Bette befand.«
»Wunderbar! Seltsam, bei meiner Ehre!«rief König Mark mit allen
Zeichen des Erstaunens und der Überraschung auf dem gläubigsten Gesichte von der Welt.»So kam es mir auch vor«, erwiderte Misfragmutosiris, »und ich würde mich sicher selbst beredet haben, daß mir alle diese wunderbaren Dinge bloß geträumt hätten, wenn die geheimnisvolle Rolle in meiner Hand mich nicht von der Wirklichkeit derselben hätte überzeugen müssen. Ich betrachtete sie nun mit unbeschreiblichem Entzücken, ich betastete und beroch sie auf allen Seiten und konnte es gleichwohl kaum meinen eignen Sinnen glauben, daß ein so unbedeutender Mensch wie ich der Besitzer eines Schatzes sei, um welchen Könige ihre Kronen gegeben hätten. Das Papier war von der schönsten Purpurfarbe, die Hieroglyphen gemalt und die Charaktere von dünn geschlagenem Golde.«
»Das muß ein schönes Buch sein«, sprach König Mark; »ich weiß nicht, was ich darum gäbe, es nur eine Minute lang in meiner Hand zu haben. Dürfte ich bitten?«
»Von Herzen gern, wenn es noch in meinen Händen wäre.« »Wie? Es ist nicht mehr in Euern Händen?«rief Mark mit kläglicher Stimme.
»Ich besaß es nur sieben Tage. Am achten Tag erschien mir der Knabe auf dem Lotusbiatt wieder, nahm die Rolle aus meiner Hand und verschwand damit auf ewig. Aber diese sieben Tage waren für mich hinreichend, mich zum Meister von sieben Geheimnissen zu machen, deren geringstes von unschätzbarem Wert in meinen Augen ist. Seit dieser merkwürdigen Nacht sind nun über tausend Jahre verstrichen.«
»Über tausend Jahre?«unterbrach ihn König Mark abermals. »Ist's möglich? Über tausend Jahre?«
»Alles ist möglich«, antwortete der tausendjährige Schüler des großen Hermes mit seinem gewöhnlichen Kaltsinne: »Dies ist es kraft des siebenten Geheimnisses. Seitdem ich im Besitze desselben bin, ist der ganze Erdboden mein Vaterland, und ich sehe Königreiche und Geschlechter der Menschen um mich her fallen wie die Blätter
von den Bäumen. Ich wohne bald hier, bald da, bald in diesem, bald in jenem Teile der Welt; ich rede alle Sprachen der Menschen, kenne alle ihre Angelegenheiten und habe bei keiner zu gewinnen, noch zu verlieren; ich verlange über niemand zu herrschen und bin niemand untertan; aber wenn ich (was mir selten begegnet) einen guten König antreffe, so habe ich mein Vergnügen daran, sein Vermögen, Gutes zu tun, zu vermehren.«König Mark versicherte, er wünsche und hoffe, einer von den guten Königen zu sein; wenigstens habe er immer seine Lust daran gehabt, Gutes zu tun, und bloß, um unendlich viel Gutes tun zu können, habe er sich gewünscht, den Stein der Weisen in seine Gewalt zu bekommen.
Misfragmutosiris gab ihm zu verstehen, dazu könne wohl noch Rat werden; er schien die Sache als eine Kleinigkeit zu betrachten, wollte sich aber für diesmal nicht näher darüber erklären.
König Mark, der einen Mann, dem nichts unmöglich war, zum Freunde hatte, glaubte den Stein der Weisen schon in seiner Tasche zu fühlen, und gab, auf Abschlag der Goldberge, in welche er seine Kupferberge bald zu verwandeln hoffte, alle Tage glänzendere Feste; denn der Ruf des Wundermannes mit dem goldnen Sphinx auf der Mütze, der schon tausend Jahre alt war, alle Krankheiten heilen konnte und ein Krokodil zum Spiritus familiaris hatte, war bereits im ganzen Lande erschollen, und mit der hohen Meinung, die das Volk von ihm gefaßt hatte, war auch der gesunkene Kredit des Königs wieder höher gestiegen.
Die Königin Mabillje mit ihren Damen und Jungfrauen trug nicht wenig bei, diese Hoflustbarkeiten lebhafter und schimmernder zu machen. Es war schon lange, daß König Mark, der die Veränderung liebte, seiner Gemahlin einige Ursachen gab, sich von ihm für vernachlässigt zu halten, und die Eifersucht, womit sie ihm ihre Zärtlichkeit zu beweisen sich verbunden hielt, war ihm so beschwerlich gefallen, daß ihm zuweilen der Wunsch entfahren war, daß sie (ihrer Tugend unbeschadet) irgendein anderes Mittel, sich die Langeweile
zu vertreiben, ausfindig machen möchte, als das Vergnügen, das sie daran zu finden schien, wenn sie ihm seine kleineren Zeitkürzungen verkümmern konnte. Er schien es daher entweder nicht zu bemerken oder (wie einige Hofleute wissen wollten) es heimlich ganz gerne zu sehen, daß ein schöner junger Ritter, der seit kurzem unter dem Namen Floribell von Nikomedien an seinem Hoflager erschienen war, sich auf eine sehr in die Augen fallende Art um die Gunst der Königin bewarb und alle Tage größere Fortschritte in derselben machte. In der Tat war es schon so weit gekommen, daß Mabillje ihre Parteilichkeit für den schönen Floribell sich selbst nicht länger leugnen konnte; da sie aber fest entschlossen war, einen tapfern Widerstand zu tun, so nahmen ihr die Angelegenheiten ihres eigenen Herzens so viel Zeit weg, daß sie keine hatte, den König in den seinigen zu beunruhigen.Wie lebhaft auch König Mark seine Geschäfte auf dieser Seite treiben mochte, so verlor er doch das Ziel seiner Hauptleidenschaft keinen Augenblick aus dem Gesichte. Es waren nun bereits einige Monate verstrichen, seit der Erbe des großen Trismegistos an seinem Hofe wie ein König bewirtet wurde, und Mark glaubte sich einiges Recht an seine Freundschaft erworben zu haben. Misfragmutosiris hatte sich zwar bei aller Gelegenheit gegen Belohnungen und große Geschenke erklärt; aber kleine Geschenke, pflegte er zu sagen, die ihren Wert bloß von der Freundschaft erhalten, deren Symbole sie sind, kann sich kein Freund weigern von dem andern anzunehmen. Weil aber die Begriffe von klein und groß relativ sind und unser Adept von Sachen, die nach der gemeinen Schätzung einen großen Wert haben, als von sehr unbedeutenden Dingen sprach, so hatten die kleinen Geschenke, die er nach und nach von seinem Freunde Mark anzunehmen die Güte gehabt hatte, die Schatzkammer des armen Königs ziemlich erschöpft, und es war hohe Zeit, ihr durch neue und ergiebige Zuflüsse wieder aufzuhelfen. Der Ägypter schien die Billigkeit hiervon selbst zu fühlen, und bei der ersten Anregung, welche der König von den sieben Geheimnissen tat, trug er kein Bedenken
mehr, ihm zu gestehen, daß das erste und geringste derselben die Kunst, den Stein der Weisen zu bereiten sei. Mark beteuerte, daß er mit diesem geringsten gern fürlieb nehmen wolle, und der Adept machte sich ein Vergnügen daraus, ihm ein Geheimnis zu entdecken, worauf er selbst zwar keinen großen Wert legte, das aber gleichwohl, wie er weislich sagte, um des Mißbrauchs willen allen Profanen ewig verborgen bleiben müsse.»Der wahre Hermetische Stein der Weisen«, sagte er, »kann aus keiner andern Materie als aus den feinsten Edelsteinen, Diamanten, Smaragden, Rubinen, Saphiren und Opalen gezogen werden. Die Zubereitung desselben, vermittelst Beimischung eines großen Teiles Zinnober und einiger Tropfen von einem aus verdickten Sonnenstrahlen gezogenen flüchtigen Ole, ist weniger kostbar oder verwickelt als mühsam und erfordert beinahe nichts als einen ungewöhnlichen Grad von Aufmerksamkeit und Geduld, und dies ist die Ursache, warum es der Mühe nicht wert wäre, einen Versuch im Kleinen zu machen. Das Resultat der Operation, welche unter meinen Händen nicht länger als dreimal sieben Tage dauert, ist eine Art von purpurroter Masse, die sehr schwer ins Gewicht fällt und sich zu einem feinen Mehle schaben läßt, wovon eines halben Gerstenkorns schwer hinreichend ist, zwei Pfund Blei zu ebensoviel Gold zu veredeln: Und dies ist, was man den Stein der Weisen zu nennen pflegt.«
König Mark brannte vor Begierde, so bald nur immer möglich einige Pfund dieser herrlichen Komposition zu seinen Diensten zu haben. Er fragte also ein wenig furchtsam, ob wohl eine sehr große Quantität Edelsteine vonnöten wäre, um ein Pfund des philosophischen Steines zu gewinnen.
»Oh«, sagte Misfragmutosiris, »ich merke, wo die Schwierigkeit liegt. An Edelsteinen soll es uns nicht fehlen; denn ich besitze auch das Geheimnis, die feinsten und echtesten Edelsteine zu machen. Ich muß gestehen, die Operation ist etwas langweilig: Sie erfordert gerade soviel Monate als der Stein der Weisen Tage, aber . . .«
»Nein«, fiel ihm Mark in die Rede, »so lange kann ich unmöglich warten! Lieber will ich meine Kronen und mein ganzes übriges Geschmeide dazu hergeben! Einundzwanzig Monate sind eine Ewigkeit! Wenn wir nur erst den Stein aller Steine haben, so soll es uns an den übrigen nicht fehlen. Für Gold ist alles zu bekommen, und allenfalls habe ich nichts dagegen, wenn Ihr bei guter Muße auch Edelsteine machen wollt.«
»Wie es beliebig ist«, sagte der Adept. »Von zwei Unzen Diamanten und zweimal so viel Rubinen, Smaragden und dergleichen erhalten wir genau einen Stein von zwölftausend Gran an Gewicht, und damit läßt sich schon was machen. Ich für meinen Teil brauche in hundert Jahren nicht so viel.«
»Kleinigkeit«, rief König Mark, »ich wette, an meiner schlechtesten Hauskrone müssen mehr Steine sein, als Ihr verlangt: Aber wenn wir einmal an die Arbeit gehen, so muß es auch der Mühe wert sein. Laßt mich dafür sorgen! Wir müssen einen Stein von vierundzwanzigtausend Gran bekommen, oder ich heiße nicht König Mark!« »Das beste ist«, sagte der Adept, »daß ich mit dem Sonnenöle schon versehen bin, welches von allen Ingredienzien das kostbarste ist und dessen Zubereitung einundzwanzig Jahre dauert. Ich bin immer besorgt, einige Phiolen davon vorrätig zu haben; denn außer dem, daß es bei Verfertigung des Steins die Hauptsache ist, so ist es auch die Materie, woraus, vermittelst einer Konzentration, welche dreimal einundzwanzig Jahre erfordert, das Hermetische Öl der Unsterblichkeit bereitet wird, von dessen wunderbaren Kräften ich dir künftig so viel entdecken werde, als mir erlaubt sein wird.«
König Mark war vor Freude außer sich, einen Freund zu besitzen, der solche Entdeckungen zu machen hatte, und eilte, was er konnte, alles Nötige zu dem großen Werke veranstalten zu helfen. An Ofen und allen Arten chymischer Werkzeuge konnte es an einem Hofe, wo schon so lange laboriert wurde, nicht fehlen; aber Misfragmutosiris erklärte sich, daß er außer einem kleinen Herde, den er in einem kleinen Kabinette seines Zimmers bauen ließ, und einem Sacke voll
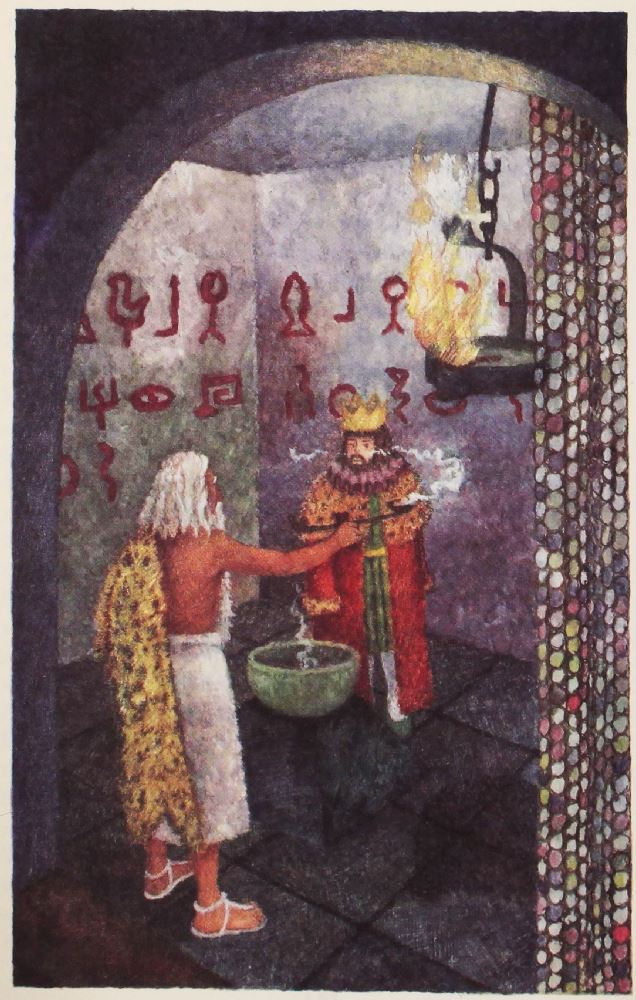
Sowie der Rauch in die Höhe stieg, erschien über dem Altar ein langöhriger Knabe, auf einem Lotusblatt sitzend, den Zeigefinger der rechten Hand an den Mund gelegt und in der linken eine brennende Fackel tragend. Mark wurde bei dieser Erscheinung leichenblaß und konnte sich kaum auf den Beinen erhalten, aber der Adept näherte seinen Mund dem rechten Ohre des Knaben und flüsterte ihm etwas zu, worauf dieser mit einem bejahenden Kopfnicken antwortete und verschwand. Misfragmutosiris hieß den König guten Mutes sein, gab ihm, um seine Lebensgeister wieder zu stärken, einen Löffel voll von einem Elixier von großer Tugend und empfahl ihm, morgen in der siebenten Stunde sich wieder einzufinden, indessen aber sich zur Ruhe zu begeben, während er selbst wachen werde, um die Erscheinung des großen Hermes, welcher ihm angekündigt worden, abzuwarten und die Mysterien zu vollziehen, womit das große Werk angefangen werden müsse, wenn man sich eines glücklichen Ausgangs versichern wollte.
König Mark begab sich voll Glauben und Erwartung in sein eigenes Gemach, und weil das, was ihm der Adept gegeben hatte, ein Schlaftrunk gewesen war, so schlief er hart und ununterbrochen zwei Stunden länger als die Zeit, auf welche er bestellt war. Endlich erwachte er, warf sich in seine Kleider und eilte dem geheimen Zimmer zu. Er fand alles in eben dem Stande, wie er es verlassen hatte; nur der weise Misfragmutosiris und das goldene Kästchen mit den Edelsteinen waren unsichtbar geworden.
Es gibt keine Worte, um die Bestürzung des Königs zu schildern, wie er seine sanguinischen Hoffnungen und sein grenzenloses Vertrauen auf das Haupt des Hermetischen Ordens so grausam betrogen sah. Auf die erste Betäubung des Erstaunens folgte Unwillen über sich selbst, und dieser brach endlich in Verwünschungen und wütende Drohungen gegen den Betrüger aus, der in einer sichern
Freistätte seiner Leichtgläubigkeit spottete. Er war im Begriff, in die Halle herunterzusteigen und alle seine Reisigen und Knechte aufsitzen zu lassen, um dem Flüchtling auf allen Seiten nachzusetzen, als auf einmal ein wunderschöner Jüngling in einem hell glänzenden Gewande mit einer goldnen Krone auf dem Haupte und einem Lilienstengel in der Hand vor ihm stand und ihn anredete. »Ich kenne den Unfall«, sprach der Jüngling, »der dich beunruhigt, und bringe dir Entschädigung. Du suchest den Stein der Weisen; nimm diesen Stein, bestreiche dreimal mit ihm deine Stirne und deine Brust hin und wider, und du wirst die Erfüllung deines Wunsches sehen.«Mit diesen Worten gab ihm der Jüngling einen purpurroten Stein in die Hand und verschwand.König Mark sank aus einer Bestürzung in die andre. Er betrachtete den Stein, den er auf eine so wunderbare und unverhoffte Art empfangen hatte, von allen Seiten, und wiewohl er nicht begriff, wie die Erfüllung seiner Wünsche und das Bestreichen seiner Stirne und seiner Brust mit diesem Steine zusammenhange, so war er doch zu sehr gewohnt, Dinge, von denen er nichts begriff, zu glauben und zu tun, als daß er hätte Anstand nehmen sollen, dem Befehle des Genius Folge zu leisten. Er bestrich sich also Stirne und Brust dreimal mit dem magischen Steine hin und wider und stand beim dritten Mal - in einen Esel verwandelt da.
Während daß dieses mit dem Könige vorging, erhob sich auf einem andern Flügel des Schlosses, wo die Königin wohnte, auf einmal ein entsetzlicher Lärm. Der schöne junge Ritter Floribell (der, wie wir nicht leugnen können, im Verdacht stand, die Nacht im Schlafzimmer der Königin zugebracht zu haben) hatte sich mit dem besten Teile ihrer Juwelen diesen Morgen unsichtbar gemacht. Mabillje war die erste Person am Hofe, die es gewahr wurde. Sie war im Begriff, vor Scham und Ärger sich ihre schönen Haare aus dem Kopfe zu raufen, als eine Dame von unbeschreiblicher Schönheit in rosenfarbnem Gewand und mit einer Krone von Rosen auf dem Haupte vor ihr stand und zu ihr sagte: »Ich kenne dein Anliegen, schöne Königin,
und komme, dir zu helfen. Nimm diese Rose und stecke sie an deine Brust, so wirst du glücklicher werden, als du jemals gewesen bist.«Mit diesen Worten reichte sie ihr eine Rose aus ihrer Krone hin und verschwand. Die Königin wußte nichts Besseres zu tun, als zu gehorchen: Sie steckte die Rose an ihren Busen und sah sich in dem nämlichen Augenblick in eine rosenfarbne Ziege verwandelt und in eine unbekannte wilde Einöde versetzt.Als die Kammerfrauen des Morgens um die gewöhnliche Stunde hereinkamen und weder die Königin noch ihre Juwelen, noch den schönen Floribell fanden, war die Bestürzung und der Lärm so arg, als man sich's vorstellen kann. Man konnte nicht zweifeln, daß sie sich von dem jungen Ritter habe entführen lassen, und man ging, es dem Könige anzuzeigen. Aber wie groß wurden erst der Schrecken und die Verwirrung, da auch der König und sein neuer Günstling, der Mann mit dem großen weißen Barte, nirgends zu finden waren! Sich vorzustellen, daß König Mark sich von dem alten Graubarte habe entführen lassen, war keine Möglichkeit. Man stellte sich also gar nichts vor, wiewohl acht Tage lang in ganz Cornwall von nichts anderm gesprochen wurde. Die Ritter und Knappen setzten sich alle zu Pferde und suchten den König und die Königin vier Monate lang in allen Winkeln von Britannien; aber alles Suchen war umsonst. Sie kamen wieder so klug nach Hause, wie sie ausgezogen waren, und das einzige, womit sich das Volk tröstete, war die Überzeugung, daß es ihnen leicht sein werde, wieder einen König zu finden, wenn sie keinen weisem haben wollten als König Mark.
Der königliche Esel hatte sich indessen mit vieler Behutsamkeit, um nicht entdeckt zu werden, aus seiner Burg ins Freie hinausgemacht und war mißmutig und mit gesenkten Ohren schon einige Stunden lang durch Wälder und Felder dahergetrabt, als er in einem Hohlwege eine junge mit einem Quersack beladene Bäuerin antraf, deren Wohlgestalt, frische Farbe und schönen blonden Haare ihm beim ersten Anblick etwas einflößten, das sich besser für seinen vorigen als gegenwärtigen Zustand schickte. Er blieb stehen, um das junge
Weib anzugaffen, die sich ganz außer Atem gelaufen hatte und vor Müdigkeit nicht mehr weiter konnte. Die Teilnehmung, die sie diesem allem Ansehen nach herrenlosen Tiere einzuflößen schien, erregte ihre Aufmerksamkeit: Sie näherte sich ihm, streichelte ihn mit einer sehr weißen atlasweichen Hand, und da er ganz ruhig stillhielt und (zum Zeichen, daß es ihm wohl behage, von einer so weichen Hand gekrabbelt zu werden) die Zähne bleckte und beide Ohren eilenlang vorstreckte, so bekam sie auf einmal Lust, ihn in ihre Dienste zu nehmen, und schwang sich auf seinen Rücken. Der Esel bequemte sich zu dem ungewohnten Dienste mit einer Gefälligkeit, von deren geheimem Beweggrunde die schöne Bäuerin sich wenig träumen ließ; er schien stolz auf die angenehme Bürde zu sein und trabte so munter mit ihr davon wie der beste Maulesel aus Andalusien. Wiewohl sie nichts hatte, womit sie ihn lenken konnte, als seine kurze Mähne, schien er doch die Bewegung ihrer Hände, ja sogar den Sinn ihrer Worte zu verstehen, und so brachte er sie durch eine Menge Abwege, die sie ihm andeutete. Gegen Einbruch der Nacht gelangten sie in eine wilde Gegend an der Seeküste, die von Felsen und Gehölz eingeschlossen und nur gegen die benachbarte See ein wenig offen war.Sie hielten vor einer mit Kiefern und wildem Gebüsche umwachsenen Höhle still, wo die junge Bäuerin kaum mit etwas heller Stimme zwei- oder dreimal Kasilde rief, als ein feiner wohlgewachsener Mann von dreißig bis vierzig Jahren in Matrosenkleidung aus der Höhle hervoreilte und mit großer Freude über ihre Ankunft ihr von dem lastbaren Tier herunterhalf. »Dank sei dem Himmel«, rief er, sie umarmend, »daß du da bist, liebe Kasilde;mir war schon herzlich bang, es möchte dir ein Unfall zugestoßen sein.« —»Sage lieber Dank diesem guten Esel«, versetzte die Bäuerin lachend; »denn ohne ihn würdest du mich schwerlich so bald, vielleicht gar nicht wiedergesehen haben.« — »Dafür soll er nun auch ausrasten und so viel Gras oder Disteln fressen, als er in dieser hungrigen Gegend finden kann«, sagte jener; »ich bin unendlich in seiner Schuld, daß er dich
und, wie ich sehe, auch den lieben Quersack so glücklich in meine Arme geliefert hat.«Der König-Esel stutzte mächtig, da er eine Stimme hörte, die ihm nur gar zu wohlbekannt war: Er betrachtete die beiden Personen (denen er unvermerkt in die Höhle gefolgt war) beim Schein einer Lampe, die aus dem Felsen herabhing, und es kam ihm vor, als ob ihm die Züge des Matrosen und der jungen Bäuerin nicht ganz fremd wären. Er schaute dem ersten schärfer ins Gesicht: Die Ähnlichkeit schien immer größer zu werden, und wie er von ungefähr nach einer Art von steinernem Tische sah, der aus einer von den Felsenwänden hervorragte, fiel ihm ein langer weißer Bart in die Augen, der auf einmal ein verhaßtes Licht in seinen dumpfen Schädel warf.
»Ha, ha«, rief die Bäuerin lachend; »da ist ja auch der Hermetische Bart!« — »Ich weiß wahrlich nicht«, sagte der Mann im nämlichen Tone, »warum ich ihn nicht unterwegs in eine Hecke geworfen habe: Er hat nun seine Dienste getan, und wir werden ihn schwerlich wieder nötig haben.« —»Dafür ist gesorgt«, versetzte jene, indem sie auf den Quersack klopfte; »sieh einmal und sage, ob ich nicht würdig bin, die Geliebte eines Zeitgenossen des Königs Amasis zu sein.« »O gewiß«, rief der weise Misfragmutosiris, »und des Dreimal großen Hermes selbst, wenn du willst. Aber«, fuhr er fort, indem er den Sack ausleerte, »wo hast du deine schimmernde Hof ritter-Kleidung gelassen, Kasilde?« — »Wie du siehst, hab ich sie mit der der ersten hübschen Bäuerin, die ich nach der Stadt zu Markte gehen sah, vertauscht.« —»Der Schade ist zu verschmerzen«, sagte das unsichtbare Haupt des Hermetischen Ordens, indem er den kostbaren Inhalt des Quersackes durchmusterte; »aber damit du mir nicht gar zu stolz auf deine Talente wirst, Mädchen - sieh einmal her, ob ich mir die Abenteuer in der großen Pyramide zu Memphis und den Schrecken, den mir die wetterleuchtenden Drachen am Prachtbette des großen Hermes eingejagt, nicht teuer genug habe bezahlen lassen.«
Man stelle sich vor, wie des armen Esels Majestät dabei zumute war, da er alle die Geschenke, die der schelmische Adept nach und nach
von ihm erhalten hatte, mit den gesamten Edelsteinen seiner Kronen und dem größten Teile des Schmuckes der Königin in funkelnder Pracht auf dem steinernen Tische ausgebreitet sah. Wäre ihm nicht die unbegrenzte Duldsamkeit zustatten gekommen, die als eine charakteristische Tugend der Gattung, zu welcher er seit kurzem gehörte, von jeher gepriesen worden ist, er würde sich unmöglich haben halten können, die Wut, die in seinem Busen kochte, auf die fürchterlichste Art ausbrechen zu lassen. O warum mußte ich nun auch gerade in einen Esel verwandelt werden? dachte er. Wär ich ein Leopard, ein Tiger, ein Nashorn, wie wollte ich! Aber wozu kann das helfen? Mit einem Esel würden sie bald fertig werden. So sprach der arme König Mark zu sich selbst und lag in seinem Winkel so still und in einen so kleinen Raum zusammengeschmiegt, als ihm nur immer möglich war, um wenigstens seine Neugier zu befriedigen, indem er dem vertraulichen Gespräche dieser zu seinem Unglück verschwornen Schlauköpfe zuhörte.Nachdem sie ihre Augen an der kostbaren Beute satt geweidet hatten, regte sich ein Bedürfnis von einer dringerndern Art; denn sie hatten beide den ganzen Tag nichts gegessen. Der Adept, der immer an alles dachte, hatte, da ihm in der Burg noch alles zu Gebote stand, sich aus der königlichen Küche mit Vorrat auf etliche Tage reichlich versehen lassen. Er zog einen Teil davon nebst einer Flasche köstlichen Weins aus seinem Sacke, und während sie sich's trefflich schmecken ließen, vergaßen sie nicht, sich durch tausend leichtfertige Einfälle über die Leichtgläubigkeit des Königs von Cornwall und die Schwachheit seiner tugendreichen Gemahlin lustig zu machen. »Nun muß ich dir doch erzählen, lieber Gablitone«, sagte die schöne Spitzbübin, »wie ich es anfing, um die Tugend der guten Königin so kirre zu machen, daß ich Gelegenheit bekam, unsern Anschlag auszuführen.«
»Wie du das anfingst, Kasilde? So wie du in deiner Hofritter-Kleidung aussahest und bei allen deinen übrigen Gaben, welche Königin in der Welt hätte sich nicht von dir fangen lassen?«
»Schmeichler! Die meinige zappelte noch im Garne so heftig, daß sie es beinahe zerrissen hätte. Meinen Verführungskünsten würde sie vielleicht widerstanden haben, aber die Eifersucht über die Buhlereien des Königs, die Langeweile, die Gelegenheit, eine gereizte Einbildungskraft und unbefriedigte Sinne kämpften für mich, und sie wurde endlich überwältigt, indem sie sich bis auf den letzten Augenblick wehrte.Das Fest, das der König am Tage vor unsrer Entweichung gab, beförderte mein Glück nicht wenig. Ich verdoppelte die Lebhaftigkeit meiner Anfälle auf ihr Herz; Tanz und griechische Weine hatten ihr Blut erhitzt; eine gewisse Fröhlichkeit, der sie sich überließ, machte sie sorglos und zuversichtlich; sie tat, was sie noch nie getan hatte: Sie machte sich ein Spiel aus meiner Leidenschaft und verwickelte sich unvermerkt immer stärker, je weniger sie Gefahr zu sehen schien. Endlich wirkte das Opiat, das ich zu gehöriger Zeit in ihren Wein hineinpraktiziert hatte. Eine angenehme Mattigkeit überfiel ihre Sinne, ihre Augen funkelten lebhafter, aber ihre Knie erschlafften; sie schrieb es der Müdigkeit vom Tanze zu und begab sich in ihr Schlafgemach. Sobald ihre Jungfrauen sie zu Bette gebracht hatten, kamen sie in den Tanzsaal zurück, und ich schlich mich davon. Mabillje erschrak nicht wenig, da sie, schon halb eingeschlummert, mich vor ihrem Bette sah. Gleichwohl merkte ich, daß ich nicht ganz unerwartet kam und daß ein anderer an meinem Platze klüger getan hätte, etwas später zu kommen. Genug, die Delikatesse, womit ich vermöge der Vorteile meines Geschlechts meine vorgebliche Leidenschaft in diesen kritischen Augenblicken zu mäßigen wußte, ohne darum weniger zärtlich und feurig zu scheinen, gewann unvermerkt so viel über die gute Dame, daß ich mich, wenn der Schlaftrunk nicht so wirksam gewesen wäre, in keiner geringen Verlegenheit befunden haben würde. Aber er überwältigte sie gar bald unter so zärtlichen Liebkosungen, daß sie beim Erwachen sich vermutlich für viel strafbarer halten wird, als ich sie machen konnte; und dieses Kästchen von Ambra mit dem besten Teil ihres Geschmeides ist der
Beweis, daß ich meine Zeit nicht mit Betrachtung ihrer schlummernden Reize verlor, wie vielleicht der weise Misfragmutosiris selbst an meinem Platze getan haben möchte.«»Spitzbübin«, sagte Gablitone, indem er sie auf die Schulter klopfte; »jedes von uns war auf seinem gehörigen Posten: Du hast deine Rolle wie eine Meisterin gespielt, und weniger konnte ich auch nicht von dir erwarten, als ich dich beredete, das Theater zu Alexandria zu verlassen und mir den Plan ausführen zu helfen, der uns so glücklich gelungen ist. Wir haben nun genug, um künftig bloß unsre eigenen Personen zu spielen. Morgen soll uns ein Fischerboot nach Kleinbritannien hinüberbringen, und von dort wird es uns nicht an Gelegenheitfehlen, in unser Vaterland zurückzukehren. Inzwischen, schöne Kasilde, laß uns dem guten Beispiel unsers Esels folgen, der dort im Winkel eingeschlafen ist. Wir sind hier vor allen Nachsetzern sicher und bedürfen der Ruhe.«
Der königliche Esel war nichts weniger als eingeschlafen, wiewohl er sich so gestellt hatte. Der Verdruß, sich so schändlich hintergangen zu sehen, ein Augen- und Ohrenzeuge der Ränke und des glücklichen Erfolges der Betrüger und (was das ärgste war) selber aus einem König in einen Esel verwandelt zu sein, seine Feinde vor Augen zu sehen und sich nicht an ihnen rächen zu können, ja in seiner Eselsgestalt noch sogar selbst ein Werkzeug ihres Glückes gewesen zu sein, alles das schnürte ihm die Kehle so zusammen, daß er kaum noch atmen konnte. Aber eine andre Szene, die in alle Leidenschaften, welche in seinem Busen kochten, noch das Furiengift des Neides goß, setzte ihn auf einmal in solche Wut, daß er nicht länger von seinen Bewegungen Meister war.
Er sprang mit einem gräßlichen Geschrei von seinem Lager auf und über die beiden Glücklichen her, die sich einer solchen Ungezogenheit von ihrem Esel so wenig versehen hatten, daß sie etliche tüchtige Hufschläge davontrugen, ehe sie sich seiner erwehren konnten. Aber der Handel fiel doch zuletzt wie natürlich zum Nachteil des unglücklichen Königs aus; denn der ergrimmte Adept fand bald einen
Knüttel, womit er einen so dichten Hagel von Schlägen auf den Kopf und Rücken des langohrigen Geschöpfes regnen ließ, daß es halb tot zu Boden fiel und zuletzt, nachdem jener auf inständiges Bitten der mitleidigen Kasilde seiner Rache endlich Grenzen setzte, in einem höchst kläglichen Zustande zur Höhle hinausgeschleppt wurde.Der arme Mark war nunmehr auf einen Grad von Elend gebracht, wo der Tod das einzige zu sein scheint, was einem, der Mensch und ein König gewesen war, in einer solchen Lage noch zu wünschen übrig ist. Aber der mächtige Trieb der Selbsterhaltung ringt in jedem lebenden Wesen dem Tode bis zum letzten Hauch entgegen. Der gemißhandelte Esel kroch, so weit er konnte, von der verhaßten Höhle ins Gebüsch, und ein paar Stunden Ruhe, die freie Luft und etwas frische Weide, die er auf einem offnen Platze des Waldes fand, brachten ihn soweit, daß er mit Anbruch des Tages seine Beine wieder ziemlich munter heben konnte. Er lief den ganzen Tag in der Wildnis herum ohne einen andern Zweck, als sich von den Wohnungen der Menschen zu entfernen, in deren Dienstbarkeit zu geraten er nun für das einzige Unglück hielt, das ihm noch begegnen konnte; denn von Wölfen und anderen reißenden Tieren war das Land ziemlich gereinigt. So trabte er den ganzen Tag auf ungebahnten Pfaden daher, stillte seinen Hunger, so gut er konnte, trank, wenn er Durst hatte, aus einer Quelle oder Pfütze und schlief des Nachts in irgendeinem dicken Gebüsche, wiewohl ihn die Erinnerung an seinen vorigen Zustand wenig schlafen ließ. Das seltsamste bei dem allen war, daß er die unselige Grille, die ihm so teuer zu stehen kam, das Verlangen nach dem Besitze des Steins der Weisen, auch in seinem Eselsstande nicht aus dem Kopfe kriegen konnte. Den Tag über dachte er an nichts andres, und des Nachts träumte ihm von nichts anderm.
Der wohltätige Genius, der den Entschluß gefaßt hatte, ihn von dieser Torheit zu heilen, machte sich diese Disposition seines Gehirnes zunutze und wirkte durch einen Traum, was vielleicht die Vorstel

Ihm träumte, er sei noch König von Cornwall wie ehemals und stehe voll Unmut über einen mißlungenen Versuch an seinem chemischen Herde. Auf einmal sah er den schönen Jüngling wieder vor sich stehen, von welchem er den purpurroten Stein empfangen zu haben sich sehr wohl erinnerte. »König Mark«, sprach der Genius mit einer Stimme voll Ernstes zu ihm, »ich sehe, daß das Mittel, wodurch ich dich von deinem Wahnsinne zu heilen hoffte, nicht angeschlagen hat. Du verdienst, durch die Gewährung deiner Wünsche bestraft zu werden. Vergeblich würdest du bis ans Ende der Tage den Stein der Weisen suchen, denn es gibt keinen solchen Stein; aber nimm diese Lilie, und alles, was du mit ihr berührst, wird zu Golde werden.« Mit diesen Worten reichte ihm der Jüngling die Lilie dar und verschwand.
König Mark stand einen Augenblick zweifelhaft, ob er dem Geschenke trauen sollte; aber seine Neugier und sein Durst nach Golde überwogen bald alle Bedenklichkeiten: Er berührte einen Klumpen Blei, der vor ihm lag, mit der Lilie, und das Blei wurde zum feinsten Golde. Er wiederholte den Versuch an allem Blei und Kupfer, womit das Gewölbe angefüllt war, und immer mit dem nämlichen Erfolge. Er berührte endlich einen großen Haufen Kohlen; auch dieser wurde in einen ebenso großen Haufen Gold verwandelt. Die Wonnetrunkenheit des betörten Königs war unaussprechlich. Er ließ unverzüglich zwölf neue Münzhäuser errichten, wo man Tag und Nacht genug zu tun hatte, alles Gold, das er mit seiner Lilie machte, in Münzen aller Arten auszuprägen. Da in Träumen alles sehr schnell vonstatten geht, so befanden sich in kurzem alle Gewölbe seiner Burg mit mehr barem Gelde angefüllt, als jemals auf dem ganzen Erdboden im Umlauf gewesen ist. Nun, dachte Mark, ist die Welt mein. Er fragte sich selbst, was ihn gelüstete, und sein Gold verschaffte es ihm, es mochte noch so kostbar oder ausschweifend sein.
Mit der Willkür, über eine unerschöpfliche Goldquelle zu gebieten, geriet er sehr natürlicher Weise in den Wahn, daß er alles vermöge: Er wollte also auch seine Wünsche ebenso schleunig ausgeführt wissen, als sie in ihm entstanden, und was er gebot, sollte auf den Sturz dastehen. Seine Untertanen zogen daher wenig Vorteil von dem unermeßlichen Aufwande, den er machte; denn er ließ ihnen keine Zeit, weder die zu seinen Unternehmungen nötigen Materialien herbeizuschaffen noch sie zu verarbeiten. Zudem fehlte es auch in seinem Lande an Künstlern; und zu warten, bis er durch seine Unterstützung welche erzogen hätte, konnte ihm gar nicht einfallen. Wozu hätte er das auch nötig gehabt? Es fanden sich Künstler und Arbeiter aus allen Enden der Welt bei ihm ein, und alle nur ersinnlichen Produkte und Waren wurden ihm aus Italien, Griechenland und Ägypten in unendlichem Überfluß zugeführt. Er ließ Berge abtragen, Täler ausfüllen, Seen austrocknen, schiffbare Kanäle graben; er führte herrliche Paläste auf, legte zauberische Gärten an, erfüllte diese und jene mit allen Reichtümern der Natur, mit allen Wundern der Künste, und das alles, sozusagen, wie man eine Hand umwendet. Die schönsten Weiber, die vollkommensten Virtuosen, die sinnreichsten Erfinder neuer Wollüste, alles, was jede seiner Leidenschaften, Gelüste und Launen reizen und befriedigen konnte, stand zu seinem Gebot. Er gab Turniere, Schauspiele und Gastmähler, wie man noch keine gesehen hatte, und verschwendete oft in einem Tage mehr Gold, als die reichsten Könige im ganzen Jahre einzunehmen hatten.
Bei all diesem zog die ungeheure Menge Gold, die er auf einmal in die Welt ergoß, einige sehr beträchtliche Unbequemlichkeiten nach sich. Die erste war, daß die Fremden, die aus allen Ländern der Welt herbeiströmten, ihm ihre Waren, ihre Köpfe, Hände oder Füße anzubieten, sobald sie von der Unerschöpflichkeit seiner Goldquelle benachrichtigt waren, ihre Preise in kurzer Zeit erst um hundert, dann um tausend, zuletzt um zehntausend Prozent steigerten. Alle Produkte des Kunstfleißes wurden so teuer, daß Gold hingegen we
gen seines Überflusses so wohlfeil, daß es endlich ganz unfähig ward, als ein Zeichen des Wertes der Dinge im Handel und Wandel gebraucht zu werden. Aber bevor es soweit kam, zeigte sich eine noch weit schlimmere Folge der magischen Lilie, die in den Händen des Königs die Stelle des Steins der Weisen vertrat; denn während seine grenzenlose Hoffart, Üppigkeit und Verschwendung die halbe Welt mit Gold überschwemmte, verhungerte der größte Teil seiner eigenen Untertanen, weil ihnen beinahe alle Gelegenheit, etwas zu verdienen, abgeschnitten war. Ackerbau und Gewerbe lagen darnieder; denn wer hätte sich im Lande noch damit abgeben sollen, da man alle Notwendigkeiten und Überflüssigkeiten des Lebens in allen Häfen des Königreichs zu allen Zeiten in größrer Güte und Vollkommenheit haben konnte und da überdies alle hübschen jungen Leute vom Lande nur nach der Hauptstadt zu gehen brauchten, um tausend Gelegenheiten zu finden, durch Müßiggehen dort ein ganz anderes Glück zu machen, als sie an ihrem Orte durch Arbeit und Wirtschaft zu machen hoffen konnten?König Mark, sobald er von der Not des Volkes Bericht erhielt, glaubte ein unfehlbares Mittel dagegen zu besitzen und säumte nicht, in allen Städten, Flecken und Dörfern des Landes so viel Gold austeilen zu lassen, daß sich der ärmste Tagelöhner auf einmal reicher sah, als es vormals sein Edelmann gewesen war. Mark glaubte dadurch dem Übel abgeholfen zu haben, aber er hatte aus Übel Ärger gemacht; denn nun hörte vollends aller Fleiß und alle häusliche Tugend auf: Jedermann wollte sich nur gute Tage machen, und in kurzem waren alle diese Reichtümer, die so wenig gekostet hatten, in Saus und Braus und unter den zügellosesten Ausschweifungen durchgebracht. Der König konnte nicht Gold genug machen, und wie es endlich seinen Wert gänzlich verlor, so stellte sich wieder der vorige Mangel ein, der aber nun durch die Erinnerung der goldnen Tage des Wohllebens desto unerträglicher fiel und unter einem Volke, das alles sittliche Gefühl und alle Scheu vor den Gesetzen verloren hatte, ein allgemeines Signal zu Raub, Mord und Aufruhr
wurde. Der König, der sich und sein Volk vor lauter Reichtum in Bettler verwandelt sah, wußte sich nicht zu helfen; aber er hatte noch nicht alle Früchte seines wahnsinnigen Wunsches gekostet. Sie blieben nicht lange aus. Sein von allen Arten der Schwelgerei erschöpfter und zerrütteter Körper erlag endlich den übermäßigen Anstrengungen der Lüste; sein Magen hörte auf zu verdauen, seine Kräfte waren dahin, seine abgenützten Sinne taub für jeden Reiz des Vergnügens, scheußliche Krankheiten, von den empfindlichsten Schmerzen begleitet, rächten die gemißbrauchte Natur und ließen ihn in den besten Jahren seines Lebens alle Qualen einer langsamen Vernichtung fühlen.In diesem Zustande merkte König Mark, daß es noch ein elenderes Geschöpf gebe als einen halbtot geprügelten Esel und daß dieses elendeste aller Geschöpfe ein König sei, dem irgendein feindseliger Dämon die Gabe, Gold zu machen gegeben, und der unsinnig genug habe sein können, ein so verderbliches Geschenk anzunehmen. Aber wie unbeschreiblich war dafür auch seine Freude, da er mitten in diesem peinvollen Zustand erwachte und im nämlichen Augenblicke fühlte, daß alles nur ein Traum und er selbst glücklicherweise der nämliche Esel sei wie zuvor! Er stellte jetzt in der lebhaften Spannung, die dieser Traum seinem Gehirne gegeben hatte, Betrachtungen an, wie sie vermutlich noch kein Geschöpf seiner Gattung vor ihm angestellt hat; und das Resultat davon war, daß er aus voller Überzeugung bei sich selbst festsetzte, lieber ewig ein Esel zu bleiben, als ein König ohne Kopf und ein Mensch ohne Herz zu sein. Während der Nutzanwendung, welche der königliche Esel aus seinem Traume zog, war der Morgen angebrochen, und wie er sich aufmachte, um die Gegend, in die er geraten war, ein wenig auszukundschaften, ward er am Fuß eines mit Tannen und Kiefern bewachsenen Felsens eine Art von Einsiedelei gewahr, um welche einige Ziegen herumkletterten und hier und da, wo sich zwischen den Spalten oder auf den flacheren Teilen des Felsens etwas Erde angesetzt hatte, ihre Nahrung suchten. Vor der Einsiedelei zog sich ein
schmaler, sanft an den Felsen angelegter Hügel hin, wovon der Fleiß des Menschen, der auch die wildeste Gegend zu bezähmen weiß, einen Teil zu einem Küchengarten angebaut und den andern mit allerlei Arten von Obstbäumen bepflanzt hatte, die unter dem Schirme der benachbarten Berge sehr wohl zu gedeihen schienen und das romantische Ansehen dieser Wildnis vermehrten. Indem der gute Mark ziemlich nahe, aber von einem dünnen Gesträuche bedeckt, alles dies mit einigem Vergnügen betrachtete, sah er eine Magd mit einem großen Krug auf dem Kopf aus der Hütte herausgehen, um an einer Quelle, welche fünfzig Schritte davon aus dem Felsen hervorsprudelte, Wasser zu holen. Sie schien eine Person von vierundzwanzig Jahren zu sein, wohigebildet, schlank, etwas bräunlich, aber dem Ansehen nach von blühender Gesundheit und munterm, gutlaunigem Wesen, wie Mark, der jetzt seine Menschheit wieder fühlte, aus ihrem leichten Gange und einem Liedchen, das sie vor sich herträllerte, zu erkennen glaubte. Sie ging in einem leichten, aber reinlichen bäurischen Anzuge daher, ohne Halstuch, die Haare in einen Wulst zusammengebunden, und indem sie sich im Vorbeigehen bückte, um eine frisch aufgeblühte Rose zu brechen und vorzustecken, hatte er einen Augenblick Gelegenheit, eine Bemerkung zu machen, die den Hofbusen, an die er gewöhnt war, wenig schmeichelte. Das Wenige, was ihn ein nicht allzu langer Rock von ihrem Fuße sehen ließ, bestärkte ihn vollends in der günstigen Meinung, die er nach diesem Muster von den Töchtern der kunstlosen Natur zu fassen anfing. Aber mit allen diesen Bemerkungen ward auch der Verdruß über seine gegenwärtige Gestalt wieder so lebhaft, daß er Kopf und Ohren voll Verzweiflung sinken ließ und (was noch nie ein Esel getan hat, noch jemals tun wird) mit dem Gedanken umging, sich von einem der benachbarten Felsen in die Schlucht herabzustürzen. Er entfernte sich mit einem schweren Seufzer von dem Orte, wo er ein so schmerzliches Gefühl seiner zur Hälfte verlornen Menschheit bekommen hatte, und war im Begriff, den Gedanken der Verzweiflung auszuführen, als ihm unversehens eine aus dem Grase emporprangende Lilie in die Augen fiel. Ihn schauderte vor ihrem Anblick, aber zu gleicher Zeit wandelte ihn eine so starke Begierde an, diese Lilie aufzuessen, daß er sich dessen nicht enthalten konnte. Kaum hatte er sie mit Blume und Stengel hinabgeschlungen, o Wunder!, so verschwand seine verhaßte Eselsgestalt, und er fand sich in einen wohlgewachsenen, nervigen, von Kraft und Gesundheit strotzenden Bauernkerl von dreißig Jahren verwandelt, der (außerdem, was in der menschlichen Bildung allgemein ist) mit dem, was er sich erinnerte vor seiner ersten Verwandlung gewesen zu sein, wenig Ähnliches hatte. Das Sonderbarste dabei war, daß er mit dem völligsten Bewußtsein, noch vor wenig Tagen Mark, König von Cornwall, gewesen zu sein, und mit deutlicher Erinnerung aller Torheiten, die er in dieser Periode seines Lebens begangen, eine ganz andere Vorstellungsart in seinem Gehirn eingerichtet fand, eine ganz andre Art von Herz in seinem Busen schlagen fühlte und an Leib und Seele bei diesem Tausche stark gewonnen zu haben glaubte.Man kann sich einbilden, wie groß seine Freude über eine so unverhoffte Veränderung war. Er dachte mit Schaudern daran, was sein Schicksal hätte sein können, wenn er wieder König Mark geworden wäre, und so lebhaft war der Eindruck, den er von seinem Traume noch in seiner Seele fand, daß ihn däuchte, wenn er wählen müßte, er wollte lieber wieder zum Esel als zum König Mark von Cornwall werden.
Unter diesen Gedanken befand er sich unvermerkt wieder vor der Hütte, aus welcher er die Frauensperson mit dem Krug auf dem Kopfe hatte herausgehen sehen. Ihm war, als ob ihn eine unsichtbare Gewalt nach der Hütte hinzöge. Er ging hinein und fand einen steinalten Mann mit einem eisgrauen Bart in einem Lehnstuhle und gegenüber ein zusammengeschrumpftes Mütterchen an einem Spinnrocken sitzen. Beim Anblick des eisgrauen Bartes wandelte ihn eine Erinnerung an, die ihn einen Schritt zurückwarf; aber alles übrige in dem Gesichte des alten Mannes paßte so gut zu diesem
ehrwürdigen Barte und flößte zugleich so viel Ehrfurcht und Liebe ein, daß er sich augenblicklich wieder faßte und die ehrwürdigen Bewohner dieser einsamen Hütte um Vergebung bat, daß er ohne Erlaubnis bei ihnen eingedrungen sei.»Ich irre«, sprach er, »durch einen Zufall, der mich aus meinem Wege warf, schon zwei Tage in dieser wilden Gegend herum, und meine Freude, endlich eine Spur von Menschen darin anzutreffen, war so groß, daß es mir unmöglich gewesen wäre, vorbeizugehen, ohne die Bewohner dieser Hütte zu grüßen, wenn mich auch kein anderes Bedürfnis dazu getrieben hätte.«Die beiden alten Leutchen hießen ihn freundlich willkommen, und da die Magd inzwischen ihr Frühstück hereingebracht hatte, nötigten sie ihn, sich zu ihnen zu setzen und mitzuessen. In kurzem wurden sie so gute Freunde, daß Mark, der sich den Namen Silvester gab, sich aufgemuntert fühlte, ihnen seine Dienste anzubieten. »Ich bin«, sprach er, »ein rüstiger junger Mann, wie Ihr seht; Ihr seid alt, und die junge Frauensperson hier mag doch wohl einen Gehilfen zur Beschickung dessen, was das Haus erfordert, nötig haben, wiewohl sie flink und von gutem Willen scheint. Ich habe Lust und Kräfte zum Arbeiten: Wenn Ihr mich annehmen wollt, so will ich alle Arbeit, die einen männlichen Arm erfordert, übernehmen und Euch in Ehren halten wie meine leiblichen Eltern.«
Die Magd, die inzwischen ab- und zugegangen war und den Fremden seitwärts, wenn sie nicht bemerkt zu werden glaubte, mit Aufmerksamkeit betrachtete, errötete bei dieser Erklärung, schien aber vergnügt darüber zu sein, wiewohl sie tat, als ob sie nicht zugehört hätte, und ungesäumt wieder an ihre Arbeit ging.
Die Alten nahmen das Erbieten des jungen Mannes mit Vergnügen an, und Silvester, der in einem Schuppen neben der Wohnung das nötige Feld- und Gartengerät fand, installierte sich noch an demselben Tage in seinem neuen Amte, indem er rings um die Wohnung alle noch unbepflanzten Plätze auszustocken und umzugraben anfing, um sie teils zu Kohl- und Rübenland, teils zum Anbau des nötigen
Getreides zuzurichten. Diese Arbeit beschäftigte ihn mehrere Wochen, und wie er damit fertig war, fing er an, einen Keller in den Felsen zu hauen, und brachte alle Zeit damit zu, die ihm die Gartenund Feldarbeit übrigließ. Das alte Paar gewann ihn so lieb, als ob er ihr leiblicher Sohn gewesen wäre, und er fühlte sich alle Tage glücklicher bei einer Lebensart, die ihm so leicht und bekannt vorkam, als ob er dazu geboren und erzogen gewesen wäre. Nie hatte ihm als König Essen und Trinken so gut geschmeckt, denn ihn hatte nie gehungert noch gedürstet; nie hatte er so wohl geschlafen, denn er hatte sich nie müde gearbeitet noch sich mit so ruhigem Herzen niedergelegt, nie war er zu den Lustbarkeiten des Tages so fröhlich aufgestanden als jetzt zu mühsamer Arbeit; nie hatte er das angenehme Gefühl, nützlich zu sein, gekannt; kurz, nie hatte er solche Freude an seinem Dasein, solche Ruhe in seinem Gemüt und so viel Wohlwollen und Teilnehmung an den Menschen, mit denen er lebte, empfunden; denn nun war er selbst ein Mensch und nichts als ein Mensch, und wie hätte er das sein können, als er König und, was noch ärger ist, ein törichter und lasterhafter König war?Mittlerweile hatten Silvester und die junge Frauensperson, die sich Rosine nannte, täglich so manche Gelegenheit, sich zu sehen, daß es in ihrer Lage ein gewaltiger Bruch in die Naturgesetze gewesen wäre, wenn die Sympathie, welche sich schon in der ersten Stunde bei ihnen zu regen anfing, nicht zu einer gegenseitigen Freundschaft hätte werden sollen, die in kurzem alle Kennzeichen der Liebe hatte und, ungeachtet sie einander noch kein Wort davon gesagt, sich auf so vielfältige Art verriet, daß das Einverständnis ihrer Herzen und Sinne keinem von beiden ein Geheimnis war. Endlich kam es an einem schönen Sommerabend zur Sprache, da sie im Walde, er bei der Beschäftigung, dürres Reisholz zusammenzubinden, sie, indem sie junges Laub für ihre Ziegen abstreifte, wie von ungefähr zusammenkamen. Anfangs war der Kreis, innerhalb dessen sie in der Entfernung eines ganzen Durchmessers arbeiteten, ziemlich groß, aber er wurde unvermerkt immer kleiner und kleiner, und so geschah
es zuletzt, daß sie, ohne daß es eben ihre Absicht zu sein schien, sich nahe genug beisammen fanden, um während der Arbeit ein freundliches Wort zusammen zu schwatzen. Die Wärme des Tages und die Bewegung hatten Rosinens bräunlichen Wangen eine so lebhafte Röte und, ich weiß nicht, was andres, das ihren Busen aus seinen Windeln zu drängen schien, ihren Augen einen so lieblichen Glanz gegeben, daß Silvester sich nicht erwehren konnte, vor ihr stehenzubleiben und sie mit einer Sehnsucht zu betrachten, die den beredtesten Liebesantrag wert war.Rosine war vierundzwanzig Jahre alt und eine unverfälschte Tochter der Natur. Sie stellte sich nicht, als ob sie nicht merke, was in ihm vorging, noch fiel es ihr ein, ihm verbergen zu wollen, daß sie ebenso gerührt war wie er. So entschloß Rosine sich, ihm freundlich ins Gesicht zu schauen. Dabei errötete sie, schlug die Augen nieder und seufzte. »Liebe Rosine«, sagte Silvester, indem er sie bei der Hand nahm, und konnte kein Wort weiter herausbringen, so voll war ihm das Herz.
»Ich merke schon lange«, sagte Rosine nach einer ziemlichen Pause mit leiserer Stimme, »daß du - mir gut bist, Silvester.«
»Daß ich dir gut bin, Rosine? Was in der Welt wollt ich nicht für dich tun und für dich leiden, um dir zu zeigen, wie gut ich dir bin!« rief Silvester und drückte ihr die Hand stark genug an sein Herz, daß sie sein Schlagen fühlen konnte.
»So ist mir's auch«, versetzte Rosine, »aber . . .«
»Aber was? Warum dies Aber, wenn ich dir nicht zuwider bin, wie du sagst?«
»Ich weiß nicht, was ich dir antworten soll, Silvester: Ich bin dir herzlich gut, ich wollte lieber dein sein, als die vornehmste Frau in der Welt heißen -aber -mir ist, es werde nicht angehen können.«
»Und warum sollte es nicht angehen können, da wir uns beide gut sind?«
»Weil es - eine gar besondere Sache mit mir ist«, sagte Rosine stockend.
»Wieso, Rosine?«fragte Silvester, indem er ihre Hand erschrocken fahrenließ.
»Du wirst mir's nicht glauben, wenn ich dir's sage.«
»Ich will dir alles glauben, liebe Rosine, rede nur!«
»Ich bin nur zwei Tage, ehe ich dich zum ersten Male sah, eine - rosenfarbne Ziege gewesen.«
»Eine rosenfarbne Ziege? —Doch wenn's nichts weiter ist als dies, so haben wir einander nichts vorzuwerfen, liebes Mädchen; denn um eben dieselbe Zeit war ich, mit Respekt, ein Esel.«
»Ein Esel!« rief Rosine ebenso erstaunt wie er; »das ist sonderbar! Aber wie ging das zu, daß du es wurdest und daß du nun wieder Mensch bist?«
»Mir erschien in einem Augenblicke, da ich mir aus Verzweiflung das Leben nehmen wollte, ein wunderschöner Jüngling mit einer Lilie in der Hand, gab mir einen Stein, mit welchem ich mich bestreichen sollte, und sagte mir, dies würde mich glücklich machen. Ich bestrich mich mit dem Stein und wurde zum Esel.«
»Erstaunlich!«sprach Rosine. »Mir erschien, da ich mir eben vor Herzeleid alle Haare aus dem Kopfe raufen wollte, eine wunderschöne Dame mit einer Rosenkrone auf der Stirne. Sie gab mir eine von diesen Rosen. >Stecke sie vor den Busen<, sagte sie, >so wirst du glücklicher werden, als du jemals gewesen bist.< Ich gehorchte ihr und wurde stracks in eine rosenfarbne Ziege verwandelt.«
»Wunderbar! Aber wie kam es, daß du wieder Rosine wurdest?« »Ich irrte beinahe einen ganzen Tag in Wäldern und Gebirgen herum, bis ich von ungefähr in diese Wildnis und an die Hütte der beiden Alten kam. Nicht weit davon, am Fußsteige, der nach der Quelle führt, erblickte ich einen großen Rosenstrauch. Da wandelte mich eine unwiderstehliche Begierde an, von diesen Rosen zu essen, und kaum hatte ich das erste Blatt hinabgeschluckt, so war ich, wie du mich hier siehest, aber nicht, was ich zuvor gewesen war.«
»Mir ging's gerade ebenso«, erwiderte Silvester. »Ich fand eine Lilie dort im Walde; mich kam eine unwiderstehliche Begierde an, sie zu
verschlingen, und da ward ich, was du siehest und was ich vorher nicht gewesen war. Es ist eine wunderbare Ähnlichkeit in unsrer Geschichte, liebe Rosine. Aber was warst du denn vorher, ehe du in eine Ziege verwandelt wurdest?«»Die unglücklichste Person von der Welt. Ein Betrüger, der sich durch die feinste Verstellung in meine Gunst eingeschlichen hatte, fand, ich weiß nicht wie, ein Mittel, sich in mein Schlafzimmer zu schleichen und machte sich mit allen meinen Juwelen aus dem Staube.
»Immer wunderbarer!« rief Silvester. »Ein andrer Betrüger spielte ungefähr die nämliche Geschichte mit mir; er machte mir weis, er besitze ein Geheimnis, mich zum reichsten Mann in der Welt zu machen; aber es war ein Mittel, mich um den Wert einiger Tonnen Goldes zu prellen und damit unsichtbar zu werden. Aber demnach müssen wir, wie es scheint, alle beide sehr vornehme Leute gewesen sein?«
»Du kannst mir's glauben oder nicht, aber ich war wirklich eine Königin.
»Desto besser, liebste Rosine!« rief Silvester. »So kannst du mich ohne Bedenken heiraten; denn ich selbst war auch nichts Geringeres als ein König.«
»Seltsam genug, wenn es dein Ernst ist! — Aber . . .«
»Wie, Rosine? Schon wieder ein Aber, da ich's mir am wenigsten versehen hätte?«
»Du kannst mich nicht heiraten, mein Gemahl ist noch am Leben.«
»Die Wahrheit zu sagen, ich fürchte, dies ist auch bei mir der Fall.«
»Du liebtest also deine Gemahlin nicht?«
»Sie war eine ganz hübsche Frau, wiewohl bei weitem nicht so hübsch wie du. Aber was willst du? Ich war ein König und in der Tat keiner von den besten. Ich liebte die Veränderung; meine Gemahlin war mir zu einförmig, zu zärtlich, zu tugendhaft und zu eifersüchtig. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr sie mir mit allen diesen Eigenschaften zur Last war.«
»So warst du ja um kein Haar besser als der König, dessen Gemahlin ich war, als ich noch die Königin Mabillje hieß!«
»Wie, Rosine, dein Gemahl war der König Mark von Cornwall?« fragte Silvester ungläubig.
»Nicht anders«, sagte Rosine.
»Und der schöne junge Ritter, der sich in dein Schlafzimmer schlich und dir deine Juwelen stahl, nannte sich Floribell von Nikomedien?«
»Himmel!« rief Rosine bestürzt. »Wie kannst du das alles wissen, wenn du nicht. . . «
»Mein Mann selber bist?« fiel ihr Silvester ins Wort, indem er ihr zugleich um den Hals fiel. »Das bin ich, liebste Rosine oder Mabillje, wenn du dich lieber so nennen hörst; und wenn du mir als Silvester nur halb so gut sein kannst, wie ich dir als Rosine bin, so haben der Jüngling mit dem Lilienstengel und die Dame mit der Rosenkrone ihr Wort treulich gehalten.«
»O wie gerne wollt ich nichts als Rosine für dich sein! Armer, armer Silvester«, sprach sie weinend, indem sie sich aus seinen Armen wand, »ich fürchte, ich bin deiner nicht mehr wert. Zwar mit meinem Willen geschah es nicht; aber der Bösewicht muß Zauberei gebraucht haben. Denn es überfiel mich ein natürlicher Schlaf leider gerade, da ich aller meiner Kräfte am nötigsten hatte, um mich von ihm loszumachen; und was kann ich anders besorgen, als daß er sich
»Über diesen Punkt kannst du ruhig sein«, sagte Silvester lachend; »dein Bösewicht war ein verkleidetes Mädchen, eine Tänzerin von Alexandrien, die sich mit dem Goldmacher Misfragmutosiris heimlich verbunden hatte, uns in Gesellschaft zu bestehlen. Ein glücklicher Zufall brachte mich, da ich noch ein Esel war, in die Höhle, wohin sie sich mit ihrer Beute flüchteten, und ich hörte alles aus ihrem eigenen Munde.«
»Wenn dies ist«, sprach Rosine, indem sie sich in seine Arme warf, »so bin ich das glücklichste Geschöpf, solange du Silvester bleibst . . .«
»Und ich der glücklichste aller Männer, wenn du nie aufhörst, Rosine zu sein.«
»Seid ihr das?«hörten sie zwei bekannte Stimmen sagen; und als sie sich umsahen, wie erschraken sie, den Greis mit dem eisgrauen Bart und das gute alte Mütterchen vor sich zu sehen!
Silvester wollte eben eine Entschuldigung vorbringen, aber bevor er noch zu Worte kommen konnte, verwandelte sich der Greis in den Jüngling mit dem Lilienstengel und das Mütterchen in die Dame mit der Rosenkrone. »Ihr seht«, sprach der schöne Jüngling, »diejenigen wieder, die es auf sich nahmen, euch glücklich zu machen, als ihr euch für die unglücklichsten aller Wesen hieltet, und ihr seht uns zum letzten Male. Noch steht es in eurer Willkür, ob ihr wieder werden wollt, was ihr vor eurer Verwandlung waret, oder ob ihr Silvester und Rosine bleiben wollt. Wählet!«
»Laßt uns bleiben, was wir sind«, riefen sie aus einem Munde, indem sie sich den himmlischen Wesen zu Füßen warfen; »der Himmel bewahre uns, einen andern Wunsch zu haben!«
»So haben wir unser Wort gehalten«, sprach die Dame, »und ihr habt in dieser Wildnis den Stein der Weisen gefunden!«
Mit diesen Worten verschwanden die beiden Geister, und Silvester und Rosine eilten beim lieblichen Scheine des Mondes Arm in Arm nach ihrer Hütte zurück.
Erschreckliche Geschichte vom Hühnchen und vom Hähnchen
Ein Hühnchen und ein Hähnchen sind miteinander in die Nußhekken gegangen, um Nüsse zu essen, und jedes Nüßchen, welches das Hähnchen fand, hat es mit dem Hühnchen geteilt, endlich hat das Hühnchen auch eine Nuß gefunden, und das Hähnchen hat sie ihm aufgepickt, aber das Hühnchen war neidisch und hat nicht teilen wollen und hat aus Neid den Nußkern ganz verschluckt, der ist ihm aber im Halse steckengeblieben und wollte nicht hinter sich und
nicht vor sich, da hat es geschrien: »Lauf zum Born und hol mir Wasser.«Hähnchen ist zum Born gelaufen: »Born, du sollst mir Wasser geben, Hühnchen liegt an jenem Berg Und schluckt an einem Nußkern.« Und da hat der Born gesprochen: »Erst sollst du zur Braut hinspringen Und mir klare Seide bringen.« Hähnchen ist zur Braut gesprungen: »Braut, du sollst mir Seide geben, Seide soll ich Brunnen bringen, Brunnen soll mir Wasser geben, Wasser soll ich Hühnchen bringen, Hühnchen liegt an jenem Berg Und schluckt an einem Nußkern«. Und da hat die Braut gesprochen: »Sollst mir erst mein Kränzlein langen, Blieb mir in den Weiden hangen.« Hähnchen ist zur Weide flogen, Hat das Kränzlein runterzogen: »Braut, ich tu dir's Kränzlein bringen, Sollst mir klare Seide geben, Seide soll ich Brunnen bringen, Brunnen soll mir Wasser geben, Wasser soll ich Hühnchen bringen, Hühnchen liegt an jenem Berg Und schluckt an einem Nußkern.« Braut gab für das Kränzlein Seide, Born gab für die Seide Wasser, Wasser bringt er zu dem Hühnchen, Aber Hühnchen war erstickt, Hat den Nußkern nicht verschlickt. |
Da war das Hähnchen sehr traurig und hat ein Wägelchen von Weiden geflochten, hat sechs Vögelchen davorgespannt und das Hühnchen daraufgelegt, um es zu Grabe zu fahren, und wie es so fortfuhr, da kam ein Fuchs:
»Wohin, Hähnchen?«
»Mein Hühnchen begraben.«
»Darf ich aufsitzen?«
»Sitz hinten auf den Wagen,
Vorne können's meine Pferdchen nicht vertragen.«
Da hat sich der Fuchs aufgesetzt, kam ein Wolf:
»Wohin, Hähnchen?«
Kam ein Löwe, kam ein Bär und andere Tiere, alle hinten drauf, endlich kam noch ein Floh:
»Wohin, Hähnchen?«
Aber der war zu schwer, der hat grade noch gefehlt, das ganze Wägelchen mit aller Bagage, mit Mann und Maus ist im Sumpfe versunken, da braucht er auch kein Grab. Das Hähnchen ist allein davongekommen, ist auf den Kirchturm geflogen, da steht es noch und dreht sich überall herum und paßt auf schön Wetter, daß der Sumpf austrocknet, dann will es wieder hin und will sehen, wie es seinen Leichenzug weiterbringt, wird aber wohl zu spät kommen, denn es ist allerlei Kraut und Gras drübergewachsen, Hühnerdarm und Hahnenfuß und Löwenzahn und Fuchsia und lauter solche Geschichten, wer sie nicht weiß, der muß sie erdichten.
Die Elfen
»Wo ist denn die Marie, unser Kind?«fragte der Vater. »Sie spielt draußen auf dem grünen Platze«, antwortete die Mutter, »mit dem Sohne unseres Nachbarn.«
»Daß sie sich nicht verlaufen«, sagte der Vater besorgt; »sie sind unbesonnen.« «
Die Mutter sah nach den Kleinen und brachte ihnen ihr Vesperbrot. »Es ist heiß«, sagte der Bursche, und das kleine Mädchen langte begierig nach den roten Kirschen. »Seid nur vorsichtig, Kinder«, sprach die Mutter, »lauft nicht zu weit vom Hause oder in den Wald hinein, ich und der Vater gehen aufs Feld hinaus.«Der junge Andres antwortete: »O, sei ohne Sorge, denn vor dem Walde fürchten wir uns, wir bleiben hier beim Hause sitzen, wo Menschen in der Nähe sind.«
Die Mutter ging und kam bald mit dem Vater wieder heraus. Sie verschlossen ihre Wohnung und wandten sich nach dem Felde, um nach den Knechten und zugleich auf der Wiese nach der Heuernte zu sehen. Ihr Haus lag auf einer kleinen, grünen Anhöhe, von einer zierlichen Stakete umgeben, welche auch ihren Frucht- und Blumengarten umschloß; das Dorf zog sich etwas tiefer hinunter, und jenseits erhob sich das gräfliche Schloß. Martin hatte von der Herrschaft das große Gut gepachtet und lebte mit seiner Frau und seinem einzigen Kinde vergnügt, denn er legte jährlich zurück und hatte die Aussicht, durch Tätigkeit ein vermögender Mann zu werden, da der Boden ergiebig war und der Graf ihn nicht drückte.
Indem er mit seiner Frau nach seinen Feldern ging, schaute er fröhlich um sich und sagte: »Wie ist doch die Gegend hier so ganz anders, Brigitte, als diejenige, in der wir sonst wohnten. Hier ist es so grün, das ganze Dorf prangt von dichtgedrängten Obstbäumen, der Boden ist voll schöner Kräuter und Blumen, alle Häuser sind munter und reinlich, die Einwohner wohihabend, ja mich dünkt, die Wälder sind hier schöner und der Himmel blauer, und so weit nur das Auge reicht, sieht man seine Lust und Freude an der freigebigen Natur.«
»Sowie man nur«, sagte Brigitte, »dort jenseits des Flusses ist, so befindet man sich wie auf einer andern Erde, alles so traurig und dürr; jeder Reisende behauptet aber auch, daß unser Dorf weit und breit in der Runde das schönste sei.«
»Bis auf jenen Tannengrund«, erwiderte der Mann; »schau einmal dorthin zurück, wie schwarz und traurig der abgelegene Fleck in der
ganzen heitern Umgebung liegt; hinter den dunkeln Tannenbäumen die rauchige Hütte, die verfallenen Ställe, der schwermütig vorüberfließende Bach.«»Es ist wahr«, sagte die Frau, indem beide stillstanden, »sooft man sich jenem Platze nur nähert, wird man traurig und beängstigt, man weiß selbst nicht, warum. Wer nur die Menschen eigentlich sein mögen, die dort wohnen, und warum sie sich doch nur so von allen in der Gemeinde entfernt halten, als wenn sie kein gutes Gewissen hätten?«
»Armes Gesindel«, erwiderte der junge Pächter, »dem Anschein nach Zigeunervolk, die in der Ferne rauben und betrügen und hier vielleicht ihren Schlupfwinkel haben. Mich wundert nur, daß die gnädige Herrschaft sie duldet.«
»Es können auch wohl«, sagte die Frau weichmütig, »arme Leute sein, die sich ihrer Armut schämen: denn man kann ihnen doch eben nichts Böses nachsagen, nur ist es bedenklich, daß sie sich nicht zur Kirche halten und man auch eigentlich nicht weiß, wovon sie leben, denn der kleine Garten, der noch dazu ganz wüst zu liegen scheint, kann sie unmöglich erhalten, und Felder haben sie nicht.«
»Weiß der liebe Gott«, fuhr Martin fort, indem sie weitergingen, »was sie treiben mögen; kommt doch auch kein Mensch zu ihnen, denn der Ort, wo sie wohnen, ist ja wie verbannt und verhext, so daß sich auch die vorwitzigsten Burschen nicht hingetrauen.«
Dieses Gespräch setzten sie fort, indem sie sich in das Feld wandten. Jene finstre Gegend, von welcher sie sprachen, lag abseits vom Dorfe. In einer Vertiefung, welche Tannen umgaben, zeigten sich eine Hütte und verschiedene fast zertrümmerte Wirtschaftsgebäude, nur selten sah man Rauch dort aufsteigen, noch seltener wurde man Menschen gewahr; zuweilen hatten Neugierige, die sich etwas näher gewagt, auf der Bank vor der Hütte einige abscheuliche Weiber in zerlumptem Anzuge wahrgenommen, auf deren Schoße ebenso häßliche und schmutzige Kinder sich wälzten; schwarze Hunde liefen vor dem Revier, in den Abendstunden ging wohl ein ungeheurer
Mann, den niemand kannte, über den Steg des Baches und verlor sich in die Hütte hinein; dann sah man in der Finsternis sich verschiedene Gestalten wie Schatten um ein ländliches Feuer bewegen. Dieser Grund, die Tannen und die verfallene Hütte machten wirklich in der heitern grünen Landschaft gegen die weißen Häuser des Dorfes und gegen das prächtige neue Schloß den sonderbarsten Eindruck.Die beiden Kinder hatten jetzt die Früchte verzehrt; sie verfielen darauf, um die Wette zu laufen, und die kleine behende Marie gewann dem langsamen Andres immer den Vorsprung ab. »So ist es keine Kunst!«rief dieser endlich aus; »aber laß es uns einmal in die Weite versuchen, dann wollen wir sehen, wer gewinnt!« — »Wie du willst«, sagte die Kleine, »nur nach dem Strome dürfen wir nicht laufen.« — »Nein«, erwiderte Andres, »aber dort auf jenem Hügel steht der große Birnbaum, eine Viertelstunde von hier, ich laufe hier links um den Tannengrund vorbei, du kannst rechts in das Feld hineinrennen, daß wir nicht eher als oben wieder zusammenkommen, so sehen wir dann, wer der Bessere ist.«
»Gut«, sagte Marie und fing schon an zu laufen, »so hindern wir uns auch nicht auf demselben Wege, und der Vater sagt ja, es sei zum Hügel hinauf gleich weit, ob man diesseits, ob man jenseits der Zigeunerwohnung geht.«
Andres war schon vorangesprungen, und Marie, die sich rechts wandte, sah ihn nicht mehr. Er ist eigentlich dumm, sagte sie zu sich selbst, denn ich dürfte nur den Mut fassen, über den Steg, bei der Hütte vorbei und drüben wieder über den Hof hinauszulaufen, so käme ich gewiß viel früher an. Schon stand sie vor dem Bache und dem Tannenhügel. Soll ich? Nein, es ist doch zu schrecklich, sagte sie sich. Ein kleines weißes Hündchen stand jenseits und bellte aus Leibeskräften. Im Erschrecken kam das Tier ihr wie ein Ungeheuer vor, und sie sprang zurück. »O weh!«sagte sie, »nun ist der Bengel weit voraus, weil ich hier steh und überlege.« Das Hündchen bellte immerfort, und da sie es genauer betrachtete, kam es ihr nicht mehr fürchterlich, sondern im Gegenteil ganz allerliebst vor: Es hatte ein
rotes Halsband um mit einer glänzenden Schelle, und sowie es den Kopf hob und sich im Bellen schüttelte, erklang die Schelle äußerst lieblich. »Ei, es will nur gewagt sein!« rief die kleine Marie. »Ich renne, was ich kann, und bin schnell, schnell jenseits wieder hinaus, sie können mich doch eben nicht gleich von der Erde weg auffressen!« Somit sprang das muntere, mutige Kind auf den Steg, rasch an dem kleinen Hund vorüber, der still war und sich an ihr schmeichelte, und nun stand sie im Grunde, und rundumher verdeckten die schwarzen Tannen die Aussicht nach ihrem elterlichen Hause und der übrigen Landschaft.Aber wie war sie verwundert! Der bunteste, fröhlichste Blumengarten umgab sie, in welchem Tulpen, Rosen und Lilien mit den herrlichsten Farben leuchteten, blaue und goldrote Schmetterlinge wiegten sich in den Blüten; in Käfigen aus glänzendem Draht hingen an den Spalieren vielfarbige Vögel, die herrliche Lieder sangen, und Kinder in weißen, kurzen Röckchen, mit gelockten, gelben Haaren und hellen Augen sprangen umher, einige spielten mit kleinen Lämmern, andere fütterten die Vögel, oder sie sammelten Blumen und schenkten sie einander, andere wieder aßen Kirschen, Weintrauben und rötliche Aprikosen.
Keine Hütte war zu sehn, aber wohl stand ein großes, schönes Haus mit eherner Tür und erhabenem Bildwerk leuchtend in der Mitte des Raumes. Marie war vor Erstaunen außer sich und wußte sich nicht zu finden; da sie aber nicht blöde war, ging sie gleich zum ersten Kinde, reichte ihm die Hand und bot ihm guten Tag. »Kommst du, uns auch einmal zu besuchen?« sagte das glänzende Kind; »ich habe dich draußen rennen und springen sehen, aber vor unserm Hündchen hast du dich gefürchtet.« — »So seid ihr wohl keine Zigeuner und Spitzbuben«, sagte Marie, »wie Andres immer spricht? O freilich ist der nur dumm und redet viel in den Tag hinein.« — »Bleib nur bei uns«, sagte die wunderbare Kleine, »es soll dir schon gefallen.« — »Aber wir laufen ja um die Wette.« — »Zu ihm kommst du noch früh genug zurück. Da, nimm und iß!« — Marie aß und fand
die Früchte so süß, wie sie noch keine geschmeckt hatte, und Andres, der Wettlauf und das Verbot ihrer Eltern waren gänzlich vergessen.Eine große Frau in glänzendem Kleide trat herzu und fragte nach dem fremden Kinde. »Schönste Dame«, sagte Marie, »von ungefähr bin ich hereingelaufen, und da wollen sie mich hierbehalten.« »Du weißt, Zerina«, sagte die Schöne, »daß es ihr nur kurze Zeit erlaubt ist, auch hättest du mich erst fragen sollen.« — »Ich dachte«, sagte das glänzende Kind, »weil sie doch schon über die Brücke gelassen war, könnt ich es tun; auch haben wir sie ja oft im Felde laufen sehn, und du hast dich selber über ihr muntres Wesen gefreut; wird sie uns doch früh genug verlassen müssen.«
»Nein, ich will hierbleiben«, sagte die Fremde, »denn hier ist es schön, auch finde ich hier das beste Spielzeug und dazu Erdbeeren und Kirschen, draußen ist es nicht so herrlich.«
Die goldbekleidete Frau entfernte sich lächelnd, und viele von den Kindern sprangen jetzt um die fröhliche Marie mit Lachen her, neckten sie und ermunterten sie zu Tänzen, andre brachten ihr Lämmer oder wunderbares Spielgerät, andre machten auf Instrumenten Musik und sangen dazu. Am liebsten aber hielt sie sich zu der Gespielin, die ihr zuerst entgegengegangen war, denn sie war die freundlichste und holdseligste von allen. Die kleine Marie rief einmal über das andere: »Ich will immer bei euch bleiben, und ihr sollt meine Schwestern sein«, worüber alle Kinder lachten und sie umarmten. »Jetzt wollen wir ein schönes Spiel machen«, sagte Zerina. Sie lief eilig in den Palast und kam mit einem goldenen Schächtelchen zurück, in welchem sich glänzender Samenstaub befand. Sie faßte ihn mit den kleinen Fingern und streute einige Körner auf den grünen Boden. Alsbald sah man das Gras wie in Wogen rauschen, und nach wenigen Augenblicken schlugen glänzende Rosengebüsche aus der Erde, wuchsen schnell empor und entfalteten sich plötzlich, indem der süßeste Wohlgeruch den Raum erfüllte. Auch Marie faßte von dem Staube, und als sie ihn ausgestreut hatte, tauchten weiße Lilien und die buntesten Nelken hervor. Auf einen Wink Zerinas
verschwanden die Blumen wieder, und andere erschienen an ihrer Stelle. »Jetzt«, sagte Zerina, »mache dich auf etwas Größeres gefaßt.« Sie legte zwei Pinienkörner in den Boden und stampfte sie heftig mit dem Fuße ein. Zwei grüne Sträucher standen vor ihnen. »Fasse dich fest mit mir«, sagte sie, und Marie schlang die Arme um den zarten Leib. Da fühlte sie sich emporgehoben, denn die Bäume wuchsen unter ihnen mit der größten Schnelligkeit; die hohen Pinien bewegten sich, und die beiden Kinder hielten sich hin und wieder schwebend in den roten Abendwolken umarmt und küßten sich; die andern Kleinen kletterten mit behender Geschicklichkeit an den Stämmen der Bäume auf und nieder und stießen und neckten sich, wenn sie sich begegneten, unter lautem Gelächter. Stürzte eins der Kinder im Gedränge hinunter, so flog es durch die Luft und senkte sich langsam und sicher zur Erde hinab. Endlich fürchtete sich Mane; die andere Kleine sang einige laute Töne, und die Bäume versenkten sich wieder ebenso allgemach in den Boden und setzten sie nieder, wie sie sich erst in die Wolken gehoben hatten.Sie gingen durch die erzene Tür des Palastes. Da saßen viele schöne Frauen umher, ältere und junge, im runden Saal, sie genossen die lieblichen Früchte, und eine herrliche, unsichtbare Musik erklang. In der Wölbung der Decke waren Palmen, Blumen und Laubwerk gemalt, zwischen denen Kinderfiguren in den anmutigsten Stellungen kletterten und schaukelten; nach den Tönen der Musik verwandelten sich die Bildnisse und glühten in den brennendsten Farben; bald war das Grüne und Blaue wie helles Licht funkelnd, dann sank die Farbe erblassend zurück, der Purpur flammte auf, und das Gold entzündete sich; dann schienen die nackten Kinder in den Blumengewinden zu leben und mit den rubinroten Lippen den Atem einzuziehn und auszuhauchen, so daß man wechselnd den Glanz der weißen Zähnchen wahrnahm sowie das Aufleuchten der himmelblauen Augen.
Aus dem Saale führten eherne Stufen in ein großes unterirdisches Gemach. Hier lag viel Gold und Silber, und Edelsteine von allen
Farben funkelten dazwischen. Wundersame Gefäße standen an den Wänden umher, alle schienen mit Kostbarkeiten angefüllt. Das Gold war in mannigfaltigen Gestalten gearbeitet und schimmerte mit der freundlichsten Röte. Viele kleine Zwerge waren beschäftigt, die Stücke auseinanderzusuchen und sie in die Gefäße zu legen; andre, höckrig und krummbeinig, mit langen, roten Nasen, trugen schwer und vornübergebückt Säcke herein, so wie die Müller Getreide, und schütteten die Goldkörner keuchend auf dem Boden aus. Dann sprangen sie ungeschickt rechts und links und griffen die rollenden Kugeln, die sich verlaufen wollten, und es geschah nicht selten, daß einer den andern im Eifer umstieß, so daß sie schwer und tölpisch zur Erde fielen.Sie machten verdrießliche Gesichter und sahen scheel, als Marie über ihre Gebärden und Häßlichkeit lachte. Hinten saß ein alter, eingeschrumpfter kleiner Mann, welchen Zerina ehrerbietig grüßte und der nur mit ernstem Kopfnicken dankte. Er hielt ein Zepter in der Hand und trug eine Krone auf dem Haupte, alle übrigen Zwerge schienen ihn für ihren Herrn anzuerkennen und seinen Winken zu gehorchen. »Was gibt's wieder?«fragte er mürrisch, als die Kinder ihm etwas näher kamen. Marie schwieg furchtsam, aber ihre Gespielin antwortete, daß sie nur gekommen seien, sich in den Kammern umzuschauen. »Immer die alten Kindereien!« sagte der Alte. »Wird der Müßiggang nie aufhören?«Darauf wandte er sich wieder an sein Geschäft und ließ die Goldstücke wägen und aussuchen; andre Zwerge schickte er fort, manchen schalt er zornig. »Wer ist der Herr?«fragte Marie. »Unser Metalifürst«, sagte die Kleine, indem sie weitergingen.
Sie schienen sich wieder im Freien zu befinden, denn sie standen an einem großen Teiche, aber doch schien keine Sonne, und sie sahen keinen Himmel über sich. Ein kleiner Nachen empfing sie, und Zerina ruderte sehr emsig. Die Fahrt ging schnell. Als sie in die Mitte des Teiches gekommen waren, sah Marie, daß tausend Röhren, Kanäle und Bäche sich aus dem kleinen See nach allen Richtungen verbreiteten.
»Diese Wasser rechts«, sagte das glänzende Kind, »fließen unter euren Garten hinab, davon blüht dort alles so frisch; von hier kommt man in den großen Strom hinunter.« Plötzlich kamen aus allen Kanälen und aus dem See unendlich viele Kinder auftauchend angeschwommen, viele trugen Kränze von Schilf und Wasserlilien, andre hielten rote Korallenzacken, und wieder andre bliesen auf krummen Muscheln; ein verworrenes Getöse schallte lustig von den dunklen Ufern wider; zwischen den Kleinen bewegten sich schwimmend die schönsten Frauen, und oft sprangen viele Kinder zu der einen oder der andern und hingen ihnen mit Küssen um Hals und Nacken.Alle begrüßten die Fremde; zwischen diesem Getümmel hindurch fuhren sie aus dem See in einen kleinen Fluß hinein, der immer enger und enger ward. Endlich stand der Nachen. Man nahm Abschied, und Zerina klopfte an den Felsen. Wie eine Tür tat sich dieser voneinander, und eine ganz rote weibliche Gestalt half ihnen aussteigen. »Geht es recht lustig zu?«fragte Zerina. — »Sie sind eben in Tätigkeit«, antwortete jene, »und so freudig, wie man sie nur sehn kann, aber die Wärme ist auch äußerst angenehm.«
Sie stiegen eine Wendeltreppe hinauf, und plötzlich sah sich Marie in dem glänzendsten Saal, so daß beim Eintreten ihre Augen vom hellen Lichte geblendet waren. Feuerrote Tapeten bedeckten mit Purpurglut die Wände, und als sich das Auge etwas gewöhnt hatte, sah sie zu ihrem Erstaunen, wie im Teppich sich Figuren tanzend auf und nieder in der größten Freude bewegten, die so lieblich gebaut und von so schönen Verhältnissen waren, daß man nichts Anmutigeres sehen konnte; ihr Körper war wie von rötlichem Kristall, so daß es schien, als flösse und spielte in ihnen sichtbar das bewegte Blut. Sie lachten das fremde Kind an und begrüßten es mit verschiedenen Beugungen; aber als Marie näher gehen wollte, hielt sie Zerina plötzlich mit Gewalt zurück und rief: »Du verbrennst dich, Mariechen, denn alles ist Feuer!«
Marie fühlte die Hitze. »Warum kommen nur«, sagte sie, »die allerliebsten
Kreaturen nicht zu uns herunter und spielen mit uns?« — »Wie du in der Luft lebst«, sagte jene, »so müssen sie immer im Feuer bleiben und würden hier draußen verschmachten. Sieh nur, wie ihnen wohl ist, wie sie lachen und kreischen: Jene dort unten verbreiten die Feuerflüsse von allen Seiten unter der Erde hin, davon wachsen nun die Blumen, die Früchte und der Wein; die roten Ströme gehn neben den Wasserbächen, und so sind die flammigen Wesen immer tätig und freudig. Aber dir ist es hier zu heiß, wir wollen wieder hinaus in den Garten gehen.«Hier hatte sich die Szene verwandelt. Der Mondschein lag auf allen Blumen, die Vögel waren still, und die Kinder schliefen in mannigfaltigen Gruppen in den grünen Lauben. Marie und ihre Freundin fühlten aber keine Müdigkeit, sondern lustwandelten in der warmen Sommernacht unter vielerlei Gesprächen bis zum Morgen. Als der Tag anbrach, erquickten sie sich an Früchten und Milch, und Marie sagte: »Laß uns doch zur Abwechslung einmal nach den Tannen hinausgehen, wie es dort aussehen mag.« —»Gern«, sagte Zerina, »so kannst du auch zugleich dort unsre Schildwachen besuchen, die dir gewiß gefallen werden, sie stehn oben auf dem Walle zwischen den Bäumen.« Sie gingen durch die Blumengärten, durch anmutige Haine voller Nachtigallen, dann stiegen sie über Rebenhügel und kamen endlich, nachdem sie lange den Windungen eines klaren Baches gefolgt waren, zu den Tannen und der Erhöhung, welche das Gebiet begrenzte. »Wie kommt es nur«, fragte Marie, »daß wir hier innerhalb so weit zu gehn haben, da doch draußen der Umkreis nur so klein ist?« — »Ich weiß nicht«, antwortete die Freundin, »wie es zugeht, aber es ist so.« Sie stiegen zu den finstern Tannen hinauf, und ein kalter Wind wehte ihnen entgegen; ein Nebel schien weit umher auf der Landschaft zu liegen. Oben standen wunderliche Gestalten mit mehligen, bestaubten Angesichtern, den widerlichen Häuptern der weißen Eulen nicht unähnlich; sie waren in faltigen Mänteln von zottiger Wolle gekleidet und hielten Regenschirme von seltsamen Häuten ausgespannt über sich; mit Fledermausflügeln,
die abenteuerlich neben dem Rockelor hervorstarrten, wehten und fächelten sie unablässig. »Ich möchte lachen, und mir graut«, sagte Marie. »Diese sind unsere guten, fleißigen Wächter«, sagte die kleine Gespielin, »sie stehen hier und wehen, damit jeden kalte Angst und wundersames Fürchten befällt, der sich uns nähern will; sie sind aber so bedeckt, weil es jetzt draußen regnet und friert, was sie nicht vertragen können. Hier unten kommt niemals Schnee und Wind noch kalte Luft her, hier ist ein ewiger Sommer und Frühling, doch wenn die da oben nicht oft abgelöst würden, so vergingen sie gar.«»Aber wer seid ihr denn«, fragte Marie, indem sie wieder in die Blumendüfte hinunterstiegen, »oder habt ihr keinen Namen, woran man euch erkennt?«
»Wir heißen Elfen«, sagte das freundliche Kind, »man spricht auch wohl in der Welt von uns, wie ich gehört habe.«
Sie hörten auf der Wiese ein großes Getümmel. »Der schöne Vogel ist angekommen!« riefen ihnen die Kinder entgegen; alles eilte in den Saal. Sie sahen indem schon, wie jung und alt sich über die Schwelle drängte, alle jauchzten, und von innen scholl eine jubilierende Musik heraus. Als sie eingetreten waren, sahen sie die große Rundung von den mannigfaltigsten Gestalten angefüllt, und alle schauten nach einem großen Vogel hinauf, der in der Kuppel mit glänzendem Gefieder langsam fliegend vielfache Kreise beschrieb. Die Musik klang fröhlicher als sonst, die Farben und Lichter wechselten schneller. Endlich schwieg die Musik, und der Vogel schwang sich rauschend auf eine glänzende Krone, die unter dem hohen Fenster schwebte, welches von oben die Wölbung erleuchtete. Sein Gefieder war purpurn und grün, durch welches sich die glänzendsten goldenen Streifen zogen, auf seinem Haupte bewegte sich ein Diadem von so hell leuchtenden kleinen Federn, daß sie wie Edelsteine blitzten. Der Schnabel war rot und die Beine glänzend blau. Wie er sich regte, schimmerten alle Farben durcheinander, und das Auge war entzückt. Seine Größe war die eines Adlers. Aber jetzt eröffnete er den leuchtenden Schnabel, und so süße Melodie quoll aus seiner
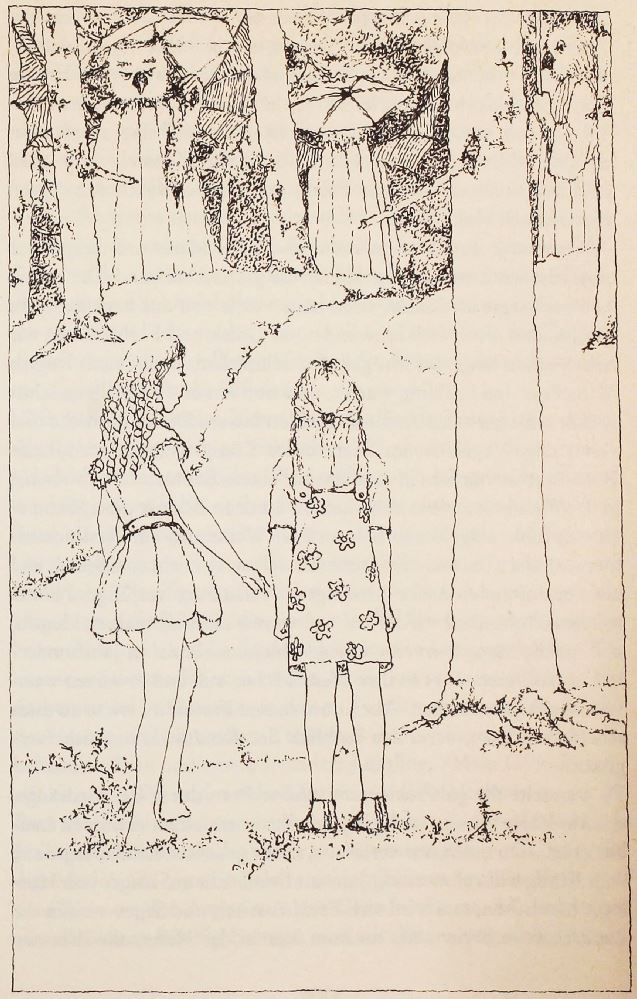
»Warum seid ihr alle so in Freude?«fragte Marie und neigte sich zum schönen Kinde, das ihr kleiner als gestern vorkam. »Der König kommt«, sagte die Kleine, »den haben viele von uns noch gar nicht gesehn, und wo er sich hinwendet, ist Glück und Fröhlichkeit; wir haben schon lange auf ihn gehofft, sehnlicher, als ihr nach langem Winter auf den Frühling wartet, und nun hat er durch diesen schönen Botschafter seine Ankunft melden lassen. Dieser herrliche und verständige Vogel, der im Dienste des Königs gesandt wird, heißt Phönix, er wohnt fern in Arabien auf einem Baume, der nur einmal in der Welt ist, sowie es auch keinen zweiten Phönix gibt. Wenn er sich alt fühlt, trägt er aus Balsam und Weihrauch ein Nest zusammen, zündet es an und verbrennt sich selbst, so stirbt er singend, und aus der duftenden Asche schwingt sich dann der verjüngte Phönix mit neuer Schönheit wieder auf. Selten nur nimmt er seinen Flug so, daß ihn die Menschen sehn, und geschieht es einmal in Jahrhunderten, so zeichnen sie es in ihre Denkbücher auf und erwarten wundervolle Begebenheiten. Aber nun, meine Freundin, wirst du auch scheiden müssen, denn der Anblick des Königs ist dir nicht vergönnt.«
Da wandelte die goldbekleidete schöne Frau durch das Gedränge, winkte Marie zu sich und ging mit ihr unter einen einsamen Laubengang. »Du mußt uns verlassen, mein geliebtes Kind«, sagte sie; »der König will auf zwanzig Jahr und vielleicht auf länger sein Hoflager hier halten, nun wird sich Fruchtbarkeit und Segen weit in die Landschaft verbreiten, am meisten hier in der Nähe; alle Brunnen
und Bäche werden ergiebiger, alle Äcker und Gärten reicher, der Wein edler, die Wiese fetter und der Wald frischer und grüner; mildere Luft weht, kein Hagel schadet, keine Überschwemmung droht. Nimm diesen Ring und gedenke unser, doch hüte dich, irgendwem von uns zu erzählen, sonst müssen wir diese Gegend fliehen, und alle umher sowie du selbst entbehren dann das Glück und die Segnung unsrer Nähe: Noch einmal küsse deine Gespielin und lebe wohl.« Sie traten heraus, Zerina weinte. Marie bückte sich, sie zu umarmen, sie trennten sich. Schon stand sie auf der schmalen Brücke, die kalte Luft wehte hinter ihr aus den Tannen, das Hündchen bellte auf das herzhafteste und ließ sein Glöckchen ertönen; sie sah zurück und eilte in das Freie, weil die Dunkelheit der Tannen, die Schwärze der verfallenen Hütten, die dämmernden Schatten sie mit ängstlicher Furcht befielen.»Wie werden sich meine Eltern meinethalben in dieser Nacht geängstigt haben!« sagte sie zu sich selbst, als sie auf dem Felde stand. »Und ich darf ihnen doch nicht erzählen, wo ich gewesen bin und was ich gesehen habe, auch würden sie mir nimmermehr glauben.« Zwei Männer gingen an ihr vorüber, die sie grüßten, und sie hörte hinter sich sagen: »Das ist ein schönes Mädchen! Wo mag sie nur her sein?« Mit engeren Schritten näherte sie sich dem elterlichen Hause, aber die Bäume, die gestern voller Früchte hingen, standen heute dürr und ohne Laub, das Haus war anders angestrichen und eine neue Scheune daneben erbaut. Marie war in Verwunderung und dachte, sie sei im Traume; in dieser Verwirrung öffnete sie die Tür des Hauses, und hinter dem Tische saß ihr Vater zwischen einer unbekannten Frau und einem fremden Jüngling. »Mein Gott, Vater!« rief sie aus. »Wo ist denn die Mutter?« — »Die Mutter?«sprach die Frau ahndend und stürzte hervor. »Ei, du bist doch wohl nicht -ja freilich, freilich bist du die verlorene, die totgeglaubte, die liebe, einzige Marie!«Sie hatte sie gleich an einem kleinen braunen Male unter dem Kinn, an den Augen und der Gestalt erkannt. Alle umarmten sie, alle waren freudig bewegt, und die Eltern vergossen Tränen.
Marie verwunderte sich, daß sie fast zum Vater hinaufreichte, sie begriff nicht, wie die Mutter so verändert und gealtert sein konnte, sie fragte nach dem Namen des jungen Menschen. »Es ist ja unsers Nachbars Andres«, sagte Martin, »wie kommst du nur nach sieben langen Jahren so unvermutet wieder? Wo bist du gewesen? Warum hast du denn gar nichts von dir hören lassen?« —»Sieben Jahr?«sagte Marie und konnte sich in ihren Vorstellungen und Erinnerungen nicht wieder zurechtfinden: »Sieben ganze Jahre?« —»Ja, ja«, sagte Andres lachend und schüttelte ihr treuherzig die Hand; »ich habe gewonnen, Mariechen, ich bin schon vor sieben Jahren an dem Birnbaum und wieder hierher zurück gewesen, und du Langsame kommst nun heut erst an!«Man fragte von neuem, man drang in sie, doch sie, des Verbotes eingedenk, konnte keine Antwort geben. Man legte ihr fast die Erzählung in den Mund, daß sie sich verirrt habe, auf einen vorbeifahrenden Wagen genommen und an einen fremden, fernen Ort gebracht sei, wo sie den Leuten den Wohnsitz ihrer Eltern nicht habe bezeichnen können; wie man sie nachher nach einer weit entlegenen Stadt gebracht habe, wo gute Menschen sie erzogen und geliebt; wie diese nun gestorben und sie sich endlich wieder auf ihre Geburtsgegend besonnen, eine Gelegenheit zur Reise ergriffen habe und so zurückgekehrt sei. »Laßt alles gut sein«, rief die Mutter; »genug, daß wir dich nun wiederhaben, mein Töchterchen, du meine Einzige, mein Alles!«
Andres blieb zum Abendbrot, und Marie konnte sich noch in nichts finden. Das Haus dünkte ihr klein und finster, sie verwunderte sich über ihre Tracht, die reinlich und einfach, aber ganz fremd erschien; sie betrachtete den Ring am Finger, dessen Gold wundersam glänzte und einen rot brennenden Stein künstlich einfaßte. Auf die Frage des Vaters antwortete sie, daß der Ring ebenfalls ein Geschenk ihrer Wohltäter sei.
Sie freute sich auf die Schlafenszeit und eilte zur Ruhe. Am andern Morgen fühlte sie sich besonnener, sie hatte ihre Vorstellungen mehr
geordnet und konnte den Leuten aus dem Dorfe, die alle sie zu begrüßen kamen, besser Rede und Antwort geben. Andres war schon mit dem frühesten wieder da und zeigte sich äußerst geschäftig, erfreut und dienstfertig. Das fünfzehnjährige aufgeblühte Mädchen hatte ihm einen tiefen Eindruck gemacht, und die Nacht war ihm ohne Schlaf vergangen. Die Herrschaft ließ Marien auf das Schloß fordern, sie mußte hier wieder ihre Geschichte erzählen, die ihr nun schon geläufig geworden war; der alte Herr und die gnädige Frau bewunderten ihre gute Erziehung, denn sie war bescheiden, ohne verlegen zu sein, sie antwortete höflich und in guten Redensarten auf alle vorgelegten Fragen; die Furcht vor den vornehmen Menschen und ihrer Umgebung hatte sich bei ihr verloren, denn wenn sie diese Säle und Gestalten mit den Wundern und der hohen Schönheit maß, die sie bei den Elfen im heimlichen Aufenthalt gesehen hatte, so erschien ihr dieser irdische Glanz nur dunkel, die Gegenwart der Menschen fast geringe. Die jungen Herren waren vorzüglich über ihre Schönheit entzückt.Es war im Februar. Die Bäume belaubten sich früher als je, so zeitig hatte sich die Nachtigall noch niemals eingestellt, der Frühling kam schöner in das Land, als ihn sich die ältesten Greise erinnern konnten. Allerorten taten sich Bächlein hervor und tränkten die Wiesen und Auen; die Hügel schienen zu wachsen, die Rebengelände erhoben sich höher, die Obstbäume blühten wie niemals, und ein schwellender, duftender Segen hing schwer in Blütenwolken über der Landschaft. Alles gedieh über Erwarten, kein rauher Tag, kein Sturm beschädigte die Frucht; der Wein quoll errötend in ungeheuern Trauben, und die Einwohner des Ortes staunten sich an und waren wie in einem süßen Traum befangen. Das folgende Jahr war ebenso, aber man war schon an das Wundersame mehr gewöhnt. Im Herbste gab Marie den dringenden Bitten des Andres und ihrer Eltern nach: Sie ward seine Braut und im Winter mit ihm verheiratet. Oft dachte sie mit inniger Sehnsucht an ihren Aufenthalt hinter den Tannenbäumen zurück; sie blieb still und ernst. So schön auch alles
war, was sie umgab, so kannte sie doch etwas noch Schöneres, wodurch eine leise Trauer ihr Wesen zu einer sanften Schwermut stimmte. Schmerzhaft traf es sie, wenn der Vater oder ihr Mann von den Zigeunern und Schelmen sprachen, die im finstern Grunde wohnten; oft wollte sie sie verteidigen, die sie als Wohltäter der Gegend kannte, vorzüglich gegen Andres, der eine Lust im eifrigen Schelten zu finden schien, aber sie zwang das Wort jedesmal in ihre Brust zurück. So verlebte sie das Jahr, und im folgenden ward sie durch eine junge Tochter erfreut, welche sie Elfriede nannte, indem sie dabei an den Namen der Elfen dachte.Die jungen Leute wohnten mit Martin und Brigitte in demselben Hause, welches geräumig genug war, und halfen den Eltern die ausgebreitete Wirtschaft führen. Die kleine Elfriede zeigte bald besondere Fähigkeiten und Anlagen, denn sie lief sehr früh und konnte alles sprechen, als sie noch kein Jahr alt war; nach einigen Jahren aber war sie so klug und sinnig und von so wunderbarer Schönheit, daß alle Menschen sie mit Erstaunen betrachteten und ihre Mutter sich nicht der Meinung erwehren konnte, sie sähe jenen glänzenden Kindern im Tannengrunde ähnlich. Elfriede hielt sich nicht gern zu andern Kindern, sondern vermied bis zur Ängstlichkeit ihre geräuschvollen Spiele und war am liebsten allein. Dann zog sie sich in eine Ecke des Gartens zurück und las oder arbeitete eifrig am kleinen Nähzeuge; oft sah man sie auch wie tief in sich versunken sitzen, oder daß sie in Gängen heftig auf und nieder ging und mit sich selber sprach. Die beiden Eltern ließen sie gewähren, weil sie gesund war und gedieh, nur machten sie die seltsamen, verständigen Antworten oder Bemerkungen oft besorgt. »So kluge Kinder«, sagte die Großmutter Brigitte vielmals, »werden nicht alt, sie sind zu gut für diese Welt, auch ist das Kind über die Natur schön und wird sich auf Erden nicht zurechtfinden können.«
Die Kleine hatte die Eigenheit, daß sie sich höchst ungern bedienen ließ, alles wollte sie selber machen. Sie war fast die früheste auf im Hause und wusch sich sorgfältig und kleidete sich selber an, ebenso
sorgsam war sie am Abende, sie achtete sehr darauf, Kleider und Wäsche selbst einzupacken und durchaus niemand, auch die Mutter nicht, über ihre Sachen kommen zulassen. Die Mutter sah ihr in diesem Eigensinn nach, weil sie sich nichts weiter dabei dachte, aber wie erstaunte sie, als sie sie an einem Feiertage zu einem Besuch auf dem Schlosse mit Gewalt umkleidete, so sehr sich auch die Kleine mit Geschrei und Tränen dagegen wehrte, und auf ihrer Brust, an einem Faden hangend, ein Goldstück von seltsamer Form antraf, welches sie sogleich für eines von jenen erkannte, deren sie so viele in dem unterirdischen Gewölbe gesehn hatte. Die Kleine war sehr erschrocken und gestand endlich, sie habe es im Garten gefunden, und da es ihr sehr wohlgefallen, habe sie es so emsig aufbewahrt; sie bat auch so dringend und herzlich, es ihr zu lassen, daß Marie es wieder auf derselben Stelle befestigte und voller Gedanken mit ihr stillschweigend zum Schlosse hinaufging.Seitwärts vom Hause der Pächterfamilie lagen einige Wirtschaftsgebäude zur Aufbewahrung der Früchte und des Feldgerätes, und hinter diesen befand sich ein Grasplatz mit einer alten Laube, die aber kein Mensch jetzt besuchte, weil sie nach der neuen Einrichtung der Gebäude zu entfernt vom Garten war. In dieser Einsamkeit hielt sich Elfriede am liebsten auf, und es fiel niemandem ein, sie hier zu stören, so daß die Eltern oft in halben Tagen ihrer nicht ansichtig wurden. An einem Nachmittage befand sich die Mutter in den Gebäuden, um aufzuräumen und eine verlorne Sache wiederzufinden, als sie wahrnahm, daß durch eine Ritze der Mauer ein Lichtstrahl in das Gemach falle. Es kam ihr der Gedanke, hindurchzusehen, um ihr Kind zu beobachten, und es fand sich, daß ein locker gewordener Stein sich von der Seite schieben ließ, wodurch sie den Blick gerade hinein in die Laube gewann. Elfriede saß drinnen auf einem Bänkchen und neben ihr die wohlbekannte Zerina, und beide Kinder spielten und ergötzten sich in holdseliger Eintracht. Die Elfe umarmte das schöne Kind und sagte traurig: »Ach, du liebes Wesen, so wie mit dir habe ich schon mit deiner Mutter gespielt, als sie klein
war und uns besuchte, aber ihr Menschen wachst zu bald auf und werdet so schnell groß und vernünftig; das ist recht betrüblich: Bliebest du doch so lange ein Kind wie ich!«»Gern tät ich dir den Gefallen«, sagte Elfriede, »aber sie meinen ja alle, ich würde bald zu Verstande kommen und gar nicht mehr spielen, denn ich hätte rechte Anlagen, altklug zu werden. Ach! Und dann seh ich dich auch nicht wieder, du liebes Zerinchen! Ja, es geht wie mit den Baumblüten: wie herrlich der blühende Apfelbaum mit seinen rötlichen aufgequollenen Knospen! Der Baum tut so groß und breit, und jedermann, der drunter weggeht, meint auch, es müsse recht was Besonderes werden; dann kommt die Sonne, die Blüte geht so leutselig auf, und da steckt schon der böse Kern drunter, der nachher den bunten Putz verdrängt und hinunterwirft; nun kann er sich, geängstigt und aufwachsend, nicht mehr helfen, er muß im Herbste zur Frucht werden. Wohl ist ein Apfel auch lieb und erfreulich, aber doch nichts gegen die Frühlingsblüte: So geht es mit uns Menschen auch; ich kann mich nicht darauf freuen, ein großes Mädchen zu werden. Ach, könnt ich euch doch nur einmal besuchen!«
»Seit der König bei uns wohnt«, sagte Zerina, »ist es ganz unmöglich, aber ich komme ja so oft zu dir, Liebchen, und keiner sieht mich, keiner weiß es, weder hier noch dort; ungesehn geh ich durch die Luft oder fliege als Vogel herüber; oh, wir wollen noch recht viel beisammen sein, solange du klein bist. Was kann ich dir nur zu Gefallen tun?«
»Recht lieb sollst du mich haben«, sagte Elfriede, »so lieb, wie ich dich in meinem Herzen trage; doch laß uns auch einmal wieder eine Rose machen.«
Zerina nahm das bekannte Schächtelchen aus dem Busen, warf zwei Körner hin, und plötzlich stand ein grünender Busch mit zwei hochroten Rosen vor ihnen, welche sich zueinander neigten und sich zu küssen schienen. Die Kinder brachen die Rosen lächelnd ab, und das Gebüsch war wieder verschwunden. »Oh, müßte es nur nicht wieder
so schnell sterben«, sagte Elfriede, »das rote Kind, das Wunder der Erde.« —»Gib!«sagte die kleine Elfe, hauchte dreimal die auf Rose an und küßte sie dreimal. »Nun«, sprach sie, indem sie die Rose zurückgab, »bleibt sie frisch und blühend bis zum Winter.« — »Ich will sie wie ein Bild von dir aufheben«, sagte Elfriede, »sie in meinem Kämmerchen wohl bewahren und sie morgens und abends küssen, als wenn du es wärst.« —»Die Sonne geht schon unter«, sagte jene, »ich muß jetzt nach Hause.«Sie umarmten sich noch einmal, dann war Zerina verschwunden.Am Abend nahm Marie ihr Kind mit einem Gefühl von Beängstigung und Ehrfurcht in die Arme; sie ließ dem holden Mädchen nun noch mehr Freiheit als sonst und beruhigte oft ihren Gatten, wenn er, um das Kind aufzusuchen, kam, was er seit einiger Zeit wohl tat, weil ihm ihre Zurückgezogenheit nicht gefiel und er fürchtete, sie könne darüber einfältig oder gar unklug werden. Die Mutter schlich öfter nach der Spalte der Mauer, und fast immer fand sie die kleine glänzende Elfe neben ihrem Kinde sitzen, mit Spielen beschäftigt oder in ernsthaften Gesprächen. »Möchtest du fliegen können?« fragte Zerina einmal ihre Freundin. — »Wie gerne!«rief Elfriede aus. Sogleich umfaßte die Fee die Sterbliche und schwebte mit ihr vom Boden empor, so daß sie zur Höhe der Laube stiegen. Die besorgte Mutter vergaß ihre Vorsicht und lehnte sich erschreckend mit dem Kopfe hinaus, um ihnen nachzusehen; da erhob aus der Luft Zerina den Finger und drohte lächelnd, ließ sich mit dem Kinde wieder nieder, herzte es und war verschwunden. Es geschah nachher noch öfter, daß Marie von dem wunderbaren Kind gesehen wurde, welches jedesmal mit dem Kopfe schüttelte oder drohte, aber mit freundlicher Gebärde.
Oftmals schon hatte bei vorgefallenem Streite Marie im Eifer zu ihrem Manne gesagt: »Du tust den armen Leuten in der Hütte Unrecht!« Wenn Andres dann in sie drang, ihm zu erklären, warum sie der Meinung aller Leute im Dorfe, ja der Herrschaft selber entgegen sei und es besser wissen wolle, brach sie ab und schwieg verlegen.
Heftiger als je ward Andres eines Tages nach Tische und behauptete, das Gesindel müsse als landesverderblich durchaus fortgeschafft werden; da rief sie im Unwillen aus: »Schweig, denn sie sind deine und unser aller Wohltäter!« —»Wohltäter«, fragte Andres erstaunt, »die Landstreicher?«In ihrem Zorn ließ sie sich verleiten, ihm unter dem Versprechen der tiefsten Verschwiegenheit die Geschichte ihrer Jugend zu erzählen, und da er bei jedem ihrer Worte ungläubiger wurde und verhöhnend den Kopf schüttelte, nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn in das Gemach, von wo er zu seinem Erstaunen die leuchtende Elfe mit seinem Kinde in der Laube spielen und es liebkosen sah. Er wußte kein Wort zu sagen; ein Ausruf der Verwunderung entfuhr ihm, und Zerina erhob den Blick. Sie wurde plötzlich bleich und zitterte heftig, nicht freundlich, sondern mit zorniger Miene machte sie die drohende Gebärde und sagte dann zu Elf rieden: »Du kannst nichts dafür, geliebtes Herz, aber sie werden niemals klug, so verständig sie sich auch dünken.« Sie umarmte die Kleine mit stürmender Eile und flog dann als Rabe mit heiserem Geschrei über den Garten hinweg den Tannenbäumen zu.
Am Abend war die Kleine sehr still und küßte weinend die Rose, Marien war ängstlich zu Sinne, Andres sprach wenig. Es wurde Nacht. Plötzlich rauschten die Bäume, Vögel flogen mit ängstlichem Geschrei umher, man hörte den Donner rollen, die Erde zitterte, und Klagetöne winselten in der Luft. Marie und Andres hatten nicht den Mut, aufzustehen; sie hüllten sich in die Decken und erwarteten mit Furcht und Zittern den Tag. Gegen Morgen ward es ruhiger, und alles war still, als die Sonne mit ihrem heitern Lichte über dem Walde hervordrang.
Andres kleidete sich an, und Marie bemerkte, daß der Stein des Ringes an ihrem Finger verblaßt war. Als sie die Tür öffneten, schien ihnen die Sonne klar entgegen, aber die Landschaft umher kannten sie kaum wieder. Die Frische des Waldes war verschwunden, die Hügel hatten sich gesenkt, die Bäche flossen matt mit wenigem Wasser, der Himmel schien grau, und als man den Blick nach den
Tannen hinüberwandte, standen sie nicht finstrer oder trauriger da als die übrigen Bäume; die Hütten hinter ihnen hatten nichts Abschreckendes, und mehrere Einwohner des Dorfes kamen und erzählten von der seltsamen Nacht und daß sie über den Hof gegangen seien, wo die Zigeuner gewohnt, die wohl fortgegangen sein mußten, weil die Hütten leerständen und im Innern ganz gewöhnlich wie die Wohnungen andrer armer Leute aussähen; einiges vom Hausrat wäre zurückgeblieben. Elfriede sprach zu ihrer Mutter heimlich: »Als ich in der Nacht nicht schlafen konnte und in der Angst bei dem Getümmel von Herzen betete, da öffnete sich plötzlich meine Tür, und herein trat meine Gespielin, um Abschied von mir zu nehmen. Sie hatte eine Reisetasche um, einen Hut auf ihrem Kopf und einen großen Wanderstab in der Hand. Sie war sehr böse auf dich, weil sie deinetwegen nun die größten und schmerzhaftesten Strafen aushalten müsse, da sie dich doch immer so geliebt habe; denn alle, so wie sie sagte, verließen nur sehr ungern diese Gegend.«Marie verbot ihr, davon zu sprechen, und indem kam auch der Fährmann vom Strome herüber, welcher Wunderdinge erzählte. Mit einbrechender Nacht war ein großer, fremder Mann zu ihm gekommen, welcher ihm bis zu Sonnenaufgang die Fähre abgemietet habe, doch mit der Bedingnis, daß er sich still zu Hause halten und schlafen, wenigstens nicht aus der Tür treten solle. »Ich fürchtete mich«, fuhr der Alte fort, »aber der seltsame Handel ließ mich nicht schlafen. Sacht schlich ich mich ans Fenster und schaute nach dem Strome. Große Wolken trieben unruhig durch den Himmel, und die fernen Wälder rauschten bange; es war, als wenn meine Hütte bebte und Klagen und Winseln um das Haus schlich. Da sah ich plötzlich ein weißströmendes Licht, das breiter und immer breiter wurde, wie viele tausend niedergefallene Sterne, funkelnd und wogend bewegte es sich von dem finstern Tannengrunde her, zog über das Feld und verbreitete sich nach dem Flusse hin. Da hörte ich ein Trappeln, ein Klirren, ein Flüstern und Säuseln näher und näher; es ging nach meiner Fähre hin, hinein stiegen alle, große und kleine leuchtende Gestalten,
Männer und Frauen, wie es schien, und Kinder, und der große fremde Mann fuhr sie alle hinüber; im Strome schwammen neben dem Fahrzeuge viele tausend helle Gebilde, in der Luft flatterten Lichter und weiße Nebel, und alles klagte und jammerte, daß sie so weit, weit reisen müßten, aus der geliebten, angewöhnten Gegend fort. Der Ruderschlag und das Wasser rauschten dazwischen, und dann war wieder plötzlich eine Stille. Oft stieß die Fähre an und kam zurück und ward von neuem beladen, auch viele schwere Gefäße nahmen sie mit, die gräßliche kleine Gesellen trugen und rollten; waren es Teufel, waren es Kobolde, ich weiß es nicht. Dann kam im wogenden Glanze ein stattlicher Zug. Ein Greis schien es, auf einem weißen kleinen Rosse, um den sich alles drängte, ich sah aber nur den Kopf des Pferdes, denn es war über und über mit kostbaren, glänzenden Decken verhangen; auf dem Haupte trug der Alte eine Krone, so daß ich dachte, als er hinübergefahren, die Sonne wolle von dorten aufgehen und das Morgenrot funkle mir entgegen. So währte es die ganze Nacht; ich schlief endlich in dem Gewirre ein, zum Teil in Freude, zum Teil in Schauder. Am Morgen war alles ruhig, aber der Fluß ist wie weggelaufen, so daß ich Not haben werde, mein Fahrzeug zu regieren.«Noch in demselben Jahre war ein Mißwachs, die Wälder starben ab, die Quellen vertrockneten, und dieselbe Gegend, die sonst die Freude jedes Durchreisenden gewesen war, stand im Herbst verödet, nackt und kahl und zeigte kaum hie und da noch ein Plätzchen, wo Gras mit fahlem Grün emporwuchs. Die Obstbäume gingen alle ein, die Weinberge verdarben, und der Anblick der Landschaft war so traurig, daß der Graf im folgenden Jahre mit seiner Familie das Schloß verließ, welches nachher verfiel und zur Ruine wurde.
Elfriede betrachtete Tag und Nacht mit der größten Sehnsucht ihre Rose und gedachte ihrer Gespielin, und so wie die Blume sich neigte und welkte, so senkte sie auch das Köpfchen und war schon vor dem Frühlinge verschmachtet. Marie stand oft auf dem Platze vor der Hütte und beweinte das entschwundene Glück. Sie verzehrte sich
wie ihr Kind und folgte ihm in einigen Jahren. Der alte Martin zog mit seinem Schwiegersohne nach der Gegend, in der er sonst gelebt hatte.
Goldener
Es sind wohl zweitausend Jahre oder noch länger, da hat in einem dichten Walde ein armer Hirt gelebt, der hatte sich ein bretternes Haus mitten im Wald erbaut, darin wohnte er mit seinem Weib und sechs Kindern; die waren alle Knaben. An dem Hause war ein Ziehbrunnen und ein Gärtlein, und wann der Vater das Vieh hütete, so gingen die Kinder hinaus und brachten ihm zu Mittag oder zu Abend einen kühlen Trunk aus dem Brunnen oder ein Gericht aus dem Gärtlein.
Den jüngsten der Knaben riefen die Eltern nur Goldener; denn seine Haare waren wie Gold, und obgleich der jüngste, so war er doch der stärkste von allen und der größte. So oft die Kinder hinausgingen, so ging Goldener mit einem Baumzweige voran, anders wollte keines gehen, denn jedes fürchtete sich, zuerst auf ein Abenteuer zu stoßen; ging aber Goldener voran, so folgten sie freudig eins hinter dem andern nach, durch das dunkelste Dickicht, und wenn auch schon der Mond über dem Gebirge stand.
Eines Abends ergötzten sich die Knaben auf dem Rückweg vom Vater mit Spielen im Walde, und hatte sich Goldener vor allen so sehr im Spiele ereifert, daß er so hell aussah, wie das Abendrot. »Laßt uns zurückgehen!«sprach der älteste. »Es scheint dunkel zu werden.« — »Seht da, der Mond!«sprach der zweite. Da kam es licht zwischen den dunklen Tannen hervor, und eine Frauengestalt wie der Mond setzte sich auf einen der moosigen Steine, spann mit einer kristallenen Spindel einen lichten Faden in die Nacht hinaus, nickte mit dem Haupte gegen Goldener und sang:
»Der weiße Fink, die goldene Ros,
Die Königskron im Meeresschoß.«
Sie hätte wohl noch weitergesungen, da brach ihr der Faden, und sie erlosch wie ein Licht. Nun war es ganz Nacht, die Kinder faßte das Grausen, sie sprangen mit kläglichem Geschrei das eine dahin, das andere dorthin, über Felsen und Klüfte, und verlor eins das andere.
Wohl viele Tage und Nächte irrte Goldener in dem dicken Wald umher, fand auch weder einen seiner Brüder noch die Hütte seines Vaters, noch sonst die Spur eines Menschen; denn es war der Wald gar dicht verwachsen, ein Berg über den andern gestellt und eine Kluft unter die andere. Die Braunbeeren, welche überall herum rankten, stillten seinen Hunger und löschten seinen Durst, sonst wär er gar jämmerlich gestorben. Endlich am dritten Tage, andere sagen gar erst am sechsten, wurde der Wald hell und immer heller, und da kam er zuletzt hinaus auf eine schöne grüne Wiese. Da war es ihm so leicht um das Herz, und er atmete mit vollen Zügen die freie Luft ein.
Auf derselben Wiese waren Garne ausgelegt, denn da wohnte ein Vogelsteller, der fing die Vögel, die aus dem Wald flogen, und trug sie in die Stadt zu Kaufe.
Solch ein Bursch ist mir gerade vonnöten, dachte der Vogelsteller, als er Goldener erblickte, der auf der grünen Wiese nah den Garnen stand und in den weiten blauen Himmel hineinsah und sich nicht satt sehen konnte. Der Vogelsteller wollte sich einen Spaß machen: Er zog seine Garne, und husch! war Goldener gefangen und lag unter dem Garne gar erstaunt, denn er wußte nicht, wie das geschehen war. »So fängt man die Vögel, die aus dem Walde kommen«, sprach der Vogelsteller, laut lachend; »deine roten Federn sind mir eben recht. Du bist wohl ein verschlagener Fuchs; bleibe bei mir, ich lehre dich auch die Vögel fangen.«
Goldener war gleich dabei; ihm dächte unter den Vögeln ein gar

»Laß erproben, was du gelernt hast«, sprach der Vogelsteller nach einigen Tagen zu ihm. Goldener zog die Garne, und bei dem ersten Zuge fing er einen schneeweißen Finken.
»Packe dich mit diesem weißen Finken«, schrie der Vogelsteller, »du hast es mit dem Bösen zu tun!«Und so stieß er ihn gar unsanft von der Wiese, indem er den weißen Finken, den ihm Goldener gereicht hatte, unter vielen Verwünschungen mit den Füßen zertrat.
Goldener konnte die Worte des Vogelstellers nicht begreifen; er ging getrost wieder in den Wald zurück und nahm sich noch einmal vor, die Hütte seines Vaters zu suchen. Er lief Tag und Nacht über Felsensteine und alte gefallene Baumstämme, fiel auch gar oft über die schwarzen Wurzeln, die aus dem Boden überall hervorragten.
Am dritten Tage aber wurde der Wald heller und immer heller, und da kam er endlich hinaus und in einen schönen lichten Garten, der war voll der lieblichsten Blumen, und weil Goldener so was noch nie gesehen, blieb er voll Verwunderung stehen. Der Gärtner im Garten bemerkte ihn nicht so bald, denn Goldener stand unter den Sonnenblumen, und seine Haare glänzten im Sonnenschein nicht anders als so eine Blume.
»Ha!«sprach der Gärtner. »Solch einen Burschen hab ich gerade vonnöten«, und schloß das Tor des Gartens. Goldener ließ es sich gefallen, denn ihm däuchte unter den Blumen ein gar buntes Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters wiederzufinden.
»Fort in den Wald«, sprach der Gärtner eines Morgens zu Goldener, »hol mir einen wilden Rosenstock, damit ich zahme Rosen darauf pflanze!« Goldener ging und kam mit einem Stock der schönsten goldfarbenen Rosen zurück, die waren auch nicht anders, als habe der geschickteste Goldschmied sie für die Tafel eines Königs geschmiedet.
»Packe dich mit diesen goldenen Rosen!« schrie der Gärtner. »Du
hast es mit dem Bösen zu tun!«Und so stieß er ihn gar unsanft aus dem Garten, indem er die goldenen Rosen unter vielen Verwünschungen in die Erde trat.Goldener konnte die Worte des Gärtners nicht begreifen; er ging getrost wieder in den Wald zurück und nahm sich nochmals vor, die Hütte des Vaters zu suchen.
Er lief Tag und Nacht von Baum zu Baum, von Fels zu Fels. Am dritten Tage endlich wurde der Wald hell und immer heller, und da kam Goldener hinaus und an das blaue Meer, das lag in einer unermeßlichen Weite vor ihm. Die Sonne spiegelte sich eben in der kristallhellen Fläche, da war es wie fließendes Gold, darauf schwammen schöngeschmückte Schiffe mit langen, fliegenden Wimpeln. Eine zierliche Fischerbarke stand am Ufer, in die trat Goldener und sah mit Erstaunen in die Helle hinaus.
»Ein solcher Bursch ist uns gerade vonnöten«, sprachen die Fischer, und husch! stießen sie vom Lande. Goldener ließ es sich gefallen, denn ihm däuchte bei den Wellen ein goldenes Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, seines Vaters Hütte wiederzufinden.
Die Fischer warfen ihre Netze aus und fingen nichts. »Laß sehen, ob du glücklicher bist!«sprach ein alter Fischer mit silbernen Haaren zu Goldener. Mit ungeschickten Händen senkte Goldener das Netz in die Tiefe, zog und fischte eine Krone von hellem Golde.
»Triumph«, rief der alte Fischer und fiel Goldener zu Füßen, »ich begrüße dich als unsern König! Vor hundert Jahren versenkte der alte König, welcher keinen Erben hatte, sterbend seine Krone im Meer, und so lange, bis irgendeinen Glücklichen das Schicksal bestimmt hätte, die Krone aus der Tiefe zu ziehen, sollte der Thron ohne Nachfolger in Trauer gehüllt bleiben.« — »Heil unserm König!« riefen die Fischer und setzten Goldenern die Krone auf. Die Kunde von Goldener und der wiedergefundenen Königskrone erscholl gar bald von Schiff zu Schiff und über das Meer weit in das Land hinein. Da war die goldene Fläche bald mit bunten Nachen bedeckt
und mit Schiffen, die mit Blumen und Laubwerk geziert waren, diese begrüßten alle mit lautem Jubel das Schiff, auf dem König Goldener stand. Er stand, die helle Krone auf dem Haupte, am Vorderteil des Schiffes und sah ruhig der Sonne zu, wie sie im Meere erlosch.
MÄRCHEN
VON ERNST MORITZ ARNDT
Geschichte von den sieben bunten Mäusen
Vor langer, langer Zeit wohnte in Pudmin*ein Bauer, der hatte eine schöne und fromme Frau, die fleißig betete und alle Sonntage und Festtage zur Kirche ging, auch den Armen, die vor ihre Türe kamen, gern gab. Es war überhaupt eine freundliche und mitleidige Seele und im ganzen Dorfe und Kirchspiele von allen Leuten geliebt. Nie hat man ein hartes Wort von ihr gehört, noch ist ein Fluch und Schwur oder andere Ungebühr je aus ihrem Munde gegangen. Diese Frau hatte sieben Kinder, lauter kleine Dirnen, von welchen die älteste zwölf und die jüngste zwei Jahre alt war: hübsche, lustige Dingelchen. Diese gingen alle übereins gekleidet mit bunten Röckchen und bunten Schürzen und roten Mützchen; Schuhe aber und Strümpfe hatten sie nicht an, denn das hätte zuviel gekostet, sondern gingen barfuß.
Die Mutter hielt sie nett und reinlich, wusch und kämmte sie morgens früh und abends spät, wann sie aufstanden und zu Bett gingen, lehrte sie lesen und singen und erzog sie in aller Freundlichkeit und Gottesfurcht. Wann sie auf dem Felde was zu tun hatte oder weit ausgehen mußte, stellte sie die älteste, welche Barbara hieß, über die anderen; diese mußte auf sie sehen, ihnen was erzählen, auch wohl etwas vorlesen. Nun begab es sich einmal, daß ein hoher Festtag war —ich glaube, es war der Karfreitag -da ging die Bauerfrau mit ihrem Manne zur Kirche und sagte den Kindern, sie sollten hübsch artig
Die meisten Kinder sprangen nun alsbald auf und guckten danach, und auch Barbara, die älteste, stand auf und guckte mit. Und die Kinder flüsterten und sprachen dies und das über den schönen Beutel und was wohl darin sein möchte. Und es gelüstete sie so sehr, es zu wissen, und da riß eines den Beutel von dem Nagel, und Barbara öffnete die Schnur, womit er zugebunden war, und es fielen Äpfel und Nüsse heraus. Und als die Kinder die Äpfel und Nüsse auf dem Boden hinrollen sahen, vergaßen sie alles, und daß es Festtag war und was die Mutter ihnen befohlen und aufgegeben hatte; sie setzten sich hin und schmausten Äpfel und knackten Nüsse und aßen alles rein auf. Als nun Vater und Mutter um den Mittag aus der Kirche nach Hause kamen, sah die Mutter die Nußschalen auf dem Boden liegen, und sie schaute nach dem Beutel und fand ihn nicht. Da erzürnte sie sich und ward böse zum ersten Male in ihrem Leben und schalt die Kinder sehr und rief: »Der Blitz! Ich wollte, daß ihr Mäusemärten*alle zu Mäusen würdet!« Der Schwur war aber eine große Sünde, besonders weil es ein so heiliger und hoher Festtag war; sonst hätte Gott es der Bäuerin wohl vergeben, weil sie doch so fromm und gottesfürchtig war. Kaum hatte die Frau das schlimme Wort aus ihrem Munde gehen lassen, so waren alle die sieben niedlichen Kinderchen weg, als hätte ein Wind sie weggeblasen,
Die sieben bunten Mäuse aber liefen den Weg entlang aus dem Dorfe heraus, immer spornstreichs; und so liefen sie über das Pudminer Feld und das Günzer Feld und das Schoritzer Feld und durch die Krewe*und die Dumsewitzer Koppel. Und die Mutter lief ihnen außer Atem nach und konnte weder schreien noch weinen und wußte nicht mehr, was sie tat. So liefen die Mäuse über das Dumsewitzer Feld hin und in einen kleinen Busch hinein, wo einige hohe Eichen standen und in der Mitte ein spiegelheller Teich war. Und der Busch steht noch da mit seinen Eichen und heißt der Mäusewinkel. Und als sie in den Busch kamen und an den Teich im Busche, da standen sie alle sieben still und guckten sich um, und die Bauerfrau stand dicht bei ihnen. Es war aber, als wenn sie ihr Adje sagen wollten. Denn als sie die Frau so ein Weilchen angeguckt hatten, plumps! und alle sieben sprangen zugleich ins Wasser und schwammen nicht, sondern gingen gleich unter in die Tiefe. Es war aber der helle Mittag, als dies geschah. Und die Mutter blieb stehen, wo sie stand, und rührte keine Hand und keinen Fuß mehr, sie war auch kein Mensch mehr. Sie ward stracks zu einem Stein, und der Stein liegt noch da, wo sie stand und die Mäuslein verschwinden sah; und das ist dieser große runde Stein, an welchem wir sitzen. Und nun höre mal, was nach diesem geschehen ist und noch alle Nacht geschieht! Glocke zwölf, wann alles schläft und still ist und die Geister
Herut! Herut! Du junge Brut! Din Brüdegam schall kamen; Se hebben di Doch gar to früh Din junges Leben namen. |
Sitte de recht up'n Steen, Watt he Fleesch un Been, Und wi gan mit dem Kranze: Säven Junggesell'n Uns führen schäl'n Juchhe! To'm Hochtidsdanze. |
Und nun will ich dir sagen von dem Gesange, was er bedeutet. Die Mäuse tanzen nun wohl schon tausend Jahre und länger um den Stein, wann es die Mitternacht ist, und der Stein liegt ebensolange. Es geht aber die Sage, daß sie einmal wieder verwandelt werden sollen, und das kann durch Gottes Gnade nur auf folgende Weise geschehen:
Es muß eine Frau sein, gerade so alt, als die Bäuerin war, da sie aus
Erdwürmchen
In Diestelfeld im Fichtelgebirge lebte ein ehrlicher Bauersmann, Kunz Bartold genannt, der hatte eine Frau, die hieß Kathrine Hüllmanns und war eine recht christliche und fromme Frau. Diese guten Leute hatten viele liebe Kinder, aber das liebste von allen war ihnen ein kleines Mädchen, das in der Taufe den Namen Eva Maria empfangen hatte. Denn die kleine Eva war ein gar frommes, stilles und sinniges Kind, das fleißigste in der Schule und das andächtigste in der Kirche und gut und freundlich und gehorsam gegen alle Menschen; besonders gab es den Armen gern und bat die Mutter immer, wenn sie etwas auszuteilen hatte, daß sie ihr die Spende überließe.
Sonst war das Kind bei aller seiner Freundlichkeit sehr in sich gekehrt und von stiller, verschwiegener Natur, sprach nicht viel, war gern allein und liebte sehr die Einsamkeit im Garten, im Felde und in den grünen Wäldern.Der liebe Gott, der jedem Menschen so seine eigenen Anlagen und Triebe mitgibt auf die Welt, hatte diesem Kinde eine große Liebe für die Natur und ein leichtes und helles Verständnis der Dinge mitgegeben, so daß sie, was kluge Leute kaum halb aussprachen und nur so leicht hinwinkten, schon begriff und vieles verstand und im Spielen lernte, was ihr kein Mensch erklärt noch gelehrt hatte. Die Leute pflegen sich über solch helle Kinder zu wundern; einige nennen sie Sonntagskinder, weil sie alles sehen und verstehen können; andere, schlimmer, meinen wohl gar, es gehe nicht mit rechten Dingen zu bei ihnen. Und ist doch alles natürlich und kommt von Gott her, daß die einen viel wissen und leicht lernen und die andern dumm sind und nichts lernen. Die kleine Eva kannte, als sie zehn Jahre alt war, schon die meisten Tiere, Vögel, Blumen und Bäume und ging mit ihnen so unschuldig und vertraut und sicher um, als hätte sie schon ein paar hundert Jahre mit ihnen gelebt. Aber fast ein noch größeres Wohlgefallen als an diesen hatte sie an bunten Steinen und Gewürmen und konnte sich gewaltig freuen, wenn sie ein buntes Steinchen fand, und mit Marienwürmchen, Goldkäfern, Gottespferdchen, Schmetterlingen und Laubfröschen konnte sie oft tagelang spielen, ohne daß ihr die Zeit dabei lang ward. Sie ging nun ins elfte Jahr und mußte ihrer Mutter Kühe im Walde hüten.
Da sammelte sie sich immer eine Menge buntes Geflügel und Gestein, und wann sie des Abends heimkam, hatte sie die Taschen gewöhnlich voll Steine und Schächtelchen und Binsenkörbchen, die sie sich selbst flocht, voll Käfer, Schmetterlinge und Laubfrösche, mit welchen sie und die andern Kinder dann spielten. Wegen dieser Liebe zu den bunten Steinchen und Käferchen wühlte sie viel in der Erde, wälzte Steine und Holzblöcke um, riß die Rinde von den Bäumen, und die Leute, die das sahen, und die eigenen Eltern nannten
die kleine Eva deswegen im Scherz Erdwurm. Aus diesem Scherz ward aber ein solcher Ernst, daß sie künftig nicht mehr Eva, sondern Erdwurm bei allen Leuten hieß.Nun begab es sich einmal, als Erdwürmchen im Frühlinge ihres zwölften Jahres ihre Kühe und Kälber in den Wald trieb und mit ihrem Hündchen hinterdreintrabend ein Liedlein sang, daß ihr eine alte Frau begegnete, die fast nackt war und gar bleich und elend aussah. Diese jammerte über Kälte, und es war der Monat April, und da ist es in den Waldbergen oft noch recht kalt. Das konnte Erdwürmchen nicht lange anhören; sie mußte ihr Röckchen ausziehen und es der alten Frau umhängen, welche wegging und ihr zurief: »Schönen Dank, mein Kind! Das soll dir nicht unvergolten bleiben.« Erdwürmchen ging nun den ganzen Tag im bloßen Hemde und fror selbst sehr und ward obendrein des Abends von der Mutter tüchtig ausgescholten, daß sie mehr weggegeben hatte, als sie durfte; denn die Mutter war auch nicht so reich, daß sie ihren Kindern immer neue Kleider zumessen lassen konnte. Als nun die Sonnengicht gekommen und die Tage am längsten waren, da hatte sich Erdwürmchen einmal im Walde gebadet. Als sie nun aus dem Bache stieg und hinter einem Dornbusch, wo sie sich entkleidet hatte, ihre Kleider suchte, fand sie statt deren, welche sie suchte, die allernettesten neuen Kleider, als wären sie eben vom Schneider gekommen, und ein blankes Mützchen und ein Paar neue Schuh. Dies letzte verwunderte sie am meisten, denn im Sommer trugen sie und ihre Geschwister keine Schuh, sondern mußten barfuß laufen. Sie zog aber alles an und probierte auch die Schuhe an und freute sich recht kindisch, und in der Freude rief sie aus: »O wer mag mir das wohl geschenkt haben?«
»Das hab ich getan«, schallte es hinter den Büschen, und bald sah sie eine alte Frau kommen, dieselbe, der sie im Frühlinge ihr Röckchen gegeben hatte, und die alte Frau trat freundlich vor sie und fragte sie: »Erdwürmchen, kennst du mich nicht mehr?« Und Erdwürmchen sprach: »Jawohl, du bist ja die arme alte Frau, die hier
im Frühlinge so fror und in zerrissenen Kleidern ging, und nun hast du so schöne Kleider an!« —»Ja, so geht's, mein Kind«, sagte die alte Frau; »heute reich und morgen arm. Ich habe dir dafür, daß du ein so barmherziges Kind warst, die neuen Kleider gebracht, und wenn du noch etwas wünschest, so sage es, ich will dir's gewähren.«Und Erdwürmchen bedachte sich nicht lange und sprach: »O laß den schönen, großen, blanken Käfer alle Tage zu mir kommen und mit mir spielen, den ich hier nur einmal im Walde gesehen habe; haschen habe ich ihn aber nicht können!« —»Das glaub ich wohl, denn er ist ein verzweifelt kluger Gast«, sagte die alte Frau; »er soll kommen. Und nun adjes, mein Kind!«Und die alte Frau küßte sie, nahm ihren Stock und ging weg.Und als sie kaum weg war, säuselte es summ, summ, summ durch die Bäume, und ein großer, glänzender Käfer kam geflogen und setzte sich neben Erdwürmchen hin, und seine Flügeldecken sahen aus wie lauteres Gold, und seine zwei hellen Augen funkelten wie Diamanten. Erdwürmchen hatte seine herzinnige Freude an dem Käfer und spielte den ganzen Tag mit ihm; und als sie ihre Herde nach Hause trieb, da nahm er auch seine Flügel und flog weg. Und auf dieselbe Weise, wie er heute getan, kam er jeden Tag, sooft sie im Walde war, und flog immer auch weg, wann sie wegging. Und Erdwürmchen spielte und flüsterte mit ihm, als wäre es ein Mensch; sie erzählte auch den andern Hirten, die sie zuweilen mit dem Käfer trafen, er sei ihr kleiner Waldbräutigam und verstehe alles, was sie ihm sage; er bringe ihr auch schöne und blanke Sachen zum Spielen und Äpfel und Nüsse, wann sie hungere. Die andern Kinder hörten das so an und lachten und glaubten es nicht; aber den goldenen Käfer mochten sie gern leiden. Ich weiß auch nicht, ob das wahr war, oder ob Erdwürmchen den Kindern zum Scherze solche Fabeln erzählte; aber das ist gewiß, daß die beiden sehr viel voneinander hielten und daß der Käfer den andern Frühling wiederkam, sobald Erdwürmchen ihre Kühe in den Wald trieb, und daß sie in der alten Freundschaft miteinander lebten und umgingen. Da lernte Erdwürmchen
nun auch, daß es ein ganz seltener Käfer war und mehr konnte, als andere gemeine Käfer können.Einst saß sie nach ihrer Gewohnheit mit ihm unter einer grünen Eiche und spielte mit ihm und mit andern bunten Würmchen und Käferchen im Grase. Da flog ihr eines der schönsten und buntesten Marienwürmchen auf und schwang seine kleinen Flügel, und in einem Hui war es über die Eiche hinaus. Und Erdwürmchen sah ihm sehnsüchtig nach und rief: »O wer doch auch so fliegen könnte und sich in der leichten Luft über die Bäume hinwiegen!« Und Goldkäferchen, der diese Worte hörte, flüsterte ihr leise zu: »Erdwürmchen, möchtest du das?«Und sie sagte: »Ja, für mein Leben gern!« Und es währte nicht eine Sekunde, so kam der allerniedlichste Wagen aus der Luft herunter und senkte sich vor Erdwürmchen zur Erde herab, als spräche er: »Erdwürmchen, willst du, so steige ein!« Das Wägelchen war von dem allerweißesten Elfenbein leicht und sauber gearbeitet, und es waren viele tausend niedliche und bunte Vögelein drein geschnitzelt und darauf gemalt. Es war groß genug, daß ein kleines Mädchen bequem darin sitzen konnte, und ward von sechs himmelblauen Gottespferdchen gezogen.
Erdwürmchen stand vor dem zierlichen Wägelchen und verwunderte sich und schlug in die Hände, daß es so schön war. Goldkäferchen machte sich hinzu und sagte: »Nun steige ein, Erdwürmchen, und kutschiere dich durch die Luft, wenn du Lust hast!«Erdwürmchen stand da, zitternd und bebend vor Freude, Furcht und Verlangen; doch mußte sie laut lachen, als Goldkäferchen diese letzten Worte sprach, und sagte: »Was soll ich einsteigen? Die kleinen magern Rappen werden mich wohl weit ziehen!« —»Steig du nur ein«, sprach Goldkäferchen wieder, »ich will der Kutscher sein.«Und mit diesen Worten schwang er sich auf den Bock. Da lachte Erdwürmchen wieder und setzte sich ein, zum Spaße, meinte sie, denn dies Gespann würde sie doch nicht von der Erde aufziehen.
Aber siehe! Goldkäferchen faßte die Zügel, nahm das goldene Peitschchen, aus feinsten Sonnenstrahlen geflochten, und klatschte,
daß es durch den Wald klang; und die sechs geflügelten Rappen zogen an, und hui! ging es in die Höhe und über die höchsten Buchen und Eichen fort, daß es sauste. Erdwürmchen hatte gar nicht geglaubt, daß es Ernst sei; auch hatte sie ihren Wunsch, einmal so durch die Lüfte zu fliegen, nur so leicht hingesagt, wie Menschen, wenn sie Vögel oder Schmetterlinge sich in den Lüften wiegen sehen, wohl sprechen: >O wer doch auch einmal so fliegen und durch die leichten Lüfte segeln dürfte!< Nun hätte sie gern >Halt! Halt!< geschrien, aber sie hatte keine Zeit dazu; denn es ging gar zu geschwind, und sie hatte genug zu tun, sich an der Lehne des Wagens festzuhalten, damit sie in der Angst nicht herausflöge. Als sie aber zuletzt sah, daß keine Gefahr dabei war, da ließ sie sich die Fahrt gefallen, die immer über den Wald hin ging, wohl zwei Meilen weit und dann wieder zurück. Und als das Wägelchen hingekommen ist, wo ihre Kühe und Kälber weideten, hat Goldkäferchen ihn sanft abwärts gelenkt, und so sind sie auf derselben Stelle wieder niedergekommen, wo sie aufgefahren waren.Diese Fahrten hat Erdwürmchen oft gemacht und sich inniglich ergötzt, daß sie in dem elfenbeinernen Wagen mit dem leichten Gespann der Gottespferde geschwinder als die geschwindesten Vögel fliegen konnte, so daß sie da oben oft Tauben und Falken und andere Schnellflieger gegriffen hat. Sie ist auch zuweilen des Nachts ausgefahren, wann Goldkäferchen, ihr Kutscher, sie zu solcher Spazierfahrt einlud; sie hat sich dann leise und heimlich aus dem Bette geschlichen, wenn die andern im Hause alle schliefen, und diese Fahrten beim Mond- und Sternenschein deuchten ihr die allerlustigsten. Aber nie hat sie der Mutter etwas davon merken lassen; nur das hat sie erzählt, daß die alte Frau ihr die schönsten Kleider geschenkt hat für das Röckchen, das sie ihr im Frühling gegeben.
Erdwürmchen war nun fünfzehn Jahre alt und begann ein großes Mädchen zu werden; sie hütete aber noch immer das Vieh im Walde. Auch sammelte sie, wenn Goldkäferchen gerade nicht bei ihr war - er kam schon viel seltener -, die andern Knaben und Mädchen, die
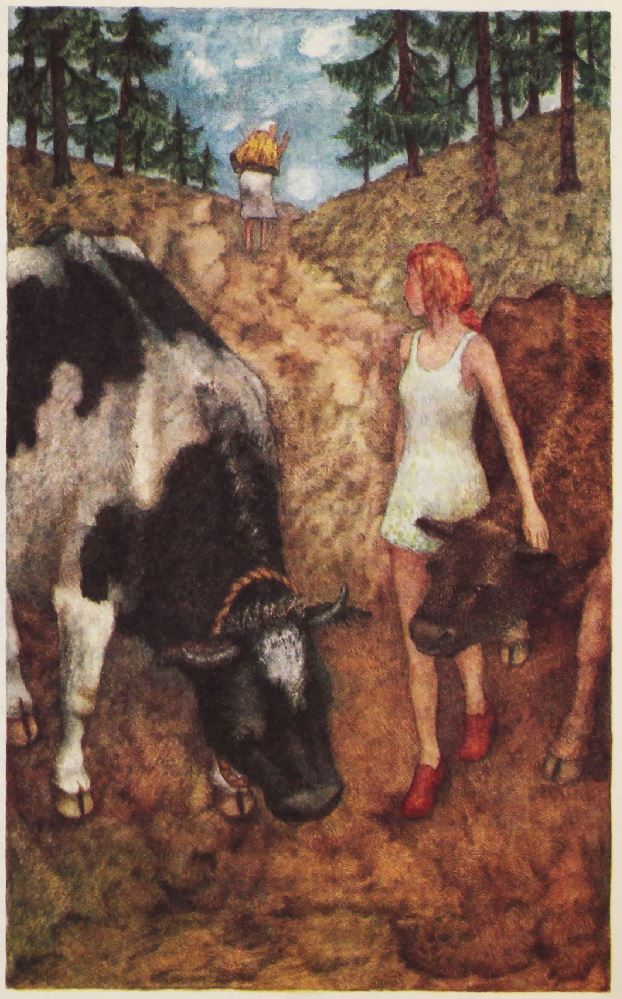
Ade! Es muß geschieden sein! Reich mir ein Gläslein kühlen Wein, Reich mir ein weißes Semmelein! Ade! Den kühlen Wein, das Semmelein! Ade! Ade! Mir tut mein Herz so weh! |
Ade! Es muß geschieden sein! Ade du heller Sonnenschein! Und Mondenschein und Sternenschein! Ade! Du Sonnenschein und Sternenschein! Ade! Ade! Mir tut mein Herz so weh! |
Ade! Es muß geschieden sein! o weine nicht, Feinsliebelein! Es muß von dir geschieden sein! Ade! |
Es muß, es muß geschieden sein! Ade! Ade! Mir tut mein Herz so weh! |
Diese Geschichte war ihr so auf das Herz gefallen, daß sie sie gar nicht aus dem Sinn schlagen konnte und immer für sich singen mußte:
Ade! Es muß geschieden sein! O weine nicht, Feinsliebelein! |
Und dabei liefen ihr die hellen Tränen wie brennende Ströme aus den Augen. Als sie so in traurigen Gedanken unter der grünen Eiche saß, wo sie gewöhnlich zu sitzen und zu spielen pflegte, kam mit einem Male Goldkäferchen hergeschwirrt, der einige Tage nicht dagewesen war, und flüsterte ihr zu: »Erdwürmchen, willst du luftfahren? Es ist heute der schönste Regenbogen am Himmel, und den wollen wir recht nah besehen; aber komm und mache dich gleich fertig!«Sie sagte ja, der Wagen kam, sie stieg ein, und Goldkäferchen nahm seine goldene Peitsche und klatschte auf die Pferde.
Und die Pferde brausten im sausenden Galopp davon, so geschwind, geschwind, daß Erdwürmchen Himmel, Erde und Meer kaum voneinander unterscheiden konnte und von dem schönen versprochenen Regenbogen gar nichts sah. Der mutwillige Kutscher knallte und klatschte in einem fort, und die Gottespferde wieherten und brenschten, und die Luft ging so gewaltig, als wenn Sturmwinde bliesen; Goldkäferchen aber klatschte und sang immer mit heller Stimme drein: »O weine nicht, Feinsliebelein! Es muß, es muß geschieden sein!«Das arme Erdwürmchen aber hatte nichts anders zu tun, als sich nur festzuhalten; denn jetzt kam ihr die Fahrt wirklich so vor, als sollte alles auseinanderfliegen und sie durch die weite leere Luft so fortgewirbelt werden. So sauste der Wagen fort, und ihr fehlte selbst der Atem, zu fragen, bis der Wagen mit einem Male anfing, sich zu senken und in einer unbekannten Gegend zur Erde kam. Als Erdwürmchen fühlte, daß es nicht mehr flog mit ihr, wollte sie Goldkäferchen fragen: »Wo sind wir?« Aber in demselben Hui waren Wagen, Kutscher und Pferde weg, und sie hat sie seit der Stunde in ihrem Leben nicht wiedergesehen.
Es war schon dunkel, die Sonne war lange unter, und der Mond und die Sterne standen hell am Himmel. Da hätte Erdwürmchen Ade! Ade! Ade! singen mögen, aber ihr war der Gesang jetzt knapp geworden, und sie saß im stillen Leide, rang ihre Hände und weinte bitterlich. Dann seufzete sie tief und rief einmal über das andere aus: »O ich gottloses Mädchen! Die Mutter hat mich oft gescholten, daß ich soviel mit den Würmern spielte; nun sehe ich wohl, was das für bunte Schelme sind. Warte nur, Goldkäferchen! Wenn du mal wiederkommst, sollst du's kriegen! O wenn ich nur einen Menschen fände, der mir den Weg nach Hause wiese!«
Sie fing an, durch die Büsche fortzugehen; aber sie war von dem geschwinden Fluge so müd geworden, daß sie kaum hundert Schritt gegangen war, so setzte sie sich unter einen Baum nieder und schlief ein und schlief da bis an den hellen Morgen. Das arme Kind meinte, sie sei nahe bei ihres Vaters Hause; aber sie war in der dreistündigen Fahrt über fünfzig Meilen weit durch die Luft gereist. Schlafe wohl und träume wohl, liebes Erdwürmchen!
Als Erdwürmchen erwachte, stand die Sonne schon hell am Himmel. Sie sah sich mit großen Augen um, denn das von gestern war ihr alles wie ein Traum. Sie hatte auch die ganze Nacht nichts anderes geträumt als von der sausenden Reise, wo sie, wie ihr deuchte, dreimal aus dem Wagen stürzte und immer wieder hereingebracht ward, von brennenden Häusern, von Krieg und Geschrei und von allerlei Not und Angst. Mit diesen Gedanken wachte sie auf und sah nun wohl, daß sie in einer unbekannten Gegend war und fern von ihres Vaters Hause. Denn sie erblickte ringsumher himmelhohe Berge, deren oberste Spitzen mit Schnee bedeckt waren. Und als sie das sah, weinte sie bitterlich und brach in die Worte aus: »O du erzbösewichtiges Goldkäferchen! Hier komme ich nimmer wieder heraus, ich sehe Vater und Mutter nimmer wieder, denn wie soll ich über den hohen Schnee kommen?«Mehr konnte sie vor Traurigkeit nicht sagen; doch ging sie gedankenlos fort. Sie kam bald an einen kleinen Baumgarten, wo Äpfel, Birnen und Pflaumen die Fülle an Bäumen
hingen. Sie ging hin und brach sich davon und aß, denn sie war sehr hungerig. Als sie sich gesättigt hatte, ging sie weiter fort durch die Bäume und hörte einen Hahn krähen und einen Hund bellen. Und da ward sie ganz froh und fiel mit dem Angesicht auf die Erde, faltete ihre Hände und betete ein frommes Morgengebet und sprach: »Gott sei gelobt, daß ich wieder zu Menschen komme!«Und als sie um einen kleinen Busch herumgekommen war, da sah sie hinter dem Busche ein kleines strohenes Häuschen stehen und ging gerade auf das Häuschen zu.Und ehe sie noch an das Häuschen kam, sprang ein buntes Hündchen auf sie zu und wedelte lustig mit dem Schwanze und bellte und brummte nicht, und dann kam ein schneeweißes Miezekätzchen und strich sich den Pelz an ihrem Knie glatt und schnurrte behaglich, wie die Katzen im Wohlgefallen tun. Und diese beiden begleiteten sie. Vor der Türe des Hauses saß ein altes Mütterlein mit weißem Kopfe an einem Spinnrade und spann und sang mit heller Stimme: »Wach auf, mein Herz, und singe!« und ließ sich nicht stören, daß Erdwürmchen kam, und Erdwürmchen stimmte ein und sang mit, bis das Lied zu Ende war, und freute sich, daß sie zu frommen Leuten gekommen war. Darauf stand die alte Frau von ihrem Spinnrade auf und reichte dem Erdwürmchen die Hand und hieß sie freundlich willkommen. Als sie aber dem Kinde ins Gesicht sah, rief sie: »Herrje! Erdwürmchen, bist du es? Wie in aller Welt kommst du hierher?« Erdwürmchen wunderte sich nicht wenig, als sie sich mit ihrem Namen anreden hörte, sah die alte Frau genau an und erkannte nun bald, daß es dieselbe alte Frau war, die ihr, als sie badete, einst die schönen neuen Kleider hinter den Dornbusch hingelegt hatte. Und sie antwortete ihr vergnügt: »Ja, Mutter, ich bin Erdwürmchen, aber wie ich herkomme, das weiß ich nicht; das weiß ich aber wohl, daß dein Goldkäferchen ein Erzlügner ist; er hat mir etwas vorgegaukelt von einem wunderschönen Regenbogen, und so ist er im sausenden Galopp durch die Luft mit mir davongefahren, daß mir Hören und Sehen dabei vergangen ist, und so bin ich endlich
hier wieder auf die Erde herabgekommen, und da hat er mich sitzenlassen. Nun ist es nur gut, daß ich dich hier treffe. Du kannst mir wohl den Weg durch die Berge zu Vater und Mutter zeigen; denn die werden sehr traurig sein, daß ich gestern abend nicht nach Hause gekommen bin, und werden glauben, daß mich Räuber gestohlen oder Wölfe und Untiere gefressen haben.«Die alte Frau antwortete ihr: »Sei mir hier willkommen, Erdwürmchen! Deine Eltern wohnen sehr weit von hier, und ich kann dich nun nicht hinbringen. Denn alle Straßen sind unsicher, und es ist Krieg, und gestern sind fremde Soldaten bei euch in Distelfeld eingerückt. Und schelte nicht so sehr auf Goldkäferchen! Es hat dich deswegen weggebracht. Deinen armen Eltern hättest du doch nicht helfen können; dir und deiner Ehre aber hätte leicht ein Leides geschehen können. Darum gib dich nur drein und bleib hier bei mir. Wir wohnen hier abseits im Walde; hier bist du sicher, und über diese Schneeberge kommt kein Feind. Wann es dort wieder ruhig ist, will ich dich schon nach Hause bringen.«Und Erdwürmchen gab sich drein und blieb; im stillen aber weinte sie manches Tränchen in ihrem Kämmerlein und im einsamen Walde, daß sie so weit weg war von Hause. Doch ging es ihr sonst recht gut.
Es war dies ein kleines Bauergütchen, das ganz einsam im Walde lag und etwas Feld, einen Garten, eine Wiese und des Holzes genug hatte; auch waren in Bächen und Teichen Forellen und Karpfen. Hier wohnte die Alte mit ihrem alten Manne, der wohl noch älter war als sie, und mit einem Knechte, der auch nicht mehr jung war, und die drei bestellten und bestritten die ganze Wirtschaft. Nun kam Erdwürmchen noch dazu und half ihnen. Sie hatten zwei Ochsen, zwei Pferde, acht Kühe, zwanzig Schafe und Ziegen, viele Hühner und Enten auf dem Hofe und Obst im Garten und Korn im Felde und lebten recht gut und vergnügt. Auch waren es christliche, fromme Leute, und in ihrem Leben hat Erdwürmchen nicht so viel in der Bibel und im Gesangbuche gelesen wie hier. Den Sommer waren alle fleißig, daß sie das Haus und die Scheunen vollschafften für
den Winter; den Herbst und Winter droschen die Männer Korn und fällten und fuhren Holz aus dem Walde; Mütterchen aber und Erdwürmchen, wann sie das Vieh und die Küche besorgt hatten, saßen am Spinnrocken und spannen und erzählten einander Geschichten oder sangen geistliche Lieder. Erdwürmchen hat nachher oft erzählt, die Jahre, die sie hier verlebt habe, seien die vergnügteste Zeit ihres Lebens gewesen.So waren hier fünf Sommer vergangen, und die Zeit war Erdwürmchen gewiß nicht lange geworden; da kam die alte Frau eines Morgens zu Erdwürmchen in ihr Kämmerchen und sprach: »Liebes Erdwürmchen, nun ist es Zeit, daß du von hier reisest und wieder zu deinen lieben Eltern kommst. Es ist arg hergegangen in Distelfeld und im ganzen Frankenlande; jetzt aber ist der Krieg vorbei, es ist wieder Friede, und nun ist es billig, daß du wieder zu den Deinigen ziehest und den Eltern die Sorge vergeltest, die sie in deiner Kindheit um dich gehabt haben. Siehe, ich habe dich hierher holen lassen, nicht daß ich dich bloß bei mir hätte -denn ich habe dich sehr lieb, das weißt du wohl -, sondern daß du sicher wärest vor der Wildheit und Wüstheit des Krieges; und wenn ich dich gleich gern behielte, so muß ich dich doch deinen Eltern wiedergeben, denn das andere wäre Sünde. Du hast wohl gemerkt, daß ich allerlei Künste kann, und das ist wahr; aber ich bin eine von den Frauen, die solche, die sie kennen, die Holden heißen, und ich gebrauche meine Künste nie zum Bösen. Darum erschrick nur nicht vor mir und behalte mich in einem guten Andenken: Ich bin eine von denen, die sie die guten weisen Frauen nennen, und ich habe mein Leben darauf verwendet, tolle Geschichten in kluge und Verkehrtes in Rechtes zu verwandeln. Und nun, liebes Kind, mache dich fertig, suche deine Sachen zusammen und packe deine Kleider und dein Leinzeug ein; denn morgen fahren wir ab.«
Und Erdwürmchen tat mit allem Fleiß, wie ihr befohlen war, und setzte sich dann einsam hin und weinte, daß sie die alte Frau verlassen sollte, die ihr so viel Liebes getan hatte in so manchem Jahr. Und
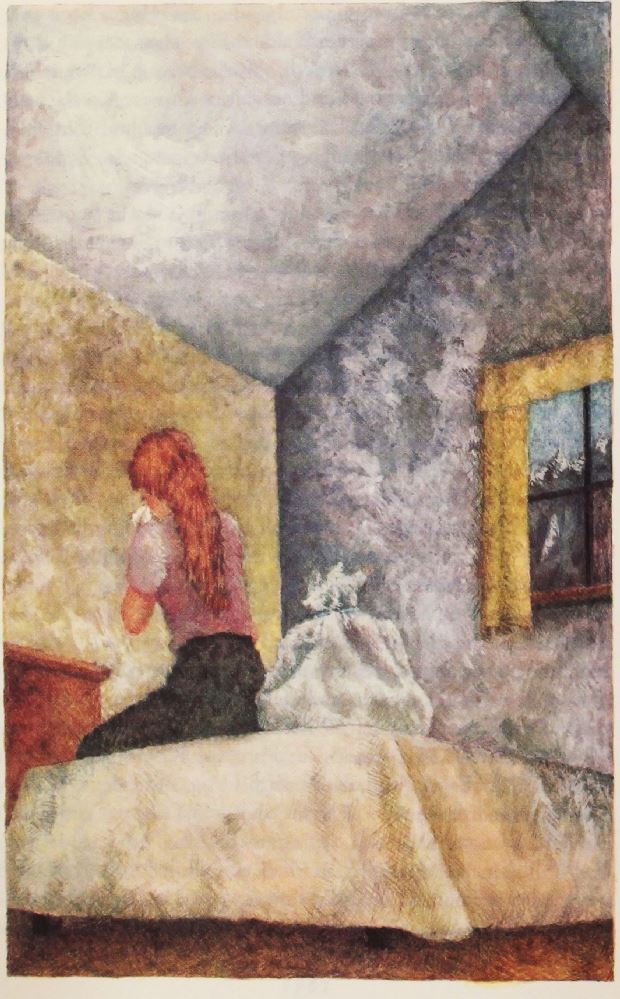
Als sie auf die Distelfelder Mark kamen, verwunderte sie sich, daß sie so wenige Häuser sah und von diesen einige ganz neu schienen, und sie sprach zu dem Fuhrmann: »Aber ist denn dies Diestelfeld?« —»Ja, freilich ist das Distelfeld«, antwortete er; »aber es ist nicht mehr das alte Distelfeld; das ist im Kriege meist abgebrannt, und sie fangen nun an und bauen wieder einige neue Häuser.« Erdwürmchen erschrak sehr, und sie dachte an ihre Eltern und Geschwister, und ihr war sehr bange im Herzen; aber sie mochte den Mann nicht fragen. Und sie fuhren in das Dorf hinein, und sie sah Brandstellen, ungeheure Bäume und Balken hin und her liegend, zerbrochene Zäune und niedergerissene Mauern, bis sie an ihres Vaters Haus gelangten. Das war auch nicht mehr das alte, sondern ein neues, das sie schon wieder aufgebaut hatten. Da fand sie ihre beiden Eltern gottlob noch am Leben, die waren sehr arm geworden, aber doch noch nicht mutlos, denn es waren fromme Leute, die Gott fürchteten. Ihre Geschwister lebten auch noch bis auf einen Bruder, der im Kriege geblieben war. Ihre beiden Schwestern, welche älter waren als sie, hatten schon Männer, die in andern Dörfern wohnten. Und
sie erzählte ihren Eltern, wie es ihr wunderbar ergangen und wo sie so lange gewesen war, und sagte ihnen viel Freundliches und Liebes und tröstete sie aus Gottes Wort und sprach: »Gott kann helfen, und ich will auch helfen und kann auch helfen!«Und mit diesen Worten öffnete sie den Beutel, welchen ihre alte Pflegemutter ihr beim Abschiede in die Hand getan hatte, und es waren fünfhundert blanke Dukaten darin; in den Kisten aber war das schönste Leinzeug, das sie zum Teil mit gesponnen und gebleicht und das die gute, alte weise Frau ihr zum Brautschatz mitgegeben hatte.Und Erdwürmchen hat sich bald einen wackern jungen Bauer zum Mann genommen und in Diestelfeld gewohnt und als eine fromme und christliche Frau gelebt. Und Gott hat ihren Fleiß und ihre Frömmigkeit gesegnet, daß sie ihren Eltern und vielen Menschen hat Gutes tun können. Ihre Kinder hat sie fleißig in Gottes Wort unterwiesen und frühe zur Kirche und Schule gehalten; aber sie hat nicht gelitten, daß sie viel in Waldeseinsamkeit lebten oder nächtlich und mitternächtlich herumwandelten. Denn sie pflegte zu sagen: »Es ist nicht gut, daß der Mensch sich zu sehr an die Kreaturen hängt und mit Steinen und Würmern und allerlei Tieren zu viele Gemeinschaft hat. Mancher ist dadurch verwirrt und närrisch geworden und in böse Hände geraten. Ich danke Gott jede Stunde, daß er mich in meiner Jugend bewahrt hat. Denn das ist das Sicherste, daß der Mensch sich an Gottes Wort hält und nicht zuviel fragt, was in Bäumen und Bergen steckt und wovon die Würmer und Vögel, ja die Blumen und Blätter zu flüstern und zu sprechen wissen. Das hat manchen auf schlimme Abwege gebracht, und wohin hätte es mich Ärmste nicht bringen können, wäre Gott nicht so gnädig gewesen?«
Rattenkönig Birlibi
Ich will die Geschichte erzählen von dem Rattenkönig Birlibi, eine Geschichte, die mir Balzer Tievs aus Preseke oft erzählt hat nebst vielen andern Geschichten. Balzer war ein Knecht, der auf meines Vaters Hofe diente, als ich acht, neun Jahre alt war, ein Mensch von schalkischen Einfällen, der viele Geschichten und Märchen wußte. Die Geschichte von dem Rattenkönig Birlibi lautet also:
In dem stralsundischen Dorfe Altenkamp, welches zwischen Garz und Putbus seitwärts am Strande liegt, hat vormals ein reicher Bauer gelebt, der hieß Hans Burwitz. Das war ein ordentlicher, kluger Mann, dem alles, was er angriff, geriet, und der im ganzen Dorfe die beste Wehr hatte. Er hatte sechzehn Kühe, vierzig Schafe, acht Pferde und zwei Füllen auf dem Stalle und in den Koppeln, glatt wie Aale und von so guter Zucht, daß seine Füllen auf dem Berger Pferdemarkt immer zu acht bis zehn Pistolen das Stück bezahlt wurden. Dazu hatte er sechs hübsche Kinder, Söhne und Töchter, und es ging ihm so wohl, daß die Leute ihn wohl den reichen Bauer zu Altenkamp zu nennen pflegten. Dieser Mann ist durch nächtliche Gänge im Walde um all sein Vermögen gekommen.
Hans Burwitz war auch ein starker Jäger, besonders hatte er eine treffliche Witterung auf Füchse und Marder und war deswegen oft des Nachts im Walde, wo er seine Eisen gelegt hatte und auf den Fang lauerte. Da hat er im Dunkeln und im Zwielichte der Dämmerung und des Mondenscheins manche Dinge gesehen und gehört, die er nicht wiedererzählen mochte, wie denn im Walde des Nachts viel Wunderliches und Absonderliches vorgeht; aber die Geschichte von dem Rattenkönig Birlibi hat man von ihm erfahren. Hans Burwitz hatte in seiner Kindheit oft von einem Rattenkönig erzählen hören, der eine goldene Krone auf dem Kopfe trage und über alle Wiesel, Hamster, Ratten, Mäuse und anderes dergleichen springinsfeldisches und leichtes Gesindel herrsche und ein gewaltiger Waldkönig sei; aber er hatte nie daran glauben wollen. Manches liebe Jahr war
er auch im Walde auf Fuchs- und Marderfang und Vogelstellerei rundgegangen und hatte vom Rattenkönig auch nicht das mindeste weder gesehen noch gehört. Da mochte der Rattenkönig aber wohl in einer andern Gegend sein Wesen getrieben haben. Denn er hat viele Schlösser in allen Ländern unter den Bergen und zieht beinahe jedes Jahr auf ein anderes Schloß, wo er sich mit seinen Hofherren und Hofdamen erlustigt. Denn er lebt wie ein sehr vornehmer Herr, und der Großmogul und König von Frankreich kann keine besseren Tage haben, und die Königin von Antiochien hat sie nicht gehabt, die ihr Vermögen in Herzen von Paradiesvögeln und Gehirn von Nachtigallen aufgefressen hat. Und das glaube nur nicht, daß dieser Rattenkönig und seine Freunde Nüsse und Weizenkörner und Milch je an ihren Schnabel bringen; nein, Zucker und Marzipan ist ihr tägliches Essen, und süßer Wein ist ihr Getränk, und leben besser als König Salomo und Feldhauptmann Holofernes.Nun ging Hans Burwitz wieder einmal nach Mitternacht in den Wald und war auf der Fuchslauer. Da hörte er aus der Ferne ein vielstimmiges und kreischendes Getöse, und immer klang mit heller Stimme heraus Birlibi! Birlibi! Birlibi! Da erinnerte er sich des Märchens vom Rattenkönig Birlibi, das er oft gehört hatte, und er dachte: Willst mal hingehen und zusehen, was es ist! Denn er war ein beherzter Mann, der auch in der stockfinstersten Nacht keine Furcht kannte. Und er war schon auf dem Sprunge zu gehen, da bedachte er das Sprichwort: Bleib weg, wo du nichts zu tun hast, so behältst du deine Nase; aber das Birlibi tönte ihm nach, solange er im Walde war. Und die andere Nacht und die dritte Nacht war es wieder ebenso. Er aber ließ sich nichts anfechten und sprach: »Laß den Teufel und sein Gesindel ihr tolles Wesen treiben, wie sie wollen! Sie können dem nichts tun, der sich nicht mit ihnen abgibt.« Wollte Gott, Hans hätte es immer so gehalten! Aber die vierte Nacht hat es ihn übermächtigt, und er ist wirklich in die bösen Stricke geraten.
Es ist der Walpurgisabend gewesen, und seine Frau hat ihn gebeten,
er möge diese Nacht nur nicht in den Wald gehen, denn es sei nicht geheuer, und alle Hexenmeister und Wettermacherinnen seien auf den Beinen, die könnten ihm was antun; denn in dieser Nacht, die das ganze höllische Heer loslasse, sei schon mancher Christenmensch zu Schaden gekommen. Aber er hat sie ausgelacht und hat es eine weibische Furcht genannt und ist seines gewöhnlichen Weges in den Wald gegangen, als die andern zu Bett waren. Da ist ihm aber der König Birlibi zu mächtig geworden. Anfangs war es diese Nacht im Walde eben wie die vorigen Nächte, es tosete und lärmte von fern, und das Birlibi klang hell darunter; und was über seinem Kopfe durch die Wipfel der Bäume schwirrte und pfiff und rauschte, das kümmerte Burwitz nicht viel, denn an Hexerei glaubte er gar nicht und sagte, es seien nur Nachtgeister, wovor dem Menschen graue, weil er sie nicht kenne, und allerlei Blendwerke und Gaukeleien der Finsternis, die dem nichts tun könnten, der keinen Glauben daran habe. Aber als es nun Mitternacht ward und die Glocke zwölf geschlagen hatte, da kam ein ganz anderes Birlibi aus dem Walde hervor, daß Hansen die Haare auf dem Kopfe kribbelten und sauseten und er davonlaufen wollte. Aber sie waren ihm zu geschwind, und er war bald mitten unter dem Haufen und konnte nicht mehr heraus.Denn als es zwölf geschlagen hatte, tönte der ganze Wald mit einem Male wie von Trommeln und Pauken und Pfeifen und Trompeten, und es war so hell darin, als ob er plötzlich von vielen tausend Lampen und Kerzen erleuchtet worden wäre. Es war aber diese Nacht das große Hauptfest des Rattenkönigs, und alle seine Untertanen und Leute und Mannen und Vasallen waren zur Feier desselben aufgeboten. Und es schienen alle Bäume zu sausen und alle Büsche zu pfeifen und alle Felsen und Steine zu springen und zu tanzen, so daß Hansen entsetzlich bange war; aber als er weglaufen wollte, verrannten ihm so viele Tiere den Weg, daß er nicht durchkommen konnte und sich ergeben mußte stehenzubleiben, wo er war.
Es waren da die Füchse und die Marder und die Jltisse und Wiesel
und Siebenschläfer und Murmeltiere und Hamster und Ratten und Mäuse in so zahiloser Menge, daß es schien, sie waren aus der ganzen Welt zu diesem Feste zusammengetrommelt. Sie liefen und sprangen und hüpften und tanzten durcheinander, als ob sie toll waren; sie standen aber alle auf den Hinterfüßen, und mit den Vorderfüßen trugen sie grüne Zweige aus Maien und jubelten und toseten und heulten und kreischten und pfiffen, jeder auf seine Weise. Kurz, es war das ganze leichte Diebsgesindel der Nacht beisammen und machte gar ein scheußliches Geläute und Gebimmel und Getümmel durcheinander. In den Lüften ging es ebenso wild als auf der Erde; da flogen die Eulen und Krähen und Käuze und Uhus und Fledermäuse und Mistkäfer bunt durcheinander und verkündigten mit ihren gehenden und kreischenden Kehlen und mit ihren summenden und schwirrenden Flügeln die Freude des hohen Tages.Als Hans erschrocken und erstaunt sich mitten in dem Gewimmel und Geschwirr und Getöse befand und nicht wußte, wo aus noch ein, siehe, da leuchtete es mit einem Male heller auf, und nun sangen viele tausend Stimmen zugleich, daß es in fürchterlich grauslicher Feierlichkeit durch den Wald schallte und Hansen das Herz im Leibe bebte:
Macht auf! Macht auf! Macht auf die Pforten! Und wallet her von allen Orten! Geladen seid ihr allzugleich; Der König ziehet durch sein Reich. |
Ich bin der große Rattenkönig; Komm her zu mir, hast du zuwenig! Von Gold und Silber ist mein Haus, Das Geld mess' ich mit Scheffeln aus. |
So klang es im feierlichen und langsamen Gesange fort, und dann schauten immer wieder einzelne kreischende und gehende Stimmen mit widerlichem Laute darunter Birlibi! Birlibi!, und die ganze

Hansen war schon bange genug gewesen, jetzt aber, als er den Rattenkönig und die Rattenkönigin und die Wölfe und Kater und Hasen so miteinander sah, da schauderte ihm die Haut auf dem ganzen Leibe, und sein sonst so tapferes Herz wollte fast verzagen, und er sprach bei sich: »Hier mag der Henker länger bleiben, wo alles so wider die Natur geht! Ich habe auch wohl von Wundern gelesen und gehört; aber sie gingen doch immer etwas natürlich zu. Daß dies aber buntes Teufelsspiel ist und teuflisches Pack, sieht man wohl. Wer nur heraus wäre!«
Und Hans machte noch einen Versuch, sich herauszudrängen; aber der Zug brauste immer frisch fort durch den Wald, und Hans mußte mit. So ging es, bis sie an eine äußerste Ecke des Waldes kamen. Da war ein offenes Feld und hielten viele hundert Wagen, die mit Speck und Fleisch und Korn und Nüssen und andern Eßwaren beladen
waren. Einen jeden Wagen fuhr ein Bauer mit seinen Pferden, und die Bauern trugen die Säcke Korn und den Speck und die Schinken und Mettwürste und was sie sonst geladen hinab in den Wald, und als sie Hans Burwitz stehen sahen, riefen sie ihm zu: »Komm! Hilf auch tragen!«Und Hans ging hin und lud mit ab und trug mit ihnen, er war aber so verwirrt, daß er nicht wußte, was er tat.Es deuchte ihm aber in dem Zwielichte, als sehe er unter den Bauern bekannte Gesichter und unter andern den Schulzen aus Krakevitz und den Schmied aus Kasnevitz; er ließ sich aber nichts merken, und jene taten auch wie unbekannte Leute. Mit den Bauern aber hatte es die Bewandtnis: Sie hatten sich dem Rattenkönige und seinem Anhange zum Dienst ergeben und mußten ihnen in der Walpurgisnacht, wo des Rattenkönigs großes Fest steht, immer den Raub zu dem Walde fahren, den Rattenkönigs Untertanen einzeln aus allen Orten der Welt zusammengemaust und zusammengestohlen hatten. Und Hans kam nun auch ganz unschuldig dazu und wußte nicht wie. Sowie die Säcke und das andere in den Wald getragen wurden, war das wilde Diebsgesindel darüber, und es ging Grips! Graps! und Rips! Raps! hast du nicht gesehen, und jeder griff zu und schleppte seinen Teil fort, so daß ihrer immer weniger wurden. Der König aber hielt noch da in seinem hohen und prächtigen Wagen, und es tanzeten und toseten und lärmten noch einige um ihn. Als aber alle Wagen abgeladen waren, da kamen wohl hundert große Ratten und gossen Gold aus Scheffeln auf das Feld und auf den Weg und sangen dazu:
Hände her! Mützen her! Wer will mehr? Wer will mehr? Lustig! Lustig! Heut geht's toll, Lustig! Händ' und Mützen voll! |
Und die Bauern fielen wie die hungrigen Raben über das ausgeschüttete Gold her und griffelten und graffelten und drängten und stießen sich, und jeder raffte so viel auf von dem roten Raube, als
er habhaft werden konnte, und Hans war auch nicht faul und griff rüstig mit zu. Und als sie in bester Arbeit waren wie Tauben, worunter man Erbsen geworfen, siehe, da krähete der Morgenhahn, wo das heidnische und höllische Reich auf der Erde keine Macht mehr hat - und in einem Hui war alles verschwunden, als wäre es nur ein Traum gewesen, und Hans stand ganz allein da am Walde. Und der Morgen brach an, und er ging mit schwerem Herzen nach Hause. Er hatte aber auch schwere Taschen und schönes rotes Gold darin; das schüttete er nicht aus. Seine Frau war ganz ängstlich geworden, daß er so spät nach Hause kam, und sie erschrak, als sie ihn so bleich und verstört sah, und fragte ihn allerlei. Er aber fertigte sie nach seiner Gewohnheit mit Scherz ab und sagte ihr nicht ein Sterbenswörtchen von dem, was er gesehen und gehört hatte.Hans zählte sein Gold - es war ein hübsches Häuflein Dukaten - legte es in den Kasten und ging die ersten Monate nach diesem Abenteuer nicht in den Wald. Er hatte ein heimliches Grauen davor. Dann vergaß er, wie es dem Menschen geht, die Walpurgisnacht und ihr schauerliches und grauliches Getümmel allmählich und ging nach wie vor im Mond- und Sternenschein auf seinen Fuchs- und Marderfang. Von dem Rattenkönig und seinem Birlibi sah und hörte er nichts mehr und dachte zuletzt selten daran. Aber als es gegen den Frühling ging, veränderte sich alles, er hörte zuweilen um die Mitternacht wieder das Birlibi klingen, daß seine mattesten Haare auf dem Kopfe ihm lebendig wurden, und lief dann zwar immer geschwinde aus dem Walde, hatte aber dabei doch seine heimlichen Gedanken auf die Walpurgisnacht; und weil das, was die Menschen bei Tage denken, ihnen bei Nacht im Traume wiederkommt und allerlei spielt und spiegelt und gaukelt, so blieb auch der Rattenkönig mit seiner Nachtgaukelei nicht aus, und Hans träumte oft, als stehe der Rattenkönig vor seiner Türe und klopfe an; und er machte ihm dann auf und sah ihn leibhaftig, wie er damals in dem Wagen gesessen, und er war nun ganz von lauterem Golde und auch nicht so häßlich, als er ihm damals vorgekommen, und Rattenkönig sang ihm mit
der allersüßesten Stimme, von der man nicht glauben sollte, daß eine Rattenkehle sie haben könne, den Vers vor:Ich bin der große Rattenkönig, Komm her zu mir, hast du zuwenig! Von Gold und Silber ist mein Haus, Das Geld mess' ich mit Scheffeln aus - |
und dann kam er dicht zu ihm heran und flüsterte ihm ins Ohr: »Du kommst doch wieder zur Walpurgisnacht, Hans Burwitz, und hilfst Säcke tragen und holst dir deine Taschen voll Dukaten?«Zwar hatte Hans, wann er aus solchen Träumen erwachte, neben der Freude über das Gold immer ein Grauen, und er sprach dann wohl: »Warte nur, Prinz Birlibi, ich komme dir nicht zu deinem Feste!« Aber es ging ihm, wie es andern Leuten auch gegangen ist, und das alte Sprichwort sollte an ihm auch wahr werden: Wen der Teufel erst an einem Faden hat, den führt er auch wohl bald am Strick. Genug, je näher die Walpurgisnacht kam, desto mehr wuchs in Hans die Gier, auch dabei zu sein. Doch nahm er sich fest vor, dem Bösen diesmal nicht den Willen zu tun, und ging den Walpurgisabend auch glücklich mit seiner Frau zu Bett. Aber er konnte nicht einschlafen; die Wagen mit den Säcken und die Bauern und die großen Ratten, die das Gold aus Scheffeln auf den Boden schütteten, fielen ihm immer wieder ein, und er konnte es nicht länger aushalten im Bette, er mußte aufstehen und sich von der Frau fortschleichen und in den finstern Wald laufen. Und da hat er diese zweite Nacht ebenso wiedererlebt als das erstemal. Er hatte sich ein Säckchen mitgenommen für das Gold und hatte auch viel reichlicher eingesammelt als das vorige Jahr.
Nun däuchte ihm, er habe des Goldes genug, und er tat einen hohen Schwur, er wolle sich nimmer wieder in die Versuchung geben und auch nie wieder in den Wald gehen. Und er hat den Schwur gehalten und sich selbst überwunden, daß er nicht in den Wald gegangen ist
und keine Walpurgisnacht wieder mitgehalten hat, sooft ihm auch noch von dem Birlibi und dem goldenen Rattenkönig geträumt hat. Er hat das aber nicht in seinem Herzen sitzen lassen, sondern hat es mit eifrigem Gebet wieder ausgetrieben und den Bösen endlich müd' gemacht, daß er von ihm gewichen ist. So war manches Jahr vergangen, und Hans hieß ein sehr reicher Mann. Er hatte sich für seine Dukaten Dörfer und Güter gekauft und war ein Herr geworden. Es munkelte auch unter den Leuten, es gehe nicht mit rechten Dingen zu mit seinem Reichtum; aber keiner konnte ihm das beweisen. Aber endlich ist der Beweis gekommen.Der Böse lauerte auf den armen Mann, an dem er schon einige Macht gewonnen hatte. Er war ergrimmt auf ihn, weil er von seinen hohen Festen in der Walpurgisnacht ganz ausblieb, und als Hans einmal wieder mit sündlicher Lüsternheit an das Goldsammeln gedacht und darüber das Abendgebet vergessen, auch einige unchristliche Flüche über eine Kleinigkeit getan hatte, hat er mit seinem Gesindel hervorbrechen können, und Hans hat nun gelernt, was das goldene Spielwerk des Königs Birlibi eigentlich auf sich habe. Seit dieser Zeit hat Hans weder Stern noch Glück mehr in seiner Wirtschaft gehabt. Wieviel er sich auch abmattete, er konnte nichts mehr vor sich bringen, sondern es ging von Tag zu Tag mehr rückwärts. Seine ärgsten Feinde aber waren die Mäuse, die ihm im Felde und in den Scheunen das Korn auffraßen, die Wiesel, Ratten und Marder, die ihm die Hühner, Enten und Tauben abschiachteten, die Füchse und Wölfe, die seine Lämmer, Schafe, Füllen und Kälber holten. Kurz, das Gesindel hat es so arg gemacht, daß Hans in wenigen Jahren um Güter und Höfe, um Pferde und Rinder, um Schafe und Kälber gekommen ist und zuletzt nicht ein einziges Huhn mehr hat sein nennen können. Er hat als ein armer Mann mit dem Stock in der Hand nebst Weib und Kindern von Haus und Hof gehen und sich auf seinen alten Tagen als Tagelöhner ernähren müssen.
Da hat er oft die Geschichte erzählt, wie er zu dem Reichtum gekommen und aus dem Bauer ein Edelmann geworden ist, und hat
Gott gedankt, daß er Ratten und Mäuse als seine Bekehrer geschickt und ihn so arm gemacht hat: »Denn sonst«, hat der arme Mann gesagt, »wäre ich wohl nicht in den Himmel gekommen, und der Teufel hätte seine Macht an mir behalten, und ich hätte dort jenseits endlich auch nach des Rattenkönigs Pfeife tanzen müssen.« Das hat er auch dabei erzählt, daß solches Gold, das man auf eine so wundersame und heimliche Weise gewinne, doch keinen Segen in sich habe; denn ihm sei bei allen seinen Schätzen doch nie so wohl ums Herz gewesen als nachher in der bittersten Armut, ja, er sei ein elenderer Mann gewesen, da er als Junker mit Sechsen gefahren, als nachher, da er oft froh gewesen, wenn er des Abends nur Salz und Kartoffeln gehabt habe.
Rotkehlchen und Kohimeischen
Rotkehlchen und Kohimeischen waren einst ein paar hübsche Dirnen, Töchter einer alten, frommen Witwe, die sich vom Spinnen, Nähen und Waschen und von anderer Arbeit knapp, aber doch ehrlich ernährte. Sie hatte nur diese beiden Kinder, von welchen die älteste Gretchen und die jüngste Kathrinchen hieß. Sie hielt, wie sauer es ihr auch war, die Kinder immer nett und reinlich in Kleidung und schickte sie fleißig zur Kirche und Schule, und als sie größer wurden, unterwies sie sie in allerlei künstlicher Arbeit mit der Schere und Nadel und hielt sie still in ihrem Kämmerlein in aller Ehrbarkeit und Tugend. Und Gretchen und Kathrinchen gediehen, daß es eine Freude war, und wurden ebenso hübsch und fein, als sie fleißig und ehrbar waren, so daß alle Menschen ihre Lust an ihnen hatten und die Nachbarn sie ihren Töchtern als rechte Muster zeigten und lobten. Die Witwe starb, und die beiden Schwestern blieben in ihrem Häuschen und lebten, wie sie mit der Mutter bisher getan, von ihrer Hände Arbeit. Aber es blieb nicht lange mehr so still in dem Häuschen, als es sonst gewesen war. Die Falken und Habichte, welche auf
schönes, junges Blut lauern, merkten, daß die Hüterin weg war, welche die Täubchen sonst bewacht hatte, und es fanden sich häufig lose, junge Gesellen ein, welche die Mädchen zu Tänzen und Gelagen und zu Spaziergängen auf die Dörfer verlocken wollten.Die beiden Schwestern wehrten sich einige Wochen tapfer, aber endlich ließen sie sich bewegen und gingen mit und dachten, es kann doch wohl keine Sünde sein, was so viele Frauen und Mädchen tun, die niemand unehrlich nennt. Zuerst kam es ihnen bei diesen Tänzen doch zu wild vor, und sie sahen nicht einmal lange zu, sondern gingen früh weg und waren vor Sonnenuntergang wieder zu Hause und ließen sich nicht bis in die Nacht hinein halten, wieviel die, welche sie mitgenommen hatten, auch locken mochten. Das zweite und dritte Mal tanzten sie schon mit, gingen aber bei Tage heim und mit etwas schwerem Herzen und nahmen sich deswegen vor, den nächsten Sonntag zu Hause zu bleiben. Aber das Worthalten war schwer, denn die jungen Gesellen kamen immer wieder und baten zu schön. Das vierte und fünfte Mal blieben sie schon bis nach Sonnenuntergang, und das sechste und siebente Mal hatte die Glocke zwölf geschlagen, als sie heimkamen, und sie mußten ihre Wirtin herauspochen, daß sie ihnen die Türe aufschlösse, und als die alte Frau sie ermahnte und sie ihrer seligen Mutter erinnerte, lachten sie schon und sprachen: »Ach! Die Mutter und Ihr! Wann die Mäuse keine Zähne mehr haben, schelten sie auf die Nußknacker; Ihr werdet auch getanzt haben, als Ihr jung waret.«
Die Mädchen waren zu Hause noch immer sehr fleißig, auch hatten sie noch nichts Unehrbares getan noch gelitten; aber die Türe zum Bösen war geöffnet, und Leichtsinn und Leichtfertigkeit nahmen von Tage zu Tage zu, und nun ward auch schon mancher kostbare Wochentag mit Nichtstun und Herumprangen vertändelt und verquändelt, den sie sonst auf nützliche Arbeit verwendet hatten. Auch in ihrem Kämmerchen mußte alles anders werden; die Vögel waren lustig und bunt geworden, es mußte alles blankere und zierlichere Federn anziehen: neue Tische, neue Stühle, neue Vorhänge, feinere
Kleider und Schuhe. Aber mit dem alten Hausrat schien auch der mütterliche Segen, der bisher sichtbar auf den Kindern geruht hatte, aus dem Hause gezogen zu sein. So schlich sich das Unglück mit dem Leichtsinn ein; erst hielt sie der Böse nur an einem dünnen, seidenen Fädchen, zuletzt hat er sie mit einem dicken Kabeltau der Sünde umflochten, und sie haben die Schwere und den Schmutz desselben gar nicht mehr gefühlt.Gretchen und Kathrinchen hatten immer viel schöne Arbeit und kostbare Zeuge unter Händen, woraus sie Schmuck und Kleider stickten und näheten. Sie gebrauchten jetzt mehr Geld als sonst; sie fingen allmählich an zu mausen; ach! Sie stahlen zuletzt. Einmal hatten sie einen bunten, seidenen Rock gestohlen, der in einem Nachbarhause am Fenster hing, und an einen herumziehenden Juden verkauft. Ein armer Schneidergesell, bei welchem man viele bunte Lappen und Streifen Zeug gefunden, die er wohl auch gemaust haben mochte, war darüber angeklagt, gerichtet und gehängt worden. Er hing und baumelte an dem lichten Galgen. Eines Abends spät kamen die beiden Dirnen mit andern Gesellen und Gesellinnen von einem Dorf tanze zurück, und der Weg ging an dem Galgen vorbei. Da rief einer aus der Schar, ein leichtfertiger Gesell: »Fritz Schneiderlein! Fritz Schneiderlein! Wie teuer wird dir dein bunter Rock!« Kaum aber hatte er das Wort gesprochen, so schlug die Sünde wie ein Blitz in die beiden Dirnen, die schuld waren an des armen Schneiders Tod. Sie stürzten beide wie tot zur Erde hin, und die andern, die es sahen, liefen voll Schrecken weg, als hätten ihnen alle Galgenvogel schon in dem Nacken gesessen. Sie haben die Geschichte in der Stadt erzählt, und die Leute sind hingegangen; aber die beiden Dirnen haben sie nimmer gefunden.
Und wie hätten sie sie finden sollen? Sie waren in Vögel verwandelt und müssen nun in der weiten Welt herumfliegen. Gretchen ist ein Rotkehlchen geworden und Kathrinchen ein Kohimeischen: Denn Gretchen trug immer ein rotes, seidenes Tuch um den Hals und Kathrinchen ein gelbes. So müssen sie nun als kleine Vögel in den Wäldem
rundfliegen und Hunger und Durst leiden, Hitze und Kälte aushalten und vor Sperbern und Falken, vor Schlangen und Ottern, vor Jägern und wilden Buben zittern. Das hatte ihre Mutter wohl nicht gedacht, als sie so sittig und fein mit ihr in dem Kämmerlein saßen und stickten und webten und näheten und abends und morgens bei dem Zubettgehen und Aufstehen mit heller Stimme geistliche Lieder sangen. Aber die armen Kinder sind zuerst verlockt, dann verführt und so endlich in schwere Sünden gefallen und haben kaum gewußt, wie sie dazu gekommen sind: So leise und sanft hat der Leichtsinn sie seinen Schlangenblumenweg geführt. Daß diese kleinen Vögel einst Menschen gewesen, ist ganz natürlich, und man kann es auch daraus sehen, daß sie immer um die Häuser der Menschen fliegen, auch oft durch die offenen Fenster in die Zimmer kommen und sich da fangen lassen, auch daß sie im Walde, sowie sich nur Menschen da sehen lassen, sogleich um sie herumflattern und herumzwitschern. Sie haben auch die alte Unart im Vogelkleide noch nicht abgelegt und können das Mausen nicht lassen, sondern sind noch immer Erzdiebe, und wo nur etwas Buntes und Neues und Schimmerndes ausgehängt wird, da fliegen und schnappen sie danach und werden daher keine Vögel leichter in Fallen und Schlingen gefangen als diese beiden, und müssen Gretchens und Kathrinchens gefiederte Urenkel es noch entgelten, daß sie einst zuviel auf Kirmisse und Tänze gegangen und den bunten Rock gestohlen haben, worum der Schneider hangen mußte.Die Menschen jammert es sehr, wann sie Rotkehlchen und Kohlmeischen in den Schlingen hangen sehen, und sie rufen wohl: »Ach! Die armen, niedlichen Vögelein!« Denn sie sind wirklich sehr niedlich und hübsch und waren einst auch niedliche, hübsche Dirnen, ehe sie von bösen Buben verführt wurden, und lebten als fromme, einfältige Kinder und meinten und wußten nichts Arges.
Wo piepen de Müse!
Wo de Müse piepen! Weet ji woll, wo dat herkümmt, datt man seggt, wenn man sick äwer jemand lustig maken will, datt em't man klamm geit: Wo piepen de Müse?In Redebaß was eenmal een Bur, de het Marten Dreews, de was wild un sehr kettlich und karmänsch un ging gewaltig in't Tüg. De Lüde in dem Dörp heten em man den dullen Dreews. Bi de Arbeit was he düchtig un kun für twe un dre döschen un meihen; äwerst van Gott un Gottswurt wull he nicks weten, un jeden Sünndag un Festdag un männige Warkeldagsnacht satt he im Krog bi'm Spil un Brannwin und bedrew een wöst un dull Wesen. Denn supen kunn he as keen Minsch un uthollen as een Perd. Denn wenn he de Nacht dörchwakt hedd, was he des Dags doch noch flink un frisch to'r Arbeit, un wer sick mit em to'm Drunk sett'd, was vörlarn, und bi'm Spill ging't noch veel gefährlicher to. He makte all sine Mitspelers dumm edder spelde se möd un stack't Geld in de Tasch. Kortum, he was een Kerl, vör dem man jeden warschuwen müßt', und sinen Füsten dörst nüms to nah kamen. So hedd disse Marten et männigen golden Dag drewen as cen rechter Heid und Unchrist, un't was em bettan jümmer tämlich glücklich gahn. Nu geschah et, he was eenen Wihnachtsawend im Kroge to Kamin satt bi'm Kartenspill un trumfde lustig van sick. As't nu gegen Klock twelw ging, stund de Kammer Jäger, de mit im Spill was, up un sede: »Smiet't de Karten tohoop, Drews, und lat't uns een Vaderunser tosam beden, damit de Düwel ditt Jahr keene Gewalt äwer uns krigt!« Un Drews lacht em ut un sed': »Düwel hen, Düwel her! Nicks as Papensnack und Spökels vör Kinner un olle Wiwer; den Düwel hebben se lang doot sla'n, un vör den will ick bi Dag un bi Nacht seker dör de Welt gahn. Watt, du büst en Kerl, de Puiwer un Blei führt, un kannst dissen Lappen noch rüken?« — »Ja woll, dör de Welt«, sede de Jäger, »mit Gott un Gottswurt.« Un de Jäger stund up un foldede de Hände tosam und bed'de, un all de annern deden dat mit, un ok de Kartenspelers, un leden de Karten weg. Äwerst
Marten slog een Knipschen und spelde mit de Karten tüschen de Finger un lachte. Dat Spil was nu ut, denn nüms wull mit em spelen, und ging jeder in sin Hus. Un Drews ging toletzt ook weg.Un as Drews woll halwwegs was tüschen Kamin un Redebaß bi dem Kammer Busch up de grote Hamborger Lands trat an dem Wege, de nach Satel afgeit, sach he mit eenem Mal een rodes Für dör den Busch lopen, un so verwogen he was, em schudderde de Hut up dem Liwe, un all sine Haar up dem Kopp kribbelden cm unner de Mütz. Würklich wurd et em äwer't Metzer, he kunn sick nich hohen, he müßt Rietut nehmen. As he nun een Wie! dat Hasenpanier dragen hedd un uter Atem was un stilstahn müßt, da dacht he bi sick: »Pfui Diiwel, Marten! Lettst du di so van dem Düwel jagen? Un doch is't nicks as Kinnerleuschen - wer hett den Düwel sehn? Frisch? Wes en Kerl, un gah cm up't Liw, wenn he to finnen ist.« So sprack he sick Mod in dc Bost un wend'd um un ging langsam torügg wedder to dc Stell, wo cm vör eene haiwe Stund dc Beenen to flinck worden waren. Doch slog cm dat Hart gegen dc Ribben, datt man't eenen Büssenschott wiet hören kunnt hedd. Doch makte he sick stark, beet dc Tehnen tosam un wull cen Kerl sin. Un as he an den Satelschen Weg kam, wo he den wunnerhichen Schin dörch dc Böm äwer den witten Snee hedd lopen sehn, stund he still und reep mit luder Stimm, datt dc Börne im Busch bewerden: »Herut Düwel! Herut, wenn du Hart best!«
Un watt geschah? Up sin Wurt leep dc Schin wedder as een Blitz äwer den Snee un grad up cm to. Un he sach, dat kam as eene glönige Mus, dc sprung as in hellen Froiden, un piepte ganz fin un was nich gröter as eene anner Husmus, äwerst se flunkerde un flackerde as dat höllische Für un hedd eenen schönen vergüld'ten Kamm up dem Kopp und gnapperde mit den fürigen Tehnen, as ob se cm biten wull. Un Marten mügt willen edder nich, he kunn dat Wippern un Schnippern van dem Müschen nich uthollen, un, hast du mir nicht gesehen, müßt he wedder to'm Hasenpanier griepen. He hedd sick äwerst in dem deepen Snee so äwerlopen, un dc Angst hedd cm dat
Hart so upblasen, datt he woll acht Dage un länger elendig krank lagg. Äwerst sine Wihnachtslust un Sneefahrt versweeg he un sede keener Minschenseele, wo he van Kamin nach Redebaß kamen was.Un datt bleew da nich bi; bös Ding will ook Wiel hebben. He hedd den ollen swarten Fiend eenmal utföddert, und de wull nu nich mehr wiken. Marten hedd so'n Gruwel vör de Stell am Satelschen Weg, dat em bi hellem Dage nüms mit lebendigem Liwe dahen bröcht hedd. Wenn he unnertiden in Kamin edder Flemendörp een Warf edder nah'm Sunde eene Reis vür hedd, nam he jümmer eenen wieden Umweg. Äwerst de olle Griese is negenklok, he weet woll hentokamen, wo he henwill. Van Anfang an was dat besünnerlich in disser Musgeschicht, datt Marten bi aller Angst, de cm ankam, wenn he an de dulle Nacht un an de glönige Mus up'n Snee dachte, doch jümmer as eenen Brand un cen Ketteln in de Bost földe, dc fürige Mus eenmal weddertosehn. Denn so kettelt den armen Minschen de düwelsche Angst un Froid. Disse Brand wurd von Dag to Dage starker in cm und plagde em toletzt so grausam, datt he nich Rauh noch Rast davör hedd. Am heetesten äwerst brennd'et cm, wenn't gegen dc Tid ging, wo Gott den Bösen dc Strat apen deit, wo dc Düwel un all, wat Hexen- un Gespensterkappen dreggt, ehr Spil bedriwen dörren. Un wenn alle frame Christenminschen im besten Siap liggen, wenn dc Klock twelw slog, denn kunn dc armen Marten sick oft nich hohen, un wo grot sin Gruwel ook was, et drew cm oft ut dc warmen Feddern herut un ut dem Huse in dc düstre, bistrige un spökische Nacht herin up dc Landstrat, wo dc Weg ut dem Dörp bargan nah Kamin herafgeit, un bloot eene noch grötere Angst jog cm denn wedder torügg.
So hedd dc düwelsche brennende Lust un Angst cm een heeles Vierteljahr plagt von Wihnachten bett Ostern, un ut dem lustigen un äwerdrewenen Schelm, dc he süs was, wurd he beel nahdenklich un deepsinnig, so datt dc Fründe un Nabers sick wunnerden, watt et doch wo!! mit dem Marten für eene Bewandtnis hebben mügt. So
hedd Marten sick lang tapper wehrt; doch toletzt wurd de Düwel em äwer, un wo sehr he sick ook fürcht'de, he müßt an den Satelschen Weg. Un as he an den Weg kam, da was't richtig, un he hedde dat Spil up'm Wagen. Den Ogenblick was de glönige Mus ook da un sprung üm em herüm un hedd sick so lidig un sach em ut so blanken, grellen Oogen an, as wenn se sick anfrünnigen wull; und doon leep se vör em her as up den Busch to, un stund denn weder still un keek sick üm, as wull se seggen: Kumm mit! Kumm mit!, un wo sehr em ook dat Hart slog un pupperde, he kunn't nich laten, he müßt eenfach mitkamen.Un as de Mus in de Busch kam, da krop se unner eenen runden Steen, un so vörswund se, un oogenblicklich brennde de Steen lichterloh. As Marten dat sach, weg was sine Angst: He dachte an olle Leuschen, de sin Vadder cm vördags oft vörtelld hedd van brennendem Geld, un wo man den Düwel bannen schal!, datt he mat Geld unner de Erd henaftehn kann. Un Marten was nich ful, he spredede sine Hände äwerkrütz äwer den Steen und swunk sinen Hot daräwer und reep: »Wieke, Düwel, wiek! Du best keen Recht an mi.« Un so stund he keck un vörwegen, bett dc Hahn kreide un dc Lewark upflog, un dc helle Dag anbrack. Doon greep he to un wölterde den Steen weg, un da lag eene dode Mus un een groter Hupen roder Dukaten. Un he sammelde sick den Hotpoll vull un füllde alle sine Taschen un sine Schoh, un so sleek he sick gar lising to Hus un lede dat Geld in sinen Kasten. Un as he nu vam Satan dat erste Handgeld nahmen hedd, was he fast; un wo männige Nacht, wenn alle Christen im söten Siap liggen, dc alle Sorgen todeckt, müßt dc arme Marten herut un to dem Unglückssteen wanken und zitternd un bäwernd äwer ehm stahn un frieren.
Up disse Wis was't een paar Jahr gahn, un he hedd Kisten und Kasten gehüpt vull Gold un ging nu reeds as een Junker im prächtigen Rock staatsch un karmänsch un drog sülwerne Sparen un eenen Tressenhot. Dat sach äwerst jeder Christenminsch, datt dat nich mit rechten Dingen toging. Un toletzt funk et ook an van den glönigen
Müsen to munkeln, un een Knecht, de bi em deende un't vör Gruwel nich länger bi em uthollen kunn, vörtelide, datt he de brennenden Müse oft äwer den Hoff lopen sach, un datt in den Schünen un in dem Stall keen Minsch sick vör erem Piepen un Gnappern redden un bargen künn. Un so hett't sick begewen, as de Bös em bestrickt hedd, datt he sin Nett nich mehr terrieten kunn, da sünt eene Wihnachtsnacht tüschen twelw un eens so veele glönige piepende Müse up den Hoff lopen kamen, datt et eene Lüchting gaff, as ob't een Für was; un de springenden Düwelskamraten hebben em Hus un Hoff un Schünen un Ställ anstickt, un so ist Marten Drews mit Wiw un Kinnern und Ossen un Perden to Asch vörbrennt un all dat Düwelsgold mit, wenn dc Müse et nich heemlich wegdragen hebben. Man twe, drei lumpige Dukaten hebben se ut de Asch herutkraßt. Un siet de Tied seggen de Lüde: »Hür, wo piepen Martens Müse!« Un wo vortiden Martens Hus stahn hett, dat is hinner des Krögers Boomgarden, un da piept un schrejekt et de ganze Nacht, un up jedem Boom sitt eene Ul, un ick wull't nüms raden, bi doder und nachtslapender Tid äwer dc Stell to gahn.
Das schneeweiße Hühnchen
(Erzählt von Hinrich Vierk)
In Gurrevitz, eine halbe Meile von Rambin, lebte einmal ein Weber, das war ein sehr armer, aber frommer und gottesfürchtiger Mann; der hatte auch eine recht gute und christliche Ehefrau, und die beiden Leute hatten viele liebe Kinder. Das jüngste und liebste Kind von allen aber war ein kleines Mädchen, welches Christine hieß; das war acht Jahre alt. Das war ein sehr schönes, freundliches und gehorsames Kind und hatte einen recht lieben, dem Himmel zugewendeten Sinn, so daß es mit seinem kindischen Verstande die hohen und himmlischen Dinge sehr geschwind faßte und behielt und nichts lieber lesen hörte als die Bibel und nichts geschwinder auswendig
lernte als Lieder aus dem Gesangbuche. Das kleine Christinchen war sonst sehr still und für sich und konnte, wann der Frühling und Sommer da waren, ganze Tage und Wochen im Garten spielen, ohne daß es anderer Gespielen nötig hatte als die Büsche und Blumen und die Vögelein, die in den Zweigen sangen. Mit ihnen lebte, spielte und schwätzelte es, als wären es Menschen gewesen, und kam, sobald die Sonne untergegangen, immer heiter und fröhlich wieder ins Haus, aß ein Butterbrötchen, faltete die Händchen zum Gebet und schlief dann ein.Nun geschah es, daß das Kind einmal, als es nach seiner Gewohnheit des Abends in die Stube trat, etwas in seinem Schürzchen trug. Sie hielt aber das Schürzchen zu, daß niemand wissen konnte, was sie darin hatte. Und sie ließ Schwestern und Brüder raten, was sie wohl wohl hätte, und die konnten es nicht raten; und sie fragte die Mutter, und die riet es auch nicht. Und als Christinchen lange so rundgefragt hatte, und zuletzt keiner mehr antworten noch raten wollte, rief sie voll Ungeduld: »Nun, so will ich mein Rätsel ausschütten - und da seht!«Und aus ihrer Schürze fiel ein kleines, schneeweißes Küchlein, das sehr schön war und ein niedliches, buntes Büschelchen auf dem Kopf hatte. Und die Mutter verwunderte sich und fragte, woher sie das Küchlein habe. Und Christine antwortete: »Ich weiß nicht, wo das Küchlein hergekommen ist. Es kam im Garten zu mir und hüpfte auf meinen Schoß und hat den ganzen Nachmittag mit mir gespielt; und als ich weggehen wollte, ist es mir nachgelaufen, und da habe ich's in meine Schürze genommen und mitgebracht, denn es wäre wohl jämmerlich, wenn es die Nacht draußen sitzen und frieren sollte, auch könnte ein Wiesel oder Iltis kommen und fressen es auf. Darum, du liebes, liebstes, schneeweißes Küchlein, hab' ich dich mitgenommen!« Und mit diesen Worten nahm sie es wieder vom Boden auf und herzte und küssete es und legte es an ihr Herz. »Und nun sei nur nicht bange! Du sollst es recht gut bei mir haben und die Nacht bei mir schlafen, und wir wollen einander nichts zuleide tun.« Die Mutter aber glaubte ihr nicht recht, als sie das er-
zählte, und meinte, sie müsse das Küchlein wohl irgendwo bei einem Nachbarn aufgegriffen haben, und sie bedeutete Christinchen recht ernstlich, sie solle ihr die reine Wahrheit sagen, wie sie zu dem Küchlein gekommen sei. Aber das Kind blieb bei seiner Aussage und spielte und tändelte mit dem Küchlein; und als sie zu Bett ging, legte sie es auf ihre Brust, und das Küchlein breitete seine Flügelchen aus, als wolle es Christinchen damit zudecken und wärmen, und schlief die ganze Nacht auf ihrer Brust.Und den andern Morgen schickte die Weberin herum bei allen Nachbarn im ganzen Dorfe und ließ umfragen, ob jemand ein schneeweißes Hühnchen mit einem bunten Käppchen verloren hätte. Und die ließen ihr sagen, schneeweiße Hühner und Küchlein hätten sie gar nicht, auch sei keinem ein Küchlein verlorengegangen. Als diese Botschaft zurückkam, hüpfte und jubelte das Kind vor Freuden, daß es sein schneeweißes Küchlein behalten sollte; und die Mutter hatte noch viel größere Freude, denn sie hatte eine rechte Herzensangst gehabt, Christinchen möge das Küchlein irgendwo weggenommen und ihr gar was vorgelogen haben.
Und zwischen den beiden, dem kleinen Mädchen und dem weißen Küchlein, ward eine solche Freundschaft, daß es fast zuviel war, so daß die kleine Dirne nirgend sein konnte, ohne daß das Küchlein mit ihr war, und daß sie nicht einmal so gern als sonst mit der Mutter in die Kirche gehn mochte, weil Schneeweißchen - so nannte sie das Küchlein - dann zu Hause bleiben mußte. Und auch das kleine Schneeweißchen hatte eine unglückliche Zeit, wann Christinchen ihm fehlte, und lief dann unruhig umher und piepte und suchte, als wäre ihm sein Glück weg, und hätte sich oft beinahe die Seele ausgepiept. Sobald es aber Christinchen wiederkommen sah, drehte es sich vor Freuden auf seinen goldgelben Beinchen herum und flackete und flackete fort und fort mit seinen Flügeln. Gewöhnlich aber waren die beiden beisammen im Garten, wo Christinchen saß und las oder strickte oder auch die Blumen begießen und Unkraut ausjäten mußte. In diesem Garten stand ein altriger Birnbaum, worunter ein
großer, breiter Stein lag. Auf dem Stein saß Christinchen nun immer, weil Schneeweißchen sich immer unten an dem Stein hinlegte und in der Erde kratzte und seine kleinen Flügel und Federn mit Staub bewarf. Da konnte man sie immer finden, und die Mutter schalt Christinchen wohl oft, daß sie fast gar nicht mehr auf ihrer grünen Rasenbank saß, die ihr Bruder, ein junger Weberknapp', ihr gemacht hatte. Sie antwortete dann, die Stelle möge Schneeweißchen nicht leiden; wann sie in den Garten gehen, wolle es immer zu dem Stein, und da müsse sie wohl mit, denn wo Schneeweißchen sei, da müsse sie auch sein.So lebten die beiden miteinander den ganzen Frühling und Sommer als die schönsten Freunde, und Schneeweißchen hatte nichts weiter bedurft als ein paar Brotkrümchen, die Christinchen ihm immer von seinem Brötchen abgegeben; und es hatte auch sie nicht einmal bedurft, denn draußen war im Sommer für ein Hühnchen die Hülle und Fülle zu essen und aufzupicken. Als nun aber der Herbst kam und kein Blatt mehr auf den Bäumen war und der Winter anfing, den Vögeln die Körner zu verschneien, da mußten die beiden kleinen Freunde auch in die Stube ziehen und kamen in große Not.
Die Mutter nahm nämlich einen Morgen das kleine Mädchen vor und sagte zu ihr: »Mein liebes Christinchen, du bist ein gehorsames, frommes Kind, und es tut mir darum leid, daß Schneeweißchen von dir muß; aber wir können es nun einmal nicht behalten. Leben will das Hühnchen doch, und Gerste und Brot haben wir nicht übrig. Darum weine nicht und zieh dir deinen neuen Sonntagsrock an und nimm dein Hühnchen untern Arm und bring es deiner Frau Patin, der Frau Pastorin in Rambin. Die wird es um deinetwillen hegen und pflegen, und bei ihr wird es bessere Tage haben als in unserm kleinen Häuschen.« Als Christinchen diese Rede hörte, fing sie an so bitterlich zu schluchzen und zu weinen, daß es der Mutter das Herz hätte brechen mögen, und rief dann: »Nein! Nein! Mutter, ich kann und kann das nicht tun; wenn Schneeweißchen fort muß, mag ich auch nicht länger auf der Welt bleiben und muß sterben. Und
warum wollen wir das niedliche Hühnchen nicht behalten, das nun bald groß wird und uns gewiß viele schöne Eier legt?«Und das Kind weinte so sehr und bat die Mutter so flehentlich, daß diese zuletzt sagte: »Nun denn, in Gottes Namen! Du sollst dein Schneeweißchen behalten, und der liebe Gott mag uns bei unsrer Armut noch wohl so viel geben, daß Schneeweißchen ein paar Krümchen mitessen kann.Und Schneeweißchen lebte nun in der Stube und auf dem Flur und ging nicht einen Augenblick von Christinchen und schlief des Nachts noch immer auf ihrer Brust. Aber das war doch besonders, daß das Hühnchen fast alle Tage in den Garten zu dem Stein lief, wo es sich im Sommer so oft sein kühles Bett in der Erde aufgekratzt hatte. Als aber Weihnachten vorbei war und die Tage länger wurden, da legte Schneeweißchen ihr erstes Ei, und Christinchen brachte es mit großer Freude ihrer Mutter. Und von dem Tage an hat Schneeweißchen jeden Tag ein Ei, zuweilen auch zwei Eier gelegt, sieben Jahre lang, solang es gelebt hat, und ist ein rechter Schatz für das Haus gewesen. Von Christinchen aber ist das Hühnchen nimmer gewichen, und wenn diese, welche nun auch größer ward, jetzt im Walde den Kühen nachgehen oder auf dem Felde arbeiten mußte, Schneeweißchen ging oder flog immer mit; gewöhnlich aber trug Christinchen es auf dem Arm, wie ein Ritter seinen Falken trägt. Und das ganze Dorf verwunderte sich über die beiden und über ihre sonderbare Freundschaft, und die alten Weiber verwunderten sich auch, steckten die Köpfe zusammen und munkelten untereinander, wenn es nicht ein Huhn wäre und sich nicht treten ließe wie andere Hühner und nicht Eier legte, die ebenso aussehen und schmecken als andre Eier, so möchte man auf seltsame und wunderliche Gedanken kommen.
Aber wenn Schneeweißchen und Christinchen auch nicht mehr so viel im Garten saßen und spielten als die ersten Jahre, wo sie noch jung und klein waren, Schneeweißchen ging doch recht oft zu dem breiten Stein unter dem alten Birnbaum und kratzte dort, und auch
Christinchen blieb die Stelle immer lieb wegen der Erinnerung des ersten Sommers, wo Schneeweißchen zu ihr gekommen war.Und als Schneeweißchen sieben Jahr alt war und Christinchen fünfzehn Jahr und schon ein großes hübsches Mädchen war, da fing Schneeweißchen an zu piepsen und hatte trübe Augen und ließ die Flügel hängen und gluckste so traurig und mochte gar wenig essen. Und Christinchen war sehr betrübt und streichelte und fütterte das liebe Hühnchen auf das zärtlichste und sorglichste. Aber das half nicht: Schneeweißchen lag eines Morgens tot da, und Christinchen fand es neben dem Stein an der Stelle, wo es zu buddeln und sich sein kühles Sommerlager in der Erde zu kratzen pflegte. Und über diesen Todesfall entstand große Trauer im Hause, und da das Hühnchen nun tot war, fing ein jeder an, sein Stück an dem lieben Schneeweißchen zu loben. Christinchen aber weinte sehr und hielt es in seinem Arm und küßte es vieltausendmal und sagte: »O du liebes, liebes Hühnchen! O du trautes und goldenes Hühnchen! O du mein eignes, eigenstes Hühnchen! Gewiß hattest du ein lieberes und treueres Herz, als viele Menschen haben, und darum sollst du auch schön begraben werden, und die feinsten und hübschesten Blümlein sollen auf deinem Grabe blühen.«Und Christinchen und die Mutter sprachen: »Schneeweißchen soll da schlafen, wo es im Garten immer gesessen und gekratzt und sich selbst seine liebste Stelle ausgesucht hat. Denn es ist billig, daß jeder da schlafe, wo es ihm am besten gefällt.«
Und Mutter und Tochter gingen hin und wollten an dem Stein grade auf der Stelle, wo sie Schneeweißchen tot gefunden hatten, für sie ihr kleines Grab graben. Und als sie ein bißchen gegraben hatten, stieß Christinchen auf etwas Hartes und sprach: »Was ist das, Mutter?« Und die Mutter traf auch mit dem Spaten darauf und räumte die Erde weg. Und sie erblickten ein Kästchen und gruben nun vorsichtig an beiden Seiten die Erde weg und buben das Kästchen heraus, das aus Eichenholz und unten schon angefault war. Und die Mutter hob das Kästchen neugierig auf und fühlte, es war sehr

Was ist aber in dem Kästchen gewesen? Der alte Weber mußte lange arbeiten, bis er es aufbrechen konnte, denn es war sehr fest vernagelt. Und als sie es mit vieler Mühe erbrochen hatten, siehe, da steckte in dem Kästchen noch wieder ein kleineres Kästchen, und das war mit Blech beschlagen und machte dem Alten noch mehr zu schaffen. Aber was ist auch herausgekommen? Die schönsten und blanksten holländischen Dukaten, zehntausend Stück. Man kann sich denken, welch Erstaunen und welche Freude im Hause war, und wie die Leute sich verwunderten und Gott dankten, der ihre Armut auf eine so wunderbare Weise in Reichtum verwandeln wollte. Und die Mutter sagte zu dem Vater: »Nun, Vater, hab' ich nicht recht gehabt? Du hast mich immer ausgelacht, wenn ich dir sagte, es müsse mit Christinchen und Schneeweißchen etwas Besonderes auf sich haben und eine Heimlichkeit, die wir nicht verstehen, dabei sein. Und siehe, nun wird die blanke Heimlichkeit von der Sonne beschienen!« Und als sie sich genug verwundert und gefreut hatten, sagte der Vater zu Christinchen: »Eigentlich, mein liebes Christinchen, ist dies alles dein, und Schneeweißchen ist als ein unbekannter und seltener Gast zu dir gekommen und hat sieben Jahre bei dir gewohnt, damit sie dir deinen Brautschatz wiese; und du hast ja auch den Schatz gefunden und zuerst gesprochen: Schneeweißchen muß an der Stelle begraben werden, wo es gestorben ist und wo es bei seinem Leben immer so gern saß. Und nun, Christinchen, bist du ein reiches Mädchen, und kein Graf ist zu gut, sich mit den zehntausend
Dukaten zu vermählen.« Christinchen aber sagte: »Was sprecht Ihr da, Vater? Es soll uns allen gehören, und ich will haben, daß Ihr und die Mutter und die Geschwister jedes seinen gleichen Teil davon bekommen sollen.« Und so ist es auch geschehen, denn Christinchen hat es durchaus so gewollt; und sie war nun doch reich genug.Und die frommen Leute haben fest geglaubt, Schneeweißchen sei ein lieblicher, unschuldiger Geist oder gar ein von Gott gesandtes, weißes Engelchen vom Himmel gewesen, das Christinchens Jugend behüten und bewahren und sie alle glücklich machen sollte. Und es hat auch fast so ausgesehen. In den vorigen Zeiten, worüber wir jetzt lachen, haben sich viele solche Geschichten begeben, wovon die alten Leute in meiner Kindheit noch zu sagen wußten; nun aber hört man dergleichen gar nicht mehr, und keiner erlebt es, und das kommt wohl daher, weil sie nicht mehr daran glauben.
Witt Düweken
Vör veelen, veelen Jahren lewde een Eddelmann, dat was een fram un still Mann, de mehr nah den Stiernen as nah den Hirschen un Hasen keek. Un disse Eddelmann hedd eene hübsche Dochter, dat allerlustigste un nüdlichste Kind van siet un wiet im ganzen Land, un de Dochter het Kathrine. Wie! se äwerst eene sehr witte Hut hedd, dusendmal witter as de witteste Snei un as de Slee, de up dem Durnbusch bloiht, so nömden de Lüde se Witt Düweken. Den Namen mügten se ehr äwerst ook wol! gewen van wegen ehrer anmodigen Lustigkeit un Fründlichkeit; denn een schöner un fründlicher Fräulein is up der Welt nich sehn worden. Dat was äwerst ook eben keene grote Kunst; se kunn woll lustig un fründlich sin.
Denn wie! ehr Vader sehr rik un se sin einziges Döchterken un Kind was, so geschah ehr alles to Froiden, un wat de gode Mann dem
Kinde an den Oogen afsehn kunn, dat dheede un schaffte he ehr. In der Nawerschaft van dissem Eddelmann un sinem Witt Düweken lewde eene Eddelfru, dat was eene olde Bloxbargrüterin un Hex, un de hedd eenen grausam häßlich Sähn, de ungefähr van eenem Older mit Witt Düweken was. Un der olden Hex stack dat schöne Geld un dat prächtige Slott van dem Eddelmann in de Oogen, un se sunn darup, wo se Witt Düweken eenmal för ehren Sähn fangen un hüten künn. Äwerst dat was nicks Lichtes; denn de Eddelmann haßte se as de Pestilenz un hedd er sin Gebeet vörbaden, wie! se wegen heemlicher Künste bi allen Lüden so gar slimm beropen was. Denn he hedd ehr seggen laten: »Kümmst du jemals äwer mine Feldschede, so lat ick di dine Knacken as Bohnenstroh terdöschen, du olde Wäderhex!« Davör gruwde ehr, doch dachte se bi sick: »Mit der Tid werden ook de Apenärschen (Mispeln) riep, un et gelingt di noch wo!!, em sin Witt Düweken, dat Golddüweken, mal aftoluren.« Äwer all ehr Luren un Uppassen wull ehr jümmer nich gelingen; denn Witt Düweken was een gar to fründlich, unschuldig Kind, dat keene Sünd dheed, un de olde Hex kunn ehr nich bikamen. Denn van Sünd edder Hoffahrt, so wat van unchristlicher Vörmätenheit edder Vörwitz is fast jümmer dabi, entweder van den Olden edder van den Kindern sülwst, wenn de Düwel un sine Gesellen Gewalt äwer de Minschen kriegen. Wenn se so wat erlurt hebben, weeten se sick intostellen un fasttosetten un sünt nich lichtlich wedder uttodriwen.Witt Düweken was nu ins egend un föftein Jahr old worden un oihde as eene Roos van Saron, un jümmer kunn de olde Hex dem Kindeken nicks dhon. Un se kreg eene Doodesangst, datt ut der Hochtid mit Witt Düweken un ehrem knorpligen Twig nicks warden mügt; un de Angst wuß noch, as se eenen hübschen jungen Edelmann öfter ehren Hoff vörbi to Witt Düwekens Slott riden sach, van dem et munkelde, he were Witt Düwekens Brüdegam. Un dat mugt ook wo!! so wesen, denn de hübsche Junker was mit dem olden Eddelmann befründet, un he un Witt Düweken mügten sick gern liden;
segt hedden se sick't äwerst noch nich, datt se sick frieen wullen. Nu hedd dc olde Hex eene sehr fine Näs un wüßt bald, wat darunner stack, un lurde Dag un Nacht an dem eenen un dem annern, datt de Hochtid vörpurrt würd un se Witt Düweken ehrem Sähn mit ehren Künsten tospelen künn. So grübelde un lurde se woll een paar Jahr in ehren argen un gierigen Gedanken, un't wull ehr gar nich to Faden lopen. Un de Tid kam würklich, wo't unner den beiden jungen Lüden richtig worden was un de Hochtid sin schuh. Un de olde Eddelmann hedd sin ganz Slott nü afputzen laten un Spellüd un Pipers bestellt un dc ganze grote Nawerschaft beden, man nich dc olde Hex; un't schuh eene prächtige und stolte Hochtid sin. Äwerst o Je, o Je! Witt Düweken hedd eene witte Duwe, dc ehr Brüdgam ehr vör een paar Mand schenkt hedd; un dc Duw was ehr leef als ehre Oogäppel, un se hedd wohl Gott im Himmel äwer dem nüdlichen Vage! vörgäten kunnt. Un dat witte Düwiken wahnde bi ehr in ehrer Stuw un satt up eenem grönen, vörgüldten Boom, den dc Brüdgam mit dem Düwiken schenkt hedd, un att Arten un Brodkromen ut ehrer Hand nippte mit dem Snabel seinen söten Drunk van ehren Lippen und bredede sine Flüchten äwer Witt Düwekens Gesicht, wenn dat leewe Kind siapen wull; un dat Düwiken was so nüdlich un klok, as wenn't cen Minsch west were.Nu kam dc Hochtidsdag, un Witt Düweken schuh van Sülwer un Gold funkeln un van Perlen un Demanten strahlen; un vör Dagsanbruch wurd se upweckt un wegführt in eenen groten Saal, wo viele Fruen un Fräulein un Jungfern weren, dc se anputzen schuhen edder ehren Staat sehn und betrachten wullen. Un Witt Düweken hedd Hart un Kopp su vull, dat se alles vörgäten müßt; un se vörgatt ook chr Düwiken. Und as se anputzt was un bald vör den Prester up den Teppich treden schuh, ging se nochmal in ehre Stuwe, un o weh! ehr Düwiken lag dood da mit utgebreidten Flüchten und rögde sick nich und was vör Dörst vörsmachtet. Un as Witt Düweken dat sach, kunn se sick vör Jammer nich holden un lede sick in ehren heelen Hochtidsstaat bi lütt Düwiken hen un weende bitterlich un jammerde,
als lege ehr Brüdegam vör ehr up der Doodenbaar. Un se müßten dat schöne Kind mit Gewalt von dem dooden Düwiken wegnehmen un den Brüdegam ropen, datt he se tröstede. Denn nu was keene Tid tom Weenen un Klagen: de Prester un alle Hochtidsgäste weren da un se schuhen tosamspraken warden. Witt Düweken stund endlich up un ging trurig mit ehrem Brüdegam un slog sick een Mal äwer dat anner vör de Borst un reep: »O du min wittes un hartensötes Düwiken! So hew ick di vörgäten un so jämmerlich dood dörsten laten!«Un dat Wurt hedd de Bös sick markt, de up allen Stellen lurt, besünders wo't lustig hergeiht un veele Lüde vörsammelt sünt, un hedd sick in der Minut tor olden Hex hen makt un ehr in't Ohr runt: »Hür, Süster, Witt Düweken hett ehre Duwe vörsmachten taten!« Un de olde Düweissüster was nich ful, makte sick to eenem Ketelböter und flog un flog - un ehr man sick et vörsach, was se in dem Saal, wo de beiden jungen Lüte to der Trau stunden, un settede sick as de allerbunteste Smetterling in den Brutkranz, den Witt Düweken up dem Kopp hedd. Un de schöne Sommervagel gaff eenen Glanz van sick, de alle Juwelen äwerlüchtede, un alle Lüde, de et segen, vörwunderden un froiden sick und reepen: »Seht! Seht! Wat für een prächtiger Vage!! De mütt Glück bedüden!«Äwerst de Minsch mit sinen korten Vörstand un vörblendten Oogen weet oft nich, wat he spreckt. De bunte Ketelböter, äwer den un sine Pracht se so frohlockten, meende et ganz anners; he dreef dä oogenblicklich sin düwelsches Spil, un ehr se de Oogen wenden kunnen, was van Witt Düweken ook keene Spur mehr to sehn, un se segen mit Vörstaunen eene witte Duwe, de ut dem Finster flog, un eenen groten Falken, de ehr nahschot; äwerst Witt Düweken söchten ehre Oogen vörgäwes. Un ditt böse Spil geschach in demsülwen Oogenblick, as de Pastor den Mund updhon un seggen wull: »Hans, willst du Greten tor Fru hebben?«Un alle vörfeerden sick gewaltig, und alle Hochtidslust nam een trurig End; twee äwerst weren am trurigsten, de Brutvader un dc junge Brüdegam.
Und de beiden Vägel flögen in de wiede Welt herin. Dat arme Düweken müßt ehre Flüchten recken und spannen, un de grise Faik let sine Feddern dicht achter ehr klingen und gaff ehr keenen Oogenblick Rast, sick up eenen Twig edder een Dack to setten und to vörpusten. Un so jog de Falk se woll twintig Mil wiet van ehres Vaders Hus weg und toletzt in eenen deepen, woisten Wald herin, wo midden drin een Bur wahnde. Da bleef he torügg un settede sick up eene kruse Bök, de achter dem Huse stund; de lütte, arme, witte Duw äwerst flog in der Angst in cen apen Finster herin un fludderte eener lütten Dem in den Schoot. Un dat Kind sprung vör Froid up un rep: »O Moder, seh, wat hew ick Schönes! Dit witte Düweken is mi in den Schoot flagen!«Und ehre Moder, de Burfru, vörwunderde sick und ging hen un strakte dat Düweken un nam't in de Hand und sach, wo dat Dingelken mit dem Snawel jacherde un wo cm dat Hart flog. Un se strakte dat Düweken noch eenmal un sede: »Ach, du armes, lütted Düweken! Gewiß hett di een Hawk jagt, un dat schall di nich gereuen, datt du in unser Hus flagen büst, denn bi uns un van uns schall di nicks to Leeden schehen.« Un se gaff dat Düweken wedder an ehre Dochter, und dat Kind nam dat Düweken in de Hand un küßt' et, und de Moder vörmahnde dat Kind, et schuh dat Düweken nich drücken un cm jo nicks to Leeden dhon. Un de lütte Dem sede: »Moder, wat hewt ji för Sorg? Wo könn ick sonem nüdlichen Dingelken wat to Leeden dhon?«Un dat Kind nam Witt Düweken noch eenmal un küßte et woll veel dusendmal. Un Witt Düweken ging dat Hart up un froide sick, datt et to christlichen Lüden kamen was un nu vör dem grausamen Falken Freden gewunnen hedd. Un se gewen Witt Düweken to eten un to drinken, un Witt Düweken att un drunk düchtig; denn dc lange un bange Flucht hedd se sehr hungrig un dörstig makt.
Ich hew tovören vörtellt, datt van den Hochtidslüden twee am trurigsten weren, de olde Eddelmann un Brutvader un de hübsche Junker un Brüdegam. Un dat kunn wohl nich anners sin. De olde Mann, as de erste Angst un Schrecken äwerstahn was un he sick wedder een
beten vörsunnen hedd, wußte bald, wo de Sak tosam hängde, un nam dat Wurt un sede to dem Brüdegam, de ganz vörbast un vörbistert da stund: »Besinn di, min Jung, un lat di de Mod nich ganz entfallen; alles is noch nich vörlären, un Witt Düweken kann noch eens wedderkamen.« — »Ach Vader, in Ewigkeit nich«, sede de Junker; »wo schuh dat togahn! Dat is nu un jümmer vörbi; ick kriege min Witt Düweken nümmermehr to sehn, ach! in dissem Lewen nümmer, nümmer!«Äwerst de olde Vader schult en as eenen Vörzagten un Kleenmodigen un de an Gotts Allmacht vörtwifelte, un sprack wieder: »Min Bürschlin, dat vörsteihst du nich; ick äwerst seh dör dc heele Sak, wo se sich vörhölt un wo sick ditt begewen hett. Ick segg man so veel, din Schatz lewt noch un is so licht nicht dood to maken, un ick will di disse ganze Jammergeschicht vörkflren un utleggen.Du weetst, hier up dem nächsten Eddelhoff wahnt dc olde Baronin Krumholt, mit der is't nich richtig, un wat alle Lüd ehr nahseggen, is woll wahr flog. Se is van der Blocksbargrüteri, van den swarten Süstern, dc bös Wäder maken, den Höhnern un Gösen dc Feddern up dem Rüggen vörkehren un den Kälwern un Schapen den Dreihhals angrinen. Ditt vörwünschte olde Wif hett sick jümmer so leidig an mi to maken un Fründschaft intoficheln söcht; ick hew mi se äwerst mit Gott van dem Liwe holden, denn ick hedd eenen Gruwel vör ehren fründlichen Oogen, worut Legionen Düwel lachen. Darüm hett se mi üm min Glück beluchst un belurt un sick as dc höllische Ketelböter up unsre Hochtid sett't; un unser Brüdeken hedd ehr dc Macht dato gewen. Denn were din Geschenk, dat witte Diiweken, nich vörgäten un vörschmacht't, dat Undeerd hedd uns nich äwer den Süll kamen dörft. Dc sündliche Vörgätenheit van Witt Düweken is an allem schuld. Äwerst vörzag darum man nich -dat was ja keine Doodsünd - se lewt säker noch, un mi swant, datt wi se mit Gotts Hülp mal wedderkriegen. Un glöw mi, min Sähn, nich ümsüs hew ick Dag un Nacht dc Böker ups lagen un in dc Stiern keken, un will di nu seggen, wat ick dhon will un wat du dhon schast. Dine

Un de beiden hedden Jahr un Dag reist un witte Duwen köfft, un jeder hedd woll teindusend edder twintigdusend tosambröcht, de up veelen Wagen in groten Körwen achter en her fuhren. Damit togen se nu to Hus unwullen se utprowen. Denn de olde Eddelmann, de een sehr klok und wies Mann was und so fin, datt he wo!! dat Gras wassen sehn kunn, sede: »Is unser Witt Düweken dämank, so ward se sick woll to erkennen gewen; denn wenn se ook nich mit Wurden spreken kann, so kann se doch flegen un kurren un annere Teken van sick gewen. Denn de Hexen un Hexenmeister, wenn se ook de Macht to vörwandeln hebben, känen eenen doch nich ganz dumm maken, man müßte denn eene greulich Sünd begahn hebben.« Un se leten sick gewaltig grote Duwenhüser buwen un setteden de witten Duwen darin un forderden all ehre Arten un all ehren Weiten damit up; un weren se nich so stenrike Lüd west, dc Duwenhandel hedd se veelnah wo!! an den Beddelstaff bringen künnt. Un se führden een beel besünnerlich Lewen un weren mehr in dem Duwenhuse as up dem Slott un höllen een ewig Locken, Piepen, Floiten un Kurren mank en un pröwden se up veelfoldige Wis, ob Witt Düweken
ut en herut sick kund dhon wull. Un jedweder hedd sin Stückschen inöwt, wat he sung, un womit he Witt Düweken uttolocken meende.Un de olde Eddelmann sung:
Kurre, min Düweken, kurre! Snurre, min Swänziken, snurre! Kannst du mi noch kennen, Mütt dat Hart di brennen; Ach, min Hart brennt gar to sehr - Kumm, Wit Düweken, büst du hier! |
Witt Düweken! Witt Düweken! Wat best du för'n schön Liweken! |
Wat best för'n hellen Oogenschin! o künn ick, künn ich bi di sin! Witt Düweken! Witt Düweken! Wo büst, min sötes Wiweken? |
Büst du nich hier, wo büst du denn? Büst du nicht hie, o wies mi hen! Witt Düweken! Witt Düweken! o kumm, min wittes Wiweken! Ach, eenen Klang, man eenen Klang! Mi ward de Tid so starwensiang! |
Dc Duwen hedden et veel beter as ehre Herren, de vör luter Hartensunruh des Dags keene Rast un des Nachts keenen Siap hedden. Se eten un drunken nah Hartenslust, paarden sick und lewden in Froiden; äwerst de eene was as de anner, keene wull sick wat Affsünnerlichs marken laten; un se kunnen ook nich anners, denn se weren man Duwen. Damit wurden denn beide oftermalen sehr brüdt. Wenn eene Duwe krank was edder trurig un nahdenklich in der Eck satt un den Kopp hängen let un dc Flüchten nahsleppte, denn steeg in den goden Lüden towielen dc Hoffnung up, dat äwer sine Vörwandlung trurende Witt Düweken künn woll in dissem Bilde steken. Äwer sonne kranke un trurige Duw hebben se oft Weken lang lurt un acht't, ob nicks herutkamen wull; äwerst dc Duwen stürwen entweder edder wurden wedder lustig, und mit all ehrem Kicken und Beluren weren se so klok as tovör.
So vörseten dc beiden ehre Tid in dc Duwenhüsern un segen keenen Minschen in der Welt mehr; alle Lüde äwerst, dc dat hürden, wo se Hab un Gud an dc Duwen setteden, glöwden, se weren narrisch worden vör Gram äwer dat vörswunnene Witt Düweken.
Witt Düweken was nu im Burhuse im dicken Walde un hedd recht gode Dage, so gode, as een vörwandelt Fräulein se hebben kann. Dc Burfru was fründlich un fram un hedd dem Düweken üm alles in der Welt nicks to Leeden dhan, wiel't ehr in der Angst toflagen was un sich in ehren Schutz gewen hedd. Un dc lütte Dem, dc twelf Jahr old was, kunn woll för cen ewen so nüdlich un fründlich Kind gelden, as Witt Düweken in den Jahren west was, un spelde mit Witt Düweken un küßte un trutelde et un drog't up Händen un Schuldern un let et Arten un Brot ut sinem Mund bicken; un wo dc flinke Wicht ging un stund, da müßt sin Witt Düweken mit sin; un wenn se to Bedd ging, settede sick Witt Düweken to ehrem Koppend up't Bedd un keck dem Wicht fründlich in dc Oogen, bet beide inslepen.
Dc olde Hex äwerst lag im Hinderholt un lurde un grieflachte un froide sick, datt ehr alles so woll gelungen was un datt dc beiden Männer as Gecken un Narren unner den Duwen sitten un vörgäwes

Un dat erste Mal is de olde Wäderhex kamen as eene bunte Mus. Witt Düweken satt beel alleen unner dem Awen in der Stuw un kurrde un lockte gar trurig; denn se dachte an ehren Brüdegam. Da kam een lüttes, nüdliches Müsken, so kunterbunt un mit so negenkloken un fründlichen Oogen, womit se Witt Düweken ankeek un goden Dag to seggen scheen. Witt Düweken vörwunderde sick sehr, denn so een schönes, buntes Müsken hedd se all ehr Lewdag nich sehn. Un se fung an mit bunt Müsken to spelen, wiel ehr in ehrer vörlatenen Einsamkeit de Tid oft gar to lang wurd. Äwerst wo vörwunderde se sick, as dat bunte Müsken anfung to piepen! Se piepte so künstlich un lustig, was were se to ehrer Tid bi eenem Kunstpieper in der Lehre west. Un Witt Düweken hürde still un andächtig to; denn dat Müsken peep eene sehr hübsche Wise, binah so as Witt Düweken et oft sungen hedd mit ehrem Brüdegam, as se noch up twee Minschenföten ging.
Un se spelden lang mit eenanner -denn de Kunst vörstahn de olden Hexen, eenen jeden antolocken - un wurden so vörtrolich un heemlich, datt Witt Düweken dem bunten Müsken up den Nacken snaweide un bickte, un datt dat lustige, muntre Müsken Witt Düweken up den Rüggen sprung un sick unner ehren Flüchten inbuddelde, as wull se sick da een warmes Nest bereiden. O wenn dat Düweken wußt hedd, wat för een Ungeziefer ehr so dicht an dat Hart krapen was! As datt nu unner all dem Spil Awend warden wull, hürde de Mus de Stimm van dem Buren, de in den Hoff kam, un peep dem Düweken adjüs to. Un et düchte Witt Düweken, as wenn bunt Müsken, dat in een Muslock krop, ehr gar lising int Ohr peepe: »Witt Düweken, din Schatz is di untru!« Un Witt Düweken hürde den summen Klang den ganzen Awend in ehren Ohren klingen un was sehr trurig un kunn de ganze Nacht nich siapen. Un de Bur un sine Fru un de hübsche Wicht, ehre Dochter, vörwunderden sick, dat Witt Düweken de Nacht keene Rauh hedd un alle Oogenblick de Feddern up sinen Rüggen upstrüwde un mit den Flüchten fludderde; un noch mehr vörwunderden se sick, datt et in der Stuw so stunk, as hedd eener Düwelsdreck achter sich utseit. Denn de olden Hexen mütten jümmer Gestank achter sick laten. Äwerst Witt Düweken markte davan nicks.
Un as een paar Dage üm weren, un Witt Düweken wedder alleen was, kam de olde Hex dat tweete Mal un stund plötzlich as cen blankes un buntes Vägelken bi Witt Düweken un spelde mit Witt Düweken un bickte Kürner up mit ehr un hüppte un twischerde so seelenvörgnögt, datt Witt Düweken recht ehre Froid an dem schönen Vägelken hedd un up eene Wie! vörgatt, wat ehr de vörlednen Dage in den Ohren klungen, un womit dat bunte Müsken se so bedröwt makt hedd. Un as de Vage! ehr dat Hart afwunnen hedd und sach, datt Witt Düweken en för cenen goden, rechtschaffnen Vage! heelt, settede he sick up dat Finster un sung gar fine un leewliche Leeder, datt Witt Düweken vör Froid un Wehmod hedd weenen mügt; denn de Klänge weren van vörgangenen Tiden un düchten ehr wohl bekannt
tosin. Am Ende äwerst -denn de olde Hex wull ehr dat Hart to gliker Tid week un unsäker maken -klung de Gesang wedder van Unglück un Untru, un dat blanke Vägelken sung:o Leed up Leed! O Not up Not! De Leew ist kold, de Tru is dood: Witt Düweken! Witt Düweken! Ut is ut un hen is hen. |
Un Tid kam, un Tid ging, un de olde Hexe sede: »Du best den Grund upluckert un kannst nu anfangen, düchtig drin to wöhlen un Starkeres drin planten.«Un se makte sick wedder up de Beenen un tog den roden Rock van dem Hushahn an, den Witt Düweken woll kennde; denn de beiden eten oft mit eenanner ehr Foder. Un as alle in't Feld gahn weren un Witt Düweken alleen in der Stuw satt, flog de Hahn in't Finster un stund da un lede sine beiden Flüchten tosam un kraihede mit ganz besünnerlicher Stimm, as he süs nich to kraihen plag, un slog denn so mit den Flüchten, as ob he wat Rechtes uttokraihen hedd. Un Witt Düweken müßt to em upkiken, un sick vörstaunen, so vörwunderlich klung em dat ut der Kehl herut. Un de rode Hahn keck se mit groten Oogen an, datt se sick äwer en vörfierde, denn se blinkten un funkelden up eene beel unnatürliche Wis.
Un so satt dc Hahn eene lange Wiele still, man datt he een paarmal de Flüchten gewaltig tosamsiog; un Witt Düweken kunn et nich laten, se müßt jümmer to em upkiken. Un ehr he wegflog, kraihede he wedder, datt et ehr in de Seel schot, as hedd se eenen Pistolenschott kregen. Un ehr Hart was ehr so beklemmd, un se müßt wedder an de Mus un den Vagel denken; doch sprack de true Leew jümmer in ehr: »Un were dc ganze Welt eene einzige Kehle un klünge se di't mit eener Stimm to: Holl di fast, Witt Düweken! Glöw't nich! Et is doch nicht so!« Un dat was ehr to raden, datt ehr trues Hart so in sick sprack; denn hedd et anners in ehr spraken, hedd et seggt »ick glöw't«, so hedde dc olde Wäderhex gröter Gewalt äwer se wunnen, un denn hedd et sehr slimm warden künnt.
Dat olde Düweisstück let se äwerst nich so licht los un kam jümmer wedder un dachte bi sick: »Witt Düweken, wes du tru un stark, as du wist, du schast mi toletzt doch noch wohl wackeln un ick up diner Hochtid noch mit mmcm Sähn danzen!« Un se kam dat vierdemal, Witt Düweken to vörsöken un to begigeln. As alle Lüde ut dem Huse weren, siet se sich herin un tog sick der lütten Burdern Sünndagsrock an un putzte sick recht herut un sach fründlich ut als Sünnenschien, wenn he sick äwer sine bunten Blömken froh. Un se nam dat Düweken, dat jümmer noch trurig un nahdenklich was, up ehren Schot un hedd et leef un spelde so veel damit, as dc lütte Wicht nümmer to spelen vörstund, un herzte un strakte dat Düweken un sach et mit den allerfründlichsten un funklichsten Oogen an. Denn so vörsteiht dc Düwel sick to tieren und to vörstellen, wenn he bedregen will! As se ditt Spil lang nog drewen hedd, fung se an mit Witt Düweken, as dc lütte Wicht bi'm Spelen do dhon plag, un apte ehren Ton un Gebär gar natürlich nah, äwerst veel kloker un listiger, as dc kunn. Un se sede to ehr: »Min lüttes, sötes Tüt Düweken! O du min armes, lüttes Düweken! Wo jammerst du mi! Ick mark wo!! un seh di't woll an, datt du keen Düweken büst, sündern een rikes Eddelmannskind un een vörnehmes Fräulein, dat unner dissen witten Feddern vörborgen is. Äwerst o du leewer Gott! Wer kann di helpen,
wenn du van diner dummen Leewe, de di behext hölt, nich laten wist! Denn darum eben büst du een Witt Düweken worden, datt du dinen bösen Brüdegam nich kriegen un nich de unglücklichste van allen Wiwern warden schust. Denn ick will di't man seggen, he is falsch un untru un unbeständig as de Schum up dem Water un hett di lang vörgäten un herzt all wedder eene ganz annere Brut. Darum wes wis un wend din Hart ook herüm weg van dem Falschen un denk up wat anneres un Beteres; so magst du ut dissem Fedderrock erlöst un wedder een hübsches Fräulein un de Frau van eenem jungen Eddelmann warden, de woll dusendmal schöner un beter is as disse falsche Schelm un flunkernde Voß.«Un as de olde Hex disse Wurde spraken hedd, kunn Witt Düweken et vör Angst nich länger utholden up ehrem Schot un flog weg un zitterde mit den Flüchten. Se flog äwerst mit den Flüchten gegen de lütte Dem, as wenn se seggen wull: »Du lügst, dat is all nich wahr!« Un de lütte Dem siek sick ut de Dör, äwerst Witt Düweken was so trurig, datt se hedd starwen mügt, wenn man vör Trurigkeit jümmer starwen künn, wenn man wull.
De olde Hex äwerst ging un was grimmig, datt Witt Düwekens Hart so fast stund in sinem Glowen, un sede bi sick: »Töw man, Witt Düweken, ick will di woll starker bi'm Kopp faten! Alle mine Künste müßten keenen Penning wert sin, wenn ick so'n jung Ding nich week un wacklig maken künn.« Un se let wedder een paar Weken vörbi gahn, damit Witt Düweken Tid hedd, bi sick äwer alles deeper nahtogrüweln un in ehrer Trurigkeit to sinnen un sick aftoplagen. Un se sede: »Dör dat Grüweln un Sinnen kümmt man in Himmel un Höll; lat se man in den Twiweln grawen, ick will denn woll mit dem groten Spaden kamen, un de Boom, dem de Wörteln löst sünt, mütt störten, he mag willen edder nich.«
Un de olde Hex makte sick torecht as eene wunderschöne Jumfer un tog bunte un sidene Kleeder an un settede sick eenen Kranz van Perlen un Demanten in't Haar un nam eenen witten Stock in de Hand, un so trat se in de Stuwendör, als alle Lüde ut weren un Witt
Düweken in ehrer Eensamkeit trurig achterm Awen satt un kurrde. Un as se herintreden was un Witt Düweken ansichtig wurd, dheed se, as wenn se sick vörwunderde, un sede: »O Gott sei Dank! So find ick di endlich, min leewes Witt Düweken, un bün so lang in der wieden Welt herümwandelt un hew di vörgäwes nahspört un söcht. Un wes lustig un froi di, min sötes Witt Düweken! Denn din Jammer un Leed hett een End, un de Tid is kamen, wo du den Fedderrock uttehn un wedder in minschlicher Gestalt vör den Lüden erschienen schast.«Un se nam Witt Düweken un küßte un strakte se un fründigde sick mit ehr; un dat geföll Witt Düweken woll. Darup sede se wieder: »Gott hett mi to di schickt; ick bün eene van den wisen Frauen, wovan du woll hürt best, de se Feen benömen, un de veele wundersame Künste känen, äwerst idel gode Künste un sonne, wodörch se den Minschen Glück un Segen spreken un bringen. Un ick denk, du weetst dat woll edder best doch so eene Swaning davan, weswegen du in dissen Wold jagt büst un Art un Gestalt best ännern müßt. Dat hebben wie alleen to dinem Glücke dhan, di ut groter Gefahr to redden, damit du mit dem suchten un falschen Junker, den din Vader di tom Brüdegam gewen hedd, nich tosam kamen schust. Denn he ist de untruste un falscheste van allen Minschen, de je mit Schelmerei ümgahn sünt, un hett sin Witt Düweken lang vörgäten un sitt eener annern Brut in dem Schoot. Un du büst sehr dumm, datt du üm den Schelm trurst un weenst; denn he is't nich wert. Wi hebben all eenen annern för di funden, eenen Jungen as eene Seel, ook een junger Eddelmann, ebenso rik, ebenso jung un noch veel schöner. De wahnt upp eenem prächtigen Eddelhoff dicht an dines Vaters Sched un schall din söter Brüdegam sin. An den denk un hew en leef in Gedanken, un sia di den annern Junker Wippupdentwig ut dem Sinn. Wat kikst du mi so an? Wes klok un nick mi ja mit dem Köppigen!« So sprack se mit gar listigen un leidigen Mienen Würden un wull dat unschuldige Kind to eenem bösen Kopp nicken besnaken. Äwerst Witt Düweken kreg wedder de Angst un flog van ehr un wurd bi den letzten Wurden, de de olde Hexe sede, so grimmig, datt se ehr int Gesicht flog un ehr de Oogen ut dem Kopp krassen wull. Denn in ehr klung ook een Wurt, dat ehr toflüsterde: »Witt Düweken, glöw ehr nich, se lügt di wat vör, un din Brüdegam is keen Schelm!« De olde Hex äwerst, as se sach, datt all ehre Kunst nich ansiog, makte sick dävan.Se sunn nu veel hen un her, up wat Wis se dat noch finer anstellen schuh, dat schöne un true Witt Düweken to äwerlisten un't ehrem Sähn totospelen; denn se lüstede un brennde ordentlich nah dem groten Slott un den schönen Häwen un Dörpern des olden Stiernkikers. Denn se was sehr nah Gold un Sülwer ut, as't allen düwelschen Minschen in der Natur is. Toletzt sede se: »Wer nich mit Godem will, de mütt mit Quadern; ick will doch mal sehn, ob son Witt Düweken nich mit Schrecken to bedwingen is. Wi wiin eenmal kamen, as wi sünt, un uns in unsrer natürlichen Macht wisen. Denn ward se woll de Segel stricken un dhon, wat se mütt.« Un as Witt Düweken eenmal wedder alleen was, kam de olde Hex vör dat Burhus un vörwandelde sick in eene große un gefährliche Slang un krop ganz heemlich üm dat Bedd, dat in des Buren Stuwe stund. Un Witt Düweken hedd eene unbeschriewliche Angst un wüßt doch nich, worüm. Dat kam ehr äwerst jümmer so vör, as wenn't ehr torunde un flüsterde: »He is di untru, he is di untru! Vörlat den bösen Schelm man; sünst müßt du starwen.« Un as se so da satt in groter Angst, süh, da fuhr mit eenem Mal eene grote Slang unner dem Bett herut un ringelde sick up der Deele. Witt Düweken äwerst flog in wilder Angst ümher. De gefährliche Slang kunn spreken un zischde ehr to: »Witt Düweken, besinn di doch edder du müßt starwen! Ick bün utschickt, dito währschuwen; wat wist du lütte Narr denken an den, de di längst vörgäten hett? Du weetst, an wen du denken müßt, wenn du klok büst. Witt Düweken! O du armes Witt Düweken, ick mütt di vörslingen, wenn du nich een lüttes, kortes Würtken ja spreckst!« Un de Slang ringelde sick wedder un sach ut gefährlich blitzigen Oogen un steilde sick gewaltig un sprung un snappte umher. Un se dachte bi sick: »Nu ward dat Ding wohl ja seggen, un
denn hebben wi se fast, un unser junger Herr is denn de Brüdegam.« Äwerst Witt Düweken, so doodesangst ehr was, sede doch in sick: »Datis nümmer währ, un he is doch de beste!«Un so kunn se't nich laten, se müßt gegen de Siang flegen un ehr up den Kopp sian. Äwerst nu wurd de Slang giftig un zischde un sprung in der ganzen Stuw herum, veel arger as tovörn, un sprung mit snappender Tung gegen Witt Düweken up. Un ditt Spil durde lang, un as dat arme Düweken so matt was, datt et de Flüchten kum noch in der Luft rühren kunn, ging de Siang toletzt weg.Un de olde Hex was vull Gedanken, äwerst doch sede se to sick sülwst: »Wer fast hölt, behölt doch dat Beste in der Hand!« Un se kam nah cen paar Dagen wedder un makte sick to eenem groten, swarten Kater, to so eenem, worup mennig vörkappter Höhenbrand tom Blocksbarg ritt. Un as Witt Düweken alleen un trurig in der Eck satt un ehr van der Slangenjagd noch de Flüchten weh dheeden, stund plötzlich de Kater vör ehr un krümmde den Rüggen gegen se un makte een paar Kraßföt un sprack denn mit miauender Stimm to ehr: »Witt Düweken, du büst vörlarn, datt du an eenen Mann hölist, de di nich mehr tohürt. Hüt mütt dat tom End gahn, un ick kam as dc letzte Bade, as Angst un Dood to di, dito vörmahnen, an den schönen, jungen Eddelmann to denken, den du wo!! weetst; un dheist du dat, so kümmt alles, wat du vörlaren best, Schönheit un Glück, wedder to di, un du warst in Herrlichkeit und Froiden lewen. Büst du äwerst jümmer noch vörblendt in dinem Eegensinn, so vörnimm, dat din letzter Dag Hüt het; denn unsre Geduld is am End.« Un Witt Düweken slog mit allen Flüchten gegen den swarten Kater und kurrde gewaltig, als wull se seggen: »Furt tor Höll mit di, du swarter Doiwelsbad! Ick lat nich van mmcm Brüdegam.« Un as dc swarte Kater dat sach, fung he recht mit boshafter Katerlist sine Jagd an, sprung in der ganzen Stuw mit dem armen Witt Düweken herüm, ret ehr veele Feddern ut, fung se un let se wedder fähren un makte et so, als wenn dc allergrausamste Henkerknecht eenen armen Sünder to Dood pinigen will. Toletzt äwerst
packte he Witt Düweken fast mit den Klauen un miaude ehr noch mal to: »Segg ne to dinem olden Brüdegam edder starw!« Un dat Düweken strüwde sich ut allen Kräften und sede ja in sinem Harten, un de swarte Kater müßte se fahren laten un sick as een besneider Hund davon maken; denn se to terrieten edder uptofreten hedd he keene Macht.Un de olde Wäderhex vörzagde fast an ehren Künsten un sede: »Wer Doiwel schuh denken, datt et in unsern losen un lichten Tiden noch so true Harten gifft? Un bi so jungen Jahren? Äwerst töw man, Witt Düweken! Töw man! Ick will man kamen, as ick bün; wenn du mi uthöldst, so höldst du de ganze Höll ut, un min Spil mit di is vörlaren.« Un se kam den drüdden Dag in ehrer würklichen Gestalt as dat olde, adliche Hexenwif Frau van Krumholt, wovan Witt Düweken wohl oft hürt hedd, äwerst de se nümmer mit ehren Oogen sehn hedd. Un so trat se in de Dör, as Witt Düweken alleen was, un grüßte se gär fründlich; denn nicks kann mit so fründlicher Leidigkeit ut den Oogen lachen as dc, so den Düwel im Bodden des Hartens hebben. Un Witt Düweken vörschrack sick vör dem olden Wiwe noch mehr, as se vör der Slang un dem Kater bäwert hedd, un dukte sich kurrend in dc Eck. Un dc olde Hex fung toerst an, ehr sanft totospreken un ehr to vörtellen, wo se herkäme, un wer se were, un wat se för eenen schönen un hübschen Jungen, un wo veel Gold un Sülwer se in ihren Kasten, und wo veele Juweelen un Perlen un Demanten se in ehrem Slott hedde. »Un dat alles«, reep se, »min schönes Jümferken, schall din wesen üm een kleenes, lüttes, lüttes Wurt, dat ja het. Segg ne to dinem olden Brüdegam, dc all lang eene annere hett, edder segg ja to mmcm hübschen Gebhard - un dine Feddern fallen di af, un flugs steihst du wedder as dc schönste Fräulein da!« Äwerst as se sach, datt Witt Düweken nich muckste un datt alle schöne Reden an ehr vörlären weren, un datt semit Kopp edder Flüchten keen Teeken van sick gaff, dat ja sede, woll äwerst ärgerlich kurrde, as wull se seggen: »Furt, furt mit di, du Zatan!«, so nam se ehre vulle düwelsche Macht an un blitzte un funkelte so

As se nun sach, datt all ehre Künste an Witt Düweken afgieden un datt se faster as een Fels up ehrem Sinn stund, vörwandelden sick nu alle ehre Gedanken in Grimm un Wut, un dacht se up nicks anners, as wo se dat arme Kind un sin Glück beel un gär vördarwen künn. Se wendede sick nu nah eener annern Sid hen un lurde, ob se dem jungen Eddelmann mit der Witten Duwe nicks anhängen un se beed up eenmal terstüren künn. Lang lurde se cm vörgäwes up; denn in all sinem Unglück was he christlich un gottsfürchtig un dheed noch jümmer nicks anners as witte Duwen köpen un se denn probieren, ob he in en sinen vörlarnen Schatz nich wedder finden künn. So vörgingen twee Jahr, un de olde Hex vörtwiwelde binah, wie! se en nich mal an eenen Fehler faten un so mit cm in't Unglück affähren künn. Äwerst toletzt ertappte se en doch, un dat ging so to:
Dc junge Eddelmann hedd een bunt Hündeken, datnüdlichste Hündeken van der Welt un cm de leewste van allen Hunden, de up drei Beenen gingen. Ditt Hündeken was jümmert bi cm, un dat was keen Wunder; denn et was cen Geschenk van siner Brut, de cm as eene
witte Duwe ut dem Hochtidssaal wegflagen was. Ook was dat Hündeken een sehr klokes Hündeken un kunn mit sinem Herrn so hübsch lewen un ümgahn, as ob et jeden siner Gedanken vörstund. Un doch vörstund et se eenmal nich recht. Denn as sinem Herrn unmodig un düster üm't Hart was un he den lütten Hund, de öfters kam, sick an em to straken, drei-, viermal mit der Hand torüggschawen hedd, kam he doch jümmer wedder un sprung an em heran un wull en leew hebben, so datt de Herr ungeduldig wurd un dem Hündeken eens gaff und et van sick stödd, datt dat arme Deertken gegen den Kachelawen flog un em een paar Tähnen ut dem Mund feelen. Kum was ditt schelm, so kam de Düwel, de jümmer up de minschliche Gebrecklichkeit lurt, to der olden Hex un reep se an: »Süster! Süster! Flink! Flink! Nu best du dat Spil up'm Wagen: de hübsche Junker hett sick vörgahn un sin fründlich Hündeken so van sick smeten, datt cm de Tähnen ut dem Mul flagen sünt.«Un de olde Hex was in eenem Oogenblick dä un krop as een lütt Worin in't Hus, so lütt, so lütt, datt't keen Minsch sehn kunn, un flog dem Junker up den Kopp un makte ehren Pfiff. Un in eenem Nu, un de Junker was in eenen Falken vörwandelt un flog ut dem Finster. Un de olde Hex vörwandelte sick in eenen Adler un jagde den Falken un gaff em cen paar Stöt in den Nacken. Un se jagde en so listig, datt se en in den groten Wald herin jog, wo de Bur wahnde, in dessen Hus Witt Düweken nu so vull Truren satt. Un da let se en in goder Ruh sitten un dacht ehr Deel. He hedd sick äwerst up densülwigen Boom set't, worup de olde Hex flagen was, as se im Falkenkleede Witt Düweken in disse Wüstenei drewen hedd. Un he was so matt un möd van der langen un swinden Flucht un van der Angst vör dem Adler, de en dörch so velle Milen jagt un vörfolgt hedd, datt he de Flüchten hängen let un cm dc Oogen toföllen. De olde Hex äwerst flog nu weg un sede: »Sitt du man un dröm die wat, Dummkopp; morgen schast du eenen Vagel vörtehren, datt di dc Oogen äwergahn schälen!«Denn dat hedd dc olde Zatan sich utrekent, datt de Falk dat witte Düweken da finden un terrieten schuh un to spad marken, wen he terreten hedd. Se wüßt äwerst nich, wat se dheede un wat ehr dat bedüdede.Un den annern Morgen, ehr noch de Dag anbrack, was de olde Hex vör Sünnenupgang wedder da un lurde. Denn se wull ehr Hart ergötzen un tosehn, wo de Faik sinen söten Schatz fangen un upfreten würd. Un as datt hell wurd un de Bur sine Husdör updheede, flog Witt Düweken herut; denn se sach so gern in de erste frische Morgensünn. Un unser Falk, de in der Bök satt un grausam möd äwerst noch veel mehr hungrig was, hürde eene Duw kurren un sach se bald mit ehren witten Feddern up dem Husdack. Un strax dheed he, wat een Falk nich laten kann, un schot up se un grep se und slog ehr dc scharpen Klauen in da Lif, datt de Bloodsdruppen up dc Erd herafspritzten; un so makte he sich bi un verslung se mit rechter Falkenlust. Äwerst as he datt Hart van sinem Wittdüweken inslok, da begaff sick een Wunder, desgliken man nümmer sehn hett, un wovan ook de olde Hex nicks wüßt, de mit grotem Behagen tosach, wo he sin schönes Kind terret un afplückte. Denn kum was dat Duwenhart dör sine Kehl henunner, so stund he in siner lifhaftigen, minschlichen Gestalt wedder da, so as he west was, ehr he dat bunte Hündeken slog, un ut den Bloodsdruppen an der Erd wurd plötzlich dc allerschönste un allerhellste Jungfru, un dat was sine Brut. Un so hedd dat lange Krütz een End. Un dc olde Hex, dc dat nich hindern kunn, sach mit Schrecken, wat ut ehren Künsten herutsprung, un makte, daß se davan kam.
Man kann sick vörstellen, wat ditt för eene Froid un Lust was un watt dc beiden jungen Lüd sick Schönes to vörtellen hedden, un wo veel hundert un dausend Mal se sick in der Froid ümhalsten un küßten. All ditt was achterm Garden des Buren geschehen, un dc lütte Deern hedd se toerst da sehn un ehren Oldern seggt: »Kamt herut un seht, wat da hinner dem Gardentunför cen paar blanke un prächtige Lüd stahn!« Un se weren herutkamen un hedden se lang mit Vörwunderung ansehn, bet dc beeden Vörleewten markten, datt achterm Busch ook noch Lüd wahnen. Un Witt Düweken wurd se
toerst gewahr un sede to ehrem Brüdegam: »Süh! Da is dc Bur un sine Fru un Döchterken, wobi ick so lang lewt hew. Un nu kumm mit; ich will hengahn un mi bi den goden Lüden bedanken, datt se so christlich un fründlich gegen dat arme vörwandelde un vörjagde Düweken west sünt.« Un se gingen to en un böden en goden Morgen, un Witt Düweken vörteilde en de Geschicht van ehrer Vörwandlung, un de Brüdegam vörtelide ook sine Geschichte. Denn as se wedder Minschen wurden, wußten beide alles genau, wo sick datt mit en begewen hedd. Un dc goden Burslüde vörwunderden sick äwer dc Maten un wullen't erst nich glöwen; äwerst toletzt mußten se't woll glöwen an veelen Teken, dc Witt Düweken en sede, datt se würklich ehr Düweken west was, wovan se en dat Blood un dc Feddern achterm Tun wiesen kunn. Un se blewen noch cen paar Dage im Wolde un froiden sick mit den fründlichen Lüden. Den drüdden Morgen äwerst müßt dc Bur sine beiden Perde anspannen, un se setteden sick up den Wagen; un dc Bürin un ehre Dochter müßten sich ook upsetten un mitreisen, denn se schuhen mit up ehrer Hochtid danzen. Un se sünt glücklich dör den groten Wold kamen un den vierden Dag anlangt, wo dc olde Eddelmann unner sinen Duwen satt un noch jümmer nich herutfinden kunn, wat he söchte. Un dc Brüdegam ging to cm up dat Duwenhus un sede: »Glückup! Vader! Ick hew min Witt Düwekenfunden.«Un dc olde Mann sprung vör Froiden up un reep: »Gottlow, datt du dc rechte Duw utfunden best! Un is se noch man Duw edder is se wedder tom Minschen ümschapen?« —»Ja wohl is se«, sede dc Jung, »nu kamt, Vater, un seht!« Un as he dat glückliche Wurd kum spraken hedd, trat Witt Düweken herin un föll ehrem Vater üm den Hals un küßte en un weende cm söte Froidentranen up sin Gesicht.Un dc olde Eddelmann wurd nu grausam froh, un se vörteilden eenanner de Geschichten, dc se erlewt hedden, un lawden un dankten Witt Düweken, datt dör ehren Mod un ehre Tru alles een so schöns End wunnen hedd.
Un nu rüsteden se to der tweeten Hochtid, un as dc Dag da was,
sach man den Olding nich ahne Sorgen, un he sede: »De Stiern hebben mi dissen Morgen wat Dunkles vör de Oogen schawen, dat man up eens henwiesen kann; ick kenn minen saubern Vagel, de uns in so lange un grote Not bröcht hett, un darum, mine leewen, leewsten Kinder, bereidet ju wo!! mit Himmelsgedanken un Gebet un tredet hübsch in christlicher Andacht un mit demödigem Harten heran, damit uns de böse Fiend nicks anhebben kann. Ick äwerst will beter achtgewen as dat erstemal!« Un de jungen Lüde gingen tor Trau un wurden glücklich tosamspraken, un nüms kunn wat Unheemlichs vörmaken. Un des Awends was een lustiger Danz, woto de ganze Nawerschaft laden was, un dat ging munter her; un de Bur un de Bürin un de lütte Dem, de mit Witt Düweken so fründlich speit hedd, weren ook da un wurden als leewe un ehrenwerte Gäste un Fründe holden.Un seht! As't gegen dc Middnacht ging, kunn dc olde Hex sick nich länger holden vör Grimm un Wut, un se vörwandelde sick in eenen dullen Hund un nam dc Gestalt van dem bunten Hündeken an un wull so in den Saal herin, un se dachte bi sick, as den lütten Bunten würden se en wo!! inlaten. Un se kam richtig in den Saal un siek sick tüschen den Dänzers hen un meende dc jungen Lüde to biten un se dör den jämmerlichsten Dood ümtobringen. Äwerst dc olde Mann hedd dc Oogen apen un paßte up. Un as he dat bunte Hündeken so munter herinkamen un sick so lise dör dc danzenden Reigen sliken sach, rührde he't gar swind mit seinem Stock an. Und he hedd sick den Stock gar besünderlich makt. Dc Stock hedd eenen elfenbeinernen Knoop, un dc Knoop mit siner Krück was in Gestalt eenes Krüzes makt, un uterdem wa'st een Krüzdurn. Un as he den Hund kum anrührde, föhlde dc olde Hex oogenblicklich des Krüzes Gewalt un datt se ut dem Hundfell herutspringen un in ihrer wahren unechten Lifhaftigkeit tom Vörschien kamen müßt. Un se kam tom Vörschien, un dc Olding packte se an un grep se bi der Hand und reep: »Juchhe! Lustig upgespelt! Masken, tom Ball! Wellkamen, wellkamen, Fru Nawersche! Kümmt se ook so ungebeden tom
Nachtball un will mit dem olden, grisen Brutvader eenen Sprung maken?« Un he nam se un führde se up, as wull he eenen Dreiher mit ehr maken; se äwerst strüwde sick un wull sick entschuldigen un dachte sick flink wegtosliken. Doch he heelt se fast un sede: »Nu wist du woll Gemack vörstahn! Warum so unwirsch, Fru Baronin Krumholt? Man sacht un geduldig! Du bist fangen, Vage!, un schast uns morgen een beten im Für vörsingen un piepen.« Un he nam se un bund se mit eenem Krüzband mit besonderm Knoten un reep sine Deners, un se nemen de olde Düwelshex un smeten se in eenen deepen Torm un !eden ehr iserne Keden krüzwis üm't Lif, datt se sick mit ehren Künsten nich lösen kunn.Se danzten nu so de Nacht dör un höhen sick lustig; die olde Hex äwerst unner der Erd hedd sware Dröm. Un de olde Eddelmann let een paar Föder drög Holt anführen un got Öl un Pick un Swäwel daräwer un settede de olde Hex darup un let se lichterloh brennen. Un se müßte piepen, as Müse piepen, de in den heten Smoltketel fallen.
Un keenen annern Lut, gär keenen Minschenlut, hett se ut dem Für van sick gewen, äwerst ut de Asch hebben se eenen swarten Rawen flegen sehn; un allen, de dat mit ansehn hebben, is dc Gruwel ankamen.
Un as de Hochtid vörbi was, makte de olde Herr all sine Duwenhüser up un let sine witten Duwen flegen, wohen se wullen; dat weren äwerst mennige Dusende. Un he reep en nah, in de Händ klatschend: »Flegt! Flegt in dc wiede Welt! Wie hebben unser Witt Düweken wedder funden.«
Un dc jungen Lüde beschenkten den Buren un sine Fru riklich leten se wedder to Hus reisen. Dc lütte Burdern äwerst wullen se nich missen; ook wull dat hübsche Kind nümmer weg van Witt Düweken, un Witt Düweken hedd se leef, as were se ehr Swesterken west, un sede: »Di kann ick nich laten un missen un will di to diner Tid den Brutkranz int Haar setten!«
Und man hett noch mennig Jahr van Witt Düweken un ehrer wundersamen
Vörwandlung un Erlösung spraken, un alle Lüde dd herum hebben noch lang den Versch sungen:Witt Düweken! Witt Düweken! Wat best du för'n schön Liweken! Wat büst du för'n tru Wiweken! |
Aschenbrödel
In einem Walde, der von der ganzen weiten Welt abgelegen war, und wo man selten eine andre Stimme hörte als die Stimme der Vögelein, die da sangen, oder als das Girren der Tauben und Brüllen der Hirsche, lag, von allen Menschen ungewußt, zwischen höchsten Bergen ein wunderliebliches Tal, und in dem Tale stand ein kleines, kleines Häuschen, mit Stroh gedeckt und mit hellen Fensterscheiben, und an dem Häuschen war ein Gärtchen, wohl nicht so groß als der Garten Eden, worin Adam und Eva einst gelebt haben, aber gewiß ebenso schön. Das Häuschen war wohl eines der kleinsten Häuser, die jemals gebaut sind, denn es hatte nur zwei ganz kleine Kammern, gerade geräumig genug, daß in jeder ein Bett, ein Stuhl und ein kleines Tischchen stehen konnte. In der einen Kammer wohnte ein alter Mann, dessen Kopf schon schneeweiß war, und in der andern ein kleines Mädchen mit blonden Löckchen und rosenroten Wängelein und mit den hellsten und freundlichsten himmelblauen Augelein. Wie der Mann hieß, das weiß ich nicht, aber das kleine Mädchen hieß Nanthildchen. Diese beiden wohnten ganz allein im Hause. Sie lebten aber ganz verschieden; denn der Mann saß den ganzen Tag in seinem einsamen Kämmerchen und studierte Bücher verborgener Weisheit; das Mädchen aber lief in dem Garten herum und spielte sich von einer Blume zur andern und von einem Vogelnest zum andern. Des Nachts aber, wann das Mägdlein im süßen Schlaf lag, wandelte der Meister in dem Garten und auf der Waldhöhe und betrachtete
den Lauf des gestirnten Himmels; denn er war ein gewaltiger Sternkundiger. Gesprochen, glaube ich, ist in keinem Hause auf Erden weniger als in diesem Hause, denn der Alte war fast immer still und in sich gekehrt und sprach nimmer ein Sterbenswort mit dem Kinde als des Morgens, wo er sie im Katechismus und in Gottes Wort unterwies, und des Abends, wo er vor dem Schlafengehen mit ihr betete. Selten hat er ihr an den langen Winterabenden wohl einmal eine Geschichte erzählt; er hat ihr aber die allerhübschesten Geschicht-und Märchenbücher mit den niedlichsten Bildern geschenkt, worin sie lesen und sich die Zeit vertreiben konnte, wenn der Tag zu kurz war. Aber unendlich lieb hat der Mann das Kind gehabt und das Kind wieder den Mann, welchen es Vater nannte. Er hat es oft stundenlang auf seinem Schoß und an seiner Brust gehegt und es also an seinem Herzen einschlafen lassen; und dann sind ihm wohl die Tränen in die Augen gekommen, und er hat die Hände gefaltet und gebetet, die Augen gen Himmel gehoben und gesprochen: »Allmächtiger, Barmherziger, laß dieses süße Kindlein glücklicher sein, als ich gewesen bin!« Den ganzen Tag aber, solange die Sonne am Himmel stand, spielte das Kind in seinem Garten unter den Blumen und Vögeln, die hier nie aufhörten zu blühen und zu singen. Denn in diesem freundlichen und anmutigen Tale war ein ewiger Frühling und Sommer, und Blüten und Früchte sah man immer nebeneinander. Auch aßen Nanthildchen und ihr Vater nichts anderes als Früchte und Brot und tranken Milch und Wasser dazu.So hatte das Kind in seiner Einfalt und Unschuld fortgespielt und war zwölf Jahre alt geworden unter seinen Blumen und unter den Engelein Gottes, die oft unsichtbar und in der Gestalt von Vögeln und Schmetterlingen um sie scherzten, und war gewiß das allerholdseligste und freundlichste Kind auf Erden. Da hatte sich einmal ein Prinz, und zwar ein königlicher Prinz und der einzige Sohn des Königs, der über die Länder herrschte, auf der Jagd in den Bergen verirrt und war in das heimliche, verborgene Tal hinabgekommen und zu dem Gärtchen, worin das Mägdlein spielte. Und das Kind hatte
sich über den schönen Jüngling gefreut und hatte ihm Lilien und Rosen gebracht, und er hatte sich auch gefreut und das Kind auf seinen Arm genommen und es vieltausendmal geküßt und geherzt. Und darauf, als er die Jagdhörner seiner Begleiter heranblasen gehört, hatte er es freundlich gegrüßt und war weggegangen einen Seitenpfad den steilen Berg hinan und hatte beim Abschiede gerufen: »Spiele fröhlich, Nanthildchen, ich komme bald wieder und bringe dir was Schönes mit!« Und als der Abend gekommen war, hatte Nanthildchen dam Vater alles erzählt, und er hatte den Kopf dazu geschüttelt und bedenklich ausgesehen. Das hatte ihm aber am wenigsten gefallen, daß das Kind, als sie von dem Jüngling erzählte, einmal über das andere ausrief: O er war auch gar zu schön, viel, viel schöner als du, wenn du mich am allerliebsten hast und mir das Liedchen singst:Nanthilde, süßes Röselein, Blüh', blüh' im hellen Sonnenschein! Blüh', blüh', mein süßes Röselein, Geschirmt von Gottes Engelein!« |
Bei diesen letzten Worten des Kindes waren ihm die hellen Tränen in die Augen getreten, was ihm nicht leicht geschah, und er hatte aufstehen und weggehen müssen, damit er dem Kinde die Bewegung seines Herzens verberge.
Und als der dritte Tag nach diesem vergangen war und der vierte kam, da kam auch der schöne Prinz wieder geritten; und er kam diesmal in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit in einem goldnen Kleide mit Knöpfen von Demanten besetzt. Und er hat wohl an die zwei Stunden mit dem süßen Mägdlein in dem Garten gesessen und mit ihr gespielt und sich ihre Blumen und Vogelnester zeigen lassen und sie dann auf den Schoß genommen und ihr allerlei anmutige Geschichten erzählt. Endlich hat er ihr ein blaues, seidenes Kleidchen gegeben und ein feines Goldringelein, in welchem ein Demant funkelte,
und dabei gesprochen: »Behalte das, Nanthildchen, und trag es zu meinem Andenken!« Darauf hat er das Kind auf seinen Arm gehoben und es geküßt und ist weggeritten und hat ihm noch mit den Händen zugewinkt und zugerufen: »Gott behüte ich! Ich komme bald wieder.«Und als die Sonne untergegangen war und das Kind den Abend zu seinem Vater in das Kämmerchen trat, sprach er: »Mein Kind Nanthildchen, was ist dir? Du siehst ja so rot aus, als wenn du eben auf der Schmetterlingsjagd gewesen wärest!«Und sie hat geantwortet: »O er ist wieder dagewesen, der schöne, junge Mann, von welchem ich dir jüngst erzählte; und er war noch viel schöner als damals, und er war so prächtig und hatte Knöpfe an seinem Rock, die wie die Sterne funkelten, und ich habe mit ihm im Garten umherspringen und ihm alle meine schönsten Blumen zeigen und mit ihm spielen müssen; und er ist viel länger geblieben als das erstemal und hat mir noch viel freundlicher gedeucht; und er will auch oft wiederkommen und mit mir spielen, hat er gesagt; und sieh mal, was er mir Schönes geschenkt hat!« Und sie zeigte in heller Freude das seidene Kleid und den goldnen Ring. Und der Alte besah sich das und ward blaß wie der Schnee, als er den Ring umkehrte und die Worte las, die darin geschrieben standen. Aber er schwieg und sagte kein Wort. Als aber das Kind zu Bett gegangen war, trieb es ihn unruhig hinaus, und er schaute in den Sternenhimmel und rief mit großer Bewegung: »O du ewiger Sternenfürst! Noch keinen Frieden? Und ich muß wieder von hinnen und all diese stille Traulichkeit und Lieblichkeit verlassen? Denn auch hier finden mich, die mir nach der Seele stehen. Ja, fort! Fort! Und morgen noch fort, ehe die Sonne über die Berge ins Tal guckt!«
Ich muß aber nun sagen, wer der alte Mann war, dem die weißen Locken schon die Scheitel herabhingen. Er war aus dem Lande der alten Franken von weiland und war der Sohn eines Frankenkönigs, der in der Stadt Metz im Ardenner Wald wohnte. Es hatte sich aber in den Tagen seiner Jugend begeben, daß ein anderer König der
Franken, der in Burgund wohnte, plötzlich seinen Vater überfallen und ihn und alle seine Kinder, Söhne und Töchter, erschlagen hatte bis auf einen einzigen, einen Knaben von zehn Jahren, den ein treuer Diener auf seinem Rücken durch den Ardenner Wald weggetragen und an einen verborgenen Ort geflüchtet hatte. Und dieser junge Knabe war der alte Mann mit den schneeweißen Locken gewesen, der jetzt in den Sternenhimmel schauete. Und er hatte in seiner Jugend viele Abenteuer und Gefahren durchlebt und auch mehrmals um das Reich seines Vaters gestritten; aber es hatte ihm nicht gelingen wollen.Darauf war er ins Morgenland gezogen, ins Gelobte Land, und hatte gegen die Unchristen gekämpft in Syrien, Babylonien und Ägyptenland und hatte dort viele verborgene Weisheit gelernt. Und da war ihm von einer Sultanstochter, die er im Kriege gefangen, getauft und gechristet und darauf sich als Gemahl beigelegt hatte, das einzige Töchterlein, das er hatte, geboren. Als ihm aber jenes sein holdes Weib gestorben war, da hatte es ihm unheimlich gedeucht in Asien, und hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht ihn in seine Heimat zurückgetrieben. Er wollte dort aber in seinem fünfzigsten Jahre nicht mehr um die Königskronen streiten, sondern um die himmlische und unverlierbare Krone, ob er die gewinnen möchte. Und so hatte er sich mit seiner Weisheit und seinen Schätzen wohl zwanzig Meilen abwärts Metz im tiefsten Walde seine stille Heimat gesucht und dort acht Jahre mit seinem Töchterchen gewohnt. Der junge Prinz aber war der Enkel des Königs, der seinen Vater und dessen Geschlecht vertilgt hatte. Und das wußte er wohl.
Er schlief die ganze Nacht nicht, sondern wachte und betete im Freien und auch in dem Kämmerchen über seinem Kinde. Und ehe noch der Tag anbrach und es kaum dämmerte, weckte er Nanthildchen auf und sagte: »Steh auf! Steh auf, mein Kind, und halte hier dein letztes Morgengebet mit mir; denn wir müssen reisen. Jener schöne Jüngling, den du gesehen hast, darf mich nimmer sehen; denn wisse, er ist mein Todfeind und sein ganzes Geschlecht mit
ihm.«Und Nanthildchen hat diese Worte des Vaters mit Erstaunen und Schrecken gehört, und zum erstenmal in ihrem Leben hat sie gezittert. Und der Alte hat sich Träger geschafft, Gott weiß, woher, die ihm seine Bücher und Schätze trugen, und er hat sein Kind an die Hand genommen und einen Feuerbrand an das Häuschen gehalten und dabei gerufen: »Hier wohne nimmermehr ein Sterblicher!« Und so ist das Häuschen hinter ihnen in hellen Flammen auf gegangen und hat ihnen auf ihrem Pfade nachgeleuchtet: Nanthildchen aber hat bitterlich geweint, als auch der liebliche Garten fern hinter ihnen lag. Und so sind sie vier Tage gewandert durch Wald und Gebirg, bis sie in eine Gegend gelangten, die noch viel einsamer und verschlossener war als die, wo sie gewohnt hatten; und da hat der Alte sich wieder ein stilles, verborgenes Tal gesucht und ein Häuschen gebaut und ein Gärtchen angelegt gleich den vorigen. Es ist aber wunderbar gewesen, wie geschwind die Bäume dort gewachsen sind und wie bald der bunteste Blumenflor dort wieder in Blüte geprangt hat, daß einer hätte glauben können, es sei Zauberei dabei gewesen.Der Prinz ist den andern Tag nach ihrer Flucht aus dem Tale wieder den Berg herabgekommen zu der Stelle, wo er das süße und engelhafte Blumenkindlein gefunden, und hat sie indem Garten und unter allen Blumen, in allen Lauben und an allen Quellen gesucht, aber nirgends mehr eine Spur von ihr finden können. Aber als er zu der Stelle gekommen, wo jüngst das Häuschen noch gestanden und wo nun schwarze Kohlen und graue Aschen lagen, ist er in sich gewaltig erschrocken und hat eine Weile so starr dagestanden, als sollte er augenblicklich zu Stein werden. Darauf flogen ihm mancherlei wilde und verworrene Gedanken durch die Seele; der traurige Gedanke aber ist endlich fest darin gesessen, daß Räuber gekommen und sie erschlagen und verbrannt oder auch den Alten erschlagen und das schöne Kindlein mit sich weggeführt hätten; denn das deuchte ihm zuletzt unmöglich, daß an solche Huld und Lieblichkeit ein Mörder die Hand legen könne, und mit dieser Vorstellung tröstete er sich
doch ein wenig. Und er ist lange Zeit in dem Garten traurig auf und ab gegangen und hat jede Blume und jedes Sträuchlein mit einer Träne begossen; denn nun, da sie weg war, fühlte er erst, wie lieb ihm das Kind Nanthilde gewesen. So ist er endlich schmerzensreich nach Hause geritten und hat seinen Gram und seine Sehnsucht nicht bergen können; denn er hatte nur einen Gedanken und ein Leben, und das war Nanthilde und immer Nanthilde.Und der König, sein Vater, ward bestürzt, als er ihn so bleich, stumm und traurig erblickte, und fragte ihn um die Ursache seiner Traurigkeit. Der Prinz aber antwortete ihm: »Mein Herr König und Vater, dein Sohn und Diener hatte im einsamen Waldtale, wo er jagen gegangen war, ein schneeweißes Reh gefunden, das zahm war wie ein Kind und mit dem er scherzen und spielen konnte, und das Reh war seiner Seele lieb geworden - und siehe! Nun sind Räuber gekommen und haben das niedliche Tierchen getötet oder gestohlen. Darum ist mir das Herz so voll Traurigkeit. Und wenn du mich liebhast, sei nun gnädig und erlaube, daß deine Zimmerleute mit mir da hinabziehen und mir ein Häuschen bauen, worin ich zuweilen wohnen und die fröhlichen und unschuldigen Waldvögelein klingen und zwitschern hören kann, wenn mir des Schellengeklingels und Zungengeflüsters, der Schmeichler und Schönsprecher in deinen königlichen Sälen zuviel wird!« Und der alte König lächelte und sprach ja und schickte seine Zimmerleute über das Gebirg hinab, und der Prinz ritt mit ihnen und zeigte ihnen, wo und wie sie ihm das Häuschen bauen sollten. Er wollte aber eben ein solches Häuschen haben, wie er weiland auf der Brandstätte gesehen, und es sollte auch da wieder hingebaut werden. Und sie waren in zwei Tagen fertig mit dem Bau und verwunderten sich des Prinzen, daß seine Herrlichkeit unter einem so niedrigen Dache wohnen wollte.
Und die Leute raunten sich nun mit halber Stimme zu, der Prinz sei närrisch geworden; einige aber gruben tiefer und meinten, er suche die Weisheit und dürfe sich das nur vor seinem Vater, dem König, nicht merken lassen; die Weisheit aber wohne nicht in dem großen
Glanz und Getümmel noch in der Könige Häusern, sondern müsse in der Einsamkeit gesucht und erfleht werden. Und der Prinz wohnte hinfort fast immer im Walde und kam selten in die Städte und auf die königlichen Schlösser. Jäger war er auch nicht mehr, und die Hirsche und Rehe mochten ruhig um ihn spielen und die Auerhähne locken und die Tauben girren und die kleinen Nachtigallen, Finken und Zeisige singen -kein Hund und kein Hifthorn und kein rasselndes Geschoß störte den stillen Frieden dieser verborgenen Waldgründe. Prinz Hilderich war nun ein fleißiger und frommer Gärtner geworden, der Unkraut von den Beeten jätete und Bäume und Blumen pflanzte und begoß. Denn die Bäume und Blumen standen und blüheten noch wie vormals, und da wähnte das sehnsüchtige Herz die Füße und Hände der geliebten Kleinen wieder zu berühren. Wenn er aber von der Arbeit ermüdet war, dann ist er gesessen, wo er mit dem holdseligen Kinde gespielt hatte, und an der Stelle gestanden, wo er sie zuerst am Zaun stehend gefunden und wo sie ihm ein Sträußchen von Rosen und Lilien gereicht hatte. Da ist der arme Prinz oft stundenlang gestanden und hat in Sehnsucht bergan geschaut, den Pfad hinauf, welchen er in glücklichen Tagen heruntergekommen war, und hat in seiner Sehnsucht den Tag und die Sonne vergessen, und der Mond und die Sterne sind oft aufgegangen, ohne daß er gewußt, es sei anders am Tage.Armer Prinz, wie würdest du dich gefreut haben, wenn deine Augen hätten in das Gärtchen hinüberreichen können, wo deine Nanthilde jetzt wohnte, zwanzig Meilen weiter, und wo sie ebenso stand wie du und mit den Sternen kosete und mit sehnsüchtigen Augen die hohen Berge hinanschaute und seufzete: »O mein altes, süßes Gärtchen! Wo bist du geblieben? Wo ist er geblieben? —Und er soll des Vaters Todfeind sein und kann doch mein Todfeind nicht sein -wie ist das doch? Nein, das ist er nicht, ein Bösewicht ist er nicht, gewiß, das ist er nicht; und der Vater irrt sich sicherlich und weiß nicht, wen er meint. O wenn er nur hier wäre und der Vater könnte ihn sehen! Dann würde es wohl klarwerden.«
So saß der einsame Prinz hier in seinem Gärtchen und verlebte seine traurigen und auch wieder seligen Tage in Sehnsucht und Schwärmerei und ward ein ganz anderer Mensch, als er vorher gewesen. Der mutige, feurige und rüstige Jüngling, der er sonst war, der Ringer, Jäger und Reiter war gar nicht mehr in ihm zu erkennen. Auch fing die Stärke seines Leibes und die Schönheit seiner Gestalt an zu verfallen, so daß der König, der nur diesen einzigen Sohn hatte, sehr traurig war und mit seinen Freunden ratschlagte, wie er ihn dem unwürdigen Müßiggange und der leeren und nichtigen Träumerei entrisse. Es lebte nun an seinem Hofe ein weiser Mann, des Königs Freund und auch des Prinzen Freund; der ging einmal zum Könige und sprach zu ihm: »Herr König, ich wette, diese Krankheit, die dir so schlimm deucht, ist von sehr natürlicher Art und noch heilbar. Wenn ich die Menschen kenne, so hat der Prinz irgendein Bild im Traum gesehen oder sich aus Sonnenschein und Morgenrot eins gewoben und in dem Blumengarten seines jungen Herzens gehegt, oder ihm ist auch irgendwo leibhaftig das junge weiße Reh erschienen, von welchem er dir verblümt gesprochen; und das ist die Krankheit und Sehnsucht und das einsiedlerische Gärtchen und Häuschen im Walde, die einem königlichen Jüngling von achtzehn Jahren freilich nicht wohlstehen. Und gegen ein solches Übel weiß ich kein anderes Mittel als: Er muß die Stätte ändern. Darum, Herr König, laß ihn in die Welt reisen auf Ritterschaft und mich mit ihm, und ich will sehen, ob ich Freude und Heldentum neu in seiner Brust entzünden und ihn wieder gesund machen kann. Vielleicht auch, wenn die mannigfaltigsten Bilder des Lebens seine Jugend umspielen und umflattern wie bunte Vögel den Frühling, daß jenes zu feste Bild dann aus seiner Seele weicht oder doch in milderen und helleren Farben darin spielt.«
Und die Rede des weisen Reginfrid - so hieß der Rat und Freund des Königs -gefiel dem alten Könige wohl, und er hieß ihn sogleich in den Wald reiten und den Prinzen an den Hof bringen. Und als sie vor den König traten, sprach er also zum Prinzen: »Mein Sohn,
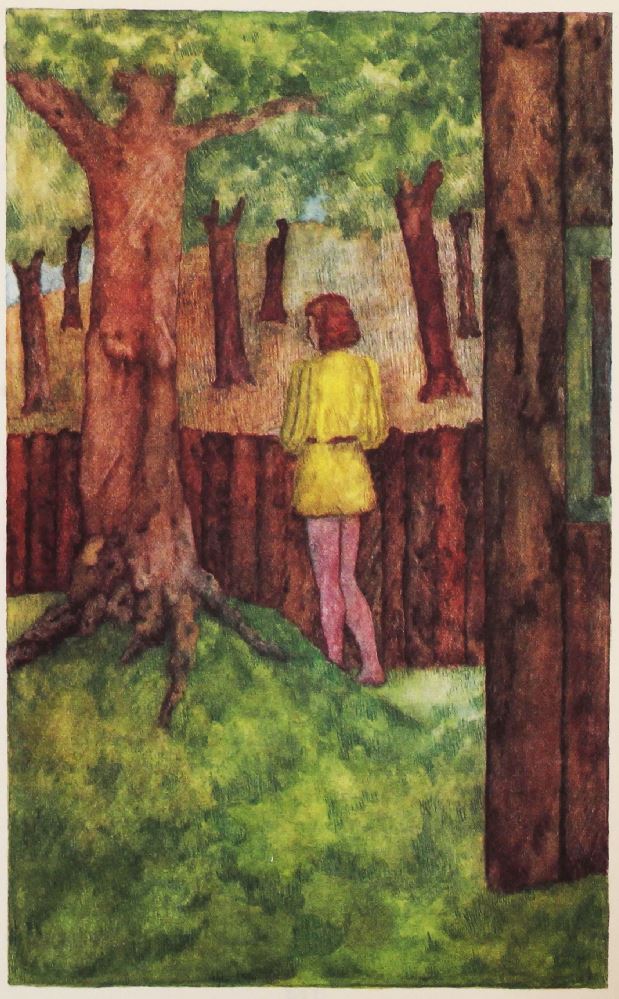
Der alte Reginfrid rüstete und bereitete alles und ritt den vierten Tag mit dem Prinzen aus dem Schloßhofe. Und sie ritten über Ströme und Berge, und nach drei Wochen kamen sie in das Land des Königs von Hispanien. Und Reginfrid hielt nirgends an, sondern trieb die Reise immer weiter bis in den äußersten Süden und Osten. Denn weil er des Prinzen Sehnsucht kannte, wollte er ihn gern bis ans Ende der Welt bringen, damit die Heimkehr nicht zu geschwind sein könnte. Und sie kamen nach Lissabon am äußersten Westmeer und mieteten dort ein Schiff nach Joppe, und von Joppe ritten sie zur heiligen Stadt Jerusalem hinauf und von da nach Damaskus und Babylon und so weiter durch die Grenzen der Perser bis nach Indien und in das Land der Chinesen. Und sie hatten manche Abenteuer zu Wasser und zu Lande erlebt, und der Prinz hatte in Kämpfen mit Riesen und Drachen und in Erlösung gefangener und bezauberter Prinzessinnen seinen ritterlichen Mut und sein königliches Herz stattlich erwiesen; aber keine einzige dieser Prinzessinnen, wie jung und schön sie auch waren, hat ihm dieses sein Herz auch nur mit einem leichten und zarten Hauch der Lust anwehen, geschweige
durchwehen können; das heißt: Eigentlich frisch und froh ist er nimmer geworden, auch hat er nimmer von der süßen Krankheit sprechen wollen, die ihm die Brust zernagte, wie oft und wie stark der Ritter auch an diese verschlossene Brust klopfte. Aber der kluge und weise Reginfrid gab acht auf ihn und auf all sein Tun wie der Falke auf die Tauben, die er fangen will, und er blieb fest bei dem Glauben, daß Hilderich von Liebe krank sei. »Denn«, sprach er, »wie viele liebliche und duftige Blumen der Schönheit haben wir gesehen! Wie viele holdselige und adligste Prinzessinen und Kaiserund Königstöchter haben wir aus Türmen und Zauberschlössern erlöst! Und sie haben sich mit all ihrer Lieblichkeit und Schönheit dem Heldenjüngling ans Herz legen wollen, und er ist kalt geblieben wie der Schnee, der über Felsen hinweht. Nein, das wäre unnatürlich und unmenschlich, wenn es nicht Liebe wäre.«Zwei Jahre hatte der Prinz dies herumirrende, abenteuernde Leben ertragen und alle Qualen der Sehnsucht nach der geliebten Heimat, woher ihm das leuchtende Bild seiner Jugend entgegenfunkelte und in immer hellerer Schöne vor seinen Blicken aufging. Endlich ward es ihm zu mächtig, und er ward so krank, daß sein weiser Begleiter fürchtete, er werde ihn in der Fremde und bei den Heiden begraben müssen. Als er ihn nun so todes bleich und elend sah, ist er eines Tages vor ihm auf die Knie gefallen, hat ihm die Hand genommen und mit Küssen bedeckt und mit tausend heißen Tränen begossen und dann diese Worte gesprochen: »Stirb nicht! O bei dem allmächtigen Gott bitt' ich dich -lieber Hilderich, stirb mir nur hier nicht! O ich kenne deine Krankheit und muß und will sie heilen. Wenn du liebst —und ich fühle und weiß, du liebst -, so liebe auch die Hoffnung! Denn ohne die grüne Hoffnung ist die schönste Liebe welk. Sei jung und mutig, wie du ein Jüngling bist! Liebe und hoffe, und hoffe und liebe! Denn wie dunkel es dich auch dünke, es kann ja mit Gott noch alles lichter Sonnenschein werden.«Und der Prinz erstaunte ob der Rede des Mannes, und sie hatte ihn so weich gefunden und gemacht, daß er endlich sein süßes und schmerzliches Geheimnis gebeichtet
hat. Und Reginfrid war froh und sagte: »Geliebter Prinz, glaube und vertraue, Gott ist mit in diesem wundersamen Spiel. Gewiß, das süße Kind lebt, so grausam hat der Himmel nicht mit dir spielen wollen; du wirst sie wiederfinden, und alles Leid wird Freude werden.« Und er hauchte dem Kranken so viel Hoffnung und Mut in die Brust, daß er von Stund an gesund ward und in wenigen Tagen wieder zu Roß saß.Jetzt aber legten sie der Rückreise scharfe Sporen an, und es ging wie auf Windesflügeln ohne Rast und Ruh aus dem Morgenland immer gen Westen, und der Prinz hätte den Vogel Greif der Wüste Kobi haben mögen, um recht geschwind zur Stelle zu sein, wohin seine Sehnsucht spornte. Da, als sie des Weges ritten in Persien am Kaspischen Meer hin und Hilderich einmal unter grünen Bäumen und blühenden Rosensträuchen ein ländliches Gärtchen und Häuschen sah und ein kleines Mädchen mit blonden Locken, welches die Blumen begoß, sprach er: »So ungefähr war es dort in meinem stillen Bergtale, und solche goldne Locken trug mein Nanthildchen und solche weiße, linnene Kleider! Aber weh mir, denn nimmer wird der stolze König, mein Vater, mir die Tochter eines Gärtners zum Gemahl geben.« —»Er wird es, weil er muß, wenn sein Sohn leben soll«, sprach Reginfrid. »Und warum sollte eines armen Mannes Kind nicht Königin sein können? Hast du nicht die schöne Geschichte gehört von dem Könige in England, der eines armen Schäfers Kind aus einem Adlerneste herunterholte, und das Kind ward so wunderschön, daß er es seinem Sohne zur Frau gab? Gott, der größte und künstlichste Meister, macht oft die herrlichsten Menschenkunstwerke in den Hütten der Hirten und Bauern und läßt die weisesten und tapfersten Kaiser und Könige, wenn er will, zuweilen Weichlinge und Ungeheuer zeugen. Und ist dein Nanthildchen die holdseligste und unschuldigste aller Jungfrauen im Lande, wie sollten wir vor ihr nicht gern als vor unserer Königin knien? Darum mutig und fröhlich in Hoffnung weiter!«
So hat Reginfrid den Prinzen getröstet und frischen Lebensmut und
Liebesmut in seiner Brust angeblasen, und sie sind immer gegen Westen geritten, bis sie wieder zum Lande der Franken und zur lieben Heimat gelangten.Und der alte Mann und seine Tochter hatten ein Jahr still in ihrem Tale gewohnt, und Nanthildchen hatte jeden Tag vergebens über den Gartenzaun geguckt, daß ein freundlicher Mann zu Pferde kommen und sie grüßen sollte; aber er war nimmer gekommen. Es kam aber etwas anderes, das nicht so lieb war, in ihr Häuschen, nämlich eine Frau mit zwei Töchtern. Diese brachte ihr Vater einen Tag mit, und sie blieben da, und er befahl Nanthilden, sie solle die Frau Mutter und die beiden Töchter Schwestern nennen, und sie tat das. Aber die Frau hatte kein Mutterherz, und ihre Töchter hatten kein Schwesterherz zu Nanthilden, und das fühlte sie wohl und hielt sich deswegen allein zu ihrem Vater. Wie und warum die nun dahin gekommen sind, das weiß ich nicht; genug, der Alte hat sie eines Abends mitgebracht und hat die Frau seine Frau genannt. Die Leute aber sagen, es war nicht seine Frau, sondern die Frau eines Ritters, der vormals im Morgenlande mit ihm gewesen war, und weil dieser sein Freund nun gestorben war, so nahm er die Witib und ihre Töchter mit in sein Haus und kleidete sie in köstliche Kleider und hängte ihnen goldne Ringe und Spangen um und gab ihnen alles, was ihr Herz nur begehren konnte; denn er war sehr reich. Aber auch er war am meisten mit seiner Tochter Nanthilde und nahm sie jetzt manche Nächte mit unter den Sternenhimmel und lehrte ihr die verborgene himmlische Weisheit und was Gott und der Heiland den Heiligen und Frommen in stillen Stunden von oben zuflüstern und zuwinken. Und Nanthilde war jetzt eine wunderschöne Jungfrau und dabei recht inniglich fromm und freundlich.
Prinz Hilderich und Ritter Reginfrid waren endlich am Ende des dritten Jahres ihrer abenteuernden Ritterschaft zu Hause gekommen, und der alte König hatte sich darüber so gefreut, daß er vor lauter Freuden gestorben war, und so hatte Hilderich nach ihm das Königreich überkommen. Aber er hatte noch ein anderes König-
reich im Herzen, das ihm mehr war als die königliche Krone der Franken und Burgunden, und das ihm Tag und Nacht keine Ruhe ließ, und das war das liebliche Blumenkindchen, das er in dem einsamen Tale gesehen hatte und das ihm wie ein Wunder erschienen und wie ein Wunder verschwunden war. Wieviel und -oft er nun auch auf seinem königlichen Throne sitzen mußte, viel lieber saß er auf der grünen Rasenbank, wo er mit Nanthildchen gesessen und gespielt hatte, und in seinem strohenen Häuschen, wo er sich träumte, daß sie sitzen und mit ihm kosen könnte; und dann seufzete er oft recht schwer: »Ach, was ist die königliche Krone und aller Glanz der Welt gegen den Glanz der Liebe?« Sein redlicher Reginfrid aber tröstete ihn immer mit der Hoffnung und sprach: »Nur immer in den Wald und ins Gebirg, wann Ihr Zeit habt, Herr König! Als Jäger, als Pilger, als Gärtner, als Köhler, als Schäfer und Hirt, kurz in allen Wald- und Feldsgestalten alle Berge und Täler in der Runde zwanzig und dreißig Meilen weit durchwandert und durchspäht, und wir werden unsre Königin endlich wohl finden! Ich für meinen Teil will auch nicht müßig sein und treu suchen helfen.«Das glaubte denn Hilderich so gern und wanderte und ritt alle Berge und Täler rastlos auf und ab und ließ keine Köhlerhütte und kein Hirtenhäuschen und Strohhalmdach, das er fand, unbesucht und unbegrüßt. Und er fand auch Frauen und Mädchen die Hülle und die Fülle, und auch recht feine und liebliche; aber was er suchte, das fand er nicht. So war er eines Tages auch in die wilde Gegend gekommen, wo der alte, weise Mann mit der Frau und ihren Töchtern wohnte. Und es traf sich, daß der Alte mit seiner Tochter auf die höchste Bergspitze geklommen war, damit er die Sonne jenseits auf dem Blachfelde untergehen sähe, und siehe, unsern suchenden König hatte seine Sehnsucht auch hieher geführt - und er sah Nanthilden und staunte vor Schrecken und Wonne. Aber in demselben Augenblick war sie auch weg. Denn der Alte schrie bei dem Anblick des Königs Weh mir! und riß sie wie ein Sturmwind mit sich dahin durch das dichteste Gebüsch hinab. Hilderich stand durch Staunen,
Freude und Schrecken festgebannt, und ehe er sich besinnen konnte, ob sein Gesicht Traum oder Wirklichkeit gewesen, war auch keine Spur des geliebten Bildes mehr da.Es ward Nacht, und der König verlor sich die Nacht im Walde. Er suchte und ließ suchen - keiner fand das Tal, wo der Alte wohnte, und doch, glaube ich, ist vor den Spürenden und Suchenden kein Häslein oder Füchslein in seinem Lager geblieben. Doch war Hilderich glückselig, denn er konnte sich sagen: »Ich habe sie wiedergesehen, und endlich werde ich sie wohl finden und behalten!« Und damit tröstete ihn auch sein treuer Reginfrid. Viele aber haben gesagt, der Alte sei ein Zauberer gewesen, und darum habe niemand sein Häuschen und Gärtchen finden können. Das kann man aber nicht glauben; denn dann hätte er den Prinzen von sich und seiner Tochter doch wohl durch Zauberei wegbringen und fernhalten können.
Der Alte, der aus den Augen des Königs Hilderich geschwinder als der Blitz mit seiner Tochter verschwunden war, hatte sich vor Schrecken und Ärger so erschüttert, daß er hart erkrankte und in wenigen Tagen eine Leiche war. Mit ihm war auch Nanthildens Glück gestorben. Die fremde Frau im Hause mit den beiden Töchtern, welche sie Mutter nannte, hatte sie gar nicht freundlich und mütterlich gemeint, aber sie hatte doch freundliche Gebärden gemacht und sich verstellt und gezwungen, als der alte Herr, den sie fürchtete, noch lebte. Kaum aber hatte er die Augen zugetan, so fuhren in sie und in ihre Töchter sieben Teufel der Bosheit, und sie brachten jetzt an den Tag, was sie sich früher nicht hatten merken lassen dürfen.
Nanthilde, die schöne und unschuldige Nanthilde, das freundliche und sonnenscheinige Kind, das seines Vaters Liebling und Augapfel gewesen war, ward von den drei Greulichen zur gemeinen Küchenmagd, ja zum Aschenbrödel erniedrigt, und es litt alles geduldig und war still und gehorsam, denn sie erinnerte sich der Worte ihres Vaters, die er gesprochen, als die Fremden zuerst in das Haus gekommen waren: »Nanthildchen, dies soll nun deine Mutter sein, und ihr
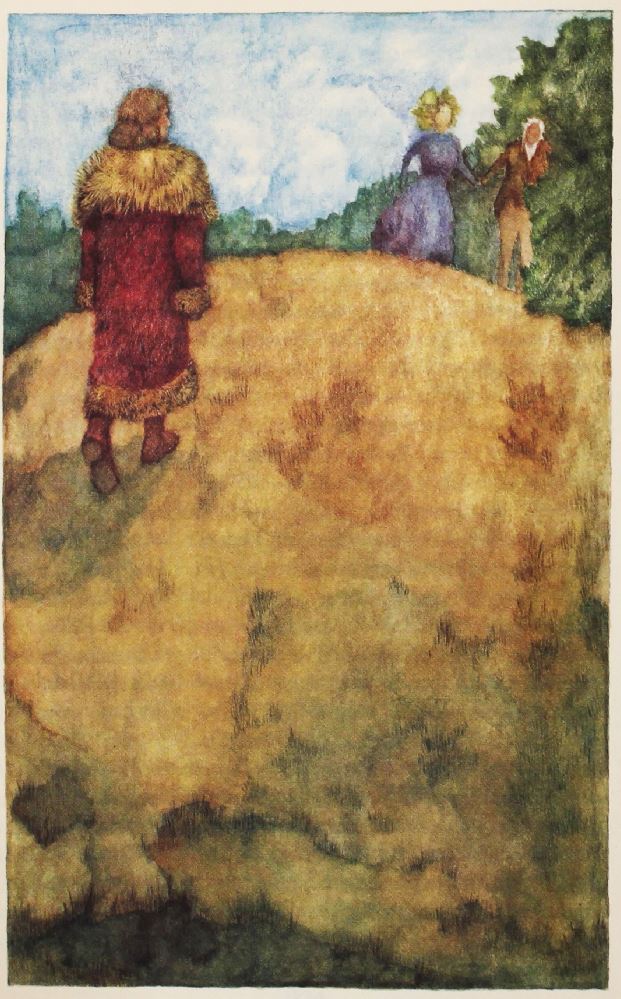
Weil nun die Alte und ihre Töchter auf Nanthilden erzneidisch waren wegen der wunderbaren Lieblichkeit und Schönheit, womit Gott vom Himmel sie begabt hatte, so suchten sie sie auf alle Weise recht häßlich und garstig zu machen, damit sie wegen Schmutzes und Lotterlichkeit von niemand angesehen würde. Sie zogen ihr sogleich ihre schönen Kleider aus und schnitten ihr die langen, blonden Locken ab und plünderten sie von allem ihrem Geschmuck und Geschmeide und gaben ihr schlechte Kleider und Hadern aus dem gröbsten und schwersten Werg und ließen sie Winter und Sommer barfuß gehen, und sie mußte Holz hauen und Wasser tragen und Kessel und Töpfe scheuern und die Ofen heizen und am Feuerherde in der Asche sitzen und liegen; denn auch ihr Stübchen und Bett hatten sie ihr genommen. Und sie sagten frohlockend bei sich: »So wird sie wohl grau und runzlig und häßlich werden und einen breiten und krummen Rücken und dicke und krumme Finger und plumpe und platte Füße bekommen, ja zuletzt viel greulicher werden als unsereins!« Das letzte hätten sie auch sagen können, aber das sagten sie nicht. Der abscheuliche Neid und Haß gegen das fromme und freundliche Unschuldchen glühte aber in ihnen, weil sie selbst erzhäßlich
waren. Und weil dies alles noch nicht genug war und sie immer noch schön blieb gegenüber ihnen wie der Tag gegen der Nacht, ließen sie sie fast hungern und dursten und gaben ihr nur Kleienbrot zu essen, womit die Hunde gefüttert werden, und geboten ihr, sich nimmer zu waschen noch den Schmutz abzutun, sondern Haupt, Gesicht und Hände und Füße mit Asche und Staub zu beschütten und damit begrauen zu lassen, damit kein Aug die helle Rosenfarbe, womit Gott sie geschmückt hatte, sehen könnte. Und das alles tat und litt das liebe Kind geduldig und hieß in dem ganzen Hause bei der Herrschaft und Dienerschaft bald nur der dumme und häßliche Aschenbrödel.Nur einen Trost hatte Nanthildchen, den durfte sie sich aber vor den Bösewichten nicht merken lassen; denn hätten sie ihn gewußt, so hätten sie ihr den auch wohl versperrt. Dieser Trost war die stille Nacht, die fromme und verschwiegene Freundin aller betrübten und zärtlichen Seelen. Wenn alles schlief und auch der schnurrende Kater auf dem Feuerherde seine Augen zugetan hatte, um die tote Mitternacht machte Aschenbrödel sich aus ihrem Schmutze auf, worin sie in der Asche liegen mußte, wusch sich Hände und Gesicht, zog sich ein weißes Hemd an und band sich eine weiße Schürze vor - und leise, leise schlich sie durch den Garten hinaus an den Wald, wo ihr Vater unter einer grünen Buche begraben lag, und weinte und betete auf seinem Grabe und schaute mit Augen der Sehnsucht und Liebe zu den ewigen Sternen hinauf und dachte: Wird er jemals wiederkehren, den dein Vater seinen Todfeind nannte, und der doch gewiß nicht wie ein Todfeind aussieht? Wirst du den schönen Jüngling je wiedersehen, vor welchem du jüngst noch wie ein Blitz wegschießen und verschwinden mußtest? Bei diesem Gange durch die stille Nacht fand sie immer Trost und ward ihr lind und fröhlich ums Herz, und sie meinte, das sei eine Freude von oben, weil sie nach ihres Vaters Gebote so gehorsam war und alle Schmach so geduldig ertrug; und es war auch wohl eine Freude und ein Friede von Gott. Und das war auch wohl eine himmlische Gabe und eine Gnade Gottes, daß sie fast
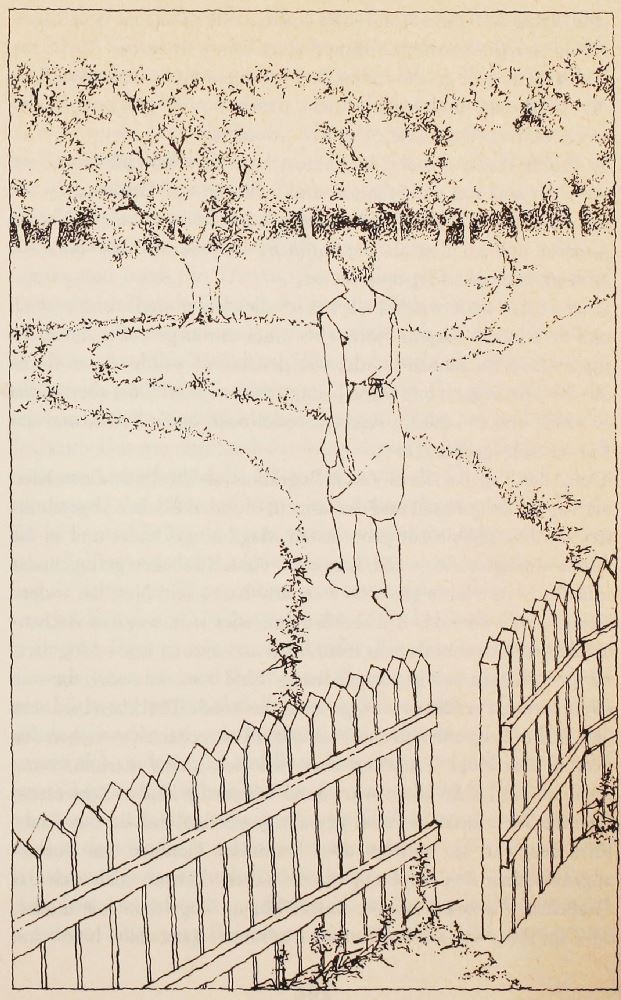
So mußte Aschenbrödel in Schmutz und Knechtschaft leben und ward oft und viel mit Schelten und Schlägen und Backenstreichen gemißhandelt und von jedermänniglich mit keinem andern Namen genannt und gerufen als der häßliche dumme Aschenbrödel. Sie schwieg aber geduldig und dachte:
Gott wird es wohl wissen, warum ich dies leiden muß; und er weiß und tut alles am besten. Hätte aber einer es nur gewußt, der mächtigste Mann im ganzen Lande, wie geschwind würde dieser Glanz aus der Niedrigkeit und Verachtung erhoben sein! Gott aber wußte es wohl, und er schickte Aschenbrödel noch einen Trost, und das war ein sehr großer Trost.
Gleich den Tag nach ihres Vaters Begräbnis, als ihr die schönen Kleider vom Leibe gerissen und die langen, blonden Locken abgeschnitten wurden und sie zur gemeinsten Magd eingekleidet und in die Asche hinabgestoßen ward, kam ein weißes Täubchen geflogen, das sonst nicht im Hause gewesen war, und baute sein Nest bei andern Tauben dicht über der Küchentüre und wies sich, wenn es Aschenbrödel erblickte, immer sehr freundlich und munter und schlug dann mit den Flügeln und girrte gar lustig. Und Aschenbrödel, die nun so einsam und verlassen war, gewann das weiße Täubchen bald sehr lieb, und es entspann sich eine besondere Freundschaft zwischen den beiden. Das kluge Täubchen aber ließ sich nichts merken, wann Aschenbrödel nicht allein war; denn wären die beiden Schwestern oder die Stiefmutter so etwas gewahr geworden, daß ihr das Täubchen lieb war, sie würden dem frommen Tierchen aus Bosheit augenblicklich den Kopf abgerissen haben. Darum hielt sich das Täubchen, das gewiß ein besonders kluges Vögelchen sein mußte, bei Tage unter den andern Tauben fast immer ganz stille. Nur wann
Aschenbrödel draußen allein Holz haute oder Wasser trug oder allein in der Küche stand und an dem Feuerherde wirtschaftete, kam es geflogen und girrte und freuete sich und aß die Brotkrumen und Erbsen, welche Aschenbrödel ihm aufgehoben hatte. Aber des Nachts, sobald Aschenbrödel aus der Türe ging in den Garten oder zu dem Grabe ihres Vaters, gleich war auch das weiße Täubchen da und flog auch nicht von ihr, sondern girrte und schmeichelte und streichelte mit dem Schnabel und mit den Flügeln und saß auf Aschenbrödels Schoße und pickte ihr den Tau von ihren schönen Lippen und trank die Tränen, die aus ihren Augen flossen. Und Aschenbrödel hat das Täubchen über die Maßen liebgewonnen und oft gesagt, indem sie es innig herzte und an sich drückte: »Mein liebes, liebstes weißes Täubchen! Hättest du nicht ein Federkleid an, ich könnte glauben, du wärest ein Engelein Gottes, welches das arme, verlassene Nanthildchen trösten soll. Denn lieb und klug bist du dazu!«Das war aber noch das Besonderste an dem Täubchen, daß es, wann Aschenbrödel die Küche fegen und die Ofen und Zimmer putzen und das Holz auf dem Herd zurechtlegen und die Töpfe, Schüsseln und Teller scheuern mußte, immer mit dabei war und so emsig half, als wäre eine zweite Magd dagewesen. Alle Augenblicke flog sie dann zum Wassereimer und tauchte die beiden Flügel ein, wusch Schüsseln und Teller und säuberte Tische, Bänke und Fenster, ja die Flur fegte sie oft mit den beiden Flügeln rein und brauchte diese gleichsam als zwei Besen, so daß, wenn sie es im Hause klappern hörte und merkte, daß die Leute wach wurden und aufstanden, sie oft ganz schwarz und schmutzig von Aschenbrödel weggeflogen ist und sich an dem nächsten Bach hingesetzt und sich wieder weiß gewaschen hat. Ach, wie mußte der arme Aschenbrödel weinen, wenn er dies sah, wenn er sah, wie das Täubchen sich weiß waschen und auf dem Dache in die Sonne setzen und seine Flüglein trocknen konnte, und er das nicht durfte! Bei keiner Arbeit aber hat das Täubchen dem Aschenbrödel so flink und geschickt geholfen, als wenn er Erbsen, Linsen und Bohnen auszulesen hatte; da hat es mit seinem Schnäbelchen die schwarzen und wurmstichigen auf das geschwindeste wegzupicken verstanden.König Hilderich, nachdem er das engelhafte Bild, das jetzt in einen Aschenbrödel verwandelt war, in der ganzen Gegend ringsum vergebens gesucht hatte, ist endlich auch in dieses verborgenste Tal gekommen. Aber dort hat er kein kleines strohenes Haus mehr gefunden, sondern da stand schon wie durch Zauberkünste in die Luft emporgestiegen ein prächtiges und schimmerndes Schloß. Und als die alte, böse Hexe gehört hat, der König ist da, ist sie mit ihren Töchtern hinausgetreten und hat den Herrn eingeladen. Und sie haben sich alle auf das glänzendste geschmückt gehabt und von den Perlen und Demanten der schönen Sultanstochter gefunkelt. Und der König ist sehr freundlich und gnädig gewesen wie der Könige Art ist; und sie haben bei sich gedacht: Wenn er dich doch zu seiner Königin machte!, denn das Gerücht war umhergeflogen, er ziehe durch Berg und Tal umher und suche sich eine Braut. Und der König, der in den schönen Garten gehen wollte, der ihm fast vorkam wie der Garten, in welchem er seine süße Nanthilde zuerst erblickt hatte, hat auch Aschenbrödel gesehen, der draußen stand und Holzbündel kleinhieb. Und er hat gefragt: »Wer ist das garstige und unglückliche Geschöpf mit den abgeschorenen Haaren und den schmutzigen, zerrissenen Kleidern, das da Holz haut?«Und sie haben geantwortet: Der garstige und dumme Aschenbrödel. Aschenbrödel aber hat ihn sogleich erkannt und seine Worte gehört, und es ist ihr in der Seele gewesen, als sollte sie antworten: »Nein, es ist nicht wahr! Aschenbrödel bin ich nicht, sondern Nanthilde!« Aber sie hat sich gedemütigt und geschwiegen und gedacht: »Der Prinz ist nun der König, und was kümmert der sich um die arme kleine Nanthilde, mit welcher er einst gespielt hat und die nun in so abscheulichem Schmutz vor ihm steht?«Doch in ihrem Herzen hat sie in so bitterm Jammer geweint, daß ein Teufel mit ihr hätte Erbarmen haben können. Denn es war die unschuldigste und süßeste Liebe, die in ihr weinte.
In solchem Suchen war König Hilderich an manchen Ort gekommen, wohin er nicht gewollt hatte, und hatte manches häßliche Gesicht gesehen, welches er nicht verlangt hatte; aber das einzige, was er suchte und was für ihn in der Welt einzig war, konnte er immer noch nicht finden. Es saß ihm aber fest in seinem Herzen, sein Kleinod müsse in dieser Gegend irgendwo verborgen sein, wo es ihm zuletzt wie ein Engel des Himmels plötzlich erschienen und wieder verschwunden war. Nun begab sich eine Kleinigkeit, die sein krankes und sehnsüchtiges Herz in neue Flammen setzte und zu vielen prächtigen Festen und Tänzen Gelegenheit gab. Er fand einmal fast hart an der Stelle, wo er die holdseligste Sonnenuntergangserscheinung gehabt hatte und wo er manchen Abend und manche Nacht in wehmütiger Sehnsucht saß, einen weißen Schuh; und den Schuh hatte das süße Kind da in den Büschen steckenlassen, als ihr Vater sie so geschwind aus des Prinzen Anblick davongerissen. Sogleich bildete er sich ein, der Schuh müsse von ihrem Fuße sein: »Denn welches Weib«, sprach er, »hätte ein Füßchen so fein und zart, daß es in diesen Schuh hineinginge?« Diesen Schuh zeigte er seinem Freunde, dem treuen Ritter Reginfrid, und sagte: »Den Schuh habe ich wohl, aber immer fehlt mir noch der lebendige Fuß dazu, das süße, engelhafte Kind, wonach wir nun so manche Monate jagen. Hilf mir nun mit deinen klugen Gedanken und laß uns sinnen, wie wir diesen Schuh füllen!«Und der alte Ritter rieb sich die Stirn und rollte seine Gedanken wie auf einer Mangel viel auf und ab und hin und her, dann rief er: »Ich hab's! Ich hab's! Und gelingt das nicht, so möchte ich glauben, alle Kunst sei am Ende. Und höre, Herr, was du tun sollst:
Sende Botschafter und Ehrenholde in alle Flecken, Dörfer und Städte ringsum aus und laß es durch die Hoftrompeter ausblasen und durch die Hofzeitung verkündigen und auf alle Kirchen- und Rathaustüren nageln, du werdest glänzende und königliche Freibälle im grünen Walde halten während der schönen Sommerzeit, wo von allen schönen Prinzessinnen und Jungfrauen, die darauf er-
scheinen wollen, kostbare und rechte königliche Ehrenpreise gewonnen werden können: Der höchste Preis aber solle derjenigen zufallen, die einen Fuß aufweisen könne, der in den Schuh passe, der am Eingange des Ballsaales werde ausgehängt sein, der herrlichste Demant in ganz Europa, wohl zehn Millionen Dukaten wert. Laß aber dabei verkünden, es solle bei diesen Festen ganz ein buntes und mannigfaltiges und Sommerleben der Alter, Geschlechter und Farben sein, die fröhliche Gleichheit und Freiheit des Naturlebens, wie Lenz und Sommer sie bringen, und die Tochter des Schäfers so willkommen sein wie die Tochter des Grafen.«Und dieser Vorschlag gefiel dem Könige wohl, und er hatte große Lauben gebaut mitten im Walde und viele tausend Geiger und Pfeifer dazu bestellt und viele Hunderttausende Frauen und Jungfrauen jedes Alters und Standes gesehen, arme und reiche und schöne und häßliche - und alle seine andern Preise war er losgeworden, aber den besten Preis hatte er zu seinem Schmerz immer noch behalten. Denn wie viele Füße hatten in den Schuh treten wollen, aber keiner hatte hineingepaßt! Der König ließ dann nach diesen ersten Versuchen auch einen großen, prächtigen Laubsaal bauen oben auf dem Berge, wo er den Alten und Nanthilden gesehen hatte, und ließ die Wege und Stege dahin bahnen und bereiten. Und der Abend des Festes kam, und hunderttausend Fackeln und Lampen leuchteten durch den Wald bis ins tiefe Tal hinab, und jede Buche und Eiche schien ihren eigenen Mond zu haben, und viele tausend Musikanten spielten auf, so daß die kleinen Waldmusikanten, die Amseln, Drosseln, Finken und Nachtigallen, beschämt aus dem Reviere flohen.
Die alte Hexe und ihre Töchter lebten bei diesem Glanze und Klange gewaltig auf. Sie hatten sich zu diesem Feste die glänzendsten neuen Kleider machen lassen und alle ihre besten Perlen und Juwelen ins Haar und vor die Brust gesteckt; aber wie sehr sie auch blitzten, schön wurden sie dadurch doch nicht, sondern erleuchteten nur ihre Häßlichkeit. Die alte Hexe aber, als sie es von der Bergspitze herab funkeln sah und klingen hörte, schmunzelte bei sich: »Hab' ich es
nicht gedacht? Gewiß, er hat das Aug auf eine meiner Töchter geworfen - und Juchhe! Sei fröhlich, Königin Mutter! Denn warum hätte er seinen Ballsaal grade oben auf dem Berge gebaut, wenn er nicht verblümt sagen wollte: Kommt herauf und leuchtet, ihr Sterne der Schönheit, die ihr unten im Tale verborgen funkelt, und verdunkelt hier oben meine Fackeln und Kerzen?«Und mit diesen stolzen Gedanken setzte sie sich mit ihren beiden Töchtern in den Wagen, und sechs prächtige Schimmel trabten mit ihnen den Berg hinan.Alles war aus dem Schlosse gelaufen, damit es die Herrlichkeit da oben mit ansähe. Aschenbrödel allein war zurückgeblieben -denn die alte Hexe hatte geboten: »Hüte mir das Schloß, Aschenbrödel, und weiche nicht von der Stelle!«Und sie stand traurig in des Hauses Hintertüre und schaute mit wehmütiger Sehnsucht zu dem Glanze und Klange hinauf. Denn das eine Bild, das ihr in ihren Kindertagen an dem Gartenzaun erschienen war, blühete ewig in ihrem zärtlichen Seelchen. Und als sie so einsam und traurig dastand, flog gleich das weiße Täubchen zu ihr hinab und setzte sich auf ihre Schulter und streichelte ihr mit den weichen Flügeln die Wangen und sah ihr so wunderfreundlich in die sehnsüchtigen Augen. Und es war ihr, als redete das Täubchen mit ihr und flüsterte ihr zu: »Was stehst du hier so traurig? Geh doch auch hinauf und schau zu und sieh den geliebten König, den schönsten und ritterlichsten aller Männer! Du kannst dich ja so verkleiden, daß niemand dich kennen kann.« Und Nanthildchen kam große Lust an, und sie ging und suchte, ob sie noch wohl Kleider hätte, wovon die alte Hexe, ihre Stiefmutter, nichts wüßte. Doch wieviel sie umhersuchte, alles hatten die Bösen und Neidischen ihr weggenommen; sie fand nichts Gutes und Nettes und weinte bitterlich. Als sie nun so in traurigen Gedanken einherging und im Gefühl ihres Elends das Köpfchen hangen ließ, leuchtete ihr auf einmal von einem Stuhle etwas Schimmerndes entgegen, und sie erblickte erstaunt das schönste rote Ballkleid und eine Maske dabei und weiße, seidene Strümpfe und Schuhe. Und nun säumte sie nicht lange, fragte auch nicht, wie es dahingekommen,
noch wer es gebracht habe, sondern ging hin, wusch sich, kämmte sich, kleidete sich, spiegelte sich und lief flugs auf geschwindesten Füßen der Liebe den Berg hinan. Und das weiße Täubchen flog mit ihr bis dicht vor den Saal und girrrte und klatschte mit den Flügeln in einem fort, als wollte es sagen Glückauf! Glückauf! Dann flog es ins Tal zurück.Und zitternd und bebend vor Freude und Schüchternheit trat Aschenbrödel in den Saal, wo viele Tausende im buntesten Gewimmel sich durcheinanderdrängten. Sie aber wollte nichts als ihren geliebten König Hilderich sehen; und sie sah ihn viel und freute sich in ihrem Herzen. Aber sie stellte sich immer so, daß er sie nicht sehen konnte. Er aber ging und schaute ringsumher und schaute am meisten immer nach den Füßen; denn er hoffte, aus dem Schuh werde ihm das Glück kommen. Und es ist wahr, Aschenbrödel hatte, als er hereintrat, auch den Schuh besehen und sogleich erkannt, daß es sein verlorener Schuh war, und sich erstaunt und bestürzt, aber auch gefreut, daß der König ihn gefunden und so großen Preis auf seinen Fuß gesetzt hatte. Aber demütig in seinem Herzen ließ es sich nichts merken; denn es sagte: »Was sollte ich mit dem herrlichen Demant, wenn ich ihn auch gewönne? Denn die böse Stiefmutter würde mir ihn gewiß wegnehmen und mich künftig nur desto baß dafür plagen und auch deswegen, weil ich ohne ihre Erlaubnis das Haus verlassen habe.« Endlich aber ist der König Nanthilden gewahr geworden, und da er auf die hohe, schlanke Gestalt geschaut, sind plötzlich alle Leute um sie her vor Ehrfurcht ausgewichen, und er hat nun auch die zartesten aller Füße gesehen und vor Freuden außer sich gerufen: » Welche Füße! Das ist sie! Das ist sie!«Nanthilde aber ist erschrocken und hat sich schnell in den dichtesten Haufen hineingeflüchtet und so in geschwindester Eile aus dem Saale heraus und durch den Wald zu Hause. Der König hat aber in dem ganzen Saal und draußen unter allen Bäumen und in allen Büschen nach der schönen roten Maske gesucht und suchen lassen; aber keiner hatte nur die Spur von ihr gesehen, und sie fanden sie nicht.
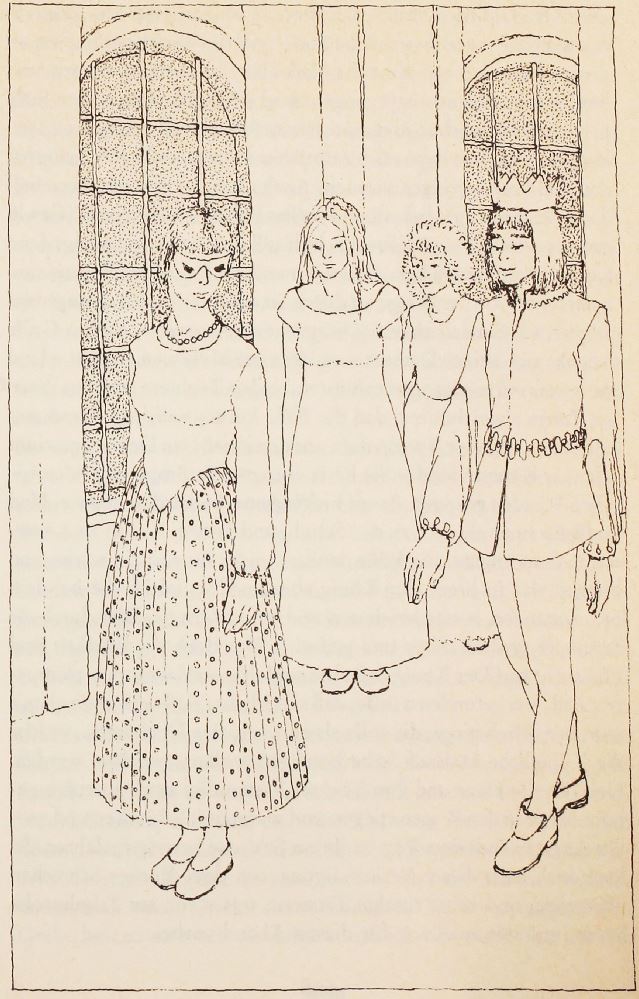
Als es ein Uhr nach Mitternacht war, da ist trompetet und ausgerufen worden: »Jetzt beginnt die Schuhprobe, und der große Demant kann gewonnen werden.« Es sind aber die meisten Frauen und Mädchen beschämt weggegangen, weil sie verzweifelten, ihre Füße in jenen weißen Schuh hineinpressen zu können. Nur einige sind geblieben, und diese haben sich zerquält und zermartelt, aber keine hat den Fuß hineinzwingen können. Auch die alte Hexe mit ihren beiden Töchtern ist geblieben, und sie hat bei sich gesprochen: »Gewiß sucht er eine Braut, und dieser Schuh soll ihm ein Zeichen sein; denn Könige und Prinzen haben oft die wunderlichsten Einfälle und sind nicht selten von der Wiege an durch Sterndeuter und Wahrsager auf dergleichen Sonderlichkeiten hingewiesen. Aus einer bloßen Grille schenkt man keinen Demant weg, der viele Millionen wert ist.«Und sie ist seitwärts gegangen mit ihren beiden Töchtern und hat ihnen die Zehen abgeschnitten, daß die Füße kürzer würden. »Denn was schadet's«, sagte sie, »wenn man nur den kostbaren Demant gewinnt oder gar Königin wird?« Sie hatte aber rote Strümpfe über den frischen Schaden gezogen, damit nichts gemerkt werden könnte. Und endlich kamen sie auch an den Schuh, und wieviel sie ihn auch zerrten und zwängten, die Füße wollten nicht hinein; sie waren und blieben viel zu breit. Der König aber und Reginfrid, die bei dem Schuh standen, hatten bei diesen und bei andern das Blut durch die Strümpfe greinen sehen und gedacht: Was doch die Eitelkeit und Habsucht tut! Der König ließ aber sogleich ausblasen und -trompeten, daß, wer gefunden würde, daß sie sich den Fuß verkürzte, damit er in den Schuh ginge, die solle als eine gemeine Ubeltäterin, welche die Königliche Majestät habe betrügen wollen, gerichtet werden. Und die alte Hexe und ihre Töchter hatten dies noch ausrufen gehört, als sie in den Wagen stiegen und waren mit Schrecken und großer Angst eilends den Weg zu ihrem Schlosse heruntergefahren. Es kam auch nach dieser Verkündigung von dem Könige Schrecken über viele, und keine einzige Tänzerin trat mehr zur Schuhprobe heran, und das Spiel war für diesen Abend vorbei.
Traurig und erschrocken kam die alte Hexe mit ihren Töchtern heim; und Aschenbrödel lag schon wieder in seinem Schmutz und in der Asche, und von der Herrlichkeit des Baues und von der roten Maske war auch keine Spur mehr an ihr. Die Alte aber mußte ihren Töchtern ganz stilichen die Füße verbinden und durfte sich von dem Unglück nichts merken lassen. Und die drei gingen gar betrübt zu Bett und ächzeten und stöhneten jämmerlich wegen der abgeschnittenen Zehen. Als nun alles im Hause still ward und die Lichter sich auslöschten, machte Aschenbrödel sich nach ihrer Gewohnheit auf, wusch sich und zog ihre reinen, linnenen Kleider an und ging, sich auf ihres Vaters Grab unter der Buche setzen.
Ihr war aber außerordentlich unruhig, beklommen und wehmütig um das Herz, doppelt wehmütig, weil oben auf dem Berge noch alle Kerzen und Lampen brannten. O wie viele Kerzen brannten und leuchteten auch in ihr!
Ebenso brannte und leuchtete es auch in dem Könige. Als Trompeten und Saitenspiel schwiegen und der letzte Jubel des Festes in einzelnen matten Tönen zu verhallen begann, ging er, ein nächtlicher Wandrer, unter den Fackeln und Lampen dahin und rief: »O menschliche Jämmerlichkeit und Nichtigkeit! Allen diesen Glanz kann ein Wort von mir entzünden und auslöschen und sich in eitlem Stolz gebärden, als könne er auch Sonnen und Sterne machen - und ach, das einzige Licht kann ich nicht machen, wobei ich die dunkle Unbekannte und doch so Bekannte, die ich nun so lange schon vergebens suche, finden könnte!«
Und er eilte mit fliegenden Schritten voll trauriger Unruhe aus dem Glanze und suchte den Pfad abwärts in den Wald hinein, wo es dunkler war. Und so war er in den Garten gekommen bei Aschenbrödels Schlosse und hatte dort eine Weile in stiller Trauer mit allen Bäumen und Blumen gesprochen, bis das Morgenrot im Ost herniederzudämmern begann. Da erschien ihm das liebe Kind im weißen, linnenen Gewande gleich einem nächtlichen Geiste von fern auf dem Grabe kniend und betend. Und er schlich sich sanft hin, bei sich
sprechend: »Ich muß doch sehen, was das Wesen da ist, das auch die Einsamkeit sucht.« Und er ist gar leise hinzugeschlichen und hat hinter Büschen gelauscht, daß sie ihn nicht erblickte. Aber was hat er sich erlauscht? Als das Kind sich aufgerichtet, um heimzugehen, und die Augen aufgeschlagen, da hat er den Stern der Schönheit gesehen, wonach er so lange vergebens gespäht, und ist vor das Kind getreten und hat es angeschaut und gesprochen: »Wohin eilst du so, Nanthildchen? Kennst du denn deinen alten Spieler nicht mehr, dem du den schönen Blumenstrauß geschenkt hast?« Und sie hat laut aufgeschrien vor Freude und vor Schmerz und bestürzt und erschrocken wieder davoneilen wollen. Er hat sie aber nun nicht entfliehen lassen, sondern ihre Hände gefaßt und gestreichelt und geschmeichelt und geküßt und ihr so liebe, freundliche Worte zugesprochen, daß sie gern geblieben ist. Und sie haben an des Vaters Grabe mit Entzücken gesessen und Himmel und Erde miteinander vergessen. Und die Sonne stand schon hoch am Himmel, und sie dachten nicht daran, ob es Tag oder Nacht war. Da hat es mit scharfem Klang aus dem Schlosse geklungen: »Aschenbrödel! Aschenbrödel! Wo bist du?«Und Nanthildchen ist bei diesem Rufe zusammengefahren und erschrocken aufgesprungen und hat gesagt: »Laß mich! Ich muß gehen.« Denn jene Stimme war ihren Ohren eine fürchterliche Gewohnheit geworden. Der König aber, erstaunt, hat sie gefragt, was das sei, das sie so in Angst jage, und sie hat ihm geantwortet: »Ich bin jener Aschenbrödel, den du in so schändlichem Zustande in unserm Schlosse gesehen hast; und jetzt begreife ich wohl, daß sie mich so unter Schmutz und Elend versteckt haben, damit du mich nicht kennen solltest!« Und der König hat noch viel mehr gefragt, und sie hat ihm nun den ganzen Jammer erzählt, wie er seit ihres Vaters Tode ihr widerfahren. Der König, nachdem er alles von ihr gelernt, hat dann im Grimm gerufen: »Scheußlich! Abscheulich! Für jedes Goldhaar, das sie in deinen Locken dir abgeschnitten, soll ein Faden genommen werden, und drei lange Stricke will ich daraus machen und die drei Unholde lebendig an Pferdeschweife binden und zu Tode schleifen lassen! Ja, brennen sollen sie! Lichterloh brennen! Und ihre Asche soll in alle Winde verstreut werden!« Aber Nanthildchen ist ihm in die Rede gefallen und hat gebeten: »O mein König und Herr, vergib, vergib ihnen! Um meiner Liebe und um Gottes Gnade und Glücks willen vergib ihnen! Es ist ja nun alles gut, und ich bin nicht mehr der Aschenbrödel.« Und sie hat so lange gebeten, bis er es ihr zugesagt.Und darauf ging der König mit ihr hinab an das Schloß und rief der alten Hexe. Und sie kam und erschrak sehr, als sie den König erblickte; denn sie glaubte, er wolle ihren Töchtern die Füße besehen, was es mit ihren Zehen für eine Bewandtnis habe und wie der weiße Schuh so mit Blut vollgelaufen gewesen. Die Armen aber lagen ächzend und wimmernd im Bette und hatten vor Schmerzen die ganze Nacht kein Auge zutun können. Noch mehr aber erschrak die alte Hexe, als sie Aschenbrödel weiß und hell wie die junge Morgensonne in weißen, linnenen Kleidern neben dem Könige stehen sah. Und schon wollte sie finster schauen und schelten, aber sie faßte sich geschwind und bezwang ihren grimmigen Mut so weit, daß sie ihr Gesicht zu einem leidigen Lächen zusammenzerrte und mit den Knien bis zur Erde tiefste Verbeugungen knixte. Der König aber sah ernst und zornig auf sie, nahm Nanthildchen bei der Hand und sprach: »Schau her! Dies ist meine Gebieterin und Braut, du aber bist eine Erzbübin und Teufelin und würdest mit deinen Töchtern zu Asche verbrannt und in alle vier Winde geworfen werden, wenn dieser dein Aschenbrödel nicht so freundlich wäre und für ihre Plagerinnen gebeten hätte!«Und die Alte fiel Nanthilden zu Füßen und umklammerte ihre Knie und schrie: »Gnade! Gnade!« Der König aber sprach: »Fort von hier! Die Luft, wovon dieser Engel gelebt hat, soll von eurem Atem nicht länger verpestet werden. Zum dritten Male darf die Sonne dich und deine verruchten Töchter nicht mehr bescheinen! Deine Schätze und die Juwelen und Demanten, die du dir diebisch gestohlen und dieser deiner Herrin entwendet - dies und alles andre magst du mitführen; aber dies Tal, wo wir das
freundliche Strohhäuschen der Liebe wieder aufbauen wollen, dürfen deine verbrecherischen Augen nimmer wiedersehen.«Und der König ging zornig aus dem Hause des Unglücks, von welchem nach wenigen Tagen kein Stein mehr auf dem andern war, und führte sein Herzallerliebstes mit sich den Berg hinan. Und das treue weiße Täubchen hat auch nicht hintenbleiben gewollt und ist mitgeflogen, und Nanthilde hat es freundlich auf die Hand genommen. Und das Täubchen ist nimmer wieder von ihr weggeflogen, sondern bei ihr geblieben bis an ihr Lebensende und hat in späteren Tagen auf den Wiegen ihrer Kindlein gesessen und sie umgirrt und mit ihnen gespielt: Am fröhlichsten aber ist es gewesen, wenn der König und seine Königin nach dem kleinen Strohhäuschen im Tale gefahren sind, und wenn es dort im Blumengarten hat herumflattern können. Das ist aber das Sonderbarste gewesen: Als Nanthilde endlich nach vielen Jahren selig gestorben, da ist auch das weiße Täubchen verschwunden und an den bekannten und geliebten Orten nimmermehr gesehen worden.
Wir erzählten, wie der König seine geliebte Braut von dem Schlosse den Berg hinaufführte. Von da nahm er sie mit in seine Stadt und in seine Königsburg und zeigte sie bald allem Volk als seine Königin. Und alle Menschen, welche sie sahen, sagten, es sei die allerschönste Prinzessin, die je auf der Erde gelebt habe. Das hat er aber auch gelernt aus den Papieren ihres Vaters, welche die alte Hexe ihm schickte, daß sie eine königliche Prinzessin der Franken und seine Muhme war. Und er hat sich dieses Fundes gefreut und gesprochen: »Wir wollen den Haß und Mord der Geschlechter für alle ewige Zeiten durch Liebe versöhnen!«
Und sie haben beide Wort gehalten, und es hat nie ein glücklicheres und sieghafteres Menschenpaar auf Erden gelebt. Als Nanthilde aber schon eine große und mächtige Königin war, ist sie doch fleißig zu dem Gärtchen gefahren, wo sie als Kind gespielt und wo ihr König und Gemahl sich das strohene Häuschen gebaut hatte, und auch zu jenem zweiten Gärtchen, wo nach Austreibung der alten Hexe
ein zweites Häuschen wieder gebaut worden war. Bei diesem Gärtchen hat sie neben der Buche an ihres Vaters Grabe eine Kirche gebaut, wo sie oft in Andacht gebetet und sich in Freude der alten Zeiten und in Demut der Nichtigkeit und Hinfälligkeit aller irdischen Güter erinnert hat.Und sie und König Hilderich haben viele Jahre miteinander gelebt und einen Sohn gezeugt, der hieß Dagobert, zu deutsch Lichthell, und ist in seiner Zeit ein großer und gewaltiger König geworden. Und Aschenbrödel ist zu einem sehr hohen Alter gelangt und ist endlich selig gestorben und in dem Kirchlein an der grünen Buche begraben. Und nun weiß keiner die Stelle mehr, und Gärtchen und Häuschen und Kirche und Buche sind lange von der Erde verschwunden; aber die Geschichte von Aschenbrödel haben alle Menschen erzählen gehört.
DEUTSCHE MÄRCHEN
SEIT DEN BRÜDERN GRIMM
Das Posthorn
Es war einmal ein sehr kalter Winter, da fuhr ein Postillion auf dem Schwarzwald in einem Hohlwege und sah einen Wagen auf sich zukommen, nahm sein Horn und wollte dem Fuhrmann ein Zeichen geben, daß er stillhalte und ihn erst vorbeilasse; allein der Postillion mochte sich anstrengen wie er wollte, er konnte doch keinen einzigen Ton aus dem Horn hervorbringen. Deshalb kam der andere Wagen immer tiefer in den Hohlweg hinein, und da keiner von beiden mehr ausweichen konnte, so fuhr der Postillion geradewegs über den andern Wagen hinweg. Damit aber dergleichen Unbequemlichkeiten nicht noch einmal vorkommen möchten, so nahm er alsbald wieder sein Horn zur Hand und blies alle Lieder hinein, die er nur wußte; denn er meinte, das Horn sei zugefroren, und er wollte es durch seinen warmen Atem wieder auftauen. Allein es half alles nichts; es war so kalt, daß kein Ton wieder herauskam. Endlich gegen Abend kam der Postillion in das Dorf, wo ausgespannt wurde und wo ein anderer Knecht ihn ablöste. Da ließ er sich einen Schoppen Wein geben, um sich zu erwärmen; weil aber in dem Wirtshause gerade eine Hochzeit gefeiert wurde und die Stube von Gästen ganz voll war, so begab er sich mit seinem Wein in die Küche, setzte sich auf den warmen Feuerherd, hing sein Horn auf einen Nagel an die Wand und unterhielt sich mit der Köchin.
Auf einmal aber erschrak er ordentlich, als das Posthorn von selbst zu blasen anfing. Da blies es zuerst einige Male das Zeichen, das die Postillione gewöhnlich geben, wenn jemand ausweichen soll; dann
aber auch alle Lieder, die er unterwegs hineingehaucht hatte und die darin festgefroren waren und die jetzt an der warmen Wand alle nacheinander wieder auftauten und herauskamen, z. B. »Schier dreißig Jahre bist du alt« usw., »Du, du liegst mir im Herzen«, »Mädel ruck ruck ruck«und andere Schelmenlieder. Zuletzt auch noch den Choral: »Nun ruhen alle Wälder«, denn dies war das letzte Lied, welches der Postillion hineingeblasen hatte.
Das Kind mit dem goldenen Apfel
Es war einmal eine Bäuerin, die hatte einen Sohn namens Michel; der war nie weiter als vom Tisch bis an den Kachelofen gekommen. Und da dachte sie endlich, du mußt ihn doch einmal in die Welt schicken, sprach daher zu ihm: »Geh, Michel, hinaus an den Teich und hol Wasser.« —»Jawohl«, sagte Michel, »aber wo ist denn der Teich?« —»Wenn du aus der Haustür trittst, dann mußt du den Steig im Garten gerade hinuntergehen, dann wirst du ihn zur Linken finden.« —Michel machte sich auf den Weg, fand auch wirklich Haustür, Garten und Steig und kam an den Teich; wie er da den Eimer herauszieht, springt ein großer Hecht heraus, der bittet ihn, er möge ihn doch wieder ins Wasser werfen, er wolle es ihm wohl vergelten. »Hab' ich dich denn heißen herausspringen?« sagte Michel; »so springe du auch wieder hinein!«Aber der Hecht bat gar zu sehr und versprach Micheln endlich, alles, was er wünsche, solle geschehen, nur solle er ihn wieder ins Wasser werfen. Da tat er's denn, nahm seinen Eimer und ging wieder nach Hause.
Nun hatte er aber, als er draußen am Teich war, drüben in der Ferne ein Haus gesehen, das glänzte prächtig wie lauter Gold und Silber; darum fragte er seine Mutter: »Mutter, was ist das drüben für ein Haus, das man am Teich sieht?« —Sprach die Mutter: »Das ist des Königs Haus, da wohnt er mit der schönen Prinzessin drin.« Wie Michel das hört, denkt er: Ich will doch mal versuchen, ob der Hecht
wahr gesprochen hat; ich möchte, daß die Prinzessin noch vor Abend einen kleinen Jungen kriegt. Als nun der Abend kam, so hatte die Königstochter einen kleinen Jungen mit einem goldnen Apfel in der Hand und wußte selber nicht warum und woher. Da kam ihr Vater, der König, in einen großen Zorn, ließ alle weisen Männer aus dem ganzen Land zusammenkommen und befahl ihnen, herauszubringen, wer des Kindes Vater wäre. Sie rieten lange hin und her, und keiner wußte was. Da ließ eine alte Zigeunermutter, die auf den Tod gefangensaß, dem Könige sagen, wenn er ihr das Leben schenken wolle und so viel Geld, daß sie von nun an sich ehrlich ernähren könne, so wolle sie die Sache zu einem guten Ende bringen. Da ward sie alsbald losgelassen und bekam das Geld. Ob sie hernach nicht mehr gestohlen hat, weiß ich nicht zu sagen, aber ihr Rat war der: Man solle das Kind mitten im Saal auf einen Tisch setzen und alle ledige Mannschaft aus dem ganzen Lande aufs Schloß kommen und im Kreis herum an dem Kinde vorbeigehen lassen; dann würde es mit dem Apfel nach seinem Vater werfen.Der König tat, wie ihm die Alte geraten, er ließ überall in seinem Reiche ein Gebot ausgehen, daß alle unbeweibten Mannsleute sich an seinem Hofe versammelten. Und als nun der bestimmte Tag kam und das Kind mit dem Apfel in der Hand inmitten des Saales auf dem Tische saß, da traten zuerst all die Fürsten, Herzöge und Grafen herein, aber das Büblein blieb unbeweglich und warf nach keinem den Apfel. Darauf kamen die Minister und alle Beamte und Diener des Königs von den höchsten bis auf den Nachtwächter, aber das Büblein rührte sich nicht. Darauf mußten auch die geistlichen Herren und die Kaufleute und die Bauern und Handwerker und die Tagelöhner, die Dienstknechte und alle bis auf den Schinder herein in den Saal und gingen an dem Jungen vorüber; aber der rührte sich nicht. Als sie alle vorübergegangen waren und der König nicht anders glaubte, als daß alle ledigen Männer aus seinem Lande dagewesen wären, kam noch einer in den Saal gestolpert in einem alten schmutzigen Teerrock und mit einem alten dreitütigen Hut; das war
Michel, den hatte seine Mutter mit Gewalt hinaustreiben müssen und hatte ihn zurechtgestutzt, so gut es ging. Kaum hatte ihn das Büblein erblickt, so warf es den goldenen Apfel nach ihm.Nun hatte das Kind einen Vater und die Prinzessin einen Mann, aber der König geriet ganz außer sich vor Zorn darüber, daß Michel sein Schwiegersohn sein sollte und sagte, er wollte nun weder Vater noch Mutter, noch Kind bei sich behalten. Er ließ sogleich eine große gläserne Kugel mit einer Schraube gießen, daß man sie öffnen und schließen konnte, ließ den Michel, seine Tochter und den Kleinen hineinbringen, und die Kugel auf das Wasser setzen, und nun schwamm sie auf die weite See hinaus. Wie sie nun so dahintrieben und die Königstochter traurig dasaß, daß sie einen solchen Vater zu ihrem Kinde gefunden habe und nun hier elend würde umkommen müssen, da wünschte Michel, daß sie doch an eine Insel kommen möchten, und augenblicklich geschah es; die Kugel saß auf dem Strande fest, sprang auseinander, und alle drei traten wohlbehalten heraus. Da wünschte sich Michel ein prächtiges Schloß mit der reichsten Bedienung und allen dazugehörigen Häusern, und gleich war alles da. Nun wurde die Prinzessin auch zufriedener: Michel wünschte sich prächtige Kleider und sah jetzt ganz stattlich aus, und so lebte er hier lange Zeit mit seiner Frau und seinem Kinde in großer Herrlichkeit. Aber endlich verlangte doch die Königstocher mehr und mehr nach ihrem Vater und ihrer Heimat, und sie sagte das ihrem Mann; da wünschte er sich eine Brücke nach ihres Vaters Reich. Sogleich stand eine da, und zwar immer ein Balken von Gold, der andere von Silber; nun stiegen sie in eine prächtige goldene Kutsche und fuhren übers Wasser zum Schloß des alten Königs. Dessen Zorn legte sich sogleich, als er erfuhr, wie gut seine Tochter noch angekommen sei, und nun lebten sie glücklich und zufrieden miteinander bis an ihr Ende.
Die beiden Goldkinder
Vor vielen, vielen Jahren geschah es einmal, daß zwei Mägde im Feld nicht weit von der Landstraße arbeiteten; die eine rupfte Hanf, die andere schnitt Korn; sie sprachen aber miteinander von mancherlei und waren lustig und guter Dinge.
Auf einmal kam auf einem stattlichen Roß der junge König herangeritten. Die Mägde ließen von ihrer Arbeit, standen und staunten. Als der König ganz nahe war, grüßte er die Jungfern freundlich, und da rief die jüngere gleich der ältern zu: »Wenn mich der König zum Weibe nähme, würde ich ihn und seinen ganzen Hof mit meinem Hanf bekleiden!«
»Und ich«, sagte die ältere, »würde, wenn er mich zu seiner Köchin machte, ihn und sein ganzes Haus mit meinem Korn ernähren!«
Diese Reden hatte der König gehört, und da sie ihm wohlgefielen, schickte er am folgenden Tage nach den beiden Mägden und wählte sich die jüngere zu seiner Gemahlin, die ältere aber machte er zu seiner Oberköchin und gab ihr die Aufsicht über alle Bäcker und Köche des Reiches. Anfangs fühlten sich beide Mägde sehr glücklich, bald aber erwachte in der älteren der gelbe Neid: Sie wäre selbst gerne in der Stelle ihrer jüngern Freundin gewesen. Darum erdachte sie bei sich einen Plan, wie sie dieselbe verderben sollte. Sie stellte sich gegen die junge Königin sehr untertänig und treu, und diese in ihrem arglosen Herzen liebte sie wie zuvor, als sie noch Gespielinnen waren. Nun kam aber die Zeit, daß die junge Königin gebären sollte; die Köchin hatte unter gutem Vorwande alle Leute aus der Nähe entfernt; die Königin gebar zwei wunderliebliche Kinder, einen Knaben und ein Mädchen mit goldenen Haaren. Die arge Köchin nahm nun diese schnell, ohne daß es die kranke Königin merken konnte, eilte mit ihnen in den Hof und begrub sie in den Mist, lief dann wieder hinein und legte ein Hündchen und ein Kätzchen an die Stelle der Kinder und setzte sich neben das Bett.
Bald darauf bat die Königin ihre Freundin, sie möchte ihr die Kinder zeigen. Da fing diese an zu jammern und zu klagen: »O Gott, wünsche dir das nicht; es ist ein großes Unglück geschehen.«Damit stand sie auf und lief wehklagend hinaus und erzählte es den Hofleuten, und diese erzählten es weiter, und bald kam es an den König. Als dieser hörte, daß sein Weib einen Hund und eine Katze geboren hätte, ward er sehr zornig und ließ gleich die beiden Tiere ersäufen und sein Weib lebendig begraben. Nicht lange danach heiratete er die Köchin. Aus dem Mist aber, worin die beiden Kinder begraben worden, wuchsen zwei goldene Tannenbäumchen hervor, so schön, daß es eine Lust war, sie anzuschauen, und der König besonders hatte große Freude daran. Doch der Königin pochte immer das Herz, wenn sie die Bäumchen sah, und am Ende konnte sie ihren Anblick nicht mehr ertragen; sie stellte sich daher krank und sprach zum König: Sie könne nicht eher genesen, bis sie nicht auf Brettern ruhe, die aus den beiden Tannenbäumchen gemacht worden wären. So leid es dem König um die Bäumchen tat, so ließ er es doch geschehen, daß man sie fällte und daraus zwei Bretter für das königliche Ehebett machte. In der Nacht aber, als der König und die Königin zuerst darauf ruhten, fingen beide Bretter auf einmal an zu reden. »Brüderchen«, sprach das eine, »wie drückt es mich so schwer, auf mir liegt die böse Stiefmutter!« —»Schwesterchen«, sagte das andere, »wie ist mir so leicht, auf mir liegt der gute Vater!« Der König schlief fest und hörte nichts; die Königin jedoch hatte alles wohl vernommen und war voller Unruhe die ganze Nacht.
Als es Tag wurde und der König erwachte, sprach sie: »Ach, lieber Mann, die Bretter taugen gar nichts, mein Übel ist nur ärger geworden, laß uns sie verbrennen!« Der König widerredete nicht, denn er wünschte ja, sein Weib solle gesund werden. Alsbald wurde der Ofen geheizt, und als die Glut groß genug war, ließ die Königin die zwei Bretter hineinwerfen und sah zu, wie sie verbrannten. Zwei kleine Funken aber waren herausgesprungen und in die Gerste gefallen, das hatte die Königin nicht bemerkt. Bald darauf gab die
Magd die Gerste den Schafen, und ein Mutterschaf fraß die beiden Funken mit, und nach einiger Zeit brachte es zwei Lämmlein mit goldener Wolle zur Welt. Der König hatte große Freude darüber, aber als die Königin sie sah, gab's ihr einen Stich ins Herz, daß sie gleich krank wurde. Man verordnete ihr allerlei, allein sie konnte nicht gesund werden; da sagte sie endlich, wenn sie die Herzen der beiden Lämmlein äße, müßte ihr das wohl helfen. Was sollte nun der König tun; er mußte zulassen, daß sie geschlachtet wurden. Die Herzen briet man und brachte sie der Königin; die Gedärme aber wurden in den Fluß geworfen; zwei Stücke davon wurden weithin vom Wasser fortgeführt und endlich ans Ufer ausgeworfen. Hier wurden daraus wieder die zwei Kinder mit den goldnen Haaren und waren gleich so groß, als wären sie seit ihrer Geburt immer gewachsen; nur blieben sie nackend, denn noch keine Mutter hatte ihnen ja ein Hemdchen angelegt. Sie waren aber so lieblich und schön, daß die Sonne auf ihrem Tagesgange stehenblieb, sich nicht satt sehen konnte und sieben Tage nicht unterging.Da es nun so lange nicht Nacht werden wollte, verwunderte sich des unser Herrgott und dachte: Das hast du doch nicht also geordnet! Er kam daher zur Sonne und fragte sie, warum sie so lange am Himmel verweile und nicht untergehe? Da zeigte sie ihm unten auf der Erde die beiden schönen Kinder, wie sie an dem Flusse spielten. Unser Herrgott war entzückt und gerührt bei dem Anblick der Kleinen, die so mutterseelenallein und nackt waren und sprach: »Ich will mich ihrer annehmen.«Da stieg er auf die Erde als ein alter guter Mann, und die Kinder liefen, sobald sie ihn sahen, gleich zu ihm und waren froh. Da gab er jedem ein Hemdchen und ein goldnes Hämmerchen und sprach: »Gehet nur immer auf der Straße fort, da werdet ihr in die große Stadt kommen; klopfet an die Türen an, und wo man euch aufmacht, da tretet ein. Wenn da ein freundlicher Mann euch fragt, wer ihr seid, so erzählt ihm dieses Märchen.« Nun erzählte ihnen unser Herrgott ihre ganze Lebensgeschichte, ging dann fort und stieg wieder in seinen Himmel hinauf. Die Kleinen aber wandelten
weiter und kamen endlich in die große Stadt; sie klopften an viele Türen, aber keine wurde ihnen aufgetan; zuletzt kamen sie auch an den Palast des Königs. Sowie sie hier anklopften, öffneten sich gleich von selbst die großen Flügeltüren. Sie traten ein, und es saß der König gerade in tiefem Nachdenken und härmte sich, daß er keine Kinder hatte; indem fiel sein Blick auf die kleinen himmlisch schönen Kinder mit den goldnen Haaren. »Kommt her«, rief er, »was für ein Engel hat euch zu mir gesendet? Erzählt mir's!«Die Kleinen gingen hin, setzten sich ihm vertraulich auf die beiden Knie und liebkosten ihn; der Knabe fing darauf an zu erzählen, wie ihn unser Herrgott gelehrt hatte, und wenn er etwas ausließ oder nicht gut erzählte, verbesserte ihn sein Schwesterchen.»Gott, o Gott!«seufzte der König, als die Erzählung zu Ende war, und in dem Augenblicke trat auch die Königin ein. Als sie die Kinder erblickte, erfaßte sie ein grausiges Entsetzen; sie kehrte um, schlug die Türe hinter sich zu und lief wie wahnsinnig fort. Die Kinder aber saßen dem König auf dem Schoße ruhig und voller Unschuld und wußten nicht, warum er so schwer geseufzt und die Frau sie so entsetzlich angeschaut hatte.
Endlich sagte er: »O ihr meine lieben Kinder, das ist kein Märchen, was euch der alte Mann erzählt hat, sondern euere und meine wahrhaftige Geschichte. Der alte gute Mann aber ist der liebe Gott, der alles so wunderbarlich geleitet und nun offenbart hat. Wehe, wehe der bösen Königin!«Damit ging er hinaus und gab Befehl, daß man sein Weib sogleich lebendig begraben solle. Aber man konnte sie lange nicht finden; endlich traf man sie am Ufer des Flusses, wie sie sich die Haare zerraufte. Sie hatte sich erhängen wollen, aber der Strick war gerissen, darauf hatte sie sich ins Wasser gestürzt; allein der Fluß hatte sie wieder herausgeworfen; da wurde sie ergriffen und lebendig verscharrt; die Erde behielt sie nun und bedeckte ihre große Sünde mit. Der König jedoch schickte sogleich in das Land der sieben Zwerge um Wasser des Lebens, ließ seine rechte Gemahlin ausgraben und machte sie lebendig. Beide lebten nun froh und
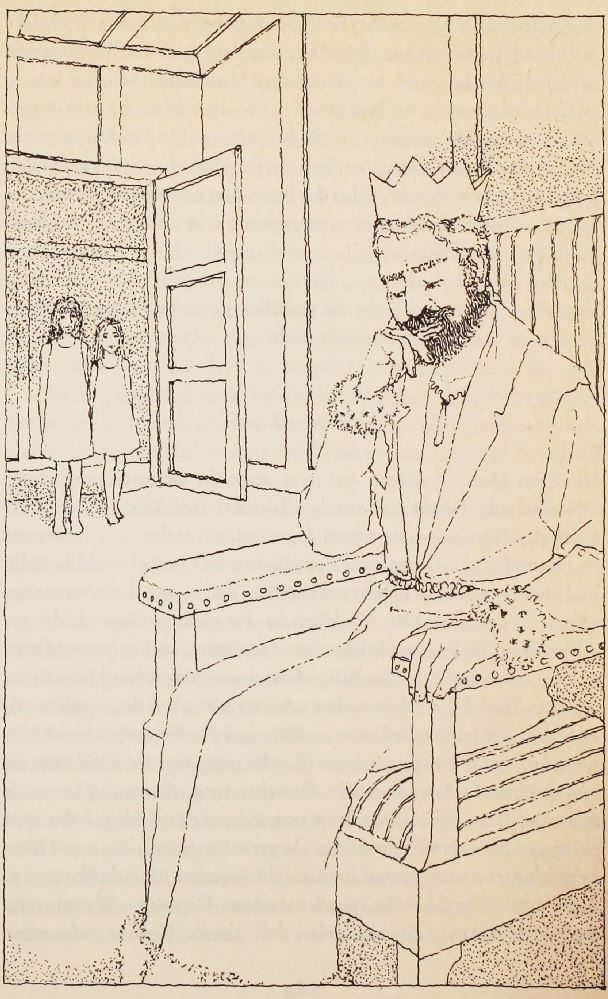
Auch du hättest sie wahrlich gerne bekommen; Allein dich hätte sie nicht genommen! |
Siebenschön
In einem Dorfe wohnten ein paar arme Leute in einem kleinen Häuschen, die hatten eine einzige Tochter. Das Mädchen besorgte ihnen den Hausstand, sie wusch, fegte, kochte und schaffte alles, was zu tun war; das Gärtchen vor dem Hause war immer wohl bestellt, im Hause war alles so blank und reinlich, daß es eine Lust war anzusehen. Es gab auch kein Mädchen in der ganzen Gegend, die geschickter im Nähen und Sticken gewesen wäre, und damit verdiente sie ihren armen Eltern das Brot; denn feine Arbeit wird immer gut bezahlt. Weil das Mädchen aber schöner war als sieben andere zusammen, so nannten die Leute sie Siebenschön. Sie war dabei so sittsam, daß, wenn sie sonntags zur Kirche ging, was sie fleißig tat, sie immer einen Schleier vor dem Gesichte trug, damit die Leute sie nicht angaffen sollten. Da sah sie nun einmal des Königs Sohn, und sie war so schlank wie eine Esche, da verliebte er sich in sie und hätte herzlich gerne auch einmal ihr Gesicht gesehen, aber das konnte er nicht vor dem Schleier. Er sprach zu seinen Dienern: »Warum trägt Siebenschön immer einen Schleier, daß man ihr Gesicht nicht sehen
kann?«Die Diener antworteten: »Das tut sie, weil sie so sittsam ist.« Da sandte der Königssohn einen Diener mit einem goldenen Fingerreif zu Siebenschön und ließ sie gar sehr bitten, heute abend bei der großen Eiche zu sein, er habe was mit ihr zu sprechen. Siebenschön ging hin, denn sie dachte: Gewiß will der Prinz bei dir ein Stück feine Arbeit bestellen. Als aber der Prinz sie nun sah, da verliebte er sich noch viel mehr und verlangte sie zur Frau. Doch Siebenschön sprach: »Du bist so reich und ich nur so arm; dein Vater wird sehr böse werden, wenn er hört, daß du mich zur Frau genommen.« Aber der Prinz bat so viel und sagte, wie lieb er sie habe; da sagte Siebenschön endlich: »Wenn du noch ein paar Tage warten willst, so will ich mich darauf bedenken.« —Aber schon am andern Tage schickte der Königssohn seinen Diener zu Siebenschön. Der brachte ihr ein paar silberne Schuhe und bat sie, sich heut abend wieder bei der Eiche einzufinden, denn der Prinz wolle mit ihr sprechen. Siebenschön ging hin, und als der Prinz sie sah, fragte er sie, ob sie sich schon besonnen habe.Da antwortete Siebenschön: »Ich habe mich noch nicht bedenken können, denn meine Tauben und Hühner wollten gefüttert, der Kohl mußte geschnitten und die Hemden sollten genäht werden; aber was ich dir sagte, ich bin so arm und du so reich, dein Vater wird böse werden, darum kann ich nicht deine Frau werden.« Da aber bat sie der Prinz wieder so viel, daß sie endlich sagte, sie wolle sich's ganz gewiß bedenken und mit ihren Eltern sprechen. Am anderen Tage schickte er durch seinen Diener ein prächtiges goldenes Kleid und ließ sie bitten, heute abend wieder zu der Eiche zu kommen. Siebenschön ging abends auch wieder hin, und der Prinz fragte, wie sie sich denn nun besonnen habe. »Ach«, sagte Siebenschön, »ich habe mich nicht bedenken können, und meine Eltern habe ich auch noch nicht gefragt, es gab den ganzen Tag wieder so viel zu schaffen in und außer dem Hause, daß ich nicht dazu kommen konnte; aber was ich immer gesagt habe, dabei muß ich bleiben, ich bin viel zu arm und du zu reich, und dein Vater wird sehr böse werden.« Nun
ließ der Prinz gar nicht mit Bitten nach und stellte ihr vor, daß sie endlich Königin werden sollte, er würde ihr auch ganz gewiß treu bleiben und keine andere heiraten, was da auch kommen möchte. Da Siebenschön nun sah, wie lieb er sie hatte, so sagte sie endlich ja. Von nun an trafen sie sich jeden Abend bei der Eiche und waren ganz glücklich, denn sie liebten einander recht von Herzen. Der König sollte es nicht wissen, aber es war da eine alte garstige Dirne, die sagte es ihm endlich doch, daß sein Sohn mit Siebenschön jeden Abend spät zusammenkäme. Da ward der König ganz grimmig und schickte seine Leute hin, Siebenschöns Haus in Brand zu stecken, damit sie darin verbrenne. Siebenschön saß am Fenster und stickte; als sie aber merkte, daß das Haus brenne, sprang sie geschwind hinaus und gerade hinein in einen leeren Brunnen; ihre armen Eltern verbrannten beide mit dem Hause.Da war es ihr erst gewaltig gram und so traurig ums Herz, daß sie tagelang im Brunnen saß und weinte. Nachdem sie aber ausgeweint, arbeitete sie sich allmählich hinauf und grub sich dann mit ihren feinen Händen etwas Geld aus dem Schutt ihres verbrannten Hauses. Dafür kaufte sie sich Mannskleider. Dann ging sie zum Könige an den Hof und bat, er möge sie doch als Bedienten annehmen, sie heiße Unglück. Dem Könige gefiel der hübsche junge Mensch, und er nahm ihn zum Bedienten an. Sie war nun immer treu und fleißig, und bald mochte der alte König Unglück von allen seinen Bedienten am liebsten leiden und ließ sich von keinem andern bedienen.
Der Königssohn aber, als er hörte, Siebenschöns Haus sei niedergebrannt, trauerte sehr, denn er meinte nicht anders, als daß Siebenschön auch mit verbrannt sei. Nachher aber wollte sein Vater, daß er sich eine Frau nehmen sollte; der alte König wollte seinem Sohn das Reich übergeben, aber dann mußte dieser auch eine Königin haben. Also freite der Prinz um eines andern Königs Tochter und ward mit ihr verlobt. Als nun die Hochzeit sein sollte, ward das ganze Land dazu eingeladen, und als der König mit seinem Sohn hinreiste, die Braut zu holen, mußten alle Bedienten mit. Das war eine traurige
Reise für Unglück, und es lag ihm so hart auf dem Herzen wie ein Stein. Er hielt sich immer hinten im Zuge, damit die Leute nicht seine Traurigkeit sähen; als sie aber in die Nähe des Schlosses der Braut kamen, hub er an zu singen mit klarer Stimme:Siebenschön bin ich genannt, Unglück ist mir wohl bekannt. |
Siebenschön bin ich genannt, Unglück ist mir wohl bekannt. |
Siebenschön bin ich genannt, Unglück ist mir wohl bekannt. |
Als sie nun alle beisammen waren auf dem Schosse der Braut und ward eine große Gesellschaft da, so sagte der König, der Vater der Braut: »Wir wollen Rätsel spielen, und der Bräutigam soll anfangen.
«Da fing der Königssohn an: »Ich habe einen Schrank, und vor einiger Zeit verlor ich den Schlüssel dazu; da ging ich gleich hin und kaufte mir einen neuen; als ich aber nach Hause kam, fand ich meinen alten wieder; nun frage ich dich, Herr König, welchen Schlüssel soll ich zuerst gebrauchen, den alten oder den neuen?« Der König antwortete sogleich: »Natürlich den alten!« Da sagte der Königssohn: »So behalte du nur deine Tochter, hier ist mein alter Schlüssel.« Er ergriff Siebenschön bei der Hand und führte sie mitten unter sie; der alte König aber, sein Vater, rief: »Nein, das ist ja Unglück, mein Diener!«Doch der Königssohn antwortete: »Lieber Vater, es ist Siebenschön, meine Frau!« Da gingen allen die Augen auf, und sie sahen nun erst, wie schön sie war.
Die drei Träume
Drei wandernde Gesellen kamen überein, sie wollten alle Dinge gemein haben; Speis und Trank, Nutzen und Schaden wollten sie miteinander teilen. Zwei davon hatten's aber hinter den Ohren und hielten heimlich zusammen, daß sie den dritten, der ein einfältiger Geselle war, über den Löffel halbierten. Als sie ein paar Tage miteinander gegangen waren, kamen sie in eine einsame Gegend und verloren den Weg. Da litten sie große Not; alle Nahrung war ihnen ausgegangen, und es war nur noch etwas Mehl da, davon beschlossen sie einen Kuchen zu backen. Während aber der Einfältige das Feuer dazu anzündete, ratschlagten die zwei Schälke, wie sie es vorkehren möchten, daß sie den Kuchen unter sich allein teilen und den Einfältigen um seinen Teil betrügen könnten. Da sagte der eine: »Weißt du was, Bruderherz? Wir machen ihm den Vorschlag, daß wir alle drei schlafen wollen, bis der Kuchen gebacken ist; wenn wir aufwachen, soll ein jeder erzählen, was ihm geträumt hat; und wer dann den wunderlichsten Traum erzählen kann, dem soll der Kuchen gehören.« Gesagt, getan. Die zwei schliefen alsogleich ein; den Einfältigen
hielt dagegen der Hunger wach, und kaum sah er, daß der Kuchen gebacken war, so machte er sich herzu und aß ihn auf; es ist kein Brosamlein übriggeblieben. Hernach legte er sich aufs Ohr. Alsbald wachte der eine der Schälke auf und rief seinem Kameraden zu: »Freue dich, Bruderherz, mir hat Wunderliches geträumt; denke dir: Es war mir, als ob ein Engel mit goldenen Flügeln mich vor Gottes Thron mitten ins Himmelreich geführt hätte.«Da sprach der andere: »Ei! Und mir hat geträumt, der Teufel habe mich in die Hölle hinabgeführt und mir da der armen Seelen Pein gezeigt. Was kann einem Wunderlicheres träumen? Der Kuchen ist unser!«Hierauf weckte er den Einfältigen mit dem Ellbogen auf und sagte: »Wie lange willst du noch schlafen? Sag her, was hat dir geträumt?« — »Heda«, rief der Einfältige und streckte sich, »wer ruft mich?« —»Ei, wer sonst als deine Gesellen?« —»Aber«, fragte er wieder, »wie seid ihr denn wieder hergekommen?« — »Wo sollten wir gewesen sein?« sagte der andere. »Ich glaube, guter Freund, es ist nicht ganz richtig in deinem Oberstübchen.« —»Freilich ist's«, antwortete der Einfältige; »aber da hat's mir so kurios geträumt; ich habe die hellen Tränen um euch geweint, weil ich meinte, ich hätte euch schon verloren; es träumte mir, einer von euch sei ins Himmelreich gefahren und der andere in Teufels Revier; dieweil man aber noch selten von einem gehört hat, daß er von diesen Gegenden wieder heimgekommen sei, so hab' ich mich des getröstet so gut ich konnte und in Gottes Namen den Kuchen aus dem Feuer genommen und gegessen. Nehmt nicht für ungut.«
Schulze Hoppe
Es war einmal ein Schulze, der hieß Hoppe, dem konnte es der liebe Gott nie recht machen mit dem Wetter; bald war's ihm zu trocken, bald regnete es zuwenig. Da sagte der liebe Gott endlich: »Im nächsten Jahr sollst du das Wetter selbst machen.« So geschah es denn
auch, und der Schulze Hoppe ließ nun abwechselnd regnen und die Sonne scheinen, und das Getreide wuchs, daß es nur so eine Freude war, mannshoch. Als es nun aber zur Ernte kam, waren alle Ähren taub, denn Schulze Hoppe hatte den Wind vergessen, und der muß doch wehen, wenn das Getreide sich ordentlich besamen und Frucht tragen soll. Seit der Zeit hat Schulze Hoppe nicht mehr übers Wetter gesprochen und ist zufrieden damit gewesen, wie es unser Herrgott gemacht hat.
Kännchen voll
Es war einmal eine arme Witwe, die hatte ihren letzten Groschen ausgegeben. Sie hatte sich dafür zu essen gekauft, und als sie das verzehrt hatte, da machte sie ihre Küche blank, wusch das einzige Kännchen, das sie noch hatte, und setzte es draußen vor die Tür in die Sonne zum Trocknen. Dann schloß sie die Untertür und darnach auch die Obertür und dachte: Was soll nun aus mir werden?
Aber während sie so saß und sann, fing das Kännchen an zu rollen und rollte so lange fort, bis es zu einem Schlachter kam. Da stand gerade eine Frau, die hatte Suppenfleisch gekauft und hatte nichts mitgebracht, wo sie es hineintun konnte. Sie sah das leere Kännchen und sagte: »Das kommt ja wie gerufen für mein Fleisch.«Aber sowie das Kännchen merkte, es war gefüllt, da rollte es weg. Und ehe man es fassen konnte, war es den Leuten schon aus den Augen und rollte nach Haus zurück. Da bumste es an die Tür. Die Frau rief: »Wer ist da?« —Das Kännchen antwortete: »Kännchen voll, fühl nur mal in mein Hohe bolle Bäuchsken!« Die Frau tat die Tür auf und -da fand sie das herrlichste Suppenfleisch!
Den andern Tag ging das ebenso. Als die Frau ihre Suppe gegessen und das Kännchen ausgewaschen hatte, setzte sie es wieder draußen vor die Tür zum Trocknen und tat die Tür zu, und das Kännchen fing nun wieder an zu rollen. Und rollte fort, bis es zu einem Krämer kam. Da war jemand, der Kaffee und Kandisklümpchen kaufte, und
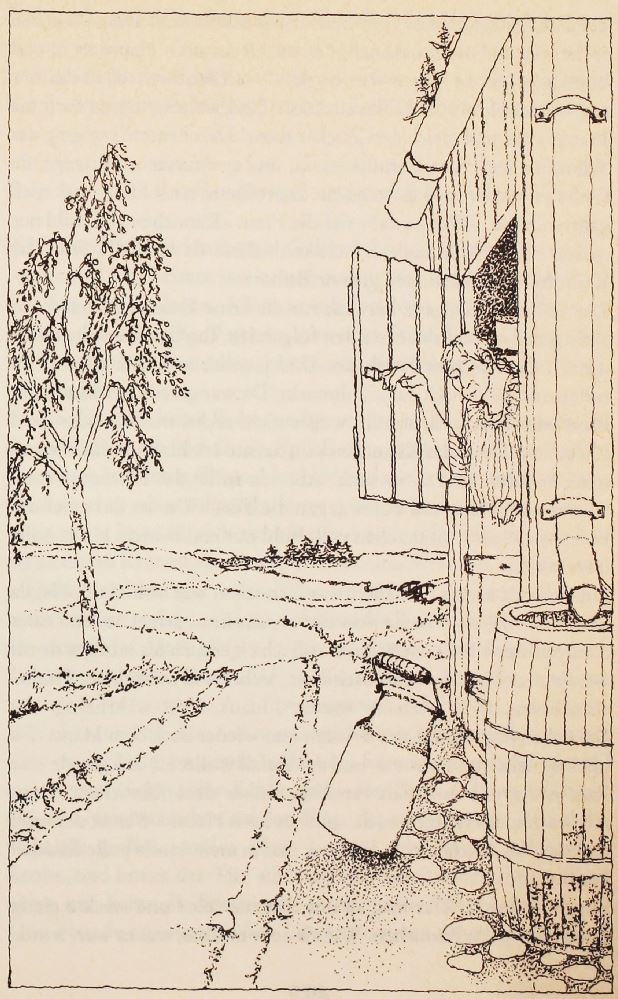
Das war natürlich ganz herrlich für die arme Frau und konnte ihr wohl gefallen, und sie setzte den folgenden Tag das Kännchen wieder vor die Tür zum Trocknen. Und jawohl, es fing wieder an zu rollen und rollte nach dem Kuhmarkt. Da war gerade ein Bauer, der hatte seine Kuh verkauft und wußte nicht recht, wohin er das Geld tun sollte. Wie er das Kännchen sah, dachte er: Halt, da kann ich es fein hineintun, und tat es auch. Aber da rollte das Kännchen weg, wieder nach Haus und bums gegen die Tür. »Wer ist da?« rief das Frauchen wieder. »Kännchen voll! Fühl nur mal in mein Holle bolle Bäuchsken!«
Die Frau tat es, und wirklich, das Kännchen war voll Geld. Na, da hättet ihr mal die Freude von der armen Frau sehen sollen! Aber dann dachte sie bei sich: Warum soll ich eigentlich bis morgen damit warten, das Kännchen auszuschicken, sicher will es noch ein Trachtchen holen. Und setzte es wieder hinaus. Und wahrhaftig, das Kännchen fing wieder an zu rollen und wieder nach dem Markt. Da blieb es stehen und wartete, und der Zufall wollte es, daß gerade eine Kuh eine große Botschaft verrichtete über dem Kännchen. Kaum merkte dies das Kännchen, da rollte es nach Haus. »Wer ist da?«rief die Frau. »Kännchen voll, fühl nur mal in mein Holle bolle Bäuchsken!«
Die Frau dachte: Was mag es nur diesmal sein? und steckte gierig ihre Hand in das Kännchen. Wie sie aber merkte, was es war, wurde
sie so giftig, daß sie das Kännchen auf die Straße warf, und da sprang es entzwei!So war sie das Kännchen quitt, aber sie hatte nun Geld genug zum Leben, und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie heute noch.
Das Pomeranzenfräulein
Einst wurde ein reicher junger Graf ensohn von seinen Eltern sehr bedrängt, daß er heiraten solle, und viele schöne Prinzessinnen wurden ihm vorgeschlagen. Allein er mochte keine von allen, denn er hatte es sich in den Kopf gesetzt, nur eine Braut heimzuführen, die nicht von einer Mutter geboren war, und eine solche konnte er lange nicht finden.
Es ließ ihm aber keine Ruhe, und er wollte so lange suchen, bis er die rechte Braut für sich fände. Erließ sich sein Roß satteln und nahm von seinen betrübten Eltern Abschied und ritt in die weite Welt hinein. So war er schon sehr, sehr lange geritten, und noch immer hatte er die rechte Braut für sich nicht finden können. Da kam er eines Tages zu einem Kreuzwege; dort stand ein altes Weiblein, krumm und gebückt, das hatte nur einen Zahn im Munde, und seine Augenbrauen waren so lang, daß sie tief über die Augen hingen. Als nun der junge Graf das Weiblein fragte, wohin die zwei Wege führten, da hat er schreien müssen, daß sie ihn verstand, denn das Weiblein war vor Alter fast taub. Auf ihre Fragen erzählte er ihr von seinem Vorhaben, und die Alte nickte und wackelte beifällig mit dem grauen Kopf und sagte mit einer kreischenden Stimme, die schwer zu verstehen war: »Schmucker Knabe, gehe den Weg« —dabei zeigte sie mit dem Haselstöckchen auf den Weg, der rechts führte -, »und du wirst ein großes, großes Haus finden, gehe hinein, schmucker Knabe, und hinter der Tür wirst du einen Kehrbesen finden. Den nimm und kehre die Stiege, und wenn du die Stiege gekehrt hast, dann wirst du zu einem großen Löwen kommen, schmucker Knabe!
Und der hält einen goldenen Schlüssel in seinem Rachen. Den Schlüssel mußt du dem Löwen mit Gewalt aus dem Rachen reißen und damit die Zimmertür aufsperren, vor der er steht. Dann wirst du in ein prächtiges Zimmer kommen, da steht wieder ein Löwe mit einem Schlüssel im Rachen vor einer Tür. Diesen Löwen aber mußt du erlegen, schmucker Knabe, und ihm wieder den Schlüssel nehmen. Mit dem schließt du die andere Tür auf, dann kommst du in die Küche, und in der Küche wirst du drei schöne rotgelbe Pomeranzen finden und ein Messer mit einem Griff aus Ebenholz. Das Messer nimmst du und schneidest eine der drei Pomeranzen auf, schmucker Knabe, dann wird ein wunderschönes Fräulein, schön wie die Sonne, herauskommen. Du mußt aber mit ihr gleich zu dem Brunnen gehen, der vor dem Haustore unter den zwei Linden steht, und deine Braut unter das Wasser halten, sonst wird sie gleich zusammenwelken und sterben.«
Der Grafensohn dankte ihr für ihren guten Rat, ritt in den kühlen dunklen Wald hinein und kam immer tiefer und tiefer, bis er plötzlich vor einem großen Schlosse stand, das aus weißem Marmor erbaut war. Er trat durch das große schöne Portal ein und fand hinter der Haustüre den Besen; den nahm er und kehrte damit die Stiege, wie es ihm die Alte gesagt hatte. Als er das getan hatte, kam er zu dem Löwen, dem nahm er den goldenen Schlüssel aus dem Maule, sperrte die Saaltüre auf, die von Ebenholz war, durchschritt dann den weiten Saal, bis er zu dem zweiten Löwen kam, der wieder einen goldenen, noch schöneren Schlüssel im Rachen hielt. Er erlegte den Löwen, nahm den Schlüssel, schloß damit die nächste Türe auf und ging in die Küche. Dort fand er auch wirklich das Messer und die drei Pomeranzen, die waren wie das reinste Gold und glänzten wie die Sonne; er wagte es kaum, sie anzufassen. Endlich faßte er sich ein Herz und griff nach der nächsten ersten Pomeranze und nach dem blanken Messer und schnitt den goldenen Apfel entzwei. Aber kaum hatte er die obere Hälfte abgelöst, da stand ein wunderschönes Mädchen vor ihm in der unteren Hälfte der Pomeranze, die er in den
Händen hielt; das kleine Fräulein war so schön wie der Tag und seine Augen blau wie der Sommerhimmel.Dem Grafensöhne wurde es ganz wunderlich ums Herz, er vergaß die Mahnung des alten Mütterchens ganz und gar und schaute und schaute nur das schöne Jungfräulein an, dachte gar nicht an den Brunnen. Und wie er so dastand, da welkte das schöne Bild zusammen und starb vor seinen Augen. Da erschrak er und dachte, das zweitemal den Rat der Alten besser zu befolgen; er nahm die zweite Pomeranze und das blanke Messer und stieg die weiße Marmortreppe hinab in den Hof. Als er bei dem Brunnen unter den zwei Linden angekommen war, schnitt er die goldene Frucht auf; und es blendete ihm fast die Augen, ein Jungfräulein stand vor ihm, so schön, wie die Sonne noch nie eins beschienen hat. Er hielt sie unter den Strahl des Wassers, und da wurde sie immer größer und größer, so daß seine Hände sie nicht mehr halten konnten und sie auf dem Boden stand und endlich fast so groß war wie er. Da schlang er den Arm um sie, führte sie in das Marmorschloß und sprach zu ihr, sie solle da bleiben, bis er mit Roß und Wagen wiederkäme. Dann nahm er Abschied von ihr, küßte sie und wanderte zu seinen Eltern, um Roß und Wagen zu holen. Die schöne Pomeranzenjungfrau aber blieb nun ganz allein im Schlosse, mußte sich selbst das Wasser holen und das Essen bereiten und hatte so ganz allein wohl manches Mal Langeweile.
Neben dem großen Marmorschloß stand aber ein kleines Haus, darin wohnte eine Hexe mit ihren zwei Töchtern. Die sahen das schöne Mädchen öfters zum Brunnen unter den Linden gehen, kamen auch zu ihr herauf und fragten sie aus, und das Pomeranzenkind war arglos und erzählte ihnen in seiner Einfalt alles, gerade wie es Kinder tun.
»Komm mit«, sagte einmal die ältere Hexentochter, »die Mutter hat Kuchen gebacken, die schmecken so gut.«Das Mädchen ließ sich bereden und ging mit. Sie spielten allerlei Spiele, und da sollte das Mädchen einmal Königin werden und mußte sich umkleiden und die
Haare flechten lassen. Wie es aber so dasaß, da drückte ihm eine von den beiden Schwestern eine Nadel in den Kopf, das war eine Zaubernadel, und das arme Kind wurde in eine Taube verwandelt.Eine von den zwei häßlichen Schwestern ging nun in das Schloß hinüber und wartete, bis endlich der Bräutigam angefahren kam. Der staunte nicht wenig, wie er anstatt seiner schönen Braut die garstige Hexentochter fand. Aber die wußte allerhand Ausreden, und er meinte, sein gegebenes Versprechen müßte er halten, und ihn könnten doch nur die Augen täuschen; er nahm also die häßliche Braut zu sich in den Wagen und fuhr nachdenklich mit ihr fort.
Während sie aber unterwegs waren, kam der alten Hexe die Taube aus und flog dem Wagen nach und umflatterte ihn und schlug mit den weißen Flügeln, daß der junge Graf es merkte und mitleidig die Hand herausstreckte, um sie hereinzulangen. Die falsche Braut aber war böse darüber und wollte es nicht leiden, denn sie hatte das Tierchen erkannt. Doch er nahm es herein, hielt es auf seinem Schoß und streichelte es, so daß es zu girren anfing. Und wie er ihm so über den Kopf strich und das Täubchen ihn mit seinen schwarzen klugen Augen ansah, kam er an die Nadel; voll Mitleid zog er sie heraus, da stand das schöne Pomeranzenfräulein wieder vor ihm. Nun war der Grafensohn in einer Glückseligkeit, daß er sie wiederhatte. Als er aber erfuhr, wie alles zugegangen war, da warf er das böse Hexenmädchen zum Wagen hinaus, daß es beide Beine brach. Das Brautpaar fuhr jetzt voll Freude nach Hause, und die Eltern freuten sich mit ihrem Sohne, und es gab eine prächtige Hochzeit. Die Geschichte ist wahr, denn ein Grafensohn davon lebt jetzt noch.
Widewau
Es war einmal ein Müller, von dem sagten die Leute, er wäre so grob wie Bohnenstroh. Niemand mochte mit ihm gern etwas zu tun haben; ja, wäre nur in der Nähe eine andere Mühle gewesen, dann wären die Mahlgäste wohl einer nach dem andern fortgeblieben. Aber es war weit und breit nur diese eine. So kam der Müller immer mehr in die Wolle und wurde zuletzt ein reicher Mann. Dabei war er aber so knickerig, daß er sich nicht einmal einen Dienstboten hielt, sondern er tat auch noch die Arbeit eines Mühlknappen, und seine Frau und seine einzige Tochter machten außer der Hauswirtschaft die Mägdearbeiten. Eines Tages kam einmal ein altes armes Mütterchen, das um Almosen bat. Die kam aber schön an! Der Müller wetterte auf sie los: »Fort von meiner Tür, du alte Hexe, sonst lasse ich den Hund los! Ihr elendes Bettlergesindel kommt ja nur, um zu sehen, wo es was zu stehlen gibt.« Die Alte wollte noch weiter bitten, er jagte sie aber ohne Mitleid von seinem Hofe.
Unterwegs begegnete ihr ein junger Müllersbursch, der war von armen Eltern und ging in die Fremde, um sein Handwerk noch besser zu lernen und sich in der Welt umzusehen. Bisher war's ihm recht schlecht gegangen. Nirgends hatte er Arbeit gefunden, und seine wenigen Spargroschen waren nun auch schon verzehrt. »Guten Abend«, sagte die Alte. Er grüßte freundlich wieder und fragte: »Weißt du nicht, Mutterchen, ob hier eine Mühle in der Nähe ist?« Sie zeigte ihm den Weg zu der Mühle, von der sie eben kam, und sagte: »Du gefällst mir, und ich kenne deine Not; ich will dir helfen, doch mußt du mir auch einen Dienst leisten. Gib genau acht und tu, was ich dir sage, es wird dein Glück sein. —Wenn du an den Mühlbach kommst, wirst du auf den ersten Blick am Ufer ein schwarzes Steinchen sehen, das heb auf und nimm es mit. Dann geh ins Haus, und wenn sie dich auch nicht aufnehmen wollen, du bleibst doch da und sagst, wenn sie auch schimpfen, nur immer: >Schönsten Dank!< Iß und trink auch dann, wenn du nicht dazu gebeten wirst und leg
dich ins Bett, ohne daß man dich dazu auffordert. Wenn aber in der Nacht alles schläft, dann schleich dich zum Herd und leg dein Steinchen in die Asche. Morgen früh wird dann etwas geschehen, das wird alle im Haushalt närrisch machen; das soll die Strafe für den Müller sein. Nur du allein kannst helfen, du nimmst einfach das Steinchen aus der Asche. Aber sei klug, du kannst dein Glück dort machen.«Dem Müllergesellen kam das alles doch recht bedenklich vor. Aber die Alte sagte, es würde alles gut werden, und da versprach er's. — Er kam an den Mühlbach, fand das Steinchen und steckte es ein. Dann ging er in die Mühle und bat die Müllerin um Nachtquartier. »Nein, hier ist keine Herberge.« —»Schönsten Dank«, sagte er, legte sein Ränzel ab und setzte sich auf die Ofenbank. Der muß närrisch sein, dachte die Frau. »Ihr habt mich wohl nicht recht verstanden«, sagte sie laut, »hier dürft Ihr nicht bleiben!« — »Schönsten Dank, schönsten Dank!« erwiderte er freundlich, und was sie auch vorbrachte, wie oft sie ihm die Türe wies, stets antwortete er »Schönsten Dank!«und blieb ruhig sitzen. —Nun ging die Frau für ihren Mann das Essen kochen und brachte es nach einer Weile auf den Tisch. »Schönsten Dank!«rief der Geselle und fing gleich an zu essen. »Das ist ja für meinen Mann!« schrie die Frau wütend. Er aber kehrte sich nicht daran, löffelte weiter, sagte dazwischen schönsten Dank und hieb ein, daß der Frau angst und bange wurde. Da kam ihr Mann nach Hause. »Gott sei Dank, daß du da bist«, rief sie ihm entgegen und erzählte ihm von dem unheimlichen Gast. Da fuhr der Müller wütend auf den Fremden los; der aber tat, als würde ihm die größte Freundlichkeit erwiesen und beantwortete alles Schimpfen immer nur mit »Schönsten Dank!«
Der Müller hätt ihn am liebsten zur Tür hinausgeworfen, aber er sah, der Kerl war jung und stark, wer weiß, wie das ablief. »Mach mir denn mein Bett«, sagte er endlich zu seiner Frau, »ich bin müde.« Die Frau machte das Bett, der Fremde aber zog sich ohne weitere Umstände aus, sagte »Schönsten Dank!«, legte sich in die Federn und schlief bald wie ein Klotz. Mann und Frau hätten ihn am lieb-

Aber: »Widewau, widewau, widewau«, ging das auch bei ihm, »was zum Teufel ist da los, widewauwauwau.« Und Vater, Mutter und Tochter widewauten, daß einem die Haare hätten zu Berge stehen können. Endlich schickten sie die Tochter zum Nachbar Küster, vielleicht wußte der Rat. »Guten Morgen, Herr Küster, widewauwauwau, kommen Sie doch mal, widewau, und helfen Sie uns, widewau, widewau, wir sind alle behext widewauwauwau, sagte der Vater widewauwauwau.« Der Küster dachte, schade um das Kind, es war doch sonst so gescheit, die hat ja ganz den Verstand verloren, und ging mit. Da standen Müller und Müllerin am Herde und schrien auch; »Widewau, widewau.« Als er nun endlich aus ihnen herausbrachte, daß sie hätten Feuer machen wollen und das nicht brennen wolle, sie aber seitdem das verwünschte Wort nicht loswürden, bückte er sich ebenfalls und spitzte seine Lippen, aber es ging ihm
nicht besser. »Widewau, widewau, widewau-wau-wau«, fing auch er nun an. Da war nun guter Rat teuer. Es blieb nichts anderes übrig, als den Pfarrer zu holen, der konnte vielleicht den Zauber lösen. »Widewau, Herr Pfarrer, widewau! Ach, kommt doch, widewau; wir wissen uns nicht zu helfen, widewauwauwau«, so kam atemlos die Müllertochter zum Pfarrer gelaufen. Der folgte ganz erstaunt dem Mädchen, um zu sehen, was es da gäbe. Da fand er denn die ganze Gesellschaft am Herde stehn und »widewau -das Feuer -widewau, widewau -will nicht angehen« — so heulten sie durcheinander. »Widewau, Herr Pfarrer, ach vertreibt doch nur den bösen Geist, widewau-wau-wau, da in dem Herd«, so rief der Müller. »Widewau, ich will auch ein ganz anderer Mensch werden, widewauwauwau, ich will nicht mehr grob und geizig sein, widewau, widewau.« Der Pfarrer rückte seine Brille zurecht und setzte sich gegen den Herd in Bewegung. —Und jetzt spitzt ihr natürlich alle darauf, wie es Hochehrwürden wohl ergehen wird. Das könnte euch wohl passen - aber das weiß kein Mensch auf der ganzen Welt.Denn inzwischen war der Fremde nebenan von dem Lärm munter geworden und hatte rasch seine Kleider übergeworfen. Wie er hörte, was der Müller gelobte, kam er herein, sah das gute schöne Kind, wie es mit den andern um die Wette widewaute, und sagte zum Müller: »Ich will Euch von diesem Zauber befreien, wenn Ihr mir versprecht, daß ich Eure Tochter zur Frau bekomme.« —»Widewau, du sollst sie haben, widewau, und die Mühle dazu, widewau, wenn du uns befreist«, rief der Müller. Der Bursch bückte sich, stocherte ein wenig die Asche auf und nahm unbemerkt das Steinchen daraus hervor. Dann schichtete er das Holz übereinander, blies hinein, und im Nu brannte es hell und lustig, und sofort konnten wieder alle ordentlich und vernünftig reden, und von widewau war nichts mehr zu hören. Der Müller aber hielt Wort; er gab dem jungen Gesellen seine Tochter zur Frau, und der Pfarrer verlobte sie sogleich. Damit waren beide sehr wohl zufrieden, denn sie fanden großes Wohlgefallen aneinander. Das junge Paar mußte nun die Wirtschaft
übernehmen, und so hatte die Not des jungen Müllerburschen ein Ende. Doch vergaß er im Glücke auch seine armen Eltern nicht, unterstützte sie reichlich, und so waren alle glücklich ihr Lebtag. Und auch der Müller war von seiner Grobheit und seinem Geiz kuriert.
Woher die Feindschaft zwischen Hund und Katze
und zwischen Katze und Maus kommt
In alten Zeiten, als die Riesen noch auf Erden wohnten, gab es erst wenig Menschen, und die Riesen kümmerten sich nicht um die und verachteten sie; aber Hund und Katze merkten, daß die Menschen einst die Herren der Erde werden würden und schlossen sich ihnen an. Der Hund ging mit auf die Jagd und trieb das Wild heran und bewachte seinen Herrn, wenn der schlief. Die Katze hütete Küche und Feld und vertrieb das kleine Getier, das sich da unnütz machte. Und die Menschen waren dankbar und gut zu Hund und Katze und teilten ihre Speise mit ihnen. Als aber die Menschen sich vermehrten und mehr Müh und Not hatten, sich zu ernähren, vergaßen sie die treuen Dienste der beiden Tiere und gaben ihnen bald statt des Fleisches nur noch die Knochen. Da gingen zuletzt Katze und Hund vor Gericht und verklagten die Menschen. Die Richter aber getrauten sich nicht, so einen schwierigen Fall allein zu entscheiden und schickten nach einem ganz alten Mann, der wegen seiner Weisheit weit und breit berühmt war. Der Alte kam und besah erst dem Menschen und dann dem Hunde und der Katze die Zähne und sprach: »Hund und Katze sind mehr zum Fleischessen geschaffen als der Mensch; der soll auch Gemüse essen: Der Mensch muß den Hunden und Katzen ein genügend Teil Fleisch abgeben.« Das Urteil wurde auf Pergament geschrieben und den Klägern eingehändigt, damit sie es jederzeit dem Menschen vorhalten könnten, wenn der ihnen einmal wieder ihr Recht verweigern wollte. Froh gingen die Tiere nach
Hause. Aber unterwegs sprachen sie zueinander: »Wie fangen wir es bloß an, daß uns der Mensch nicht über unsere Urkunde kommt und sie in den Ofen steckt?« Der Hund meinte: »Wir legen sie unter einen schweren Stein.« —»Nein«, sagte die Katze, »das geht nicht; wie leicht kann der Mensch sie da finden; und wenn er sie auch nicht findet, so wird sie feucht und verdirbt. Ich will sie in den Hahnenbalken tragen, da ist es hübsch trocken, und dahin kommt auch kein Mensch.«Das war der Hund zufrieden, und die Katze kletterte unters Dach und versteckte das Pergament unter einer Latte.Ein paar Jahre lang taten nun die Menschen nach dem Richterspruch und gaben den Tieren von allem Fleisch, das auf den Tisch kam, ihr Teil ab. Allmählich aber wurden sie nachlässiger, und zuletzt hatten sie den Urteilsspruch des weisen Mannes vergessen, und Hunde und Katzen bekamen wieder nur Knochen. Da wollten sie die Menschen an ihre Pflicht erinnern, und die Katze kletterte unters Dach, um das Urteil zu holen. Als sie aber oben hinkam, da hatten die Mäuse das Pergament ganz zernagt, und es war nicht mehr zu gebrauchen. So konnten die beiden dem Menschen auch ihr Recht nicht beweisen und müssen sich seitdem immer mit den Knochen abspeisen lassen. Der Hund aber wurde bitterböse auf die Katze, und wo er eine erblickt, fährt er wütend auf sie los; die Katze aber sucht ihre Rache an den Mäusen und verfolgt sie, wie sie nur kann, weil sie die Urkunde zerstört haben. —Warum sind sie denn nicht wieder vor Gericht gegangen? Ja, der alte Mann war in der Zeit gestorben.
Der Schmied und der Teufel
Einmal ging unser Herr mit St. Peter auf Reisen, da verlor der Esel, auf dem der Herr ritt, ein Hufeisen. Als sie es merkten, waren sie gerade vor einer Schmiede. Der Meister sah es und rief: »Kommt herein und setzt euch, ihr sollt gleich bedient sein.« Der Herr und
St. Peter traten in die Schmiede, und da beschlug der Schmied den Esel mit silbernen Hufeisen, denn er verdiente viel Geld und war ein guter lustiger Kerl, der gern mal recht nobel war. Und als die beiden fragten, was es kostete, sagte er: »Nichts!«, denn er meinte, es wären zwei arme Schlucker. Unser Herrgott wußte es wohl, daß der Schmied dies dachte. Und ehe sie weiterzogen, sprach er: »Weil Ihr so gut seid, dürft Ihr auch drei Wünsche tun.« —»Schön«, sagte der Schmied und fing an nachzudenken. —»Wähl dir den Himmel!« flüsterte ihm St. Peter zu. —»Zuerst«, fing der Schmied an, »ich hab da hinterm Ofen einen Lehnstuhl, in den setzen sich immer die Bauern, wenn sie etwas machen lassen, und sind nicht wieder herauszukriegen; ich wünsche mir also, daß jeder, der sich hineinsetzt, nicht wieder aufstehen darf, bevor ich es will. Zweitens« — » Wähl dir doch den Himmel!«sprach Petrus lauter zu ihm und zupfte ihn am Ärmel —»wünsche ich mir, daß die Bengels, die da immer auf meinen großen Apfelbaum steigen, alle darauf festsitzen und nicht wieder herunterdürfen, bevor ich es will. Und drittens« —»Wähl dir doch den Himmel, Dummkopf«, rief Petrus ganz ärgerlich. »Ach, da bin ich nicht bange drum, der kann mir nicht entgehen. Drittens wünsch' ich mir, daß alles, was in meine Ledertasche hineinkommt, nicht wieder hinaus kann, bevor ich es will.«Da sprach der Herr: »Es soll alles so geschehen, wie Ihres wünscht«, und zog weiter mit St. Peter, der dem Schmied ein bitterböses Gesicht machte.Der Schmied aber lebte weiter lustig in den Tag hinein und meinte, es sollte immer so fort gehen, aber eines Tages hatte er sein letztes Geld vertan und sein letztes Eisen verschmiedet, saß ärgerlich in seiner Werkstatt und dachte, hättest du dir doch Geld gewünscht statt der drei Schnurrpfeifereien, die dir bis jetzt noch gar nichts genützt haben! Das merkte aber auch der Teufel, denn der spioniert alles aus, und dachte, da ist was zu holen. Und wie noch der Schmied saß und spintisierte, hörte er draußen Pferdegetrappel; er trat in die Tür und sah einen vornehmen Herrn auf die Schmiede zugeritten kommen. Der Fremde hielt vor der Tür und fragte, ob der Schmied ihm sein
Pferd beschlagen wolle. »Gern«, sagte der Schmied, »wenn Ihr nur warten wollt, bis ich mir im nächsten Dorf Kohlen und Eisen geborgt habe.« —»Wenn dir weiter nichts fehlt«, sprach der Reiter, »da will ich dir bald geholfen haben; unterschreib nur dieses Blatt mit deinem Blut!«Auf dem Pergament aber stand, daß der Schmied nach zehn Jahren dem Teufel gehören sollte, wenn ihn der mit Kohle und Eisen versorgte. Zehn Jahre ist lang, dachte der Schmied und sprach: »Gib her, lieber die Seele dem Teufel verschreiben als noch länger so dasitzen und nichts tun und Hunger leiden!« Ging in die Schmiede, schlug mit dem Knöchel gegen den Amboß, daß ihm das rote Blut heraussprang, und unterschrieb das Pergament. Und als er wieder hinauskam, lag so viel Eisen und Kohle auf dem Hof, daß er gar nicht wußte, wohin damit. Nun beschlug er das Pferd, und der Herr ritt fort. Der Schmied aber arbeitete nun wieder lustig drauflos, bekam bald große Kundschaft und hatte ein gutes Leben und kümmerte sich den Teufel was um den Teufel. Aber die zehn Jahre gingen rasch herum, und pünktlich kam der feine Herr, um den Schmied zu holen. »Ihr seid sicher müde, setzt Euch ein bißchen hintern Ofen in den Lehnstuhl, geduldet Euch nur so lange, bis ich gegessen habe. Es schmeckt mir wohl so bald nicht wieder.« Der feine Herr grinste, und der Schmied grinste auch. Der Herr ließ sich gemütlich in den Großvaterstuhl nieder, und der Schmied aß gemütlich weiter, und als er fertig war, sagte er: »So, nun kann die Reise losgehen.« Der Teufel wollte auf ihn los, kam aber nicht auf und brüllte einen Fluch so lang wie Jakobstag. Der Schmied aber hatte unterdessen eine Eisenstange geholt und zählte ihm was auf, bis der Teufel schrie: »Hör auf, laß mich los, ich will dir noch zehn Jahre geben!« — »Das läßt sich hören, nur mach, daß du fortkommst!« sprach der Schmied, und fort war der Teufel.Nun fing der Schmied das alte herrliche Leben von neuem an, aber die zehn Jahre gingen wieder rasch herum; diesmal schickte der Oberteufel seinen ältesten Gesellen. »Ich bin gleich fertig«, sagte der Schmied, »aber ein paar Äpfel sollten wir uns doch mitnehmen, sie
sind gerade so schön reif, sowas gibt's in der Hölle nicht, da könnten wir sie so gut braten. Du kannst gewiß gut klettern; bring vier, wenn du nicht gern drei bringst.« Der Teufel war flink hinauf wie eine Katze, aber mit dem Herunterkommen hatt's lange Zeit. »Kommst du noch nicht bald wieder?« spottete der Schmied. »Ich kann ja nicht«, brüllte der Teufel; der Schmied aber setzte an und bearbeitete den Teufel so lange, bis der schrie: »Hör auf, ich will dir noch zehn Jahre geben!« — »So, nun mach, daß du fortkommst!« rief der Schmied, und fort war des Teufels Altgeselle.Aber diese zehn Jahre waren auch wieder schnell vergangen, und nun kam der Oberteufel in eigener Person, um den Schmied zu holen. »Meinetwegen«, sagte der Schmied, »aber es ist mir doch etwas genierlich, wenn nachher alle Leute im Dorfe sagen, der Teufel hat den Schmied geholt. Ich habe gehört, du könntest dich so groß und so klein machen, wie du wolltest. Wenn das wahr wäre, könnte ich dich ja auch in meinen Ranzen nehmen und dich ein Ende tragen, bis wir zum Ort hinaus sind. Aber ich glaube nicht, daß ihr solche Kunststücke versteht. Bis jetzt hast du mir nur so dumme Teufel geschickt.« Der Teufel traute wohl dem Schmied nicht recht, aber er konnte sich nicht denken, daß da ein Betrug hintersteckte, und außerdem war er rein beteufelt, sehen zu lassen, was er konnte. Er machte sich also ganz klein und fuhr in die Schmiedetasche hinein, und der Schmied schnallte sie bedächtig zu. Dann ging er damit in die Schmiede, legte sie auf den Amboß, rief seine Gesellen und hämmerte mit ihnen darauflos, daß der Teufel schrie, als ob die Erde berste, und ganz jämmerlich um Gnade winselte. »Erst gib meine Unterschrift wieder heraus!« — »Ja, ja!« schrie der Teufel. Da machte der Schmied die Tasche ein bißchen auf, und der Böse reckte die Verschreibung heraus. Der Schmied nahm sie. »So, nun mach, daß du fortkommst«, rief er, und fort war der Oberteufel.
»Gott sei Dank, den bin ich los!«sprach der Schmied. Nun lebte er noch einige Jahre friedlich und gemächlich. Dann spürte er, daß sein letztes Stündlein kam, hängte sich seine Ledertasche um, setzte sich
in seinen Lehnstuhl und starb mit unbeschwertem Gewissen. Dann kam er zum Himmel und klopfte ruhig an die Tür. Aber als St. Peter den Mann sah, der nicht auf seinen Rat hatte hören wollen, sagte er barsch: »Dickkopf, du kommst hier nicht herein! Warum hast du dir damals nicht den Himmel gewünscht!«und schlug die Tür vor ihm zu. »Dann bleibt mir nichts übrig, als nach der Hölle zu gehen«, sagte der Schmied.Als er da ankam und anklopfte, guckte der Teufel, der gerade an dem Tage Pförtneramt hatte, erst durch den Türspalt, und das war gerade einer von denen, die der Schmied so jämmerlich verprügelt hatte; als der den schrecklichen Schmied sah, war er so entsetzt, daß er fast in Ohnmacht fiel und kaum noch den andern zurufen konnte, sie sollten ihm helfen, fest zumachen, der Schmied wäre vor der Tür. Da rief der Oberteufel: »Der mit der Ledertasche? Laßt ihn ja nicht herein!« Und die andern wußten vor Schrecken gar nicht, wo sie den Riegel von der Höllentür hingetan hatten; da steckte rasch einer seine lange Nase statt des Riegels vor, daß er nur nicht hineinkäme. Der Schmied wartete und klopfte und rüttelte, aber die Höllenpforte blieb ihm verschlossen, und er mußte zuletzt wieder nach dem Himmel zurückwandern. Er klopfte zum zweitenmal, und St. Peter schnaubte ihn zum zweitenmal und noch barscher an, für ihn wäre hier kein Platz. Da bat ihn der Schmied, dann möchte er ihn doch nur mal durch die Spalte sehen lassen, wie schön es im Himmel wäre. Der Apostel mochte ihm das nicht abschlagen und tat die Tür ein wenig auf, da steckte der Schmied seinen Arm durch. »Au, au!« schrie er, »mach doch etwas weiter auf, daß ich meinen Arm zurückziehen kann!«St. Peter tat es, da steckte der Schmied flugs auch seinen Kopf durch. »Unverschämte Seele!«rief der Pförtner, »zieh deinen Kopf zurück!« — »Ich kann nicht, du quetschst mich ja - um Gottes willen, mach noch etwas weiter auf!«St. Peter mußte die Tür noch etwas mehr öffnen. —Im Nu sprang der Schmied in den Vorhof der seligen Wohnungen, warf seine Ledertasche hin und setzte sich drauf. »Heraus mit dir, du frecher Patron«, rief St. Peter. »Ich sitze
auf dem Meinen«, antwortete der Schmied ganz ruhig. Rot vor Zorn eilte St. Peter zu seinem Herrn und Meister und erzählte es ihm. Und unser Herr stieg nieder von seinem Sitz, um die böse Seele zu sehen und hinauszutreiben. Als er aber den Schmied erkannte, der ihm einst so nobel den Esel beschlagen hatte, lachte er und sprach zu dem Apostel: »Laß ihn sitzen, er sitzt gut.«
QUELLENHINWEISE UND ANMERKUNGEN
Neun Märchen aus der Zeit vor Grimm sind aus dem seit langem vergriffenen Band »Deutsche Märchen vor Grimm« entnommen, der im Jahre 1938 im Verlag Rudolf M. Rohrer in Brünn (Mähren) erschien und von Albert Wesseliski herausgegeben wurde. In Stil- und Schreibweise haben wir einige geringfügige Änderungen einzelner Texte vorgenommen.
Das Märchen vom Erdkühlein ist erstmals gedruckt worden in einem der Schwankbücher von Paul Messerschmidt in Straßburg, vermutlich zwischen 1559 und 1566. Als Herausgeber wurde damals M. Montanus genannt. In der damaligen alemannischen Ausgabe hieß es dort »Erdkülin«. Es handelt sich um die wohl älteste deutsche Darstellung des Aschenbrödel-Märchens. Bekannt ist, daß Goethe, der das Märchen wohl während seiner Straßburger Studentenjahre kennengelernt hat, es sehr liebte. Den Brüdern Grimm ist es seltsamerweise fremd geblieben.
»Die Padde« stammt aus den Kindermärchen, die in Verbindung mit Volkssagen und Legenden J. G. Büsching im Jahre 1812 herausbrachte. Es scheint auf das französische Vorbild der »Chatte blanché«zurückzugehen (Madame d'Aulnoy). Auch »Der Riesenwald«geht wohl auf die Bearbeitung eines Märchens der Madame d'Aulnoy zurück. Es gehört zu den französischen Feenmärchen und zeigt deutliche englische Einflüsse.
»Hans Dudeldee«gehört zu den 1809 erschienenen Kindermärchen von Albert Ludwig Grimm - es ist nach Aussagen, die ihm in seiner pommerschen Heimat zu Ohren gekommen waren, von dem in Wolgast geborenen Maler Philipp Otto Runge zu Papier gebracht worden. Er ließ ein anderes pommersches Märchen -den »Machandelboom« —in Achim von Arnims Zeitschrift für Einsiedler »Tröst Einsamkeit« erscheinen. Die Brüder Grimm haben dieses und eine andere Fassung des »Hans Dudeldee« in pommerschem Platt später in ihre Sammlung aufgenommen. Albert Ludwig Grimm, dessen Märchenband vorher herauskam, war nur deren Namensvetter.
»Die sieben Schwäne«gehören zu den in Braunschweig herausgekommenen Feenmärchen und sind vermutlich flämischen Ursprungs. Die Brüder Grimm brachten davon eine andere Fassung.
»Der Popanz« entstammt der Büschingschen Sammlung, und es gibt in den Grimmschen Märchen dazu zwei Varianten.
»Die drei Gürtel«gelten als eins der besten Stücke der Braunschweigischen Sammlung. Eine Nuß mit höchst wundersamem Inhalt kommt bereits in einem italienischen Märchen aus dem sechzehnten Jahrhundert vor.
»Die drei Königssöhne«gehören zu den Kindermärchen von Albert Ludwig Grimm (vermutlich Anfang 1809 erschienen).
»Der Stein der Weisen« stammt von Wieland. Das Märchen steht im ersten Band des Sammelwerkes »Dschinnistan - auserlesene Feen- und Geistermärchen«, übersetzt und umgearbeitet von Wieland und anderen, gedruckt in Winterthur, 1786.
Die Kinderschnurre »Vom Hühnchen und vom Hähnchen«erschien 1808 im dritten Band des von Achim von Arnim herausgegebenen »Des Knaben Wunderhorn«. Das Märchen »Die Elfen«erzählte Luwig Tieck 1811 im ersten Band seines »Phantasus«. Wichtige Motive daraus ähneln der bekannten Geschichte vom Mönch von Heisterbach, kommen aber auch in uralten japanischen Märchen vor. Man begegnet ähnlichen Dingen bei Walter Scott.
Justinus Kerners »Goldener« wurde erstmals in dem von ihm zusammen mit de la Motte-Fouqu& Uhland und anderen herausgegebenen »Deutschen Dichterwald« gedruckt, der Ende Mai 1813 herausgekommen ist, etwa fünf Monate später also als die Märchen der Brüder Grimm. Niedergeschrieben wurde das Märchen reichlich zwei Jahre zuvor. Uhland selber widmete dem Märchen ein überschwengliches Lob und schrieb dazu: »Wie soll ich Dir genug danken für Dein himmlisches, goldenes Märchen, das so ganz Goldglanz ist! Man sollte es an trüben Abenden lesen, um den goldnen Abendglanz dadurch zu ersetzen.« Kerner selber wähnte, es liege diesem Märchen eine Volkssage oder Volksdichtung zugrunde, doch beruht das auf einem Irrtum.
Die acht von Ernst Moritz Arndt aufgenommenen Märchen gehören wohl zu den schönsten Stücken, die dem auf der Insel Rügen Geborenen von Mägden und Knechten in seiner Kindheit auf den Äckern und Wiesen erzählt worden sind, die zum väterlichen Hof gehörten. Arndts Wunsch und Wille ist es gewesen, Volksmärchen zu erzählen und nicht etwa als Dichter von Kunstmärchen den Romantikern zu folgen. Sein erster Märchenband erschien 1818. Dessen Inhalt ist größtenteils in sehr früher Jugend unmittelbar aus dem Mund älterer Menschen vernommen worden und wurde »dann durch ein gutes volles Menschenalter weitererzählt«. Arndt berichtet aus seinen Kindertagen: »Im Bett, und zwar in einem dunklen Kämmerlein, ward Erzählung getrieben. Ich für meinen Teil hatte mir einen fabelhaften Goldadler vor einen luftigen Wagen gespannt, und er hat mich zu Magnetinseln und in Diamantgruben, in die Höhlen von Riesen und Zauberern und in die goldenen Paläste der Unterirdischen . . bis unter die gefährlichen Flügel des Vogels Rock getragen.« Immer wieder,
auch noch im späteren Alter, muß Arndt, wenn er bei Familien mit Kindern zu Gast erscheint, seinen Goldadler anschirren, und reicher Segen entströmt seiner heimatlichen, nie versiegenden Phantasie. Die Erstausgabe seines mit sechs Kupferstichen geschmückten Märchenbandes erschien i 818 im Berliner Verlag seines Freundes Georg Reimer. Später hat er noch weitere, meist plattdeutsche Märchen und Geschichten folgen lassen.Im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts, nachdem durch das Unternehmen der Brüder Grimm das Märchensammeln allmählich Schule machte. sind nachher u. a. Wolfs »Deutsche Hausmärchen« —zumeist im Großherzogtum Hessen-Darmstadt gesammelt -erschienen, ferner Colshorns »Märchen und Sagen« aus dem Hannöverschen. In Tirol gehörte Kinder- und Hausmärchen haben die Brüder Zingerle herausgegeben. Ulrich Jahn sammelte pommersche Märchen. Hirten erzählten Märchen in der Schweiz. Seefahrer und Fischer taten's an der Wasserkante. Es fanden sich Volksmärchen aus allen deutschen Landschaften bis nach Siebenbürgen. Von den Erzählern wurden sie je nach Umwelt, Beruf und sozialer Stellung umgeformt und -gestaltet. Sie mischen sich mit Schwänken, Legenden und Sagen. Zauber- und Wundergeschichten spannen häufig aufgegriffene Märchenthemen weiter. Foppereien und wirklich wunderbar Erscheinendes gediehen zu unerschöpflichen Mischungen. Paul Zaunert hat in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in der von Friedrich von der Leyen besorgten herrlichen Sammlung »Märchen der Weltliteratur« zwei stattliche Bände »Deutsche Märchen seit Grimm« zusammengestellt. Mit Erlaubnis des Verlages Eugen Diederichs haben wir für den Schlußteil dieses Bandes ii Märchen daraus entnommen.



