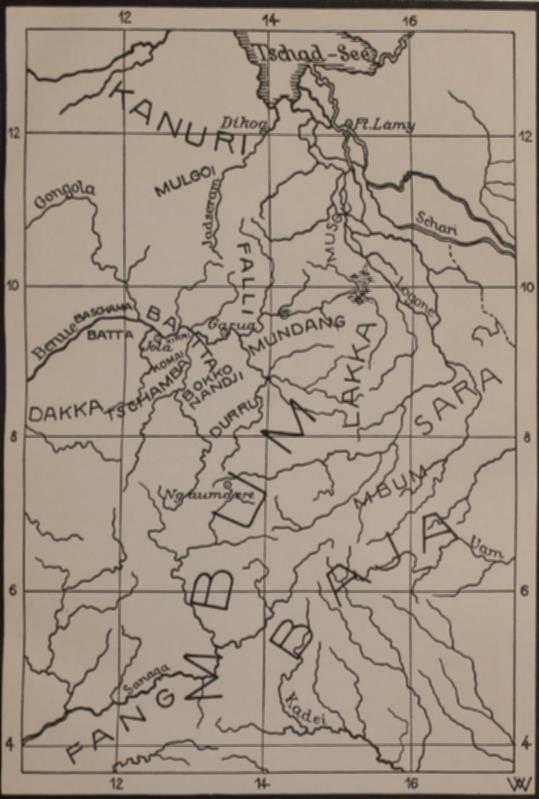|
DICHTEN UND DENKEN IM SUDANHERAUSGEGEBEN VON LEO FROBENIUS 1925 VERLEGT BEI EUGEN DIEDERICHS/JENA TITEL- UND EINBANDZEICHNUNG VON F.H. EHMCKE MIT EINER KARTE UND EINER TAFEL ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER ÜBERSETZUNG IN FREMDE SPRACHEN VORBEHALTEN 1 COPY-RIGHT 1925 BY EUGEN DIEDERICHS VERLAG IN JENA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es wurden genannt die von den Schamba von den Dakka
Tschamba Tsamboa Samba
Dakka Nagajare Nagajarembu
Komai Ko-öma Kombu
Werre Moma Mombu
|
Es wurden genannt die von den Schamba von den Dakka
Batta Kago Kambu
Nandji Namsöma Namdjibu
Bokko Wógo Wogobu
Bum Bumma Bumbu
Durru Durrubira Durrubu
Fulbe Pulla Tullibu
Haussa K'haussa Haussabu
Kanuri Sirto-jibira Sirtobu |
Das war mir eine sehr interessante und bis dahin unbekannte Tatsache, daß die Kanuri von allen heidnischen eingeborenen Stämmen als Sirreto bezeichnet wurden.
Altersklassen, Beschneidung, Weiberentzahnung. — Die Tschamba zerfallen, wie alle Äthiopen, in Altersklassen, die die folgenden Namen haben:
Wabengsa = Baby
Wadja = noch nicht Beschnittener
Wagabsa = Beschnittener
Nena = Verheiratete
Nengabaroa = Patres familias, auf der Höhe des Lebens
Doroa = Greise, die nichts mehr vermögen und nur noch als
eine Last angesehen werden, wenn man sie das bei
den Tschamba auch nicht so zu fühlen lassen scheint
wie bei manchem andern Volke. Diese Greise sind
übrigens die einzigen, die Eier essen dürfen. Man
sagte, wenn junge Menschen Eier essen würden,
bei etwaiger Verwundung das Blut nach innen statt
nach außen laufe, und das wäre sehr schlimm.
Dieses Verbot, Eier zu essen, ist sehr streng. |
Der bedeutsamste Augenblick für die jungen Leute ist fraglos der Übergang vom Wadja zum Wagabsa. Der Wadja gehört noch, auch wenn er dem Vater bei der Farm hilft, in den Mutterschutz. Der Wagabsa ist von dem Gängelband losgelöst. Die Beschneidung bedeutet den großen Wendepunkt der Trennung von familienzugehöriger Kindheit und staatsrechtlicher Stammeszugehörigkeit. Der betreffende Monat (= sua, in Fulfulde: Leuru, in Haussa: Watta, in Kanuri: Kontagu, d. h. Mond und Monat), in dem das besonders zu sehen ist, heißt Suo-dinga. In diesem spielen sich die großen Zeremonien und Opferfeste ab, und dann gehen die Beschnittenen mit den Männern und Stammesleuten in geweihte Genossenschaft, während die Unbeschnittenen gleichwie Kinder mit den Weibern in die Frauenhäuser zurückgedrängt und strengstens von der Opfergemeinschaft ausgeschlossen werden.
Die Tschamba rufen die Burschen nicht jedes Jahr, sondern alle vier Jahre zusammen. Nach Beendigung der Ernte und der Erntezeremonien, im Beginn der kalten Nächte, also im November, werden sie mit in den Busch genommen und bleiben da draußen bis zur nächsten Pflanz- und Saatzeit, d. s. also vier Monate. Die Zeremonie geht ihren wohlgeordneten Gang. Zunächst wird draußen im Busch ein Platz gesäubert, der als Beschneidungslager hergerichtet wird. Ein alter Mann, der als Gabsa bezeichnet wird, sammelt die Buben und Burschen. Alle Väter, ältere Brüder und Onkel schließen sich dem Zuge an und legen draußen hilfreich Hand an.
Der Beschneider, der Womba, selbst legt zunächst seine Tracht an, die durch eine Tasche, hergestellt aus der abgezogenen Pranke eines Leoparden, bezeichnet wird. In dieser, Goea genannten Tasche, befinden sich die Kamsa, die Beschneidungsmesser. Ein Bube nach dem andern wird von seinem Angehörigen herbeigebracht. Die Buben müssen bei der Operation stehen. Sie dürfen nicht mucksen, sonst bekommen sie von ihren Vätern, Brüdern usw. arge Puffe. Und eine gewaltige Schande ist es für den, der etwa schreit. Nach der Operation (Praeputium =Adellgussa, Beschneidung =Gaba) wird die Wunde gewaschen und mit heilenden Blättern verbunden.
Abends erklingen dann die hölzernen Schwirren, die Langa. Die älteren Männer, Väter, Brüder und Onkel gehen heim. Im Beschneidungslager bleiben nur die Laela, das sind die Burschen, die vier Jahre vorher die Operation und Zeremonie durchgemacht haben. Diese haben die Pflege der Beschnittenen in diesen vier Monaten. Die Frauen bringen täglich das Essen aus dem Orte in die Nähe, stellen es am verabredeten Orte hin und die Laela gehen dann und holen es ab. In vorsorglicher Weise wird übrigens vorgeschrieben, daß in der Tunke keine scharfen Gewürze seien. —Die Zeit nach Heilung der Wunde wird erfreulich verbracht, so fröhlich und gesund, daß sie den Buben eine schöne Erinnerung fürs Leben bleiben muß. Unter Anführung des Laela begeben sie sich täglich weiter hinein in den Busch und suchen kleine Tiere zu erlegen, bald fischend im Bach, bald Fallen stellend und ihnen auflauernd. Alles, was sie so ergattern, ist ihre eigene Beute — nur eines nicht, die Paela, die kleine Art der Feldratten, die allgemein als eine der größten Buschdelikatessen gilt. Die kleinen Paela fangen sie aber vorzugsweise, schneiden ihnen dann den Bauch auf und rösten oder räuchern sie. Die kleinen Paela werden so sorgfältig wie nur möglich und so reichlich wie nur irgend erreichbar gefangen, geräuchert und aufgespeichert. — Es ist eine große Ehre, recht viel von diesen kleinen Buschbewohnern einzuheimsen. Einige Burschen haben am Ende der Beschneidungszeit nur 50, aber andere 100, 200 und ganz besonders geschickte Jäger gar an die 300 solcher Beutestücke, diese alle erhält gewissermaßen
als Dankes- oder Opfergabe der große Wombaa, der Oberpriester der heiligen Eisenschellen, der Jeskinna. Sie werden ihm am Ende der Beschneidungszeit überliefert. Alles andere Wildbret aber, große Ratten und Fische, allerhand Buschkätzchen, Schlängelchen, Insekten, kleine Antilopen usw. wird von den Burschen zum eigenen Genusse mit ins Beschneidungslager gebracht, wird da geröstet (nicht gekocht) und verzehrt.
Im Busche tragen die Burschen nur Jessa, das sind Blätterkleider. Am letzten Tage kommen aber die Väter und Brüder in das Beschneidungslager, schneiden den Burschen die Haare und geben ihnen die Kleider der erwachsenen Männer, das aus einem vorderen (gonubea) und einem hinteren Baumwollschurz (belbea) besteht. Nassa, die Büffelkopfmaske, und die Walaera, die Bläser, die hier Läre genannten Balaiken, die schon am Tage der Beschneidung bliesen, kommen wieder und tanzen und schließen so die viermonatige Beschneidungsperiode ab, so wie sie sie vorher einleiteten.
Sie bringen in feierlichem Aufzuge die Beschnittenen tanzend und blasend zum Orte zurück, wo alle gemeinsam vor dem Häuptlingsgehöft einen Reigen aufführen und wo die Weiber sie schreiend und händeklatschend begrüßen. Jede Familie hat gutes Bier (barma) und viel Essen bereitet. Das alles wird nun zum Platze vor dem Königsgehöft gebracht, und alle Welt ißt und trinkt sich gründlich satt. Der König selbst begrüßt die Beschnittenen und sagt ihnen, daß sie nun keine Kinder mehr wären. Abends aber geht das fröhliche Jubilieren wieder in ein ernsteres Stadium über. Die Schwirren erklingen nun wieder, Weiber, Kinder und Unbeschnittene flüchten.
Wenn nun aber im Busch ein Bursche starb, so sagt man das an diesem Tage der Mutter, und zwar hier mit den Worten: "langa bobyokse fuaja", d. h.: "Langa hatte kein Fleisch, da hat er deinen Sohn gegessen."Jene Mutter verfällt dann in Traurigkeit und Klagen, während die andern fröhlich sind. Es sei übrigens bemerkt, daß die Weiber ganz genau wissen, was in dem Buschlager vor sich geht, nämlich daß dort die Beschneidung vorgenommen wird. Aber niemand spricht hierüber ein Wort, wie überhaupt nicht einmal der Gatte zur Gattin je eine Silbe über geschlechtliche Dinge äußert. Es herrscht nur eine Überzeugung, auch unter den Fulbe, daß alle diese äthiopischen Stämme von einer ungeahnten und unvergleichlichen Keuschheit seien.
Natürlich kann es nicht unterbleiben, daß die Weiber trotz aller Furcht vor den Tönen doch zuletzt einmal auf den Busch klopfen und über das Wesen der unheimlichen Buschstimmen aufgeklärt sein möchten. Dann sagt man ihnen, daß Langa ein Urahne sei, der zum Biertrinken und Essen käme, daß man ihn fürchten müsse und daß er nur Wenige freundlich anspreche. Die Beschneidung selbst
wird aber ganz bestimmt und klar mit dem Langa in Verbindung gebracht, und jeder Tschamba, mit dem ich über diese Sachen sprach, hat mir mit aller Bestimmtheit versichert, daß der Nichtbeschnittene auch nicht in den Langaverband aufgenommen werden könne. — Mädchen werden nicht beschnitten. Dagegen werden ihnen die beiden mittleren der oberen Schneidezähne ausgeschlagen, was bei den Knaben nicht stattfindet. Diese Goja genannte Zeremonie soll aber im gewissen Sinne der Beschneidung der Burschen entsprechen. Demnach werden alle vier Jahre die Mädchen in der Stadt versammelt und ein Mann schlägt ihnen zwei Schneidezähne oben in der Mitte heraus. Es tanzen weder Nassa noch Balaiker. Jeder Mann kann der Operation zusehen. Die folgenden vier Tage dürfen die Frauen nur Bier trinken und nichts Festes essen, dann ist ihre Duldezeit vorbei. Die Lücke zieht sich ziemlich stark zu.
Jugendliche, Verehelichung, Beischlaf, Kinder. —Mit dem Abschluß der Beschneidungszeit beginnt für den Burschen aber auch der Eintritt in das Interessenleben der Männer, auf deutsch, er schafft sich möglichst schnell einen Schatz, eine Freundin an. Freund und Freundin nennen sich gegenseitig Ssamura. Die Anknüpfung ist eine durchaus bequeme. Wenn ein Bursche ein Mädel am Brunnen oder beim Tanzen sieht, zupft er sie am Arme, daß sie ein wenig mit ihm zur Seite trete, und fragt sie dann: "Willst du meine Ssamura sein?" Wenn das Mädchen zustimmt, was mit Sicherheit der Fall ist denn diese Naturkinder wissen sich ihre gegenseitigen Empfindungen besser abzutasten als wir im Denken erzogenen und daher im Empfindungsaustausch vergröberten Menschen — dann sendet der Bursche dem Vater des Mädchens am andern Tage die ersten Geschenke, die von da an häufig wiederholt werden. Es sind keine großen Gaben, sie beschränken sich auf Hühner, kleine Jagdbeuten und dergleichen.
Und von da an schlafen der Bursche und das Mädchen, die beiden Ssamura, miteinander, bald sie im Hause seiner Eltern, bald er im Gehöft der ihren. Aber niemand spricht davon. Niemand schenkt dem auch nur eines Augenaufschiages Beachtung. Angeblich schlafen die beiden Liebenden wie Kinder völlig harmlos miteinander; ich will diese Möglichkeit gar nicht bestreiten, denn es wird uns viel zu schwer, uns in das Sexualleben dieser urkeuschen und urnatürlichen Völker hineinzudenken. Jedenfalls wird alles als ein großes tiefes Geheimnis, d. h. als ein selbstverständliches, das keiner Beachtung wert ist, behandelt und das Verhältnis in diesem Sinne auch gewissermaßen respektiert. Und das dauert so an die zwei bis drei Jahre.
Eine Heiratsverpflichtung liegt jedoch nicht darin. Wenn einmal Streit ausbricht, gehen beide auseinander, und dann heiratet wahrscheinlich
jedes einen andern, nur nicht diesen ersten Ssamura; und das, ohne daß der eine oder andere nun für das Leben gekränkt oder das Mädchen in seinem sozialen Ansehen auch nur im allergeringsten geschädigt ist. Wenn dagegen die Ehefrage reif wird, so arbeitet der Bursche für seinen Schwiegervater etwa ein Jahr in der Farm, beim Hausbau und dergleichen, ohne daß er dadurch natürlich von der Pflicht, seines Vaters Farm in Ordnung zu halten, behoben ist.
Für die Verehelichung selbst hat der Bursche dann dem Schwiegervater die beträchtliche Menge von 20 großen Krügen Bier zu leisten. Dies Sorghumbier gilt den Tschamba über alles, wenn sie auch Barma (Bier) aus Mais (Bankara) herzustellen wissen. Gegen Abend bringt der Bursche dann noch eine Gilla, d. i. ein Schaufeiblatt in der Form der Battahacken zu seinem Schwiegervater. Er legt das Schaufeleisen in dem Empfangs- und Durchgangshause nieder und nimmt seinerseits die Braut vom Vater in Empfang. Die Freunde des Burschen stellen sich mit ein und bilden bei der Heimführung der Braut einen stattlichen Zug. Die Braut selbst weint nicht, zeigt keinerlei Trauer oder Schmerz, sondern geht in Gelassenheit mit. Alles das vollzieht sich in fröhlicher Ruhe und gemessener Würde. Die Ausstattung selbst wird erst fünf Tage später der jungen Frau zugesandt.
Die Brautnacht selbst wird den Ehevollzug nicht erleben. Die langsame Annäherung erfordert zwei bis drei Tage, und dann wird sittengemäß der Jüngling der Jungfrau noch ein Huhn oder eine Gilla stiften müssen, ehe sie ihm wilifährt. Die Stellung der Koitierenden ist die äthiopische. Der Mann hockt nieder, hat die Frau, die sich angeblich hier mit den Armen rückwärts auf den Boden stützt, hingezogen und hält sie mit seinen Armen um den Nacken umschlungen. Die Beine des Weibes liegen um die Lenden des Mannes. — Hier möge noch das Ergebnis einer Unterhaltung mit einem Manne niedergelegt sein, der lange Jahre bei den Tschamba Sklave gewesen, der in dieser Zeit nicht ihre Keuschheit, wohl aber deren Sitte angenommen hatte. Der Mann äußerte sich über diese Form des Beischlafes folgendermaßen: Es wäre bei den alten Tschamba die einzige, die als anständig gelte und derzufolge man unbedingt auf Nachwuchs rechnen könne; einige wenige, in der näheren Umgebung der Fulbesiedelungen ansässige Tschamba hätten die bei den Fulben übliche Deckungsform angenommen. Das gelte aber als widerlich bei den alten Tschamba; außerdem hätten diese beobachtet, daß solche Ehen geringe Aussicht auf baldige Nachkommenschaft hätten; im übrigen hätte er, der frühere Tschambasklave, der mit einem Tschambamädchen verheiratet gewesen sei, diese Frau nie bewegen können, den Koitus mit ihm in der Decklage auszuführen. Wenn man den Koitus in der Hockstellung ausführe, so wäre es für keinen Mann
möglich, ihn ein zweites Mal in der gleichen Nacht oder auch nur in der nächsten auszuführen. Vielmehr verlöre man alle Kraft dabei, während man den Koitus in der Decklage sehr gut mehrfach in jeder Nacht ausführen könne, wenn man nur von Zeit zu Zeit eine Nacht aussetze, was die Fulbefrauen, mit deren einer er jetzt verheiratet sei, denn auch sehr schätzten, denn diesen kommt es weit weniger auf reichlichen Nachwuchs als auf reichlichen Geschlechtsgenuß an. Ich halte diese Ausführungen aus dem Grenzgebiet zweier so weit verschiedener Rassen und Kulturen für wichtig genug, um sie dem Aktenmaterial beizufügen. (Ceterum: beschlafen = mussoja; penis waela; Skrotus gola; Vagina = faä; Klitoris fawa).Im allgemeinen verlangt und erwartet man, daß die Neuvermählte in der Brautnacht Blut verliere. Aber man spricht sich im Falle eines Ausbleibens solchen Zeichens nicht mit den Schwiegereltern, ja nicht einmal mit der jungen Frau aus. Das widerspricht dem Keuschheitssinne der alten Tschamba. Immerhin verbreitet das Gerücht der Tatsache sich doch nach und nach und die junge Frau entgeht dann nicht reichlichem Gespött, das zwar auch wieder verhalten ist, deswegen aber nicht weniger beißend zu sein braucht.
Die Ausstattung folgt fünf Tage nach der Verehelichung, und zwar besteht sie in Töpfen Kjaela und Kalebassen =Maga. Ein Mörser wird nicht mitgesandt, da die Tschamba ihn nicht kennen; sie mahlen nur in Steinmühlen.
Das junge Ehepaar lebt im väterlichen Gehöft des Ehemannes und bleibt immer darin wohnen. Das ist der große Unterschied, der das soziale Leben der Tschamba ganz anders als das der meisten andern Splitterstämme Nordkameruns gliedert: Während bei den andern das junge Ehepaar einige Zeit nach der Verheiratung als junge triebkräftige Familie selbst aus dem Gehöft des Hausvaters in ein eigenes Heim verpflanzt wird, bleibt der Familienzusammenschluß bei den Tschamba fest geschlossen. Bei ihnen ist die Familie eine Einheit, eine Wirtschaftsgenossenschaft; alle Familienglieder haben gemeinsam die gleichen Farmen zu bewirtschaften und an ihren Ergebnissen sittengemäß und ihrer Stellung nach herkömmliche Anrechte. Bei den Tschamba verhält sich das alles wie bei den Joruba und deren Verwandten am Benue.
Die Arbeitsteilung der Geschlechter im Familienverband ist folgende: Die Männer bauen die Häuser, wobei die Frauen nur Wasser herbeibringen und den Boden klopfen; sie spinnen und weben alle Netzarbeiten, das Formen der Tonpfeife zum Rauchen und der größte Teil der Farmarbeit sowie selbstverständlich endlich das ganze Schmiedehandwerk fällt ihnen zu. Die Frauen ihrerseits tragen Holz und Wasser, bereiten Öl und kochen die tägliche Nahrung, in ihren
Händen liegt die Töpferei und Kalebassenherstellung, sie helfen dem Manne bei der Farmarbeit und haben natürlich die Fürsorge für die Kinder, die nicht im Rückenleder, sondern auf der Seite, oft auch auf den Schultern in Reitstellung getragen werden, im übrigen tragen sie wie die Männer alle Arten von Lasten, Holz, Körbe wie Töpfe auf dem Kopfe, irgendwelches Schultertragen ist durchaus unbekannt.Das Feuermachen erfolgt auch hier lediglich mit Stein und Eisen. Das Rohrfeuerzeug ist gänzlich unbekannt. — Das führt aber unbedingt zur Besprechung der Stellung der Schmiede, die die beiden wichtigsten Kulturgeräte der Tschamba, Feuerzeug und Schaufel, herstellen. Die Schmiede sind bei den Tschamba ungemein verehrt. Die Tschamba selbst sagen: sie sind geachtet wie die Könige. Und trotzdem wird kein Mensch sich je mit einer Schmiedefamilie durch Ehe in Beziehung bringen wollen; man heiratet nicht ihre Töchter und gibt die eigenen nicht ihren Söhnen. Die Schmiedefamilien heiraten danach stets untereinander. Dieser strenge Abschluß einerseits, und die Achtung, die man ihnen entgegenbringt, anderseits, wurde mir von den Tschambaalten mehrmals betont, und es war ihnen wichtig, daß ich darüber keine falsche Anschauung mit nach Hause nähme. Fernerhin: Die Schmiede stehen in einem bestimmten Zusammenhange mit allen heiligen Dingen. Man glaubt, daß von ihnen sowohl die Schwirren und Jeskinna stammen, als daß sie die Urheber der Beschneidung wären. Solche Angabe ist nicht durchaus beweisend, da zwar alle Geräte, die heute zu dieser Zeremonie benutzt werden, Schwirren, Glocken, Messer usw., von Eisen sind, früher aber geradesogut aus andern Materialien bestanden haben können. Noch größere Reihen von Übereinstimmungen und Sinnwerten der Entwicklungstendenz beweisen die verbale Volkstradition.
Das Volk der Tschamba zerfällt in verschiedene Familien, als da sind: Dingkuna, Sankuna, Salkuna, Pellakuna, Turrukuna, Bem.. sonikuna, Ulerukuna, Samkuna, Leutschukuna, Kwamkwamkuna usw., womit für uns zunächst nur Namen gegeben sind. Denn ich habe keine Spur irgendeines Totemismus feststellen können in dem Sinne, daß irgend jemand ein heiliges Tier oder Gewächs besonders verehre, nicht verzehren dürfe usw. Eine einzige Angabe dieser Art fand ich. Es gibt auch eine Familie Jamkuna, die nicht den Hund ißt. Nun heißt der Hund hier Jagala oder Jagara. Da kuna Familie bedeutet, so kann Jam eine abgekürzte Form des Wortes für Hund sein; also würden wir die Bedeutung des Familiennamens ebenso annehmen dürfen wie bei den Dakka, bei denen in jeder Vorsilbe das Tier oder Gewächs angegeben ist, das verschmäht werden muß. Späteres Studium wird also wahrscheinlich die einstigen Wappentiere der Tschambafamjljen noch feststellen können. Dies ist um so wahrscheinlicher, als mit dieser Familien-Kunagliederung strenge
Exogamie verbunden ist. Niemand darf einen andern aus gleichnamiger Familie ehelichen. —Ausnahme: Wie schon oben bemerkt, heiratet aber die Familie Lamkuna (von Lama = Schmied) nur untereinander, nie mit den andern.Man erwartet, daß das junge Weib zwei oder drei Monate nach der Verehelichung schwanger wird und vom Zeitpunkt des Ehevollzugs an in neun bis zehn Monaten gebäre. Die Geburt geht im Hause vonstatten. Die Kreißende nimmt auf einem Steine Platz. Es helfen ihr zwei ältere erfahrene Frauen. Eine sitzt in ihrem Rücken und sie lehnt rückwärts gegen sie, die ihrerseits die Kreißende mit den Armen umfaßt. Die andere sitzt vor oder zwischen den gespreizten Beinen der Wöchnerin, bereit, die Frucht in Empfang zu nehmen. Sissa, der Nabel, wird mit einem Sorghumstengel abgeschnitten. Uja, die Nachgeburt wird im Hofe vergraben. Der Nabelstrang fällt dann bei Knaben drei, bei Mädchen vier Tage nach der Geburt ab. Am siebenten Tage gibt der Vater dem Kinde den Namen. Dieser wird stets aus den in der Vaterlinie üblichen ausgewählt, und zwar nach feststehendem Gesichtspunkt immer der eines verstorbenen Mitgliedes, also für Knaben der eines Vaters, Großvaters, Mutterbruders usw., für Mädchen der einer Großmutter, Vaterschwester, Tante, Großtante usw. Man gibt den Namen eines Verstorbenen in jeder Familie immer nur einem Sprossen, nie etwa so, daß zwei Lebende diese bedeutungsvolle Namenserbschaft teilen können. Was das bedeutet, ist klar ersichtlich.
Solange das Kind keinen Namen hat, muß die Mutter daheimbleiben und darf nicht ausgehen. Nun aber steht ihr freie Bewegung zu. Buben und Mädchen hängen etwa drei Jahre nur von der Mutter ab, die Väter sollen aber stets sehr freundlich zu ihnen sein, viel mit ihnen spielen, wenn sie abends von der Farm heimkehren und der Mutter hie und da manche Wartung abnehmen, die man sonst nur vom weiblichen Geschlecht erwartet. Die Angaben über das Aufwachsen sind so schwankend, daß ich sie nicht wiedergebe; aber sicherlich weicht ihre Kultuseinführung nicht wesentlich von den andern Stämmen ab. Vom dritten und vierten resp. vom vierten und fünften Jahre an werden sie in spielender Weise in das Werktagsleben der mütterlichen und väterlichen Tätigkeit eingeführt; und dann wachsen sie in den Arbeitsschuh der Wirtschaftsfürsorge hinein, in ebenmäßiger Zunahme der Kräfte und ihrer Anwendung, bis die Beschneidungszeit die Burschen mit einem Ruck aus dem ausschließlichen Familiengeist heraus und in die Interessensphäre der sozialen "Staatsverbände" hineinführt und das Mädchen mit dem ersten Anzeichen der Reife ahnungsvoll ihre Augen aus dem Gehöft der Eltern hinaus über die Burschen der Nachbarsfamilie hingleiten läßt.
Alter, Krankheit, Orakel, Verzauberung, Medikamente. — Auch die Tschamba stehen im Rufe, ein ungemein gesundes Volk zu sein, dessen Greise älter werden, als manchem jungen Elternpaar im Hinblick auf die von unten heranwachsende und auch zu ernährende Kinderschar lieb ist. Denn freie Selbstverfügung über den Besitz tritt natürlich für die jungen Familienväter erst dann ein, wenn die Alten entweder selbstverständlich oder freiwillig das Regiment aus den Händen geben. Nun kann ein solcher Äthiope ganz gut mit hundert Jahren noch genügend geistige Frische und körperliche Rüstigkeit haben, um allmorgendlich selbst das Korn an die verschiedenen einzelnen Familienparzellen herauszugeben und die Bestellung der Farmen anzuordnen. Solches kommt öfters vor, und die Tschamba wußten mir mehrere Fälle anzugeben, in denen ein etwa hundertjähriger Mann (der die Ankunft der Fulbe im Battalande als junger Mann mit erlebt hatte) mehrere etwa achtzigjährige Söhne, etwa sechzigjährige Enkel (die schon gelebt haben, als der erste Weiße den Benue heraufkam), eine Reihe vierzigjähriger Urenkel (die gegen die Fulbe fochten, als sie von Tschamba aus das Tschambaland erobern wollten und zurückgeworfen wurden) und eine Unzahl kleiner Ursprossen in seinem Gehöfte beherbergte. Häufig sind allerdings solche Beispiele nicht, denn mehrere schwere Hungersnöte und Kriege gegen die Fulbe haben die Tschamba arg mitgenommen. Aber in den höheren und gerade ärmeren Gebirgsstücken soll es diese Fälle noch geben. Natürlich ist der familiäre Umbildungsprozeß hier aber ebenso wie bei den andern Völkern solcher Art. Wird der Urahne allzu greise, so entziehen ihm die "jungen Alten" nach und nach die Oberleitung, setzen ihn auf sein gutes Altenteil und bringen so in den familiären Wirtschaftsbetrieb mehr Energie und Elastizität. Also hat mancher zu voller Reife herangewachsene Sohn sein Erbteil schon in Verwaltung und Besitz, ehe der alte Vater noch die Augen zugemacht hat. — Der Weg zum Ende ist aber hier folgender:
Wenn jemand erkrankt, geht ein Angehöriger zu einem Geba, d. i. ein Wahrsager, der das Saa genannte Orakel abliest. Dieses besteht aus drei Hörnchen von zwei Antilopenarten, nämlich entweder der schwärzlichen Boä (die in Fulbe = hamfurde, in Haussa = gada und im Kanuri = kamuga heißt), oder der mehr bräunlichen Saä, die die Fulbe jebäre und die Kanuri widja nennen. Beide sind ganz kleine Antilopen, die sehr schnell laufen können und zierliche, gazellenartige gerade Hörnchen haben. Um sein Orakel zu lesen, klemmt der Gaba diese drei Hörnchen zwischen die Finger der rechten Hand. Diese hält er flach mit gespreitzten Gliedern und mit der Handfläche nach oben hin und steckt je ein Hörnchen zwischen kleinen und Ringfinger, zwischen Ring- und Mittelfinger und zwischen Mittel- und Zeigefinger. Bei nach oben gewendeter Handfläche sind
die Öffnungen der Hörnchen auch nach oben, die Hornspitzen zur Erde gerichtet. Der Ausfall des Orakels hängt davon ab, ob aus den Hörnchen beim Umkehren Wasser herausläuft oder nicht. Die Füllung erfolgt in der Weise, daß der Geba durch einen Schwung die nach oben gehaltene Hand nach unten in eine Schale mit Wasser und wieder nach oben heraus streift, wonach also in den Hörnchen Wasser enthalten ist. Die Entscheidung des Orakels erfolgt aber in der Weise, daß der Geba nach solcher schwungvollen Füllung der Hörnchen Hand und Hörnchen schnell umdreht, so daß also nun die Öffnung der Hörnchen und die Handfläche nach unten gerichtet sind. Läuft und tropft nun Wasser aus den Hörnchen zu Boden, so ist dem kranken Menschen nicht zu helfen, dann muß er sterben. Es ist dann auch niemand schuld an der Erkrankung —will sagen, sie verdankt ihren Ursprung nicht einem bösen Zauberer. Die Sache ist damit erledigt; man macht keine großen Anstrengungen mehr, hilft dem Kranken durch allerhand Darbietungen noch über die Schwierigkeit der letzten Tage und Stunden hinweg und erwartet sein Verscheiden mit Ruhe.Wenn aber nach dem Hinstreichen durchs Wasser und nach schneller Zubodenkehrung der Hörnchenmünder das Wasser in den Hörnchen bleibt und nicht heraustropft, so sagt das Orakel damit klipp und klar, daß die Krankheit durch Verzauberung zustande gekommen ist. Sie ist dann durch die schändliche Manipulation eines Deera, eines Hexenmeisters, verursacht, und nachdem der Geba sein Orakel gelesen hat, kennt er auch den bösen Menschen, ohne aber den Angehörigen der Familie seinen Namen zu sagen.
Sobald die Familie weiß, um was es sich hier handelt, dringt sie erst gar nicht lange in den Geba*, das Geheimnis des Namens zu verraten, sondern sie wendet sich direkt an den König und trägt dem den Fall vor. Denn die Vernichtung eines so gemeingefährlichen Zauberers ist natürlich nicht nur Sache der diesmal betroffenen Familie, sondern der ganzen Gemeinde. Und so wird die Angelegenheit auch behandelt. Der König hat einen eigenen Sitz, das ist ein Steinblock, der Bunga genannt wird (irgend etwas Besonderes soll an dem Steine nicht sein; er ist ein natürlicher Block). Der König stellt sich auf seinen Bunga und ruft über die Ortschaft weit hin. Er ruft, das der und der erkrankt sei; daß erwiesenermaßen ein böser Deera (Mann oder Weib) der Urheber der Krankheit sei, daß dieser Schlimme, wenn er den Kranken nicht sofort freigabe, von ihm, dem König, herausgesucht und dann getötet werden würde. Solche Drohung soll manchmal zur Folge haben, daß der Zauberer von seinem Opfer läßt. Dann scheint man die Sache auf sich beruhen zu lassen.
Wenn der Zustand des Kranken sich aber nicht bessert, man infolgedessen zu dem Glauben gezwungen wird, daß der böse Zauberer sein Opfer immer noch gepackt halte, dann schreitet man zum Ordal, dem die ganze Gemeinde sich unterwerfen muß. Es wird aus giftiger Baumrinde der Trank Nura bereitet. Jedes Gemeindeglied, eines nach dem andern muß ihn schlürfen. Die meisten werden ihn wieder von sich geben, und die sind dann unschuldig. Einer aber wird ihn bei sich behalten und wird unter schweren Qualen sterben. Das ist dann der Zauberer.
Das Volk weiß natürlich, wie dieser Unhold, solch ein Deera, sein Werk ausführt. Zunächst weiß er sich in geschickter Weise eines Haares oder eines Fadens aus einem alten Kleide seines Opfers zu bemächtigen. Er tut das gelegentlich, im Vorübergehen, jedenfalls ohne Anwendung irgendeiner Zauberkraft. In nächtlicher Stunde vergräbt er dieses Härchen oder Fädchen in einer kleinen Aushöhlung im Boden, und irgendeine extra beigefügte Medizin bewirkt dann die sympathische Rückwirkung des am Objekt ausgeübten Zaubers auf den, von dem es stammt. Wird der Zauberer nun auf irgendeine Weise entdeckt, indem der Geba zum Beispiel vor dem Nuraumtrunk ihm rät sich zu stellen, so führt er die Familie des Kranken zu der Zauberstelle, und ein Angehöriger kann die Sache ausgraben. Dann wird der Kranke gesund. Der Deera wird für dieses Mal noch nicht getötet, sondern ihm wird nur gesagt, daß man ihn vernichten würde, wenn es noch einmal vorkomme. Ein Tschamba aus nördlicher Gegend gab an, daß der Deera in den letzten Minuten vor seinem durch den Nuratrunk herbeigeführten Tode noch den Ort zu verraten pflegte, wo er das kleine Objekt vergraben hat. Erfolgt das Ausgraben aber nicht, so stirbt zwar der Deera, ebenso aber auch der Kranke. —
Aber nicht nur auf Magie und magische Heilungsverfahren läßt man sich bei der Behandlung der Krankheiten ein. Man weiß auch verschiedene Medikamente = gana anzuwenden und kennt auch die Massage =neumbia, die auch hier mit Blättern ausgeführt wird, die man brüht und dampfend auflegt.
Danach preßt man die Leichen in der Weise zusammen, daß die Knie hoch heraufgeschoben werden, daß die linke Hand unter der im.. ken Wange, die rechte Hand oben auf der rechten Wange liege. Man schnürt und umwickelt die Leichen dann mit Jergossa, d. i. das starke Webstoffband, das bei Werre und Namdji hergestellt werden soll und allenthalben hoch bewertet und für den Bestattungszweck verwendet wird. Inzwischen richtet man auch das Grab her. Es wird draußen im Busch, außerhalb des Ortsbildes angelegt. Zunächst wird ein mannstiefer Schacht ausgehoben, dann von dessen Sohle aus ein Kanal in der Richtung nach Sonnenaufgang seitwärts ins Erdreich geführt. Diese Gräber scheinen, besonders in alter Zeit, ganz bedeutende Tiefbauanlagen gewesen zu sein. Man benötigte Zeit zur Herstellung und konnte den Toten nicht am gleichen Tage des Versterbens beisetzen. Man ließ Frauenleichen zwei, Männerleichen drei Nächte außerhalb des Grabes. Danach wurden sie in den Kanal gelegt, und zwar so, daß die linke Hand unter die linke Wange, die rechte Hand über den Kopf zu liegen kam. Die Tschamba sagen: "Legt man die Leiche nicht so, daß die rechte Hand oben auf dem Kopfe liegt, so kann der Tote nicht als Kind wiederkommen." Das Gesicht der Leiche wird nach Süden, der Unterteil also nach Westen gerichtet. Der berichtende Tschamba legte Gewicht darauf, daß ich die Richtung genau vermerkte; wenn man es anders macht, dann "nützt die ganze Bestattung nichts."
Fernerhin gibt man der Leiche bei: eine Axt =hurra, einen Speer =dinga (nie aber einen Bogen oder ein Bogengerät!) und ein Messer = jerra. Auf keinen Fall darf man das Grab zuschütten, denn "dann höre der Tote nicht, was man ihm (beim Opfer) sage"! Der Schacht wird oben mit einem flachen Steine zugedeckt, auf den dann eine kleine Lehmspitze gesetzt wird. Dieser Lehmconus soll nur sein, damit man das Grab wiederfände.
Die Feierlichkeit der Begräbniszeit richtet sich natürlich auch hier danach, ob der Verstorbene ein junger Mann in arbeitstüchtigem Alter oder ein verbrauchter Greis war. Im ersteren Falle wird viel geweint und geklagt, im letzteren aber getrommelt, gezecht und getanzt. Wenn der Tote aber ein alter Mann war —nicht etwa eine alte Frau —wird beim Begräbnis geschwirrt, für junge Menschen kommt das natürlich nicht in Betracht. Wenn Frauen und Kinder zur Zeit des Begräbnisses eines alten Mannes das Tönen der Schwirrhölzer hören, so sagen die Männer ihnen erklärend, daß der Urahne gekommen sei, den Toten zu holen und zu sich zu nehmen. Das ist nur für die alten Männer. Für alte Frauen und Männer aber erscheint beim Leichenfest und Leichenessen die Nassa, die Büffelkopfmaske, mit den Lärabläsern. Nie aber geschieht das für jüngere Leute.
Wo der Tote nach dem Begräbnis hingeht, wissen die Tschamba
nicht zu sagen. Mit aller Bestimmtheit versichern sie aber, daß jeder Tote in einem kleinen Kinde der Vaterfamilie, einem Enkel, Urenkel oder Neffen oder so wieder geboren werde. Darüber könne kein Streit sein, sagen sie. Als Beweis führt ein alter Mann in Laro an, man könne ja an jedem Kinde genau sehen, wer es sei, denn jeder wiedergeborene Tote sähe genau so aus wie in früherer Lebenszeit und ehe er begraben sei! Man sieht also der Tschamba geht in der Ähnlichkeitsfeststellung noch weiter als unsere nordischen Mütter und Tanten, die jedes Kind "ganz dem Vater" oder der "Mutter wie aus dem Augen geschnitten" finden!Am bezeichnendsten äußert sich die Wiedergeburtsidee bei der Verehelichung eines Mädchens. Das muß irgendwie mit dem Verstorbenen in Beziehung gebracht werden, damit sie den jungen Leib der Fruchtbarkeit weihe. Der Vater bringt also das Mädchen in der Hochzeitszeit mitsamt einem Hahn (gleichgültige Farbe) und einem Topf Bier zum Grabe seines eigenen verstorbenen Vaters (oder Großvaters); er schlachtet den Hahn, daß das Blut auf den Grabstein träufelt, und betet: "Mein alter Vater, hier ist meine Tochter, die hat noch nicht geboren. Nun mach du, daß sie ein Kind gebiert. Hier hast du einen Hahn und Bier. Ich bitte dich sehr!" Danach gießt er über das Grab noch das Bier aus. Der Hahn wird mit in die Stadt genommen und dort geröstet. Er wird unter die kleinen Kinder verteilt, die den Leckerbissen genießen.
Bemerkt sei, daß diese Mädchenweihe nicht ganz klar nach ihren Familienbeziehungen scheint. Ein Tschambamann versicherte mir, ehe das betreffende Mädchen heirate, werde ein Geba gefragt, ob es zwecks Konzeption zu den Gräbern der Brautfamilie oder der Bräutigamsfamilie gebracht werden solle.
Wenn die junge Frau dann gebiert, so erhält das Kind sieben Tage nach seiner Geburt entsprechend seiner Ähnlichkeit, die sorgfältig aufgesucht wird vom Vater (der jungen Frau?),den Namen jenes, den man im Kinde wiedergeboren glaubt und den man immer in der Vaterfamilie finden zu müssen überzeugt ist.
Die starke tellurische Beziehung des Manismus tritt auch hier in einem besonderen Opferfest zutage, das dem eigentlichen größeren Erntefest, dem Bissjana, folgt und den Ahnen gewidmet ist. Dieses Opferfest heißt Wadnjina oder Waderjina und wird von jedem Familienoberherrn in seinem eigenen Gehöft abgehalten. Er nimmt dazu einen Hahn oder ein Huhn und begibt sich mit den Angehörigen vor einen Sorghumspeicher. Auf dem Platze vor dem Kornhause dreht er dann dem Huhn das Genick herum und wirft es in den Speicher. Sterbend wirft das Huhn sich hin und her, alles wartet gespannt auf das Ende. Im Augenblick des Verendens grüßt der Familienvater es noch mit Händeklatschen. Aus der Lage des verstorbenen
Huhnes erkennt man aber die nächste Zukunft, ob sie der Familie Gutes oder nicht Gutes bringen werde. Ist das Tier auf dem Rücken liegend verendet, so ist das ein recht gutes Zeichen, dann freut man sich. Tut es dies aber auf der Brust liegend, so will das nichts Gutes für die nächste Zukunft besagen.Der Familienvater gießt an der Opferstelle dann noch Bier aus und betet etwa folgendermaßen: "Mein Vater! Meine Großväter! Meine Väter! Ich bringe euch einen Hahn (oder ein Huhn) und Bier. Ich hoffe, daß mein Haus, meine Familie und mein Farmland gut sein werden. Ich bitte euch! Ich bitte euch! Helft mir hierzu!" Nachdem der Familienvater dieses Hauptopfer für die ganze Familie dargebracht hat, kann jedes andere Mitglied, das etwas Besonderes auf dem Herzen hat, auch darankommen und sein Opfer an der gleichen Stelle darbringen und beten, was es auch sei.
An die königlichen Ahnen wendet das Volk sich aber, wenn Regennot ist und die Gefahr besteht, daß die ausgestreute Saat im Boden vertrockne und ohne Nässe von der Sonne versengt werde. Dann wendet das Volk sich an den Ahnherrn des Gara, des Königs, und zwar geht es zu seinem Herrscher und bittet ihn, das Opfer im Namen aller darzubringen. Der König nimmt dann einen schwarzen Schafbock (= Berdinga) oder in Ermanglung dessen einen schwarzen Ziegenbock (= Woa-Dinga). Mit diesem und einem guten Topf Bier sowie Mehl begibt er sich dann zum Grabe seines Vaters oder Großvaters.
Der König schlachtet das Opfer über dem Grabe, gießt das Bier darüber aus und schüttet das Sorghummehl hin, dann betet er: "Mein Vater (oder Großvater), ich weiß nicht, was es ist. Alles Volk kommt zu mir und sagt: ,Alles Korn verdirbt uns!' Mein Vater, wir haben keinen Regen und doch haben wir alles gepflanzt. Wenn es nicht regnet, wird kein Essen da sein und viele Leute werden sterben. Mein Vater! Wir bitten dich! Wir bitten dich! Wir bitten dich! Hilf uns!" Nach diesem Gebet geht der König heim. Man ist überzeugt, daß es nun regnen wird. Die Schwirren werden bei diesem Opfer nicht geschwungen. —
Hier wie bei manchen andern Stämmen dieser Art finden wir also, daß nur eine bestimmte Persönlichkeit in der Totenwelt zum Regen helfen kann, der verstorbene Vater eines Königs oder der verstorbene Vater eines Regenmachers, nicht aber die Gesamtheit als Ahnen. Diese können nur insgesamt die Erde beeinflussen, vielleicht jeder für seine Familie, aber immer nur der eine den Regen, die Himmelserscheinungen. Das ist das Wesentliche der tellurischen Weltanschauung.
Wenn man ein Tschambagehöft durch das Torhaus (= tara) betritt, so sieht man links im Winkel ein kleines Häuschen, das heißt Wula und wird nach seinem Inhalt auch wohl "Tauwila", "das Wula der Tauwa"genannt. Denn in ihm sind die beiden Holzfiguren (Sing.: "Tau")(Plur.: "Tauwa") aufbewahrt. Es sind das stets zwei Figuren, eine weibliche, "Tau-kendoa", und eine männliche, "Tau-wandoa" genannt. Es ist stets ein Paar, und zwar ein Paar alter Holzfiguren. Denn wenn es richtige sein, wenn sie auf der Höhe ihrer Leistungen stehen sollen, dann müssen sie seit langer, langer Zeit in der Familie bis auf die derzeitigen Alten vererbt sein, so behauptet der Volksglaube. Man betrachtet die beiden Tauwa als uralte, miteinander verheiratete Leute, als ein Ehepaar. Aber sie heißen nur einfach Tauwa und haben niemals persönliche Namen. Man hält sie auch nicht so geheim, daß Frauen und Kinder sie etwa nicht sehen dürften.
Auf keinen Fall können es Ahnenfiguren sein, weder hier noch bei den Tim, noch bei den Muntschi, noch bei den Tombo der Hornburiberge. Jede Frage nach dieser Richtung stößt auf ein verständnisloses Stammeln. Die Tauwa haben nirgends etwas mit den Toten zu tun, sie sind etwas wesentlich Verschiedenes und doch überall untereinander Gleiches. Nun erklären die Tschamba mit aller Bestimmtheit, daß sie diese Tauwa einst von den Schmieden erhalten hätten. Eine gleiche Anschauung traf ich später bei den Dakka. Aber die Schmiede haben sie nur hergestellt. (Holzschnitzerei gehört zum Berufe der Schmiede.) Irgendwie mit dem Tauwadienste in Verbindung stehen die Schmiede nicht. Es gibt aber über den Ursprung der Tauwa eine ungemein lehrreiche Legende:
In alten Zeiten ging einmal ein Jäger (= goktana) in den Wald. Eine Schlange (=bissa) biß ihn. Der Jäger hob den Bogen auf und schoß einen Pfeil nach der Schlange. Die verwundete Schlange lief weg. Als die verwundete Schlange ein Stück weit gekommen war, sagte sie: "Ich habe den Jäger gebissen. Der Jäger wird sterben. Aber der Jäger hat mich verwundet. Ich weiß also nicht, ob ich nicht heute sterben werde. Jedenfalls werde ich meine Medizin (=gana) essen." Der Jäger hörte das. Der Jäger ging der Schlange nach. Der Jäger sah, daß die Schlange zu einem großen männlichen Woanabaume (in Fulfulde = Kabidji oder Kabidschi, in Haussa = Baramagada, in Nupe =Foro, in Kanuri = Kabi genannt, dessen Rinde bei allen Stämmen als glänzende Medizin gilt) ging und von seiner Rinde aß. Er sah, wie die Schlange dann zu einem kleinen weiblichen Lengtepsinabaume (in Fulfulde =Dukudji, in Kanuri =Gonogo, in Haussa =Gondachechi, in Nupe =Nungbere —der Genuß der Rinde dieses
Baumes gilt auch bei diesen Stämmen als vorzügliches Mittel gegen die schädlichen Folgen des Schlangenbisses, auch als Pferdemedizin verwendet) lief und von seiner Rinde aß. Er sah, wie die Schlange dann zu einer Ganja (eine zwiebelähnliche Pflanze, in Fulfulde Gadel, in Haussa =Gadelli, in Nupe =Jenjukutschi genannt-diese Zwiebelart gilt überall als uraltes Eingeborenenmedikament und wird in sehr vielen Gehöften nur zu diesem Zweck angepflanzt und kultiviert) lief, wie sie dann von der Ganga nahm und genoß. Als der Jäger das gesehen hatte, sagte er: "Ich bin von der Schlange gebissen. Ich werde sicher sterben. Aber ich will es versuchen, ob diese Baumrinden und diese Zwiebel mir doch vielleicht auch helfen können." Der Jäger ging hin und aß erst von der Woanarinde. Dann ging der Jäger hin und aß von der Lengtepsinarinde. Endlich ging der Jäger hin und genoß von der Ganjazwiebel. Danach ward der Jäger, trotzdem er von der Schlange gebissen wurde, nicht krank. Die Schlange starb an der Wunde, die sie durch den Pfeil des Jägers empfangen hatte. Als der Jäger das sah und fühlte, daß er wieder gesund sei, eilte er heim und sagte zu seinen Leuten: "Ich wurde von einer Schlange gebissen. Ich schoß auf die Schlange. Die Schlange lief fort und sagte: ,Ich habe den Jäger gebissen. Der Jäger wird sterben. Aber der Jäger hat mich verwundet. Ich weiß also nicht, ob ich noch heute sterben werde. Jedenfalls werde ich meine Medizin essen.' Dann lief die Schlange hin und aß von der Rinde eines großen männlichen Woanabaumes. Dann lief die Schlange hin und aß von der Rinde eines kleinen weiblichen Lengtepsinabaumes. Dann lief die Schlange hin und aß von einer Ganjazwiebel. Die Schlange hatte mich gebissen. Ich wußte, daß ich sterben muß. Die Schlange hatte gesagt, daß ich sterben würde. Ich wollte aber versuchen, ob die Baumrinden und die Ganjazwiebel mir nicht helfen können. Ich aß von der Woanarinde. Ich aß von der Lengtepsinarinde. Ich aß von der Ganjazwiebel. Ich wurde gesund. Die Schlange aber starb."*Da ist zunächst das Opferfest Ganteboberma, das im Beginn dei Regen- und Saatzeit abgehalten wird, also in einer Zeit, wo das Korr im Lande schon rar geworden ist. Da macht man, trotzdem man noch lange Monate bis zur neuen Erntezeit vor sich hat, ein gutes Bier und veranstaltet ein Trinkfest. Der Pater familias bringt die Tauwa auf den Hof. Man gießt ihnen Bier hin. Dann tötet er einer schwarzen oder roten Hahn —eine andere Farbe ist nicht statthaft —, schlachtet ihn und läßt sein Blut über die Tauwa fließen. Auch klebt er ausgezupfte Federn des Vogels an die heiligen Figuren. Nach dem Opfer betet er. Er bittet, daß niemand außer den Dieben beim neuen Farmbau von den Schlangen gebissen werden möchte, die Farmdiebe möchten aber sicher von den Schlangen getötet werden; er bittet, daß alles gesund bleibe und daß der Acker gute Ernte tragen möge. — Bei dem Gebet redet er die Figuren mit Mama an d. h. Großvater. Die Anrede Mama bietet man aber jedem alten Mann und nicht nur etwa Angehörigen. Nach Abschluß dieses Gebets geben
Dem Ganteboberma im Frühjahr, in der Saatzeit, entspricht der Bisnjama in der Erntezeit. Seine Stellung zwischen den andern Ernteopferfesten werden wir nachher kennenlernen. Jedenfalls fällt er in die Zeit, nachdem die ersten Sorghumbüschel geschnitten sind, wird aber eher abgehalten als das Wormambea, d. h. liegt in der Periode, in der jede geschlechtliche Betätigung strengstens untersagt ist. Um es zu begehen, beschafft sich auch der Familienvater einen schwarzen, und wenn er keinen solchen erhalten kann, wenigstens einen ganz dunklen Hahn und eine gute Menge Bieres. Die Alten der Familie und die Langaschwinger lassen sich dann entweder in oder (mir ist das nicht ganz klar geworden) direkt vor dem Wula, in dem die Tauwa wohl aufbewahrt in einem großen Topfe wohnen, nieder. Die jungen Leute bleiben draußen. Der Pater familias schlachtet nun den Hahn und besprengt die Figuren entsprechend mit Blut. Man schüttet Bier vor die Figuren und dann betet der alte Mann: "Gebt uns gutes Leben, Kinder, Gesundheit und Farmen in diesem Jahre!" Die Anwesenden heben dazu die rechte Faust auf und schütteln sie den Tauwa zu, ein Bestätigungszeichen, das vom Niger bis hierher weit verbreitet ist und das im vorliegenden Falle bedeuten soll, daß man sich dem Gebet des Vorredners anschließe.
Wenn nach diesem Gebete und Opfer irgend jemand von dem so geweihten Biere trinken will, muß er auch einen Hahn darbringen, der in gleicher Weise geopfert wird. —
Es ist also zu erkennen, daß diese Tauwa in einem zweifellosen Verhältnis zum tellurischen Farmkultus stehen, und das erinnert uns daran, daß die entsprechenden, nur rohrgeschnitzten Doppelfiguren der Muntschi, die Kombu Humba, auch neben der Haustür stehen und auch lediglich den Opfern für die Farmen gelten. Jeder Muntschi hat sie vor seinem Hause. Und nie erfuhr ich etwas anderes von den Kombu Humba, als daß sie der Farmentwicklung gelten und die Opfer vor ihnen den Farmsegen bringen sollten.
(HB. Bei einigen der Doppelfiguren der Tim erinnere ich mich, auf dem Rücken eine Schlange eingeschnitzt gesehen zu haben.)
Die Schmiede, Kulturlegende, Ursprung der heiligen Geräte. — Ehe wir dazu schreiten, in großen Zügen die wesentlichsten Momente des tellurischen Kultus, wie ihn die Tschamba pflegen, zu einem Bilde zusammenzufassen, müssen wir uns über die eigenartige Stellung, die die Schmiede im Kultus- und Legendenwesen
des Volkes haben, klar werden. — Jeskinna (siehe unten, eiserne Schellen) und Langa (eiserne Schwirren) werden meist in einem großen Topf außerhalb des Gehöftes, irgendwo im Busch unter einem alten Baume, sehr viel seltener in einem versteckten Platze im Gehöfte aufbewahrt. Der Ursprung der heiligen, eisernen Geräte wird nun den Lama, den Schmieden, zugeschrieben, die ihrerseits selbst noch einige der merkwürdigsten, nämlich die Langa ganz allein beim Zeremonialtanze zu schwingen pflegen. Von den Schmieden soll auch die Beschneidung kommen und noch viel mehr*. Die Tschamba erzählten mir diese Tradition folgendermaßen:In alter, alter Zeit hatten die Leute kein Feuer; sie setzten ihre Töpfe (Kalebassen) mit Wasser gefüllt in die Sonne; wenn die Sonne das Wasser gewärmt hatte, rührten sie Mehl hinein, und so bereiteten sie das Essen. Der Schmied aber war es, der ihnen das Eisenschlagfeuerzeug (= Latoma) und die Töpferei beibrachte. Dann ging er wieder fort. — Damals nun pflegten die Menschen den Beischlaf in der Weise auszuführen, daß die Männer den Frauen den Penis in die Achselhöhle stießen. Denn die Vagina hielten die Leute jener Zeit für etwas Ungesundes, weil von Zeit zu Zeit Blut herausfloß. Sie füllten diese Vagina also immer nur mit gana, mit Medizin, nicht mit ihrem männlichen Gliede. Dann kam der Schmied wieder. Er hörte, daß die Menschen ihre Frauen immer unter den Armen, statt in die Vagina koitierten. Er ließ sich eine Matte bringen und sagte: "Ich werde euch zeigen, wie man eine Frau richtig beschläft." Darauf lernten die Männer es, ihre Frauen so zu beschlafen, wie sie es heute tun (in Hockstellung). Die erste Frau ward aber schwanger. Der Leib schwoll ihr. Die Leute sagten: "Diese Frau hat ein Kind im Leibe, das muß herausgeschnitten werden." Sie nahmen ein Messer und schnitten der Frau den Leib auf von oben bis unten. Sie nahmen das Kind heraus. Die Mutter starb, das Kind starb. Nach einiger Zeit kam der Schmied wieder. Der Schmied sagte: "Wie war es? Hat die Frau nun ein Kind geboren ?" Die Leute sagten: "Die Frau hatte einen dicken Leib. Es war ein Kind darin. Das Kind konnte aber nicht heraus, denn es war vorne keine Öffnung. Darauf haben wir die Frau aufgeschnitten, um das Kind herauszunehmen. Aber die Frau und das Kind sind gestorben." Der Schmied sagte: "So müßt ihr es nicht machen. Bringt mir eine andere schwangere Frau." Nach einiger Zeit war wieder eine Frau schwanger. Die Leute brachten sie dem Schmiede. Der Schmied nahm darauf Öl und rieb ihr den Leib ein. Darauf rief er zwei ältere Frauen und hieß diese sich eine hinter, eine vor die schwangere Frau setzen. Dann zeigte er ihnen, wie sie das Kind auffingen, wie sie die Nabelschnur mit einem Rohr*
* Siehe Bamanaanschauung, daß alles Gute im Leben von den Schmieden kommt.
splitter abschneiden, wie sie die Nachgeburt beiseite bringen und begraben sollten. Der Schmied zeigte ihnen, was sie mit der Nabelschnur tun sollten, bis sie einfiel. Dann sagte ihnen der Schmied, wie sie das Kind benennen sollten. Weiterhin unterrichtete der Schmied sie darin, wie sie in ihren Häusern Türen machen könnten, denn vorher verstanden sie das nicht. Als die Menschen das alles gelernt hatten, baten sie den Schmied, nicht wieder fortzugehen, sondern unter ihnen Wohnung zu nehmen. Nachher starb ein alter Mann. Die Leute fragten den Schmied, was sie tun sollten. Der Schmied zeigte ihnen darauf, wie sie das Begräbnis begehen sollten. Der Schmied zeigte ihnen, daß sie dem Toten Eisen, eine eiserne Axt, ein eisernes Messer oder derartiges mitgeben sollten. Ein Jahr nach dem Begräbnis sollten sie dann aber ein Fest veranstalten, sollten Bier brauen und so weiter. Zwei Töpfe mit Bier sollten sie in das Grab stellen, dann tanzen, die Lären blasen und die Eisensachen wieder aus dem Grabe nehmen. Daraus sollten sie dann die Jeskinna (d. s. die eisernen Schellen usw.) und die Schwirreisen (= Langa) verfertigen. Dann sollten sie läuten und schwirren, und wenn die Frauen danach frügen, was das sei, zur Antwort geben: "Der Großvater kam heraus! Der Großvater kam heraus!" Dieses alles lernten die Tschamba vom Schmiede. Deshalb muß man allen Toten bis heute eiserne Gegenstände mit ins Grab geben, den Männern eiserne Waffen, den Frauen aber eiserne Schaufelblätter.Damit schreibt die Legende der Tschamba, die der entsprechenden des Dakka sehr ähnlich ist, also eigentlich alle Kultur den Schmieden zu, in gleicher Weise, wie auch die Mande erklären, daß alles irdisch Wesentliche von den Schmieden stamme. Vor allem stammte aber die Einführung des Jeskinna und des Langa, die man gemeinsam als Woma bezeichnet, von den Schmieden. Und da wir deren traditionellen Ursprung nun auch kennen, so können wir zur Behandlung der wichtigsten Persönlichkeit jener Tschambagemeinde übergehen, zur Besprechung der Oberpriester und seiner Obliegenheiten. —
Die Obhut des Woma (gleich heiliges Gerät, Heiligtum, entspricht dem Worte Lauru bei den Fulbe und dem Worte Sanam im Kanuri) ist dem Wombaa oder Womgara anvertraut. Ich hörte beide Worte aus verschiedenen Distrikten, aber auch nebeneinander; sie bedeuten eben Herr oder Verwalter oder vielleicht auch Besitzer der Woma. Er steht, wie wir eben sahen, gewissermaßen als Erbe der sehr geachteten Schmiedezunft nahe, die ihm stets das heilige Gerät erneuern und zuführen müssen. Diese Beziehung drückt sich aber meines Wissens in keiner besonderen Sitte aus.
Als Priester und Herr des Woma hat der Womgara nun aber mit ziemlich allen Phasen des menschlichen Kreislaufes etwas zu tun.
Am deutlichsten tritt dies im Tellurismus dieser Stämme natürlich in der Zeit des Herbstfestes hervor, der Ernte- und Reifeperiode, die der Womgara sowohl einleitet wie abschließt. Die Reihenfolge der gesamten Opfer ist:
1. das Girsenga (Reifezeit einleitend),
2. das Bisnjama, (für die Tauwa),
3. das Wad-nina (für die Ahnen),
4. das Wornambae (Erntezeit abschließend). Das Girsenga wird in der Zeit gefeiert, wenn die ersten Feldfrüchte zu reifen bcginncn. Dann zieht der Womgara mit dem Jeskinna und Langa in die Farmen. Er schneidet ein wenig Kornsprossen, wickelt sie in Blätter —Kissina, d. s. Nelbi-(Fulfulde) Blätter —und legt sie unter einen Stein. Man legt diese Opfergabe auf einen Weg, so daß der deckende Stein quer darüber beiderseits hinwegragt. Diese Wegstelle und Opfergabe können in Zukunft Männer unbedenklich entlanggehen und überschreiten. Frauen und Kinder aber müssen sie meiden. Die müssen in großem Bogen darum herumgehen.
Bei den Dakka erfuhr ich über dieses Zeremonial Näheres. Sie wählen als Blätter stets solche von den Bäumen, aus denen die Tschamba die weibliche Tauwa machen (Dakkabeschreibung 5. 11). Nun mache ich auf folgende drei Beziehungen aufmerksam: 1. Dies Verfahren des Bedeckens mit einem Stein ist gleichlaufend mit der Form der Behexung in allen diesen Ländern. Wenn ein Mensch einen andern behexen oder bannen will, eignet er sich von den Haaren oder Zeugfäden oder irgendein Körperliches jener an und belastet das mit einem Steine. Dann wird der andere schwach. Diese Steinbelastung bedeutet also eine Bannung oder Behexung. 2. Die Blätter, die die Dakka nehmen, sind von einem Baume, aus dem die Tschamba die weibliche Tauwa machen (und Tam, also ganz ähnlich, heißt auch bei Muntschi die weibliche der beiden Doppelfiguren). Demnach würde es eine Bannung der weiblichen Elemente sein, was aus dieser Steinbelastung der Blätter gerade dieses Baumes spricht. 3. endlich dürfen die Weiber nicht über die Stelle hinwegschreiten, und vor allem ist in der folgenden Zeit der Beischlaf verboten. Also eine Linie der Enthaltung und Zurückschiebung der Weiblichkeit. Es ist wie ein philosophischer Grundgedanke und mich deucht, es müsse hier ein wichtiger Anhaltepunkt zu fassen sein. Es ist also, als habe dieser tellurischen Weltanschauung ein bestimmter Sexualgedanke zugrunde gelegen — wo, wann in welcher Richtung, das zu verfolgen ist hier nicht der Platz. —
Nachdem das Girsenga wie gesagt dargebracht ist, geht der Womgara heim, und von diesem Augenblick an darf niemand einerseits vom neuen Erntegut essen, anderseits mit einem Weibe sich vermischen, sei es im ehelichen oder außerehelichen Beischlafe.
Wenn aber das Korn reif ist, dann wird das zweite Hauptfest, das Womnambea oder Wornambea gefeiert, und wieder ist es der Womgara, der es einleitet. Er zieht wieder hinaus und schneidet nun auf den verschiedenen Farmen die ersten Sorghumbündel, überall ein wenig, und alles in allem etwa zehn bis zwanzig Lasten. Diese werden in die Stadt gebracht und dann wird Bier daraus bereitet. Das eigentliche Womnambea besteht darin, daß alle Gemeindeglieder von diesem gewissermaßen heiligen oder geweihten Biere trinken, nicht nur Männer, sondern auch Weiber und Kinder. Abends erschallen dann Jeskinna und Langa. Damit ist dann die fertige Reifezeit abgeschlossen, von nun an kann jeder von der neuen Ernte genießen und sich jeder in geschlechtlichen Verkehr einlassen nach Belieben. Die Erntezeit hat abgeschlossen und es beginnt die Beschneidungsperiode. —
Der Womgara hat aber, wie gesagt, mit den meisten Veranstaltungen zu tun, mit Krankheitserscheinungen, Beschneidungen und Begräbnissen. Wenn z. B. ein Mann erkrankt und die besorgten Angehörigen zum Geba gehen, daß der sein Saa-Orakel lese, dann erhalten sie nicht selten zur Antwort, die Woma seien über den Mann böse und hätten ihn krank gemacht, weil er sie vernachlässigt habe. Dann geht die Familie mit einem Opfertiere zum Womgara und der bringt dieses dann den Langa dar und beschwichtigt sie so.
In den Händen des Womgara liegt der zeremoniell wichtige Bläsertanz, der hier ebenso angesehen ist wie anderweitig. Ich sah ihn besonders schön in Jelba und Laro. Am letzteren Platze waren an den Lären Kalebassenresonanzen, an ersteren nicht. Der Trommler stand in der Mitte. Die Lärenbläser tanzten einen Reigen um ihn herum. Außerhalb der tanzenden Bläser gingen aber in Laro die vier Zeremonienmeister, und zwar der vorderste mit einem Stock und einer schlechtweg Lama genannten Eisenaxt. Der zweite tanzte mit einem ebenfalls Lama genannten Holzstück, das geschwungen war wie das Blatt der Axt. Der dritte hatte ein Kuhhorn, auf dem er von Zeit zu Zeit blies, der vierte auf seiner Brust die Goea mit den Beschneidungsmessern. Die Lärenbläser hatten aber noch zwei Korbrasseln von gleicher Art, wie ich sie bei den Kuti erwarb; sie gehören mit zum Lärainstrumentarium. Die vier Auß ntanzenden waren Womgara, Beschneidungsmeister und Schmiede. — Erwähnt sei, daß der Womgara nie ein Schmied sein kann. — Außerdem tanzte bei dieser Vorführung noch der Nassamaskierte, ziemlich isoliert und ohne intimen Zusammenhang mit den andern.
Diese Bläserkapelle der Lära befindet sich auch in Händen und Verwaltung des Womgara; er ist es auch, der die Ganga = Kürbis auf seinen Farmen pflanzt, eine besondere Kalebassenart, die zur Herstellung der Schalitrichter dient, und der Womgara ist es, der die
Lära repariert, wenn sie einmal zerbricht — was nicht gerade selten ist. Und wenn dann ein Fest im Anzuge ist, da gibt der Womgara das wohlerhaltene Blasegerät heraus.Die Stellung des Womgara ist erblich. Wenn ein solcher Priester stirbt, begräbt man mit ihm ein größeres Jeskinna und eine eiserne Langa. Es folgt dann eine Trauerzeit von zwei Jahren, in der kein Tanz, kein Trinkgelage, kein ungewöhnliches Fest gefeiert werden darf. Die ganze Gemeinde trauert. Den Kultus versieht in der Zwischenzeit der älteste Sohn des verstorbenen Womgara, ohne aber schon als vollgültiger Oberpriester angesehen zu werden. Nach Ablauf der zwei Jahre nimmt man aber aus dem Grabe des verstorbenen Womgara die mitbestatteten Jeskinna und Langa heraus und übergibt sie dem ältesten Sohne, der damit endgültig in die Stellung eingerückt ist, die er bislang nur verwaltete. Ein alter Mann steigt in die Gruft und bringt das heilige Gerät empor.
Ich darf hier auf eine gewisse Parallelität hinweisen. Bei andern Stämmen dieser Zentraläthiopen nimmt man nach Verfall der Leiche deren Schädel heraus, bewahrt ihn auf und nimmt an, daß aus dieser Reliquie der Geist des Verstorbenen dann in einer nachfolgenden Generation wiedergeboren werde. Hier nimmt man die Langa und Jeskinna aus dem Grabe des Zerfallenen und übergibt sie dem Nachkommen, der damit gewissermaßen der geheiligte Nachfolger wird. Es liegen gleiche Grundgedanken zugrunde. Die heiligen Tongeräte entsprechen dem Schädel, wie ja die Töne, die sie hervorbringen, auch den Verstorbenen zugeschrieben werden, deren Schädel man verehrt. —
Das Gehöft eines Womgara pflegt meist schöner zu sein und besser gepflegt zu werden als sonst eines in der Gemeinde. Denn alle Ortsbewohner helfen dem Oberpriester gern bei der Errichtung und Erhaltung seiner Wohnstätte; ja, solche Bauhilfe gilt vielfach sogar als wichtige und heilige Sache. Denn abgesehen von allem andern, sind in diesem Hause auch verschiedene kleine Heiligtümer angebracht, die allen möglichen Leuten, auch Weiber und Kinder nicht ausgeschlossen, nützen können und von Zeit zu Zeit mit einem entsprechenden Opfer bedacht werden.
So befindet sich z. B. an der Außenwand des Tara genannten Torhauses die Tega genannte Stelle. Tega besteht aus fünf kleinen Hörnchen, die in der Wand eingemauert sind. Tega ist eine Opferstelle, an die jeder geht, der von der Lungenentzündung gepackt wird. Indem er Tega opfert, glaubt er an seine Genesung. Ferner ist auf der Hof- oder Innenseite Luria. Luria ist auch an der Wand dieses Torhauses etwa in Schulterhöhe. Luria ist eine Stelle der Wand, die mit vielen warzenartigen kleinen Erhöhungen bedeckt und mit roter Erdfarbe überschmiert ist. Luria ist eine Stätte, zu der
Magenkranke pilgern, hier ihr Opfer darbringen und Heilung erhoffen.Dagegen befindet sich im Gehöft des Womgara kein Paar Tauwafiguren. Der Womgara hat mit den Tauwafiguren absolut nichts zu tun. Ganz ebensowenig geht ihn und seinen Wirkungskreis die Nassamaske etwas an. Und um seine Tätigkeit weiter zu begrenzen, sei gleich noch beigefügt, daß der Womgara in keinerlei Beziehung zur weltlichen Gerichtsbarkeit steht. Alles Richteramt mit allem was dazu gehört ist einzig und allein des Gara, des Königs. In Gerichtsverhandlungen greift die Hand des Womgara erst ein, wenn der Gara die Verabfolgung des Mura, des Giftbechers, bestimmt. Das ist dann wieder Angelegenheit des Womgara.
Eine besondere Enthaltung von Speisen oder Heilighaltung irgendeines Tieres ist dem Womgara nicht auferlegt. Dagegen opfert er von jeder Speise, die er zu sich nimmt, ein wenig dem Woma. — Mit den Schmieden steht der Womgara immer auf sehr gutem Fuße, und bei einem Umtrunke reicht er diesen die Schale immer zuerst. —
Die Nassaniaske,Büffelkopfmaske und Büffelfamilie. —Die Tschamba lassen bei ihren Bläsertänzen einen Mann mittanzen, der auf seinem Haupte eine sehr große Büffelkopfmaske trägt und dessen Körper von oben bis unten in einem lang herabfallenden Grasfaserbehang versteckt ist. Irgendeine besondere Heiligkeit legt man dieser grotesken Figur nicht bei. Frauen und Kinder dürfen sie sehen. Sie nimmt stets an den Bläsertänzen teil. Sie gehört nicht etwa nur einer Familie oder Sippe. Es gibt nach alter Tradition in jedem Dorfe eine, und es kann sich darin demonstrieren, wer Lust und Tanzkunst besitzt. Beim Tanzen werden bestimmte Bewegungen des Büffels nachgeahmt. Manchmal trippelt sie im Reigen der Bläser und in deren Reihenanordnung, manchmal in, manchmal außer dem Kreise. Wenn ihr zu warm wird, zieht sie sich zurück und lüftet ein wenig den Kopfaufsatz. Im übrigen wäre nicht viel mehr von ihr zu sagen, wenn es nicht über ihren Ursprung folgende Sage gäbe:
In alter, alter Zeit ging einmal ein Jäger in den Busch, um ein Tier zu schießen. Er kam an eine Wasserstelle und traf da viele, viele Büffel (Njella). Er kletterte unbemerkt auf einen Baum und wollte von da aus einen Büffel schießen; da sah er, daß alle Büffel ihre Häute ablegten. Nachdem die Büffel ihre Häute abgelegt hatten, hatten sie Menschenform. Als Menschen gingen sie dann ins Wasser und badeten. Nachdem sie gebadet hatten, kamen sie aus dem Wasser, legten ihre Häute wieder an und waren nun Büffel wie vorher. Als Büffel liefen sie wieder in den Busch. — Der Jäger fürchtete sich, einen dieser Büffel zu schießen. Er wartete, bis alle im Busche verschwunden waren — dann kletterte er von seinem Baume herab.
Der Jäger ging heim. Er kam zu einem Schmiede. Er sagte zu dem Schmiede: "Ich war heute im Busch an einer Wasserstelle. Da kamen viele Büffel. Ich kletterte auf einen Baum, um einen Büffel zu schießen. Die Büffel legten alle ihre Haut ab. Sie stiegen als Menschen in das Wasser und badeten. Nachher kamen sie wieder aus dem Wasser. Sie legten die Häute an. Sie liefen als Büffel in den Busch. Ich fürchtete mich, einen der Büffel zu schießen. Was soll ich tun? Willst du mir nicht helfen, einen der Büffel zu töten?" Der Schmied sagte: "Töte keinen von den Büffeln. Sammle aber Termiten (=Tebteba). Nimm viele Termiten mit dir. Gehe wieder zu der Stelle, wo du heute die Büffel sahst. Lege die Termiten erst beiseite. Dann verstecke dich im Wasser. Wenn die Büffel kommen und ihre Häute ablegen, dann komm vorsichtig heraus. Lege alle Termiten auf eine Haut. Verstecke dich wieder und warte ab, was sich ereignen wird." Der Jäger sagte: "Das werde ich versuchen." — Der Jäger sammelte sogleich viele Termiten. Er nahm sie und ging wieder zu der Stelle am Wasser. Er legte die Termiten beiseite und versteckte sich im Wasser. Nach einiger Zeit kamen die Büffel. Die Büffel legten ihre Häute ab. Sie hatten nun Menschengestalt. Als Menschen stiegen sie ins Wasser. Als die Büffelmenschen ins Wasser kamen, schlich der Jäger sich hin, nahm alle seine Termiten und warf sie auf eine der Büffelhäute. Die Termiten begannen sogleich die Büffelhaut anzufressen. Der Jäger ging wieder fort und versteckte sich. Nachher hatten die Büffelmenschen genug gebadet und kamen wieder aus dem Wasser an das Land. Jeder Büffelmensch nahm seine Haut an, wurde Büffel und lief als Büffel in den Busch. Der letzte Büffelmensch wollte seine Haut auch übernehmen. Es war die Haut, auf die der Jäger die Termiten gestreut hatte. Die Termiten hatten inzwischen große Löcher in die Haut gefressen. Als der Büffelmensch sie sich überwerfen wollte, fiel sie auseinander und zur Erde herab. Darauf ließ er sie liegen und rannte ohne Haut den andern nach in den Busch. Der Jäger kam nun aus seinem Versteck heraus. Er hob die zerrissene Haut des Büffels auf. Er rannte damit in die Stadt und zu dem Schmied. Er zeigte die Haut dem Schmiede und sagte: "Ich habe es getan, wie du mir gesagt hast. Als der Büffelmensch seine Haut übernehmen wollte, war sie von den Termiten zerfressen. Sie fiel herab. Der Büffelmensch rannte ohne Haut von dannen. Ich kam herbei, nahm die Haut auf und habe sie hier mitgebracht." Der Schmied sagte: "Das ist eine gute Sache für uns. Ich werde diese Sache zurechtmachen." Dann nahm der Schmied Holz, schnitzte es und setzte es in die Haut des Büffels hinein. Die Ohren machte er aber wie die eines Menschen. Die Haut des Körpers war so zerfallen, daß sie nicht mehr hielt; sie wurde also durch Faden des Golebe (die der malvenartigen Rama der Haussa entspricht) ersetzt. So ward das Körperkleid aus einer Haut zu einem Faserumhang. Derart bereitet, gab der Schmied dem Jäger die Nassa. Auf diese Weise kam die Nassa in die Welt. Seitdem kauft jeder, der eine solche Maske tragen will, diese beim Schmiede.Wenn man diese Form der Legende mit der bei den Dakka eingeheimsten (vgl. Beschr. der Dakka Kap. 4) vergleicht, so muß es auffallen, daß beide Legenden ziemlich gleichlautend sind. Aber während hier nur die Maske gerettet und heimgebracht ward, stahl bei den Dakka der Jäger das seiner Büffelkleidung beraubte Mädchen und führte es als Mutter des nachher aufkeimenden Geschlechtes heim. Die Tschamba haben die Sitte der Nassamaske und die Dakka haben sie nicht, wohl aber den Totemismus, der das gestohlene Büffeiweib als Stammherrin einer der vier Familien erklärt, weshalb die Nachkommen unbedingt kein Büffelfleisch essen dürfen. Es ist wundervoll klar, wie die Sitten und Formen der Legenden einander entsprechen, und am wesentlichsten ist es, daß wir die Weiterentwicklung der Maskenform in Händen der Djukum finden konnten, bei denen sie eine große Rolle spielt. Und ehe ich noch diese Äthiopen Nordkameruns persönlich kennen lernte, schloß ich, daß die Tschamba oder ein benachbartes Volk dieses wesentliche Quellmaterial besitzen müsse. —
Von der Venus sagen sie, sie hieße Sogwana; Sogwana aber wäre der erste Mann (oberste Beamte) des Mondes. Das Dreigestirn Orion heißt bei ihnen Kondingna. Sie erklären lachend, es wären das zwei Komaleute, die einen Ochsen stehlen; der eine ziehe ihn hinter sich her; der andere folge hinterher, ihn zu treiben. Die Plejaden endlich heißen Jebkem-sirba. Man sagt, das wären spielende kleine Mädchen, die miteinander tanzten. Mehr schon wissen sie vom Mond und der Sonne zu erzählen, über die ich auch die gleichen Geschichten aufschreiben konnte wie bei den Dakka. Die erste Legende ist die vom Streite der beiden Hauptgestirne um den Vorrang der Macht. Sie lautet:
Der Mond und die Sonne hatten einst einen Streit miteinander. Die Sonne sagte: "Ich bin ein großer Mann." Der Mond sagte: "Du bist ein großer und starker Mann; ich aber bin größer und stärker." Die Sonne sagte: "Das ist nicht so!" Der Mond sagte: "Es ist gut! Sende mir abends deinen Sohn. Ich will sehen, ob er meine Sache aushält." Die Sonne sagte: "Es ist mir recht. Ich werde meinen Sohn heute senden. Morgen sendest du mir deinen Sohn!" Abends sandte die Sonne ihren Sohn an den Himmel. Der Mond stand klar da. Er vereinigte aber alle Kälte und alle Wolken um den Sohn der Sonne. Der Sohn der Sonne stand in der Kälte zwischen all den Wolken am Himmel. Zuletzt starb er. Am andern Tage sagte der Mond zur Sonne: "Ich habe dir gleich gesagt, daß ich stärker bin als du und daß dein Sohn meine Sache nicht aushalten würde." Die Sonne sagte: "Es ist so. Nun sende mir aber deinen Sohn. Du wirst sehen, dein Sohn hält meine Sache auch nicht aus." Der Mond sagte: "Ich werde ihn senden." Der Mond sandte seinen Sohn. Der Sohn des Mondes stand in dem Scheine der Sonne. Die Sonne sammelte alle Hitze und sandte sie auf den Sohn des Mondes herab. Der Sohn des Mondes wurde ganz heiß. Darauf kam der Mond mit Wasser herbei und goß viel Wasser über seinen Sohn aus. Darauf ward sein Sohn wieder kühl und kalt. Immer wenn die Sonne den Sohn des Mondes mit ihrer Hitze ganz heiß gemacht hatte, so daß er bald sterben mußte, kam der Mond mit Wasser herbei und goß das über seinen Sohn aus. Darauf wurde denn der Sohn immer wieder kühl. Am Abend hatte aber die Sonne keine Hitze mehr. Der Sohn des Mondes war aber nicht gestorben. Darauf sagte der Mond zur Sonne: "Habe ich dir nicht gesagt, daß ich stärker bin als du? Dein Sohn starb an meiner Sache. Du konntest aber meinen Sohn mit deiner Sache nicht töten."
Die andere wichtige Tradition ist die vom Sonnenfang, von dem ich bei den Tscharnba folgende Version empfing:
In alter Zeit neben die Frauen das Sorghum auf Steinen immer an der gleichen Stelle zu Mehl. Jeden Abend kam nun aber ein weißer Schafbock (ein Borwana birua) und fraß an den Mahlsteinen das Mehl, das heruntergefallen war. Jeden Abend kam der weiße Schafbock und stahl und fraß. Eines Abends lockte eine Frau den weißen Schafbock aber ganz dicht zu sich heran. Sie hielt ihn fest. Dann rief sie ihren Mann. Der Mann kam. Die Frau sagte: "Ich habe hier den weißen Schafbock, der jeden Abend das Korn frißt, das von dem Mahlstein herunterfällt." Der Mann sagte: "Ich werde den Dieb festbinden." Der Mann band darauf den weißen Schafbock fest, so daß er nicht fortlaufen konnte. —Nachher legten sich die Leute hin, um zu schlafen. Sie schliefen. Sie schliefen in einemfort, ohne aufzuwachen. Es war dunkle Nacht. Die Nacht nahm kein Ende. Die Leute schliefen lange Zeit. Dann wachten sie auf. Die Leute sagten: "Was
ist das? Es ist immer noch Nacht?" — Der Gara wachte auf. Der Gara sagte: "Was ist das? Es ist immer noch Nacht?" Der Gara rief alle Leute zusammen und sagte: "Was ist das? Es wird nicht Tag?" Die alten Leute sagten: "Man muß dagegen einen Nelgebea (Orakelmann, Wahrsager) befragen." Es wurde ein Nelgebea gerufen. Der Nelgebea kam und brachte seine Hörnchen zum Wasserschöpfen mit. Der Nelgebea fragte seine Orakel. Der Nelgebea sagte: "Es muß jemand einen Schafbock gefangen haben. Weiß niemand davon, ob nicht irgendwo ein weißer Schafbock gefangen ist?" Der Mann der Frau, die abends den Schafbock herangelockt und dann festgehalten hatte, sagte: "Ich weiß davon. Meine Frau hat gestern einen Schafbock, der immer an den Mahisteinen stahl, festgehalten. Ich habe den Schafbock festgebunden, so daß er nicht fortlaufen konnte." Der Nelgebea sagte: "Dann muß der weiße Schafbock wieder losgebunden werden. Eher wird es nicht Tag werden." Der Mann sagte: "Ich werde das sogleich tun." Dann ging er hin und band den weißen Schafbock los. Darauf rannte der weiße Schafbock fort. Gleich darauf stieg die Sonne am Himmel empor. Es wurde Tag.Irgend welche Opfer werden der Sonne nicht dargebracht. Zu dieser Legende vergleiche die gut erhaltene Form der Dakka und die verkehrte der Jukum, dann das Material, das sonst im Sudan und am Kassai eingesammelt wurde. —
4. Kapitel: Die Dakka*
Königreich, König. —Die Dakka oder, wie sie sich selbst nennen, die Nagajare, gehören ihrer ganzen Art und Kultur nach fraglos zu den wenig abgewandelten Äthiopen Nordkameruns. Aber sie gehören zu denjenigen, die wenigstens in der Vergangenheit eine wesentliche soziale Geschlossenheit aufweisen konnten. Sie erinnern sich sehr wohl noch an die Tatsache, daß ihre Volksgemeinschaft einen bedeutenden Staat darstellte, wenn es auch anderseits kaum möglich sein wird, aus der Volkserinnerung noch irgendwelche bedeutsame geschichtliche Einzeltatsachen herauszufinden.
Heute sitzen die Dakka ziemlich arg verdrängt in den Tälern des Tschebschigebietes, vordem aber hatten sie ein bedeutenderes Vorland im Westen und Osten inne. In alter, alter Zeit hatte ihr Gangi, d. h. ihr König, seine Residenz in Jelu, einer Stadt, die bei den Dakka Dajella heißt. Von Dajella ward dann der Königssitz nach Sugu verlegt, das bei den Dakka Gassubi heißt, aber Jelu ist bis heute die Grenze zwischen Dakka und Tschamba geblieben. Noch heute ist der Herr von Jelu ein Sproß der Dakkafamilie, wenn er und seine
Gang — Duguna,
Gang — Dsagana,
Gang — Djebena,
Gang — Sirena,
Gang — Taonte (heutiger Fürst).
Diese Reihe zählte mir der Jelufürst selbst her. Da nun in der
Dakkasprache jedes auslautende "i" des Substantivs vom nachfolgenden
Worte verschluckt wird, da demnach in dieser Reihe nach
Battasprechweise Gang losgelöst vom Namen in Gangi umzusetzen
wäre, so würden wir für die Könige von Jelu genau die Dakkabezeichnung
Gangi für König erhalten, während König im Tschamba
gleich Gara ist. Daraus ist zu ersehen, daß das Machtbereich der
Dakka weitgehender anzusetzen ist, als man bislang auf den Karten
annahm. |
Die bedeutende Macht des Dakkakönigreiches ist längst verschwunden, gehörte auch schon lange, lange der Vergangenheit an, als die Fulbe dem Benuelande sich näherten. Wir können uns heute zunächst noch kein Bild der vorhistorischen Vorgänge machen, die den heutigen Zustand geschaffen haben. Aber so viel ist sicher, daß in alter Zeit Beziehungen geherrscht haben, die weit über den Rahmen der heutigen Sprachbegrenzungen herausgingen. In dieser Hinsicht mag auf folgende Analogiengruppe hingewiesen werden. König heißt in Dakka Gangi, bei Kirn Gange, im Mundang Gong. Die Beschneidung findet hier wie dort im Zusammenhange mit dem Absterben des Königs statt, die beiderorts mehr oder weniger klar gewaltsam in perioden von sieben Jahren statthaben mußte. Wir haben in beiden Stämmen nicht nur echt äthiopische Stämme vor uns, die ausgesprochen klare Kulturelemente in diesem Sinne zeigen, die sogar in mancher Hinsicht im Religionswesen untereinander noch größere Analogien aufweisen als andere, sondern die auch in sozialreligiöser Hinsicht Erbschaftsreliquien aus einer gemeinsamen Machtperiode gerettet haben, die sehr bedeutungsvoll sind. Im übrigen haben die Dakkaalten die Erinnerung an diese Zeit durchaus nicht wie eine solche an goldene Vergangenheit bewahrt, vielmehr erzählen sie, es wäre damals durchaus kriegerisch zugegangen und Königreich und Friede scheinen keine nähere Verbindung geschlossen zu haben, weder hier noch in irgend einer andern westäthiopischen Gegend, als z. B. dem Mossireiche.
Das Reich ist heute ganz zerfallen. Es gibt mehrere Gangi, und eine Gemeinde, die keinen Gangi hat, hat doch wenigstens einen Nissani. Das ist ein kleiner Dorfchef, dessen Amt zwar erblich ist,
d. h. früher nicht war, aber im Laufe der Erschlaffung des Königszügels heute geworden ist.Für die Könige besteht aber auch heute noch folgendes Gesetz: Gangi wird nie der Sohn des verstorbenen Königs, sondern meistens heißt dem Gesetze nach der Sohn seiner Schwester Gangi, wenn der Bruder des Königs nicht geschickt bei Zeiten die Macht an sich reißt. Also matriarchalische Gesetze. (Nur bei Kirn wird der Sohn König!) Und auch das erinnert uns wieder an die Mundang, denn dort ist es der Pulian, der Mutterbruder, der dem allzu Langlebigen am Ende der sieben Jahre das Lebenslicht ausbläst.
Am Hofe des großen Königs gab es vordem —und heute ahmen das die kleinen Könige nach —folgende drei Männer: erstens einen Gweri, der stets den Schultersack des Königs trug. In diesem, "Nerri" genannten Sacke aus Leopardenfell befanden sich auf einer Seite (wohl in einer Tasche) als Amulett Schnurrbarthaare vom Leoparden und Löwen; auf der andern aber Tabak zum Rauchen und Brei zum Speisen. Dieser Gweri, der erste Mann bei Hofe, war ein Schmied. Der zweite an Rang war der Kuni, der hatte immer die Tabakspfeife des Königs zu tragen. Diese war aus Gelbguß und wurde im Werrelande gekauft, denn die Dakka wußten solche Güsse nicht selbst herzustellen. Der Kuni war kein Schmied, und ebensowenig gehörte der dritte Hofmann, der Gwangabeni der Schmiedekaste an, dessen Aufgabe es war, dem Gangi das Bier zu reichen.
Diese drei Männer waren also immer mit dem Könige zusammen. Sie aßen mit ihm und tranken mit ihm. Sie besprachen mit ihm jede Sache, und wenn der König mit dem Volke sprechen wollte, so sprach er durch diese drei. Er selbst wurde eingeschlossen gehalten. Dieses war die weltliche Macht, die in alter Zeit über dem Dakkareiche herrschte. Sie ist nur noch kümmerlich erhalten. —
Hier im Djubuu liegen nun die Dosi und die Langa. Diese beiden aber sind die einzigen heiligen Geräte, die das Volk als solches besitzt. Die Dosi bestehen aus einem eisernen Ring, an dem eiserne Glocken und eiserne Platten hängen. Sie gelten als Heiligstes, was das Volk überhaupt besitzt, und werden direkt als "Großväter" bezeichnet. Und das hat seinen guten Grund. Wenn nämlich ein Kameni stirbt und bestattet werden soll, stellt der Schmied alsbald eine eiserne Schelle her, die wird ihm mit in das Grab gegeben. Wenn man nun annimmt, daß die Leiche drunten im Grabgang verwest ist, öffnet man die Gruft, steigt hinab und nimmt die eiserne Schelle heraus. Sie wird mit Medizin gewaschen und andern Schellen der Dosi beigefügt. Die Dosi sind so heilig, daß das Volk um ihren Besitz kämpft.
Zum zweiten gehören zu den Djubi die Langa, die Schwirren. Es gibt Schwirren und Schwirrhölzer. Die Schwirreisen ruhen immer in der Urne. Ihre Anwesenheit schützt und fördert, auch ohne daß sie geschwungen werden. Sie werden nicht mit in die Grube des Kameni oder anderer Leute gelegt. Sie sind ganz einfach nur noch da aus alter Zeit. Nicht alle Djubuu scheinen Schwirreisen zu besitzen. — Dagegen werden die Schwirrhölzer an den entsprechenden heiligen Tagen geschwungen. Sie sind es, die die heiligen, weiberverscheuchenden Töne hervorbringen. — Wenn die Dosi gegeneinandergeschlagen und die Langa geschwungen werden, so sagt man, daß das die Stimme der Väter sei.
Die vornehmsten Obliegenheiten der Kameni sind die Abhaltung der Erntezeremonien, die an zwei verschiedenen Festtagen stattfinden, von denen der eine an den Beginn der Reife, der andere an den Beginn der Ernte gelegt wird.
Der erste der beiden Festtage heißt Kela und hat dem Monat, in dem er begangen wird, seinen Namen gegeben. Der Monat wird Sukela genannt. Er fällt nach unserer Zeitrechnung wohl ungefähr in den Anfang September. An diesem großen Tage hüllt der Kameni sich schon frühmorgens in ein weites Blättergewand, das aus grünen Zweigen zusammengesetzt ist und ihn von oben bis unten so vollkommen verhüllt, daß er fast wie ein wandelnder Busch aussieht. Zum gleichen Tage haben sich festlich vorbereitet vier alte Männer, vier Da-Kalomi, d. s. Greise und viele, viele kleine Knaben. Diese laufen immer hinter dem verhüllten Kameni mit seinen vier Alten her und schreien unentwegt "hu! hu! hut", und zwar das immer in den höchsten Tönen.
Die Prozession begibt sich hinaus zu den Farmen. Bei der ersten
großen Farm wird haltgemacht. Der Kameni nimmt ein wenig Goo, d. i. Jams heraus. Er wickelt einen Teil davon in die Blätter des Boo.. baumes. Dieser Boo heißt bei den Haussa Gonda, bei den Fulbe Dukudje, bei Kanuri Gonogo, es ist einer der beiden, aus denen die Tschamba ihre Tauwafiguren machen. Seine Rinde gilt allenthalben als geschätztes Medikament und seine Früchte kann man genießen. Der Kameni scharrt also eine flache Erdvertiefung, legt von dem Jams und den Booblättern hinein und belastet das mit einem Steine. —Die Kirn erklären, daß dieses Opfer (vom Jams Maniok und Guineakorn in Lumiablättern [Haussa =Oroa]) Shie, der Erde, und Ka, den Verstorbenen (merkwürdigerweise bei Fulbe Kaka) geboten wurde, damit die Ka gutes Korn und reiche Ernte gewähren. —Ist das Werk auf einer Farm vollendet, so zieht die Prozession zu einer anderen, vollführt die gleiche Zeremonie und bricht auf, die Farm einer dritten Familie mit gleicher Maßnahme zu bedenken. Die Prozession zieht von einer Farm zur andern, bis die Farmen aller Familien besucht sind. Dann wendet sie sich zum Heimweg. Von jeder Farm haben die Buben ein wenig Jams mitgenommen. Nun wallt der Zug zum Gehöft des Kameni, betritt dieses aber nicht, sondern sucht den dahintergelegenen Platz auf, auf dem das Djubuu steht, in dem sich das heilige Gerät befindet. Die Djubi selbst treten heute nicht in Tätigkeit, denn in der Regenzeit sollen die heiligen Stimmen nicht ertönen und soll dann das heilige Gerät überhaupt nicht sein Haus verlassen. Der Priester betritt anscheinend nicht einmal den Tempel. Wohl aber wird nun der mitgebrachte Jams neben dem Tempelchen abgekocht. Mit der Speisung endet das Zeremonial dieses Tages. Ist der Jams gekocht, so genießt erst der Kameni selbst davon, das andere aber verteilt er dann an die vier Greise und die vielen kleinen Kinder, die ihn auf der Prozession begleiten, die aber —wie nochmals betont wird — nur Knaben sind und unter denen sich kein weibliches Wesen befinden darf.
Vor oder während der Speisung wird nicht gebetet, wohl aber verrichtet der Kameni auf jeder Farm, auf der er Jams und Booblätter unter den Stein legt, folgendes nicht uninteressantes Gebet: "Ich gebe diesen Jams allen Vätern und allen Großvätern und allen, die gestorben sind. Ich gebe diese Booblätter und diesen Stein der Erde. Möge alles Schlechte, was das Korn im Boden zurückhält, aus der Erde weggehen!"
Im übrigen tritt von diesem Tage an für jedes Familienleben ein sehr strenges Gesetz ein: zum ersten darf niemand etwas von den Feldern genießen, also die neue Frucht berühren. Fernerhin ist aber auch jeder Geschlechtsgenuß, jede sinnliche Annäherung von Frauen und Männern, Mädchen und Burschen aufs strengste verboten, und zwar ist legitime Hingabe wie illegitime ebenso verwerflich.
Über den inneren Zusammenhang dieses Gesetzes mit der Einrichtung der Erntezeremonien waren meine Berichterstatter fast alle gleich unklar. Einer meinte, wenn trotz dieses Verbotes ein Mann den Beischlaf ausübe, so schade das dem Manne an sich nichts, für die Frau sei es aber durchaus schlecht; sie werde entweder das Bein brechen oder schwer erkranken oder so dergleichen. Nachher kam aber einer und sagte folgendes: Wenn eine Frau in dieser Zeit schwanger würde, so könne das Korn nicht gedeihen. —Ich glaube, daß hier ein selten heller Äthiopenkopf den Grundelementen dieser Anschauungswelten nähergekommen, als dies sonst zu erhoffen ist. Denn in unendlich konservativer Starrheit hat die stumpfsinnige Bauernmischung unserer Tage die Formen alten Ritus, erhalten, ohne aber dem inneren Sinne so viel Interesse widmen zu können, daß er davon leben und lebendig fortbestehen könne. Diese Sitten und Zeremonien sind versteinert, sind Knochengerüste ohne Muskeiwerk, und nur selten hören wir eine so kluge sinnlich wahrscheinliche Darlegung und Erklärung wie den eben wiedergegebenen Satz meines alten Dakkafreundes.Der Geschlechtsgenuß und die Genehmigung, von der neuen Saat zu genießen, werden erst wieder berechtigt, wenn die Kräfte, die in der Erde ruhen und wirken, ihr Werk vollendet haben, wenn die Ernte ganz reif ist. Und das wird mit einem zweiten Feste gefeiert, an dem die ganze Bevölkerung viel regeren Anteil nimmt.
Dies zweite Fest ist das Dja, das folgerichtig im Sudja, d. h. im Monat Dezember gefeiert wird. Dann ist nämlich alles Sorghum gemeiniglich zum Schnitte reif. Der Kameni setzt dann wieder den Tag fest und hüllt sich am frühen Morgen wieder in sein buschiges Blättergewand. Er bestellt wieder die vier Greise und versammelt wieder die vielen Knaben um sich. Wie beim ersten Feste zieht die ganze Prozession zu den Farmen hinaus, voran der belaubte Priester, hinterher die Knaben, die just wie damals ununterbrochen schreien. Auf der ersten Farm schneidet der Kameni dann einen reifen Stengel Sorghumkornes ab. Und so machen es die Burschen nach ihm auf den andern Farmen, so daß sie zuletzt mit einer guten Ladung, die von allen Farmen zusammengesammelt ist, in lärmender Prozession zur Ortschaft zurückkommen.
Im Gehöft des Kameni wird die Frucht ausgedroschen, und nach.. her begibt man sich wieder zum Djubuuplatze. Hier wird aus dem Korne Bier gekocht. Es ist eine große Menge, und für die vielen Leute benötigt man auch ein gut Teil. Der Kameni bringt auch die Opfertiere mit. Das sind vor allem ein ganz schwarzer Ziegenbock (= Win-wirrigi), dann ein gelber Hahn (= gwalum-dji). Mit diesen beiden betritt er das Djubuu, das Tempelchen. Drinnen tötet er beide Tiere, und zwar nicht durch Schnitt, sondern durch Erwürgen.
Er vollführt das anscheinend allein im Innern; die andern bleiben draußen, aber während des Würgopfers spricht er ein lautes Gebet, das man auch draußen vernimmt und das etwa folgenden Wortlaut haben soll: "Ich töte diesen schwarzen Ziegenbock und diesen gelben Hahn für euch, daß niemand krank werde! Sorgt, daß alles gut gehe und daß alles gesund sei, während von dem neuen Korne gegessen wird." Hierauf bringt er die beiden erwürgten Tiere hinaus, die vier Greise zerlegen sie nun. Dann wird auf dem Platze vor dem Djubuuplatz von der Prozessionsgesellschaft abgekocht. Sobald die Gerichte fertig sind, beginnt das Mahl, das der Kameni, die vier Alten und die Knaben miteinander teilen. Außerdem wird auch das Bier getrunken, das erste dieses Jahres, das vom Korn aller Farmen gebraut wird. Wenn das Mahl beendet ist, waschen sie sich insgesamt und gehen auseinander, ein jeder zu seiner Familie.Wie schon gesagt, sollen während der ganzen Regenzeit bei den Dakka die Djubi nicht ihr Haus verlassen. Heute, am Abend des Djafestes, kommen sie nun zum ersten Male heraus. Lärmend verlassen sie unter Leitung des Kameni ihr Haus und ziehen auf einem Umwege zum Platze vor dem Hause des Königs. Hier dröhnen Dosi und Langa mit aller Macht. Sie danken dem Könige, daß er den schwarzen Bock und den gelben Hahn gestiftet hat (denn er hat ihre Opfergaben zu liefern). Von diesem Augenblick an, wo die Djubi vom Djubuuplatze aus ihre dröhnenden Stimmen erheben, beginnen Weiber und Kinder, den Kopf verhüllend, fortzurennen. Sie laufen in ihre Hütten, verschließen die Türe und verharren in weggebeugter Stellung, bis das Tosen die Stadt verlassen und am Djubuu ausgeklungen hat. Es herrscht eine große Furcht vor diesen Nachtstimmen. Fragen die Kinder am andern Tage nach ihrem Ursprunge, so sagt man ihnen, das sei der ganz alte Koko (= Großvater) gewesen, der gestern so herumgebrüllt habe.
Sobald dieses Fest begangen ist, darf jedermann von der neuen Ernte genießen und sich, soweit nicht andere Behinderungen vorliegen, der Liebe nach Laune hingeben.
Kann man dieses Fest also als eine Gemeindeveranstaltung bezeichnen, in der alle durch gemeinsame Feldfruchtgabe und -opferung vereinigt werden, so wird gleichzeitig ein Opfer dargebracht, das nur im Königshause gefeiert und Sulumi genannt wird. Dieses Sulumi ist eine Art Gottesgericht und findet in dem Zeitpunkte statt, wenn im Periodenbau sonst die Beschneidungszeit einsetzt. Es ist das Fest, dem eventuell der König zum Opfer fällt.
Das Sulumi ist eine Zeremonie, die einen Monat nach dem Dja im Banne des Königsgehöftes stattfindet und zu der sich der Gangi (der König), der Gpegange, d. i. der oberste der Gweri, der Schmied und der Kameni vereinigen. Im Gehöfte des Königs, und zwar in
dessen Bierhause, hat der König zwei hölzerne Figuren, die Too genannt werden. Es sind eine weibliche und eine männliche Figur, eine tomi und ein tolumi. Es ist stets ein Paar und die Dakka sagen, sie seien genau von der gleichen Art wie die Tauwa der Tschamba, nur hätte bei den Tschamba eine jede Familie ein Tauwapaar; bei den Dakka besäße aber nur der König ein Toopaar, sonst niemand.Zur Sulumizeremonie werden die Too also aus dem Bierhause geholt und vor dem Gehöfte, und zwar vor dem Torhause des Gangi aufgestellt. Alle drei, Gangi, Kameni und Gpegange, sind um die Figuren versammelt. Der Kameni kommt mit einer Kalebasse voll Wasser. Der Schmied spricht darauf zu dem Priester: "Ich war es, der diese Too gemacht hat. Ich also beauftrage dich, den Kameni, den König zu den Too sagen zu lassen, was er für richtig hält." Darauf muß dann der Kameni dem Schmiede gehorchen (auch bei den Tschamba reicht der Oberpriester das Giftordal!); er hält dem Könige die Schale mit Wasser hin und der Gangi spricht vor den Too über oder auf der Wasserfläche in die Kalebasse: "Wenn ich, der Gangi, zu irgend jemand schlecht bin (oder gewesen bin?) und wenn ich gegen jemand ungerecht bin (oder gewesen bin?), dann mögen die Too mich strafen und töten. Wenn ich aber recht gehandelt habe, dann mögen die Too in Freundlichkeit das Wasser hinnehmen!" Wenn der König so gebetet hat, gießt der Kameni das Wasser vor den Too aus und spritzt danach die letzten, in der Kalebasse hängengebliebenen Tropfen auf den Kopf der beiden Figuren. Das ist die Sulumizeremonie, nach ihrer Vollziehung wandern die Figuren wieder für ein Jahr in das Bierhaus des Königs. —
Gottesgericht, Schmiede. —Dieses Sulumi ist also eine Art Gottesgericht für den König. Wir sehen auch hier wieder den echt äthiopischen Zug, daß der König durchaus nicht ein reiner Tyrann im orientalischen Sinne ist, daß er vielmehr dem Gerechtigkeitssinne unterworfen ist, so wie wir das schon von Herodot hören, wie die Mossi es üben, wie die Numu der alten Zeit in der Nacht des heiligen Gusses über den Mandekönigen richteten. Und diese Parallelität muß uns auch noch auffallen und unsere Aufmerksamkeit fesseln. Der Schmied fordert auch hier den König zum Selbstgericht vor den Werkzeugen seiner Hand heraus. So haben wir denn wieder einen jener großen Wesenszüge, die die äthiopische Kultur des Westens zwischen Schari und Senegal zu einer stempelt, wenn die einzelnen Varianten zunächst auch in hundert Farben zu schillern scheinen. Nachher werde ich auf die große Bedeutung der Schmiede im Legendenkreise der Dakka und Tschamba zu sprechen kommen.
Wie gesagt, wandern die beiden Too wieder an ihren üblichen Aufenthaltsort, d. i. das Bierhaus des Königs.
Toofiguren und Wuowuo. —Diesem Bierhause müssen wir das richtige Verständnis abgewinnen und ihm eine eingehende Beschreibung zuteil werden lassen, zumal wir es nicht nur in der fürstlichen Behausung, sondern auch bei Vornehmen finden. — Es führt den Namen Wuowuo und liegt, wenn man das Gehöft durch das Torhaus betritt, stets an der rechten Seite. Man kann nicht direkt hineinsehen oder hineingehen. Es ist stets eine Art Sekkozaun davor, in den ein bogenförmiger Eingang geschnitten ist, der durch Ruten versteifte Rahmung hat. Dieser Sekkoeingang heißt Jago. Ein schmaler Raum trennt den Jagobogen vom Wuowuo. In diesem weilt der Hausherr häufig. Es ist ein echtes Männerhaus, welches eine Frau niemals betreten darf. Es geht hier nicht etwa besonders mystisch zu, aber die männliche Exklusivität findet hier ihren bezeichnendsten Ausdruck. Wenn die Männer hier sich abends zum Trunk vereinigen, können sie sicher sein, daß kein Weib ihre Behaglichkeit stört. Hier hat jeder Familienvater auch seinen heiligen Kram. Hier wird z. B. auch das Juptege in einem Topfe aufbewahrt. Vor allen Dingen stecken im Königsgehöft aber die heiligen Geräte, die zum Sulumi herausgebracht werden. Vor den beiden heiligen Toofiguren befindet sich die männliche stets an der rechten, die weibliche immer an der linken Seite über der Mauer im Dach festgesteckt. Das entspricht der Auffassung, daß die rechte Seite Männer-, die andere Weiberseite ist. Aber das ist nirgends konsequent durchgeführt. Die Paarfiguren der Muntschi, Dakka und Tschamba haben alle eines gemeinsam: die männliche Type ist stets durch spitzen Auslauf, die weibliche durch flachen Abschnitt ausgezeichnet. Es ist auffallend, daß alle diese Stämme auf diese Kopfausbildung so großes Gewicht legen und lediglich damit die Geschlechtszugehörigkeit andeuten, die Geschlechtsteile selbst dagegen so gut wie gänzlich vernachlässigen. Es ist sehr selten, daß man einmal hier oder da eine Geschlechtscharakteristik findet. Und doch sind sie wieder in bezug auf die Paarstellung sehr wenig konsequent. Manchmal steht die Frau rechts, manchmal links. Einige dieser Figuren werden übrigens gleich aus einem Stücke geschnitzt. Sie stehen dann paarweise auf einem Sockel. Und das gemahnt dann noch mehr an die Paarfiguren, die auf den Deckelschalen der Tombo- und der Homburistämme stehen.
Noch mehr werden wir aber an diesen Formen- und Gedankenkreis des Westens erinnert, wenn wir das Beiwerk sehen, das diesen Toofiguren beigegeben ist. Es besteht in eisernem Gerät. Da ist vor allen Dingen Wo oder Wuo (einmal gab ein Mann die Bezeichnung Wosomi), das ist ein Eisen in Schlangenform, das heißt ein in Schlangenwindungen gebogenes Eisen. Es soll aber keine Schlange sein, sondern der Blitz. Ferner sind da Torsum und Rumssereni, Eisen.. stäbe, die zirka zwei Fuß lang und nach oben in eine Lanzenspitzenform
ausgehämmert sind. Rumssereni hat jederseits unter dem lanzettlichen Blatt eine nach oben geführte Spirale, über die lange Schelleneisen gehängt sind. Torsum unterscheidet sich von Rumssereni dadurch, daß es diese Schellenspirale nur an einer Seite hat. Alle diese Eisengeräte werden zum Sulumi mit aus dem Wuowuo vor das Gehöft gebracht und rund um die Too in die Erde gesteckt. Sie erinnern jedenfalls ungemein an die gleichen Geräte bei andern Völkern. Besonders wichtig scheint mir die Analogie mit dem Kultus der Tim. Diese haben auch die Paarfiguren und dazugehörig die Eisenschlangen und Eisenrasselstäbe, die so ungemein an die Ossenji der Joruben erinnern. Ja, ich erinnere mich an Timfiguren, die auf dem Rücken mit einer Schlange geziert waren.Die eiserne Blitzschlange erinnert aber daran, daß auch der Donnergott Schango hie und da in Tempeldarstellungen schlangenförmige Blitze hat, daß dieser Too aber außer Mehl und Bier hier bei Dakka nur einen roten Hahn, überall in diesen Gebieten Symbole der Schmiede und des Feuers (siehe Durru) geopfert werden darf. — Und darin scheinen alle Dakkastämme einig, wenn sie auch sonst im Kultus nicht unwesentliche Varianten zeigen.
Verschiedentlich hörte ich, daß die Too bei den Dakka als uralte Vorfahren des Königs angesehen werden.
Die Kirn nun, um auf diesen Südstamm zu sprechen zu kommen, haben diese Einrichtung der Paarfiguren im Königsbesitze anscheinend nicht, wohl aber konnte ich eine andere ausfindig machen, die mir in höchstem Grade bemerkenswert, und zwar bemerkenswert zur Analogie und zur Eisenausstattung der Too, scheint.
Der König (=Gjang) der Kirn besitzt eine Holzfigur männlichen Geschlechtes, die heißt: Wuo. (Wuo heißt in Kirn: Blitz.) Vor der liegt ein Stäbchen mit Muscheln = Tiksi und ein Wurfmesser aus dem Logonegebiete, im vorliegenden Falle Wuo-ssien, d. h. Speer der Wuo genannt. Diese Dinge repräsentieren gewissermaßen den Donnergott der Kirn, mit dem lediglich der Häuptling Beziehung pflegt, weshalb dieser das Gottesbildnis auch an einem geheimnisvollen Orte verborgen hält. Im allgemeinen erhält diese Gottheit auch nur ein Opfer, und zwar dies am Beginne der Regenzeit. Es besteht in Bier und Kornspeisen, die in Blätter gehüllt sind. Wenn solche Gabe dargebracht wird, sagt der königliche Spender: "Mein Großvater, iß du das Korn, ehe noch ein anderer davon genießt." Zu dieser Figur gehören dann noch die Ssu, das sind Blasekalebassen, die ihr während des Opfers zu Füßen gelegt, nachher aber, wenn die Männer draußen beim festlichen Umtrunk sitzen, im Hause geblasen werden. Die Frauen können sie dann hören, nie aber sehen. Sowie die Frauen sie sehen würden, würde alle Fruchtbarkeit von den Feldern und aus den Familien verschwinden.
Sehr wichtig aber ist, daß diese Figur auch dem Schwure gilt. Wenn eine kritische Situation eintritt, so muß der Angeklagte vor der Figur niedersitzen, muß das Wurfeisen anfassen und sagen: "Wenn ich das getan habe, soll mich der Blitz totschlagen!" Man nimmt an, daß das Wurfeisen den Falschschwörenden tötet. Wichtig ist, daß in älterer Zeit auch der König schwören mußte, wenn er etwas Schlechtes getan habe, solle ihn der Blitz treffen. In welchem Zeitpunkt des Jahres dieser Schwur abgelegt wurde, konnte ich nicht mehr feststellen, jedenfalls stimmt er ganz genau mit dem entsprechenden Eidschwur überein, den der Nagajarenkönig von den Too ablegen mußte.
Und so sehen wir vielfache Verknüpfung. Die Nagajare bezeichnen das heilige Haus, das die Toofiguren birgt, als Wuowuo, die Eisenblitzschlange als Wuo; hier heißt die Figur Wuo und das von weither gekommene Wurfeisen Wuo-ssien, also als des Donnergottes Waffe, die sonst der Blitz, die eiserne Blitzschlange, und bei andern Völkern der Donnerkeil ist. Beiderseits der Eidschwur! Die Fäden verlaufen hier so ungestört parallel, daß das Gewebe einst wiederhergestellt werden kann.
Im übrigen hat der Kameni bei Beschneidung und Begräbnis mitzuwirken — in welcher Weise, soll im nachfolgenden geschildert werden. Dagegen hat er mit Geburt, Heirat und auch dem Regenzauber nichts zu tun. Das sind eben Angelegenheiten, die absolut privatfamiliärer Natur sind oder aber —wie z. B. der Regenzauber —hier mit der Erde, und zwar der gemeinsamen Erde nichts zu tun haben. Mir scheint das Tätigkeitsgebiet des Kameni außergewöhnlich klar begrenzt.
Priester und Priestertätigkeit. — Nun noch einige Anmerkungen über die entsprechenden Einrichtungen und Sitten der Kirn. Bei diesen heißt der Priester trotz aller sonstigen linguistischen Übereinstimmung nicht Kameni, sondern Djakonsu oder Djakomsu. Fernerhin besitzen die Kirn unter den heiligen Geräten nicht die Langa, die Schwirren. Ihre Stelle wird durch ein Kalebassenblasinstrument, ein Ssu, eingenommen. Das Schellengeläute = Dosa ist vorhanden.
Für die Dosa verrichtet der Djakomsu in jedem Jahre, vor der Ernte, also Anfang November, ein Opferfest. Der Djakomsu geht mit einem schwarzen Ziegenböcke (= Djinjuga) in den Busch, in dem der heilige Subiplatz liegt. Dort sind die Dosa in einem geschlossenen Topfe aufbewahrt. Der Djakomsu betritt mit den alten Leuten den Platz, nimmt die Dosa heraus und betet: "Hier bringe ich dir ein Geschenk. Bringe allen Leuten Glück! Sorge, daß keine Krankheit eintrete." Danach wird der schwarze Bock getötet, zubereitet
und vorn Djakomsu verspeist. Das ist das wichtigste Fest für die Dosa. Dieselben werden nicht wie bei den Nagajare mit dem Priester begraben, sondern einfach auf den Sohn fortvererbt, der nach dem Tode seines Vaters traditionell Djakomsu wird.Die nächste Opferung, die der Djakomsu zeitgemäß vorzunehmen hat, ist die vor den Königstoo, die vorher besprochen wurde, und daran schließt sich dann, wenn das Jahr gerade entsprechend liegt, die Beschneidung der Burschen. Die Kirn pflegen auch wie andere Völker dieser Gegenden die Beschneidung nur alle sieben Jahre vorzunehmen. Die Kirn geben an, daß die Beschneidung bei ihnen nichts mit dem Tode des Königs (= Gjang) zu tun habe. Dieser gibt jedes siebente Jahr mit dem Zeichen seiner Macht, dem Speer (=Samiagi), die Zustimmung dazu.
Und doch besteht ein vielleicht nicht ganz zufälliger Zusammenhang zwischen Königtum und Beschneidung. Jedem regierenden König ist es strengstens untersagt, Leoparden (= djue) zu töten oder von ihrem Fleische zu genießen. Wuo selber wacht über der Innehaltung des Gebotes. Anderseits führt der Djakomsu auch hier wieder die Operation in seinem Kleide aus, das nun vollständig eine Vermummung im Leopardenfell darstellt. Ja, es soll sogar vorkommen, daß, wie bei den Nagajare, die Messer in einer Leopardentatze aufbewahrt werden, was um so bedeutungsvoller scheint, wenn man auch gelegentlich hören kann: "Wenn ein Bursch in der Beschneidungszeit stirbt, sagt man nachher der Mutter, ein Leopard habe ihn getötet." Ich glaube, schönere Zusammenhänge kann man sich nicht wünschen. —
Im übrigen verrichtet der Djakomsu allgemein gesagt dieselben Zeremonien und Opfer wie der Kameni, wenn ihm auch z. B. bei der Dosabeopferung und Begießung mit Bier (= Sim) der Kunzie genannte Unterpriester hilft. Wie bei andern Stämmen liegt in seiner Hand auch das Reifezeremonial, und dessen genußeinschränkende Bedeutung erstreckt sich auch hier auf eine eheliche Enthaltsamkeit und das Sorghum, aber auf keine andern Feldfrüchte.
Der Djakomsu hat aber bei den Kirn noch eine Opferzeremonie auszuführen, die die Nagajare nicht pflegen. Wenn kein genügender Regen fällt und in der Saatzeit Gefahr im Anzuge ist, dann begibt sich der Djakomsu mit gewissen Blättern, Mehl und Wasser hinaus auf einen Kreuzweg (= honuo), legt die Blätter hin, mischt darauf das Mehl mit Wasser und betet: "Dieses Geschenk hier bringe ich, damit es regne. Laßt es regnen, denn dieses Korn vertrocknet in der Erde." — An wen das Gebet im Speziellen gerichtet ist, konnte ich nicht feststellen, aber sicher ist, daß man an seine Wirkung glaubt.
Wichtig ist, daß die Blätter, die auf dem Kreuzwege unter das Mehl gelegt werden müssen, Blätter vom Baume Luom sein müssen. Dieser
Luom heißt bei den Kanuri Runo, bei den Fulbe =Nunudje, in Joruba =Egba,bei den Haussa =Doroa, in Nupe =Ellu. Dieser Baum hat eine längliche Frucht, deren zahlreiche Kerne von Kindern und Erwachsenen gern genossen werden. Es ist die berühmte Sumbala der Mande. Das Wichtigste nun ist, daß die Priester der Dakka nicht nur ihre Opfergabe in Blättern vom Luom (Kirn) oder Lomi (Nagajare) darbringen, sondern daß der Genuß dieser Frucht auch ihr Speiseverbot darstellt. Deshalb sind sie alle von einer Familie, die dem verbotenen Baum entsprechend bei Kirn Ljekuna, bei Nagajare Longkumi heißen.Königstod, Beschneidung. — Nun werden wir die merkwürdigste Sitten- und Anschauungsverknüpfung kennenlernen, die das Religionssystem dieser Dakka bietet und die in ihrer Art eine wunderbare Analogie zu ähnlichen Erscheinungen bei den Lakka aufweist.
Man sagt, im allgemeinen fände Jereni, die Beschneidung, nur alle sieben Jahre nach der Begehung des Sulumi statt, und zwar fügten meine Berichterstatter erklärend hinzu: In alter, alter Zeit hätten die Dakka die Beschneidung alle drei Jahre abgehalten; da aber starben die Könige zu schnell, nämlich auch alle drei Jahre; denn das Blut, das bei der Beschneidung fließe, töte die Könige und flösse ihrem Leben nach. Um nun zu verhindern, daß die Könige so oft stürben, hätten sie die Periode der Beschneidungszeiten auf sieben Jahre festgesetzt. Daher stürbe jetzt der größte Teil aller Könige alle sieben Jahre. Wenn er nicht nach sieben Jahren stürbe, so müsse er vor dem fünfzehnten Jahre seiner Regierung sterben — denn nach sieben Jahren würde ja wieder ein Beschneidungsfest abgehalten, und mehr als eine Beschneidungsperiode und deren Blutfluß könne kein König überleben. Soweit die erste direkte Erklärung. Ich werde aber sogleich zeigen können, daß die Beschneidung als Sitte und Opferart noch bedeutend enger mit dem Königswohl, dem Königstode und der Königswahl zusammenhängt. Verfolgen wir aber erst den Weg des toten Königs.
Wenn ein König der Dakka stirbt, was meistens nach dem Sukumizeitpunkt stattfindet, verheimlicht man das dem Volke zunächst so peinlich wie möglich, und wenn es trotzdem Außenstehende merken sollten, so haben auch sie die Pflicht, die Tatsache nicht zu besprechen oder irgendwie von ihr merklich Kenntnis zu nehmen. Nur die Familie, der Schmied und der Kameni wissen darum und erledigen alles. Schmied und Priester bereiten erst die Leiche, dann wickeln sie sie in die bekannten breiten Stoffbänder, die man hier Jagessi nennt und die die Dakka angeblich von den Koma oder Werre kaufen. Darauf schaffen sie bei Nacht den Leichnam heimlich
dahin, wo alle Könige nebeneinander begraben liegen, jeder in seinem eigenen Grabe, aber alle auf gleicher Fläche. Jedes Grab ist eine tiefe Grube, von deren Sohle ein Kanal nach Sonnenaufgang verläuft. In diesen Kanal lagert man den Leichnam, und zwar auf seine linke Seite, die linke Hand unter der linken Wange, die rechte Hand oben herüberfallend. Sein Antlitz wird dabei nach Süden gewendet, so daß die Füße also dem Kanalausgange nach Westen zu Platz finden. An sein Kopfende kommt ein Sack mit schwarzem Eingeborenensalz aus Pflanzen- oder Düngerasche gelaugt. Mehr gibt man dem Herrscher nicht mit. —Die Schachtöffnung wird hierauf mit einem flachen Stein geschlossen und hierüber ein großer Topf gestülpt, der von allen Seiten durch Erdverkleisterung fest mit dem Boden verkittet wird, damit kein Wasser hineinrinnen und unten eine Zerstörung anrichten könne. Sollte später trotz aller Vorsicht dennoch das Grab einstürzen, so wird ein schwarzer Schafbock (Tomsulum =wirgi) darüber geopfert. Sein Blut muß hinabtropfen, und dann wird das Grab repariert. —Nachdem nun der König gestorben und in aller Heimlichkeit begraben ist, geht man sogleich daran, in größerer Menge Bier zu brauen, das drei Tage nach dem Tode des Königs fertig sein muß. Während dieser dreier Tage wird das Geheimnis aber strengstens gewahrt. Um den Volksbetrug aufrechtzuerhalten, setzt der Kameni irgendeinen alten Mann in die Hütte, dahin, wo sonst der König zu hocken und Besuche zu empfangen gewöhnt war. Er sitzt da zusammengekauert und vornübergebeugt, so daß man ihn nicht erkennen kann und man wohl glauben könne, der König sitze da in etwas nachdenklicher Stellung und fühle sich nicht recht wohl. Da nun aber die großen Könige der Dakka vordem überhaupt nicht mit dem Volke zu sprechen pflegten, so braucht es ja auch nicht aufzufallen, wenn der König in diesen Tagen offenkundigen Mißbefindens ganz gleichgültig dahockt. Soweit die Schilderung des Königsvertreters nach den Angaben meiner Berichterstatter.
Drei Tage nach dem Königstode ist nun aber das frisch gebraute Bier fertig. Da ruft der Kameni alles Volk zusammen und verkündet, daß der Gangi gestorben sei. Alle Welt schreit auf. Wehklagen verbreitet sich über die Dörfer und Farmgehöfte. Soweit die Kunde dringt, schneiden Männer und Weiber die Haare und nachts dröhnen die heiligen Schellen und Schwirren durch die Luft — was sich bei Totenfesten nur gelegentlich des Hinscheidens des Gangi oder des Kameni ereignet, sonst aber für keinen Sterblichen.
Am andern Tage ist dann aber ein bedeutsames Fest. Nun wird das Bier hervorgeholt, das nach dem Ableben des Königs gebraut ward. Jeder, der nur ein wenig bedeutet, kommt herzu. Alles trinkt von dem königlichen Leichenbier. Zwischen den zechenden Leidtragenden
sind aber auch die Kinder, die Söhne der Schwester des verstorbenen Königs —also dessen Neffen —anwesend, und unter diesen befindet sich der zukünftige König. Auch der Kameni ist anwesend. In seiner Tasche oder im Lendenbehang trägt er ein bestimmtes Blatt bei sich. Es ist ein Blatt vom Guschinobaume, den die Fulbe Katkatki und die Haussa Schiwaka nennen. Die Blätter dieses Baumes sind bitter und werden häufig als Medizin für kranke Pferde verwendet. Also ein solches Blatt trägt der Kameni bei sich und damit geht er zwischen den Zechenden hin. Kommt er nun am ältesten Neffen (Schwestersohn) des Verstorbenen vorbei, so zieht er unversehens das Blatt heraus und steckt es jenem vorn in den Schurzbehang (vorderer Schurzbehang: Ische = benani, hinterer Schurzbehang: Ische =dunani), und zwar derart, daß es allen sichtbar ist. Diese Anheftung des Blattes durch den Kameni ist gleichbedeutend mit der Königswahl. Sowie das Volk das Blatt wahrnimmt, beginnt ein allgemeiner Jubel. Die Frauen kreischen. Die Männer umdrängen den zukünftigen Gangi. Dann wird an Essen und Bier herangebracht, was irgend aufzutreiben ist, und die Zecherei wird so lange fortgesetzt, wie der Stoff reicht.Nun aber kommt das seltsame Bindeglied in diesem merkwürdigen Sitten- und Anschauungsaufbau: Nachdem der alte König gestorben und der neue erwählt ward, muß erst eine Beschneidung der Burschen stattfinden, ehe der neue König wirklich anerkannt wird. Nun sind sich meine Berichterstatter darin vollkommen einig gewesen, daß erstens das Beschneidungsfest nur alle sieben Jahre stattgefunden hat, und daß jeder König vordem stets wenige Tage vor dem Ablauf der Sieben-Jahre-Periode und vor dem Beginn einer neuen Beschneidungszeit "gestorben" ist! Also können wir, in Anbetracht, daß wir das Beispiel der Mundang vor Augen haben, ganz folgerichtig annehmen, daß jeder König, wenn ihn nicht eine höhere Gewalt abrief, kurz vor dem Ablaufe einer Interkonzisionszeit ums Leben gebracht wurde. Diese Annahme oder Schlußfolgerung wird noch dadurch bekräftigt, daß jedes Beschneidungsfest unbedingt für ein Opfer gilt, das dem verstorbenen Könige dargebracht wird. Die Dakka sprechen direkt aus, daß alles Blut, das bei der Beschneidung fließt, dem letztverstorbenen Könige zufließe. Und deshalb, so erklären sie, kann der neue König auch noch gar nicht richtiger König sein, ehe nicht das Beschneidungsfest für den verstorbenen König vonstatten gegangen wäre. Würde er schon vorher als richtiger König angesehen, so sagte ein Dakka, würde er wahrscheinlich während des Beschneidungsfestes sterben!
Also sendet der Kameni in alle umliegenden Ortschaften die Nachricht, daß der Zeitpunkt gekommen sei, die Buben und Burschen zu einer Beschneidungsfeier zusammenzubringen. Und nun kommt
alles zusammen, was beschnitten werden kann, will und soll, und das sind ganz kleine Kinder und größere halberwachsene Menschen. Der Kameni, der alledem vorsteht und zu allen Nebendiensten seine eigene Familie verwendet, läßt demnach im Norden und in entsprechender Entfernung von der Ortschaft von seinen Söhnen einen größeren Platz säubern, auf dem alle zusammenkommen. Die Kinder werden von ihren Vätern und Müttern begleitet, die ihnen die nötige Beihilfe zuteil werden lassen.Die Operation findet dicht neben einem Wasser statt. Der Kameni gibt sich dazu ein möglichst fürchterliches Aussehen. Er ist über und über rot bemalt und trägt auf dem Kopfe ein Leopardenfell. Diese Staffage ist, nach fester Behauptung der Dakka, nur dazu da, die Burschen möglichst zu erschrecken, und soll weiter keine Bedeutung haben. Wir denken aber unwillkürlich daran, daß auch die Mundangbeschneider so gekleidet sind und daß auch bei den Beschneidungsmeistern der Tschamba die Operationsinstrumente in einer Leopardenklaue auf der Brust hängen — wir denken daran, daß die Fürsten dieser Stämme meist den Leoparden oder Löwen zum heiligen Tiere haben, daß die Beschneidung hier bei den Dakka ausgesprochen und bei den Mundang schlußfolgerungsgemäß vordem oder heute als Opfer für den verstorbenen König aus diesem Raubtiergeschlechte galt. Wir denken unwillkürlich an alle diese Zusammenhänge und fragen uns, ob diese Sitte lediglich zum Erschrecken erstand und nicht vielleicht als eine tiefer empfundene Beziehung zu mythologisch-sozialem Wesensglied. —
Der schauerlich ausstaffierte Kameni steht also nahe dem Wasser und läßt sich einen Burschen und Buben nach dem andern vorführen. Er löst mit schnellem Schnitt ein Praeputium (Pannguu) nach dem andern ab und wirft es in eine zu diesem Zwecke ausgehobene Grube, die nach Aufnahme aller Operationsobjekte wieder zugeschüttet wird. Die ersten, die der Operation unterworfen werden, sind die eigenen Söhne des Kameni. Jeder Bursche muß den Schnitt im Stehen und in leicht hintenübergebeugter Haltung an sich vollziehen lassen. Vater und Bruder halten ihn. Er darf auf keinen Fall schreien oder strampeln. Das würde eine große Schande über ihn bringen und unendlicher Hohn der Altersgenossen würde ihn noch lange verfolgen. Wenn der Schnitt erfolgt ist, eilt der Operierte ins Wasser, um die Wunde zu kühlen und das Blut abrinnen zu lassen. Nachher wird er von den älteren Söhnen des Kameni, die diesem assistieren, verbunden.
An diesem Abend ertönen weit in die Nacht hinein die Langa und die Dosi oder Doschi. Darob verbreitet sich im Lager der Beschneidungszöglinge große Angst. Sie hocken in ihren Hütten, beugen sich weit nach unten, damit kein Blick nach oben sie irgendeinem unheimlichen
Geiste der Luft preisgabe, und verstecken sich in ihrem Blätterkleide. Wird anderntages irgendeine schüchterne Frage laut, so erfolgt die Antwort: "Das waren die Koko (die alten Großväter), die schrieen."Die Burschen werden auch während der ganzen, zwei Monate dauernden Zeit nicht in die Mysterien der Djubi eingeführt. Das findet erst ein Jahr, nachdem sie die Beschneidung über sich haben ergehen lassen müssen, statt.Während der zwei Buschmonate sind die Burschen in Blätterkleider gehüllt, die angeblich ihren ganzen Körper bedecken. Aber an dem Tage, an dem sie zu den übrigen im Dorfe zurückkehren, legen sie diese Kleidung ab. Der Vater bringt ihnen aus der Ortschaft einen neuen, hübschen Vorder- und Hinterschurz, und in dieser Gewandung ziehen sie dann wieder zusammen aus dem Busch in die Heimat zurück. Während der ganzen Zeit ihres Lagerlebens durften sie kein weibliches Wesen sehen, durfte sich ihnen kein weibliches Wesen nahen. Die Speise wurde von den Müttern nur in entsprechende Nähe gebracht und dann von den Vätern oder Brüdern abgeholt. Heute sehen sich nun also Mütter und Söhne, Schwestern und Brüder wieder, und die Weiber geben ihrer Freude gehenden Ausdruck.
Alles zieht zunächst auf den Platz vor dem Königsgehöft. Es ist vorsorglich Bier und allerhand gute Speise bereitet worden. Die Schlemmerei ist eine allgemeine. Nach einem großen Tanze erfolgt der Umtrunk, wieder Tanz usw. Wenn nun aber ein Bursche im Busch starb und die Mutter unter der fröhlichen Gesellschaft ihr Kind vergeblich sucht, so gibt man ihr die niederdrückende Antwort: "Djubi-gani", das heißt: "Die Djubi haben ihn gegessen." Diese Antwort aber ist klassisch wertvoll. Ich erinnere daran, was schon der alte Dapper über die Beschneidungszeremonien der Belli in Liberia erzählte, was ich dazu bei Gersse und Tomma usw. erfuhr, was man mir in Nupe sagte. Man spricht hier nur davon, daß ihn der Stammes-, der Ahnengeist verzehrte, man sagt nicht, daß die Wiederkehrenden die Wiedergeborenen sind, aber die Idee liegt in ihrer Projektion auf der gleichen Ebene. Sie ist hier nur nicht zu Ende gedacht.
Sobald dieses Fest begangen ist, gilt der neue König wirklich als bestätigter Herrscher, dem eine Regierungsdauer von sieben Jahren bevorsteht. —
Nur ein Beschnittener kann heiraten. Das scheint die einzige Vorbedingung der Ehe. Es ist sicher kein Zufall, daß gerade hier, wo die Jugendliebe fehlt, die Verehelichung um ein Bedeutendes vereinfacht ist gegenüber jenen Stämmen, bei denen die Burschen erst eine Zeitlang mit ihren Mädchen legitim in freier Liebe leben dürfen. Ja, ich gewinne sogar den Eindruck, als ob hier gar nicht etwa die Jugendliebschaft aus dem Leben der Burschen ausgeschaltet ist, sondern als ob die Verehelichung der Dakka der Liebschaftsanknüpfung der andern Stämme entspreche, also bei ihnen die Ehe weiter nichts sei als eine zur Dauer erhobene Jugendliebschaft — daß also demnach bei den Dakka nicht etwa die Jugendliebe mit ihrer wunderlichen Form der Probenächte, sondern die Erwerbung des Besitzrechtes an die Frau durch Zahlung, alias "echte" Verehelichung fehle. Ob das ein älterer archaistischer oder ein jüngerer durch Sittenverlust entstandener Zustand ist, will ich dahingestellt sein lassen. — Die Sache geht nämlich in folgender Weise vor sich:
Der Bursche und das Mädchen sprechen zunächst miteinander über die Möglichkeit einer Verehelichung. Niemand wird zu Rate gezogen weder von ihrer noch von seiner Seite. Sind sie sich einig, so geht der Bursche eines Tages mit einigen Freunden in das Gehöft des Vaters der Braut, und da wird diese denn eingefangen und in das Haus geschleppt, in dem der Bursche auf seines Vaters Grund und Boden wohnt. Dabei strampelt und wehrt sich das Mädchen durchaus nicht. Sie geht willig mit und es scheint, daß ihre Angehörigen kein Recht irgendeines Einspruchs besitzen. Daß dieses eine Brautraubsitte, wenn auch eine um das Heulen und Zähnefletschen beschnittene Variante derselben ist, daß hier überhaupt keine Besitzergreifungsform durch Kauf vorliegt, geht nicht nur daraus hervor, daß die Genehmigung der Brauteltern verschmäht wird, sondern auch aus der Kümmerlichkeit der Geschenke und daraus, daß die Braut überhaupt keine Aussteuer mit in das Haus ihres Gatten bringt.
Sowie der Bursch seine Braut im Hause hat, sendet er dem Schwiegervater fünf Hühner und eine Ziege. Das ist alles. Er ist auch in keiner Weise weder vor noch nach der Verehelichung gezwungen, auf den Farmen des Schwiegervaters zu arbeiten. Wenn er an großen Arbeitstagen, wenn der Schwiegervater viel Bier gebraut hat und alle Leute zum Biertrinken und Mitarbeiten zusammenruft, auch hingeht und trinkt und arbeitet, so tut er das eben wie jeder andere Bursche des Dorfes, der für ein gutes Freibier schon gern einmal auf dem Acker eines Großbauern in fröhlicher Gemeinschaft arbeitet. Aber
er tut das nicht etwa als Schwiegersohn. — Nachdem der Bursche seine fünf Hühner und eine Ziege abgeliefert hat, erfolgt anstandslos die eheliche Verbindung. Die Stellung ist die echt äthiopische, d. h. der Mann hockt hin, legt das Weib vor sich auf den Boden und schlingt dessen Beine um seine Lenden. (Beschlafen =Laeneni, Penis =quani, Skrotum =derre, Vagina = don, Klitoris =dormiri.) Ein reichlicher Blutfluß in der Hochzeitsnacht als Zeichen weiblicher Unberührtheit ist erwünscht, und wenn er dem jungen Ehemanne genügend erscheint, sendet er dem Schwiegervater ein Huhn. — Damit ist alles erledigt. Weiteres Aufheben macht man von der Verehelichung nicht.Nun kann sich jedoch nicht jeder Bursche mit jedem Mädchen ehelich verbinden. Es herrscht streng totemistische Exogamie. Man unterscheidet im Dakkalande fünf verschiedene Sippen (=kuni), und zwar sind dies unter gleichzeitiger Aufzählung des Speiseverbotes folgende:
1. Gan-kuni (Königssippe), ißt nicht Njiki =Löwe und Gwe =Leopard.
2. Kongla-kuni, ißt nicht Kongla, den Elefanten.
3. Fed-kuni, ißt nicht jerri, den Büffel.
4. Gin-kuni, ißt nicht gingi, d. i. Adja (panicum).
5. (G)bae-kuni, die Schmiedesippen, die alles essen (siehe unten).
6. Long-kuni, die vornehme Sippe der Priester (Karemi, siehe oben).
1. Gank-una, die Sippe der Fürsten, deren regierende Mitglieder den Leopard weder töten noch von seinem Fleische genießen. Sie haben in früherer Zeit angeblich das Gebot befolgt, alle oberen Schneidezähne zu spitzen, das heute aber von ihnen wie andern Stammesgliedern der Laune entsprechend durchgeführt wird.
2. Tua-kuna, der die Schmiede angehören, von deren Speiseverbot ich nichts erfuhr.
3. Gua-kuna, die den Alligator = Cuarum nicht genießen.
4. Lje-kuna, der Sippe der Djakomsu (siehe vorher).
Das Tier oder Gewächs, das eine Sippe nicht ißt — man sieht, drei von ihnen haben danach direkt ihren Namen — wird als girenni bezeichnet. Leute mit gleichem girenni können einander nicht heiraten. Außerdem heiraten die ersten vier Sippen zwar alle durcheinander, nie aber mit Schmiedesippen, über die wir dann noch besonders zu sprechen haben. Das Speiseverbot wird durchweg mit der Abstammung oder einer Urverehelichung in Verbindung gebracht, und zwar ward mir als ausdrücklich beweisendes Material folgende
wertvolle Legende erzählt, die den Ursprung des Jed-kuni und ihres Speiseverbotes erklären soll:In alter, alter Zeit ging einmal ein gola, ein Jäger, in den Wald, um ein Tier aufzuspüren. Er kam an eine Stelle, an der der Boden wie Salz (salzhaltig) war und an der er die Spuren vieler Büffel sah, die hier Salz geleckt hatten. Der Jäger stieg auf den Baum, um auf die Tiere zu warten. Nachdem der Jäger lange auf seinem Baume gewartet hatte, kamen viele, viele Büffel an. Es waren Bullen und Kühe und Kälber. Der Jäger nahm seinen Bogen hoch und wollte einen guten Bullen schießen. Da fingen alle Büffel an, ihre Haut abzulegen. Überall lagen die Häute der Büffel und die Büffel waren nun selbst Menschen, Männer und Frauen, und diese fingen an, von der salzhaltigen Erde abzukratzen und zu essen. Nachdem sie das eine Zeitlang getan hatten, gingen sie wieder zu ihren Häuten. Ein jeder legte seine Haut an, ward wieder ein Büffel und lief in den Wald. Die Bullen liefen in den Wald, die Kühe liefen in den Wald, die Kälber liefen in den Wald. —Als die Büffel fortgelaufen waren, stieg der Jäger von seinem Baume und ging in seinen Ort. Er sammelte viele Termiten. Am andern Tage ging er dann wieder in den Busch und nahm die Termiten mit sich. Er versteckte sich im Gebüsch der Bäume und wartete. Nach einiger Zeit kamen die Büffel wieder, Bullen und Kühe und Kälber. Die Büffel fingen an derselben Stelle an, ihre Haut abzulegen. Überall lagen die Häute der Büffel und die Büffel waren nun selbst Männer und Frauen und diese fingen an, die salzhaltige Erde abzukratzen und zu essen. Darauf stieg der Jäger aus seinem Baumgezweig und ging dahin, wo ein großes Büffelkaib, ein Mädchen, seine Haut abgelegt hatte. Der Jäger legte die mitgebrachten Termiten darauf und diese fingen sogleich an, die Haut zu zerfressen. Nachdem die Büffel eine Zeit aber die Salzerde abgeschabt und gegessen hatten, gingen sie wieder zu ihren Häuten. Ein jeder legte seine Haut an, ward wieder ein Büffel und lief in den Wald. Die Bullen liefen in den Wald, die Kühe liefen in den Wald, die Kälber liefen in den Wald. Das eine Mädchen, auf dessen Haut der Jäger die Termiten gelegt hatte, ging auch zu ihrer Büffelhaut und wollte sie anziehen. Die Termiten hatten sie aber so zerfressen, daß sie ihr wieder abfiel. Alle andern Büffelbullen und Kühe und Kälber hatten ihre Haut schon lange angelegt und waren in den Wald gelaufen. Das Mädchen stand noch bei seiner Haut und weinte. Da stieg der Jäger heimlich vom Baume, schlich sich zu dem Mädchen und fing es. Er brachte es nach seiner Ortschaft und heiratete es. Aus dieser Ehe ist die Jed-kuni(familie) hervorgegangen, und weil eine Büffelkuh ihre Ahnfrau ist, deshalb essen sie kein Büffelfleisch.
1. das Beschneidungsfest,
2. die Bestattung des Königs und
3. die Bestattung des Kameni.
Mit dem wilden Büffel und dem Dienste dieser Art hängt aber auch noch eine Einrichtung zusammen, die als Jup-tege bezeichnet wird. Sie besteht aus einem großen Büffelhorn, dessen Rand mit Eisenringen besetzt ist, und einem kleinen Hörnchen. Jeder Wohlhabende hat ein solches, aus zwei Stücken bestehendes Instrument, denn es gilt als wertvoller, im Wunschfalle todbringender Beschützer einerseits und als die Familie unterstützender Segenspender anderseits. Jeder Hausherr hat das Instrument, in einem Topfe geborgen, in seinem Wuowuo liegen. Wenn ihm nun etwas gestohlen ist, so nimmt er das Jup-tege heraus, schlägt mit dem kleinen Hörnchen gegen das große Ringhorn und betet: "Wer mir das stahl, den töte! Wer mir das stahl, der soll sterben! Wer mir das stahl, der soll sterben!"
Frauen dürfen das Jup-tege auf keinen Fall sehen, wohl aber seine befruchtende Kraft genießen. Wenn eine Frau unfruchtbar bleibt, so füllt der Hausherr im Wuowuo ein wenig Medizin und Wasser in das Ringhorn und betet: "Möchte diese Frau doch ein Kind erhalten. Möchte diese Frau doch ein Kind erhalten!" Dann gießt er den Trank aus dem Horn in eine Kalebasse, bringt ihn der Frau in ihr Haus und gebietet ihr zu schlürfen. Die Folgen bleiben nicht aus.
Wir sehen hier also Tod und Leben in einem Instrumente zusammengefaßt. Hier ist es an der Zeit, auf die erstaunliche Ähnlichkeit hinzuweisen, die diese Kulturform mit der der Jukum gemeinsam hat. Das Jup-tege ist genau das gleiche Instrument, das die Aku-kua schwingen. Auch dort ist, den Entstehungszügen nach, die Idee des Todes diesem Instrumente einerseits nach allen Konsequenzen, anderseits nach der totemistischen Grundidee verbunden. —
Genau gleiche Anschauungen und Legenden finden wir nun auch bei den Kirn; und da doch eine Abweichung der Sitten und Berichte
von denen der Nagajare vorliegt, so mögen alle Angaben hier wiederholt werden.Die Kirn haben ein Instrument, das heißt Ta-djubi. Das besteht aus mehreren rohen, zusammengebundenen Aststücken, an denen an einer Schnur das Horn eines wilden Büffels herabhängt. Der Mann, der dies aufbewahrt, führt den Titel eines Singterra. Das Tadjubi hängt an der Wand des Hauses des Singterra. Wenn der Gatte nun mit allzu langer Sterilität seiner Gattin unzufrieden ist, begibt er sich mit ihr zu diesem Heiligtume. Als Gabe bringt er guten Mehlbrei mit. Vor dem Ta-djubi betet der Mann: "Hier ist meine Frau. Ich habe sie vor so und so langer Zeit geheiratet. Ich beschlafe sie. Sie wird nicht schwanger. Sage du, daß sie schwanger werde! Dieses gebe ich dir!" Danach gießt der Gatte den Brei auf die Holzstücke und das Horn, und damit ist dann das Befruchtungsopfer abgeschlossen. Das Ehepaar geht hoffnungsvoll nach Hause.
Die Kirn haben angeblich auf deutschem Gebiet keine Masken, dagegen sollen einige englische Kirriortschaften Büffelmasken haben, die dann auch Nanbiningi heißen. Näheres konnte ich nicht hören. Dagegen haben die Kirn ebenfalls die Büffellegende, und zwar die schönste und vollständigste Form, die mir überhaupt bekannt geworden ist. Sie lautet:
Ein Jäger (Sanam-buka) ging einmal in den Busch. Er war lange umhergelaufen. Er kam an ein Wasser. Der Jäger hörte etwas. Er versteckte sich. Nachdem der Jäger sich versteckt hatte, kamen Büffel (Nam oder Namm) an. Diese Büffel begannen ihre Haut abzulegen. Sie wurden Menschen. Jeder Büffel legte seine Haut ab und ward ein Mensch. Als die Büffel ihre Häute abgelegt hatten, begannen sie von dem Salz, das am Wasser war, zu essen. Der Jäger sah das alles. Er schlich sich vorsichtig hin und nahm eine Haut der Menschen, die am Wasser waren, weg. Er nahm die Haut mit und versteckte sich. Nach einiger Zeit kamen die Menschen wieder. Sie begannen ihre Häute anzulegen. Jeder legte seine Haut an und lief als Büffel von dannen. Die letzte Büffeifrau suchte ihr Büffelfell. Sie konnte ihre Haut nicht finden. Sie ging hierhin und ging dahin. Sie konnte nun nicht mit den andern fortlaufen, denn sie hatte keine Haut. Die andern Büffel waren weit fort. Die eine Frau saß da und weinte. Der Jäger kam heraus aus seinem Versteck. Er sagte zu der Frau: "Komm mit mir, ich will dich in ein Haus bringen und dir ein Kleid geben!" Die Frau kam mit dem Jäger. Der Jäger heiratete die Frau. Der Jäger hatte einen Knaben von ihr. Der Knabe wurde größer. Eines Tages sagte der Jäger zu seinem Sohne: "Weißt du, wie ich deine Mutter gewonnen habe ?" Der Junge sagte: "Nein, ich weiß es nicht." Der Jäger sagte: "Ich war einmal am Wasser, da kamen Büffel. Sie legten am Wasser ihre Büffelkleider ab und
waren Menschen. Ich nahm einer der Frauen die Büffelhaut fort. Sie konnte nicht mit den andern wegrennen, denn sie hatte keine Haut. Dann nahm ich die Frau mit nach Hause. Ich habe sie geheiratet. Das ist nun deine Mutter. Die Büffelhaut habe ich aufgehoben." Der Junge fragte: "Wo hast du die Büffelhaut versteckt?" Der Jäger zeigte es seinem Sohne und sagte: "Hier habe ich sie versteckt." Der Junge sagte: "Behalte sie nur gut versteckt." Der Vater sagte: "Das werde ich tun." Der Jäger ging zur Jagd. Der Sohn ging zu seiner Mutter und sagte: "Mein Vater sagte mir, er habe einst an einem Wasser viele Büffel gesehen. Die legten ihre Büffeikleider ab und waren Menschen. Mein Vater nahm einer der Frauen die Büffelhaut fort. Sie konnte nicht mit den andern wegrennen; denn sie hatte keine Haut. Damals nahm mein Vater die Frau mit nach Hause. Mein Vater hat sie geheiratet. Das bist du, meine Mutter. Die Büffelhaut hat mein Vater aufgehoben." Die Mutter sagte: "Ich danke dir! Wo hat dein Vater meine Büffelhaut versteckt ?" Der Sohn sagte: "Komm mit, ich will es dir zeigen." Der Sohn zeigte der Frau, wo der Vater die Büffelhaut versteckt hatte. Die Frau nahm die Büffelhaut heraus. Sie zog die Büffelhaut an. Sie war nun ein Büffel. Sie nahm ihren Sohn und lief mit ihm in den Busch. —Leider haben wir von den andern Familien keine entsprechenden totemistischen Sagen. Aber es ist wohl kein Zufall, daß wir hier, zumal noch in der Nachbarschaft der Büffelmaskentänzer (Jukum und Tschamba) gerade diese Büffelfamilienlegende erhalten finden; wenn die Dakka auch selbst, wenigstens auf dieser deutschen Seite des Tschebschigebirges, keine Maskensitten üben. Wichtig ist es fernerhin, daß die Ahnfrau das Büffeiwesen ist und nicht der Ahnherr. Auf die ursprünglich weibliche Natur der Maske wurde ich schon oft aufmerksam, besonders jedesmal dann, wenn die verschiedenen Stämme mir erzählten, daß die Masken ursprünglich in den Händen der Frauen und nicht in den Händen der Männer gewesen waren. Die Legenden und Sitten der drei Nachbarvölker Dakka, Tschamba und Jukum erklären in ihrer entwicklungsgeschichtlichen Beziehung und Stufenbildung sowie in ihrer produktiven und modifizierenden Wirkung auf das Ritual, zumal Maskenritual, eine große Anzahl von Erscheinungen des westlichen Sudan und Afrikas überhaupt. —
Soweit die totemistische Exogamie. Im übrigen gibt es noch die kastengemäße Sitte des Ausschlusses der Schmiede aus dem Vierfamilienverbande, und diese wesentliche Tatsache gibt uns Veranlassung dazu, den Schmieden überhaupt einmal unser Augenmerk zu widmen. — Also kein anderer Dakka heiratet eine Schmiedemaid oder gibt seine Tochter einem Schmiede zur Frau. Und die Schmiede selbst verschmähen solche Verbindung auch; und außerdem ist jeder
Schmied ein Omnivore, ist keinem totemistischen Gesetz unterworfen. Dabei sind die Schmiede hoch angesehen. Ihr Oberhaupt bildet mit dem Könige und dem Priester zusammen eine gewisse Regierungseinheit. Diese Leute werden reich beschenkt, und ein Dakka sagte, wenn ein König eine schöne Sache erhalte, beeile er sich, noch eine zweite, gleiche zu erwerben, um sie dem Schmiede zu schenken. So hoch achtet und ehrt man diese abgesonderte Kaste.Aber nicht nur das. Wir haben gesehen, daß der Schmied mit dem Priester zusammen den König begräbt — daß der Schmied dem toten Priester die zukünftigen Heiligtümer ins Grab gibt —ja, daß der König einem jährlichen Gottesgericht unterworfen ist, dem der Schmied präsidiert. Also hier wie anderweitig steht der Schmied dem Kultus und Religionswesen in leitender Stellung nahe, und solche Beachtung dieser Kaste findet ihren bedeutsamen Ausdruck in folgender Kulturlegende, die die Dakka fast gleichlautend mit den Tschamba gemeinsam haben:
In alter Zeit waren es drei Sachen, die die Menschen nicht kannten. Einmal konnten sie nicht kochen. Wenn sie essen wollten, stellten sie ausgehöhlte Steine (wahrscheinlich sind Mahlsteine gemeint) in die Sonne, füllten sie mit Wasser, warteten, bis die Sonne das Wasser erhitzt hatte, und rührten dann darin ihr Mehl an. Das so bereitete Gericht aßen sie dann. Zum zweiten hatten sie wohl Häuser. Sie verstanden es aber nicht, darin eine Türöffnung zu machen, und so konnten sie nicht hineingehen und waren gezwungen, unter dem Dachvorsprunge zu schlafen. Drittens endlich verstanden sie es gar nicht, mit den Weibern richtig umzugehen, sie sachlich zu beschlafen und von ihnen dann Kinder gebären zu lassen. Sie hielten die in der Menstruationszeit blutende Vagina für eine ungesunde Einrichtung, für eine kranke Stelle, und koitierten deshalb ihre Frauen unter der Achselhöhle. Trotzdem wurden die Frauen von Zeit zu Zeit schwanger und dann schnitten die Leute den Weibern von oben bis unten den Leib auf, um dem jungen Wesen den Austritt zu verschaffen. Dabei starben aber dann jedesmal die Mutter und das Kind. Das also waren die drei Dinge, die die Leute in jener alten, alten Zeit nicht verstanden. — Damals kam aber ein Schmied. Der wanderte von Dorf zu Dorf und belehrte die Menschen in allem, was sie noch nicht verstanden. Er zeigte ihnen erst, wie sie die Frauen richtig beschlafen könnten, daß sie sich nämlich auf die Erde legen, zwischen ihren Beinen niederhocken, ihre Beine hochziehen und um die Lenden schlingen und dann in die Vagina hinein begatten sollten. Der Schmied zeigte es und dann machten die Menschen es auch so. Darauf wurden die Frauen schwanger. Die Männer wollten nun den Frauen den Leib aufschneiden, um die Frucht herauszunehmen. Der Schmied sagte jedoch: "Tut das nicht! Setzt jede schwangere Frau
auf einen Stein. Eine alte Frau soll hinter ihr niedersitzen, sie umschlingen und ihr den Leib drücken, eine andere alte Frau soll vor ihr niedersitzen und soll das zwischen den gespreizten Beinen der Frau heraustretende Kind aufnehmen! Das Kind wird dann von selbst kommen." Die Männer machten es so mit ihren Frauen und die starben nun nicht mehr, sondern gebaren lebende Kinder. — Dann zeigte der Schmied den Leuten das Kopira (d. i. das Eisensteinfeuerzeug) und wie man Feuer mache. Er zeigte ihnen die Töpferei und wie sie mit dem Feuer in den Töpfen ihr Essen bereiten könnten. — Endlich zeigte der Schmied den Menschen, wie sie in ihren Häusern schlafen könnten, indem sie Türen hineinmachten, so daß sie nicht mehr nötig hätten, unter dem Dachvorsprunge zu schlafen. —Dieses ist die Kulturlegende der Dakka. Man ersieht aus ihr, welche eminente Bedeutung man den Schmieden seit alter Zeit beimaß. Es sei erwähnt, daß auch die Kirn mir mancherlei über die ursprüngliche Bedeutung der Schmiede erzählen konnten, die Kulturlegende aber nur in folgender kurzen Fassung kannten:
Anfangs hatten die Männer die Frauen nur unter der Achselhöhle beschlafen, weil ihnen die Vagina krank vorkam. Dann aber kam ein Schmied (= Pie) und sagte: "Das ist falsch! So beschläft man nicht die Frauen. Ich werde euch aber zeigen, wie es richtiger ist." Dann rief der Schmied eine Frau. Er legte sie hin und beschlief sie. Erstand auf und sagte: "Habt ihr gesehen, wie manes macht? Könnt ihr es nun auch ?" Die Männer sagten: "Wir haben es gesehen. Wir können es nun auch." Die Männer gingen hin und jeder beschlief seine Frau. Darauf wurden die Frauen schwanger. Die Männer sagten: "Wir wollen ihnen nun den Leib aufschneiden und die Kinder herausnehmen." Der Schmied sagte aber: "Tut das nicht! Ihr tötet nur die Frauen und Kinder. Ich will es den alten Frauen zeigen, wie sie einer jungen Frau bei der Geburt helfen sollen." Darauf zeigte das der Schmied. —
Auch für die Dakka liegt die wesentliche Bedeutung der Verehelichung in dem Familienzuwachs, der allein Ausblick auf ein angenehmes Alter bietet. Denn alles Streben und Arbeiten erachten diese Völker ja nur als Vorspiel zur großen Periode ihres Lebens: d. 1. die, in der ihre Kinder für sie alle Arbeit verrichten und sie selbst sich auf Anleitung und Verteilung beschränken und im übrigen ein behagliches Leben fristen können.
Zwei bis drei Monate nach der Eheschließung erwartet man, daß die junge Frau die Schwangerschaft verspüre. Und einen Zeitraum von neun Monaten schreibt man überhaupt der Entwicklung der Frucht zu. Die Geburt soll gewöhnlich im Hause verlaufen, und zwar in jener Stellung, die die Kulturlegende der Schmiedebelehrung zuweist.
Der Nabel (Ubani oder Uwani) wird mit dem Splitter eines Sorghumhalmes abgeschnitten und Njessa, die Nachgeburt, außerhalb des Hofes begraben. Die Mutter muß nach der Geburt mehrere Tage das Haus hüten, und zwar, wenn sie ein Mädchen gebar, vier, wenn einen Knaben, drei Tage. Man nimmt auch hier an, daß die zwischen ein gespaltenes Rohrstück geklemmte und dadurch unterbundene Nabelschnur bei männlichen Kindern in drei, bei weiblichen in vier Tagen abfalle. Am Nachmittage des Tages, an dem das morgens geschah, darf die Mutter das erstemal ausgehen. Die Dakkamütter tragen ihre kleinen Kinder angeblich meist auf der linken Schulter, und nur wenn sie ermüdet sind auf der Lende. Sie nehmen sie nie mit aus dem Gehöft, weder mit zum Wasser, noch etwa in die Farm. Daher ist das Tragleder der Komai ihnen unbekannt. —Übrigens werden sonst alle Lasten, sowohl Körbe als Töpfe, von Männern wie Frauen auf dem Kopfe getragen. Das Schultertragen der Töpfe, wie es in der oberen Benue- und in der Faroebene üblich ist, ist ihnen unbekannt. —bei Kirn: midji —Babys, njisinji mibonani — unbeschnittene Burschen, bamburen mijerreni — beschnittene Burschen, netschakpall gaptschi — verheiratete Männer, njesuka neba-wori — leitende Familienväter, nejatu da-kalomi - verbrauchte Alte, Greise, namhori |
Die Stellung der einzelnen Typen untereinander ist eine naturgemäß vorgeschriebene. Die mijerreni und gaptschi sind die wertvollsten Arbeiter der Familie und Gemeinde in Farmarbeit, sind auch die gegebenen Krieger und in jeder Hinsicht von den neba-wori abhängig, welche vom Bierhause und von dem Dorf platze aus alles leiten und anordnen. Endlich die da-calomi, die Greise, werden noch durchgefüttert, stellen aber im großen und ganzen einen nicht gerade sehr gern gesehenen, nur konsumierenden und nicht produzierenden Teil der Bürgerschaft dar. Und doch rühmen auch die Dakka, daß ihre Alten so außerordentlich alt würden - sie bestätigten also seufzend das, was Herodot erstaunt über die Äthiopen berichtet und was mir selbst bei vielen Stämmen auffiel. —
Wenn ein Mensch erkrankt, gibt man ihm Medikamente. Aber die Massage mit heißgemachten Blättern wollen die Dakka nicht kennen. Um über den Zustand des Kranken in Klarheit zu kommen, wendet man sich an einen Newonani, d. i. ein Wahrsager. Der Wahrsager
der Dakka hat als Orakelinstrument ein Schneckenhaus =Tiktra (in Fulfulbe=honjoltu; in Kanuri Katantaua), das ist mit der durchbohrten Spitze an einen Faden gebunden. Der Newonani läßt das Fadenende, an den das Schneckenhaus gebunden ist, aus der Hand gleiten und so das Gehäuse zur Erde fallen. Wenn das Schneckenhaus bis zum Boden fällt, dann stirbt der Kranke, dessentwegen er konsultiert ist. Bleibt es aber in der Luft stehen, dann kann jener gerettet werden. Mit diesem Schneckenhaus kann der Newonani durch Fallenlassen alles feststellen, wie man den Kranken legen, welche Blätter, Wurzeln oder Rinden man ihm als Medizin geben soll usw. Also verfährt man, wenn man glaubt, daß der Kranke einer natürlichen Krankheit anheimgefallen sei.Bricht sich aber bei der Familie des Kranken die Überzeugung Bahn, daß der Kranke einem Noreni, einem Zauberer anheimgefallen sei, so bringt sie die entsprechende Klage sogleich beim Könige vor. Der läßt dann seinerseits den Newonani kommen und gibt ihm den Auftrag, mit seinem Tiktra festzustellen, wer dieser böse Noreni sei. Der Newonani läßt also nun beim Könige sein Schneckenhäuschen fallen und spricht bei jedem Fallenlassen den Namen eines Dorfgenossen aus. Wenn das Tiktra zu Boden fällt, so ist der, dessen Name ausgesprochen wurde, unschuldig. Wenn es aber in der Luft stehenbleibt, so ist damit unbedingt der Name dessen gefunden, der die Verhexung des armen Kranken ausgeführt hat. —
Von den None sagen sie, daß es Menschen seien, die ihr schlechtes Werk nachts ausführen. Sie verlassen dann ihr Haus und fliegen als Eulen (=Djisso) umher. Sie pflegen sich schreiend auf das Haus eines Menschen zu setzen, der dann nachher sterben wird. Das Wie und Warum konnten meine Leute nicht sagen, wohl aber, daß sie das Herz ihres Opfers zu essen pflegten, und darin liegt schon der Beweis, daß die Quelle der Legende dem Subachentum entstammt.
Die Dega sind echte Deeren; es gibt aber eine seltene und sehr hübsche Erzählung von ihnen: In alter Zeit hatten nämlich die Dega Hörner wie Antilopen. Daher wußte jeder Mensch, der sie sah, sogleich: "Das ist ein Dega!" Darauf kamen einmal alle Dega zusammen und sagten zueinander: "Wir wollen diese Hörner uns abnehmen lassen." Die Dega gingen also alle zusammen zu einem Schmiede
und sagten: "Mache uns die Hörner ab, damit man uns nicht immer gleich erkennen kann. Wir wollen dir zahlen, was du willst." Die Dega baten sehr. Der Schmied tat es. Er nahm ihnen allen die Hörner ab. Seitdem haben die Dega keine Hörner mehr und man kann sie nicht so leicht erkennen.Die Dega der Kirn verrichten ihr Werk ein klein wenig anders als die Deeren anderer Stämme. Der Dega pflegt seinem Opfer tagsüber in den Busch zu folgen. Er geht in der Gestalt, in der er ist, als Mensch. Im Busch überfällt er aber sein Opfer und nimmt ihm den Körperteil weg, der zur Bezauberung nötig ist, das ist hier das Herz. Er schneidet dem Überfallenen die Brust auf, nimmt das Herz heraus und näht sie wieder zu. Danach fragt er den Beraubten noch: "Kennst du mich?" Der Beraubte sagt dann: "Nein, ich kenne dich nicht." Der Dega geht mit dem geraubten Herzen heim. Er legt es in seinen Topf mit Medizin (Genjegu genannt) und deckt es mit einem Steine zu. — Der Beraubte kommt auch nach Hause. Er ist krank, er weiß von dem, was vorgefallen ist, gar nichts und stirbt meist. Man kann aber den Tod vermeiden, wenn man vorsichtig ist.
Wenn nämlich ein Familienmitglied bei den Kirn schwer unter Aufsehen erregenden Umständen und Symptomen erkrankt ist, soll man zu einem Davinse, d. i. ein Orakelmann, ein Wahrsager, senden. Der hat ein Djabusi, das ist eine Art Würfelorakel. Es besteht aus über hundert kleinen geflochtenen Strohzöpfchen, die der Davinse vor sich auf den Boden schüttet. Aus ihrer Lage und Konstellation erkennt er den Sachverhalt und gewinnt von dem Tatbestande ein Bild. Wenn also ein Verwandter eines derartig durch Deerenberaubung Erkrankten beizeiten zu diesem Wahrsager geht, so kann der seine Strohwürfel ausschütten und den Dega erkennen. Der wird verhaftet und gezwungen, ein Geständnis abzulegen. Er muß dann den Stein von seinem Zaubertopfe nehmen und vor allem dem Kranken das Herz zurückgeben. Das tut er in der Weise, daß er von der Medizinflüssigkeit und Wasser in den Mund nimmt und dem Kranken auf die Brust speit. Dann wird der gesund! — Wenn man aber erst nach dem Tode des Erkrankten den Davinse aufsucht, so nutzt das nichts, da der Wahrsager dann nur feststellen kann, daß ein Dega die Hand im Spiele hat, nicht aber dessen Persönlichkeit. —
Die Hexenmeister stellen die Dakka sich nun in der Weise vor, daß sie annehmen, der Noreni habe den Tina, d. h. den Schatten (in Fulfulde = Dendi; in Kanuri = Kaime) des darob Erkrankten gefangen und habe ihn in eine leichte Erdhöhlung gelegt, wo er ihn mit einem Steine belastet und so festgelegt habe. Wenn —und das soll noch vor einigen Jahren so gewesen sein — früher ein solcher Noreni entdeckt wurde, so ließ der König ihn mitsamt seiner ganzen Familie vernichten. Die Männer wurden dann von den Schmieden
mit Keulen totgeschlagen, Weiber und Kinder weit fort verkauft. Der Sünder selber aber wurde vor seinem Ende durch entsprechende Behandlung dazu gezwungen, den Schatten des Kranken freizugeben. Wenn er sich dazu bereit erklärt hatte, führte man ihn zu einem von dem Noreni selbst angegebenen Orte. Dort forderte der Zauberer die den Strick haltenden Schergen auf, sich abzuwenden, und wenn sie dieser Aufforderung nachgekommen waren, nahm der Noreni schnell den Stein weg. Der gestohlene Schatten wurde dadurch frei, konnte weg und zu seinem Herrn eilen, und der ward darauf gesund. Der Noreni aber ward vernichtet.Die Subachen fehlen auch hier. Der Kameni hat mit alledem nichts zu tun.
Wenn ein Kranker stirbt, so wird wie allenthalben in diesen Ländern für einen Jungen ein Klagen angestimmt, das weit über das Land hin ertönt. Für einen Alten war man ja auch ein wenig traurig — aber die allgemeine Fröhlichkeit betäubte doch schnell vereinzelte Schmerzgefühle und es hob ein allgemeines Biertrinken und Jubeln an, das in folgenden bezeichnenden Worten die Meinung wiedergab: "Laßt ihn gehen! Laßt ihn gehen! Er wird wiederkommen!" Wie wunderbar klar äußert sich hierin der unbeirrte Seelenwanderungsglaube!
Die Leiche wird erst gewaschen, dann von oben bis unten mit roter Erdfarbe (= Kurri) eingerieben und hierauf mit breitem Baumwollband in zusammengedrückter Stellung eingewickelt und verballt. Zunächst kommt sie dann in ein Verwesungsgrab. Jede Familie hat ein solches. Es ist angelegt wie die Gräber der Könige und besteht aus einem Schacht mit einem Seitenkanal. In diesen Seitenkanal wird jede neue Leiche niedergelegt, und zwar in gleicher Richtung wie die Königsleiche, also mit dem Antlitz nach Süden. Ist diese Leiche zerfallen und eine neue einzulagern, so nimmt man die Knochenteile der älteren heraus. Man hebt aber nicht wie bei den Splitterstämmen der Mittellinie (Faili, Nandji, Bokko) die Schädel in einem Mausoleum auf, sondern man verscharrt sie an einer beliebigen Stelle des Kirchhofes, ohne ihnen weitere Bedeutung beizulegen. Ein eigenes Grab erhält nur jeder König. Im allgemeinen wird den Toten nichts mit ins Jenseits gegeben. Nur Schmiede erhalten Axt, Speer und Messer als Grabbeigabe. Irgendein Opfer findet auch nicht statt. Wenn ein König oder ein Kameni stirbt, ertönen abends die heiligen Djubi. Für andere Sterbliche erklingen sie aber nicht.
Nun das Totenfest. Im Gegensatz zu den meisten andern Stämmen feiern die Dakka das Totenfest nicht im Herbste, am Ende der Erntezeit, sondern zu Beginn der Regenzeit. Wenn die erste Saat in die Erde gebracht ist, veranstaltet man dieses sogenannte Urumsimi für
jeden Toten, der in den Gräbern liegt, alljährlich, für Männer aber erst drei Jahre, für Frauen vier Jahre, nachdem sie bestattet sind. Also ausdrücklich: man wartet nach dem Tode eines Mannes drei, nach dem einer Frau vier Jahre, ehe man beginnt, ihnen zu opfern. Das Opfer selbst geht in folgender Weise von statten: Jeder Grabschacht ist mit einem flachen Steine geschlossen, über jeden Stein ein großer Topf gestülpt. Der Hausherr naht nun an der Spitze der Familienglieder mit einem weißen Hahne dem Grabe. Die andern halten den Hahn ganz stramm und fest, so daß er sich nicht rühren und bewegen kann. Denn wenn er irgendwie zucken kann, wird im kommenden Jahre ein Familienmitglied sterben. Der Hausherr selbst durchsticht mit einem Messer den Hals des Hahnes. Er durchsticht ihn, er durchschneidet ihn nicht. Das Blut tropft auf den Grabtopf. Man hält den Hahn, bis er ausgeblutet hat und verendet ist. Danach gießt man noch rund um den Topf eine Schale Bier aus und betet dabei: "Großvater, mach nichts Schlechtes in der Farm. Mach nichts Schlechtes in der Familie! Gib, daß wir Kinder bekommen! Gib, daß wir reiche Ernte haben! Mach, daß kein Streit entsteht." Nach diesem Opfer zieht die Familie heim und genießt das Opfermahl. Hernach pflanzt man das Korn. Wie gesagt, die Dakka feiern nur dieses Opferfest alljährlich für die Ahnen und keines in der Erntezeit. Aber bei mancher andern Gelegenheit äußert sich der manistische Glaube.Zum Beispiel: wenn ein Mädchen heiratet und längere Zeit mehr erhofft, als die Natur ihr gewährt. Der Vater einer solchen jungen Frau pflegt dann mit diesem, seinem Kinde, einem weißen Huhn, Bier und etwas Sorghummehl zum Kirchhof seiner Familie zu gehen und an das Grab des Verstorbenen zu treten. Dort bringt er die Opfer dar und betet: "Mein Großvater, gib, daß diese Frau bald schwanger wird. Tue ihr Gutes. Tue nur Gutes!" Danach geht er mit seiner Tochter heim. Man glaubt bestimmt an Erfolg.
Wenn ein Kind geboren wird, gibt der Vater des Ehemanns, also der Großvater ihm den Namen, und zwar wenn es ein Knabe ist, sieben, wenn es ein Mädchen ist, zehn Tage nach der Geburt. Den Namen erhält er aber nach einem verstorbenen Mitgliede seiner Familie, nach einem, das er in diesem Kinde bestimmt wiederzuerkennen glaubt. Dabei achtet man auf allerhand Ähnlichkeiten. Wenn ein Urahn z. B. eine Pfeilschußnarbe am Arme hatte, muß seine Wiedergeburtsform an gleicher Stelle auch irgend ein Mal oder Zeichen haben. Wenn er irgendeinen Finger oder Zehen zuviel oder zuwenig hatte, so muß das auch wieder zutage treten.
Der Manismus äußert sich auch, wenn ein Suondchimi stattfindet, das ist ein Trinkgelage, bei dem auch Frauen und Kinder gegenwärtig sind. Wenn es abgehalten wird, erklingen die Lära, hier auch
Lärs genannt, aber ohne Schalitrichter von Kalebasse oder Horn. Wenn der Kameni bei einem solchen Feste anwesend ist, so muß der im Beginn der Trinkerei eine Kalebasse Bier schöpfen und sie auf die Erde entleeren. Er muß dann beten: "Wenn der Kameni ein rechter Kameni ist und kein Betrüger, so bitte ich, daß alle Farmen und alle Kinder gut gedeihen mögen. Ich bitte euch, meine Großväter in der Erde, dieses zu verschaffen." Ist der Kameni nicht im Kreise, dagegen der Gangi, so hat dieser das Opfer darzubringen und ein Gebet an die Großväter zu sprechen. Danach beginnt dann der allgemeine Umtrunk. —Sonne und Mond machten einmal Streit miteinander. Die Sonne sagte zum Monde: "Ich bin stärker als du durch meine Hitze. Jedermann stirbt unter meiner Macht. Sende deinen Sohn, er wird es sehen." Der Mond sagte: "Es ist mir recht!" Der Mond brachte seinen Sohn zur Sonne. Der Sohn stand vom Morgen bis zum Abend in der Sonne. Es war sehr heiß. Dem Sohn des Mondes ward heiß. Der Mond goß aber Wasser auf seinen Sohn. Da wurde der Sohn wieder kalt. Der Mond goß immer wieder Wasser über den Sohn, so daß er immer wieder kalt wurde. Abends lebte der Sohn des Mondes. Der
Mond sagte: "Nun sende du mir deinen Sohn." Die Sonne sagte: "Es ist recht." Die Sonne sandte ihren Sohn. Der Mond stellte den Sohn der Sonne unter die Wolken. Er schien ganz klar und kalt herab. Es war sehr kalt. Die Sonne sandte Leute, die für ihren Sohn Feuer machen sollten, aber der Mond goß Wasser darüber, daß das Feuer immer wieder erlosch. Der Mond tötete alle Leute der Sonne durch seine Kälte. Auch der Sohn der Sonne starb. Der Mond sagte zur Sonne: "Habe ich dir nicht gesagt, daß ich stärker bin als du?" — Daher ist der Mond stärker als die Sonne. Der Mond ist sehr schlecht. —Ein Jäger fand einmal im Busch einen ganz schmalen, aber sehr gut ausgetretenen Weg. Der Jäger sagte: "Hier muß eine gute Antilope ihren Weg gehen. Hier will ich meine Falle aufstellen." Der Jäger stellte seine Falle auf. Am Abend fing sich in der Falle ein über und über weißer Schafbock (Tomtschi burgi). Nachts schliefen alle Menschen. Niemand wachte auf. Alles schlief und schlief. Die Leute wachten auf. Es war ganz dunkel draußen. Der Gangi ließ einen Newonani kommen und sagte: "Sieh nach, weshalb es nicht wieder Tag wird." Der Newonani warf seine Schneckenschale. Der Newonani sagte: "Es muß ein Tier im Busche gefangen sein." Alle Leute suchten. Der Jäger ging und fand, daß in seiner Falle ein weißer Schafbock gefangen war. Der Jäger band darauf den weißen Schafbock los. Darauf ließ der Gangi durch den Kameni ein großes Opfer darbringen und durch alle einen großen Gruß (mit Händeklatschen) ausführen. Alle dankten der Sonne (Suu) und Gott (Urumi). —
Diese Kirn wissen noch einiges von alten Fabeln zu erzählen und berichteten mir darüber folgendes:
In alter, alter Zeit gab es ein Volk, das hieß Talum. Das waren ganz kleine Menschen. Die kämpften mit Speeren und Messern. Sie hatten große, dicke Hoden, wie heute nur noch ganz kranke Menschen. Sie gingen immer zu zweien umher; es war immer ein Paar, ein Mann und eine Frau. Aber solcher Paare waren sehr viele. Sie gingen überall im Lande umher. Man konnte aber kein Essen machen, ohne daß die Talum kamen. Wenn man das Wasser im Topfe auf das Feuer setzte und kein Talum in der Nähe war, dann sagte das Wasser: "Ich koche nicht, ich koche nicht, denn es ist kein Talum da. Ich koche nicht, ich koche nicht, denn es ist kein Talum da." Wenn dann aber ein Talumpaar in die Nähe kam, begann das Wasser zu kochen und sagte: "Die Talum kommen. Die Talum kommen! Tu Mehl hinein. Ich koche! Die Talum kommen! Die Talum kommen! Tu Mehl hinein! Ich koche!" Dann warf die Frau schnell das Mehl in das kochende Wasser und bereitete die Speise. — Wenn das Essen aber so bereitet war, dann kamen die Talum ganz dicht heran und sie schüttelten die Speise selbst aus dem Kochtopf in die Kalebassen, verteilten sie und sagten: "Frau, nun rufe deinen Mann. Nun wollen wir sehen, wem das zukommt." Es blieb den Kirrifrauen alsdann nichts weiter übrig, als ihre Gatten zu rufen, und die mußten mit den Talum kämpfen. Die Talum und die Kirri kämpften aber solange miteinander, bis einer von beiden unterlag. War der Kirn zu Boden geworfen, rief der Talum seiner Frau zu: "Stich ihn tot." Und dann nahm die Talumfrau den kurzen Talumspeer und tötete den Kirn. Wenn der Talummann aber unterlag, tötete die Talumfrau ihn auch, denn die Talumfrauen waren sehr, sehr schlimm. Wer aber gesiegt hatte, der konnte die Speisen, die die Kirrifrau vorher
gekocht hatte, essen. Niemand konnte aber sein Essen ohne einen solchen Kampf mit den Talum gewinnen. — Die Kirn sagten: "Wir müssen einen Platz suchen, wo die Talum uns das Essen nicht wegnehmen können. Wir wollen aus dem Dorfe in den Busch gehen!" Die Kirn gingen mit ihren Frauen aus dem Dorfe. Sie gingen dahin, wo rundherum Sidigras wuchs (das Gras heißt in Haussa =tofa, in Kanuri =Suduk, in Fulfulde =soo; es zeichnet sich, besonders wenn es noch niedrig ist, durch so dornigscharfe Keimspitzen aus, daß es allgemein gefürchtet ist). In der Mitte machten die Frauen Feuer und setzten das Wasser im Topfe darauf. Das Wasser im Topfe aber sagte: "Ich koche nicht, ich koche nicht, denn es ist kein Talum da! Ich koche nicht, ich koche nicht, denn es ist kein Talum da." Nach einiger Zeit kam aber ein Talumpaar in die Nähe. Da sagte das Wasser: "Die Talum kommen! Die Talum kommen! Tu Mehl hinein! Ich koche! Die Talum kommen! Die Talum kommen! Tu Mehl hinein. Ich koche." Die Kirrifrau warf also ihr Mehl in das kochende Wasser und bereitete die Speise. Als das Essen nun bereitet war, wollten die Talum ganz dicht herankommen, um es aus dem Kochtöpfe in die Eßkalebasse zu schütten. Sie traten aber auf das spitze Sidigras und zogen die Füße zurück. Sie versuchten es an einer andern Stelle. Es war aber überall dasselbe. Es kamen viele Talum und sahen, daß sie nicht mehr zu den Töpfen konnten. Als der große Talumfürst sah, daß da nichts mehr zu machen sei, flog er in die Luft. Und die andern Talum zerstreuten sich in alle Welt. Die Menschen konnten ungestört ihre Speise verzehren, und nachher, als die Talum erst fortgegangen waren, brauchten sie auch gar nicht mehr auf ihre Nähe zu warten; das Wasser kochte, wenn das Feuer stark genug war. Was sonst über diese Talum erzählt ward, ist teilweise wesentlich. Immer wieder hörte ich, daß stets zwei, Mann und Weib, zusammen umherzogen. Sie gelten vor allen Dingen als eine Art wandernder, zigeunerhafter Schmiede der Urzeit. Wenn man an eine Stelle im Busche kommt, wo Eisenschlacken aufgehäuft liegen, wenn irgendwo die Reste längst zerschlagener Hochöfen gefunden werden, dann sagt man, daß das eine Stelle sei, an der in alter, alter Zeit einmal die Talum ihr Werk betrieben. Sie sollen die ältesten Schmiede gewesen sein. Wenn man an solchen Stellen nicht die Blasebälge findet, so sagt man, das komme daher, daß sie zu tief unten gewesen wären. Aber etwas anderes schreibt man noch der Eigenart dieser Talum zu, nämlich jene ovalen Reibsteine in den Felsen, in denen seit undenklicher Zeit die Frauen ihr Korn mahlen. Von ihnen sagt man, sie seien überall da entstanden, wo ein Talum sich niedergesetzt habe, und zwar seien sie die Eindrücke ihrer ungeheuerlichen Hoden. —Diese Sache mit den Talum soll sich in uralten Zeiten abgespielt
haben. Später — und das ist auch schon sehr, sehr lange her — hatten die Kirn dann noch einmal ein Erlebnis mit einer Art Jajawa. Die Talum waren Menschen. Diese Pensuguri, mit denen sie nachher zu tun hatten, waren aber Jajawa, d. h. soviel wie Geister.Einmal fanden die Kirn im Busch einen Platz unter Bäumen, der war ganz ausgezeichnet geeignet für eine Farm, denn die hohen Bäume verbreiteten nach unten hin breite Schatten. Die Kirn machten da also eine Farm, und zwar eine Maisfarm. Einmal schlief ein Bursche, der da gearbeitet hatte, im Schatten der großen Bäume ein. Darauf kam ein Pensuguri. Die Pensuguri sind ein Volk, von dem jeder nur ein Bein hat. Es sind Jajawa. Der Pensuguri kam auf die Maisfarm unter die Bäume und sagte: "Das ist mein Platz. Das war immer mein Platz. Nun haben die Menschen hier eine Farm gemacht. Das will ich nicht." Der Pensuguri sah den Burschen. Er weckte den Burschen und sagte: "Mein Junge, ihr habt hier eine Farm gemacht. Der Platz ist aber mein Platz. Geh also nach Hause und sage deinem Vater, daß dies Pensuguriland ist und daß hier niemand eine Farm machen darf. Ich bin aber ein guter Mann. Daher will ich dir nichts tun. Ich möchte dich nur bitten, mir deinen Arm-. ring zu schenken." Der Bursche zog darauf den Armring herunter und gab ihn dem Pensuguri. Der Pensuguri sagte: "Ich danke für den Ring. Geh nun heim und sage deinem Vater, daß alle solche Plätze, über denen die Bäume einen weiten Schatten machen, dem Pensuguri gehören und daß man da keine Farmen machen darf." Der Bursche lief nach Hause und sagte zu seinem Vater: "Ich schlief auf der Farm. Da kam ein Pensuguri und sagte: ,Mein Junge, ihr habt hier eine Farm gemacht. Der Platz ist mein Platz. Geh also nach Hause und sage deinem Vater, daß das Pensuguriland ist und daß hier niemand eine Farm machen darf. Ich bin aber ein guter Mann. Daher will ich dir nichts tun. Ich möchte dich nur bitten, mir deinen Armring zu schenken.' Ich gab ihm meinen Armring und er sagte: ,Sage deinem Vater, daß alle solche Plätze, über denen die Bäume ihre weiten Schatten werfen, dem Pensuguri gehören und daß man da keine Farmen machen dürfe."Seitdem meiden die Kirn Plätze um Bäume, wenn sie eine Farm bauen wollen. —
Die Nagajare haben mir nicht solche Dinge erzählen können. Aber ich hörte, daß auch sie sich eines schmiedekundigen Volkes erinnern, daß sie Tirim oder Tinimbu nennen. Die Pensuguri als gute Geister wollen sie nicht kennen. Dagegen sagen sie, daß es im Busche Kona oder Konabu gebe, das sei ein ganz schlimmes Volk. Wenn man davon einen träfe, käme man sicher krank nach Hause. Diese hätten auch die Eigenschaft, daß sie sich vor den Augen des Wanderers plötzlich aus einer in zwanzig und mehr Personen verwandeln können.
Die Alkassomleute (Dakka der Berge) erzählen von den Schmieden: Auf dem Sagamberge an der Grenze des Dagalandes lebte der erste Pie (Schmied), den Gott (Urumkuksa) gemacht hatte. Von ihm lernten die Daga die Feuerbereitung. Die Schmiede sind auch hier ganz außerordentlich geachtet. Aber niemand will eine ihrer Töchter heiraten oder ihnen eine der eigenen zur Frau geben. Man zahlt auch hier in den Dagadörfern des Gebirges an die Schmiede Abgaben, und zwar zahlt jeder Farmer ein wenig Sorghum, jeder Jäger einen Anteil vom Fleische seiner Jagdbeute. — Über ihren Schmiedefeuern haben die Schmiede auch hier einen Hühnerkopf hängen. —
Diese Leute erzählen über die Jeskinna, die hier Urumkuksa (also "Gott") heißen: Wenn man in uralter Zeit das Sorghum zu Mehl rieb, so ward es über Nacht wieder zu Korn. Wenn man damals ein Tier geschlachtet hatte, dann ward das zerlegte Fleisch über Nacht wieder zum lebendigen Tiere. Jedes Ding, sei es Pflanze oder Tier, das man schon zum Essen bereitet hatte, ward über Nacht wieder zusammengefügt und lebendig. Darauf stellte ein Schmied die Urumkuksa (also die Jeskinna) her. Man schwang diese, und seitdem hat sich nichts wieder in seinen früheren Zustand zurückverwandelt, nachdem es einmal zerteilt war. Es blieb dann immer wie es war. — Man opfert den Urumkuksa Sorghumbier, und zwar im Busch. —
Daga über die Blitzschlange = Wuo, aus Eisen. Wenn man bestohlen ist, geht man zu dem Wuoeisen und betet: "Bitte, töte den Dieb." Dann kommt der Blitz herab und tötet den Dieb. — Es wird Hühnerblut jeder Art in der Erntezeit über den Wuoeisen geopfert. Man gibt ihnen aber nur das Blut. —
Daga über die Figurenpaare: heißen hier Mun. Es kamen einmal die Blattern (= komma; in Fulfulde = Katschindang; in Haussa =Massassawa) ins Land und töteten viele Menschen. Darauf stellte
man die Munfiguren her, die vertrieben diese Krankheit. Seitdem opfert man ihnen im Hause Schim oder Tschirn, d. i. Bier. —Daga über die Ta-djubi. Wenn ein Mensch erkrankt, wird auf den Ta-djubi geblasen und auch hineingesprochen: "Ich bitte dich, daß der Mann gesund werde." Solches Gebet wird viermal wiederholt. Es wird Wasser hineingegossen und dieses über den Mann ausgeleert. Dann wird er gesund.
Früher hatte ein Oberpriester bei den Daga alle diese Heiligtümer unter seiner Verwaltung. Der Mann wurde Karam Kungum genannt. Heute macht es alles Gjagse, der König selbst. —
Daga haben weder Schwirrholz noch Schwirreisen. —
Daga tragen am Gürtel ein Eisen (= Djennpisso) als Schutzamulett gegen Stich und Hieb. —
Daga haben folgende Opfer feste:
1. In der Pflanzungszeit erhalten alle Heiligtümer Bier, dazu eine Ziege oder zehn Hühner ohne Rücksicht auf Farbe und Geschlecht. Dies ist ein Opfer für die Heiligtümer insgesamt.
2. Wenn das Sorghum reift, wird Mais- und Sorghumbier gebraut und dieses auf einer Bergspitze geopfert.
3. Wenn die gesamte Ernte beendet ist, muß erst ein gutes Sorghumbier gebraut und dies über dem Urumkuksa (Jeskinna) geopfert werden, ehe irgend jemand vom neuen Korn genießen darf.
4. Als letztes Opfer gilt das alle vier oder fünf Jahre wiederholte Beschneidungsfest. —
Irgendwelche besonders zu beobachtenden Schaf- oder Ziegen.. opfer, bei welchen Geschlecht und Farbe wichtig sind, kennen die Daga nicht. —
Daga haben einen Orakelmann =bi-mwua, der seine Weissagungen aus dem Gegeneinanderreiben seiner beiden Handflächen und dem etwa eintretenden Hängenbleiben derselben liest. —
Daga haben Beschneider. Ein solcher pflegte gekleidet zu sein in ein Gewand aus breitem, bis fünf Hände breitem Stoffbande, das Usipassi genannt und das wohl mit einem dem Muntschityp ähnlichen Webstuhl hergestellt wurde. Da die uralten Nachbarn der Daga, die heute von den Jukum unterworfenen Wurbo diese Breitweberei am Griffwebstuhl seit uralten Zeiten kannten, so kann sehr wohl auch dem Südwestdakka dies Gerät bekannt gewesen sein. Jedenfalls hatten die Daga für ihre Weiber Umschlagetücher aus Breitstreifen, die dann Ja-usi genannt werden. Usi-passi —und demnach auch Ja-usi —sind nicht mehr gebräuchlich. Ich konnte nur noch die Erinnerung daran und nicht mehr die Namen der Produkte selbst auffinden. Heute wird nur noch auf Trittwebstuhl das übliche Schmalband von Handbreite, das Usi-tari, hergestellt. Der Beschneider trug früher also, wie gesagt, ein Ja-usi. —
Dagakönig (Gjagsa) durfte nicht essen: Elefant (=Kogna), Nilpferd (=Dung-barre) und vor allem nicht Leopard (=bie), trotzdem er auf einem Felle von letzterem Tiere zu sitzen pflegte. —
Daga haben folgenden Rest der alten Amazonentradition: Anfangs lebten die Männer und Weiber getrennt voneinander und keiner der beiden wollte sich dem andern nähern. Eine Frau nahm aber eines Tages viele Blätter. Sie breitete vor der Ansiedlung der Frauen bis zu der der Männer einen weichen Weg, auf dem sie dann nachts zu den Männern hinüberging. Sie ließ sich von einem derselben beschlafen und kam dann ebenso leise und vorsichtig wieder zurück. Eine Frau machte es der andern nach. Wenn eine Frau nachts einen Mann besuchen und sich beschlafen lassen wollte, bereitete sie einen weichen Weg aus Blättern, so daß niemand ihre Schritte hören konnte. — Eines Tages nun wollte auch ein Mann einmal den Versuch machen, in die Ansiedlung der Frauen zu gehen, um eine von ihnen zu beschlafen. Der Mann vergaß aber in seiner Hast eine Blätterunterlage auf den Weg zu breiten. Also machten seine Tritte viel Geräusch. Die Frauen hörten das. Die Frauen kamen heraus und fingen den Mann. —
5. Kapitel: Die Mundang*
Königtum, Königstod, Königsbegräbnis. —An allen äthiopischen Stämmen, d. h. rein äthiopischen Kulturen können wir die Beobachtung machen, daß sie, wenn sie auch eine sicherlich vertiefte materielle Kultur besitzen, doch entschieden sozial minder begabt, embryonal entwickelt oder doch mehr dem Verfall als der Zusammenfassung zu gerichtet sind. Wir wissen, daß die Zersplitterung das direkt Typische der äthiopischen Stämme ist. Wo wir aber eine weiter ausgedehnte Macht, eine politische Umfassung eines größeren Gebietes sehen, da ist es auch niemals schwer festzustellen, wie stark der Konflikt zwischen einer dynastischen Macht und einer zersetzenden prinzipiellen Uneinigkeit der "Völker", der Sippenverbände ist. Das beste Beispiel, das ich hierfür überhaupt kenne, bieten aber die Mundang, wie wir sogleich aus der Einführung in deren Sittenart erkennen werden.
Die Mundang feiern, wie alle ihre südlichen Nachbarn, vor allem mit voller Begeisterung das Fest der Beschneidung, das Djang(u)re. Dieses kann aber nur dann stattfinden, wenn ein Gong, ein König, gestorben ist. Nun muß aber ein jeder König, ob er der große mächtige von Leere oder der irgendeines kleinen Dorfes ist, im siebenten oder achten Jahre seiner Herrschaft sterben. Er muß sterben, ob die Natur oder er es wollen oder nicht. Wer den etwa Widerstrebenden
Wenn der König nämlich nicht acht Jahre nach seinem Regierungsantritt von selbst stirbt, so muß der Pulian den Schädel des verstorbenen Vaters des Königs, also seines Vorgängers, in eine weiße Kuhhaut gebunden an einem Stricke auf dem Boden da vorbeischleifen, wo der derzeitige "überfällige" König sich befindet, so daß der dies memento mori sieht. Wenn er das aber gesehen hat, dann wird er unbedingt in der folgenden Nacht sterben. Ist das geschehen, so fällt dem Pulian die zweite Aufgabe zu; er muß dem soeben verstorbenen Könige den Kopf abschneiden. Der frische Kopf wird dann seinerseits in eine weiße Kuhhaut genäht, so verhüllt in einen großen Topf gelegt und diese Urne sorgfältig auf den Berg hinausgetragen, in dem die Mausoleumshöhle der Königsköpfe sich befindet. Der übrige Körper wird aber in den Fluß geworfen. Niemand kümmert sich weiter um den königlichen Leichnam.
Und doch hat sich aus älterer Zeit wohl eine Erinnerung an eine andere Bestattungsform, an eine Parallelzeremonie erhalten, über deren Zusammenhang mit diesem rituellen Königsmorde ich augenblicklich nichts weiter zu sagen vermag. Nämlich außer der Schädelverwahrung und Körperverschleuderung erfolgt noch eine "Königsbestattung". Es besteht ein Grab für den verstorbenen oder getöteten König, aber er findet, wie wir sahen, nicht selbst darin Aufnahme. Vielmehr hat der Pulian noch zwei junge Sklaven, einen Knaben und ein Mädchen zu töten durch Kopfabschneiden. Diese beiden finden samt ihren Köpfen Aufnahme in der Königsgrube. Wenn es nun aber ein ganz kleiner König war, der so ins Jenseits wanderte, ein armer Wicht, in dessen Nachlaß es nicht solche Sklavenmädchen und -knaben gibt, so begnügt man sich damit, zwei Hölzer zurechtzuschnitzen, sie schwarz zu färben und statt der fleischlichen Opfer in die Grube zu stoßen. Die Graböffnung wird danach mit einem großen glockenähnlichen Deckel, der mit einem Handgriff versehen ist, geschlossen. Danach schlachtet man für den verstorbenen König viel Rindvieh, für mächtige, wie den von Laere, bis an die hundert Stück, und zwar Buckeirinder, da man die kleine alte Rinderrasse hier nicht mehr kennt — sich übrigens im Mundanglande ihrer auch nicht mehr erinnert. Es ist eine große Festzeit.
Nun ist es im Mundanglande aber genau umgekehrt wie in höher entwickelten Staatszuständen. Im Mundanglande herrscht zur Zeit des Königs ununterbrochen Fehde; bei seinem Tode zieht ein Landfriede ein. Denn diese Könige sind aller Beschreibung nach mehr Räuber als Könige. Sie führen mit aller Welt kleine Raubkriege — mit diesem Flecken, um seine Kühe zu erobern, mit jener Familie, um ein hübsches Mädchen zu stehlen. Sie rauben und plündern im
Inland und rauben und plündern im Ausland. Und wie die Könige es vormachen, so ahmen es sachlich und logisch alle starken Familien nach. Es sind Zustände wie im alten Florenz — nur daß der geniale Schöpfergeist fehlt, der den Stärksten und Überlegenen auch den Sinn für Neuschöpfungen verleiht. Jede starke Familie kämpft gegen die andere. Ja, ganz besonders einflußreiche scheuen sich nicht, gegen den eigenen König und sein Besitztum einen Streifzug zu unternehmen. Man gibt seinen Gelüsten eben nach, und wer die Beute hat, lacht über die andern. Es ist ein so echt äthiopischer Zustand, wie er nur im Kipirsigebiet oder bei den Tamberma oder im Lobigebiet herrscht, und eigentlich ist das einzig Merkwürdige bei der Sache, daß diese Sippen überhaupt einen König haben, hie und da sogar einen starken König, der nicht etwa Ordnung schafft, sondern der, ganz ähnlich dem Zustand im Mossilande, gleich allen andern, die in dieser Atmosphäre leben, dem Zwistigkeitsteufel anheimfällt und allen demnach in althergebrachter Weise mit räuberischern Beispiel vorangeht.Gleichzeitig wird am Tage des "Verscheidens" des vorigen Königs ein neuer Gong eingesetzt, das ist gemeiniglich sein ältester Sohn. Dann werden vier tüchtige Burschen ausgesandt, die müssen im Busch einen weiten Plan reinigen, auf dem das Zeremonial stattfinden soll. Und dann kommt alles dahinaus, was die Operation über sich ergehen lassen will oder muß. Da das Fest der Beschneidung (=djangure) nur alle sieben Jahre stattfindet, so haben sich natürlich die verschiedensten Jahrgänge aufgespeichert. Aber noch mehr. Einige haben sich aus Furcht vor dem heiligen Tosen der Schwirren frühere Gelegenheiten entgehen lassen und so kommt es, daß neben jungen Burschen Männer auftreten, die schon Kinder haben. Und dann gibt es auch Eltern, die in ihren Kindern die Furcht vor dem Rauschen der Ahnenstimmen gar nicht erst aufkommen lassen wollen oder die ganz richtig meinen, in jüngeren Jahren heile solche Wunde schneller —kurz, auch Kinder, die noch von der mütterlichen Brust leben, werden dahinausgebracht.
Der Bakane, der die Operation ausführt, ist höchst eigentümlich aufgeputzt. Der Mann ist über und über mit Sale, d. i. rote Erdfarbe, bemalt. Sein Kopf ist von einem Stück Leopardenfell bedeckt, unter dem das Gesicht mit grellem Rot bemalt heraussieht. In jeden Mundwinkel
hat er ein Beschneidungsmesser geklemmt; eins hat er noch in der Hand. So ausgerüstet steigt er in das Wasser, an dem die Beschneidungszeremonie vor sich geht. Man sagt, er tauche in dem Wasser ganz unter; aber das kann auch ein Irrtum sein. Jedenfalls befindet er sich im Wasser, während man ein Menschenkind nach dem andern, alt und jung, herbeibringt, daß er ihm das Präputium (=koake), abschneide.Die Operation wird anscheinend von diesem Mann in schneller Reihenfolge vorgenommen. Man führt einen Burschen nach dem andern an den Fluß, aus dem der Beschneider.seine Arme herausstreckt, um ein Häutlein nach dem andern vorzuziehen und schnell abzuschneiden. Die Koake werden alle in ein Loch geworfen, das an dieser Stelle am Ufer gegraben ist und das später zugeworfen wird. Die Operierten werden ihren Angehörigen übergeben, damit diese sie verbinden und weiter versorgen. Es ist verpönt, zu jammern oder zu schreien, und trotzdem dröhnen die gefürchteten Laute währenddessen durch die Luft.
Denn inzwischen schwingen die älteren Männer emsig die Schwirren, von denen man mehrere Arten unterscheidet. Da sind zunächst die Schwirreisen, die eigentlichen Mafalli, die mächtig surren sollen. Denen schließen sich gleichmäßig dröhnende Falliku, das sind Schwirrhölzer, an. Die Mundang haben besondere, vorn mit einer Kerbe versehene Exemplare, denen sie ganz besondere Klangfärbung zuschreiben. Diese Falliku surren die Stimmen der Mittellage. Dann gibt es endlich noch die Mafalli-serre, Schwirr-Rohre, die aus Sorghumstengel hergerichtet sind und die den entsprechenden Typen der Mossi, Tamberma und Jukum entsprechen. Hier sind sie aber nicht wie bei jenen Spielzeug; hier summen sie die höheren Klänge des Schwirrkonzertes. —Zur Vollständigkeit sei erwähnt, daß man mir auch noch von Mafalliku, aus Baumrinde, und von Mafalli-teffai, aus Kalebassen hergestellten Schwirren berichtete, die den eingeweihten Zöglingen später zur Übung dienen sollen. Es ist mir nicht gelungen, von diesen Varianten eine Vorstellung zu gewinnen, da sie dem Material an sich nach viel zu leicht sein müssen, um die Hervorbringung von Tönen zu ermöglichen. —
Jedenfalls vollführen während der Operation die eigentlichen ernsten Schwirren im Hintergrunde einen heillosen Lärm, der geeignet sein dürfte, einem jungen Menschen, der genügende Vorahnungen mitbringt, und der sich vor, im Augenblicke, oder hinter einer Operation befindet, das Herz schwer zu machen, so daß er gläubig mächtig düsterer Gewalten harrt, die ihn bedrängen könnten.
Aber es ereignet sich nichts Zauberhaftes oder irgendwie Überirdisches. Es geht vielmehr sehr irdisch und sogar recht kräftig irdisch zu. In dieser wunderbaren Zeit ist nämlich Prügelei für alle
Gebenden fakultativ, für alle Nehmenden obligatorisch, und nur der Herr König macht hiervon eine Ausnahme, d. h. er darf nur prügeln, ohne selbst verpflichtet zu sein wie die andern, alle derben Prügel, die ihm etwa verabreicht werden, geduldig mit gebücktem Rücken hinzunehmen. Dieses Spiel beginnt der König selber, und zwar nimmt er das übliche Instrument, eine burre-huasuome, eine Peitsche aus Flußpferdhaut. Wenn der König die vor einem Mann aufhebt, so ist der Bedrohte verpflichtet, sich artig vornüberzubeugen und so seinen Rücken den königlichen Gnadenstreichen freiwillig bequem zu stellen. Die Sitte will, daß er das so tut und alles folgende hinnimmt, ohne zu zucken oder zu schreien. Wenn er jammert oder wegläuft, wird er gründlich verspottet.Und wie der König es vormacht, so ahmen alle andern nach. Ein jeglicher muß dem guten Herkommen gemäß seinen Rücken hinhalten, wenn ein guter Freund seinen Knüttel an ihm versuchen will. Es bleibt ihm im Grunde nichts weiter übrig, als heute die Zähne zusammenzubeißen und darüber nachzudenken, wem er morgen diese fromme Gabe weitergeben kann. Diese amüsante Beschäftigung währt nicht weniger als zwei Monate, d. h. solange die Wunden der Burschen nicht geheilt sind, welcher Prozeß ungefähr diesen Zeitraum in Anspruch nimmt; und während dieser ganzen Zeit prügelt man sich allmorgendlich etwa vor Sonnenaufgang bis zur Sonnenhöhe. Und die beschnittenen Knaben prügeln einander genau ebenso, lernen das bei dieser Gelegenheit und gewinnen so vor allem die hochgeschätzte Kunst, Schmerzen zu ertragen, ohne etwas davon merken zu lassen —worauf das Ganze ja wohl hinauskommt.
Außer dem König selbst gibt es eine einzige Persönlichkeit, die diesem Verfahren nicht ausgesetzt ist, das ist des Königs Sohn, und zwar derjenige, der aller Wahrscheinlichkeit nach dereinst dem Vater nachfolgen wird. Dieser Jüngling wird nicht der allgemeinen Prügelei ausgesetzt, sondern daheim im Königsgehöft beschnitten.
Fernerhin muß bemerkt werden, daß es überhaupt recht viele Mundang zu geben scheint, die nicht beschnitten sind. Übereinstimmend wird angegeben, daß diese Unterlassung aus Furcht vor dem Dröhnen der Schwirren, nicht aber aus Furcht vor der Operation oder der Prügelei geschehe. Den meisten Europäern ist die Furcht der Leute vor den Schwirrhölzern und Schwirreisen einfach rätselhaft. Diese Angst besteht nicht nur bei den Weibern und Kindern, die nicht wissen, um welch ein Geräusch es sich handle, sondern in gewissem Sinne bei den Schwirrern selbst. Es ist, als ob die Furcht, die sie andern mit ihren harmlosen Luftkreiseln beibringen, in ihnen selbst ein Gefühl des Respektes vor der Macht der Instrumente, die in ihren Händen liegen, erweckt. Ich habe manchen alten Äthiopen Nordkameruns
in meinem Studio die Schwirren in seine Hände nehmen und sein Gesicht in ernste Falten gleiten sehen.Die Beschnittenen mögen nun also in ihrem Buschlager eine große Angst verspüren, wenn das unheimliche Rauschen allabendlich an ihr Ohr dringt. Zehn Tage läßt man sie über den Ursprung der Töne im Unklaren, dann aber werden sie aufgeklärt, und diese Aufklärung führt sie gewissermaßen in die Rechtsame eines Bürgers, eines stimmberechtigten Stammesgliedes hinüber.
Das Leben der Beschnittenen ist natürlich durch keinerlei Nahrungssorge bedrängt. Die Väter haben ihnen da draußen Häuserchen aus Sekko-( hiki-) Wänden gebaut, in denen sie schlafen, während die Väter oder älteren Brüder, die es auf sich genommen haben, das Leben im Beschneidungslager zu teilen, draußen unter Bäumen oder unter dem freien Himmel ihr Haupt zur Ruhe niederlegen. Die Ernährung der Gesellschaft erfolgt vom Dorfe oder von der Stadt, jedenfalls vom heimatlichen Gehöft aus. Die Mütter und Schwestern bereiten daheim das Essen und bringen es in die Nähe des Beschneidungslagers, dem sie aber um alles in der Welt nicht allzu nahekommen dürfen. Sie setzen die Ätzung zu festgesetzter Stunde an verabredeter Stelle im Busche nieder, und dann kommen die Väter oder älteren Brüder und holen es ab.
Nun sind aber auch ganz kleine Kinder unter den Beschnittenen, solche, die noch nichts anderes genießen, als was die Natur ihnen durch die Brust der Mutter bietet. Der Vater, der ein solches Kind mit in das Beschneidungslager zur frühzeitigen Operation bringt, muß sich der Mühe unterziehen, es alltäglich wohl eingewickelt hinab zum Gehöft der Mutter zu bringen, wo es dann seine Nahrung auf folgende gelungene Weise empfängt: Die Mutter darf das kleine Bübchen in dieser Zeit nicht sehen; sie muß sich also in einem Hause mit einer Sekkowand aufhalten, in der einige Maschen beiseite geschoben sind; der Vater kommt mit dem Kind von außen heran; die Mutter reicht durch den Sekkomattenspalt den Busen heraus und nun kann das Würmchen seinen Hunger stillen. Ist das zur Genüge geschehen, so wickelt der Vater den Säugling wieder ein und trägt ihn in das Beschneidungslager zurück, in dem ihm die ganze Wartung des Geschöpfchens, alles Waschen usw. zufällt. Und jeden Morgen trägt er das kleine Wesen wieder zu seiner Mutter hinab.
Nach zwei Monaten schlachtet der Vater dann Hühner, Hähne, Ziegen, einen Bock oder gar ein Stück Rindvieh. Die Beschnittenen werden alle gemeinsam vom Beschneidungslager herüber in den Ort geführt. Sie haben an diesem Tage den großen wichtigen Wechsel in der Tracht vorgenommen. Vordem hatten die Buben als "Kleidung" das Djelle, ein kleines Penisfutteral als Flechtwerk, das anscheinend
genau dem von den Moba getragenen gleicht. Und größere Burschen haben sich mit einem Sassae, einem Baumwolläppchen behelfen müssen. Nun aber erhalten sie das Hoke, ein tüchtiges Leder, das mit Kaurimuscheln besetzt ist. Alles Blätterwerk haben sie im Busche gelassen. In dieser "Gewandung" nun ziehen sie also erst vor das Haus des Königs. Der nimmt aus der Schar die Kinder seiner Familie heraus. Es wird da noch etwas getanzt, und dann macht jede Familie die Ansprüche an ihre Sprossen geltend. Jeder Vater greift sich seinen Sohn aus der jubelnden Rotte und führt ihn im Triumph heim zur Mutter. Da wird nun gründlich gefeiert. Daß die Mutter der reichlichen Fleischspende des Vaters eine nahrhafte Breimasse zugrunde gelegt hat, ist ganz sicher. Dann gibt es Bier, von dem die Mundang zwei Arten unterscheiden, nämlich Idere, eine dicke, warm zu trinkende, frisch bereitete Suppe, mehr an eine Brotsuppe als an Bier erinnernd, und Himi, ein stark gegorenes Bier. An diesem Tage trinkt man natürlich Himi. — Mit dieser Empfangsfestlichkeit ist die große Zeit im Leben der Burschen abgeschlossen und für das Volk die Periode des Landfriedens verstrichen. Plünderei und Raub werden wieder legitim — soweit die Macht reicht.1. wia-lan-poön, das sind Säuglinge.
2. wenje farn, kleine, zumeist noch nicht beschnittene Buben.
3. tibana, große, meist schon beschnittene Buben.
4. dobli, ältere Leute, die erwachsene Kinder haben und durch diese die Farmen bestellen lassen können.
5. maga-dschogge, ganz alte Männer, in dem Sinne gänzlicher Verbrauchtheit nicht nur der körperlichen, sondern auch der geistigen Kräfte.
Diese naturgemäße und bei diesen Äthiopen immer wiederkehrende Gliederung birgt innere Trennungsgesetze in sich. Es gibt wenige ganz scharf ausgesprochene äußerliche Einschränkungen. So dürfen Unbeschnittene unbedingt keine Eier essen; —eigentlich ist das nur ganz alten Leuten genehmigt; — Tibana und Dobli sollen ferner keine Alligatoren und Hühner genießen. Bei der Besprechung dieser Speiseverbote ward mir erzählt, daß eine Familie unter den Mundang sei, die Djallume, die auch Hunde verspeist, was im allgemeinen die Mundang als Ausnahme bezeichnen, unbedingt aber der Jugend sonst vorenthalten.
Die "Freundschaft"zwischen Bursche und Mädchen stellt sich ganz von selbst ein und hat sittengemäß abgerundete Formen. Irgendwo
beim Spiele oder Tanze werden sie aufeinander aufmerksam. Hat der Bursche sie beim Tanze mehrfach beobachtet und seine Schlüsse gezogen, so sendet er ihren Eltern entweder kpai, d. h. Eisenschaufeln, oder Ziege oder Schaf, und damit ist Absicht und Wunsch klar. Sind nämlich Vater und Mutter einverstanden, so senden sie Bier zurück. Das gilt als Zusage, und der Bursche sendet seinerseits wieder einige Schaufeln zum Zeichen der Dankbarkeit. Wenn dann abends wieder Tanz gewesen, trennt sich das junge Paar nicht mehr, sondern die Jungfrau begleitet den Jüngling in das väterliche Heim des Burschen, wo dieser ein behagliches Häuschen bereitgestellt hat.Das Mädchen schläft von dem Tage an bei ihrem Gesellen —Nacht für Nacht. Die Mundang schworen mir, das sei harmlos und bleibe harmlos; es sei ein Spiel, das auch nur Spiel bleibe. Sie müssen dabei wohl aber von dem "harmlosen Spiel" andere Begriffe gehabt haben als ich, denn als ich ihnen später die wichtige Frage nach der Stellung bei der Begattung vorlegte, da sagten sie mir: Verheiratete Leute pflegten den Beischlaf meist in der Seitenlage, manche auch in der Überlage (europäische Form) auszuüben. Einige blieben aber auch der Sitte der Gwebe treu. Ich fragte nun, welches denn die Sitte der Gwebe sei, und erhielt darauf die schöne Antwort: "Gwebe nennen sich der Freund und die Freundin gegenseitig. Wenn die Freundin mit zum Freunde geht, um bei ihm zu schlafen, so suchen die beiden gewöhnlich in der Hockstellung miteinander zu koitieren". In dieser Form würde denn auch die Ehe vollzogen.
Daraus ersieht man also, daß das Spiel dieser Gwebe in unserm Sinne kaum als harmlos bezeichnet werden kann, wenigstens im allgemeinen nicht, wenn auch aus nachfolgender Schilderung klar zu ersehen ist, daß hie und da auch bei Mundang auf die Keuschheit der Braut Gewicht gelegt wird. Jedenfalls dauert der Zustand der Gwebe etwa drei Jahre, und dann kann man wohl annehmen, daß die beiden sich auch heiraten werden. Viel Wechsel in Liebschaften kommt nicht vor, wenn auch der Ehevollzug durch Mittellosigkeit des Bräutigams weit hinausgezögert werden kann. So kann es gar leicht vorkommen, daß ein anderer ihm die Frau noch in letzter Stunde wegschnappt.
Der Bursche arbeitet im allgemeinen naturgemäß auf der Farm seines Vaters; aber zweimal im Jahre muß er dem Schwiegervater Knechtdienste leisten. Damit macht er sein Verhältnis zu diesem offenkundig. Will er aber endgültig heiraten, so hat er eine umfangreiche Zahlung zu leisten: ca. fünfzehn Ziegen, zwei Kühe und einen Ochsen. Danach bringt der Schwiegervater seine Tochter samt ihrer Ausstattung, die in Kalebassen (nhere), Töpfen (tschiri), einem Mörser (sangne), einer Mörserkeule (kussan) usw. besteht, in das Haus des Burschen, d. h. in das Gehöft des Vaters des jungen Ehemannes,
in dem er noch eine geraume Zeit weilt, bis er sich endlich eine eigene Behausung bauen kann.In der Hochzeitsnacht schenkt der Bursche dann der Braut noch eine Ziege, und auf diese Gabe hin gewährt sie ihm die Eherechte. Der Ehevollzug erfolgt seitens des Mannes in äthiopischer Hockstellung. Sind diese beiden noch nicht lange miteinander befreundet oder hat der Bursche vorher wohl überhaupt nicht mit ihr im Gwebeverhältnis gestanden, so erwartet er unbedingt reichlichen Bluterguß auf der Beischlafmatte als Beleg der bisherigen Keuschheit der Braut zu finden. Wird diese Erwartung erfüllt, so ist er sehr erfreut. Die junge Frau kann dann am andern Tage mit ihrer Ziege zu den Eltern gehen, gibt dadurch den Beleg der Zufriedenheit des Gatten offiziell ab und dem Vater dieses symbolische Tier zur Aufbewahrung. Ganz ebenso wird es verlaufen, wenn zwei sich nach längerem Gwebezustand heiraten und wenn der Bursche vorher selbst im "harmlosen Spiele" die Möglichkeit raubte, die Hochzeitsmatte zu röten. Dann wird er sich hüten, irgendwelchen Streit heraufzubeschwören, und vielmehr die junge Frau sehr gern am andern Tage mit ihrer Ziege dem väterlichen Hof zuwandern sehen.
Anders aber wird die Sache, wenn ein Bursche, der selber die Keuschheit bis dahin wahrte, in der Hochzeitsnacht vergeblich nach dem Keuschheitsbeleg der jungen Frau auf der Matte Umschau hält, wenn er sich also sicher weiß, keinerlei Einbrüche in die Jungfräulichkeit des soeben geehelichten Wesens vorher ausgeübt zu haben. Dann wird er ärgerlich. Er nimmt der jungen Frau die Ziege wieder weg, so daß sie andern Tages nicht dieses Keuschheitssymbol in ihr Elternhaus führen kann. Und oft begnügt er sich nicht damit. Es kommt dann nicht selten vor, daß er eine Eisenschaufel nimmt, in ihre Mitte ein tüchtiges Loch schlägt und das so zum Symbol gestempelte und entwertete Gerät dem Schwiegervater als schweigende, aber doch beredte Mitteilung und Tatsachenschilderung zusendet. Wenn die junge Frau dann statt mit der Ziege mit der durchlochten Schaufel im Hause der Eltern ankommt, so entsteht darin ob der Schande, die sie hineinträgt, große Wut. Darum wird die junge Sünderin daheim gründlich verhauen und dann voller Zorn wieder herausgeworfen, so daß ihr nichts anderes übrigbleibt, als zu ihrem Gatten zurückzukehren, bei dem sie aber nun einen schlimmen Einzug und eine wenig beneidenswerte Einführung als Gattin findet. Immerhin nimmt man die Sache nur so lange wichtig, als die Wellen der augenblicklichen Erregung sich nicht geglättet haben. Wenn die junge Frau bald guter Hoffnung wird, dann ist alles ganz in der Ordnung. Es kommt noch dazu, daß die Mundang wie alle Äthiopen bei aller sexuellen Genußfreudigkeit und Hingabebereitschaft doch in ihren Worten und Gedanken unendlich keusch sind, eine
Sache, auf die ich nachher noch zu sprechen kommen werde, die aber ganz entschieden diese Schwierigkeiten des Ehebeginnes leichter überwinden hilft. Denn worüber der Mensch in Gedanken und Worten schweigen kann, darüber hilft ihm ein stärkeres Gefühlsleben stets ohne Schwierigkeit und schnell hinweg. —Vor der Ehe gehen die Mundangweiber nackt; die verheiratete Frau ist durch einen zwischen den Beinen durchgezogenen Baumwollstreifen ausgezeichnet, der sin oder sen heißt.In sozialer Hinsicht ist bezüglich der Eheverbindungen noch nachzutragen, daß die Verehelichung innerhalb der Familiengruppe durch überaus streng eingehaltene Exogamie bedingt wird. Ich hörte von folgenden Familien oder vielmehr Sippen, deren Namen und Speiseverbote ich hier wiedergebe, bei deren Aufführung ich aber ausdrücklich betone, daß Mißverständnisse meinerseits in bezug auf das Speiseverbot durchaus nicht ausgeschlossen sind und daß sie nur einen Bruchteil aus der großen Zahl der Sippenbildungen repräsentiert:
Die Sippe Gonkoda ißt nicht pii, den Leoparden,
Gondschelo " " mbolle, den Löwen,
Gontaba " " oi, gelber Fisch mit dickem Kopf,
Dabesokko " " mungiri die Hyäne,
Bamdere " " bussame, das Schaf,
Tosoko " " ssuo, die Schlange,
Bandju " " tumburi, den Raben,
', " Towaja " " tigirgan, Fisch mit Hundezähnen,
Bangue " " guo, den Hund,
Basse " " se, den Büffel. |
Das betreffende Tier ist für die Familie Ssiri, d. h. eine heilige, gewissermaßen unantastbare Sache. Wenn z. B. ein Mitglied der Familie Tosoko eine ssuo, eine Schlange in seinem Hause trifft, so darf er sie um alles nicht etwa totschlagen oder auch herausjagen. Vielmehr muß der Mann schnell eine Mischung aus Benniseed und Salz herstellen und diese in einer Kalebasse der Schlange hinreichen. Die Schlange wird sich dann ein wenig aufrichten, davon genießen und sich wahrscheinlich entfernen. Übrigens halten unter den Mundang einige Familien, denen sie besonders heilig sind, Schlangen daheim, genau wie gewisse Westäthiopen Nordtogos und der Mossiländer in ihren Kornspeichern Schlangen halten, die dann eindringende Ratten und Mäuse verzehren. —Oder aber: wenn ein Mitglied der Gonkodafamilie (der Königsfamilie) die Spuren eines Leoparden in seiner Farm sieht, so weiß es, daß sein Lebensende nahe herbeigekommen ist. — Oder aber: die Mitglieder der Bassefamilie sagen, es würden einem jeden von ihnen die Hände abfallen, sobald er Büffelfleisch genießen würde. — Oder aber: das Volk glaubt, wenn ein Mann
der Bandjufamilie einen Raben ißt, daß er dann sogleich krank, nämlich über und über gelb werden würde. — So trennen allerhand Anschauungen jede Familie von dem Tier, das ihnen heilig ist. Sozial wichtig ist aber die streng eingehaltene Exogamie, und daß niemals zwei Menschen mit gleichem Speiseverbot einander heiraten dürfen, wenn sonst auch bis in weite Ferne rückwärts keine Familienverwandtschaft nachweisbar ist. —Da in diesen Ländern die soziale Stellung der Schmiede und deren Heiratsanschluß sehr schwankt, so mag auch diesen hier ein Wort gewidmet werden. Die Familie der Schmiede heißt Tro. Angeblich haben ihre Mitglieder weder ein heiliges Tier noch ein Enthaltungsgebot. Man sagt, sie äßen alles, bis auf "Gift". Die Schmiede sind aber im Mundanglande außerordentlich geachtet. Jeder wird einem Schmiede gern seine Tochter geben und jeder wird eines Schmieds Tochter gern heiraten. Denn die Schmiede stehen immer zusammen mit den Leuten, die die heiligen Zeremonien leiten, die das heilige Gerät in Verwaltung haben; das ist also vor allem die Königsfamilie, dann aber auch jede andere, die Besitz, Macht und weites Ansehen genießt.
Natürlich ist auch den Mundang der wesentlichste Zweck der Ehe Kindersegen. Man erwartet, daß die junge Frau sich nach zwei Monaten schwanger fühle. Die Geburt soll ordnungsgemäß etwa neun bis zehn Monate nach dem Eheschluß erfolgen, und zwar der Regel nach im Hause vor sich gehen. Sowohl die Mutter der Frau als die des Mannes finden sich beim Eintritt der Wehen zur Hilfeleistung ein. Die Gebärende nimmt auf dem nächsten Hausboden sitzend Platz. Sie lehnt sich rückwärts gegen die eine hinter ihr hockende Helferin, die ihr mit den Armen den Leib umspannt. Sie spreizt die Beine, die Knie leicht hochziehend, so daß dazwischen die andere Pflegerin kniend Platz findet, bereit, die Frucht in Empfang zu nehmen. Der Nabel (Sa-fun) wird mit dem scharfen Splitter eines Sorghumstengels abgeschnitten. Saghirre, die Nachgeburt, wird im Boden der Hütte vergraben.
Klar und sicher erklären alle Berichterstatter auch bei den Mundang, daß die Nabelschnur bei Knaben drei Tage, bei Mädchen vier Tage nach der Geburt abfalle. Sie wird alsdann in einen kleinen Lehmkloß gehüllt und in dieser Form im Hause aufgehängt. Später, wenn das Kind laufen kann, wird das Lehmklümpchen ins Wasser geworfen. —
Außerdem und vor allen Dingen aber wendet man sich an einen Paphasa, d. i. ein Orakelmann, von dessen Manipulationen man auf jeden Fall die Aufklärung darüber erwartet, ob der Kranke seinen schlimmen Zustand etwa einem Masa-a, einem Zauberer, verdanke oder nicht.
Wenn ein Mensch stirbt, sei es auch aus welchem Grunde, so richtet sich das Mundangvolk nach dem äthiopischen Grundsatze, daß der Verlust eines jungen Mannes ein Verlust für die gesamte Arbeitskraft, der Tod eines Greises aber eine Ersparnis an Ausgaben und ein guter Wechsel auf Vermehrung des Familienzuwachses bedeute. Wenn ein junger Mann stirbt, so weint man, weil seine Zeit noch nicht gekommen sei. Wenn ein alter Mann stirbt, so tanzt und jubiliert man. —Die Leiche wird in hockender Stellung zusammengepreßt, so daß die Hände zwischen den Beinen nach unten hängen und der Kopf auf den Knien liegt. So wird die Leiche mit Stricken verschnürt und dann in einem Tcholle, das ist ein Korb aus Sekkorolle, der gleich dem Bienenkorb der Boko in Nordkamerun und der Mande am obern Niger ist, eingepackt. Aber vorher erhält die Leiche noch ein Kleid. Für eine männliche Leiche wird ein Schaf getötet, ihm die Haut abgezogen und der Leiche zwischen den Beinen durch um den Unterleib gelegt und fest angezogen. Die Blößen der Frauenleichen werden aber mit Streifen aus Baumwollstoff bedeckt. Fernerhin werden die Leichen über und über mit roter Erdfarbe bedeckt. Für jede Leiche wird ein eigenes Loch gegraben, das etwa schultertief ist. Dem patriarchalischen Grundsatze getreu, werden Männer im Gehöft, Weiber aber außerhalb desselben eingescharrt. Ist die Leiche in die Grube gelegt, so schüttet man sie einfach zu. Solche Bestattung findet für jedes Glied des gemeinen Volkes statt. Nur für den König allein wird jene Bestattungsform geübt, die ich im Anfange
dieses Kapitels schilderte und die darin gipfelt, daß man der Leiche den Kopf abschneidet. Dabei ist es ganz gleich, ob es sich um die Leiche des mächtigen Königs von Laere oder den Häuptling eines ganz kleinen Dorfes handelt. Jeder König wird eben nach siebenjähriger Herrschaft sterben müssen und seine Leiche dann enthauptet.Wenn ein alter Mann stirbt — und nur dann, nicht aber wenn ein altes Weib oder ein junges oder ein junger Mann oder gar ein Kind das Zeitliche segnet — werden die Schwirren geschwungen. Ist das eigentliche Begräbnis bei Nacht, so ziehen die Schwingenden durch das Dorf; ist es bei Tage, so dröhnen und rauschen diese Stimmen vom Busch. Dann müssen Weiber und Kinder und alle Unbeschnittenen sich eilig in die Gehöfte zurückziehen und hinter Matten verstecken, denn sonst könnte es ihnen nach dem Volksglauben ganz schlimm ergehen.
Neben das Grab setzt die Familie des Toten viel Speise und Trank. Kein eigenes Mitglied darf davon genießen; andere Leute können solche Speise aber forttragen und verzehren. Dann wird um die Grabstätte ein Kreis von Steinen gelegt und die Innenfläche mit Sand ausgefüllt. Über dieser Stelle schlachtet der Sohn des Verstorbenen alljährlich zur Erntezeit einen Hahn.
Auch dem Glauben an die Totenstädte oder den irdischen Weiterwandel der Verstorbenen begegnen wir wieder bei den Mundang. Sie sagen, die Toten, die Holi, wandern in die nächste Stadt und bleiben da. Aber jeder Verstorbene weilt da nur seine Zeit und bis es ihm gefällt, in jugendlicher Form wieder in den Schoß seiner Familie zurückzukehren. Auch hier ist es unbedingt anerkannte Überzeugung, daß jeder Verstorbene in einem Gliede der Familie wiedergeboren werde.
Wenn also ein Mädchen heiratet, so geht es mit seiner Mutter zusammen und wohlausgerüstet mit vielem Essen zum Grabe eines Vaters oder Großvaters. Dort betet es: "Sieh, mein Großvater, ich habe noch kein Kind geboren. Gib, daß ich jetzt ein Kind bekomme. Sprich mit deinen Vätern und Brüdern, daß sie mir helfen mögen. Ich will für meine Kinder gut sorgen. Ich will sie gut waschen!" Danach ruft das Mädchen viele kleine Kinder (ich glaube Knaben!), so viele als zu haben sind, in den Hof und gibt einem jeden von der Speise ab, die es mitgebracht hat, und zwar dies, damit (nach der Angabe eines Berichterstatters) "die Holi (das sind die Verstorbenen) sich wünschen, von dem Mädchen auch so gutes Essen zu erhalten." — Nach dieser Zeremonie wird das Mädchen bei gleichzeitiger Begattung durch den Ehemann schwanger und das Kind ist dann klar ersichtlich ein wiedergeborener Holi.
Das Opfer selbst findet dann im Hofe statt und zwar vor einem Sorghumspeicher, um dessen Vorplatz sich alle Familienglieder, natürlich vor allem die Männer versammeln und niederhocken. Außer den Familiengliedern sind aber möglichst viele Kinder zusammengerufen. Die Frauen bereiten Brei. Der Familienvater schlachtet die Tiere. Es wird abgekocht. Dann erfolgt das Gebet. Der Familienvater nimmt ein wenig Brei und ein Stückchen Fleisch — womöglich Leber — er legt es auf die Erde vor dem Speicher und sagt: "Das ist für dich, mein Vater!" Danach nimmt er wiederum ein wenig Brei und Fleisch, legt es auf die Erde und sagt: "Das ist für dich, mein Großvater!" Er vollführt die gleiche Opferspende zum dritten Male und sagt: "Das ist für meine andern Holi." Darauf kostet er selbst zweimal von der Speise. Hierauf reicht er zweimal seiner Frau, die als zweite von den Gaben der neuen Ernte speisen muß, und den ganzen Rest bekommen die rund herum versammelten Kinder.
Ehe dieses Opferfest Siki nicht begangen ist, darf niemand von den neuen Feldfrüchten genießen. Damit beginnt aber die Zeit des neuen Reichtums an Nahrungsmitteln. Sonst sind keinerlei heilige Handlungen mit dem Fest verbunden, auch erklingen am Abend nicht die Schwirren. — Nur im Herbste wird derart den Ahnen geopfert, nicht aber in der Frühlingszeit.
Ein Opfer wird dagegen in der Saatzeit veranstaltet, wenn der Regen ausbleibt und die Nahrungssorge am Horizont dämmert. Dann holt die Gemeinde vom König die Genehmigung ein, einen Guale, d. i. einen Regenmeister herbeizurufen. Wird sie erteilt, so muß ein schlohweißer Schafbock besorgt werden. Das Tier muß schlohweiß und fleckenlos und männlich sein, und wenn kein geeigneter Schafbock aufzutreiben ist, so wird statt seiner ein ebenfalls makellos weißer Bulle ausgewählt. Mit diesem Opfertier zieht dann der Guale in den Busch. Eine große Menge von Buben folgt ihm. Es darf aber unbedingt kein Knabe darunter sein, der schon etwas mit einem Weibe zu schaffen gehabt hat. Außer diesen folgen die Greise des Dorfes, soweit sie das Alter der geschlechtlichen Betätigungsfähigkeit überschritten haben. In dieser Zusammensetzung geschlechtlich
noch nicht oder nicht mehr tätiger männlicher Wesen zum Prozessionsmarsch liegt wiederum eine wichtige Übereinstimmung mit den Sitten der Dakka.Diese Gesellschaft wird vom Guale zu einem heiligen Platze geführt, der immer im Westen der Ortschaft liegt und den Namen Barne führt. An diesem Platze liegen stets zwei weiße Steine, anscheinend Quarzstücke. Sie heißen Disalle und gelten als Mann und Weib. Über diesen Disalle opfert der Guale das Opfertier, so daß das Blut auf sie niedertropft. Dazu spricht er: "Hier bringe ich für die Ortschaft einen weißen Schafbock. Er ist weiß. Die Leute haben ihr Korn in die Erde gelegt; aber es will nicht regnen. Das Korn vertrocknet. Es ist kein Essen mehr vorhanden. Alle fürchten, daß nichts wachsen wird. Gebt, daß es regnet, damit die Leute nicht sterben. Gebt, daß es ein gutes Jahr werde und Gesundheit bleibe." Nach diesem Gebet wird abgekocht. Es gibt ein ausgezeichnetes Essen, das den Knaben und Greisen vorgesetzt wird. Nur die noch keuschen Knaben und die nicht mehr geschlechtlich wirksamen Greise dürfen davon genießen. Wenn alles verzehrt ist, verläßt die Prozession den Bameplatz und begibt sich wieder heim. Die Zeremonie ist damit abgeschlossen. Irgendein Schwirren erfolgt auch an diesem Tage nicht. Man behauptet, daß es danach unbedingt regnen müsse. — Etwas Näheres über die Disallesteine vermochte ich nicht zu erfahren. —
6. Kapitel: Die Lakka*
Verbreitung und altes Königtum. —Östlich der Mundang-Damastämme wohnt im Flußgebiete des Logone und des Schari ein Volk, das auf der deutschen Seite im allgemeinen als Lakka bezeichnet wird, dessen Ostflügel aber den Namen Sarra (oder nach meinem Ohr besser Sarre) trägt. Das Volk nennt sich selbst aber Dokula; sowohl Lakka als Sarra bezeichnen sich als Dokula, und wenn ich den Namen Dokula nicht als Generalnamen benutze, so geschieht es, weil ein Name, den jemand nur selbst kennt, nicht aber seine Nachbarschaft, keine Lebenskraft hat. Der Name Lakka stammt von den südlichen Nachbarn unserer Freunde, von den Baja. Die Lakka wohnen im Flußgebiete des Logone, den sie Mamberre nennen. Ihre östlichen Brüder, die auf dem rechten Ufer des Mba genannten Schari wohnen, sind die Sarra oder Sarre. Sie scheinen sich außerordentlich weit nach Osten hin auszudehnen. Ein Sarramann, den ich 1906 am Kongo traf, erklärte mir, außer den Somrai (?) gehörten *
Siehe die Kartenskizze. Die Lakka gehören zu dem großen Völkerbündel der Sarra, die vom Tschadsee und Baghirmi aus nach Süden die Talbecken der Schari und Logone einnehmen. alle Ost-Scharistämme zu den Sarra, und seinen Angaben zufolge müßten Sprachverwandte sowohl bis in das Abwässerungsgebiet des Ubangi als in dem des Bahr-el-Ghasal wohnen; er selbst gab an, aus Dar Runga zu stammen, was mit Dar Ronga identisch sein muß; und andere Stämme seiner Verwandtschaft sollten in Dar Fertit wohnen. In Kordofan fand ich 1912 Bestätigung dieser Angabe. Dafür spricht außerdem die Verbreitung der Wurfmesserformen, denn aus Fertit empfangene Typen zeigen eine Mischung von Nord- und Südtypus. Wenn sich diese Angaben aber bewahrheiten, so haben wir hier eine Völkergruppe, die das Plateau des wahren Flußnabels aller großen afrikanischen Nord- und Westströme bewohnen. (Einige Benue- oder Nigerzuflußbäche Schari-Logone, Ubangi-Kongo, Bahr-el-Ghasal-Kongo.) |
Innerlich zerfallen die Lakka in eine Unzahl kleiner Klane oder Stämme, deren jede als Djege bezeichnet wird. Ich erhielt die Namen der Mamgaua, Kutebe, Batutu, Babandja, Kutu, Bindja, Kodjala, Turra, Guru, Bemala, Brrrr, Mball, Rube. Es ist das nur eine kleine Auswahl der nach Hunderten zählenden Djege, deren Zusammenhangsschwäche offenbar echt äthiopischer Natur ist. Heute stellen die Lakka keinerlei politische Machtgruppe mehr dar, und ihre Nachbarn, die sie Kullanga (das sind die Bum), Schirto (Kanuri), Tari (Mundang) und Bajadje (d. s. die Baja) nennen, haben die politische Schwäche arg ausgenutzt. Am schlimmsten haben aber ihrer Angabe nach die Nbangba (d. s. die Fulbe) unter ihnen gehaust, und in der Tat findet man in dem ethnographischen Mosaik eines Fulbegehöftes auffallend viel Lakka vor. Sie vertreten etwa hier die Stelle, die im Granit der Feldspat einnimmt. Die Fulbe schätzen die Lakkasklaven ganz außerordentlich.
Aber wenn heute das Bild dieses Volkes auch sehr viel von seiner Ursprünglichkeit, und vor allem sein politisches Gefüge jeden Zusammenhang größeren Maßstabes eingebüßt hat, so muß es desto mehr erfreuen, noch die Erinnerung an bessere, größere Zeiten im Volke zu entdecken.
Die Lakka sagen, sie hätten einmal einen König gehabt, einen Gogagadje, der war sehr machtvoll und residierte weit im Osten, in einer Robe genannten Stadt. In Robe soll ein Gogagadje nach dem andern geherrscht haben, aber das ist schon lange her. Der Gedanke an ein Königreich lebt nur noch in der Vorstellung des Volkes, gleich der eines längst entschwundenen goldenen Zeitalters. "Es war einmal." Aber wo in dem Nebel verflossener Völkergeschicke dies "einmal" erstarb, wußte mir kein Mann zu sagen. Es war eben "lange, lange, ehe die Fulbe ins Land kamen". Es hat in diesen Ländern aber immer etwas Versöhnendes, von einem Königreiche zu hören, das nicht von den Fulbe zerstört wurde.
Allen Traditionen nach war "das" Königreich der Lakka (ebenso gut können es mehrere nebeneinander gewesen sein) ein echt äthiopisches. Die Regierungszeit jedes Herrschers ward überwacht, aber wie und ob sie begrenzt war, darüber hörte ich nichts, was der Wiedergabe wert wäre. Das Königreich und der Hofstaat waren nicht reich an Erzämtern. (Die weitest nach Osten vorgeschobenen Erzämter hat in diesen Ländern der "Hof" des Bumkönigs gegeben.) Wohl aber gab es in der Umgebung des Gogagadje zwei junge Leute, die zu bestimmten Diensten verwandt wurden. Das waren ein Netoa genanntes Mädchen und ein Gana genannter Knabe, beide aus der Familie, d. h. näherer oder weiterer Verwandtschaft des regierenden Herrn gewählt. Sie waren eine Art Pagen- und Botenpaar, das einerseits offizielle Dienste verrichtete und anderseits doch wieder privater Natur war. Wenn Netoa und Gana eine Zeitlang ihren Pflichten zur Zufriedenheit genügt hatten, heirateten sie einander.
Wenn ein König starb, wurde ein sehr tiefes Grab, ca. zwei Meter tief, ausgehoben; erst eine Grube, von der dann nach Osten hin der Grabraum ausgeschachtet wurde. Die Leiche des Herrschers fand hierin noch am Tage des Verscheidens Aufnahme, und zwar ohne Kleidung in vorgeschriebener Stellung und Lagerung, nämlich mit dem Kopfe nach Osten, den Beinen nach Westen, auf der Seite, so daß die linke Hand unter der linken Backe ruhte — also mit den Augen nach Süden. Dem Begräbnis folgte eine Zeit des Totentrunkes. Zehn Tage lang trank man Hirsebier, und es galt als schicklich und als Zeichen der Anhänglichkeit an die Sitte, wenn man in dieser Zeit nie recht zum klaren Verstande kam. Mit Sorghumbier —hier Koto genannt —wurde auch ein Sklave trunken gemacht. Im Osten des Königsgrabes wurde ein zweiter Schacht ausgehoben, der in der Tiefe nach Westen in einen Kanal mündete; dieser Kanal ward fortgesetzt, bis man an das Gemach gelangte, das die Königsleiche barg. Also führte der Ostzugang in die Grabstätte des toten Fürsten. Und da hinein brachte man den trunkenen Sklaven und schüttete den Zugangsschacht zu. Der König hatte seinen Todeskameraden erhalten.
Speiseverbot für den König war Nam, der Löwe und Kage, der Leopard. Das königliche Abzeichen des Herrschers bestand der Tradition nach in einer speziellen Haartracht. Der König mußte sein Haar, zumal in der Mitte, sehr lang wachsen lassen. Es wurde in der bekannten Längsraupe als Mittelachse geflochten und gebunden und dann mit einem langen Streifen aus Messingblech (Messing = bangora) geschmückt, der in der Mitte entsprechend der ganzen Anordnung von vorn nach hinten verlief. — Diese Sitte üben heute noch die angesehenen mächtigeren Dogobodja in Nachahmung der Sitten des nun schon lange verstorbenen Königtums. —
Das Lebensbild dieses Zellwesens ist eine genaue Kopie dessen, was wir bei allen Äthiopen als Grundform finden. Die Zellen zeigen eine ausgesprochene Tendenz, sich gegenseitig abzustoßen. Die Gollbai leben in ununterbrochener Fehde der einen gegen die andern, wobei die Freundschaften und Feindschaften von heute auf morgen wechseln und einander ablösen können. Diese ständigen Reibereien der Gollbai untereinander verleihen ihnen natürlich eine größere Härte und Festigkeit nach innen, schützen vor auflösendem Anthropismus der Familienkraft, wie wir ihn typisch etwa bei den Jukum finden. Die Zwistigkeiten und Fehden nehmen oft harte Ausdrucksformen und den (für primitive Verhältnisse) gesunden Typus des Kampfes ums Dasein an. Niemand steht über der Gollbai, die etwa als republikanischer Altensenat oder als herrschende Königsgewalt die Zwistigkeiten regeln und Gegensätze ausgleichen könnte. Vielmehr steigt die Erbitterung der Uneinigen oft bis zum Vernichtungskampf. Die stärkere Gollbai siegt im Waffenkampf; die schwächere unterliegt. Der Sieger führt die Ausrottung der Unterlegenen konsequent durch. Die siegende Gollbai nimmt die Menschen der besiegten gefangen und verkauft sie als Sklaven, wenn nicht ein gleichwertiges Lösegeld von einer andern Gollbai aufgebracht wird, die vielleicht durch Heiratsbeziehung mit der Unterlegenen liiert ist. Aber die besiegte Gollbai verliert alles Eigentum. Sie muß alle Waffen abgeben, den Speer =Ninga, den Schild (mit einem Holzgriff gleich dem der Baja) =Dirr, vor allem das Wurfmesser = Mia. Das Wurfmesser spielt die entscheidende Rolle; den Bogen kennen Lakka und Sarre nicht. Die Stämme haben eine Art Panzer = Nieman (d. h. Krokodu);
er besteht aus Krokodilhaut und ist mit Schultertragbändern versehen; es ist der gleiche wie bei den Baschama und wenigstens der Konstruktion und Form nach, gleich dem Eisenpanzer von Marua.Der Bogen fehlt. Auch im Kampfe mit der Tierwelt, bei Jagd und Fischerei findet er keine Anwendung. Die Jagd auf Antilopen wird mit einem lang ausgedehnten Stelinetze = Kulla, genau wie bei den Asande und Nupe ausgeführt; es kommen auch Schlingen = Nare zur Anwendung. Diese Schlingen bestehen in einem Reifen, der über ein Loch in der Erde gelegt ist und an dessen innerem Rande spitze Eisenstifte befestigt sind. Die Spitzen treffen einander in dem Zentrum. Wenn die Antilope in den Kreis tritt, stößt sie die Eisenstifte nach unten; dann aber, den Fuß wieder heraufziehend, bleiben die Spitzen über den Hufen hängen und bohren sich, je stärker das Tier zieht, in das Fleisch ein. — Der Schleuder = Kula bedienen sich die Lakka wie die andern Äthiopen zum Schutze der Felder.
Sehr intensiv wird der Fang von Fischen (= Kanji) betrieben. Außer den gewöhnlichen Langnetzen (=Kulla) kommt auch das Bottarahmennetz, das Korro, in Anwendung. Es ist das gleiche, das ich bei den Sankurrustämmen fand, das am Kongo und Ubangi gebräuchlich ist, das Mansfeld am Großriver abgebildet hat, das am untern Niger vorkommt und das die Fischer bei Lokoja kennen. (Nur am Benue wird es vom Ufer aus gehandhabt.) Fischirrgänge aus Stäben und Flechtwerk, Fischgatter wie bei Batta üblich, fehlen. Dagegen werden Fischkammern aus Matten ins Wasser gebaut; es wird Futter hineingeworfen und dann die Mattentür vom Ufer aus mit einem Tau hochgezogen. Wenn Fische hineingelockt sind, läßt der Fischer vom Ufer aus die Tür zufallen.
Vor allen Dingen ist der Lakka aber ein glänzender Bauer, und als solcher wird er auch allenthalben jedem andern Sklavenmaterial des Ostens vorgezogen. Bei den Lakka fällt das ganze Farmwerk nur den Männern zu. Die Weiber haben für die Hauswirtschaft zu sorgen, haben die Kinder zu warten, bringen Holz und Wasser, kochen (bereiten besonders die Schibutter = Uwu oder Ubu, die bei den Lakka besonders gut sein soll), destillieren Salz und töpfern. Der Farmbau liegt aber ausschließlich in Männerhänden. Die Hauptfrucht der Lakka ist Penisetum, und zwar die Maiwa-(Haussa-)Form. Als menschliches Nahrungsmittel wird Sorghum lediglich zur Bierbereitung gebraucht, und dann dient es hier auch zur Ernährung der Pferde, von denen die Lakka eine eingeborene Ponyform haben, die mit der Rasse der Bautschi und Borgu übereinstimmt. Alt und jung nährt sich von Brei, der bei den Lakka von gemahlenem Penisetum bereitet wird.
Die Farmen werden bei den Lakka ganz flach angelegt und das
scheint die verbreitetste Form des Ostens und Nordkameruns zu sein. Von der flachen Form weichen vor allem Bokko, Nandji und Durru, also die zentralen Splitterstämme Adamauas ab; und ferner wird, wo angebaut, allenthalben der Jams auf Haufen gebracht, von denen die Faili mit ihren zuweilen über mannshohen Kegeln die höchsten Typen haben.An Vieh züchtet der Lakka keinerlei Rindviehrasse. Alle Rinder (=Nda), die gelegentlich bei den Lakka vorkommen, sind bei der Nachbarschaft eingekauft oder geraubt. Dagegen werden außerordentlich viele Ziegen (=Mbate), Schafe (=Mbija) und Hühner (=Kunja) gezüchtet. Der Mist dieser Tiere wird zur Salzsiederei verwendet, nicht als Dung. Auch der Küchenabfall wandert nicht hinaus. Vor den Gehöften wird er zuweilen zu mächtigen Kjökkemödingern (=doibi) aufgetürmt, die aber nicht der Abendbelustigung, sondern praktischer Verwendung dienen; sie werden bepflanzt. —
Heilige Geräte (Kuma), Priester, Sorghum- und Erntefestopfer, Altersklassen, Mannesweihe. — Das heilige Gerät der Lakka besteht aus gleichen Emblemen und findet gleiche Anwendung wie bei ihren westlichen Vettern. Ein Oberpriester (Gongoria) hütet es, und verwahrt wird es an einem heiligen Platz (Lokuma) im Busch. Im einzelnen gehört dazu:
1. Gandubijae, Schwirre aus Eisen, von denen mehrere Exemplare zusammengehören.
2. Mandi, eiserne Fußschelle für die Schwirrenschwinger.
3. Rongo, Rohrflötenensemble, das den Lära der Tschamba entspricht, dem aber ebenso wie bei den Komai Horn- und Kalebassenschalitrichter fehlen.
4. Perr, heilige Rohrgebläse, die den Exemplaren der Mundang entsprechen.
Die Zusammensetzung ist die der andern Stämme. Die Anwendung der Instrumente ist anscheinend bei allen Zweigen der Lakkagruppe die gleiche; aber die Namen sollen verschieden sein, ja zuweilen absichtlich geändert werden, worüber ich nichts Spezielles erfuhr. —Alle Heiligtümer werden am Lokuma, d. i. ein Platz im Busch, östlich der Gehöfte aufbewahrt. An dem Platze ist ein Häuschen, in dem Häuschen steht ein großer Topf. Der Gongoria wacht über ihnen, gibt zur Anwendung Anordnung oder Erlaubnis, trägt sie aber nicht selbst aus dem oder in den Busch. Dieses Amt vertraut er vielmehr einem Burschen seiner Familie an.
Die Anwendung ist eine recht verschiedene. Eisenschwirre, Fußschellen und Rohrgebläse finden in der Erntezeit bei den großen Festen Verwendung. Jedoch dürfen die Frauen sie auf keinen Fall je zu Gesicht bekommen. Auf den Rohrgebläsen wird außerdem das
heilige Geräusch beim Begräbnis alter Leute hervorgerufen; also sind sie doppelt heilig. Dagegen wird auf den Lären von den Burschen gelegentlich jeder vergnüglichen Veranstaltung im bekannten Kreisreigen getanzt, bei gutem Mondschein, bei frohem Umtrunk ebenso gut wie beim Totenfest. Und oftmals kommen die Burschen zum Gongoria, ihn um Freigabe der Instrumente zu bitten. Ganz selbstverständlich ist es, daß dann die Frauen anwesend sind, genau so wie bei Dakka, Tschamba und Komai.Man könnte demnach auf den Gedanken kommen, diesen Chorinstrumenten überhaupt alle Heiligkeit abzusprechen und sie als profane Orchestermusik in Anspruch zu nehmen, wenn sie nicht einmal, wie schon bemerkt, vom Oberpriester am Lokuma verwahrt und zweitens bei ganz bestimmten religiösen Amtshandlungen angewendet würden. Zum Beispiel: Es kommt vor, daß ein Weib schwanger ist, aber die Geburt läßt ungebührlich lange auf sich warten. Da geht das Weib zuletzt in seiner Not und mit seiner Bürde zum Gongoria und bittet ihn, ihr zur Erlösung zu helfen. Das ist ein Fall religiöser Anwendung der Rongo. Der Priester nimmt eine der Bambusfiöten; er füllt sie mit Wasser; er bläßt darauf; er gießt der Schwangeren das Wasser auf den Kopf. Nun wird die Geburt bald und leicht vonstatten gehen.
Der priesterliche Wahrer dieser Schätze, der Gongoria, dessen Amt erblich ist, hat auch hier die zwei Hauptfunktionen: einmal das Opfer (= Umadjae) zur Erntezeit, zum zweiten die Einführung der Burschen in die Männerschaft des Stammes.
Auch hier wieder haftet das Erntefest am Sorghum, aus dem die Menschen doch nur ihr Bier bereiten, so daß man hier, wenn man das Zeremonial den dionysischen Festen zuschreiben kann, unbedingt von einer bacchantischen Form sprechen muß. Das Mehl des täglichen Brotes oder vielmehr Breies, das Penisetum, findet auch nicht die geringste religiöse Beachtung. Man erntet es und genießt es, wie die Natur es gibt. Es fällt niemand ein, seinetwegen auch nur die geringste Kultushandlung, das geringste religiöse Einschränkungsgebot zu übernehmen. Nur dem Sorghum gilt das Weihefest.
Wenn das Sorghum reif ist, ruft eines Tages der Gongoria fünf alte Männer und nimmt einen schwarzen Ziegenbock (Bian-dull). Die kleine Prozession begibt sich mit dem Opfertier auf die Farm des Gongoria. Zu nächtlicher Zeit wird dann der Ziegenbock geopfert. Der Gongoria spricht ein Gebet für Reichtum der Ernte, bittet um Gesundheit, bittet um Familienvermehrung — alles das für die ganze Gehöftgruppe, für die Gollbai, die er vertritt. Mit dem Zeremonial dieser Nacht beginnt dann eine Enthaltungsperiode von sieben Tagen. Niemand darf vom neuen Korn genießen. Kein Mann darf während dieser sieben Tage und Nächte bei seinem Weibe oder
überhaupt einer Frau liegen und sie beschlafen. Wohl aber darf am Tage nach der Opfernacht und nachdem der Priester die vollzogene heilige Handlung durch Mitteilung an die Männer bekanntgegeben hat, jedermann sein neues Korn schneiden —schneiden, aber nicht genießen. Am achten Tage bringt dann der Gongoria von dem Sorghum in das Lokuma (Haus der heiligen Geräte, die "Kuma"genannt werden), bringt es dort dar und sagt: "Das ist für die Erde und die Kuma." Damit ist die heilige Zeit, in der die heiligen Geräte rauschen, abgeschlossen. Jedermann kocht Bier und es folgt ein kleines Bacchanal.Wie gesagt, beim Penisetumernten wird kein Zeremonial veranstaltet. Dagegen spielt das Sorghum in durchaus typischer Weise auch in andere Kultushandlungen hinein, die hier gleich erwähnt werden sollen. Einmal bringt man auch hier den Toten Sorghummehl, kein Penisetummehl dar. Zweitens ist es die Opfergabe bei Regenmangel. Wenn ein Regen allzu lange ausbleibt, wandert die Altenschaft zu einem Schmiede (Goibarr). Ein jeder bringt eine Kalebasse voll Sorghummehl mit. Der Schmied nimmt Wasser in den Mund und bläst es in die Luft. Bringt man dem Schmied Penisetum, so kommt kein Regen. —
Die zweite wichtige Amtshandlung des Gongoria erstreckt sich auf die Einführung der Jünglinge in die Männerschaft. Genau wie die Baschama kennen auch diese an der Peripherie Adamauas wohnenden Lakkastämme die Beschneidung der Burschen ebensowenig wie eine Exzision der Mädchen. Die Mannesweihe des Jünglings findet statt, wenn er ehereif ist, also ehe er die berechtigte Beziehung zum Weibe und die Fortpflanzungstätigkeit beginnt. Demnach lauten auch die Altersklassen:
1. Gong(o) = Bursche a) Gong(o) tigiriba =Säugling. b) Gong(o) dariba = Bube von drei bis fünf Jahren. c) Gong(o) gadji = Bube von sechs bis neun Jahren. d) Gong(o) togo = Bursche vor der Ehe. |
2. Dengau oder Dingau =junge verheiratete Männer.
3. Dogo-togo = ältere leitende Familienväter.
4. Bukau = Greise. Wenn der Bursche etwa vierzehn bis fünfzehn Jahre alt ist, also am Ende der Gongo_togo-Periode, so hat er seine "Braut" (siehe weiter unten), steht vor dem Heiratsmoment, und dann werden etwa drei bis fünf junge Leute je nachdem der Heiratsandrang gerade ist, vom Gongoria in den Busch gebracht. Dieser Auszug erfolgt nachts und heimlich. Die Kleidung der Ausziehenden ist bemerkenswert. Sie besteht nämlich beim Priester in absoluter Nacktheit, bei den Burschen aber in einem schwarzen Ziegenfell, das umgehängt und
während der ganzen Buschzeit getragen wird, und das ein sonst den Lakka unbekanntes Kleidungsstück sein soll.Östlich vom Dorf im Busch, wenig südlich vom Lokumaplatze, pflegt anscheinend der Dokula genannte Platz angelegt zu werden, auf dem die Burschen die Buschzeit verbringen. Es sind da Hütten aufgeschlagen. Der Zeitpunkt des Auszuges soll gleichgültig sein, doch dürfte er im allgemeinen anderer Angabe zufolge meist im Winter stattfinden. Nicht ganz erklärlich sind die Angaben über die Dauer der Buschzeit. Jüngere Burschen sollen sechs Monate, ältere nur elf Tage im Busch bleiben. Danach scheint es fast so, als ob zuweilen auch einmal Burschen längere Zeit vor der Verehelichung die Gelegenheit einer seltenen Initialperiode mit benutzten.
Auf keinen Fall dürfen die Burschen während dieser Zeit Weiber sehen. Brüder oder Vettern, Onkel oder die Väter selbst bringen die Speisen auf den Dokula. Die Zeit wird, wie bei Baschama, mit Jagen und Fischen ausgefüllt. Und was sie erlegen, rösten die Jünglinge selbst und genießen es als erwünschte Zutat zum mütterlichen Penisetumbrei. Auf keinen Fall dürfen aber Weiber von dem genießen, was die Burschen in dieser Zeit zur Strecke bringen.
Man sagt, daß, wenn im Verlaufe dieser Buschzeit einer der Pfleglinge des Gongoria sterben sollte, der Priester einen andern lebenden Burschen für den toten eintauschen muß, daß er das auch vollkommen könne, ohne daß es jemand merke, da er infolge seiner Kräfte und Künste einen jeden dem Toten so ähnlich zu machen imstande sei, daß niemand bei der Rückkehr den Unterschied zu bemerken vermöge.
Wenn die Burschen vom Dokulaplatze in die Gehöfte zurückkehren, schlachtet der Gongoria einen weißen Schafbock. —
Wenn der Bursche aus dem Busche kommt, heiratet er. Während er im Dokula lebte, haben die Brüder ihm ein eigenes kleines Gehöft nahe dem des Vaters errichtet. Nun er in den Schoß der Seinen zurückgekehrt ist, bringt die Familie der Braut das Mädchen und die Ausstattung d. i. Kalebassen (= Ka: sind vertikal geschnitten nach äthiopischer Weise), Töpfe (= Djo), den Stampfmörser (= Birri), die Stampfkeule (= Goi) und zehn Kalebassen Penisetummehl. Fleisch bringt sie nicht mit. Das ist Sache der Männer. Und die sorgen dafür. Es gibt demnach ein großes Familienmahl mit nachfolgendem Tanz und kräftigem Zutrunk. In echt bäuerlicher Weise wird das Fest ausgedehnt — hier sieben Tage lang.
Während dieser Hochzeitswoche ist der junge Ehemann mit seinem jungen Weib immer beisammen. Der Mann braucht schicklicherweise seine zehn Tage, bis er das Hymen so weit durch langsames Vordringen zur Seite geschoben hat, daß kein Blut fließt. Denn es gilt auch hier wie bei andern Nachbarn für unschicklich, wenn Blut kommt. Die Koitusform ist die echt äthiopische, d. h. die Frau liegt und der Mann hockt im geöffneten Schoße.
Eine Zeremonie ist mir dem sonstigen Sittenzusammenhange nach unverständlich geblieben. Der Vater des Burschen schlägt im Busch ein Stück Holz von der Länge eines Unterarmes und dem Umfang eines Oberarmes. Das Holz wird bei Beginn der Verehelichung vom Burschen mit der Spitze in das Feuer gelegt und von ihm jeden Tag ein wenig weiter in die Flammen geschoben, so daß es ganz langsam verbrennt. Anscheinend nimmt man als Verbrennungszeit zehn Tage an. Dann soll die junge Frau konzipiert haben, und die Lakka wollen diese Tatsache oder ihr Ausbleiben daran erkennen, daß die Brustwarzen der Weiber sich schwarz färben oder nicht. Ist das erfreuliche Zeichen eingetreten, dann herrscht Jubel im Hause.
Wenn die junge Frau aber nicht sogleich die an die familiäre Fruchtbarkeit gestellten Erwartungen erfüllt, wird durch manistisches Zeremonial eingegriffen, und das geschieht am Grabe der Verstorbenen nach echt kamerun-äthiopischer Weise. Aber eine Variante möchte ich feststellen, die mir eminent wichtig erscheint. Nicht die Frau wird zum Grabe geführt, sondern in echt patriarchalischem Sinne (der Mann gebiert das Kind!) der Bursche. Dabei soll folgendes Gesetz sein:
a) starb die Mutter des Burschen schon, führt ihn die Schwester der Mutter zum Grabe der Mutter,
b) starb der Vater des Burschen schon, führt ihn der Bruder des Vaters zum Grabe des Vaters,
c) wenn die Eltern noch leben, der Großvater aber schon starb
(das Anzunehmende!), führt ihn die Schwester des Vaters zum Grabe des Großvaters väterlicher Seite. Zu diesem Bitt- und Betgange führt der Begleiter (oder die Begleiterin) des Burschen eine Kalebasse mit Sorghummehl und einen On-kogolo mit sich. Letzteres ist ein Taschenkrebs von der Art, die häufig genug über die Wege läuft. Am Grabe opfert der Begleiter dann erst das Sorghummehl und spricht folgendes Gebet: "Sieh, mein Vater (resp. Bruder oder so), dieser Bursche aus unserer Familie hat nun schon vor zehn Tagen geheiratet. Er hat seine junge Frau beschlafen, aber sie ist noch nicht schwanger geworden. Es ist besser, du kommst wieder. Also bitte ich dich um dieses." Während des Gebetes wird das Mehl vollkommen ausgeschüttet. Es muß aber unbedingt Sorghummehl sein, sonst führt alle Mühe nicht zum Ziel. Danach läßt der Begleiter den Taschenkrebs einmal über den Burschen hinweglaufen, anscheinend auf der einen Seite herauf und auf der andern wieder herunter. Dann begibt sich das Bittpaar wieder nach Hause und der junge Mann gibt seiner Frau noch eine profane beschleunigende Medizin und pflügt das Feld seiner Hoffnungen aufs neue. Hat er nun Erfolg, so nimmt man unbedingt an, daß der junge Weltbürger der wiedergeborene Verstorbene ist, an dessen Grab gebetet wurde. —Sehen wir schnell einmal über die hier üblichen Geburtsakten hin:Naht die Stunde der Schwangeren, so setzt sie sich in ihrer Hütte auf einen Stein, und zwar auf dessen Kante, so daß dem Austritt kein Hindernis erwächst. Der Stein ist etwa schemelhoch. Die Gebärende spreizt die Beine und stemmt die Hände fest gegen die Knie oder auf die Oberschenkel. Zum Beistand kommen zwei erfahrene Frauen von denen die eine hinter ihr Posto faßt und ihr in der üblichen Weise drückend den Leib herabpreßt, die andere aber vorn hockt, bereit, die austretende Frucht in Empfang zu nehmen. Die Nabelschnur (Kum) wird mit dem Splitter eines Sorghumhalmes losgeschnitten. Die Nachgeburt (Kue oder Kwuae) soll nicht selten schwer auskommen, und man weiß sehr wohl, daß, wenn das nicht innerhalb zweier oder dreier Tage geschieht, die Wöchnerin stirbt. Bei solcher Zögerung nimmt der besorgte Lakkagatte zu einer wieder recht eigenartigen zeremoniellen Maßnahme Zuflucht. Er nimmt nämlich seine Axt (Tenna) und geht in die Nähe zu einem Massi, d. i. ein Tamarindenbaum (Samia in Haussa). Er schlägt einige Hiebe in den Baum. Danach soll dann das Rückständige sogleich hervortreten. — Die Nachgeburt wird im übrigen in einer Kalebasse aufgefangen und vor der Haustür begraben.
Dann wieder die altgewohnte Angabe: bei Knaben fällt die Nabelschnur nach drei, bei Mädchen nach vier Tagen ab. Auch die "Kum" wird in eine kleine Kalebasse gefüllt, diese dann aber oben in der Hütte aufgehängt.
Die Familie heißt Gokum. Die Familienweiterbildung durch Verehelichung erfolgt nach totemistisch exogamischen Gesetzen. Ehe ich aber den familiären Speiseverboten nähertrete, will ich auf ein durchgehendes allgemeines Sittengesetz hinweisen, das an gleiche Gebräuche bei Baja und Bakuba erinnert.
Es ist nämlich ausnahmslos allen Frauen der Lakka verboten, Ziegen- und Hühnerfleisch zu genießen. Dazu berichtet die Legende: Einmal badete Umadje im Flusse. Da kam ein Schafbock (Mball). Der Mball sah, daß Umadje badete und ihn nicht wahrnahm. Mball grüßte darauf Umadje von ferne, so daß Umadje auf ihn aufmerksam wurde und beizeiten seine Blöße bedecken konnte. — Am andern Tage badete Umadje wieder. Da kamen ein Hahn und ein Ziegenbock. Der Hahn und der Ziegenbock sahen zwar Umadje, aber sie kümmerten sich nicht um ihn, kamen schnell näher, und so hatte Umadje keine Gelegenheit, noch seine Blöße zu bedecken. Der Hahn und der Ziegenbock sahen also Umadjes Blöße. Darüber ward Umadje sehr zornig. Und Umadje sagte: "Du Schafbock sollst in Zukunft deinen Schwanz nach unten tragen. Ihr beide, der Hahn und die Ziege, ihr sollt den Schwanz nach oben tragen, so daß jeder sieht, was für unanständige Tiere ihr seid. Und weil ihr so unanständig seid, soll keine Lakkafrau von eurem Fleisch essen." So wurde es und so blieb es. —
Wieweit diese Legende altes Volkseigentum, wieweit sie etwa modernerer Import ist, ist mit so schwachem Material nicht zu entscheiden. Es muß einerseits stutzig machen, daß die islamitisierende Neuzeit diesen Umadje in dieser Geschichte mit "Anabi" (= Prophet) bezeichnet. Aber die Erzähler sagten das wohl nur, weil sie, nach der Persönlichkeit dieses Umadje befragt, nicht sogleich Rede und Antwort zu stehen vermochten. In Wahrheit hat wenigstens der Name Umadje nichts mit dem Islam zu tun. Ich habe oben schon gesagt, daß das Wort Umadje auch für "Opfer"angewendet wurde. Aber auch das trifft nicht des Pudels Kern. —Als Umadje bezeichnen die Lakka vielmehr die Verstorbenen, die Ahnen, die in ihrem Anschauungs- und Weltbetrachtungsfeld eine vielfüllende Macht bedeuten. So sagen die Lakka z. B., daß die Umadje den Leuten, die ihnen wohlgetan haben, die Freundschaft in der Weise vergalten, daß sie ihnen im Schlafe gern das in die Hand drückten, was sie am andern Tage brauchen, sei das nun Medizin oder Jagdgerät oder was sonst. Die Umadje sind also die typischen Ahnengeister, und es ist durchaus sinngemäß, wenn die Leute sagen, daß diese seit uralten Zeiten überkommenen Sitten von den Ahnengeistern stammen. —
Im übrigen bestehen exogamische Speiseverbote für die einzelnen Gokum. So gibt es eine Familie, die ißt nicht Löwe und Leopard, eine, die ißt nicht "Ndi" (Sumbala der Mande, Doria der Haussa),
eine, die ißt nicht Abu (Flußpferd). Die Mitglieder der letzteren sagen, sie würden, wenn sie sich dennoch an dem Verbotenen vergriffen, von der Lepra (=Bandji) befallen werden. —Gleiche Speiseverbote schließen die Ehe aus. Eine Frau, die heiratet, muß in der Ehe außer den eigenen auch die Speiseverbote des Gokum ihres Mannes einhalten. Die Kinder folgen im Speiseverbote nur dem Vater und nicht der Mutter.Interessant scheint mir folgende Zusammenstellung:
Kum = Nabelschnur,
Gokum = totemistisch Cian, Familie,
Kumma = die dem Ahnendienst gewidmeten Geräte.
Krankheit Verzauberung, Tod, Begräbnis. — Wenn ein Mensch erkrankt, wird er auf sein Bett gelegt und zunächst einmal der Wuare unterworfen. Wuare ist Massage unter Anwendung von Blättern, die in heißem Wasser gelegen haben. Danach aber wendet man sich an einen Arzt, von dem man sinngemäße Behandlung erwartet. Der Arzt wird Njekumma genannt, d. h. also Herr der Medizin, denn dies kann nicht gut etwas anderes sein als das Wort, das wir oben für heiliges Gerät feststellten. Trotzdem behaupten die Lakka steif und fest, daß diese Ärzte keinerlei religiöse Funktionen hätten. Es soll ein Arztgewerbe geben, genau wie das jedes andern Berufs, und man lerne die Praxis entweder vom Vater oder man gehe für Geld in die Lehre zu einem andern angesehenen Arzte. Meist gibt aber auch ein Vater, der selbst Arzt ist und seinen Sohn Medizin studieren lassen will, den Burschen bei einem andern Meister in die Lehre, so daß er außer der väterlichen Praxis noch fremdes Wissen dazu gewinnt. Übrigens sehr schwer kann das Studieren der Medizin bei den Lakka nicht sein. So ein angehender Medizinmann hilft zwei Monate lang beim Handwerk und "weiß dann alles". —Der Njekumma verwendet in seiner Praxis warme und kalte Getränke, Pulver, vegetarische und mineralogische Medikamente und, wenn ich recht verstanden habe, Klistiere.
Wenn aber auch dieses Weisen Kunst versagt, dann wendet sich die besorgte Familie an einen Wahrsager, einen Orakelmann.
Wenn ein Mensch stirbt, wird sein Leichnam erst gewaschen und dann nackt in eine Sekkomatte gelegt. In der Matte wird er nicht fest eingeschnürt, sondern locker gelagert, so daß er auf der linken Seite liegt, die linke Hand unter der linken Wange. Alles schreit und klagt einen Tag lang, für jung und alt, für Mann und Weib. Dann wird am gleichen Tage, stets außerhalb des Gehöftes, ein Grab ausgehoben, das aus einem tiefen vertikalen Schacht und einer nach Osten gerichteten Grabkammer besteht. Vorsichtig wird die Leiche hineingebracht und mit dem Kopfe nach Osten, den Beinen nach Westen,
wie gesagt, auf die linke Seite (also nach Süden blickend) gelegt, eingelagert. Der Tote bekommt nichts mit ins Grab, außer der Sekkomatte absolut nichts. Nicht einmal den Ndarr genannten Lederschurz läßt man ihm. Der Grabeingang wird mit einem umgekehrten Topf geschlossen, und rund um dessen Rand werden zur Befestigung Kalebassenstücke gedrückt.Am Grabe wird durch Ausgießen Bier geopfert und dann zehn Tage gefeiert, d. h. geschlachtet, gekocht, getanzt und getrunken. Damit ist die Sache aber auch ein für allemal erledigt. Wie jeder Tote sein eigenes Grab hat, so hat er auch nur ein Totenfest, und gewöhnlich treten die Überlebenden nur dann wieder mit ihm in Verbindung, wenn sie etwa Kindersegen für die jungen Männer herabflehen wollen, d. h. also, wenn der Tote nicht von selbst im jungen Nachwuchs wiederkehrt und hierzu erst durch die oben beschriebene Sorghummehl- und Taschenkrebszeremonie veranlaßt werden muß.
Abgesehen von den Umadje und den bösen Njembe oder Zauberer scheint man aber auch noch an den Umgang anderer Geister zu glauben. So hörte ich vage Berichte von einer Art Geister, die als Affen am Wasser nahe den Badeplätzen hausen, sich plötzlich auf die Badenden stürzen, sie in den Nacken schlagen, so daß das Blut herausspritzt, und sie so töten, sowie von einer andern Art von Geistern, die sich in eine Buschkatze verwandeln, die den Menschen das Herz stehlen und es in großen Bäumen aufhängen. Nächtliche Spukgestalten spielen also in der Phantasie jener Völker im Osten Adamauas eine große Rolle.
7. Kapitel: Die Baja*
Die Baja stellen das entfernteste Volk dar, dessen Vertreter unserem ethnologischen Untersuchungsverfahren am Benue unterworfen wurden. Sie wohnen außerhalb des Reisegebietes, nämlich in jenem Landteile, auf dem die Queliflüsse der Logone —Schari, der Sanga-Kongo und des direkt zur Küste abwässernden Sanaga entspringen. Ihr umfangreiches Land gehörte damals teils dem deutschen Kamerun, teils der französischen Kongokolonie zu.
Die Baja müssen mit zu den wildesten und brutalsten Völkern gerechnet werden, die Westafrika noch bietet. Noch heute gehört der Kanibalismus mit zu den selbstverständlichen Eigenarten dieser Stammesgruppe, und der Totschlag im Affekt ist bei ihnen sehr häufig; man betrachtet das dort ebenso wie im Lakkagebiet als herkömmlich. Vordem wollen die Baja selbst eine größere, geschlossene
Ihrem Kulturbesitz nach stehen sie zwischen den Äthiopen Kameruns einerseits und den Westafrikanern anderseits. Sie stellen durchaus die Übergangsform zu den Kongotypen dar, ihren Waffen (siehe das diskale Wurfeisen, den Rohrschild und den einfach umwickelten Rotangsehnenbbgen) und ihrer Lebensweise nach, dann aber auch darin, daß bei ihnen entschieden Sorghum dem Maniok gegenüber stark zurücktritt.
Die Vertreter, die mir zur Verfügung standen, wurden mir als ausnahmsweise kluge Individuen ihrer Art beschrieben. Ich habe große Mühe mit ihnen gehabt und kann deshalb eine besondere Intelligenz des mir bekanntgewordenen Bruchteils der Baja nicht gerade feststellen. Im Bajalande soll noch mehr Alkohol getrunken werden wie im zentralen Kamerun, da es mehrere Brautypen gibt. Vielleicht darf man diese Tatsache mit dem Geisteszustand in Verbindung bringen. Sicherlich sind die Baja ein hochinteressantes Volk und ich bedaure, daß ich nicht mehr und Genaueres über ihre teilweise höchst originellen Gebräuche vernehmen konnte. —
Wenn ein Fürst gestorben war, wurde seine Leiche zunächst gewaschen; die Haare ließ man stehen, rieb aber den Körper und Kopf über und über mit roter Farbe ein. Diese ward ausschließlich aus Erde (und nicht, wie ein wenig östlich, aus Rotholz) bereitet und Koll oder Kall genannt. Danach schnitt man die linke Seite der Leiche in der Weiche auf. Die linke Seite heißt hier wie bei Durru "Frauenseite", die rechte "Männerseite". Aus der Öffnung zog man vorsichtig alles Jasawi, d. i. Gedärme, heraus. Man füllte sie in einen Topf und goß kaltes Wasser darauf. Dieser Topf ward zugedeckt und später beim Begräbnis mit beigesetzt. Hernach zog man die Leiche
zusammen, so daß die beiden Hände, bei leicht nach links geneigtem Kopfe, jede auf je eine Seite des Gesichts gelegt, und die hochgezogenen Beine mit den Knien an die Brust gepreßt wurden.Mittlerweile tötete man fünf weiße Ziegenböcke (weiß =budua; schwarz =tudua). Deren Häute zog man fest über die zusammengelegte Leiche. Es ist interessant, daß genau an der entgegengesetzten Seite meines Kameruner Interessengebietes die Farbe eine so entgegengesetzte Bestimmung im Totendienst findet. Bei den Mulgoi-Kanuri werden nur schwarze Bullenhäute, bei den Baja nur weiße Ziegenbockshäute um die peruanisch zusammengepreßte Leiche gezogen. Neben der Leiche ward dann ein Feuer angezündet. Neun Tage lang ward sie hier gedörrt und nachdem das Fett herausgetropft ist, soll sie in der Tat ziemlich dürr wie Holz geworden sein. Diese neun Tage waren ein Fest. Es ward getanzt und viel Bier (do oder don) getrunken; daneben aber auch ein wenig geklagt und geheult. Im Busch ging noch anderes Zeremoniell vor sich.
Im Busch, und zwar südlich oder westlich jeder Ortschaft fand sich ein großer freier Platz für Männer, der Tua heißt, und von dem wir noch Näheres bei Gelegenheit der Beschneidungsbeschreibung hören werden. Auf diesem Platz kommen stets nur Männer zusammen, in diesen Tagen aber ganz besonders zahlreich. Es stand auf dem Platze ein Haus, das barg in Kalebassen verpackt eine hölzerne Maske, die den Namen Noe-Noe oder Noi-noi führt. Sie war aus Holz geschnitzt, stellte ein Menschenantlitz dar und hatte einen langen Behang. Während aller neun Tage ward nun im Busch getrunken und zur Trommel getanzt, und die Maske spielte dabei eine große Rolle. Frauen war der Zutritt strengstens versagt, aber nicht wegen der Maske, sondern wegen der Heiligkeit der Örtlichkeit.
Inzwischen war für den König das Grab gegraben. Aus den mehrfachen Beschreibungen bin ich nicht vollkommen klar geworden. Jedenfalls war die Stelle an einer Örtlichkeit gelegen, die in der Trockenzeit frei von Wasser, in der Regenzeit aber größtenteils von fließendem Wasser bedeckt war. Die Fürsten ihrerseits nun scheinen die Eigentümlichkeit gehabt zu haben, in der Regenzeit zu sterben, und daß die Sterbestunde des Herrschers nicht von der Natur, sondern von dem Willen bestimmter Menschen abhängt, das ist eine echt äthiopische Einrichtung. — Also die Stelle, an der just in der Regenzeit, in der die Fürsten die Eigenschaft hatten zu sterben, das Grab dem Verstorbenen hergerichtet wurde, war mit Wasser bedeckt, und deshalb wurde eine Maßnahme getroffen, die uns wohl alle an eine bekannte Erzählung aus dem Norden erinnert; nämlich genau wie die Goten ihren Alarich im Busento, so setzten diese Nachkommen und Verwandten der alten Äthiopen ihre Fürsten bei.
Um die betreffende Stelle, an der der Tote seine Ruhestätte finden
sollte, wurden der Sage nach Stöcke gesteckt. Außen wurden Gräben gelegt, dann der Stockzaun mit Sekko und Erde zu einem Wall ausgebaut. Durch die Seitengräben floß das Wasser ab; die Grabstelle ward so trocken gelegt. Es konnte nun mit dem Bau eines tiefen Schachtes begonnen werden, der in alten Zeiten ungefähr zwei Mann tief gewesen sein soll. Von der Sohle des Schachtes aus wurde dann eine Grabkammer nach Osten hin angelegt. Sie nahm den Toten auf, der mit dem Antlitz nach Süden auf die linke Backe und Seite, die rechte Hand obenauf liegend, gebettet ward. Neben die Leiche stellte man noch den Topf, der die Eingeweide barg. Sonst aber fügte man dem Leichnam nichts weiter bei.Die Öffnung des Schachtes ward dann mit einem großen Topfe geschlossen. Von allen Seiten wurde Erde darum gestrichen und — wenn ich richtig verstanden habe — in ganz alten Zeiten eine richtige kleine Mauer aus Lehmklößen um den Topf aufgeführt, so daß das Wasser seinen Rand nicht unterwühlen und in die Grabstätte stürzen konnte. Der Boden, aus dem die Spitze des Topfes herausragte, ward jedenfalls mit großer Sorgfalt geglättet. Um den so entstandenen Kegel aber wurden dann endlich Stöcke gesteckt von der Art, die Wurzel schlägt. Im nächsten Frühjahr, d. h. mit beginnender neuer Regenzeit, schlugen diese aus und bildeten so einen Kranz von Bäumen, die mit ihren Wurzeln das Grab mehr und mehr festlegten.
Zunächst wurde aber das künstliche Mauerwerk, das den Fluß zurückhielt, weggerissen und der Fluß aus den neuen Gräben wieder in sein altes Bett zurückgeführt. Das Grab ward derart von Wasser überrieselt. Aber nur für einige Zeit, wie die Baja sagen. Später floß dann das Wasser auch in der Regenzeit immer weiter um das Grab. Ich kann das nur so verstehen, daß das Wasser an der das Grab umgebenden Baumwand seinen Schwemmsand niederlegte und so eine von Jahr zu Jahr wachsende Insel schuf.
Dieses soll alte und allein vollgültige Sitte gewesen sein, wenn es sich um die Bestattung eines großen Fürsten handelte. Wieviel davon Sage, wieviel Wahrheit ist, wird auch dem, der im Bajalande reist, nur dann möglich sein näher festzustellen, wenn er das Glück hat, einer solchen archaistischen Zeremonie beizuwohnen, oder wenn der Spaten der nordischen Kultur ein wohlerhaltenes Königsgrab der Baja anschneidet. Mit Bestimmtheit dürfen wir aber sagen, daß solche alte Tradition höchstens in den Dimensionen, nie aber in den Grundtatsachen von der Wahrheit abzuweichen pflegt. —
Im Beginn der nächsten Saatzeit hat dann der Bruder des Königs, der die meisten Opfer im Auftrage des Fürsten auszuführen hat, acht rote oder rotgelbe Hähne an diesem Grabe zu schlachten. Die Hähne werden beim Opfern sehr fest gehalten. Vor ihrem völligen Verscheiden
dürfen sie nicht zappeln und zucken, noch viel weniger aber zur Erde fallen. Sonst würde in Bälde noch ein anderer großer Mann der Fürstenfamilie verscheiden. Vor dem Halsumdrehen dieses ersten Hahnes betet nun der opfernde Bruder des Königs: "Wenn ich es war, der meinen Bruder getötet hat, so soll mein Kopf umgedreht werden, so wie ich diesem Hahn den Hals umdrehe." Danach vollzieht er das Opfer. Er nimmt einen zweiten Hahn, ebenso festgebunden und festgehalten wie der erste, hält ihn über das Grab und betet: "Wenn irgendein anderer Mann den König getötet hat, so soll ihm der Kopf umgedreht werden, so wie ich diesem Hahn den Kopf umdrehe."Wieder muß ein Hahn das Leben lassen und dann folgen ihm die andern sechs Genossen, ohne daß der Opfernde dabei weitere Schwurgebete spricht.Ein zweites Opfer am Grabe des toten Königs wird im Beginn der Reifezeit abgehalten, und zwar fällt die Vollziehung auch dieser Zeremonie dem Bruder des Königs zu. Es werden zwei rote Ziegenböcke und eine weiße Ziege mit herausgebracht. Erst wird ein roter Ziegenbock geschlachtet und von dem fürstlichen Priester etwa folgendermaßen gebetet: "Dieses schlachte ich, damit niemand krank werde und nichts mißlinge. Alles Schlechte soll hierauf kommen!" Das ist dann gleichbedeutend mit einer Fluchabladung. Und der Fluch bleibt nun auf dem Bock hängen. Kein angesehener und junger Mensch wird nun von dem Fleische dieses Tieres essen wollen. Aber es wird den alten Leuten als Speise zubereitet; an denen liegt den Baja sowieso nicht sehr viel. Sie werden auf diese Weise vielleicht desto eher sterben, denn der Fluch geht jedenfalls auf die über, die das Fleisch dieses Tieres genießen.
Danach schlachtet der Königsbruder die andern beiden Tiere und bittet dabei, daß alles gut gehen, daß die Ernte gut ausfallen, daß die Mutterschaft des Landes fruchtbar sein möge. Diese beiden Tiere werden auch gekocht und zubereitet und von dem Fleisch kann jeder genießen, denn darauf lastet kein Fluch. Dieses und alle ähnlichen Opfer vollzieht der Bruder des Königs, der — wie einst Aron — die Stellung eines Volkspriesters einzunehmen scheint. Er wird in dieser Eigenschaft Konowell genannt und neben ihm gibt es keinen andern Opferer.
Von dem Tage an, wo das Reifeopfer am Königsgrabe gebracht ist, dürfen die Baja aber nicht mehr bei ihren Frauen schlafen, darf auch zunächst und bis auf weiteres niemand von dem neuen Sorghum genießen. Dieses erste Fest setzt der Konowell nach dem Monde fest, d. h. wenn in der Reifezeit der Mond das erstemal seine schmale Streifensichel zeigt, ist der Zeitpunkt seiner Absolvierung gekommen. Und mit dem Aufleuchten dieser ersten Mondsichel beginnt dann auch die Enthaltung vom Genuß des jungen Sorghum und der Weiblichkeit.
Ein zweites Fest hebt diese Bestimmung auf. Der Tag seiner Begehung wird durch den König selbst festgesetzt. Er findet seine natürliche Fixierung durch die völlige Reife des Sorghum. Sobald der Fürst die Parole ausgegeben hat, beginnt man in jeder Familie vom neuen Korn viel Bier zu bereiten. Das Zeremoniell ist nur der Zeit und der Form, nicht aber dem Orte nach übereinstimmend. Es ist ein Familien- und Ahnenfest. Der Familienälteste begibt sich mit Bier zum Grabe eines Großvaters oder anderer Ahnen. Sein Gebet lautet angeblich folgendermaßen: "Du bist gestorben? Das war Deine Sache (soll so viel heißen: ,wenn Du gestorben bist, so laß das nicht uns entgelten, die daran schuldlos sind'). Nun aber sieh, daß meine Familie Kinder bekomme, und daß meine Farm viel Frucht trage. Sieh, daß meine Familie gesund sei!" Nach diesem Gebete wird das Bier auf das Grab gegossen und nun wird heimgegangen. Im heimischen Gehöft hebt aber ein großes Bier- und Breifest an, denn nun darf jeder von dem neuen Erntegut genießen und außerdem so setzte mein alter Berichterstatter mit besonderem Behagen hinzu — darf nun jeder wieder mit seiner Frau schlafen.
Alle Heiligtümer und alle Zeremonien hängen in dem Teile des Bajalandes, aus dem meine Berichterstatter kamen, mit dem Königsstamme zusammen. Der König ist gewissermaßen auch erster Priester, Priesterkönig. Aber weder er noch das Volk besitzen Schwirrhölzer oder Schwirreisen oder Lären, d. h. heilige Blasinstrumente oder aber Holzfiguren. Von jener einzigen Maske haben wir schon gehört und werden wir noch mehr hören. Das größte Stammesheiligtum findet sich aber im Königshause. Jeder Fürst hat eine heilige große Schlange (-Dua). Sie lebt in seinem Schlafgemache, und der hohe Herr gibt ihr eigenhändig jeden Tag die Speisung. Der Fürst betet diese Schlange an. Er bittet sie um alles, je nach der Gelegenheit; um Waffenerfolg im Kriege, um reichen Ernteerfolg, um Kinder usw. Er redet sie an mit dem Wort Nakom, d. h. Großvater, was mir aber mehr ein schmeichelndes Wort, ehrwürdigem Alter dargebracht, als eine Andeutung mystischer Familien-und Herkunftsbeziehung zu sein scheint. Diese Schlange wird auch um Regen gebeten, wenn im Frühjahr die Saat im Boden liegt, und keine Befruchtung durch Himmelsnaß erfolgt.
Nur der Fürst hat eine solche heilige Schlange, sonst niemand. Aber wenn die Schlange stirbt, muß auch der König der alten Sage nach unbedingt sterben. Hier scheint schon einer der gewaltsamen Abschlüsse äthiopischen Königtumes vorzuliegen. Umgekehrt aber tötet man nicht etwa die Schlange, wenn der König stirbt. Die Schlange läßt man weiter leben und übergibt sie dem neuen König. Wenn aber ein neuer König keine Schlange vorfindet, weil der Tod der alten ja eben der Grund des Ablebens seines Vorgängers ist, SO
wendet er sich an seinen Mutterbruder und erbittet von diesem ein neues Tier. Wo dann der Mutterbruder die neue Schlange gewinnt, konnte niemand sagen.Der Tod dieses priesterlichen Königs ist aber keine so sehr fernliegende Sache. Nach guter alter Bajasitte nahm man nicht an, daß ein König länger als vierzehn Jahre leben würde. Nun habe ich anfangs nicht genau verstanden, wie das gemeint ist. Aber meine Baja grinsten ganz verschmitzt bei dieser Angabe. Nach meinen Erkundungen scheint die Sache sich folgendermaßen abzuspielen:
Derjenige, der altem Ritus zufolge die Lebenszeit der Regenten verkürzte, war der eigene Sohn, wenn der Vater nach vierzehnjähriger Regierungszeit ihm nicht freiwilligplatz machte. Die Familie (Familie =Njakong oder Njankong) hatte folgende Speiseverbote: 1. Go = Leopard, 2. Diga Löwe, 3. Mbongo Hyäne, 4. Domo (?) = Karnickel, 5. weiße Hähne und 6. das Fleisch von Menschen, d. h. nur Männern; (wir werden sehen, daß im Gegenteil Mädchen- und Frauenfleisch zu den bevorzugten Gerichten der Königstafel gehört). Der König muß nun am gleichen Tage, wo er Leopard oder etwas Derartiges verzehrt, unbedingt sterben, und demnach ist es für den Sohn nicht schwer ,seinen Vater zu beseitigen. Er besorgt sich zunächst das Schnurrbarthaar eines Leoparden, dann einen Topf sehr guten Bieres. Das Leopardenhaar wird in das Bier getan und dann dem Herrscher vom eigenen Sohne überbracht. Der Sohn sagt: "Mein Vater, ich erhielt von einem Freunde ein sehr gutes Bier. Es ist so gut, daß ich Dich bitte, es zu trinken." Der König wird nun gierig, wie alle Baja hinter dem Sorghumsaft her sind, das annehmen. Er wird trinken. Er wird in dem Augenblick, in dem das Leopardenhaar ihm in den Hals kommt, sterben. Er erstickt daran. Ich fragte den erzählenden Baja, ob der Sohn vielleicht auch noch ein wenig Gift in das Bier tue. Er lachte aber nur und ein beisitzender Durru erklärte, daß man im Bajalande gewohnheitsgemäß nicht vom Vergiften spreche; man sage nicht alles, was man tue.
Ganz außerordentlich verehrt am Königshofe ist Kote, der Schmied. Diese Nen-Kote gelten als dem König am nächsten stehend. Alle Baja verschwägern sich durchaus gern mit den Schmied-Familien. Man sieht sie als kluge und geschickte Menschen an, nicht aber als eine irgendwie abgesonderte Kaste. Aber da der Sohn das Handwerk immer vom Vater lernt, so ergibt sich eine familiäre Geschlossenheit oder Sippenbildung der Schmiede ganz von selbst.
Mannes, der Odekirri genannt wird. Eines Abends bei Sonnenuntergang versammelt er alle Burschen, die etwa zwölf oder vierzehn Jahre alt sind und führt sie zu dem Platze im Busch, der Tua heißt, und den wir oben schon kennengelernt haben als Tua der Männer (denn es gibt auch einen Tua der Weiber) und Aufbewahrungsort für die Maske Noi-Noi. Der Vater begleitet seinen Sprossen dahin. Der Odekirri hat keine besondere Kleidung. Er ist nur eingeölt. Die Handlung wird meist vor Sonnenuntergang ausgeführt und die ganze Gesellschaft von zehn bis zwölf Jünglingen in schneller Reihenfolge ihres Präputiums (Nua) beraubt, und dieses fortgeworfen. Der Bursche steht dabei aufrecht. Es gilt als große Schande, wenn er schreit oder wimmert. Dabei wird mit Trommel und Tanz gelärmt.
Die beschnittenen Burschen tragen im Busch einen Schurz, der aus der Rinde des Baobab geklopft ist. Solcher Rindenstoff heißt So. Er ist mit roter Farbe bemalt und ist nur einfach umgelegt. Während dreier Monate verweilen die Jungen auf dem Tua und währenddessen dürfen sie kein Weib sehen. Die Frauen bereiten die Nahrung im Busch und senden sie durch die Väter und Onkel auf den Tua. Bei den Beschnittenen aber bleiben die älteren Brüder, die, die das vorige Mal der Beschneidung unterworfen wurden. Diese waschen und verbinden die Wunden und sorgen für die nötige Bewegung.
Wenn die Gesellschaft nach völliger Genesung und Vernarbung in den Ort kommt, gibt es viel Freude. Es ist Bier gebraut und eine Ziege geschlachtet. Jeder einzelne Vater kommt herbei und sucht sich seinen Sohn heraus. Wenn nun aber ein Vater seinen Sohn nicht findet, weil der nämlich in der Zwischenzeit im Busche starb, dann nimmt er einen der Wärter jener Burschen der vorigen Beschneidungsperiode beiseite, und fragt den aus, und der teilt ihm dann das Unglück mit.
In voller Wut rennt der Vater dann zu seiner Frau, der Mutter des Verstorbenen und führt eine Tat aus, die die ganze Brutalität und Bestialität dieses Volkes an den Tag legt. Er schreit die Frau an und sagt: "Mein Junge, den ich durch Dich hatte, ist im Busch gestorben. Du mußt den Jungen im Busch getötet haben!" Die entsetzte Frau sagt: "Nein, ich habe es nicht getan. Ich habe Deinem(!) Sohne nichts getan!" Der Vater ist aber nicht zu besänftigen. Er fährt in großer Wut weiter fort: "Du mußt das getan haben. Erst habe ich Dich für hohe Ausgabe geheiratet, dann hast Du mir den Sohn geboren und nun hast Du ihn als Doa (Verhexerin) getötet. Ich aber will Dich nun auch töten!" Dann nimmt der Mann sein Messer und tötet die eigene Frau, die Mutter seines Sohnes, indem er ihr den Bauch aufschlitzt. Die Angelegenheit ist damit erledigt. Der Mann wird nicht zur Rechenschaft gezogen und die Frau wie jeder andere Mensch begraben.
Auch die Mädchen werden beschnitten und zwar in der Zeit der Reife, d. h. wenn sie heiratsfähig werden. Sie dürfen vor der Beschneidung auf keinen Fall mit einem Mann zu tun gehabt haben, sonst schwillt ihnen nach der Operation der Leib mächtig auf und ein Wurm bildet sich in ihrem Innern, an dem sie rettungslos sterben. Wie die Männer, so haben auch die Weiber im Busch einen eigenen Zeremonialplatz, der auch Tua heißt und im Osten der Ortschaft zu liegen pflegt. Es steht ein Haus darauf, über dessen wesentlichsten Inhalt wir nachher sprechen werden. Männer dürfen den Weibertua nicht betreten.
Auf diesen Weibertua führen die alten Frauen nun die Mädchen und schneiden ihnen zirka einen Zentimeter weit die Spitze der Klitoris (=Jüdong) ab. Die abgeschnittenen Stücke werden auf ein spitzes Holz gestellt und in die Grasdecke der Tuahäuser gesteckt, wo man denn alle Jahrgänge derart aktenmäßig geordnet vorfinden kann. Zwei Monate währt der Aufenthalt auf dem Weibertua und in der Zeit herrscht da ein reges Leben, während die Frauen sonst ihren Tua gar nicht zu besuchen oder zu betreten pflegen. Die operierten Mädchen tragen aber im Busch nur Blätter vom Baume Goschi, die vorn und hinten an der Lendenschnur befestigt und zwischen den Beinen durchgezogen sind.
Nach Begehung dieser Reifeopfer ist es aber der Bajajugend nicht wie bei den echteren Vertretern äthiopischer Kultur gestattet, Freundschaften einzugehen, die oftmals als harmlos geschildert, doch alles in allem einen Übergang zum Geschlechtsleben bedeuten. Bei den Baja herrscht vielmehr strengste Abgeschlossenheit der Geschlechter und der Vater, der einen Liebhaber mit seiner Tochter zusammen ertappt, nimmt dem sein ganzes Besitztum fort. Es herrscht überhaupt wie auf allen Gebieten, so besonders auf dem des Geschlechtslebens die volle starre, rigoros brutale Durchführung des Männerrechtes, wie sie für die Baja ganz allgemein charakteristisch ist. Solche fast tierische Grausamkeit wie bei den Baja soll überhaupt nur noch bei den Lakka herrschen, unter denen allgemeiner Überzeugung nach die neben den Baja gewalttätigsten Menschen zu suchen seien. Wenn also ein Baja einen Liebhaber bei seiner Frau findet, pflegt der Baja wie der Lakka ihn einfach totzuschlagen, und solche Totschlägerei ist bei den Baja allgemein und häufig. Danach entsteht dann ein Kampf zwischen beiden Familien, dessen Folge meist eine Anhäufung von Todesfällen ist, in dem aber der "regierende Fürst" nach echt äthiopischem Rezept höchstens mitschlagend und parteinehmend, nicht aber ausgleichend wirken kann.
Der Mann, der ein Mädchen heiraten will, hat nach Bajaverhältnissen schwer zu zahlen, und zwar erhält der Schwiegervater Schaufelgeld (Warra), Speere (Schere oder Jere), Ziegen, Hühner und
Matten. Fernerhin muß er für den Schwiegervater einen Monat lang Knechtsdienste tun. Während dieser Zeit muß der Vater des Burschen diese umfangreichen Gaben zusammenbringen und abliefern. Alle Baja sollen sich darüber einig sein, daß eine Frau zu teuer bezahlt wird.Der Monat Knechtdienst ist keine Ubertreibung. Der Bursche muß als echter und rechter Knecht in das Haus seines Schwiegervaters ziehen und da arbeiten, was sein Brotherr verlangt: Farmwerk, Hausbau, Jagd, Holztragen usw. Und was er erlegt oder erarbeitet, gehört auch seinem Schwiegervater. Der Ort, an dem der Knecht-Bräutigam schläft, ist aber kein anderer als das Schlafgemach seiner Braut. So sehen wir die alte Form der Jugendliebe und Freundschaft der Äthiopen bei den Baja wieder auftauchen, — nur mit der Modifikation, daß der Bräutigam, wenn der Schwiegervater es nicht ausdrücklich genehmigt (was allerdings bei Zahlungsunsicherheit des Bräutigams manchmal vorzukommen scheint) — auf keinen Fall sein Mädchen beschlafen darf. Auch hier hängt das schneidige Messer der Bajawut ununterbrochen über seinem Haupte.
Wenn aber innerhalb dieser Monate der Vater des verknechteten Bräutigams alles bezahlt hat, dann zieht er aus der Brotstelle unter Mitnahme der Braut ins Vaterhaus zurück. Da herrscht natürlich ob der Vermehrung der Arbeitskraft große Freude. Es wird allerhand geschlachtet und gekocht. Es ist Bier bereitet und abends gibt es dann Tanz. In dieser Nacht kommt das junge Ehepaar jedenfalls nicht zu behaglicher Hingabe. Der natürliche Ehevollzug beginnt vielmehr erst in der folgenden Nacht. Irgendwelche verschämte Zurückhaltung oder gar kampfbereite Verteidigung der Braut oder ein Flittergeschenk sind hier nicht Sitte. Dennoch rechnen die Baja, wie andere Kameruner, daß man zur Vollendung der Perforation des Hymens fünf Tage benötige. Sie drücken das wenig verblümt so aus, "daß der Mann mit dem Beschlafen langsam (,,klein, klein") beginne und daß dann am fünften Tage Blut flösse". Ich nehme also an, daß eine hastige Überstürzung hier nicht zum guten Ton gehöre. Wenn nun die roten Male Beleg ablegen für die Keuschheit der jungen Frau, so ist es auch hier Sitte, dem Schwiegervater ein kleines Geschenk zu senden.
Die Ehemöglichkeiten sind totemistisch begrenzt. Das Bajavolk zerfällt in verschiedene Njakongs, das sind Familien, deren jede ihre eigenen Speiseverbote hat. Solcher Totemismus schließt Exogamie ein. Man kann wohl ein Mädchen aus dem gleichen Dorfe heiraten, nicht aber eine aus gleichem Njakong, — auch dann nicht, wenn irgendwelche Blutsverwandtschaft sich direkt nicht nachweisen läßt. Ein nicht familien- sondern geschlechterweises Verbot besteht für die Frauen außerdem darin, daß keine von ihnen Fisch essen
darf. Wenn eine das Gebot übertritt, so wird sie nicht schwanger. — Daß den Weibern auch Menschenfleischkost untersagt ist, stellt nur eine, wie es scheint, bei allen kannibalischen Völkern Afrikas wiederkehrende Einschränkung dar. Der Beischlaf wird in äthiopischer Weise ausgeführt. Die Frau liegt also auf der Erde und der vor ihren Geschlechtsteilen niederhockende Mann zieht deren Beine zwischen Oberschenkel und Weichen um seinen eigenen Leib herum.Altersklassen lauten bei den Baja:
Bem =Säuglinge. Kurenja = kleine Jungen vor der Beschneidung. Uba = Beschnittene. Sapti = Verheiratete. Mbangawa = Männer in den besten Jahren. Gwaenana Greise. |
Einteilung und Auffassung der Gruppierung entspricht genau der überall bei den West-Athiopen üblichen Art. Vom Kurenja erwartet man noch keine verantwortungsvolle Arbeit, vom Uba erwartet man Erwachen des Interesses für den Stamm und Loslösung vom mütterlichen Schürzenband; der Sapti arbeitet für seinen Vater, der als Mbangawa die schönste Zeit des Männerlebens verbringt und der Gwaenana endlich wird als ein überflüssiges Ubel angesehen, das man notgedrungen weiter ernährt. Es muß aber bemerkt werden, daß nach übereinstimmenden Angaben die Baja nicht so viele und so alte Männer haben wie die andern Stämme und ich glaube, daß man das einfach mit dem brutalen, kriegerischen Sinn des Volkes, das jedenfalls auf Altersschwäche der Angehörigen in keiner Weise Rücksicht nimmt, in Zusammenhang bringen muß. Das Bem tritt in der mütterlichen Hütte ins Außenleben. Die Wöchnerin sitzt zurückgelehnt da, eine alte Helferin stützt sie im Rücken und hält sie umschlungen, eine andere hockt zwischen den geöffneten Schenkeln, bereit, das junge Wesen zu empfangen. Der Nabel (Kon) wird mit einem Rasiermesser abgeschnitten. Batue (oder Nachgeburt) wird herausgetragen und vor der Türe im Boden begraben. Der Nabel fällt auch hier je nach dem Geschlecht, bei Buben nach drei, bei Mädchen nach vier Tagen ab. Nach einem Jahr soll das Kind sprechen und laufen können. Zunächst trägt die Mutter es im Tragleder, das wie das der Komai gebildet ist, auf dem Rücken herum. Das Tragleder heißt bei den Baja jerri, bei Durru kunri und bei Bum ngangsamma. Sonst werden aber alle Lasten auf dem Kopf getragen. In dortiger Gegend tragen nur die Bute den Schulterriementragkorb. Die Baja sind im allgemeinen ein Felle bevorzugendes
Volk, kennen demnach nicht die Tragsäcke aus Flechtwerk, sondern nur die aus Fell und Leder.Ebensowenig ist der Webstuhl bei ihnen heimisch. Sie tragen zumeist Rindenstoffe. Die Arbeitsteilung ist eine übliche: Die Männer haben den größten Teil an der Farmarbeit, machen Körbe und Matten und Sekko-( =kin) wände, führen den Hausbau aus, schmieden, formen und brennen aber auch ihre Tabakspfeifen. Die Töpferei liegt in den Händen der Frauen.
Die Volks- und Familiensitten richten sich im Todesfalle auch bei den Baja nach der Altersklasse, aus der den Sterbenden der Tod herausreißt. Gehörte er noch der arbeits- und zeugungsfähigen jungen Welt an, so ist große Trauer, wildes Schreien üblich; es gilt als Unglück. Wenn aber ein verbrauchter Mensch aus der Sippe verschied, dann erhebt sie freudiges Geschrei, braut Bier, tanzt und ergeht sich in Ausgelassenheit. Nach einer Nacht, d. h. am Morgen nach dem Tode wird der Leichnam schon im Busch bestattet. Jeder Tote erhält sein eigenes Grab. Es ist ein mehr oder weniger tiefer Schacht, von dem eine Kammer nach Osten zu angelegt wird. Die Leiche wird mit den Händen auf den Backen und mit hochgezogenen Knien in eine Matte = Ndurru fest eingeschnürt. Sie wird, gleich ob Mann ob Weib, in der Kammer auf die Seite, mit nach Süden gerichtetem Kopfe gelegt. Danach wird das Grab zugeworfen. Wie man die Grabkammer vor einfallender Erde schützt, habe ich nicht verstanden. Wenn der Tote ein alter Mann war, wird für ihn noch ein Hahn geschlachtet.
Die Baja üben das uns bekannte Ahnenopfer, und zwar in der Frühzeit. Ehe noch der erste Regen fällt und die Saat ausgestreut wird, zieht der Älteste zu der repräsentativen Grabstätte heraus, schlachtet seinen Hahn und spricht für sich und seine Familie, für Farm und Nachwuchs und Gesundheit sein Gebet. Diesem Ahnenopfer entspricht auch der bekannte Beleg des Seelenwanderungsglaubens.
Wenn eine junge Frau längere Zeit verheiratet ist, ohne schwanger zu werden, so geht ihr Vater oder ihre Mutter mit ihr zum Grabe eines Ahnherrn der müllerlichen Familie, sei es nur, daß der Bruder, Mutterbruder oder Großvater darin ruhe. Die Alte (oder der Alte) nimmt weißen Stoff und Bier mit hinaus. Sie breitet den Stoff über dem Grabe des Toten aus, gießt opfernd das Bier hin und betet: "Ich bitte dich! Du hast mich geboren. Hier ist mein Kind! Sie ist verheiratet und ihr Mann beschläft sie. Aber sie bekommt kein Kind. Gib du, daß die junge Frau schwanger werde." Nach Absolvierung dieses Gebetes wird der weiße Stoff vom Grabe genommen und der jungen sterilen Frau umgebunden. Sie geht heim. Sie darf sich auf dem Heimwege aber nicht umwenden resp. nach dem Grabe zurücksehen.
Das weiße "Seelentuch" scheint mir eines Hinweises auf ähnliche Zeremonien und dementsprechenden Anschauungszusammenhang wert. Wenn die Nupe auswärts der Ortschaft einen Menschen verlieren, so geht ein Familienglied hin zu dem zuweilen sehr fernen Grabe. Ein weißes Tuch wird ausgebreitet, von der Erde auf dem Grabe ein wenig eingefüllt und dieses zurückgebracht. Wo daheim das Tuch mit der Erde dann bestattet ist, da bringt man dem Toten die Opfer dar. Man nimmt also an, daß die Seele des Toten darin heimgekehrt sei. Ähnliches sah ich bei den Bassariten. Hier nun ist im Bajalande eine Parallele vorhanden. —
Wenn einem Kind der Nabel abgefallen ist, also bei Knaben am dritten, bei Mädchen am vierten Tage, erhält es vom Vater seinen Namen, doch aus welcher Familie man ihn wählt, habe ich nicht klar erkennen können.
Das Erbschaftsrecht ist angeblich sehr einfach. Da man von jedem Menschen annimmt, daß er das ihm Notwendige selbst erwirbt, so fallen alle Immobilien (vor allem das Farmland) und auch die Mobilien dem Könige zu. So lautet wenigstens die Tradition. Die Baja geben aber selbst zu, daß das Gesetz nicht scharf angewendet werde. — Eine Frau gibt ihrer Trauer um den Verlust des Gatten in der Weise kund, daß sie die Haare abschneidet. Das allgemein übliche Trauerabzeichen der Kinder für ihre Eltern, der Geschwister und Gatten besteht aber darin, daß die Leute sich den Oberkörper mit Asche einreiben und dadurch weißen.
Wenn ein Bajafürst ein dralles, appetitliches Mädchen sieht, so läßt er sie wohl einfangen und einschließen, aber nicht, um mit ihr schöne Nächte zu verbringen, sondern um sie mästen, feist werden und dann schlachten und rösten zu lassen. Sie wird in seiner "Hofburg" aufbewahrt, wird mit allem versehen, was sie in einen guten Leibeszustand versetzen kann, und wenn sie dann für die königliche Tafel gut vorbereitet scheint, dann schickt der Fürst sie mit seinen Leuten in den Busch. Da wird sie geschlachtet, ihr Fleisch geröstet und nachts dann in die Hofburg gebracht, um für einige Tage den Gaumen des hohen Herrn und seiner Günstlinge zu laben. Der König verzehrt aber nur Mädchen- und Frauen-, kein Männerfleisch.
Der Kannibalismus ist bis heute noch, oder war es jedenfalls bis in die jüngsten Tage hinein, eine durchaus allgemein verbreitete Sitte im Bajalande. Es wird offen ausgesprochen, daß kein Fleisch
so ausgezeichnet sei, wie das von Menschen. Auf Märkten wurde Menschenfleisch allerdings nie verkauft, einmal, weil es nämlich keine Märkte gab und dann, weil alle Menschenfresserei geheim betrieben wurde. Die Frauen durften nichts davon sehen und nichts davon genießen. Sie wären sonst sicherlich steril geworden. Aber wenn man das Fleisch auch nicht gerade feil hielt, so tauschte man doch hier ein Bein und da einen Arm. Denn zum Menschenfleisch gehörte ein Trunk Bier, und Bier hatte man nicht immer, wenn man den Leckerbissen hatte, wohl aber sicher einen Nachbarn, und so gab man das eine oder andere Stück gern weg, um einen guten Trunk dafür zu erhalten.Entweder man erlangte diese edle Speise im Kriege oder durch Schlachten. Hatte man im andern Dorf einen Mann erschlagen oder erstochen und war der Leichnam zu schwer, um ihn ganz wegzuschaffen, so schnitt man ihm Arme oder Beine oder was man sonst bevorzugte ab, steckte es in den Ledersack und machte sich eilig auf den Heimweg —eilig, denn jeden Augenblick konnte der erboste und verstärkte Feind wieder zurückkommen. Hatte man aber einen Gefangenen, der für die Tafel bestimmt war, so schlachtete man den auch nicht daheim. Jedes Menschenfleischmahl findet im Busche statt. Da wird dann der Gefangene hingebracht und mit Halsschnitt getötet.
Zum Mahle versammelt sich dann die Verwandtschaft und die Freundschaft, aber alles nur altes Volk. Kein junger Mann, auch wenn er verheiratet ist, wird zugelassen. Menschenfleisch ist bei den Baja, wie bei andern Stämmen der Genuß von Eiern, ein Vorrecht des Alters. Im Busch errichtet man dann kleine Roste aus lendenhohen Gabelstöcken, über die Querstäbchen gelegt sind. Darauf wird das Fleisch geröstet. Menschenfleisch wird stets geröstet, nie gekocht genossen. Man macht unter dem Roste Feuer von Holz und Blättern. Das Zerlegen des edlen Wildes erfolgt in der Weise, daß erst die Glieder abgelöst werden. Danach schneidet man die Geschlechtsteile ab und wirft sie in den Busch. Über die Verteilung bestehen auch alte Übereinkünfte. So erhält das Rumpfstück immer ein altbewährter Krieger. Den Kopf aber gibt man dem Jäger, der ihn in besonderer Weise aufzubewahren hat.
Der Jäger hütet nämlich in seinem Bereiche eine kleine Pflanze, die hier Daeae (nasal gesprochen) heißt. Die Pflanze dient dem Medizinalwesen und wird bei allen möglichen Krankheiten angewendet. Ich darf darauf hinweisen, daß die Medizinen stets von den Jägern herrühren, die sie auf irgendeine Art von den Tieren der Legende nach empfingen. Nun ist diese Daeae keine andere als die Gadell (siehe Tschambabeschreibung unter Tauwa) der Nordvölker. — Indem der Kopf des Verzehrten auf die wichtige Gesundheitspflanze
gesetzt wird, die hier bei den Baja als mächtigste Kriegsmedizin schützender Art geschätzt wird, knüpft die brutale Gesittung der Baja doch wieder an die feingliedrige mythologische Auffassung der Äthiopen an. —
8. Kapitel: Die Bokko-Nandji *
Wohnort, Charakter, Religion, Ethik, Vergangenheit und Völkernamen. —In den Tälern und am Fuße des Ssarigebirges wohnen zwei Völker, die Nandji weiter nördlich, die Bokko im Südlande. Ihr Gebiet wird im Westen durch den Faro begrenzt, im Norden sind ihre Nachbarn die Batta und im Süden und Osten die Durru. Diese Nandji und Bokko sind eigentlich nicht zwei Völker, jedenfalls nicht im Sinne voll ausgeglichener, ausgereifter Nationalbildung. Sie repräsentieren zum ersten ihrem inneren Wesen nach auch heute noch den Typus altäthiopischen Gemeindezerfalles, größte Splitterung im Innern, ausgedrückt in dialektischer Sprachverschiedenheit, die es häufig sogar benachbarten Dörflern schwer macht, einander zu verstehen. Das tritt bei den Nandji ganz besonders hervor, und sehr bezeichnend ist die Erklärung eines Nandjihauptes: "Wenn die Nandjikinder klein sind, können sie nicht sprechen. Erst wenn sie ein Jahr alt sind, können sie mit Vater und Mutter sprechen. Mit allen Leuten, auch aus weiter gelegenen Gehöften, können sie sprechen, wenn sie drei Jahre alt sind. Wenn sie geheiratet haben, lernen sie die Sprache der nächsten Dörfer. Aber kein Mensch wird so alt, daß er die Sprachen aller Nandji lernen kann." In Wahrheit scheinen es mir nur dialektische Verschiedenheiten zu sein, die allerdings groß genug sind, einen babylonischen Turmeinsturz für die kleinen Nandjivölker allein zu rekonstruieren.
Doch kann man wohl sagen, daß die Nandjisprachen alle miteinander sich mehr oder weniger ausgesprochen den Tschambadialekten anreihen. Und damit bin ich beim zweiten Punkt angekommen: der Separierung von Bokko und Nandji. Die letzten gehören ihrer Sprache nach ganz entschieden zur Durru-Duigruppe. Das entspricht ja auch der Lagerung: Die Nandji wohnen näher dem Tschamba-komaigebiet, die Bokko dem Volke der Durru zu.
Wenn also auch sprachlich ein ähnlicher Zustand herrscht wie in der Dafinaprovinz, unter den sog. Bobostämmen, so ist doch anderseits die kulturelle Übereinstimmung nicht zu verkennen. Deshalb glaubte ich, die Stämme in folgende zusammenfassen zu dürfen, auch wenn sie untereinander verschieden sind. Die einen haben heilige Schwirren, die andern dafür heilige Blasinstrumente. Die einen haben heute noch das Kleinrind, die andern haben es fast ganz oder
Aber die Stämme sind doch in ihrem gemeinsamen Bewohnen eines Gebirgsmassivs, das inselartig aus der Ebene emporsteigt, naturgemäß dem Prozeß einer gewissen Vereinheitlichung, Denkweise und Entwicklungsart unterworfen. Allerdings gibt es selbstverständlich auch darin wohl erkennbare Verschiedenheiten. Diese sind doch aber so wenig bedeutsam gegenüber den Einwirkungen der Umwelt, die sie geformt und verbunden haben, daß wir solcher Verschiedenartigkeit gegenüber die Gemeinsamkeit des Grundwesens nicht vergessen dürfen. Von dieser aber möchte ich folgendes sagen:
Die Menschen der Ssaristämme sind widerhaarige, heftige Naturen, die die leitenden Charakterzüge aller Splitteräthiopen tragen. Sie sind schwer zugänglich und nicht sehr empfänglich für fremde Kulturgaben. Sie wollen nichts Neues, betreiben dagegen das Alte, ihnen von Urväterzeiten Vertraute mit großer Energie und müssen deshalb als durchaus aktive, wenn auch absolut nach innen gewendete Menschen bezeichnet werden. Ihr Trotz dem Fremden gegenüber entspringt einem klar erkennbaren Selbständigkeitsgefühl, in dem sie bei leisem Streifen der Ellbogen schon den Pfeil zu wechseln geneigt sind. Sie sind aber doch nicht so leicht reizbar, wie z. B. die Tambermaäthiopen Nordtogos. Vielleicht hat ihre Vergangenheit, die sicher härter war als die anderer, den Reiterstämmen der Ebene nicht so ausgesetzter Äthiopen, und die nun schon Jahrhunderte währende Bedrängung durch Batta, Tschamba und Fulbe, sie biegsamer gemacht. Sie haben aber noch weit mehr ,Streitbarkeit', bewahrt, als etwa die Komai am Rande des Atlantikagebirges.
Auch haben sie eines bewahrt, das die Menschen in ihrer neuzeitlich fast unvorstellbaren Altertümlichkeit verehrungswürdig erscheinen läßt, ich meine die geradezu ans Unglaubliche grenzende Keuschheit. Es verhält sich damit bei ihnen ebenso wie mit den Mundang. Ängstlich hütet sich der Mann irgendeinem oder auch seinem eigenen Weibe je den Anblick seiner ,völligen' Nacktheit zu gewähren. Nie wird ein Mann mit einem Weibe auch nur ein Wort über Geschlechtliches sprechen. Das Geschlechtsleben wird aber ganz genau ebensowenig unter den Männern erörtert; und nur in einer nächtlichen Stunde, wenn kein anderes Ohr es hört und sie sich selbst nicht dabei sehen können, bespricht die Mutter mit der Tochter das, was sie im Geschlechtsleben sehen und erleben wird, und diese Ermahnung gipfelt auch darin: "Kind, schrei nicht. Andere Leute würden das Schreien hören. Andere Leute wissen was vorgeht, wenn du schreist!" Welche Mühe es kostete, von Leuten dieser Art die notwendigen Mitteilungen über das Ehe- und Geschlechtsleben zu gewinnen, davon macht sich niemand eine Vorstellung, der
das nicht miterlebt hat. Diese Äthiopen erscheinen mir heute genau noch wie zur Zeit des alten Vaters Herodot als die sittlichsten aller Menschen.Damit hängt zusammen die fast unheimliche Religiosität dieser Menschen, die ihren uralten, uns im ersten Augenblick entschieden unmenschlich berührenden Kultus mit einer Selbstverständlichkeit erfüllen und durchführen, die ,richtig beurteilt, geradezu erschütternd wirkt. Das ist alles so rein und unverfälscht, so unnahbar hoch erhaben über Skepsis oder gar Hohn, daß der moderne Mensch zunächst dazu neigen wird, an "Dummheit" zu glauben. Aber der ernsten Beobachtung kann eine solch bequeme Abfindung unmöglich Stich halten. In Wahrheit besitzen diese Äthiopen noch die Grundlage einer alten Ethik, die wir längst eingebüßt haben, um neuzeitlichem Denken Raum zu geben, deren Verlust uns aber durchaus kein Grund zur besonderen Freude sein kann, und die nur sehr oberflächliche Menschen belachen können. Diese Menschen haben noch einen ganz selbstverständlichen Glauben. Kein Gedanke der Skepsis kann auf diesen Überzeugungsfelsen auch nur das kümmerlichste Würzelchen schlagen. — Auch das muß man erlebt haben, mit welcher klaren Ruhe die Leute die Wanderung der Seele von einem Körper zum andern schildern. Man muß es erlebt haben, wie sie über die Leichen der Alten jubeln: "Jetzt kann uns ein neues Kind geboren werden!" Das ist richtig betrachtet tief ergreifend, und ich kann nur wieder an das erinnern, was uns die alten griechischen Weisen an Dokumenten überliefert haben: Diese Äthiopen sind aber die frömmsten aller Menschen.
Ihren Sitten und Anschauungen nach gehören diese Äthiopen zu den Völkern, die in den Gebirgsländern des oberen Benue hausen, und von denen die namhaftesten unter den nicht Nationalisierten sind: Tangale, Djenn, Werre, Faili, Nandji, Bokko, Durru. Von diesen nämlich weiß ich, daß sie die Schädel der Angehörigen in der uralten Weise, nämlich nach der Art der Issedonen verehren (Herodot IV, 26).
Diese Völker wissen natürlich nicht sehr viel von ihrer Vergangenheit. Folgende Legende traf ich aber zuerst bei den Bokko an und fand dann nachher Bestätigung sowohl bei den Komborro oder Kombore (Komai) als den Nandji: Anfangs war eine Frau, die wohnte in Kombore und gebar da drei Söhne. Der Älteste von denen blieb in Kombore. Von ihm stammen alle Komai ab. Der zweite wanderte in das westliche Ssarigebirge aus und ward der Stammvater aller Nandji. Der dritte zog aus in das Land am Südabhang des Ssari und hatte dann eine reiche Nachkommenschaft, die heute als Bokko bezeichnet wird. — Diese Sage erhalten alle drei Stämme aufrecht, trotz aller Sprachverschiedenheit.
An historischen Erinnerungen wissen die Ssaristämme, daß vordem der Lamordefürst auch über sie gebot und sie ihm, gleich allen Nachbarn, Abgaben zahlen mußten. Nachher aber kamen die Fulbe ins Land, begannen den Krieg gegen Lamorde und verjagten die Batta aus vielen Teilen des Landes. Die Nandji und Bokko wurden so auch für einige Zeit von der Oberherrschaft der Batta frei. Die Fulbe konnten zunächst nicht in die Gebirge kommen, bis die Nandji anfingen, mit ihnen Frieden zu machen. Die Nandji waren aber nicht nur die ersten Freunde der Fulbe, sondern sie überredeten auch die Bokko und Komborro, sich diesem Freundesbündnis anzuschließen. Bokko und Komborro taten es. Wie aber die Nandji die geneigtesten zum Friedens- und Freundschaftsschlusse waren, so waren sie auch die ersten, die das gute Einvernehmen störten. Natürlich war die Grundbedingung der von den Fulbe gewährten Freundschaft, Botmäßigkeit. Das behagte den Nandji bald nicht mehr, und so entstand der Krieg. Die Nandji, die damals noch sehr zahlreich in der Faroebene wohnten, wurden gezwungen, in die Berge zu ziehen, und die Bokko zogen solche Vorsichtsmaßregel auch vor, obgleich sie bis heute noch keinen Krieg mit den Fulbe hatten. —
Folgendes sind die Namen, die die beiden Völker einander und den Nachbarn geben.
Es nennen die Bokko: die Nandji (Singular) (Plural)
die Bokko Longbo Longwe Gubio Nandji Tungbo Tungwe Duajo Durru Papaen Papenjwe Durru Batta Didjibo Didjiwe Tarrio " Tschamba Samba Sambajowe Schamba Komai Nebo gurre bürre Gullei-ade nebo (Volk) gulle (Berg). gurre (Berg) Aus dieser kurzen Liste spricht schon die Splitterhaftigkeit der Nationalbildungen. Nur die Tschamba haben überall den gleichen Namen und die Komai nennen beide Bergvolk. Das ist das einzige Übereinstimmende. |
(Es sei übrigens betont, daß die Bokko auch ein Blasinstrument für Opfer in der Erntezeit haben. Es ist das der Wongbo.) Die Bokko haben hölzerne Schwirren und nennen diese Uonatonajo. Also ganz
verschiedene Geräte und doch, wie ich gleich zeigen werde, absolut übereinstimmende Verwendung.Das Jajo dürfen die Frauen auf keinen Fall sehen und wenn sie es aus der Ferne hören, sollen sie sich fürchten. Es wird bei drei verschiedenen Gelegenheiten geblasen. 1. Wenn ein alter Mann stirbt. 2. Zur Ernte Sorghumfestlichkeit. 3. Zur Beschneidung. In allen drei Fällen tanzen dann die Männer im Busch. Den Weibern aber sagt man: "Es seien Dukumi und Jojo, schlimme Buschgeister, die durch Geschenke beschwichtigt werden müssen. Also bereiten die Weiber allerhand Speisen, händigen sie den Männern aus und sind froh, die Sorge loszuwerden.
Die entsprechenden Maßnahmen und Sitten der Bokko will ich gleich näher schildern, und dann auf die Parallelen der Nandji zurückkommen.
Wenn man ein Bokkogehöft durch das Torhaus betritt, so sieht man sogleich rechts in der Wandnische, an der Stelle, wo auch die Tambermastämme Nordtogos Schmuckwand und Heiligtum haben, ein kleines Häuschen, das Nahurga heißt. In diesem ist oben an einem Stöckchen das Wonatonajo oder Uonatonajo, das Holz zum Schwirren aufgehängt, die Bokko haben nur hölzerne, keine eisernen Schwirren. Wenn die Weiber das Geräusch hören, so sagt man ihnen, daß die Wuonatona (soviel wie Geister der Toten, von einem östlichen Bokkomann hörte ich diese Bezeichnung Wuarratora aussprechen) das Geräusch machten; sie wollten etwas und sprächen deshalb in dieser Weise, es seien die alten Väter, die nach Essen und Tabak schrien! Wenn die Weiber das hören, dann laufen sie schnell und bereiten die gewünschten Leckereien vor. Die Männer sind, wenn die Schwirren ertönen im Wongliwo, d. i. ein heiliges Haus außerhalb des Dorfes. Dorthin bringt ein von den Männern an die Weiber entsandter Bote das, was die Frauen bereitet haben. Dann vergnügen sich die Alten an den guten Dingen. Es geschieht das bei Gelegenheiten, deren jede ernst ist, aber deren keine düster absolviert wird; denn das ist nicht Art der Äthiopen. Es wird geschwirrt: 1. Im Beginn der Erntezeit, dann wird vor allem Bumme, d. h. Bier geopfert und fünf Tage lang getanzt und getrunken, abends wird erst geschwirrt, hernach das heilige Geräte weggepackt, das Weibervolk gerufen und gejubelt. Sie opfern den Sorghum jedoch nur an diesem Fest, nicht aber um Regen, Kinder oder Erntemehrung zu erlangen, 2. wird geschwirrt, wenn die jungen Burschen beschnitten werden und 3. endlich ,wenn ein alter Mann stirbt. Alles was sich hierbei ereignet und dem folgt, ist aber so voll und klar erhalten, daß dieses Sittenbild uns mancherlei Aufschluß geben kann, weshalb ich mich dieser Sache zunächst einmal eingehend widme.
Wenn bei den Bokko ein junger Mann stirbt, dann herrscht eine
allgemeine Traurigkeit. Man weint und klagt. Wenn aber ein alter Mensch verscheidet, dann jubelt das Volk und trinkt und tanzt. Schon wenn ein alter Mann todkrank ist, also noch ehe er vom Leben Abschied nahm, trifft man die ersten Vorkehrungen. Man schlachtet einen Bullen. Der darf aber nicht von der Fulbebuckelrasse sein, die bei den Bokko Djabenawo, bei den Nandji Sanajo heißt und die erst mit der jüngsten Fulbeinvasion in das Land gekommen ist. Ehe die Fulbe erschienen, hatten aber sowohl die Bokko wie die Nandji große, halbwild gehaltene Herden einer kleinen, buckellosen Rasse, die allerdings weder die Bokko noch die Nandji zu melken wußten (Tschamba auch nicht!). Diese Rasse wird bei Bokko Nawewio, bei Nandji Dunajo genannt. Es soll früher, zumal um Taere, eine große Nandjisiedelung, herum große Herden davon gegeben haben, aber bei den Bokko sind heute diese Rinder so gut wie ganz verschwunden, und bei den Nandji ist diese anscheinend uralte, gut akklimatisierte und wertvolle Rinderrasse entschieden auch im Rückgang begriffen.Also ein Bulle von dieser Rasse wird geschlachtet und enthäutet. Die Haut wird feucht ausgespannt und feucht gehalten. Wenn der Kranke dann den Geist aufgegeben hat, wird er in ein großes Kleid, in ein Kollanwo gewickelt. Die Stellung, in der er eingewickelt wird, ist die eines knienden Menschen, der seine Hände vor den Knien mit der Innenfläche gegeneinander gelegt hat. Die Wicklung ist so stark wie nur irgend möglich, fest und straff. Die Bokko nehmen den starken Gurtstoff dazu, den sie ebensogut wie Werre, Nandji und Durru (wenigstens heute noch) herzustellen vermögen. Nachdem diese feste Wickelung beendet ist, wird der Leichnam mit der linken Seite auf die feuchte Rinderhaut gelegt und in diese eingeschnürt, wobei der Kolliüberzug so fest angezogen wird wie nur möglich. So wird die Leiche bestattet, und zwar in einem Grabe, das als Schacht erst vertikal in die Tiefe geführt und dann mit einer Kammer versehen wird. Dort liegt die Leiche mit dem Kopf nach Süden und das Antlitz nach Sonnenaufgang, also auf der rechten Seite. (Ein andermal wurde mir gesagt, die Leiche würde auf die linke Seite gebettet.) Danach wird dann der Eingang in das Grab mit einem flachen Stein verschlossen, den man ringsum mit Erde verkittet, so daß in der Regenzeit kein Regen hineinrieseln kann.
Nach einem Jahr wird das Grab dann wieder geöffnet, indem man den Erdkitt löst und den Stein zur Seite schiebt. Man steigt hinab, öffnet die Rinderhaut und nimmt den Schädel (julningo) heraus. Ich will gleich fortfahren und die ungeheuerliche Konsequenz darstellen, in der man früher bei den Bokko dem Schädeldienst und dem Seelenwanderungsdienst huldigte. — Man brachte den Schädel mit nach Hause, reinigte ihn säuberlich und hob ihn in dem kleinen
Häuschen der Nahurga auf, in dem ja auch die Stimmen der Ahnen, die Schwirrhölzer Aufnahme finden. Früher — die Bokko haben sich inzwischen mehr an die einfachen Sitten der Nandji gewöhnt — ließ man den Schädel in der Nahurga, gab ihm wohl ein wenig Bier als Opfergabe, bereitete ihn aber erst zu, wenn ein Mädchen der Familie heiratete.Wenn nun dieses bevorstand, dann ging der Vater in das Nahurga. In früher Zeit zerschnitt oder zerbrach er dann den Schädel, so daß die einzelnen Teile um das abgelöste Schädeldach herumlagen. Dann rief er das Mädchen herein. Das Mädchen kam mit Sorghummehl und Wasser. Der Vater mischte das in der Schädelschale und tupfte dem Mädchen davon auf die Brust. Gleichzeitig sagte der Vater zu dem Schädel: "Du alter Vater, du starbst nun schon vor langer Zeit. Du hast mich geboren, ehe du starbst. Dann habe ich eine Tochter geboren. Die hat noch kein Kind gehabt, aber sie heiratet jetzt. Du alter Vater, ich bitte dich, gib dem Mädchen nun ein Kind." Danach spuckte der Vater noch einmal in den Mehlbrei und betupfte damit den Leib der Tochter bis unten zu den Geschlechtsteilen. In einigen Familien genoß das Mädchen auch ein wenig von dem Mehlbrei. — Nach diesem Opfer muß dann die junge Frau unbedingt bald schwanger werden und gebären. Dies Kind gilt als Wiedergeburtsform des beopferten Ahnen und erhält demgemäß auch dessen Namen. Sollte ein einmaliges Opfer dieser Art nicht fruchten, so wird es in genau der gleichen Weise wiederholt. Das kann mehrere Male notwendig werden. Die junge Frau muß aber jedesmal dem Vater ein Huhn bringen, das dann unbedingt dem Schwirrholz geopfert wird. Man sieht die nahe Beziehung zwischen Ahnendienst und Schwirren.
Bemerkt muß werden, daß die Bokko heute nicht mehr die Schädel zerbrechen oder zu zerschneiden pflegen. Sie legen und bespucken den Mehlbrei auf den unverletzten Schädel.
Vergleichen wir damit die entsprechende Sitte der Nandji:
Wenn bei diesen ein junger Mann stirbt, weinen und heulen sie, weil er so gut arbeiten konnte. Wenn aber ein alter Mann stirbt, entsteht in der Familie und aus Mitgefühl in der ganzen Gemeinde ein großer Jubel. Die Leute erklären dies ganz naiv damit, daß dieser Mensch doch hätte keine Arbeiten mehr ausführen können. Jetzt aber, wo er gestorben sei, jetzt könne er einem Mädchen der Familie den Leib schwangern. Nun würde ein neuer Mensch kommen, der nach wenigen Jahren schon stark genug sein würde, um bei der Arbeit zu helfen. Diesem Verhalten und Ausspruche nach wird die Bestattung auch durchaus sinngemäß parallel ausgeführt.
Wenn ein gewöhnlicher alter Mann bei den Nandji stirbt, dann wird ein Bulle geschlachtet, wenn es aber ein Warm, ein Häuptling ist, ihrer drei, und dann werden die Felle auch gleich abgedeckt und
feucht ausgespannt, die Leiche wird in sitzende Stellung gebracht, wobei die Hände, bei ausgestreckten Armen mit der Fläche gegeneinandergelegt, zwischen die Beine gelegt werden. (Der Häuptling wird bei den Bokko Gario genannt. Bei Tod folgt ihm der Sohn, wie überhaupt streng patriarchalische Erbfolge eingehalten wird.) In dieser Position wird die Leiche fest mit Stoffbändern (hile) umwickelt und in die feuchte Rindshaut gepackt. Das Leichenbündel wird hierauf in ein Lehmbett gelegt und daneben ein Feuer angezündet. Es bleibt da mehrere Tage in Räucherung. Die Leiche eines Wario wird dem Feuer und Rauch nicht weniger als zehn Tage ausgesetzt, und wenn eine deckende Rindshaut dabei verdirbt, wird eine weitere darüber gezogen.Nach Ablauf dieser Zeit wird der Mumienballen zum Grabe gebracht. Das ist bei den Nandji eine Gruft, deren an der Erdoberfläche verhältnismäßig schmaler Eingang sich unten trichterförmig zu einem weiten Gelaß öffnet. Es ist dies also ähnlich wie bei den Marghi. Unten ist diese Höhle auch reichlich mit Knochen bedeckt, die gelegentlich einmal zur Seite geschoben werden. Im Grab wird der Ballen ein wenig gelüftet, d. h. die Felihülle wird da, wo der Kopf ist, und zwar an der Hinterseite, geöffnet, so daß das Haupt später aus dem Schnitt leicht herausgelangen kann. Danach wird ein Eisenhaken, ein sog. Russe, von unten hineingebohrt, die Leiche an diesem Eisenhaken befestigt und an einem Strick, der das andere Ende des Hakens hält, in die Grube gelassen. Der Leichenballen hängt nun oben in der Höhle. Der Strick wird draußen an einem Stein oder Baum festgebunden, und der Grabeingang mit einem flachen Stein leicht zugedeckt.
Alle paar Tage kommt nun jemand und schüttelt ein wenig an dem Strick, so daß das Leichenpaket an dem Haken hin und her schwankt und die Fleisch- und Muskelteile, die den Kopf mit dem Körper verbinden, allmählich gelockert wird. Dies Schüttelverfahren wird etwa zwei bis drei Monate fortgesetzt. Dann kann man annehmen, daß die Bemühungen von Erfolg gekrönt sind, d. h. der schwere Ballen hat den Hals vom Kopfe, der mit Strick und Haken oben festgehalten ist, losgerissen und stürzt nun hinab zu den andern Gebeinen. Der Schädel wird nun vom Haken genommen und heimgebracht. Es wird ihm sogleich Sorghumbier — Bumme —geopfert und dann wird er gereinigt. Um die Knochen im Grabe kümmert man sich nicht weiter. Man läßt die Gruft sich mit Knochen füllen, bis keine Ballen mehr hängen können, schüttet sie zu und gräbt eine andere.
Daheim wird der Schädel nun, wie gesagt, sorgfältig gereinigt und rot angemalt. Es wird ein Topf — donjo — mit einem Deckel besorgt und die Reliquie hineingelegt. Die Urne wird in die Berge getragen.
Denn die Nandji heben die Reliquien nicht wie Palli, Bokko, Durru und Djenn usw. im Dorfe auf, sondern sie haben Ahnengrüfte in den Bergen, naturgeborene Feishöhlen. Jede Familie besitzt eine solche. Man nennt sie Jenko. Jede Familie sperrt ihre Jenkogruft gegen jeden Fremden insofern ab, als streng darauf geachtet wird, daß nur die Reliquien der eigenen Familie darin Aufnahme finden. Im Jenko stehen die mit Deckel versehenen Urnen in Reihen. Die alten Geschirre sind verfallen, die jüngeren sind in guter Verfassung und werden dann und wann auch einmal wieder mit roter Farbe aufgefrischt.Wenn nun ein Mädchen (Wassengo, bemerkenswert ist, daß eine Wassengo nicht etwa eine unberührte, sondern nur eine unverehelichte Weiblichkeit darstellt, bei dem schrankenlosen Liebesleben der Nandji kommt kein Mädchen unschuldig in die Ehe!) geheiratet hat, oder vielmehr nach gebührender Bezahlung verheiratet worden ist, so bringt man es zu den "Ahnen". Das heißt wenige Tage nach dem Ehevollzug führt der Vater oder die Mutter das junge Wesen in die Berge zu den Familien-Jenko. Familiär heißt hier patriarchalisch. Das heißt, es stehen da in wohlgegliederter Ordnung alle Nachkommen und Vorfahren der Vaterfamilie, exklusive eingeheirateter Frauen. Die Schädel der eingeheirateten Frauen kehren nach dem Tode ganz folgerichtig wieder in das Haus ihres Vaters zurück.
Auf der Urne irgendeines direkten Vorfahren des Vaters, also des Vaters, Großvaters usw., bereitet nun der führende Vater eine kleine Mehimischung. Dann hebt er den Topf auf und betet: "Ich bitte dich, Beto! (Gott). Dieses Mädchen ist noch unverheiratet. Nun gib du ihm ein Kind." Danach spuckt der Vater darauf, und die Zeremonie ist erledigt. Das Mädchen wird nicht, wie bei den Bokko, mit Mehlbrei bekleistert, sondern man nimmt an, daß dieses einfache Opfer und Gebet genüge. Wenn die junge Frau nun schwanger wird und gebiert, so erkennt man an dem Sprößling den wiederkehrenden Ahnen und gibt ihm dementsprechend auch seinen Namen. Wenn Zwillinge erscheinen, so erkennt man in Nr. 2 einen wiedergekehrten Bruder, über dessen Schädel geopfert und gebetet wird. Die Linie solcher Erbfolge verläuft danach also immer in der Vaterfamilie.
Fernerhin wird in dem Jenko, diesem Urnenfriedhof von den Nandji auch dann geopfert, wenn die Ernte mißrät oder wenn der Regen ausbleibt. Zur Erntezeit werden allerdings Küken und Bier in der Farm und nicht im Schädelmausoleum geopfert, aber eben für Regen. Darin weichen sie also von den Bokko ab (ebenso wie die Dakka von den Nordtschamba usw.). Denn die Bokko sagen, es gäbe keine Regenmacherei und nur Njio, d. h. Gott, könne Regen spenden. Beide Stämme haben darüber schon viel disputiert. Aber die Nandji
weichen gar nicht so sehr von den Bokko ab, denn sie bitten ja auch bei den Schädeln zu Beto (Gott), wie sie überhaupt keine Fruchtbarkeit ohne seine Hilfe für möglich erachten. —Die Altersklassen der Nandji sind:
Wuasse =Säuglinge,
Toketo = unbeschnittene Burschen,
Nabo = beschnittene Burschen,
Waltscherro = verheiratete junge Männer,
Bach'ma = ältere Männer, Familienväter, die schon so viele und
große Nachkommen haben, daß sie selbst nichts
mehr arbeiten brauchen und sich auf das Dirigieren
beschränken können.
Dentio =Greise, die keinerlei Handlungen von Wert mehr
vornehmen können und als durchaus unnütz bezeichnet
werden. Das sind die, über deren Tod man
sich freut, weil sie nun in den Kindern wiederkehren
können. |
Wie bei vielen dieser Völker haben die Nandji für die Unbeschnittenen eine ganz besondere Einschränkung. Diese, die sog. Pario, dürfen nämlich keine Kapaune essen, sonst werden sie steril. Die Nandji verstehen wie alle diese Völker ausgezeichnet und genau in der gleichen Weise wie die Losso in Togo die Hähne zu kapaunisieren und Böcke zu kastrieren. — Es gibt nämlich bei den Nandji nicht wenige Pario, Unbeschnittene. Man sagt hier allgemein, daß die Beschneidung in Adamaua und seinen Nachbarländern überhaupt vielfach fehlt. Zu den sehr selten Beschnittenen rechnen die
Batta und Fulbe die Lakka, zu den nie Beschnittenen die Faili, die Dakka am Mandaragebirge im Modjogoi oder Musogoi, die Lam, die Matafall usw.Die Nandji geben selbst zu — trotzdem die Beschneidung auch in den Bergländern Südadamauas heute schon als ein Zeugnis der Bildung gilt —daß es mit der Beschneidung bei ihnen recht ungenau gehandhabt würde. In den Beschneidungstagen treffe man ganz kleine Buben neben älteren Männern, die selbst schon beschneidungsfähige Söhne haben; und sie geben als Grund für diese Unregelmäßigkeit an, daß das Beschneidungsfest, das "dumbio", nur alle paar Jahre gefeiert werde. Es wird das aber ausgeführt in der sog. Wollewato-Zeit.
Ein älterer Mann, der den Titel Jotojajo (jajo ist das heilige Blasehorn) führt, sammelt, wenn die Zeit gekommen ist, in mehreren Dörfern die Buben, Burschen und Männer, die aus eigenem Willen oder nach Bestimmung ihrer Eltern die Operation durchmachen sollen. Es kommen dann meist hundert, ja zuweilen an die hundertfünfzig zusammen. Ein jeder wird von seinem Bruder oder sonstigen Verwandten begleitet und baut sich im Busch draußen ein kleines Häuschen. Ist die eigentliche Operation überwunden, so bleibt die Genossenschaft noch ein Jahr, ein ganzes Jahr draußen im Busch, so daß wir sagen können, die Nandji üben diese Sitte zwar recht unregelmäßig, wenn sie es einmal tun, dann aber auch desto gründlicher.
Im Beginn der Buschzeit bereiten die Weiber unten im Tal oder in der Ebene die Speise und senden sie in das Lager. Denn sie selbst dürfen natürlich keineswegs den jungen Leuten unter die Augen treten. Wenn aber nach zwei Monaten die Wunden völlig geheilt sind und die Beschnittenen wieder ihre größere Aktionsfreiheit haben, dann müssen sie selbst an die Nahrungsfürsorge denken und müssen zur Hacke greifen. Die Burschen müssen einen Farmgrund freilegen, müssen roden, Steine wegräumen und glätten und selbst ihre Farmen anlegen. Und ehe die selbstgesäte Feldfrucht nicht reif geerntet und verspeist ist, dürfen sie nicht nach Hause zurückkehren. Also verleben sie ein Jahr im Busch. Erst wenn sie ihr Sorghum im nächsten Jahr geerntet haben, dürfen sie wieder heimkehren. Und erst dann dürfen sie wieder ein weibliches Wesen sehen. —
Am Tage, wenn die Burschen beschnitten werden, tragen sie ein maskenartiges großes Kleid aus Blättern. Es ist ein großer Festtag, wenn sie dies anlegen. Wenn sie jedoch beschnitten sind, das Jahr im Busch verbracht haben und nun heimkehren, so tragen sie das "Bendere", d. i. die Bente, die Baumwolischürze, die zwischen den Beinen durchgezogen ist. Große Freude herrscht bei ihrer Rückkehr, und es ist ein Begrüßen und Jubeln, das jedenfalls am gleichen Tage kein Ende nimmt. —
Der Bube oder Bursche arbeitet auf seines Vaters Farm bis er heiratet. Durch diese Arbeit verpflichtet er seinen Erzeuger, ihm die Mittel zu seiner Verehelichung zu geben. Der Weg zu dieser führt aber einige Jahre durch eine von alter Tradition geheiligte Kinderliebe. Bursch und Mädchen, die sich leiden mögen, nennen sich gegenseitig Bagio. Der Bagioverkehr ist absolut legitim, genau wie bei den Kabre die Jugendfreundschaft. Wenn zweie sich verstanden habendenn niemand redet über so etwas — schickt der Bursch der Mutter des Mädchens Geschenke. Die Mutter, die das Geschenk annimmt, erlaubt ihm auch, sie zu besuchen. Und wenn er kommt, zeigt sie ihm eine kleine Hütte und sagt: "Da kannst du von jetzt ab mit meiner Tochter schlafen." Es muß ein sehr keusches Volk sein, bei dem man solche Worte aus solchem Munde gang und gäbe findet.
Und von nun an schläft der Bursche mit seinem Mädchen in diesem Raum, ganz allein, Nacht für Nacht, ein jedes auf seinem Bett. In dieser ersten Zeit ist es noch völlig kindliche Kameradschaft, "denn die Brüste des Mädchens sind noch ganz klein". Aber der Bursche macht sich seiner Bagio angenehm, wo er kann. Ja, wenn er genügend vermögend ist, kauft er ihr sogar einmal einen Hund. Hund ist aber für den Nandji etwa dasselbe, was bei uns Bärenschinken ist, ein ausgewählter Leckerbissen, an dem sich alt und jung gern delektieren. Und wenn einmal dem Mädchen ein Gericht beim Kochen besonders gelingt, dann weiß sie es ihrem Gefährten so heimlich hinter das Bett zu stecken, daß kein Mensch es merkt und daß er es ganz allein in Behaglichkeit verschmausen kann.
So nach und nach ergibt es sich von selbst, "daß die beiden einander mit der Hand berühren", wie die Nandji sich sehr fein ausdrücken, und damit meinen sie, daß die geschlechtliche Anziehungskraft bei aller Keuschheit und Naivität, kleine Annäherungen, unscheinbare Berührungsgelegenheiten heraufzaubert, deren tieferer Sinn ihnen natürlich unverständlich bleibt. —Eine Zeitlang war ein Nandji in meinem Gefolge, mit dem wir zuletzt sehr gut Freund und vertraut wurden. Ich fragte ihn, wie es denn komme, daß die jungen Leute zuletzt zum Liebesgenuß kämen, ohne daß sie, wie er selbst sagte, darüber miteinander sprächen. Darauf erzählte er zögernd, wie es ihm in seiner "Kindheit" ergangen sei. Er habe auch seine kleine Freundin, seine Bagio gehabt. Weiter: "Wir schliefen zwei Jahre im gleichen Hause, ohne daß ich an etwas dachte. Dann wurde meine Bagio mißlaunig. Meine Bagio weinte oft. Meine Bagio schlug mich. Meine Bagio war sehr schlecht mit mir. Ich dachte: Meine Bagio ist krank. Ich ging zur Mutter meiner Bagio und sagte: ,Meine Bagio ist krank.' Die Mutter sagte: ,Warum ist sie krank?' Ich sagte: ,Sie weint und schlägt mich.' Die Mutter sagte: ,Wenn das Mädchen dich schlägt, schlage sie wieder. Aber nicht sehr stark. Dann wird es sich
geben.' Ich sagte: ,So will ich es machen.' Ich ging zur Arbeit. Ich kam abends von der Farm heim, ich ging in das Haus, in dem wir schliefen. Meine Bagio stand an der Türe. Ich ging an ihr vorüber. Meine Bagio weinte. Meine Bagio weinte. Ich kam zu meiner Bagio und wollte etwas sagen. Meine Bagio schlug mich. Ich hielt meiner Bagio den Arm fest. Ich fühlte, daß sie stark war. Meine Bagio schlug mich mit der andern Hand. Ich nahm meine Bagio und trug sie auf ihr Bett. Ich sagte zu meiner Bagio: ,Wenn du mich wieder schlägst, dann schlage ich auch.' Meine Bagio trat mich mit dem Fuß. Wir schlugen uns. Ich drückte sie auf das Bett nieder. Ich lag auf meiner Bagio. Dann habe ich meine Bagio beschlafen. Meine Bagio hat nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt."Das war einer der feinsten psychologischen Einblicke, die ich bei diesen Völkern gewann. Ich denke, ein Kommentar dazu würde nur die Zartheit der Erklärung zerstören.
Der Bursche lebt ein bis drei Jahre im Hause des Schwiegervaters. Niemand kümmert sich darum, was in dem kleinen Häuschen vorgeht. Nur dann und wann arbeitet der Jüngling auf der Farm des Schwiegervaters. Erhält der junge Mann nun von seinem Vater die nötigen Mittel, so kann er bald heiraten, sonst muß er warten oder aber es kann plötzlich mit dem herrlichen Bagio-Zustand ein Ende nehmen, wenn nämlich irgendein anderer Wohihabenderer ihm die Braut vor der Nase wegschnappt. Die notwendige Bezahlung beläuft sich aber auf: zehn Rollen, Hile genannten, breiten Stoff, drei eingeborene fehlerlose Kühe, zehn Ziegen. Ist das beglichen, so kann der junge Mann die Braut heimführen, d. h. er kehrt zurück in das Haus seines Vaters, in dem er noch ein Jahr leben und arbeiten muß, ehe er sein eigenes Gehöft beziehen, seine eigene Farm anlegen kann. Das Mädchen kommt erst allein, am andern Tage kommt dann die Ausstattung. Diese besteht in zwei Töpfen (kokedonio) zwei Kalebassen (kokedakio) und Mehl (Sume oder Djume). Einen Mörser bringt die junge Frau nicht mit, die Nandji verrichten alle Arbeit, mahlen, stampfen und dreschen auf Steinen.
Die Arbeitsteilung ist folgende: Den Männern fällt zu: der Hausbau, die Weberei, die Ackerarbeit, das Holzschlagen, die Töpferei von Tabakspfeifen (tabuluko), die Herstellung der Sekkomatten (hier silae genannt; andere Matten kennen die Nandji nicht, sie schlafen auf Lehmbänken); die Frauen helfen bei der Ackerarbeit und beim Holzschlagen, sie tragen das Wasser, kochen das Essen, machen Töpfe, flechten die Körbe und klopfen die Rindenstoffe (ein Weiberkleid aus Rindenstoff heißt dapto-go-kumio).
Die Form des Beischlafes ist die äthiopische. Der Mann hockt vor dem auf dem Rücken liegenden Weib in der Kniebeuge. Er zieht die Beine des Weibes um seinen Leib, so daß ihre Füße sich hinter
seinem Rücken wieder berühren. Die Geschlechtstätigkeit selbst wird in großer Geschwindigkeit betrieben. Bezeichnend für die Keuschheit, in der die Gatten leben, ist noch folgendes: Die Männer der Nandji tragen einen Dapto, d. i. ein Penisfutteral aus Kalebasse über der Eichel. Es ist mit einer Schnur über die Lende gebunden. Nun gilt es als höchste Unanständigkeit, ja sogar als gefährlich, wenn je eine Frau solch einen Dapto zu sehen bekäme. Keine Frau, auch nicht die eigene, darf diesen sehen.Bemerkt muß werden, daß auch bei den Nandji durchaus nicht jeder Mann ohne weiteres jede Frau heiraten kann. Vielmehr herrscht eine klar ausgesprochene Exogamie. Ich erhielt von folgenden Sippen die Namen:
Taereleute essen nicht Sago oder Djago (den Alligator). Guajoleute essen nichts, was von den Schmieden kommt. Tujoleute essen nicht Bugule (die Eidechse). Gatijoleute essen nicht Tsetego (die Grille). Fioleleute essen nichts was von den Schmieden kommt (?). Habileute essen nicht Malio (Affen). Daskeleute essen nicht Bode (Frosch) (?). Anscheinend wohnen die totemistischen Sippen immer in einer Gemeinde zusammengesiedelt. Jedenfalls darf nie ein Mann ein Weib heiraten, das demselben Speiseverbot wie er folgt. Das ist bei ihnen und bei den Bokko gleich. |
Bei Verheirateten soll die Schwangerschaft etwa zwei bis drei Monate nach der Verehelichung eintreten, und etwa zehn Monate nach dem Schädelopfer und dem ersten legitimen Beischlaf soll die Geburt erfolgen. Man rechnet bei den Nandji aber nicht nach Monaten, sondern nach Saat- und Erntezeit. —Die Stellung der Gebärenden ist folgende: Sie soll leicht zurückgelehnt mit gespreizten Beinen auf der Erde sitzen. Eine alte Frau stützt sie hinter dem Rücken und hält sie umschlungen und eine andere erwartet das kleine Wesen. Die Nabelschnur (Ko (n) le) wird im Gehöft vor der Türe vergraben, an der gleichen Stelle, wo schon vorher Wadjeko, die Nachgeburt, verscharrt ward.
Knaben werden drei, Mädchen vier Tage nach der Geburt die Namen gegeben.
Wadoojo =Säuglinge, Wagauwa = unbeschnittene Burschen, Benjo = beschnittene Burschen, Kellebajo =junge verheiratete Männer, Mbajo = alte Männer, rüstige Familienväter, Gangere =Greise, die nicht mehr Weiber beschlafen. |
An Altersgeboten oder vielmehr -verboten sei bemerkt, daß Kinder keine Eier essen dürfen, ganz speziell unbeschnittene, aber besser ist, wenn auch die Beschnittenen sie meiden. Weiterhin soll in oder vor der Beschneidungszeit kein Bursche Hundefleisch genießen, weil das die Heilung der Wunde sehr erschwert. Eigentlich sollten nur die Gangere, die Greise, Hunde genießen, da denen nichts mehr schaden kann. Hier ist ein großer Geschmacks- oder Sittenunterschied gegenüber den Nandji zu beobachten, die die Hunde als Leckerbissen ansehen.
Mit der Beschneidung hat es auch bei den Bokko seine eigene Bewandtnis. Sie soll angeblich nur alle zwölf Jahre einmal stattfinden. Die Unternehmung wird dadurch vorbereitet, daß viel Sorghum für Bierbereitung gesammelt wird. Ehe die eigentliche Weihezeit mit der Operation beginnt, sind die Burschen schon eine Woche im Busch, und spielen da. Erst wenn die Alten ihr Bier fertig haben und wenn nun alle Männer im Busch versammelt sind, beginnt die Operation. Die Leitung hat der Kasala oder Kadjala genannte Mann. Er teilt die oft bis zweihundert betragende Jugend in Gruppen und überweist verschiedenen Leuten seinen Anteil an der Arbeit. Dann wird schnell hintereinander ein Bursch nach dem andern operiert. Wenn einer etwa schreien sollte, erntet er gründlichen Spott und Schimpf, an dem er lange zehren kann. Hiernach bleiben die Burschen noch zwei Monate im Busch. Von jedem beteiligten Dorf ist ein erfahrener Mann mit hinaus gegangen, der nach dem Wohlergehen seiner zehn bis zwölf Jünglinge sieht und für sie sorgt. Die Weiber machen während dieser ungefähr zwei Monate währenden Buschzeit daheim das Essen und senden es durch den Vater oder sonst einen Verwandten in das Beschneidungslager. Alle Burschen im Busch legen eines Tages umfangreiche, maskenartige Blätterkleider, aus denen sie nur ein klein wenig herausgucken können, an.
Wenn die Burschen diese Blättermaske zubereiten, naht die Zeit der Rückkehr. Jedermann hat dann das Bier gebraut und sieht mit Vergnügen den Belustigungen des Tages entgegen. Die Burschen selbst haben sich unter ihrem Blätterkleid nach sorgfältiger Waschung mit Öl eingerieben, das haben sie mit Tschogere (rote Erdfarbe) gemischt, so daß sie über und über, Kopf und Haare und alles, rot beschmiert sind. In dieser Maskerade, unter der die roten Menschen hervorgucken, kommen sie an. Es entsteht eine große Tanzerei. Jeder Vater kommt seinem Sohn entgegen. Er hat für ihn zwei Schurze aus Baumwollstreifen mitgebracht, einen für hinten (pinji-gore), einen für vorne (pleonegore). Die Blätterbüschel werden heruntergerissen und die neuen Kleider angelegt. Und in diesem Staat betritt der herrlich rot angestrichene Jüngling das Haus seines Vaters.
Wenn nun aber einer dieser Jünglinge in der Buschzeit starb, und wenn die jammernde Mutter nach ihm schreit und fragt, was mit ihm geworden sei, so sagt man ihr, daß der Wanatonajo (das Schwirrholz) ihn im Busch getötet habe. —
Der Bursche sieht sich beizeiten nach einer kleinen Braut um, und er schließt mit ihr Freundschaft, wenn er und sie noch durchaus Kind sind. Der Name, den die liebenden Kinder einander in diesem Lande geben, ist Mandsogio. Der Bursche leitet das, wenn er sich mit ihr einig geworden ist, in der Weise ein, daß er dem Vater seiner kleinen Freundin von Zeit zu Zeit ein Sanne (d. i. das runde Eisengeld der Durru) bringt. Er erhält dann dessen Einwilligung. Wenn die Kinder dann ihr abendliches Spiel beendet haben, begleitet er sie heim. Er teilt mit ihr eine Hütte, in der zwei getrennte Betten stehen.
Die Bokko sagen, bei ihnen käme es nicht vor, daß der Bursche in der Mandsogio-Zeit dem Mädchen näher komme. Und es scheint mir bei der außerordentlichen Naivität und Keuschheit dieser Menschen auch durchaus glaubhaft. Der friedliche Zustand währt etwa eineinhalb bis zweieinhalb Jahre, dann erwartet man aber, daß die beiden einander heiraten, will sagen, daß der Bursche seine Zahlung erstatte. Die übliche Bezahlung besteht in: zwanzig einheimischen Stoffen (Dumbalio),Schafen (Tajo), Ziegen (Sore)und Hühnern (Nogo). All das muß der Bursche dem Schwiegervater darbringen. Aber auf des Schwiegervaters Farm braucht der Bokkojüngling weder vor noch nach der Ehe zu arbeiten. Vor der Hochzeit arbeitet er lediglich auf den Farmen seines Vaters, nachher aber auf seiner eigenen.
Sobald die Zahlung erfolgt ist, kann die Hochzeit zu jeder Zeit stattfinden. Die Schwiegermutter bereitet ein besonders gutes Diner und der Schwiegervater bringt das mitsamt der vollbezahlten Tochter sowie auch mit der Aussteuer dem Schwiegersohn, der nun eigen Haus und Hof hat. Die Mitgift der jungen Frau besteht aber in folgendem Gerät:
Kochtopf Lango, Holzmörser = Surre, Suppentopf = Halango, Mörserkeule =Tap-tusio, Wassertopf Taego, Kalebasse Dare, (auf dem Kopf getragen) Mehl =Djeme, Kleiner Holztopf = Daego, Kola =Buninjo. (für Sauce) |
Naturgemäß und ohne weitere Zeremonien schlafen die Gatten dann in der nächsten Nacht zusammen. Der Bokkogatte fordert von seiner jungen Frau Beweise der Virginität und untersucht demnach am Morgen nach vollzogener Ehe die Matte aufs genaueste. Je ausgesprochener die roten Zeugnisse sind, desto größer ist die Ehre und
dementsprechend der Stolz, wenn dem Schwiegervater am andern Morgen die Matte übersandt wird. Die Begattung erfolgt bei den Bokko in der europäischen Deckstellung, also wie bei den Durru, mit denen die Bokko auch die Sprachgemeinschaft teilen.Von totemistischen Gruppen konnte ich nur vier in Erfahrung bringen, nämlich:
1. Die Wadjewo, die nicht den Wagungo genannten Affen genießen, heiraten nur mit Affenessern.
2. Die Wahibo, die nicht den "Sorreba" essen. Der Sorreba entspricht dem Dundu der Fulfulde. Das Tier wird nur geschildert als "ein Hund, der aber kein Fleisch, sondern nur Früchte ißt".
3. Die Bango oder Bangbo, die wie die Wadjewo keine Affen genießen.
4. Die Padibo, diese genießen angeblich alles.
Die vier Gruppen heiraten exogamisch untereinander.
Die Schwangerschaft soll zwei Monate nach vollzogener Ehe eintreten und die Geburt nach acht bis zehn Monaten stattfinden. Sie erfolgt im Hause. Die Nabelschnur (Hire) fällt bei Knaben nach drei, bei Mädchen nach vier Tagen ab. Die Bokko stehen im Rufe ausgezeichneter Gesundheitspfleger, die die Wöchnerinnen, wie jeden andern Kranken mit viel Umsicht und Geschick zu behandeln wissen. Besonders in der Kunst der Wupidjaba, der Körpermassage, die nach der üblichen Weise, mit in heißem Wasser gelagerten Blättern ausgeführt wird, sind sie sehr geschickt. Im übrigen ist die große Keuschheit der Bokko die Ursache, weshalb ich nichts Näheres über die Geburt erfahren konnte. Die Männer wußten nichts davon, und die Frauen darum zu fragen war ausgeschlossen.
Wenn die Bokko auch in der Behandlung aller irdischen kleinen Leiden sehr gut Bescheid wissen, so gestehen sie doch ihre absolute Ohnmacht in einem Falle vollkommen zu, d. i. wenn ein Mensch verzaubert ist. Das kommt dann so heraus. Wenn jemand erkrankt ist in einer Weise, die niemand erkennen und behandeln kann, dann fragt man ihn wohl: "Wo hast du das nur her?" Dann mag der Leidende antworten: "Ja, ich bin krank! Alle meine Haut ist trocken (welk), es ist schon möglich, daß das daher kommt, weil ich vorher mit dem und dem Streit hatte." — Wenn kürzere oder längere Zeit nach solchem Gespräch der Kranke stirbt, so klagt die Familie unbedingt jenen, dessen Namen der Kranke anschuldigend nannte, an. Es folgen dann lange und schwierige Verhandlungen, Streit der Personen und Zwist der Familien. Und die Sache findet meist nicht eher ihren Abschluß, als bis der Angeklagte den Gifttrank, der hier Bario heißt, genommen hat. Man muß aber die zum Bariotrank notwendigen Rindenstücken bei den Burru holen, weil man den betreffenden Baum im Bokkogebiete nicht hat oder kennt. Es ist dies
also ähnlich wie in Nordwesttogo, wo Tamberma und Ssola nach dem einen Ort gehen, wo dann der Gifttrank verabfolgt wird.Von der Form der Verzauberung sagen die Bokko folgendes:
Der Mann, der die böse Absicht hat, den andern in dieser Weise zu töten, bemächtigt sich gelegentlich einiger Haare oder Nägelabschnitte, oder auch nur Erde, die den Urin des Opfers aufgesogen hat. Ja es genügt ihm ein wenig von der Erde, auf der der schreitende Fuß jenes einen Augenblick ruhte. Sobald er also irgend etwas besitzt, das vom Körper seines Opfers stammt, oder mit ihm in Berührung stand, hat der böse Mann Gewalt über den ganzen Menschen und kann ihn töten, indem er die Abfallstücke vernichtet oder vergräbt. Den eigentlichen Subachenglauben, d. h. das Verlassen der Haut, Überfall des andern, Genuß der Lebenskraft usw. —das alles und außerdem den Glauben an den bösen Blick habe ich nicht bei den Bokko finden können.
Alles dies spielt bei dem biederen und emsigen Volk, das heute noch in der ebenmäßigen Weise glücklich und verhältnismäßig unschuldig, gleich den alten unsträflichen Äthiopen dahinlebt, keine wesentliche Rolle.
Die Nandji kennen die bösen Verzauberer unter den Namen Jaja (also ebenso wie heilige Trompete und Vagina). Verschiedenes.
Die Bokko und Nandji sind tüchtige Farmbauer. Ich habe oben schon gesagt, daß sie, zumal in der Vergangenheit, auch als reiche Herdenbesitzer gelten müssen. Von der Verwendung des Düngers (Dünger in Fulfulde konal; in Haussa taki; in Nupe =ngoba; in Joruba =eta) kann ich den Nandji nichts Rühmliches nachsagen. Sie werfen den Dünger der Ziegen und Schafe auf die Okrofelder, damit die Schafe nicht davon naschen. Im Gegensatz hierzu wissen die Bokko den Sori-wido, den Mist der Ziegen und Schafe (den der Rinder verloren sie ja mit den Herden) sehr zu schätzen. Sie sammeln ihn sorgfältig auf Dunghaufen und bringen ihn, noch ehe die Trockenzeit beendet ist und die Regenzeit einsetzt, auf die Felder.
Dagegen haben sowohl Nandji wie Bokko riesenhafte Abfallhaufen vor ihren Gehöften. Die Bokko nennen diese Haufen Bure. Alltäglich wird der Kehricht und der Unrat aus dem Gehöft dahinauf getragen, so daß er ständig wächst. Diese Bure sind nicht nur die Lug-ins-Land-Plätze, die Wachttürme, von denen man das ganze Land weithin übersehen kann, sondern auf ihnen versammelt sich auch alt und jung allabendlich zum Tanzen.
Die Musikinstrumente, die den fröhlichen Zusammenkünften dienen, sind allerdings harmloser Art. Die Trommel scheinen nur die Bokko zu besitzen. Es ist ein ausgehöhlter Stamm, auf den einseitig ein Fell genagelt ist. Dagegen haben die beiden Stämme
eiserne Doppeiglocken, die bei den Nandji Banajo, bei Bokko Kukangwa heißen. Der Steißtanz der Mädchen, dem die Kanuri so gerne huldigen wie Losso und Tamberma, ist unbekannt. Ebenso fehlt die Harfe, die nur Batta, Komai und Tschamba kennen sollen.Entwickelter als die Belustigungsmusik ist die Signalsprache. Das ihr dienende Instrument ist bei den Nandji ein Antilopen- oder Ziegenhörnchen und heißt Wangio, bei den Bokko eine Holzpfeife, die Seile genannt wird. Mit diesen Instrumenten vermögen die Leute sich von Gehöft zu Gehöft zu unterhalten und wichtige Mitteilung zu machen. Man sagt, man könne sich gegenseitig beim Namen nennen. Experimente, die ich in dieser Hinsicht anstellte, mißlangen. Also dürfte es sich um eine Tradition über ein früheres Gekonnthaben handeln. Denn die Pfiffsprache ist fast überall, wo ich sie untersuchte, augenscheinlich im Rückgang begriffen. Nur wenige Stämme beherrschen sie vollkommen. Die meisten Äthiopen des Westens wissen aber noch genau, daß und wie man sich früher ihrer bediente. Aber auch heute im Krieg spielt das kleine Instrument noch eine große Rolle.
Im Kriege entschied vordem der Bogen, der natürlich die typische Adamauaform hat. Zum Spannen benutzte man in ältester Zeit einen Eisenring. Heute greift auch hier mehr und mehr der Lederzapfring, der Lugudjare um sich. Es soll kaum noch diesen Spannring geben. Der Lugudjare stammt nach übereinstimmender Angabe der Nandji und Bokko von den Batta, bei denen ihn auch die Fulbe zuerst kennengelernt haben sollen. — Das Wurfmesser fehlt bei den Stämmen. Es wird mit dem Worte der Fulbe —Galli =ehi — bezeichnet und gilt hier als Nationalwaffe der Lakka. Die Schleuder fehlt anscheinend den Bokko ganz und wird bei den Nandji, die sie Bamdera nennen, wie auch sonst in Adamaua und dem Sudan zum Schutze der Felder gegen die kleinen Vögel von der Jugend angewendet. Als Kriegswaffe lernte ich sie nirgends in Westafrika kennen.
Von dem Handwerk dieser Kleinbauern ist nicht viel zu sagen. Am Webstuhl (=Wamdji-ningo oder Nungo) wurden früher mehr und bessere bunte Zeugbänder hergestellt (Hile) als heute. Rindenstoffe verstehen nur die Nandji, nicht die Bokko weich zu klopfen. Die Kalebassen werden bei Nandji horizontal und vertikal, bei Bokko nur vertikal geschnitten.
Den Doppelbruderschaftstrunk nach Art der Tamberma kennen weder Bokko noch Nandji,wohl aber die Batta,bei denen Liebende und Freunde mit aneinandergelegter Wange aus der Kalebasse trinken und dies Ndjo nennen. Aus Kalebassen stellten auch die Bokko früher ihre Wire genannten Penisfutterale her. — Männerarbeit ist die Sekkofabrikation, aus welchen hier auch Gefäße für Erdnüsse und Bienenkörbe gebunden werden. Bei Bokko heißen diese Pigo.
Eigenartig verhält es sich mit der Schmiedekunst. Daß der Gelbguß diesen Stämmen unbekannt ist, versteht sich von selbst; aber wenn man bedenkt, daß die Schmiede bei den Durru gewissermaßen alles sind, Priester und Häuptlingswähler, wenn man bedenkt, daß jede heilige Handlung dort von den Schmieden ausgeführt wird, und wenn man sich dazu vergegenwärtigt, daß die Bokko eine Durrusprache reden, dann ist es doch sehr eigenartig, daß bei diesen selben Leuten die Schmiede nichts bedeuten, auch nicht ein einziges Zeremonial in Händen haben sollen. Die Nandji aber sagten, sie wollten auf keinen Fall mit den Schmieden heiraten; sie hätten früher überhaupt keine Schmiede im Lande gehabt und hätten damals alle Eisensachen von den Batta bezogen.
Die Bokko haben über ihrem Schmiedefeuer entweder ein kleines Küken oder einen kleinen Vogel mit rotem Schnabel und rotem Schwanz und meist von blauer Farbe hängen. Die Joruba nennen ihn Eijohu, die Nupe Eloguag. Beide haben überall die gleiche Sitte und ich meine, ich hätte sie während der Tambermareise, in dementsprechenden Kapitel, auch für Tamberma und Mande gebucht.
Männer und Frauen tragen bei den Bokko die Lasten auf dem Kopf. Die Weiber haben für ihre Kinder aber das Woko, d. i. das Rückentragleder mit Schulterriemen, das ich zuerst bei den Komai sah. Schultertragkörbe kommen hier nicht vor, sondern erst im Süden, bei Tibati.
Bei den Nandji werden, wie bei den Komai, mit denen sie ja auch sonst allerlei Übereinstimmung aufweisen, die oberen vier Schneidezähne zugespitzt, bei den Bokko fehlt diese Sitte.
Nun noch an Negativem: Vergeblich forschte ich bei diesen und andern Bergvölkern Adamauas nach dem Vorkommen von alten Steinbeilen und irgendeiner Donnerkeilanschauung. Ich fand nichts dergleichen. Die Fulbe, die die Donnerkeile heire-firmango nennen, behaupten, daß ein Stamm (der Mannastamm) im Tingwegebiet solche Steine verehre; es hat sich später von Banjo aus aber keinerlei Bestätigung ermöglichen lassen. Und ebensowenig wie diese hat irgendein Volk dieser Länder die Stein- oder Lehmphallusfiguren, die im Westsudan eine so große Rolle spielen.
9. Kapitel: Die Durru*
Geschichte, König und Oberschmied, Schwirren, Reife es!. —Die Durru, die sich selbst Divio nennen, wohnen in der Mitte zwischen den Stämmen, die altäthiopische Reichsorganisation aufweisen,
Diesen Königen war also, wie gesagt, das Durruvolk tributpflichtig und sie zahlten alljährlich ihre Abgabe in kleinem, bei ihnen heimischem, buckellosem Rindvieh und vor allem in Speeren, Schaufeln, Messern u. dgl., denn wir werden sogleich sehen, daß die Durru das vornehmste Volk der Eisengewinnung Zentral- und Nordkameruns sind. Aber diese Oberhoheit verhindert es nicht, daß die Durru ihre eigenen Häuptlinge "Djab" genannt hatten. Eine jede kleine Durruortschaft hatte einen Djab. Wenn er starb, ward sein Sohn Djab. War der Djab gut, so ließ man ihn regieren, solange er lebte. Wenn er aber immer alles verzehrte, und niemand etwas von seinen Einnahmen und seinem Besitz abgab — wenn er also ein egoistischer, im äthiopisch-kommunalen Sinne "schlechter"Häuptling war, so wurde er kurzerhand abgesetzt, und darin erwiesen sich die Durru also als echte Äthiopen.
Die Durru sind das vornehmste, in der Ausübung dieses Handwerks allen andern Stämmen Nord- und Zentralkameruns voranstehende Volk der Schmiede. Also ist es folgerichtig, daß die Volksanschauung auch die Häuptlinge aus gleichem Stamme herauswachsen sehen will. (Der Schmied = Lang, Plur. Lang-wio.) An ihrer Spitze steht
ein eigener Oberherr, das ist der Togbang; der Togbang hat einen Sohn, dessen Titel Dogna ist. Wenn der Togbang stirbt, folgt der Dogna ihm im Amt. Es ist also eine eigene Organisation.Man sagt, daß der Djab und der Togban ursprünglich von einer Familie abstammen. Beide Familien heiraten nicht ineinander und sagen, wenn ein Djab ein Schmiedemädchen heirate, dann würde es Krieg geben. Nun standen die Durru unter der Herrschaft der Bum. Also wurden auch die Insignien der Djabwürde von den Bum ausgegeben. Aber die Djab mußten sie, dem alten Herkommen zufolge, von dem Togban in Empfang nehmen. Es liegt also ein ähnliches Prärogativ zugrunde wie bei Dakka oder Tschamba, wo zuletzt auch alles von den Schmieden stammt, oder wie bei den Mande, wo der Numu als Geber alles Guten gilt. Die Insignien der Djab waren aber folgende: 1. der Mbull (im Bum =Mburi), d. i. der geflochtene Adeishut mit Eisenhutnadel, 2. der Wae, d. i. ein Armring aus Kupfer, bei den Bum Ahurum-pu genannt, 3. Gbangae, ein Baumwollschurz (im Bum =Latak). Dieser letztere ist sehr bemerkenswert. Die Bum haben bis vor recht kurzer Zeit gleich den Baja nur Rindenstoffe gehabt. Die Baumwollweberei ist bei den Namdji-Bokko-Durru entschieden älter als bei den Bum. Also dürfen wir annehmen, daß wenigstens das eine oder andere Königsinsignum nicht von den Bum stammt, sondern altes Besitztum der Durru ist. Es dürfte somit das ganze Zeremonial ohne weiteres älter als die Bumherrlichkeit sein. Im übrigen veranstaltet der Djab nach der Krönung eine Versammlung seiner ganzen Gemeinde; begrüßt sie, und veranstaltet eine allgemeine Speisung mit nachfolgendem Umtrunk.
Einen eigentlichen Priester haben die Durru nicht. Der Häuptling und der Schmiedeherr, also Djab und Togban, teilen sich in die Arbeit. Das ist vor allen Dingen das wichtigste Opferfest der Gemeinde, das Opfer (Njobe, in Bum = Wwenn) der Sommer- und Reifezeit. Dieses wird veranstaltet, wenn das Sorghum noch niedrig ist und noch nicht einmal schulterhoch steht. Für den Tag ist maßgebend, daß der Mond noch eine ganz schmale Sichel darstellen muß, also etwa erst drei Tage alt sein darf. Es versammeln sich dann vor dem Königsgehöft alle männlichen Glieder der Gemeinde, alte wie junge, weibliche Wesen sind ausgeschlossen. Mit Sonnenaufgang tritt der Djab mit einem weißen Widder (Mbehere) heraus. Es wird da eine kleine Grube ausgeschachtet. Über ihr schlachtet der Djab den Schafbock, so daß alles Blut in die Grube rinnt. Der Djab betet zu Tagelle, d. i. Gott, dessen Aufenthalt man augenscheinlich in der Grube sucht, um Fruchtbarkeit der Farmen, um Gesundheit, um Kindersegen, dann aber auch um Glück auf der Jagd und um erfolgreiche Arbeit der Schmiede. Nach dem Opfer und Gebet wird die
Grube geschlossen. Danach wird Essen bereitet; es gibt Hammelfleisch mit Brei und hinterher Bier, viel Bier. Die Weiber aber sind auch von diesem Mahle und diesem Gelage ausgeschlossen. —Nachts aber, wenn alle Weiber in ihren Hütten sind, schwingt der Dogna, der Sohn des Togban, die Nsakka, das sind die Schwirren. Es gibt bei den Durru sowohl solche aus Eisen wie aus Holz, aber es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß Frauen sie auch hier keinesfalls sehen dürfen. Die Eisenschellen (Jeskinna) gibt es bei den Durru nicht (wohl dagegen bei den Bum, die sie Gvewell nennen). — Mit dem nächtlichen Schwirren hat das Fest sein Ende.Diese Veranstaltung steht lediglich mit der Reife in Verbindung; es ist ein Bittopfer. Das entsprechende Erntedankfest fehlt angeblich vollkommen. Es soll bei den Durru in keinem Landesteile Sitte sein, und demnach sollen auch sexuelle Enthaltung oder Verbote des Fruchtgenusses vor einer bestimmten Zeit durchaus fehlen. Jeder kann jederzeit von seinen Feldern nehmen und genießen, was er will, er braucht nicht auf eine der Allgemeinheit erteilte Genehmigung warten, nur muß er zuvörderst ein Opfer, ein Njobe, darbringen, eine Abgabe an die Schmiede. Damit aber hat es folgende Bewandtnis.
Die Durru ernten der Reihe nach von ihren Farmen: Jams, Panikum, Mais, Erdnüsse und können diese ohne Opfergabe jederzeit nehmen und genießen. Die andern drei Feldfrüchte dürfen sie aber erst zur Speisebereitung nehmen, wenn sie die Erstlinge dem Schmied dargebracht haben. Diese Erstlinge gelten als Opfer für die Nsakke oder Ndjakke, für die Schwirren, und ehe sie dargebracht sind, gilt es als durchaus gefährlich, von der neuen Ernte auch nur das geringste zu genießen. — Also schon hier in der Erntezeit tritt der Schmied hervor, und das ist genau so wie bei den Mande. —
Die Nsakke werden für gewöhnlich in einer Höhle im Gebirge aufbewahrt. In diesem natürlichen Felsgelaß befinden sich aber nicht nur die Schwirren, sondern auch der Topf, in dem in einem Beutel die Präputien der Beschnittenen aufbewahrt sind. Dieses Höhlengelaß wird mit einem Felsblock geschlossen und nur dann geöffnet, wenn nachts ein Schwirrenzeremonial veranstaltet wird oder wenn die Präputiensammlung einen Zuwachs erfährt. Das Schwingen der Schwirren erfolgt aber bei folgender Gelegenheit: 1. gelegentlich der eben beschriebenen Opferung des weißen Schafbockes. 2. Wenn ein ganz alter Mann oder der Djab oder ein Schmied stirbt, und in letzterem Falle am nachhaltigsten, nämlich fünf Tage lang; dies deshalb, weil der Schmied als Vater der Schwirren gilt. 3. Wenn die Beschneidung stattfindet. Außerhalb dieser Gelegenheiten sollen die Schwirren aber nicht in Bewegung gesetzt werden.
Bleibt der Regen ordnungswidrig lange aus, so daß den Farmen ernste Gefahr droht, so begibt sich das Volk zu einem Gan oder Gann (s. u.) und fragt ihn nach der Ursache des Ausbleibens. Der befragt sein Orakel und findet, daß offenbar irgendein schlechter, bösartiger Mensch den Regen zurückhalte. Danach läuft das Volk insgesamt zum Schmiedemeister, zum Togban, und berichtet dem, was der Gan gesagt habe. Der nimmt davon Kenntnis und fordert das Volk dann auf, mit ihm zu kommen. Er setzt sich an seine Spitze und fordert alle auf, ihm zu folgen.
Der Togban begibt sich mit seinen Leuten zu einem Wasserplatz und sagt: "Jetzt muß ein jeder von euch mit der Hand aus diesem Wasser schöpfen, muß das Wasser trinken und sprechen." Danach tritt einer nach dem andern hervor. Jeder schöpft mit der Hand Wasser, trinkt es und streicht sich mit der feuchten Handfläche mehrfach über den Kopf. Dazu spricht er: "Wenn ich es war, der den Regen zurückhielt, dann soll mich das Wasser töten!" Das muß unbedingt ein Dorfbewohner nach dem andern machen, denn der, der es tat, der wird sich unbedingt weigern zu trinken und zu schwören. Sollte er es wagen, so würde er, nach dem Volksglauben, einen fürchterlichen Tod sterben. An der Weigerung erkennt man also den Bösewicht. Er wird nun zum Djab gebracht und der tötet ihn durch Kopfabschneiden, nachdem er gezwungen wurde das Geheimnis der Zauberei zu lüften, so daß diese annulliert werden kann. Die Regenbannung und -lösung aber erfolgt auf folgende Weise:
Ein schlechter und in dieser bösen Sache wohlbewanderter Regenbanner beschafft sich zunächst einen roten Hahn. Den tötet er, reißt ihm den Schwanz aus und bindet dessen Federn sorgfältig zusammen. Hiernach macht er eine kleine Grube in die Erde und füllt in diese rote Erdfarbe, die Wagare genannt wird. Wenn nun eine Regenwolke am Himmel in irgendeiner Richtung auftaucht, dann nimmt er zuerst etwas mit dem Finger von der roten Farbe aus der Grube und tupft sich dann einen roten Fleck unter jedes Auge. Danach taucht er auch das Bündel der Hahnenschwanzfedern in die Grube mit der aufgelösten Wagare und führt mit lang ausgestrecktem Arm, den Hahnenschwanz als Wegweiser in der Hand haltend, eine große Bewegung aus, zuerst auf die Wolke weisend und ihr, mit dem Hinstreichen durch die Luft entlang, den Weg am Horizont
angebend, den sie gehen solle, damit sie nicht über die Ortschaft auf... steige und sich über ihre Farmen ergieße. Dazu sagt er sinngerecht: "Diesen Weg sollst du gehen!" Und die Wolken folgen dann der Bannung und Vorschrift und ziehen ohne Entladung am Himmel vorbei.Soll dieser Bann nun aufgehoben werden, so muß eine Entzauberung stattfinden und das ist nur dann möglich, wenn der Mann selbst dazu die Gelegenheit gibt. Deshalb tötet man ihn nicht eher, als er den Platz gezeigt hat, wo er den fluchwürdigen roten Hahnenschwanz verborgen hat, das ist gewöhnlich im Busch und unter der Wurzel eines Baumes. Dort ist er meistens mit einem Stück Eisen zusammen in ein Antilopenhorn gesteckt und über und über mit roter Farbe bedeckt. Dieses Zaubergerät darf man nun um alles nicht etwa verbrennen (wie klar hieraus die Beziehung zum Feuer und die Eigenart diametraler Beziehung des Regen-zum Feuerzauber spricht!), sondern man muß es in den Fluß werfen; dann erst kann der Regen wieder niederkommen.
Das ist sehr klar: Mit dem Feuerzauber wird der Regen gebannt. Rot, zumal roter Hahnenschwanz gehört zum Feuerzauber. Man muß ihn dem Wasser überliefern, gewissermaßen seine Flammenmacht im Wasser ersticken und löschen, ehe der Regen sich wieder Zutritt zu der Stelle verschaffen kann, von der die Feuermacht, der Feuerzauber ihn so lange fernhielt.
Die Beziehungen des roten Hahnes zum Feuer treten klar und unverkennbar hervor bei den Opfern, die die Schmiede ihren eigenen Unternehmungen widmen. Man kann das im Frühling sehen, wenn zum ersten Male wieder eine Schmelzung im Hochofen vorgenommen werden soll. Nachdem dann alles, was zur Arbeit an Material und Gerät nötig ist (also Holzkohlen, Holz, Eisensteine, Gras, Gebläse, Haken, Wasserkalebassen usw.) zusammengetragen oder hingelegt ist, bringt der Tagban einen roten Hahn. Den schlachtet und (Nog(o)-njere = Hahn rot) opfert er. Und danach erst beginnen die Schmiede ihr Werk. Wir finden also abermals eine durchgreifende und hochwichtige Übereinstimmung mit den Sitten der Numu, der Schmiede der Mande. Fernerhin hängen die Schmiede in ihren Werkstätten über dem Feuer ebenfalls den Kopf eines roten Hahnes auf.
Und ganz typisch ist der Gegensatz, das Ausbleiben des Hahnenopfers. Wenn vor der Erntezeit, also am Ende der Regenzeit, die ganze Familie der Schmiede zu einem Bittfest zusammenkommt, dann wird viel Bier gebraut, alles Geräte auf dem Boden ausgebreitet und Bier darüber gegossen. Der Schmiedemeister hält eine Rede, in der er um Gesundheit, Kinder, ersprießliche Arbeit usw. bittet. Auch zieht man hinaus und gießt auf den Hochofen, der in dieser Jahreszeit ja still steht, Bier und klebt ein wenig Mehl daran. Bier und
Sorghummehl dienen aber der Fruchtbarkeit, dem Erfolg. "Wenn bei dieser Gelegenheit dagegen ein roter Hahn den Schmiedegeräten geopfert werden sollte, dann würde alles Ackergeräte nutzlos werden, denn es würde kein Regen kommen, der die Felder auffrischt und dem Korn Kraft zum Wachsen gibt. Für dieses muß eben Bier und Sorghummehl geopfert werden." So sagte mir ein alter Durru, und wenn ich ihn auch nicht für viel logischer denkend erachte als die andern Durru, so übertraf er sie doch im Verständnis für die Folgerichtigkeit der alten Sitten, die so recht deutlich die diametrale Feingliederung von Regen- und Feuerzauber zeigen.Guare = Säuglinge, Nasale = unbeschnittene Burschen, Nadungujo = beschnittene Burschen, Sarbujo Verheiratete, Bogono Alter, Familienvater, Bognare = Greis. |
Der große Wendepunkt im Mannesleben fällt in die Zeit der Beschneidung. Vorher war er Kind, Familienappendix, Frauengut; nachher ist er Burseh, Mann, Bürger. — Die Beschneidung (donge) findet alle drei Jahre statt. Wenn der Zeitpunkt wieder kommt, sammelt der Dogna, Sohn des Togban, allenthalben die Burschen ein, bringt angeblich derart an die fünfzig zusammen, und führt diese seine Schäfchen, hinaus zum Hiate, d. i. ein wohigereinigter Platz östlich der Stadt, auf dem die Jünglinge die nächste Zeit zuzubringen haben. Hütten werden dort nicht errichtet. Die Männer begeben sich mit hinaus und beobachten die Zeremonie teils von der Ferne — so der Djab und die älteren Männer — oder aber sie sind bei der Operation behilflich —das sind die älteren Brüder der Burschen und die Mutterbrüder, also Onkel mütterlicherseits.
Das Opfer geht unter fröhlichem Lachen und unter Begleitung einer reichhaltigen Trommelmusik vor sich. Die Beschneidung wird an einem Wasser vorgenommen. Der Ausführende, der Dogna, hat eine Leopardenfeilmütze auf, ist mit roten Flecken bemalt und faucht und zähnefletscht nach Noten, gibt sich also keinerlei Mühe, den Burschen ihre schwere Stunde zu erleichtern. Jeder Bursche muß den Kopf weit zurücklegen. Der Bruder hält ihn, so daß der zu Beschneidende die Operation nicht sehen kann. Der Dogna zieht die Vorhaut (doke) möglichst weit vor, schneidet das Nötige mit einem Ruck ab und bindet den Rest vor der Glans zu, so daß die Blutung schnell aufhört. Alle Vorhäute werden in einen Topf geworfen, der nachher in der gleichen Höhle aufgestellt wird, in der die Schwirren
sind. Auf keinen Fall darf der Bursche schreien, das würde ihm unsagbaren Schimpf und Spott eintragen. Nach der Operation und der Aderunterbindung tritt der Bruder oder Mutterbruder seine Tätigkeit an. Er wäscht die Wunde und verbindet sie. Abends erfolgt dann das Schwirrenschwingen, und die älteren Genossen teilen den Novizen der Männergenossenschaft mit, was für eine Bewandtnis es mit diesen Instrumenten auf sich hat; gleichzeitig aber ermahnen sie die jüngeren Kameraden, nur ja nicht etwas davon den Frauen zu sagen, denn diese könnten das nicht ertragen und würden sterben.Die Beschäftigung der Burschen erstreckt sich in der Buschzeit zumeist auf Kleinjagd und Fischerei. Was sie dabei erbeuten, das bringen die Brüder in die Ortschaft zu den Müttern und Schwestern der Operierten; die fügen das als Leckerbissen den Speisen zu, welche die Brüder tagtäglich in das Beschneidungslager bringen, wo die Kameraden ordentlich miteinander teilen. Die Kleidung der Beschnittenen in dieser Zeit besteht in Blätterkappe, Blätterbehang um den Hals, Blätterbehang um die Lenden. Dieses Blätterkleid heißt Huade (Beschneidungsplatz soll heißen Hiate [s. oben]). Einen Monat lang währt dieses Buschleben und es versteht sich von selbst, daß die Jünglinge während dieser Zeit kein weibliches Wesen sehen dürfen. Jeden Morgen ziehen die Burschen aus zur Jagd, und jeden Abend kehren sie an ihre Lagerplätze zurück, auf welchem sie dann im Freien essen und schlafen. Ehe sie sich aber niederlegen, üben sie das Schwingen der Schwirren, so daß man dies allabendlich in die Ortschaften hinüberschallen hört.
Dann erfolgt die Heimkehr, die Burschen legen ihr umfangreiches Blattkleid ab und reiben sich mit Fett und roter Farbe ein. So erscheinen sie wieder im Dorf, tragen noch drei Tage die Blätterbüschel und legen dann den landesüblichen Lendenschurz um. Bei der Rückkehr erfolgt kein Schwingen der Schwirren. Wenn nun ein Bursch in der Buschzeit starb und die Mutter unter den Wiederkommenden vergeblich nach ihm sucht, so sagt man der ängstlich Fragenden, der Leopard hätte ihren Sohn im Busch getötet.
Von der Beschneidung sagt man bei den Durru, daß der, an dem sie unterlassen sei, schlecht mit den Weibern fahre und daß der, an dem man sie nicht vollzogen habe, nichts mehr im Busch und auf der Jagd erlegen würde.
Wenn der Bursch nun aus dem Busche beschnitten heimkehrt, so schafft er sich bald eine Freundin an. Bei den Durru nennen Freund und Freundin sich untereinander Jare oder Jore, bei den Bum Dalla. Aber wie harmlos dieses Verhältnis ist, kann man schon daraus erkennen, daß man mehrfach übereinstimmend erklärt, die Dalla wäre zunächst nur "so"groß. Dabei wiesen die Berichterstatter auf Mädchen von vier, höchstens fünf Jahren hin und gaben bei Anwesenheit
einer solchen die entsprechende Größe an. Man erwartet auch nicht, daß das Mädchen in diesem Alter auch schon einen großen Wahiverstand habe. Der Bursch nimmt vielmehr zwei Eisenschaufeln unter den Arm, geht zum Vater der Erwählten und nimmt mit diesem die Sache durch. So ist die Ehe für später vorgesehen und das Mädchen nicht weiter den Skrupeln über die Wahl ihres Gatten ausgesetzt. Diese Verlobung ist genau so brutal und radikal wie die entsprechende Kinderverlobung bei äthiopischen Stämmen Nordtogos. —Von nun an arbeitet der Bursch für seinen Schwiegervater auf dessen Farmen. Aber während der ganzen Zeit spricht er nicht mit seiner Braut. In der gleichen Zeitspanne läßt er sich von seinem Vater dann und wann Schaufeln und Ziegen und anderes geben, was er alles dem Schwiegervater ins Haus bringt. Es ist also durchaus ein Geschäft auf Abschlagszahlung, wie es der alte Jakob schon um Leas und Rahels willen betrieben hat. Wenn dann alles bezahlt und abgearbeitet ist, wird das Mädchen in einem Alter, das dem vorgewiesenen Exemplar nach kaum neun oder zehn Jahre überschritten haben kann, von der Mutter dem Bräutigam ins Haus gebracht. Auf dem Wege zum Bräutigam weint das Mädchen. Aber wenn es dort angekommen ist, unterdrückt es die Tränen.Dann gelten die beiden als verehelicht, und der Bursche beginnt auch in der kommenden Nacht die Deflorierung. Die Beischlafsform soll die europäische Decklage sein, die Üblichkeit der äthiopischen Hockstellung wird von den Durru bestritten, und ebenso erklären sie, die Seitenlage der Bum nicht angenommen zu haben. Vor der Verehelichung war dem Mädchen keinerlei Verhältnis gestattet und ebensowenig die Genehmigung zur Liebelei gegeben; daß das wahr ist, läßt sich nach dem kindlichen Alter der Braut ja annehmen. Nun bei der Verehelichung rechnet man bis zu fünf Tagen bis zur endgültigen Zerstörung des Hymens. Ist sie erfolgt, so sendet der dankbare Ehemann der Schwiegermutter zwei eiserne Schaufeln als Ausdruck der Anerkennung ihrer ausgezeichneten und erfolgreichen mütterlichen Fürsorge. Die Braut bringt als Ausstattung mit: Töpfe = Budi; Kalebassen
Lake; dann Fisch = Duti und Salz = Kummi. Bursche und Mädchen haben sich vor der Verehelichung noch in gleicher Weise, wie das auch bei den Baja Sitte ist, die oberen und unteren vier Schneidezähne spitz feilen lassen.
Trotz des anscheinend doch wenigstens sehr häufig noch recht kindlichen Alters der Braut, nimmt man an, daß sie nach einem Monat schwanger sei und zehn Monate nach der Verehelichung ein Kind gebären würde. Die Gebärende sitzt wie die Lakka auf der Kante eines Steines in ihrem Hause. Zwei erfahrene Frauen helfen ihr wie dort. Die Nabelschnur (Kinri) wird mit einem Messer losgeschnitten.
Die Nachgeburt (Kede) wird in einem Topf vergraben. — Die Nabelschnur soll bei Knaben nach drei Tagen, bei Mädchen nach vier Tagen abfallen. Sie wird unter einen Stein gelegt, und nachher wäscht sich die junge Mutter vier Tage lang über dieser Stelle. Ich muß diese Sitte schon irgendwo in Togo oder im Mossilande aufgezeichnet haben. Vier Tage nach der Geburt schneidet die Mutter sich die Haare und am fünften wird dem Kinde der Name gegeben. Das aber tut die Schwester des Vaters.Wenn Tagille = Gott als Krankheitserreger vom Gan erkannt ist, ist mit Menschenkräften weiter nichts anzufangen und zu helfen. Tagille wird mit einem großen Berg in Zusammenhang gebracht. Wenn ein scharfer Wirbelwind (Girgiu im Fulfulde =Dulurru, im Kanuri =Mudurua, im Haussa =Gugua, im Joruba =Igi, im Nupe = Dunduffe) des Tages über durch das Land streicht, Dächer abdeckt und Farmen verwüstet, so sagt man, das käme von Tagille. Man schreibt aber nicht nur derart widrige Vorkommnisse wie Tod und Verwüstung Tagille zu. Man glaubt vielmehr, daß er es auch ist, der alles Gute bringt, und wir sahen schon am Anfange der Durrubeschreibung, daß der Djab ihm alljährlich das Opfer des weißen Widders darbringt.
Wenn ein Mensch gestorben ist, wird sein Leichnam zunächst gewaschen; wenn er ein angesehener Mensch war, so wird der Leiche die Seite aufgeschnitten und alle Eingeweide (Njae) werden herausgenommen. Bei Männern erfolgt die Weichenöffnung rechts, bei Frauen links. Die Njae werden in einem Loch hinter dem Hause vergraben. Die Bauchhöhle wird alsdann mit Blättern (Hüote) eines Lae genannten Baumes ausgerieben und die Schnittstelle wieder vernäht.
Die derart zur Mumifizierung vorbereitete Leiche wird nun lang gestreckt, auch mit über den Kopf weg lang- und mit der Handfläche gegeneinander gelegten Armen neben ein starkes Feuer gelegt und dort ausgetrocknet. Frauenleichen bleiben vier Tage, Männer-Leichen drei Tage zum Austrocknen am Feuer liegen. Während der Zeit wird die Leiche mit Sampakka fest umwickelt. Sampakka ist breiter, starker Baumwollbandstoff, den die Durru ebensogut zu weben vermögen wie die Bokko, Nandji und Komai. Die Durru geben an, daß nach Ablauf dieser drei resp. vier Tage die Bandumwicklung zwar fettig, der Körper selbst aber durchaus trocken sei. Solch schwieriges Mumifizieren führt man aber nur für Djab und hochangesehene Leute aus.
Wenn solch alte und angesehene Männer sterben, dann lacht und tanzt die Familie und mit ihr das ganze Dorf. Junge Leute werden aber nicht mumifiziert, dagegen weint und klagt man um sie, weil sie so früh gestorben seien. — Das Grab wird draußen im Busch, im Osten der Ortschaft hergerichtet. Es ist eine vertikale Grube, die tief genug ist, um die senkrecht hineingestellte Leiche mit dem Kopf über den Rand hinwegragen zu lassen. Die Leiche wird dementsprechend hineingestellt und dann die Grube so weit zugeschüttet, daß nur Kopf und Hände herausragen. Das Antlitz der Leiche ist dem Sonnenuntergang zugewendet. Über den Kopf und die Hände wird ein schützender großer Topf gestülpt, der an den Rändern verkleistert wird. Draußen im Busche werden außerdem einige Tagelang für den Angesehenen die Schwirren geschwungen, und wenn es ein Schmied war, der begraben wird, so dauert das Surren vom Tage des Todes an fünf Tage. — Hiermit ist überhaupt die Begräbnisform geschildert, die man Angesehenen und Alten, Häuptlingen und Schmieden zuteil werden läßt. Junge Leute werden einfach lang in das Grab gelegt.
Dieses ganze Verfahren und seine Ausführung überhaupt liegt in den Händen der Schmiede. Man erkennt an der senkrechten Stellung der Leiche und der Eingrabung bis an den Hals, daß man vorhat, den Schädel wegzunehmen, daß man hier also nur ein anderes Verfahren eingeschlagen hat als bei Nandji und Bokko. —Zumal beim Djab ist folgendes Sitte: Drei Monate nachdem seine Leiche der Erde übergeben ist, geht der Schmiedemeister hin und hebt den schützenden Topf auf. Er nimmt den Schädel des alten Djab (sein Nachfolger wurde schon drei Tage nach seinem Tode gewählt, also am Tage nach seiner Bestattung) auf und hüllt ihn in Blätter. Der Schmied hat die gesamte Familie des verstorbenen Djab zusammengerufen, und somit sind die Angehörigen mit ihm hinaus zum Grabe gezogen. Sie wohnen der Abdeckung des Topfes bei. Der Schmied sagt zu dem freiliegenden Schädel: "Deine Zeit ist um; du hast deinen Sohn geboren, dein Sohn ist nun Djab. Komm und sieh, daß es jetzt gut geht. Komm mit dahin, wo auch die andern sind." Danach nimmt der Schmied den Schädel auf und reinigt ihn. Er legt ihn in eine Kalebasse und trägt sie nach Hause. Daheim wird der Schädel noch einmal gründlich gewaschen und mit roten Linien bemalt, von denen eine der Mittelhauptnaht und eine quer dazu dem Verlauf der hinteren Stirnbeinkante entspricht.
Dies ist aber der Ort, wo der Schädel nun Unterkunft findet. In jedem angesehenen und völlig ausgebauten Durrugehöft kann man, von außen durch das Keeme genannte Tor haus eintretend, rechts ein kleines Haus wahrnehmen, welches Riki oder Rigi oder Liki genannt wird. Das ist das eigentliche Haus des Hausherrn, das Herrengemach,
in welchem eine Feuerstelle ist und neben einem Bett allerhand Gerät, und vor allem der Biertopf steht. Es ist der Trinkraum des Hausherrn, der in einem gewissen Sinne im Rufe der Heiligkeit steht. Die Weiber haben hier für gewöhnlich nichts zu suchen. Dies Rigi entspricht nun genau den gleichen Kammern bei andern Stämmen.
Das Haus nun, das den Schädel des verstorbenen Djab aufnimmt und das im Gehöft des Häuptlings liegt, ist auch ein Rigi, und zwar heißt es im speziellen Rigi-njobe. Njobe ist aber wohl am besten mit Opfer zu übersetzen. Das Rigi-njobe liegt auch im Gehöft, ganz ähnlich dem Rigi anderer Leute, also vom Eintritt durch das Torhaus gesehen, auf der rechten Seite. In diesem Rigi-njobe liegen wohl geordnet, jeder in einem eigenen Topfe, schon eine ganze Reihe von Schädeln; es sind eben die Schädel der verstorbenen Djab dieser Ortschaft, alle von gleicher Familie.
Jedes Jahr einmal, wenn das Sorghum reif, aber noch nicht geschnitten ist, kommt der Togban, der Obermeister der Schmiede, mit einem roten Hahn, opfert ihn dort und läßt dessen Blut über alle Schädel träufeln. Dabei betet er: "Das erhaltet hier! Nun sorgt, daß alles gut wird, daß der Krieg gut verläuft, daß die Ernte gut wird, daß die Jagd gut wird, daß die Kinder gesund geboren werden, daß keine jungen Leute sterben!"
Man sieht, die Ahnenschädel der Djab vertreten hier die Stellung der Holzfiguren der Dakka-Tschamba. Die Schädelsitte aber haben sie gemeinsam mit Bokko und Nandji und Faili, mit den Werre und dann auch mit den Leuten jenseits der Berge und der großen Schlagader, mit den Djennleuten und den Tangale.
Aber in einem weichen die Durru angeblich durchaus von allen Nachbarn ab. Sie bringen die sterilen Töchter weder zu den Gräbern der Väter und Großväter, noch zu den Schädeln überhaupt. Sie gehen mit ihnen vielmehr zum Gan oder Gann(e), bringen ihm eine Schüssel Mehl und bitten ihn um seine Vermittlung. Darauf wirft der seine Steinchen und gibt der jungen Frau einen Trank, er heißt sie heimgehen und das Beilager mit ihrem Manne aufsuchen.
Die Durru nennen:
sich selbst Diwio, die Bum Bummi, " Lakka Laga, " Bokko Wogonina, Nandji Nandji, Tschamba Saneba, " Batta Bogo-waeo, " Damma Damo, " Fulbe Djomai-wio, " Kanuri Sirrta-wio. |
10. Kapitel: Die Bum*
Kulturelle Stelle des Stellung zentralen und Kameruns Passivität der als Bum. typisch, — als Wenn originell irgendeine und charakteristisch für mehrseitige Kulturkreuzung bezeichnet werden kann, so ist es das Land, welches von den Bum bewohnt wird. Diese Bum zeigen Kulturbeziehungen nach jeder Richtung, nach der man von ihrem Lande aus sieht. Mit den Dama usw. sind sie durch Sprachgemeinschaft verbunden. Das Symptom begrenzten Königstums haben sie gemeinsam mit der Tschamba-Dakkagruppe; mit den Bamum teilen sie die Ausbildung der Vier-Erzämterschaft und des Adelshutes mit Eisennadeln, dessen entfernteste Verwandte am San. kurru bei den Bakuba heimisch sind. Mit den Lakka-Sarra haben sie die Sitte der Entbindungsstellung und der langsamen blutlosen Entjungferung gemeinsam. Aber während sie übereinstimmend mit den Stämmen im Nordwesten, den eigentlichen Adamaua, die Harfe haben, die den Lakka-Sarra fehlen, üben sie wie diese die Marimba, das Kalebassenpiano, das ihrerseits wieder die eigentlichen Adamauastämme nicht verwenden. Wie die zentralen Splitterstämme Adamauas, zumal die Durru, erkennen sie die Schwirrhölzer als Leoparden an, aber Jeskinna und Laera haben die Bum vollkommen eingebüßt. Und nach Südosten schauend, finden wir als archaistische, fast heilige Waffe am Hofe der Bumherrscher eine Wurfeisenform, die die Hauptwaffe der Baja ist, und mit diesen Baja teilen die Bum außerdem die weitgehende Verwendung von Rindenstoffen.
Allein schon diese Zusammenstellung läßt ahnen, wes Geistes Kind diese Leute sind. Das zuletzt Entscheidende ist aber, daß die Bum unter dem letzten Einfall der Fulbe und unter dem Oberbefehl des Fulbeherrschers von Ngaundere schwer gelitten haben. Besonders begabte Typen der Bum habe ich sowieso nicht gesehen, obgleich ich genügend Gelegenheit hatte, diese Leute kennen zu lernen; und so haben wir denn ein Volk vor uns, das nicht anziehen kann durch Kulturtiefe oder Intelligenz nach irgendeiner Richtung, das in nichts ein eigenes Wesen und eigene Umbildungen gezeitigt hat, ein Volk, das zwar eine politisch bedeutsame Stellung auf kleinem Raume einnahm, deren wesentlichstes Charakteristikum aber für den Ethnologen ist, daß sich von allen Richtungen her Kulturbeziehungen zu seinem Lande hin erstreckten, die sie selbst aber nicht auszugestalten wußten, wenigstens nicht in historischer Zeit. Daß die Bum in einer längst vergangenen Periode selbst einmal alle diese Fäden in ihrer Hand vereinigten, daß sie in diesen Perioden eine politisch bedeutsame
Den Bellagas war, wie allen Königen dieser Länder, der Genuß von Leopardenfleisch verboten. Wenn sie dieser Forderung nicht nachgekommen wären, so wären sie nach der Tradition der Bum sogleich gestorben. Das aber, was die Regierungsform der Bum von der aller Äthiopen des nördlichen Kameruns unterscheidet, das ist die ständige Aufrechterhaltung von hohen Beamtenstellen. In dieser
Hinsicht stellen die Bum das Bindeglied zwischen dem Kulturbesitz der Bamum und gewisser Kongovölker dar. Auf den Schultern dieser Beamten ruhte ein Teil jener Amtsübung, die wir sonst in andern Händen fänden. Die Beamten sind:1. Der Gang-Dulun heißt so viel wie Herr der Hügel; das Wort Gang zeigt deutlich eine Beziehung zur Herrschaft der Tschamba und Mudang. Dieser Mann hatte nicht nur den König ein- und ab. zusetzen, sondern er sorgte auch für die Speisen, den Trank und die Farmen des königlichen Haushalts. Dieser Fürst hatte ferner unter seiner Beaufsichtigung auch die Ha, das sind die Wurfeisen. Diese an sich schon merkwürdigen und originellen Instrumente sind bei den Bum noch wunderlicher als anderweitig. Sie werden hier nicht mehr zum Gefecht oder irgendwelchen kriegerischen Handlungen gebraucht, sondern werden nur bei feierlichen Gelegenheiten ausgestellt. Diese Wurfeisen haben nicht die starken, gestreckten, straffen, schlanken Leiber und Glieder wie die der Mundang und Lakka usw., vielmehr sind sie flach, blechartig dünn, mit bizarren breiten Ausläufern versehen, deren Spitzen dem Südtypus der Wurfmesser entsprechend in einem Kreise liegen, und vor allem sind sie sehr schön ziseliert. Es sind feine Schmiedearbeiten der besten Ausführung, die überhaupt Afrika liefert. Ich kenne nur wenige Exemplare dieser Ha. Sie sind alle uralt und müssen aus irgendeiner Glanzperiode stammen, denn bei allen blättert das Eisen mehr oder weniger ab, und ehe das bei einer von Afrikanern bewahrten Eisenwaffe geschieht, muß schon ein schöner Zeitlauf verstreichen. Und dem Alter ihrer wunderlichen archaischen Art und der feinen Arbeit entspricht auch die sorgfältige Behandlung, die die Bum diesen hochgeschätzten Gütern zuteil werden lassen. Diese Ha werden von Zeit zu Zeit ausgestellt und werden dann mit Gnu, d. i. Sorghumbier bedacht, eine Amtshandlung, die auch dem Gang-Dulun zufiel. —Endlich war es Aufgabe des Gang-Dulun, den Betrag der Abgaben, den die einzelnen Ortschaften zu entrichten hatten, zu bestimmen und über die Abgaben zu wachen. Diese Abgaben wurden Fengmanga genannt und bestanden in Sorghum.
2. Der Wangatu war der Herr der Schwirrhölzer, die hier Djerr oder Sirr oder Dirr genannt werden. Man erklärte schon mit entsprechender Namensnennung diese Schwirren als "Leoparden"und hat demnach hier die entsprechende Bedeutung bewußt aufrechterhalten. Diese Schwirren wurden in einer Felshöhle im Gebirge aufbewahrt und um alles in der Welt durfte kein Weib sie sehen. Sie wurden der äthiopischen Sitte nach zur Beschneidungszeit geschwungen. Die Beschneidung (Ben) fand aber alle vier Jahre statt und ihre Ausführung fiel folgerichtig dem Wangatu zu. Wenn die Stunde geschlagen hatte, wurde jedes vierte Jahr der Tirr genannte Platz im
Osten der Stadt hergerichtet. Jeder dafür "reife"Junge wurde vom Bruder der Mutter (wir sehen hier im Süden das Überwiegen matriarchalischer Idee!), dem Na, dorthin gebracht und dann führte der mit einem Lederschurz bekleidete Wangatu mittels eines kleinen Messers (=Djinn) die Operation aus. Das Präputium (=Djagbum) wurde in einem Erdloch verscharrt. — Nach der Operation blieben die Burschen noch einen Monat lang im Busche. Sie trugen Röcke aus Blättern und beschäftigten sich mit Schlagen von Brennholz, das sie später heimtrugen. Man begegnet also dem Bestreben, den Beschnittenen körperliche Bewegung zu bereiten, immer wieder. Wenn die Zeit der Heimkehr nahte, waren ihnen von den Angehörigen neue baumwollene Kleider bereitet und mit diesen zogen sie dann freudig begrüßt wieder ins Dorf ein. — In der Zeit des abgeschlossenen Buschlebens lernen die Burschen auch die Handhabung der Schwirren, von denen anscheinend nur hölzerne Typen bekannt sind. Wenn die Frauen in der Stadt das Surren aus dem Busche herüberschallen hörten und fragten, was das zu bedeuten habe, dann wurde zur Antwort gegeben, das sei Djerr, der Leopard, oder Mbaga, der Löwe, die bei den Burschen umgingen. Und wenn in der Beschneidungszeit ein Bursche starb, so wurde der erregten und tieferschütterten, eine Erklärung heischenden Mutter gesagt, diese wilden Tiere im Busch hätten den Sohn getötet. —3. Der Gang-Hai, d. i. der Fleischer, der Schlächtermeister, gleichzeitig der Haremswächter und überhaupt der Hausmarschall des Bellaga. Mit diesem Amt sind natürlich allerhand Nebenfunktionen verbunden. In alter Zeit hatte er Hühner und Ziegen für den königlichen Haushalt zu töten, heute aber, nach der Fulbeinvasion, hat er Rinder zu schlachten. Daneben liegt in seinen Händen aber auch die Verabfolgung des Gifttrankes, des Mball, an solche Leute, die schlechter Handlungen angeklagt und nun ihrer Bösartigkeit endgültig überführt werden sollen.
4. Der Gang-Psinna (d. i. der Herr der Djupinna, der Arbeiter), auch Gang-Sarrsorra (d. i. der Herr der Sarrasorra, d. h. der Baum.. stangen, Stöcke usw. zum Hausbau) genannt. Er hat alle Arbeiter unter sich, die den königlichen Palast zu reparieren und auszubauen haben, was nach jeder Regenzeit geschieht.
Diese vier Ämter sind durchaus erblich und ihre Ausübung geht vom Vater auf den Sohn über. Dagegen sind alle andern Würden, die der Bellaga dem einen oder andern verleiht, durchaus gelegentlicher und vorübergehender Natur. Wenn der König z. B. einen Feldherrn, einen Madell, aussendet, so hat er dieses Amt nur temporär, und mit einem etwaigen Abbruch der Gnade des Herrschers hört auch Stellung und Ausübung auf. Nie hat es einen erblichen Feldherrn gegeben, wie es die vier ersten Erzfürsten gab, und deshalb
stellt man diese vier Beamten allen andern gegenüber, indem man sie gemeinsam als die "Gang-Djuk" bezeichnet, d. h. man nennt sie die Herren hoher Stellung. — Diese vier hohen Beamten werden vom König auch dadurch ausgezeichnet, daß sie jeden Morgen und jeden Abend eine große Kalebasse mit gutem Essen erhalten, die sie dann immer gemeinsam leeren.Mit dieser Kalebasse voll Essen hat es aber seine eigene Bewandtnis. Die Sitte dieser Gabe beweist uns, daß, wie die alten Bamum ganz richtig sagen, diese vier hohen Herren eigentlich Sklaven des Königs sind, während der weniger geachtete und periodische Madell oder Feldherr dies nie ist. Die erbliche Würde am Hofe des früher so mächtigen Königs hat aber sowohl die vier hohen Herren selbst, wie das Volk den tiefen Stand, aus dem sie einst aufstiegen, vergessen gemacht. —
Die Altersklasseneinteilung der Bum ist folgende: |
mbafoi = kleine Kinder gunsigi = Burschen vor der Beschneidung bagajaga Burschen nach der Beschneidung sakandju = Verheiratete ndschutschokka = alter angesehener Mann porka = ganz alter stumpfer Greis. |
Der Bursche hängt mit seiner Arbeitskraft vom Vater ab. Der Vater muß dem Sohne auch das nötige Geld geben, wenn er heiraten will, aber der Sohn braucht dafür auch nicht auf dem Felde des Schwiegervaters zu arbeiten, sondern findet sich mit der Zahlung für die Frau ab. Er erlegt hierfür zehn Schaufeln (gpa = Tüllenschaufeln). Bis heute gibt es im Bumlande weder Stoffwebereien noch Stoffgeld. Mit dieser Zahlung hat der Jüngling das Recht an die Braut, und der Vater bringt sie demnach eigenhändig dem Schwiegersohn ins Haus.
Der Ehevollzug erfolgt wie bei den östlichen Nachbarn schrittweise, zielt darauf hin, im Laufe von zehn Tagen das Hymen beiseite zu schieben und die Perforation sowie jede Blutung zu vermeiden. Der Beischlaf selber wird seit undenklichen Zeiten bei den Bum in der Seitenlage ausgeführt.
Die Entbindung der Schwangeren wird im Hause vorgenommen. Meist soll nur eine Helferin zugegen sein. Die Stellung der Kreißenden ist nahezu ebenso wie bei den Lakka-Sarra, d. h. die Frau sitzt mit auseinandergestellten Beinen in der Hocke. Der Stein, auf dessen Kante die gebärende Lakkafrau den Steiß stützt, fehlt, aber die Helferin sitzt hinter der Bumfrau und stützt und preßt sie. Die Nabelschnur (= andere) fällt bei Mädchen nach vier, bei Knaben nach drei Tagen ab. Sie wird ins Wasser geworfen. Die Nachgeburt (=fessal) wird dagegen vor der Tür vergraben.
Erkrankte werden hier der Massage mittels Blätter, die vorher im heißen Wasser lagen, unterzogen. Diese Maßnahme heißt bei den Bum = Bassum. Fernerhin wird aber zur Weiterbehandlung ein Arzt, ein Nanjagoi herangezogen. Wie bei den Lakka ist dies Metier hier erlernbar und geht der Medizinbeflissene bei einem angesehenen Meister der ärztlichen Kunst gegen gute Bezahlung in die Lehre. Wird dem Arzte der Verlauf bei unklarer Diagnose bedenklich, so rät er selbst, den Spezialisten für alle Fälle, den Wahrsager, zu konsultieren. Dieser Mann wird bei den Bum als Ngalla oder Njangalla bezeichnet. Der Mann hat eine kleine, mit Wasser gefüllte Kalebasse als Orakelinstrument. Er schüttelt sie und sieht hinein: das Spiel der Wasserflächen gibt ihm Antwort auf alle Schicksalsfragen und er kann demnach die Ursache der Erkrankung und vor allem den Urheber des Übelstandes erkennen.
An Erkrankungen sollen, nach Bumansicht und Entscheidungen des Wahrsagers, schuld sein: der Geist eines Verstorbenen der Familie (Geist der Verstorbenen = hull; Familie =Nsoandere); oder Gott selbst (Gott = (o) wonn); oder aber ein bogo. Die Bogo gehören zu den Subachen-Werwolftypen. Es sind Menschen, die nachts umzugehen und in Gestalt eines Hundes das Herz ihres armen Opfers zu verzehren pflegen. Vielfach soll es vorkommen, daß der Schwerkranke kurz vor seinem Tode in einer klaren Stunde den Bogo errät, erkennt und selbst nennt. Dann wird der Unmensch getötet.
Die Toten werden gewaschen. Der Unterkiefer wird an den Kopf mit einem Stück Rindenstoff, mballa, welcher früher auch als Kleidung diente, gebunden. Die Bestattung erfolgt am Tage des Hinscheidens, und zwar wird für jeden Toten ein eigenes Grab ausgehoben. Man führt einen vertikalen Schacht in die Erde und führt von hier aus eine horizontale Kammer nach Norden. Sowohl Männer- wie Weiberleichen werden auf der linken Seite liegend mit dem Antlitz nach Osten bestattet.
Ist der Verstorbene ein alter verbrauchter Mann, ein Porka, so wird gejubelt, daß der unnötige Esser weg ist. Ist es aber ein junger Mann, so beweint man ihn. — Von alten Leuten nimmt man unbedingt an, daß sie wieder kommen.
Das heilige Gerät (also lauru der Fulbe), heißt mborrianga oder mbollianga. Einen umfangreichen Apparat besitzen die Bum nicht. Sie haben das oben geschilderte "Leopard" genannte Schwirrholz. Aber Laera, Jeskinna, Figuren und Masken fehlen durchaus. Bleibt der Regen aus, so ruft der Schmied (= wugu) morgens alle Leute zusammen. Diese bringen Rinden mit, die mischt der Schmied mit Wasser und spritzt dieses den zusammengekommenen Leuten auf den Kopf. Nachts fällt dann der Regen.
Aber niemand will in eine Schmiedefamilie heiraten.
Die Bum haben für die benachbarten oder mit ihnen im Verkehr stehenden Völker folgende Namen: Durru = Durrudje Baja = Bajadje Schamba = Tschamba Kanuri = Sirrotadji Fulbe = Birari Lakka Laga Damma = Damadje Batta = Battadji
11. Kapitel: Die Mulgoi —Kanuri*
Kanuri und Bornu in ihrer ethnologischen Stellung. — Wir haben das alte, heute zerstörte Imperium des westlichen Tschadseebeckens seinem Wesen und seiner Bevölkerung, seiner geschichtlichen Wucht und seiner traditionellen Einflußsphäre nach höchstens in der Peripherie und dann auch nur im Lichte nicht sehr starker Geistesquellen kennengelernt. Zunächst war das im Haussaund Nupegebiet, wo die Bornumänner Berriberri genannt werden. Dort fand ich drei verschiedene Enklaven teilweise noch heidnischer Kanuri. Die erste war in der Kontagoraprovinz im Salikagebiet. Die Leute nannten sich da Kambali. Der zweite Kanuristamm war im Nupelande, und zwar in der Stadt Kutigi. Dort nannte er sich Bennu. Endlich konnte ich noch eine Kolonie in der Keffiprovinz um Lafia festlegen, wo die Leute ihren alten Haussanamen Bern-bern beibehalten haben. Außerdem tauchten die Spuren vergangener gewaltiger Macht des Bornukönigs im Jukumgebiet auf. Die Bornuleute heißen auch hier Berriberri. Wir wissen aus der Chronik, daß ein Bornukönig im sechzehnten Jahrhundert nach der Unterwerfung Kanos mit dem alten Jukumreich anknüpfte und aus den Traditionen der Wukarialten, daß er durch das befreundete Jukum eine Straße zum Süden anlegte.
Alles das wird dadurch noch wesentlicher, ja erhält tragfähige Säulenkraft, daß wir durch die Bornuchroniken über den Zeitpunkt orientiert sind, in dem diese Kolonien gegründet wurden und die Machtausdehnung Bornus so gewaltig gewachsen war. Es ist das elfte Jahrhundert. Nun haben aber alle Bornukolonisten von Kontagora bis nach Altkororofa zwar ihre alte Sprache aufgegeben, dagegen sämtlich die alte Tätowierung beibehalten, die in immer wiederkehrenden langen drei Parallellinien auf allen Körpergliedern und in einer Umrahmung des Gesichts mit etwa elf Parallellinien besteht. In dieser
Mir erscheint die Betonung dieser Tatsache ganz besonders notwendig, weil infolge der hochwichtigen Erkenntnisse unserer großen Bornuforscher der Hauptgesichtspunkt bei der Beurteilung dieses-Volkes der wurde, daß ihr derzeitiger Adel aus Tibesti und ihr kriegerisches Vorwärtsdrängen in den letzten Jahrzehnten des Bornureiches auf Adamaua zu, also nach Süden gerichtet war. Aber ich kann in der Untersuchung des Volkskultus der Bornuer nichts finden, was diesen beiden Entwicklungstendenzen entspräche, und in Adamaua habe ich durchaus keine Spuren der Einwirkung der alten Bornu-Kultur im Sinne derer, die unserer historisch im vorigen Jahrhundert gewonnenen Kenntnis entspräche, finden können.
Vielmehr überwiegt die Beziehung zu den westlichen Kulturstaaten. Daß das Verhältnis der Kanuri zum Nordosten, Osten, Süden viel lockerer war, als man nach den bisherigen Feststellungen annehmen zu müssen glaubte, geht daraus hervor, daß die eigentlichen Kanuri auf keinen Fall jemals das Wurf eisen besessen, d. h. hergestellt haben. Die Kanuri wandten allerdings Wurfmesser an, aber diese waren nicht ihr eigenes Produkt. Ihre Leichtbewaffneten hatten zwei verschiedene Formen im Gebrauch. Die eine hieß Daniski. Sie zeichnete sich durch Dicke und schweres Gewicht aus. Sie war nicht flach. Man kaufte sie immer bei den Marghi. Die andere dagegen hieß Gario. Die war ganz dünn und flach. Diese erwarb man stets in Bagirmi, in welchem, ehe die Bornustatthalter sich vom Heimatland frei und als unabhängige Herrscher erklärten, die Ssara allein die Oberhand hatten. Die Ssara (mit Lakka) waren ein äthiopischer Stamm wie die Mundang und Dakka. Von ihnen stammte das Saria genannte dünne Wurfeisen. Im übrigen erhielt ich an Namen für Wurfmesser:
Kanuri Daniski und Gario, Teddasprache Moserri, Bagirmi Tschikka oder Mauern Tschigga, Marghi Galaphi. |
Um aber auch nach anderer Richtung abzuschließen sei bemerkt, daß die Kanuri auch nicht das hölzerne Wurfholz kennen. Nun konnte ich aber im westlichen Gebiet zwei Formen feststellen, die in ihrem
Zusammenhange ungemein wichtig sind. Ich skizziere beide Formen nebenstehend. Man sieht die Beziehung zwischen dem Kere, dem Wurfholz der Stämme nördlich Kanos, also der Damergustämme. Nun nennen die Kanuri die Damerguleute, die groß im Werfen der Kere sind aber Kere-kere, und damit dürfte gezeigt sein, daß den Kanuri die hölzernen Wurfgeschosse ebenso unbekannt waren wie das Wurfeisen.Die Frage ist also, was die Kanuri eigentlich ihren Waffen zufolge für eine Stellung unter den Sudanstämmen einnahmen, ehe sie der Teddadynastie verfielen. Wir können es mit ziemlicher Klarheit feststellen. Die Kanuri führten als Reitervolk schwere Lanzen, als Fuß. kämpfer aber Bogen, die ungemein lehrreich sind. Es sind das nämlich mächtige äthiopische Bogen mit Sehnenschnur und papilloter Bespannung. Auch bei Tuarek und Tedda werden solche gelegentlich zur Jagd verwendet, wenn auch so selten, daß ich neuerdings nicht einmal den Namen erfahren konnte, nachdem ich früher an der guten Quelle vorbeigegangen war. Diese Bogen sind aber kümmerlich und schmächtig im Vergleich mit der Bornuwaffe, die der stärkste Bogen Innerafrikas überhaupt sein dürfte. Denn nicht nur, daß sie groß und stark gebaut ist, sie ist auch meist vollkommen umwickelt gewesen und von der klugen Behandlung durch die Schützen zeugt es, daß diese die Umwicklung meist mit Kuhmist bestrichen, anscheinend um die Austrocknung zu vermeiden. Vor allem aber haben diese Bogen auch die gleiche schöne Biegung, die man an besseren ostafrikanischen Bogen, zumal denen der Somali und Viktoriaseestämme bewundern kann. Der alte Kanuribogen, so sagen die alten Kanuri, war eine starke Waffe, er war "stark wie Eisen". Heute soll es nur noch kümmerliche Überreste und Nachkommen geben, aber auch die sind kräftig genug, um zu imponieren. Früher muß danach der äthiopische Bogen eine Hauptstätte hier besessen haben, und unwillkürlich müssen wir an jene starken Bogen der Äthiopen denken, von denen Herodot erzählt.
Ich glaube, daß nichts die bedeutungsvolle äthiopische Wurzel, aus der die Bornupflanze, die nachmals so und so oft von so und so vielen Gärtnern veredelt wurde, so beweist als dieser Bogen, den alle Heidenstämme Bornus früher gehabt haben und dessen Einflußgebiet —vielleicht aus einem alten "Bornu-Zentrum"ausstrahlend!— man nicht niedrig einschätzen darf. Wenn wir oben darauf hinwiesen, daß die Kanuritätowierung die Mande und Kanuri verbindet, so müssen wir jetzt feststellen, daß der temporale Bogen die Mande und Haussa verbindet, nicht aber diese beiden mit den Kanuri. Der Kanuribogen aber ist älter, da der temporale Bogen aus einem Einfluß syrtischer Kultur hervorgewachsen ist und die Verbreitung des Papillotbogens durchbrochen hat. Das ist bedeutungsvoll. Und ebenten
Abb. I, 2 und 5 Wurfhölzer;3, 4 und 6 Wurfeisen. Abb. i von den Dui in Nordkamerun, Abb. 5 von den Magussaua bei Kano, Abb. 2, 3, 4, 6 von den Nguduf, Mandaragebirge. (Abb. 5 trägt bei den Eingeborenen den Namen "Kere")
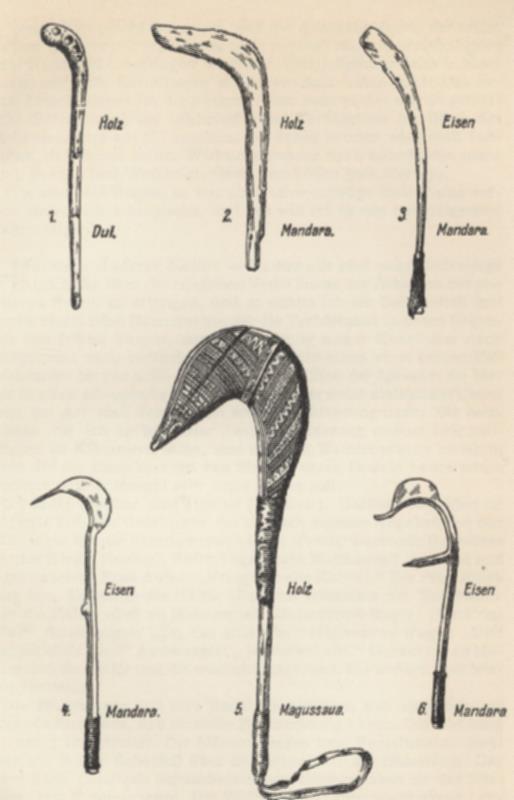
Wie aber sein Bogen, so war auch seine sonstige Kultur eine vordem wesentlich äthiopische, und das will ich in den nachfolgenden Zeilen zeigen.
Die Mulgoi selber sind Heiden (= Kirdi). Darüber berichten sie folgende hübsche Geschichte, die sie nach eigenen Angaben von den städtischen Kanuri übernommen haben: «Früher waren alle Bewohner Bornus Kirdi (Heiden). Eines Tages kam Mohammed ins Land und sagte zu seiner Frau Auwa: "Bring mir alle Kanuri." Die Frau Auwa ging hin. Sie nahm die Hälfte aller und versteckte sie. Sie brachte nur die Hälfte aller zu Mohammed. Mohammed fragte: "Sind das alle ?" Auwa sagte: "Ja, das sind alle." Mohammed fragte: "Sind das wirklich alle ?"Auwa sagte: "Ja, es sind alle." Darauf nahm Mohammed die Hälfte und die wurden Mus (e)lma. Die andern aber blieben Heiden.«
Die Mulgoileute und ihre Nachbarn zeichnen sich äußerlich vor allem dadurch aus, daß sie keine Beschneidung haben. Die Kleidung ist wenig kompliziert. Die Männer tragen kein Penisfutteral, wohl aber ein langes Schaffell über der Achsel wie die Bassariten. Das dient dann gleich als Schambedeckung. Hinten haben sie das Sitzleder, hier Puno genannt. Die Weiber aber haben vorne einen Lendenschurz, den Pusche, und hinten einen aus Baobabborke geklopften
Rindenstoff, den Damdje. Blätter werden allen Angaben nach meist nicht getragen. Ich sah aber mehrere ansehnliche islamitische Kanurimänner einen Fluß so überschreiten, daß sie alles auszogen und schnell ihre Blößen vorn und hinten mit Blätterbüscheln bedeckten. Das soll als Notfall in Bornu öfters so gemacht werden.Das wichtigste war es mir, in Erfahrung zu bringen, ob diese Kanurikirdi die gleichen Religionsverhältnisse haben, wie die Adamauastämme. Ich hörte darüber vor allem, daß die Schwirrhölzer und Schwirreisen fehlen, und daß der größte Unterschied in einem eigenartigen Baumdienst besteht.
Das Sanam (das Wort entspricht seiner Bedeutung nach dem Lauru der Fulbe, dem Dugudasiri der Mande) besteht vor allem in einem Baume, den die Kanuri Gudjo nennen und die Fulbe Djiho. Er soll nicht einen so dicken Stamm haben, wie eine Kuka (Baobab), aber viel höher sein. In jedem Jahr nun, wenn die Ernte geschnitten ist und in den Farmspeichern liegt, wenn das Gras gebrannt ist, dann wartet man die erste junge Mondsichel ab, um die Weihe vorzunehmen. Der Sanama, d. i. der Herr des Sanam, geht dann mit allen Kriegern hinaus zu diesem Baume, und ein jeder nimmt seine Kriegsaxt (Biögo), seinen Speer (Djelli), seinen Schild (Gauwa), Bogen und Pfeil mit hinaus.
Dem Sanama werden zu dieser Maßnahme die Hände auf dem Rücken kreuzweise zusammengebunden. In dieser Stellung wird er herausgebracht, und so gefesselt, spricht er zu dem Baume: "Sieh alle unsere Waffen sind unter dir. Sei mit unseren Waffen. Gib, daß sie viel Glück im Krieg haben mögen. Gib, daß wir alle viel gewinnen. Gib, daß wir Kinder haben und Nahrung." Danach stellen alle Krieger ihre Waffen unter den Baum und gehen nach Hause.
Während der nächsten drei (?)Monate bleiben die Waffen nun unter dem Baume. Während der ganzen Zeit darf niemand von der neuen Feldfrucht essen. Vielmehr muß diese unangerührt in den Farmspeichern liegen bleiben. Vor allen Dingen darf während dieser Zeit auch niemand seine Frau beschlafen. Da das nun in allen Gehöften —und das Gebiet der Mulgoi kennt nur Großfamiliengehöfte, keine Dörfer in unserem Sinne — weit und breit im Lande genau ebenso gemacht wird, so herrscht überall Friede. Das ganze Land, das sonst vom Kriegsgeschrei der verfeindeten Familien in langer, ununterbrochener Schallwelle widerhallt, hat nur eine einzige große Sache, den Frieden. Das Land liegt wie im Schlafe.
Wenn aber danach das zweitemal die feine Mondsichel auftaucht, rüstet sich der Sanama, ein großes Opferfest für die Sippe, deren geistlicher Berater er ist, zu veranstalten. Der Sanama scheint immer von seinen Stammesgenossen dadurch unterschieden zu sein, daß er ganz lange Haare und lange Fingernägel trägt. Er reinigt diese
Auswüchse an diesem Tage besonders und begibt sich mit einem weißen Ziegenbock (Dall Killi) und seinen Söhnen zudem Baum. Die andern Männer der Siedelung folgen. Am heiligen Platze schlachtet er den Ziegenbock durch einen Schnitt. Der Bock ist aber nicht festgebunden, so daß er sich im Sterben wild herumwälzt und sein Blut überall hin verspritzt, auf den Baumstamm, über den Platz hin und gegen die Waffen. Der Sanama, dem an diesem Tage natürlich die Arme nicht gebunden sind, betet dann: "Gib, daß wir im Kriege viele Sklaven machen. Gib, daß wir niemand verlieren. Gib, daß wir alle gesund bleiben. Gib, daß unsere Frauen Kinder erhalten. Gib, daß das Korn gute Ernte bringt!" Danach bereitet er von dem neuen Korn Essen. Er legt rundherum und klebt überall hin kleine Flocken des Breies und verspeist den Rest mit seinen Söhnen.Wenn das Opfermahl beendet ist, ruft er die andern Männer herbei. Er nimmt eine jede Waffe, reicht sie seinem Besitzer und sagt: "Das ist dein!" "Das ist dein!" usw. Er verteilt alles. Damit ist die neue Zeit eingeleitet. Jeder kann nun von seinem Korn genießen, jeder sein Weib beschlafen und die Waffen gebrauchen.
Bricht nun eine Fehde aus, was in Anbetracht des Abschlusses des Landfriedens sehr wahrscheinlich ist, so hat er dem ausziehenden Volke eine Vorrichtung zu bereiten, die der allgemeinen Überzeugung nach den Waffen Glück bringen muß. Er geht hinaus auf den Kreuzweg (Djewandi). Dorthin legt er erst Katagablätter, darauf ein Kotgumji, das ist der Kopf eines Pilztermitenhaufens. Auf den legt er zwei Sandalen (Sumu), so daß eine kreuzweise über der andern liegt. Dann muß alles Kriegsvolk, einer nach dem andern, darüber hinwegschreiten. Sie ziehen in den Kampf. Der Sanama aber bleibt daheim.
Am Gudjobaum hat der Sanama aber im Notfalle noch folgende Zeremonie zu verrichten. Wenn kein Regen fällt und das Saatkorn in die Gefahr kommt zu vertrocknen, dann hat zunächst einmal jedermann den ganzen Tag über von der Farm fernzubleiben. Der Sanama aber bereitet zwei Schalen Kornmehl, mit denen begibt er sich dann abends zum Gudjobaume. Dort betet er: "Der Regen bleibt aus. Gib uns Regen. Alle Pflanzen vertrocknen. Wenn kein Regen kommt, werden wir nichts zu essen haben. Viele werden sterben. Gib uns also Regen!" So betet er lange, lange Zeit hintereinander fort. Nachher hebt er die Hände wie zum Empfange bereit, hoch auf, wie das die alten Griechen beim Gebet taten, und wendet auch das Antlitz gen Himmel. Gleichzeitig ruft er sehr laut und in hoher Stimmlage: "Huuu!" Die Bewohner des Gehöftes haben darauf gewartet. Wenn von draußen der Ruf des Priesters zu ihnen schallt, heben sie in gleicher Weise die Hände auf und rufen alle gemeinsam: "Hu!" Damit ist das Gebet um Regen beendet.
Die letzte Zeremonie, die, soweit ich erkunden konnte, der Sanama zu vollziehen hat, wird im Frühjahr vor der Saatzeit und einige Tage ehe die Leute die Farmarbeit beginnen, veranstaltet. Dann geht der Sanama mit einem roten Hahn (gudogun-rodi) und einer roten Grasart (Sab[e]a oder Schab[e]a) zu einem Kreuzwege. Auf dem Kreuzwege legt er das rote Gras hin. Dann tötet er den Hahn. Das Blut des Hahnes mischt er mit Sorghum, das er in einer kleinen Schale mitbrachte. Den Hahn legt er zunächst auf das Gras auf dem Kreuzwege nieder, und mit dem blutigen Korn begibt er sich auf seine Farm. In der Mitte seiner Farm macht er zwei schalenförmige Höhlungen, beide dicht nebeneinander. Er nimmt von dem blutigen Korn in jede Hand und kreuzt dann die Arme über den Höhlungen, so daß die linke Hand über der rechten und die rechte über der linken Höhlung ist. Er legt das Korn derart in die Erdausschalungen und betet dazu: "Ich bitte, daß dieses Jahr eine gute Ernte komme, daß keine Krankheit uns störe, daß alles gut gehe!" Nach diesem Gebet geht er heim. Er verrichtet das nur auf seiner eigenen Farm, auf keiner andern. Auf dem Heimweg nimmt er aber vom Kreuzweg den roten Hahn weg, der bis dahin auf dem roten Gras liegen geblieben war. Er nimmt ihn mit nach Hause. Dort röstet er ihn. Danach ruft er alle kleinen Knaben des Gehöftes zusammen, gibt jedem ein wenig von dem Hahn ab und sagt: "Ich bitte, daß alle Farm gut werde!" Dann ißt er selbst die eine Hälfte des Bratens, die Kinder die andere. — Von einer weiteren Zeremonie, die der Sanama zu vollziehen habe, hörte ich nichts.
Altersklasse, Brautstand, Ehe usw. — Die Mulgoi haben eigentlich keine Könige. Jede Familie lebt für sich und hat ein burg. artiges Gehöft für sich. Wenn diese Genossenschaft nun mächtig genug ist, dann steht an ihrer Spitze ein sog. Marghi-mari, der hat eben Macht, soweit seine Macht reicht, nicht aber etwa nach der Tradition. Ihm folgt sein Bruder, und dessen Sache ist es zu versuchen, ob er sich die gleiche Stelle erhalten kann wie sein Vorgänger.
In dem so gebildeten Sippenumkreis spielt die Altersgenossenschaft keine große soziale Rolle. Nach Kanuriweise werden die Männer hier eingeteilt in: 1. Tataltiberini, das sind ganz kleine Kinder, 2. Tscholtscholi, das sind Kinder von drei bis vier Jahren, 3. Djero, das sind Beschnittene, 4. Patori, das sind Verheiratete, 5. Ndoti, das sind Alte, und 6. Kjari, das sind Greise. — Das ist muslimanisch. Bei den Kirdi ist es einfacher und infolge der Familienzusammenpressung und Mangels der Beschneidung nur noch wesentlich für die Frage der Kriegstüchtigkeit oder der Erbschaft. Ich kann die Einzelheiten nicht sagen. Der eigentümliche soziale Zustand aber,
der diesen Heiden eigen ist, wird durch die Schilderung der Ehesitten am besten erläutert. Sie lassen an Eigenart nichts zu wünschen übrig.Jugendfreundschaft wie bei den Kabre und Adamaua scheint man weder zu kennen noch anzustreben. Lange Liebelei liegt diesen tatkräftigen Menschen nicht. Man sieht sich. Man wird aufeinander aufmerksam. Man tastet — wenn es sich dann anfühlt wie Entgegenkommen, dann bespricht man sich. Man erklärt sein Einverständnis und verabredet Zeit und Stunde. Daran hält man sich dann. Der Bursche fängt das Mädchen am Wege ab und bringt sie in das Gehöft seines Vaters. Sobald der Vater der Braut das hört, kommt er selbst und erklärt höchst einfach: "Du hast mir meine Tochter weggenommen. Nun zahle!" Also bezahlt der Bursche oder vielmehr für ihn der Vater das "Geschenk". Es besteht in zwei Töpfen Salz, zwei Ziegen, zehn runden Eisenkugeln (Dubull, das sind die Eisenkugeln, zu denen die Schmiede die Stücke Luppe zusammenschmieden, ehe sie sie auf den Markt bringen), und einem blauen Kleid (=Djambei).
Danach kommt als zweites nun eine Art Gefecht, der Kampf um die geraubte Braut hier genannt Luballa oder Luballa-perobe. Beide Familien treten einander mit Stöcken bewaffnet gegenüber, eiserne Waffen sind untersagt. Man beginnt mit Stöcken schonungslos aufeinander loszuschlagen. Es soll heftige Szenen und manche Wunde dabei setzen, denn die Sache wird durchaus ernst aufgefaßt. Gelingt es der Familie der Braut die andern zurückzudrängen, so müssen die das Mädchen wieder herausrücken, ohne daß sie aber den Kaufpreis zurückerhalten. Gelingt es dagegen der Familie des Bräutigams, das Schlachtfeld zu behaupten, dann bleibt die Braut da, wo sie augenblicklich ist. Der Bräutigam muß sich aber einer sehr eigenartigen Prozedur und Keuschheitsprobe unterziehen, fraglos eine der sinnreichsten und raffiniertesten, von der ich überhaupt je in diesen Dingen gehört habe.
Der Vater der Braut wird nämlich am nächsten Abend von seiner Gattin ausquartiert und mag sich für diese Nacht anderweitig ein Unterkommen suchen. Dafür lädt die Schwiegermutter den Räuber ihrer Tochter ein, für diese Nacht mit ihr das Schlafgemach zu teilen, und der Jüngling mag wollen oder nicht, er muß dieser Einladung, so schrecklich sie ihm auch sein mag, Folge leisten. In dieser Nacht nun versucht die Schwiegermutter an dem Liebhaber ihrer Tochter alles, "was sonst nur Frauen ihren Ehemännern zu tun pflegen".
Das wirft aber ein merkwürdiges Licht auf die Züchtigkeit der Kanuridamen — nicht daß die um das Schicksal ihrer Tochter besorgte Mutter an ihren Schwiegersohn Standhaftigkeit und Gesundheitsuntersuchungen vornimmt, sondern wie sie das tut und daß
dieses "wie" eben das ist, "was die Frauen ihren Ehemännern zu tun pflegen". Man höre! Die Schwiegermutter legt den Schwiegersohn auf ihr Bett. Sie löscht das Licht aus, so daß nur noch wenig Beleuchtung den Raum erhellt. Sie hat einen Topf bereitstehen, in dem ist rote Farbe mit Öl gemischt. Sie beginnt dem lang Ausgestreckten nun die Oberschenkel streichelnd zu massieren. Sie gleitet mit den Fingern ein wenig über seinen Leib, um den Nabel herab. Dann streichelt sie sanft sein Glied. Sie drängt ihm die Oberschenkel auseinander und kitzelt ihm das Skrotum. Dann aber drängt sie sich gar neben ihn und bringt den ebenfalls geölten warmen Leib mit seiner Haut in Berührung. Sie murmelt ihm freundliche Sachen zu, wie: "Was bist du stark. Wie stark steht dein Glied! Wie gut wird es meine Tochter haben!" Das geht vom Abend bis zum Morgen, und zuletzt scheut sie sich nicht, mit dem Munde jene edleren Teile zu berühren!
Nun darf man nicht vergessen, daß der Versuchte ein Neger ist, der eben immer erregbar ist, und der nach meinen Erfahrungen die älteste und abgebrauchtetste Ware nicht scheut. Daß andrerseits diese Schwiegermutter noch nicht einmal dreißig Jahre alt zu sein, ergo gar nicht der Reize, die einen Negerleib erfreuen, bar zu sein braucht, daß sie vor allen Dingen aber, einmal auf den lüsternen Weg des Ehelebens getrieben, es jedenfalls, seit sie ihre Tochter gebar, zu außerordentlicher Geschicklichkeit in gewissen Dingen gebracht hat. Also glaube ich es meinen Berichterstattern gern, wenn sie sagen, daß viele Burschen den Versuchungen der Trmasdisitte (so heißt diese Versuchungsmaßnahme) anheimfallen und von der Schwiegermutter das unternähmen, was diese ihnen so nahe legt und was der Bräutigam doch eigentlich von der Tochter erwünscht. Sobald der Jüngling schwach wird und die Schwiegermutter beschläft, begleitet diese ihn am andern Tage unter Danksagungen hinaus, läßt den eigenen Gatten wieder seine Bettstatt beziehen und geht dann selbst hin, ihre Tochter wieder heimzuholen. Der junge Mann hat das Recht an sie verloren.
Verläßt der junge Mann aber als Sieger diese Höhle, so ist die Braut nach Sitte und Brauch rechtmäßig sein. Dann sendet die Mutter am andern Tage eine Botschaft an ihre geraubte Tochter, die lautet etwa: "Du hast einen guten Mann. Ich habe es die ganze Nacht versucht. Er aber hat mir nichts getan." Sie sendet ihr außerdem Sorghummehl, Sesam (Marrasi, in Haussa Ridi) usw. Nachts erfolgt dann der Ehevollzug des jungen Paares. Der Beischlaf wird in allen Teilen Bornus angeblich in der Decklage ausgeführt. — Daß das Eheleben der Kanuri kein sehr keusches ist, war schon aus obigem zu ersehen. Bestätigt wird die Sache dadurch, daß die Kanuri ihre Frauen dazu erziehen, ihnen nach dem ersten Beischlafe in gleicher Nacht noch das zu tun, was die alten Römer nannten "einen gewissen
Dienst" erweisen. Alle Kanurifrauen sollen ihre Lippen und Zunge zu diesem Verfahren hergeben, den Mund dann aber von der Beschmutzung durch die Spermen dadurch reinigen, daß der Gatte ihr andern Tages etwas Butter kauft, die Frau die Butter warm macht und damit den Mund ausspült. — Die Jungverheirateten bleiben vier Tage in ihrer Behausung und zeigen sich nicht. Wie mein Freund Bukkari sich ausdrückte: belehrt der junge Mann seine Frau in allem, was sie vorher nur von ihrer Mutter gehört hatte, was aber ihr Mann von der gleichen Frau gelernt hat. —Also von äthiopischer Züchtigkeit keine Spur. Inwieweit sich übrigens das alles sowohl in den Städten wie bei den Heiden des flachen Landes eingebürgert hat, ist schwer zu beurteilen. Die Ausdehnung der Sitte scheint aber schon weite Kreise gezogen zu haben. Sie ist libyschen Ursprungs.Die Vermehrung geht in gleicher Weise vor sich wie bei den Äthiopen Adamauas. Die Wöchnerin sitzt im Hause auf einer umgekehrten Holzschale, zwei Frauen helfen. Die Nabelschnur (Dabudi) wird mit einem Rasiermesser flacher Form (Paga) abgeschnitten und die Nachgeburt (Kwakurra) im Hause begraben. Die Nabelschnur fällt bei Knaben nach drei Tagen, bei Mädchen nach vier Tagen ab und wird dann ebenda verscharrt, wo schon die Kwakurra liegt. —
Die Schmiede sind bei der heidnischen Landbevölkerung Bornus, soweit sie in der Richtung auf Adamaua zu wohnen, auf keinen Fall verachtet. Sie stehen als Kaste abseits. Wie die Verhältnisse aber dem tieferen Sinnwort nach liegen, das bezeugen uns folgende Sitten: Wenn irgendwo im Mulgoigebiet eine Gesellschaft zechender Männer sitzt und zufälligerweise ein Schmied vorbeikommt, da wird der Gastgeber jedesmal dem Schmied aus einer besonderen Schale einen Trank bieten. Und noch mehr: jeder Mann, der einen eigenen Acker hat, muß dem Schmiede nach jeder Ernte fünf Körbe ausgedroschenen Kornes schicken. Es wird ausdrücklich versichert, daß dies deswegen geschähe, weil man dem Schmied alles verdanke: von dem Messer, mit dem bei der Geburt der Nabel abgeschnitten wird, bis zur Schaufel, mit der die Farm bestellt und mit der das Grab ausgehoben wird, in dem der Schmied dann wieder dem Menschen die letzte Ruhestätte bereitet. Es ist also eine Anschauung, wie sie klipp und klar auch von den Mande ausgesprochen und sittengemäß durchgeführt wird. Es ist ein fundamentaler gleicher Wesenszug,
den ich von Senegambien bis an das Kongobecken nachweisen konnte, und der von einer überraschenden Einheit in der Stellung zeugt. —Der Schmied heißt Kagelna. Der Zunftmeister der Schmiede Me (i) tramma. Dieses ist der, der die Bestattung überwacht.Wenn der Mensch einer Krankheit (Kassua), die allgemein bekannt ist, verfällt, kann man ihn mit üblichen Medikamenten behandeln. Wenn er aber einer gewissen Starre, einem Delirium, der Bewußtlosigkeit verfällt, so nimmt man an, daß Vergiftung (Sirguma) vorläge oder daß ein "Karama" seine Hand im Spiele hat. Dann geht ein Familienmitglied zu einem Schmied, meist zum Zunftmeister, und der bringt dann dem Kranken eine Medizin bei. Der Erfolg ist, daß der Kranke auffährt und einen Namen nennt. Wenn das der Fall ist, dann weiß man, daß der Kranke dem Karama zum Opfer verfallen, dessen Namen er eben genannt hat.
Von dem Karama sagt man, daß er seine Kraft stets von Mutterseite, von der Familie der Mutter, nie vom Vater oder der Familie des Vaters ererbt, daß fernerhin sein ganzes Verfahren darin bestehe, daß er einem Mann oder einem Weib, das ihm gefällt, nachschaut und sagt: "Das ist ein hübscher Kerl!" Dann wäre der andere ihm sogleich verfallen und würde krank —heißt es bei den Mulgoi. Wir hätten es bei den Mulgoi nur mit dem "bösen Blick" zu tun, wie es bei den Kanuri wirklich echt und recht geglaubt wird, und zwar nach dem Rezept der Berber und Libyer, von denen der Karama ererbt ist. Die ältere Anschauung der Mulgoi, d. h. also der Vertreter des alten heidnischen Kanurivolkes, kann das aber nicht sein, und zwar kann ich das sogleich an zwei Symptomen belegen.
Zunächst also ist, wie oben erwähnt, vom Kranken der Karama genannt. Sogleich wird der Angeklagte zum Marghi-mari (König) oder Bulama (Bürgermeister, von Kuka aus früher eingesetzt oder bestätigt) gebracht. Der Zunftmeister der Schmiede muß ihm den Giftbecher (das Gift heißt hier Brongu) reichen. Wenn er das verweigert, erklärt er sich damit selbst als überführt. Dann verlangt man von ihm, daß er Wasser in den Mund nehme, diesen damit ausspülen und es wieder in eine Kalebasse rinnen lasse. Wenn der Kranke dann davon trinkt, wird er wieder genesen. Außerdem muß der Karama über sein Opfer hinwegschreiten. Danach aber wird der Karama getötet und seine ganze Familie verkauft.
Geht man nun trotz der auffallenden Symptome einer Erkrankung nicht zum Schmiede, bittet den um den Trank, der jenen veranlaßt in einer freien Minute den Namen des Karama zu nennen, so stirbt der Mann. Aber auch dann erfährt man noch Näheres über den Grund seines Todes. Nach dem Tode eines jeden Menschen muß der Schmied kommen und dem Leichnam Brust und Bauch aufschneiden. Aus dem Bilde, was sich zeigt, erkennt dann der Schmied, woran
jener starb, ob an Krankheit, Vergiftung oder Verhexung durch einen Karama. Wenn nämlich ein Karama jenen getötet hat, so fließt kein Blut beim Schnitt. Der blutlose Schnitt beweist Einmischung der Karama und man geht sogleich zum Marghi-mari oder Bulama und bringt die Angelegenheit zur Anzeige. Das Oberhaupt kann nun allerdings nicht mehr feststellen, welche Persönlichkeit in der Runde die Schandtat vollbracht hat, kann also nicht mehr den Schuldigen durch den Tod für sein Verbrechen bestrafen. Wohl aber kann er mit Hilfe des Schmiedezunftmeisters alle Karama der Gegend feststellen und die werden dann, weil einer unter ihnen der Schuldige sein muß, aus dem Machtgebiet vertrieben.In dieser Schilderung stehen an zwei Stellen die Belege dafür, daß die Mulgoi ursprünglich im bösen Blick nicht die alleinige oder auch nur entscheidende Kraft- und Genußform der bösen Menschen sahen. Einmal spricht das aus der Art und Weise, wie der Karama durch Wasserspülung aus seinem Munde in den Mund jenes die Lebenskraft zurückgibt, dann in dem blutlosen Schnitt. Beides beweist, daß die Mulgoi früher die Vorstellung von einer Art Subachen hatten, von Wesen, die das Blut oder Leben ihrer Opfer aussogen und jenen die so gestohlene Lebenskraft nur dadurch wieder geben konnten, daß sie aus ihrem eigenen "Ich"Speichel, Blut oder irgendeine Flüssigkeit in der primitiven Vorstellung einer "Transfusion" wieder in den zu Tode Geschwächten zurückleiteten.
Das Verfahren, dem die Mulgoi heute noch die Leichen ihrer Stammesglieder unterwerfen, beweist aber noch manches andere. Verfolgen wir aber erst die vollkommene Beisetzung der Verstorbenen.
Sobald ein Mensch gestorben ist, wird er erst gewaschen und dann führt der Schmied den eben geschilderten Schnitt aus, der nach vollkommen übereinstimmender Angabe nur den Zweck hat, festzustellen, woran jener starb. Danach wird ohne jede weitere Maßnahme der aufgeschnittene Leichnam wieder zugenäht und von oben bis unten mit roter Erdfarbe (Djiwa oder Tjiwa) eingeschmiert. Dann wird ein schwarzer Bulle geschlachtet. Der schwarze Bulle heißt Dalotjullum. Er muß aber unbedingt von der kleinen alten, früher auch in Marghi-Mulgoi weit verbreiteten buckellosen Rasse sein, die Bare heißt und durch das bei den Kanuri Pie genannte Buckelrind der Fulbe neuerdings fast ganz verdrängt ist. Der schwarze Bulle wird gehäutet. Die Leiche drückt man dann zusamrnen, so daß die Knie an die Brust kommen, also in peruanische Mumienstellung. Danach näht man den zusammengepreßten Toten in die frische Bullenhaut ein. Drei Tage verbringt der männliche, vier der weibliche Leichnam nach dem Tode noch auf der Erde, dann wird er in das Grab befördert.
Jede Sippe (Kanuri = Djirri; Fulbe = Lenjol; Haussa =Dengi)
hat ihr eigenes Grab. Es besteht das zuweilen aus einer mächtigen Höhle, die man, nachdem man sich in einen verhältnismäßig engen Schacht in die Tiefe gearbeitet hat, durch Ausheben der Sohle im ganzen Umkreis geschaffen hat. Der Beschreibung nach hat der eigentliche Schacht bei großen und alten Gräbern einen Munddurchmesser von ca. 1,20-1,40 m. In dieser Weite führt er etwa 2-3 in tief hinab, dann erweitert er sich aber plötzlich trichterförmig zu einer Höhle, die einen Durchmesser von etwa 10 m bei etwa 2 in Höhe hat. Die Sohle dieser Höhle liegt also 4-7 m tief unter der Erdoberfläche. Dort hinab wird nun der Ballen mit der Leiche befördert, und zwar wird sie heute einfach hinabgeworfen. Sammelt sich unter dem Munde des Grabes die Fell- und Knochenmasse zu sehr an, so wird gelegentlich ein Schmied herabgesandt, der die alten Leichenteile zur Seite bringt und an den Rändern der Höhle verstaut.Geschlossen wird der Grabmund zunächst durch eine mächtige Holzplanke aus festem Holz, diese rundherum mit Sorghumbrei bedeckt, damit die Termiten sich nicht ihrer bemächtigen. Über der Planke wird dann ein kleiner Erdhügel von etwa zwei Fuß Höhe aufgeworfen und dieser dann noch mit Sugugras, —das ist die Grasart, aus der man die hier Galla genannten Sekkomatten flicht — bepflanzt. Das Gras wächst jedes Jahr wieder hoch auf und an ihm erkennt man die Stelle, unter der das Grab liegt.
Nun meine ich, die Mulgoi, also die Äthiopen der alten Bornu, müßten vordem ihren Toten mehr Sorgfalt gewidmet haben. Ich schließe das nicht nur aus der doch teilweise offenbar mächtigen Art der Grabanlagen. Vor allem ist mir hier der Brustschnitt maßgebend, den der Schmied der Leiche beibringt, um die Todesart festzustellen und die heute ohne weiteres wieder zugenäht wird. Das wirkt dadurch wie ein Rest älterer Sitte. Man könnte meinen, daß ursprünglich die Leichen geöffnet, die Eingeweide herausgenommen und entweder am Feuer oder sonstwie mumifiziert oder einbalsamiert wurden. Dafür spricht auch, daß man heute noch die Leichen drei bis vier Tage außerhalb des Grabes läßt. Wir hatten also in der langen Kette der Völker, die vordem mumifizierten, ein neues Glied: Baja, Durru, Batta (?), Matafall, nun Mulgoi. Unsere Kenntnis der edleren und feineren Sitten des alten erythräischen Äthiopenreiches im Süden des Tschadsees gewinnt eine wesentliche Bereicherung.
An dem Grabe haben sie nur ein Opfer. Wenn nämlich die Zeit des Fastens abgeschlossen und einem jeden unter dem Gudjobaume vom Sanama die Waffe zurückgegeben ist, dann geht er mit einer Schale Mball (Bier) hinaus. Er betet um Ernte, Kriegsglück, Familienvermehrung, Jagderfolg und was ihm sonst auf dem Herzen liegt. Weitere Ahnenopfer oder gar spezielle Schädelverehrung sind hier nicht Sitte.
Auch die Ahnenweihe, die an jüngeren sterilen Weibern sonst am
Ahnengrabe vorgenommen wird, fehlt im Sinne des Matriarchats und hat eine Form, die direkt als restierende matriarchalische bezeichnet werden muß. Sie geht folgendermaßen vor sich: Wie oben erörtert, ist die Ehe eine Raubehe, und es ist in Anbetracht der Enge des Wohnraumes und des entfernten Wohnens der Sippen selbstverständlich, daß jede Mutter ihre Tochter in einen andern Ort abziehen sieht, als den, in dem sie wohnt und demnach auch dem, aus dem sie selbst stammt. Wenn also eine Frau in A geboren ist, mag sie selbst in B verheiratet sein und ihre Tochter nach C abwandern sehen. Wenn nun die Tochter in C steril bleibt, so nimmt sie ein Küken und geht nach C, fordert ihre Tochter auf, ihr zu folgen und wandert mit ihr dann nach A. In A sucht die Frau die Stelle auf, an der sie selbst geboren ist. An der Stelle opfert sie das Küken und sagt: "Ich bin hier geboren. Hier hast du mich geboren. Hier ist meine Tochter, die nicht gebären kann. Hilf ihr, daß sie schwanger werde. Hier bringe ich also ein Küken." Dann geht die junge Frau heim, darf sich aber auf dem Rückweg auf keinen Fall umsehen, sonst bleibt Opfer und Gebet unwirksam.Eines Tages ging ein Karabina (ein Jäger) in den Busch und legte eine Dumbull (d. i. eine Ringfalle). Dann ging er heim. Nachts fing sich darin eine Ngirri (Antilope, die bei den Haussa Barrewa heißt). Am andern Tage kam der Karabina wieder und wollte die Ngirri töten. Die Ngirri aber sagte: "Laß mich bitte frei. Ich habe daheim ein Kind. Ich bin ausgegangen, um etwas zu fressen, denn ich hatte für das Kind keine Milch. Nun aber habe ich Milch, laß mich also frei, daß ich nach Hause laufe und dem Kinde meine Milch geben kann. Morgen komme ich ganz bestimmt wieder!" Der Karabina sagte: "Dann laufe heim und gib deinem Kinde die Milch. Ich will sehen, ob du morgen wieder zurückkehrst." Der Karabina ließ die Ngirri frei. Die Ngirri lief von dannen. Die Ngirri reichte ihrem Kinde die Milch, dann sagte die Ngirri: "Nun muß ich aber fortgehen, ich habe dem Karabina versprochen, wieder zu ihm zu kommen, wenn ich dir die Milch gegeben habe." Die Ngirri lief fort. Sie kam zu dem Karabina und sagte: "Ich habe dir versprochen, zu dir zurückzukehren, hier bin ich." Der Karabina sagte: "Du hast Wort gehalten. Nun will ich dich nicht töten. Nun sollst du mein Sallala sein!" Die Ngirri sagte: "Wenn ich dein Sallala sein soll, dann will ich dir alle Sanam sagen." Darauf erzählte die Ngirri dem Karabina alle Sanam und alle Medikamente, die vorher nur die Ngirri kannte. — — —
Bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß diese Legende nun von Senegambien bis zum Tschadsee nachgewiesen ist. Bei den Mande fand ich besonders reiche Angaben. Aber auch die Nupe und Haussa glauben, daß alle Zauber- und Heilmittel von einer Antilope (eine kleine, ziegengroße, rehfarbene mit spitzigen, geraden Hörnchen versehene Art; in Haussa Gade, in Nupe Ekoje) stamme und daß die Jäger (in Haussa Mahalbi, in Nupe Nardatsche) sie ihnen irgendwie abgelauscht oder abgenommen haben. Beide Völker glauben, daß diese Gada die klügste aller Antilopen sei und daß sie jeden Tag, ehe sie ihr Buschversteck verläßt, mit zwei großen flachen Früchten "boka" mache, also gewissermaßen das Orakel befrage, welchen Weg sie ungefährdet gehen könne und wo ihr Gefahren drohen. (Im Mossilegendarium muß, meine ich, auch etwas Ähnliches stehen.)
Weiterhin haben die Kanuri eine bestimmte Art, sich weiteres Jagdglück zu sichern, nachdem sie ein Tier erlegt haben. Sie wenden sie bei allen erlegten Tieren, zumal aber bei Büffel (=Ngarran) an. Sie stecken ihm nämlich Blätter vom Katagabaume in beide Nasenlöcher und legen ihm solche auch auf die Brust. Danach schneiden sie ihm nicht erst den Hals durch, wie die Islamiten, sondern sie öffnen den Leib da, wo das Herz liegt. Die Kirdikarabina — und es scheint, daß alle Karabina der Kanuri Kirdi sind — glauben, wenn sie dies nicht ausführen, daß sie dann an einem andern Tage kein Jagdglück haben werden. —
Die drei Locken des klugen Mannes. — Ein Mama (d. h. ein Mitglied einer Königsfamilie) wurde einmal vom König ausgewiesen. Der Mama sagte zu seinem Freunde: "Ich bin hinausgejagt von meinem Bruder. Ich muß die Gegend verlassen. Ich will in ein anderes Land gehen und eine neue Stadt aufbauen. Es werden dann andere Leute kommen. Du warst bisher mein Freund. Willst du nun mit mir das Land verlassen, mit in das andere Land kommen und mir helfen, eine neue Stadt zu bauen?" Der Freund sagte: "Es ist gut! Wir wollen zusammen in den Busch gehen. Ich bin dein Freund und kann dich nicht verlassen." Der Mama und sein Freund verließen mit ihren Familien die Gegend. Der Mama hatte ein junges Mädchen geheiratet, die hatte kein Kind. Der Freund hatte eine Frau geheiratet, die hatte von ihrem ersten Manne schon einen Sohn und den brachte sie mit in die Ehe. Es waren alles in allem fünf Menschen, die verließen die Stadt und zogen in eine andere Gegend.
Dort baute der Mama eine neue Stadt. Zu den fünf Menschen kamen andere. Die Stadt wurde immer größer. Der Mama unternahm Kriegszüge. Er eroberte andere Städte. Der Mama wurde ein großer König. Der König hatte seinen alten Freund immer bei sich. Der Mama mochte seinen alten Freund aber nicht mehr leiden.
Der Freund hatte sich auf dem Kopfe drei Haarzöpfchen gespart. Den drei Haarzöpfchen hatte er Namen gegeben. Die Namen sagte er niemand. Der König fragte ihn: "Was ist es mit den drei Haarzöpfchen?" Der Freund sagte: "Die drei Haarzöpfchen haben Namen." Der König sagte: "Welchen Namen haben sie?" Der Freund sagte: "Ich habe die Namen niemand gesagt; niemand weiß sie ohne mich." Der König sagte: "Ich will sehen, ob ich die Namen der drei Haarzöpfchen nicht erfahre. Wenn ich sie weiß, kann ich dich dann töten?" Der Freund sagte: "Gewiß kannst du mich dann töten."
Der König schickte den Freund in ein anderes Land mit einer Botschaft. Als der Freund fort war, rief er dessen Frau und sagte zu ihr: "Frau, du bist mit meinem Freunde verheiratet. Er ist nicht reich und kann dir nicht viel geben. Mein Freund hat auf dem Kopfe drei Haarzöpfchen, jedes hat seinen Namen. Wenn du sie erfährst und mir mitteilst, will ich meinen Freund verjagen und dich zu meiner Frau machen. Dann wirst du reich sein." Die Frau sagte: "Ich will sehen, ob ich die Namen der drei Haare erfahren und sie dir mitteilen kann." Dann ging die Frau wieder in das Haus ihres Mannes.
Nach einiger Zeit kam der Freund von der Reise wieder nach Hause. Als er zu seiner Frau kam, fand er sie weinend. Er fragte die Frau: "Meine Frau, was hast du?" Die Frau sagte: "Ach, laß mich." Der Freund sagte: "So sag' mir doch, was du hast?" Die Frau sagte: "Du willst es ja doch nicht." Der Freund ging fort. Die Frau weinte weiter. Am andern Tage sagte der Freund: "Du weinst immer. Was hast du?" Die Frau sagte: "Du kannst mich nicht leiden." Der Freund sagte: "Was ist das? Was willst du?" Die Frau sagte: "Ich bin nun zwanzig Jahre mit dir verheiratet. Während der ganzen Zeit hast du die drei Haarlocken, sagst mir aber ihre Namen nicht. Du magst mich nicht!" Der Freund sagte: "Die Namen kann ich dir nicht sagen." Der Freund ging. Die Frau weinte. Die Frau weinte drei Tage. Die Frau weinte weiter. Der Freund sagte: "Komm her, ich will dir also die drei Namen der Zöpfe auf meinem Kopfe sagen. Der Zopf hier vorne heißt: ,Niemand hat in seinem König einen wahren Freund.' Der zweite Zopf heißt: ,Niemand hat in einer Frau, die zum zweitenmal verheiratet ist, einen wahren Freund.' Der dritte Zopf heißt: ,Niemand hat in seinem Stiefsohn einen wahren Freund.' Nun weißt du die drei Namen. Nun behalte sie bei dir." Die Frau sagte: "Ich danke dir."
Als es nachts war, lief die Frau zum König und sagte: "Ich kenne die Namen der drei Zöpfe meines Mannes." Der König sagte: "So sage sie mir." Die Frau sagte: "Der vorderste Zopf heißt: ,Niemand hat in seinem König einen wahren Freund.' Der zweite Zopf heißt: ,Niemand hat in einer Frau, die zum zweitenmal geheiratet hat, einen wahren Freund.' Der dritte Zopf heißt: ,Niemand hat in seinein
Stiefsohn einen wahren Freund." Der König sagte: "Ich danke dir. Ich werde dich in kurzer Zeit belohnen." Die Frau ging wieder nach Hause.Am andern Morgen rüstete sich der Freund, den König zu begrüßen. Sein Stiefsohn war auf dem Felde. Sein Kleid lag da. Der Freund zog das Kleid seines Stiefsohnes über. (Eine im Sudan durchaus weit verbreitete Sitte, daß man die Kleider seiner Angehörigen gelegentlich leiht und trägt und verleiht.) Er ging dann zum König. Der König ließ trommeln. Er ließ alle Leute der Stadt zusammenrufen. Alle Leute der Stadt kamen. Der König sagte: "Hier ist mein Freund! Mein Freund hat drei Zöpfe auf seinem Kopfe. Jeder Zopf hat einen Namen. Mein Freund sagte mir, er wolle mir die Namen nicht nennen. Mein Freund sagte, ich könne meinen Freund töten, wenn ich die Namen erführe. Ist es so oder ist es nicht so?" Der Freund sagte: "Es ist so."
Der König sagte: "Heute kann ich die Namen der drei Zöpfe sagen. Der vorderste Zopf heißt: ,Niemand hat in seinem König einen wahren Freund.' Der zweite Zopf heißt: ,Niemand hat in einer Frau, die zum zweitenmal verheiratet ist, einen wahren Freund!' Der dritte Zopf heißt: ,Niemand hat in seinem Stiefsohn einen wahren Freund.' Das sind die drei Namen. Ist es so oder ist es nicht so ?" Der Freund sagte: "Es ist so." Der König sagte: "So kann ich dich nun töten lassen?" Der Freund sagte: "Gewiß, nun kannst du mich töten lassen."
Der König ließ seinen Freund fesseln und hinausführen. Viele Leute liefen hinterher und wollten sehen, wie der Freund getötet wird. Zu der Zeit kam der Stiefsohn des Freundes vom Felde. Er begegnete dem Zuge. Er fragte: "Was ist das? Was ist das?" Die Leute sagten: "Man bringt den Freund des Königs hinaus, um ihm den Kopf abzuschlagen." Der Stiefsohn sagte: "Man will meinem Stiefvater den Kopf abschlagen. Mein Stiefvater hat aber mein bestes Kleid an. Mein bestes Kleid wird blutig und beschmutzt werden. Zieht meinem Stiefvater doch das Kleid aus und gebt es mir, ehe ihr ihm den Kopf abschlagt."
Der Freund sagte: "Bringt mich noch einmal zurück zum König. Ich will ihn noch einmal sprechen, ehe ich sterbe." Die Leute brachten ihn zum König. Der Stiefsohn lief voraus. Der Stiefsohn bat den König: "Mein Stiefvater hat heute mein bestes Kleid an! Du willst ihm den Kopf abschlagen lassen. Das Kleid wird blutig werden. Ich bitte dich, befiehl, daß man ihm erst das Kleid auszieht und dann den Kopf abschlägt."
Der gefesselte Freund kam herein. Der gefesselte Freund sagte: "Hast du gehört, was mein Stiefsohn bittet?" Der König sagte: "Ich habe es gehört." Der Freund sagte: "Ein wahrer Sohn und Freund
würde nicht um das Kleid, sondern um das Leben bitten, ist es so oder ist es nicht so ?" Der König sagte: "Es ist so." Der Freund sagte: "Eine erste Frau würde als Freund nicht hingehen und dem König das Geheimnis ihres Mannes sagen, um selbst zu verdienen. Ist es so oder ist es nicht so?" Der König sagte: "Es ist so!" Der Freund sagte: "Ein König ist kein guter Freund, wenn er den Freund tötet, weil er die Wahrheit erkennt und spricht. Ist es so oder ist es nicht so?" Der König sagte: "Es ist so."Der Freund sagte: "Wenn es so ist, dann laß mich hinausführen und töten." Der König sagte: "Nein, du sollst nicht getötet werden. Ich bitte dich, mein Freund zu bleiben." Der Freund ward nicht getötet. — — —
Der Inhalt dieser Geschichte stimmt mit der Motivengeschichte von Surro Sanke der Mande überein (vgl. Atlantis Bd. VIII S. 88ff.). Auch Fezzaner und Tunesier kannten diese Motive. Sie ist also wohl zum Bestand der jüngeren syrrtischen Kultur zu rechnen.
Der ersten Geschichte nach gehen eines Tages ein Mann und seine Frau mit der Mutter des Mannes und der Mutter der Frau zusammen, also zu vieren durch den Busch. Sie wandern weit. Sie haben kein Wasser. Sie dursten. Der Mann sagt: "Ich will zur Seite in den Busch gehen und Wasser suchen." Der Mann geht. Er findet einen alten Brunnen, der ganz tief unten Wasser hat. Der Mann ruft die Frauen herbei; er erklärte ihnen, daß es nur dann gelänge, von da unten Wasser heraufzubringen, wenn sie eine Kette bildeten, d. h. wenn einer immer den andern faßte. Das geschieht dann. Zuerst wird die Mutter der Frau herabgelassen. Die nachfolgende Mutter des Mannes hält ihren Fuß und wird dann ebenso gehalten vom Manne. Die Frau bleibt oben am Rande hocken und läßt ihren Mann hinab. Unten trinkt also zunächst die Mutter der Frau, die reicht auch Wasser nach oben, so daß alle trinken. Hernach soll die Kette wieder heraufgezogen werden. Dabei läßt die Mutter des Mannes die Mutter der Frau los. Diese stürzt hinab und ertrinkt. Die Frau hört dies oben und fragt: "Was ist da hineingefallen?" Der Mann antwortete: "Ich denke meine Mutter ist hineingefallen?" Die Frau dagegen: "Nein, meine Mutter ist hineingefallen. Wenn du nun nicht den Fuß deiner Mutter auch losläßt, so daß sie hinabfällt, so lasse ich deinen Fuß los und ihr ertrinkt dann alle beide." Darauf läßt der
Mann den Fuß seiner Mutter los, und diese stürzt zur andern Schwiegermutter herab und stirbt auch. Darauf gehen Mann und Weib wieder gemeinsam nach Hause.Die andere, noch geistreichere Schwiegermutterlegende hat folgenden Inhalt: Ein Mann und eine Frau machen sich auf den Weg, der Mutter der Frau einen Besuch abzustatten und sie zu begrüßen. Sie treffen unterwegs Marguman (Vararus). Marguman sagt zu dem Manne: "Wenn du mich nicht tötest, wird deine Schwiegermutter sterben. Wenn du mich tötest, wird deine eigene Mutter sterben." Der Mann sagte darauf zu seiner Frau: "Was meinst du? Marguman sagte zu mir, wenn ich ihn nicht töte, wird deine Mutter sterben. Wenn ich ihn aber töte, dann wird meine eigene Mutter sterben. Was meinst du nun: "Soll ich Marguman töten oder soll ich Marguman nicht töten?" Die Frau sagte darauf nichts. Beide, Mann und Frau, sagten eine Zeitlang gar nichts. Dann aber sagte der Mann: "Es ist doch besser, ich töte Marguman. Dann stirbt meine Mutter. Deine Mutter aber bleibt am Leben." Darauf tötet der Mann also Marguman, zumal die Frau damit auch einverstanden ist. Sie setzten darauf den Weg zur Mutter der Frau nicht fort, sondern kehrten nach Hause zurück. Hier ist inzwischen die Mutter gestorben. — Die Mutter der Frau kommt aber selbst eines Tages, um ihren Gruß zu entbieten, um zu danken, daß man ihr Leben geschont hat. —
II
DER LEBENSINHALT DER HOCHSUDANER
12. Kapitel: Kulturen der Ausdehnung
Die Lebensbilder der Adamauavölker, wie sie in Kapitel 3-11 skizziert sind, stellen Spielformen des gleichen Kultursinnes dar. Die aufs engste verdichtete Kultur dieser Stämme beruht ihrer wesentlichen Eigenart nach in einem sprachlich ausdrucksschwachen und daher von außen her kaum dogmatisch generalisierten Reichtum des Erlebens. Die Ausdrucksschwäche bei bewegtem und reich durchlebtem Innensinn beschränkt und begrenzt. Damit erkläre ich es, daß ich bei diesen Dutzenden von Stämmchen und kleinen Gemeinschaften so außerordentlich selten und dann auch nur verkümmerte Reste von Volksdichtungen vorfand. Die Motive des bei weitem größten Teiles der afrikanischen Volkserzählungen sind kaum als afrikanisch zu bezeichnen (wenn nicht allerdings eine ganz große Gruppe überhaupt in diesem Erdteil mit seine Urheimat hat). Die meisten sind wie alle Grundlagen der Kultur, eingeführt (oder ein Teil uralt und schon urgeschichtliches Quellenmaterial). Aus diesem eingeführten Kulturgut oder Fabelwesen schufen die Afrikaner aber sehr verschiedene Formen. Sie machten sich einen Bestand zu eigen. Die einen einen größeren oder bunteren, die andern einen kleineren oder schlichteren. (Eine solche Variation tritt aus dem Vergleich der Mande- und Mossifabulei in Band VIII hervor.) Einige jedoch nahmen in bezug auf Fabel- und Märchenkunde auch nichts an oder aber ließen dies Kulturgut, weil es als solches ihrem Seelenleben nicht adäquat war, verkümmern. Es entsprach nicht den Bedürfnissen ihres Erlebens. Denn sie leben die Dichtung noch und drücken sie nicht aus, weil ihrer Art nach das Leben sie noch vorbegrifflich erfüllt.
Diese Erkenntnis erachte ich, wie gesagt, für hochbedeutsam. Sie nur kann einen Aufschluß geben über viele Erscheinungen der Morphologie der Volksdichtungen überhaupt. Wir haben hier eine Form des Bewußtseins, die wir überhaupt kaum mehr nachzuempfinden vermögen.
E s tritt das besonders zutage, wenn wir uns ein wichtiges Moment dieser tiefsudanischen Seelenbetätigung in seinen vielen Varianten vergegenwärtigen: das Verhältnis des Zeitbegriffes zum Problem des Lebens und Todes. Wir, die wir bedingungslos historisch denken, die wir das eigene Leben als Glied einer ins Unbekannte hinaus verlängerten Ordnung, einer Väterreihe, einer Volksgeschichte, eines uns durchrieselnden Kulturwachstums erfühlen, wir können kaum verstehen, daß jene leben: in einer geschichtlichen Zeitlosigkeit, in einem Rhythmus von Leben und Tod, einem ewigen Turnus, der keinen Verlust und keinen Gewinn, keinerlei Wechsel des Schicksals
und keinen Blick in ein Anderswerden gestattet —und doch innerlich bereichert.Es ist etwas Monumentales um diese Einfachheit, etwas Großes in solcher Umgrenzung, die nur zu verstehen ist aus der Isolierung und Bannung im Raum. Seit undenklichen Zeiten lebten noch bis vor kurzem große Teile dieser Gemeinschaften an der gleichen Stelle. Die Aschenabfalishaufen der kleinen Sippengehöfte, auf die die sehr reinlichen Bewohner seit Generationen den ausgekehrten Küchenabfall und Besenstaub warfen, überragen zum Teil die Häuser und Türme um ein bedeutendes. Ein Beleg der Gebundenheit im kleinsten Raum. Ein Ausdruck der Ständigkeit äußerer Lebensform.
Solche Ständigkeit wurde aber aufgehoben durch die Bildungen der hohen Kulturen des Sudan. Und wie unter der Einwirkung dieser höheren Entfaltung diese äthiopische Geistes- und Seelenart sich umbildete oder auswirkte, das zu zeigen ist Aufgabe dieses II. Teiles, der in Kapitel 13-19 wünschenswerte Belege bringen soll.
Die Staaten der Hochsudaner, wie sie noch in geschichtlicher Zeit sich gleich einer Perikette vom roten Meer bis zur Senegalmündung, von Abessynien-Napata (siehe Bd. IV) durch den Sudan zogen und zum Teil heute noch ziehen, sind auf uralten Fundamenten (uralt soll "weitvorchristlich"heißen), aufgebaut. Ein Staatsgebäude richtete sich auf den Trümmern des andern auf. Von vielen wissen wir es, von andern erzählen es Überlieferungen, und alle zusammen sind mit ihrem klaren Innenbau nicht anders zu verstehen.
Als typisches Bild gebe ich in Kapitel 13-14 den Aufbau Nupes aus dem Mythischen bis in die Gegenwart. —
Diese Hochkulturen mit ihren Staatsformen, die Gliederungen der Kardinaiprovinzen und Kardinalbeamten, der Pfalz mit dem Königsoder Kaiserhof, ihren Städten und Märkten, mit den Karawanen und Kriegshaufen, ihren Industrien und Verkehrswegen stellten etwas Ausgedehntes und in der Ausdehnung sich Bewegendes im Gegensatz zu dem Verdichteten und in der Verdichtung Ruhenden des tiefsudanischen Stiles dar.
Innerlich aber bedeutet Hochsudanertum eine ganz andere Form des Bewußtseins.
Die Bewußtseinsform der hochsudanischen Kultur ist im Prinzip der unseren gleich. Blick und Bewegung nach außen! Ständiger Austausch. Starker kultureller Austausch. In jeder Hinsicht. Je kräftiger der Lebensstil im allgemeinen, desto stärker auch im einzelnen. Natürlich auch in der Volksdichtung. Ich erinnere an die epischen Dichtungen in der Sahel (Bd. VI), an die Dämonologien am Niger (Bd. VII), an die Märchen in den Haussastaaten (Bd. IX).
Ganz außerordentlich abhängig sind die Erscheinungen in ihrer Blutwärme vom Geschick der Völker und Staaten, der Fürstenhöfe hier, des Rittergeschlechtes dort und der Stadtgröße vielerorts — ebenso abhängig von dem Zufluß aus benachbartem Gebiete, die teils zuchtstärkend wirken wie die Sahara (siehe den Beginn des VI. Bandes), teils verweichlichend wie nach Süden und Westen hin; wie von der Kraft der benachbarten Quelle, aus der Motiv und Stoff zufließt (so in Kordofan Bd. V sehr stark) und nährt. —
Außerordentlich reich an Stilformen ist so die Welt der Hochkulturen des Sudan, und wohl nirgends tritt das so deutlich zutage wie in der Volksdichtung.
Diesen Weg und Wandel zu charakterisieren, ist die Aufgabe der nachfolgenden Kapitel 13-19.
Wie gesagt, zunächst der Typus noch voller Lebenskraft und starken Entwicklungsgefühls (Nupe Kap. 13 und 14; dazu Bd. IX). Der historische Sinn ist entfaltet. Demgegenüber die Mossi mit ihrem starken Einschlag von Kultur der Splitterstämme (Kap. 15). Das Motiv der Ahnenverehrung tritt für das Herrschergeschlecht in das Stadium dynastischer Tabellierung. Ferner die Malinke. Als Einleitung die alte Tradition gebildet nach dem Typus der Heldendichtung nördlicher Stämme (Bd. VI). Aber das Sudanische tritt in dieser Sunjattalegende doch schon stark hervor (Kap. 16) und degeneriert zu historischen Notizen (Kap. 16-17), wie es auch bei den nördlichen, jüngeren Bammana der Fall ist (Kap. 18). Werden diese Völker dann in den Wald gedrängt, dann versagt der starke Schwung. das Lebensgefühl der Tiefsudaner und Waldbewohner gewinnt mehr Raum (Kap. 19).
Ziehen wir den Schluß, so drängt sich immer wieder das natürliche Bedürfnis zur Vereinfachung auf. Eine wesenlose Stammbaum- und Namensaufzählung, etwas absolut Begriffliches bleibt äußerlich haften, und prüft man das Wesen des tieferen Volksgefühles nach, so erscheint als Erlebnis wieder die alte Fürsorge und Liebe in der Vorstellung des rhythmischen Turnus einer Einheit im Reichtum des Seins — wenn auch jetzt, nach dem Durchgang durch die läuternde Flamme der Geschicke ausgedehnter Kulturen nicht mehr nur kindlich
naiv. Jetzt vielmehr ausgerüstet mit einem zwar zeitweilig brachliegenden Schatz von Begriffen im Halbbewußtsein, der aber durch schicksalsmäßige Geschicke wieder zur Nahrung einer neuen und mächtigeren Flamme des Willens zur Wiederausdehnung werden kann.
13. Kapitel: Legenden der Nupe*
Die eigentlichen Erzählungen und Berichte der Nupe, Haussa und Joruba zerfallen in drei Gruppen:
Nupename. Haussaname. Jorubaname. 1. Historische Berichte, also Geschichtsüber- Eian-jepain. Labari-nda. Jta-ati-djo. lieferungen. J 2. Historische Legen- 1 den, Sagen, Überlie- Gamaga. Dama-gana. Aka weora. ferungen. J 3. Märchen, Fabeln, Geschichten, Volks-} Etschi. Tassunja. Ab. erzählungen. J |
Die ersten von diesen: die eigentlichen historischen Kenntnisse des Volkes, ruhen in den Köpfen der alten Leute und in tabellarischen Chroniken. Die Fulbe haben arabische Chroniken auf Papier geschrieben und Aufzeichnungen gemacht von der Zeit an, da sie in diese Länder kamen. Sie sind aber beim Sturme der Engländer auf Bida verbrannt. Wenigstens behaupten die Fulbe das. Es ist immerhin nicht ausgeschlossen, daß das nicht ganz wahr ist und daß hier oder da noch die Kopien einer arabischen Geschichtsbeschreibung der letzten Jahrhunderte bestehen. Die Nupe haben vordem Tatsachen ihrer Geschichte auf Leder geschrieben. Mit dem Islam kam andere Schrift und Schreibweise ins Land und wurden dann auch jene Königsreihen aufgezeichnet, von denen ich einige Niederschriften im Süden entdeckte. Die für die heutigen Nupe geschichtliche Periode beginnt vor etwa hundert Jahren mit dem Einzug der Fulbe, mit dem Auftauchen des Maliem-dando, mit jenem fürchterlichen Kriege, der das ganze Land zerstört, die Bevölkerung dezimiert und die Herrschaft in die Hände der Fulbe langsam, aber sicher hinübergespielt hat.
Was also dieser eigentlich historischen Periode vorangeht, was aus der Zeit vorher im Volke berichtet wird, muß als Legende, Sage,
Diese Bardengesänge weisen, wie gesagt, einen verhältnismäßig schwachen Zusammenhang mit der historischen Wahrheit auf. Die Edegisagen, die Überlieferungen von der Einwanderung dieser alten Helden bergen vielleicht und wahrscheinlich noch am meisten Geschehenes. Geschichtlich wahr ist an der Mehrzahl der andern Sagen wohl nur der Name des betreffenden Königs, unter dessen Herrschaft sich die und die Geschichte abgespielt haben soll. Wir lernen also daraus, daß einmal ein Edsu (König) mit dem und dem Namen gelebt hat. Das ist alles. Das übrige ist ebensowenig historisch ernst zu nehmen wie etwa die Rotbartkyffhäusersage oder die Heiligengeschichte St. Georgs.
Somit würden diese Legenden an sich ebensogut unter die Volksüberlieferungen gerechnet werden können, ja noch besser dahin, als zu den geschichtlichen Betrachtungen, wenn sie nicht doch von den Märchen, Fabeln usw. von vornherein dadurch unterschieden würden, daß die Volksüberlieferungen vom Volke abends weitergetragen werden und von einem Mädchen- oder Burschenmund zum andern, diese "Sagen" aber von Spielleuten an Königshöfen gesungen werden. Das ist ein wesentlicher Unterschied, der von vornherein Aufmerksamkeit in der Unterscheidung fordert. Das Etschimärchen erzählt sich alle Welt. Die Gamagasage aber vererbt ein Spielmann an den andern; und der Spielmannsberuf ist in diesem Lande des Zunftwesens genau so erblich wie der der Glasarbeiter, der Metallarbeiter, der Gelbgießer usw.
Ich hatte schon einmal vor einem gleichen Unterschiede gestanden, das war bei den Bosso am Mittellauf des Nigers. Während in den Mandeländern die Bardengesänge von den Märchen in Typ und Inhalt so verschieden waren, daß nur in ganz, ganz wenigen Fällen eine Ähnlichkeit oder Annäherung in der Geistesart zutage tritt (vgl. Bd. VI und VIII), waren die sogenannten historischen Gesänge
der Bossobarden so fantasiereich, so märchenhaft, so historisch unmöglich (vgl. Bd. VII), daß sie große Ähnlichkeit mit Volksgeschichten zeigten. Gar manches Mal drängte sich mir bei den Bosso die Frage auf, ob die Barden wohl nicht etwa nur ganz übliche Märchen an Stelle der verlorenen Epentypen sängen.Dieser Verdacht tauchte auch im Nupelande bei mir auf und manchmal schüttelte ich anfangs meinen Kopf, bis sich dann eines Tages die Übereinstimmung einer solchen Nupetradition und einer entsprechenden Bossotradition aufdrängte. Ich verglich mein weiteres Material mit dem, was ich von den Bossosachen im Kopfe hatte, und kam zu der Überzeugung, daß hier ein tieferliegender Grund für die vielseitige Übereinstimmung gefunden werden müsse.
Wie immer in solchen Fragen, muß auch hier ein Hinweis auf das geographische Problem Aufklärung bieten. Die Bosso wohnen am mittleren Niger, westlich der Bogenhöhe, die Nupe am unteren Niger. Der Niger verbindet die Länder der Bosso und der Nupe. Und das ganze Gebiet, das zwischen den Bosso- und Nupeländern liegt, wurde in alter Zeit beherrscht von der Songhai-Kultur. Wie Fransen an einem schmalen, langen Schal laufen die Fäden der Bosso- und Nupekultur aus dem Gebiet dieses alten Kaiserreiches nach Nordwesten und Südosten aus. Es muß eine sehr alte Kultur sein, und die Übereinstimmung des Inhalts der Spielmannsgesänge scheint eine sehr ehrwürdige zu sein.
So betrachtet, sieht der Bardengesang der Nupe also ebenso anders aus, wie etwa der Typus des deutschen Märchens unterschieden ist von der Art der deutschen Sage - wenn beide auch aus gleicher Materie fließen und ähnliche Form vielfach angenommen haben. — Hier nun einige Gamaga.
a) Legenden der EdeßiperiodeEbensowenig wie der Westen und Südwesten war der Osten des Nupelandes unabhängig. Der Oberherr des Ostteiles der Nupe Transkaduna mit der alten, heute ausgewischten Stadt Gbarra stand unter der Hoheit des Igirraherrschers, der in Ida oder Agbarra am Niger herrschte und regelmäßige Boten nach Nupe schickte, damit diese ihm dann Tribut und Sklaven eintrieben. Mit dieser letzteren Beziehung setzte die Tradition ein. Sie weiß aber nichts davon zu berichten, daß die Haussastaaten vor dem Eingreifen der Fulbe einen Einfluß auf die Nupekultur ausgeübt hätten. — Mit zwei leicht abweichenden Versionen der Edegiherkunft will ich die Sagenwiedergabe beginnen.
Edegi lebte vor langen, langen Jahren. Er war ein Nupe. Im Kriege wurde er vom Atagarrahäuptling (dem Häuptling der Igbirra) gefangengenommen und nach Ida oder Eda am Niger gebracht. Edegis Heimatland war Danji, das nordwestlich von Bida zwischen Moregi und Edegi in Transkaduna liegt. Seiner Familie nach stammte er von Issa ab, der vordem aus Nafada kam. Edegi arbeitete in Ida so ausgezeichnet, daß er sich bald allgemeiner Beliebtheit erfreute. Eines Tages ward der Atagarrahäuptling sehr krank. Seine Familie fragte einen Boschi (= Schamane): "Wie kann der Edsu (König) wieder gesund werden?" Der Boschi sagte: "Der Edsu kann wieder gesund werden, wenn er ein Palmölgericht genießt. Die Palmkerntraube, aus der die Nuß gewonnen wird, darf aber, wenn sie abgeschnitten wird, nicht auf den Boden fallen; sie darf nicht den Boden berühren, sondern muß von einem Manne aufgefangen werden." Verschiedene Leute stiegen auf Palmbäume und schnitten die Trauben ab. Unten standen Leute, sie aufzufangen. Einige Leute sprangen beiseite, wenn die Trauben herabkamen, andere wurden von ihnen zu Boden gedrückt und getötet. Alle Trauben berührten die Erde. Edegi trat hervor und sagte: "Ich will es versuchen! Geht ihr andern fort!" Es stieg ein Mann auf einen Palmbaum und schnitt eine Palmtraube ab. Edegi stand unten und fing sie auf mit beiden Armen. Die Traube war sehr schwer. Sie vermochte Edegi nicht zu zermalmen. Sie zerschlug ihm aber das Gesicht und spaltete ihm die Oberlippe. Man bereitete das Öl. Der König genoß die Speise und ward so von seiner Krankheit geheilt. Nach einiger Zeit erkrankte der Atagarrahäuptling jedoch zum zweiten Male. Da rief er Edegi. Er sagte zu
Edegi: "Es nützt alles nichts. Ich werde doch immer wieder krank werden. Kehre also wieder in deine Heimat zurück. Ich werde dich zum Herrn von Nupe machen. Ich werde dir ein Boot geben, daß du in deine Heimat zurückfahren kannst." Der Atagarrahäuptling gab Edegi ein Boot. Edegi hatte damals noch seine gespaltene Oberlippe, und auch viele Nachkommen Edegis kann man an der gespaltenen Oberlippe erkennen. Edegi fuhr den Niger hinauf. Edegi kam so in das Nupeland zurück. Edegi kam ohne kriegerische Zwischenfälle nach Nupe und wurde Nupekönig in der Stadt Gbarra. Viele sagen, Edegi habe Gbarra gegründet. Edegi war kein unabhängiger Nupekönig. Er herrschte im Namen des Atagarrakönigs und sandte, wie es immer gewesen war, Kleider, Salz und junge Leute nach Ida. Die jungen Leute wurden in Ida als Sklaven verkauft. Sie wurden in Nupeland aus Armen und Besitzlosen zu Sklaven gemacht. Diese Abgaben sandte man erst an den Häuptling des Ortes Kotonkarifi, das am Niger, nicht weit jenseits von Lokoja, liegt. Von da wurden sie dann bis Ida gebracht und dem Atagarrahäuptling überliefert.Die andere Version der Wanderlegende lautet:
Es gibt zwei Ortschaften mit dem Namen Atagarra. Die eine, unbedeutende, liegt (oder lag) nahe dem Einfluß des Kuarra in den Niger; die andere ist das Atagarra im Igbirragebiet, das mit der Königsstadt Ida identisch ist. Im Nupe-Atagarra wohnte in alter Zeit ein Nupemann, der heiratete eine Nupefrau. Die Frau gebar ein Kind. Das ward Edegi genannt. Bald nach der Geburt des Knaben Edegi starb der Vater. Darauf machte Edegis Mutter sich auf den Weg und wanderte nach Igbirra-Atagarra. Der König dieser Stadt heiratete und nahm Edegi wie einen Sohn mit in sein Gehöft auf. In damaliger Zeit gab es keinerlei König im Lande der Nupe. Die Gerichtsbarkeit jedes Häuptlings hörte außerhalb jeder Stadt auf, und wer etwas Schlechtes getan hatte, brauchte nur bis zur nächsten Stadt zu laufen, um den Folgen seiner Handlungsweise zu entgehen. Alle Nupe zahlten aber jährlich an den König der Igbirra eine Abgabe. Es war das ein sehr großer König, der den Burschen Edegi außerordentlich liebte. Er schenkte Edegi ein Pferd. Er schenkte dem Jungen alles, was er begehrte. Man achtete darum Edegi, als ob er der Sohn des Königs wäre, und viele hielten ihn für einen Sohn des Königs. Als der Bursche groß geworden war, starb seine Mutter. Nachher starb auch der König von Atagarra. Viele sagten, Edegi solle nun König der Igbirra werden. Edegi sagte: "Wenn ich euer König wäre, würde ich ein guter König sein. Ich bin aber kein richtiger
Sohn dieses Königs. Der König hat richtige Söhne. Wenn ich jetzt König würde, würden die Söhne des Königs gegen mich kämpfen. Es wäre unrecht von mir, gegen die Söhne des Königs Krieg zu führen. Der König war gut zu mir. Deshalb will ich aus dem Lande gehen, in das Land, aus dem mein Vater und meine Mutter stammen, in das Land, in dem ich geboren ward. Ich will nach Nupe gehen und will in Nupe König werden. Hier soll aber ein Sohn des Königs König werden!"Edegi rief die Schmiede in Atagarra zusammen und sagte zu ihnen: "Schmiedet mir aus Eisen ein großes Boot, in dem ich nach Nupe fahren kann!" Die Schmiede begannen sogleich mit der Herstellung des eisernen Bootes. Es war sehr groß und ungemein stark. Als das Boot fertig war, rief er alle alten Leute von Atagarra zusammen. Er sagte zu ihnen: "Ich gehe nun fort. Gehorchet dem Sohn eures Königs!" Die Alten nahmen von ihm Abschied. Edegi legte dann in sein Boot seinen Sattel und das Zaumzeug seines Pferdes. Er legte Bogen und Pfeile seines Daumenspannringes (Mak'a) und die Bogenschelle (Emagi) hinein. Dann rief Edegi die Leute zusammen, mit denen er nach seinem Lande fahren wollte. Der erste, den er mitnahm, war ein Mann, dessen Finger von der Lepra (Nupe Soko-kundji; Haussa Kuturu; Joruba =Adete) abgefressen waren. Der zweite, den er mitnahm, war ein Blinder (Nupe =Jebondschi; Haussa Makafafu; Joruba =Efaju). Der dritte, den er mitnahm, war ein Mann mit verkrüppelten Beinen (Nupe =Eroagi; Haussa =Gurugu; Joruba Aro). Diese drei hatte er gesucht, um sie als Begleiter mit nach Nupe zu nehmen. Der vierte aber, den er mitnahm, war Dako Boea (die große Stammesmaske) —siehe auch nächste Legende — und der fünfte der mit der Mama (Juhuhu) Maskierte. Auch diese beiden stiegen mit in das Boot. Endlich stieg auch Edegi hinein. Sie fuhren den Niger hinauf, nach dem Nupe-Atagarra zu, an Lokoja vorbei. Der Blinde und der Krüppel ruderten. Der Leprakranke hatte eine Kalebasse und schöpfte damit das eindringende Wasser heraus. Edegi, Mama und Dako Bboea saßen in der Mitte.
Edegi fuhr erst bis etwa zur Mündung des Kaduna. Als er dort nach Gbarra (oder Igbirra) kam, stieg er allein aus dem Boote. Alle andern blieben, bis er zurückkehrte, darin zurück. Edegi ging an das Land, um das Haus zu sehen, in dem seine Mutter geboren war. Er blieb zwei Tage in der Stadt. Dann kehrte er zu seinem Eisenboote zurück und fand alle seine Begleiter noch vor. Sie verließen das Ufer bei Gbarra und fuhren weiter, um nach Atagarra (nahe Kaduna)
zu gelangen, das nicht weit von Nupe-ko liegt und die Heimatstadt seines Vaters gewesen war. Als sie aber in der Fahrt waren, zerbarst das Eisenboot. Sie stiegen alle hinaus und trugen ihre Sachen an das Ufer. Das eiserne Boot blieb im Flusse liegen, und wenn wenig Wasser im Niger ist, ragt es heute noch über den Stromspiegel empor. Es liegt nicht weit von Nupe-ko. Mehrere meiner Leute erklärten, es häufig gesehen zu haben. Sie beschrieben es als ungeheuer groß, genau gestaltet wie ein anderes Boot der Nupe, als Einbaum, der mit starken Plattformen vorn und hinten versehen ist. In der Regenzeit soll es aber vom Wasser überspült werden. — Nachdem sie ihre Sachen herausgenommen und ans Ufer gestiegen waren, gingen sie zu Fuß nach Atagarra weiter.In Atagarra heiratete Edegi. Seine Frau ward schwanger. Sie gebar Zwillinge (Nupe =Bakomba; Haussa =Togwai; Joruba =Ebegi). Diese Zwillinge nannte er Ebako und Ebagi. Egabi starb später in Rabba. Man nennt den Platz seines Grabes Sagunla. Bakodji aber starb in Mokwa. Sein Grabplatz heißt Sesi Saba. — In Atagarra lebte und regierte Edegi lange Zeit und häufte da seinen Besitz und seine Reichtümer auf. Vieles von seiner Hinterlassenschaft war noch nach langer Zeit, nämlich im vorigen Jahrhundert, so hoch geschätzt, daß von seinem Besitz die Königswürde in Nupe abhing. — Edegi soll gewaltig groß und stark gewesen sein. Das Pferd, das er in Atagarra ritt, war so gewaltig, wie Pferde heute überhaupt auch nur annähernd nicht mehr vorkommen.
Danach begann Edegis Zug nach dem Nupe-Transkaduna. Er zog von Ort zu Ort. Eine spezielle Legende berichtet von seinem Eintreffen in Epa und ist gleichzeitig eine zweite Tradition über das Entstehen der Dako Boea.
In Epa lebte damals der Häuptling Guschi, der erste dieses Namens. Alle Leute kamen Edegi im Lande entgegen, sobald er sich einer Ortschaft näherte. Alle begrüßten ihn als König. Als Edegi sich der Ortschaft Epa näherte, sagten die Leute: "Wir wollen Edegi entgegengehen!" Guschi sagte aber: "Nein, wir wollen ihm nicht entgegengehen, ich bin mein eigener Herr!" Die Leute aus Epa kamen Edegi nicht entgegen. Als Edegi nahe zu der Stadt gekommen war, fragte er: "Mir kommt hier niemand entgegen. Wer ist der Edsu (König) dieser Stadt?" Die Leute sagten: "Der Edsu dieser Stadt ist Guschil" Edegi fragte: "Warum kommt Guschi nicht, mich zu begrüßen?" Edegi ritt zu Pferde bis zu Guschis Gehöft. Vor der Katamba (dem Torhause) stieg er ab. Guschi sagte: "Ich will Edegi nicht sehen!"
Edegi trat heran. Guschi wandte ihm den Rücken zu. Guschi sagte: "Du bist Edsu! Ich bin Edsu! Zwei Edsu können nicht in einer Stadt leben!" Da fiel Guschi hin und starb. Edegi sagte: "Dieser Guschi war ein rechter Edsu. Ruft seinen ersten Sohn herbei!" Der erste Sohn Guschis kam. Edegi sagte zu ihm: "Bist du Guschis erster Sohn?" Der Sohn sagte: "Ich bin es."Edegi sagte: "Ich ziehe weiter. Bleibe du Edsu. Sei ein Edsu wie dein Vater und zahle deine jährlichen Abgaben. Bringt alles heraus, was Guschi gehört hat, und gebt es dem ersten Sohn!" Die Leute brachten alles heraus. Sie legten den gestorbenen Guschi in die Mitte. Edegi sagte: "Dies alles soll der erste Sohn Guschis sorgsam hüten." Dann stieg Edegi auf sein Pferd und ritt von dannen. — Am andern Morgen erwachten die Leute. Wie sie zu dem Gehöft Guschis kamen, war der Leichnam Guschis verschwunden. Vor der Tür der Katamba aber stand hochaufgerichtet Dako Boea. Als die Leute das sahen, sandte der älteste Sohn Guschis Edegi eine Botschaft nach. Der Bote kam zu Edegi und sagte: "In der Nacht ist Guschi verschwunden. Vor der Katamba steht Dako Boea."Edegi sagte: "Dann soll der älteste Sohn Guschis den Dako Boea ebenso sorgsam hüten wie alle andern Sachen Guschis." Der Bote kehrte zurück. — Seitdem heißt jeder Edsu in Epa Guschi. Die Epaleute sagen, daß ihr Dako Boea der erste aller Dako Boea sei und daß keine Stadt einen Dako Boea einrichten könne, wenn der Guschi von Epa hierzu nicht seine Einwilligung gegeben hat. Diese Tradition nimmt aber in variierter Form auch an, daß Guschi schon vor der Abreise Edegis begraben sei, daß dann aber Dako Boea aus dem Grabe Guschis aufgestiegen sei und demnach gewissermaßen die Verkörperung des verstorbenen Edsu Guschi darstelle. Andere, und die meisten Nupe erzählen aber, daß Dako Boea mit Edegi zusammen ins Land gekommen sei.Alle Überlieferungen sind sich darin einig, daß Edegi als echter Nupefürst in Transkaduna von allen Nupe mit viel Freundlichkeit aufgenommen und mit Begeisterung begrüßt wurde. Denn in allen Städten waren Vertreter des Jorubakönigs eingenistet. Er verjagte diese Joruba und setzte überall seine Statthalter (Nupe =Egba; Haussa =Adjelle; Joruba =Ogallu) ein. Sie waren seine Richter und hatten die Abgaben in gerechter Weise zu erheben. Das Nupevolk ward unter ihm sehr reich und gewann reiche Nachkommenschaft, da er ihm Frieden und Erholung gönnte. Er baute erst Nupe-ko aus, dann Mokwa, dann Rabba. Nachher zog er überall die Joruba vertreibend bis nach Sugurma, errichtete hier sein Quartier und ordnete
die Verhältnisse. Von hier aus begann er auch seinen letzten Kriegszug, der gegen die Kambelli gerichtet war. Er marschierte von Ebi, wo er die letzten Joruba vertrieb, auf Jauri zu. In Mamba, am oder nahe dem Flusse Watta, kam es zu einem Gefecht, in dem Edegi von einem Pfeile verwundet ward, der vergiftet war. Er kam noch bis zu der Stelle, an der dann später die Stadt Badege gebaut ward. Hier starb er. Sein Leib ward aufgeschnitten, die Eingeweide wurden herausgenommen und in Badege bestattet. Der Körper ward aber nach Gbarra gebracht und dort anscheinend in einer der großen Begräbnishöhlen der Vorzeit aufgerichtet. In Badege aber ward über dem Grabe ein großes Haus errichtet. In diesem fand seine Reiterrüstung und Bewaffnung Aufnahme. Man zeigt daselbst noch heute seinen Bogenspannring, seine Bogenschelle, seinen Sattel, seine Steigbügel, von denen einer so groß sein soll wie meine größten Korbkoffer. Um sein Grab herum ward aber eine neue Stadt, eben Badege, gegründet. Es ward befohlen, daß jede Stadt einen Mann und eine Frau nach dem Platze senden solle, daß sie sich da ansiedeln. So entstand die Stadt.Das ist im wesentlichen das, was ich über Edegi hörte. Interessant sind noch einige Angaben, die sich auf die Zeit vor dieser Kulturperiode beziehen. Danach soll in alter Zeit niemals der Vater das Recht über die Kinder gehabt haben, die er gezeugt hatte, sondern nur die Mutter und der Bruder der Mutter. Im Osten des Nupelandes, in Transkaduna, herrschte vor der Edegifamilie der Clan der "Bini", deren Urahn ein gewisser Tafi gewesen sein soll.
Nach dem Tode Edegis herrschten bis zu dem letzten verstorbenen Edsu Baba angeblich achtundzwanzig Könige, deren Reihe im wesentlichen aus Edegiblut resultiert, bis auf wenige Usurpatoren. Den Übergang zur wahren Geschichte bildet eine Gruppe von Überlieferungen, die an die Personen einiger Könige, wie Edsu Masu und Edsu Audu, gebunden sind.
b) Edsu Masus Krieg gegen Edsu Zurugi
Edsu Masu lebte in der Stadt Jirna, die in der Gegend von Gbarra (im Kadugebiet) liegen soll. Edsu Masu war nicht unumschränkter Herr über ganz Nupe. Er mußte die Herrschaft erst erobern. Es gab noch einen zweiten König, das war Edsu Zurugi. Viele alte Leute gingen im Lande von einem der beiden Könige zum andern und wiegelten sie gegeneinander auf. Edsu Masu, der ein Nachkomme Edegis
war, mußte drei Jahre lang gegen Edsu Zurugi kämpfen. Edsu Masu sagte: "Wie soll ich Edsu Zurugi bezwingen! Edsu Zurugi ist stark. Ich werde den Hunger rufen!" Edsu Masu rief den Hunger und sagte: "Gehe hin und töte die Leute Edsu Zurugis!" Der Hunger ging hin und begab sich zu Edsu Zurugi. Die Leute Edsu Zurugis begannen zu hungern. Einige Leute Edsu Zurugis starben. Die Hälfte der Leute Edsu Zurugis starb. Es starben zweitausend Leute, weil sie nichts zu essen hatten. Dann sagte der Hunger: "Ich habe zweitausend Menschen getötet, nun bin ich müde. Es kommt der Regen, und das Korn wird wachsen. Edsu Zurugis Volk wird immer wieder zu essen haben." Der Hunger ging fort.Edsu Masu sagte: "Wie soll ich Edsu Zurugi bezwingen! Der Hunger hat ihm zweitausend Menschen getötet, aber er ist noch stark. Ich werde Sagpanadji (die Blatternkrankheit) rufen!" Edsu Masu rief Sagpanadji und sagte zu ihm: "Gehe hin und töte die Leute Zurugis!"Sagpanadji ging hin in Edsu Zurugis Stadt. Er begab sich zu Edsu Zurugis Leuten. Die Leute Edsu Zurugis begannen zu erkranken. Es starben einige. Es starben viele. Es starben zweitausend von Edsu Zurugis Leuten. Dann ging Sagpanadji aus der Stadt Edsu Zurugis heraus. Er begab sich zu Edsu Masu und sagte: "Ich tötete zweitausend von Edsu Zurugis Leuten. Nun bin ich müde."
Edsu Masu sagte: "Wie soll ich Edsu Zurugi bezwingen? Der Hunger hat ihm zweitausend Menschen getötet. Sagpanadji hat ihm zweitausend Menschen getötet. Aber Edsu Zurugi ist noch stark." Es war da ein Monafiki (hinterlistiger Hetzer, Verräter usw.). Dieser Monafiki kam zu Edsu Masu und sagte: "Gib mir Perlen! Gib mir Kleider! Gib mir ein Gewehr! Ich will damit zu Edsu Zurugi gehen und ihn schwächen, so daß du ihn bezwingen kannst." Edsu Masu gab ihm Perlen und Kleider und ein Gewehr. Der Monafiki ging damit in die Stadt Edsu Zurugis.
Als der Monafiki in die Stadt kam, fragte er die Leute: "Wer ist stärker: Edsu Zurugi oder sein Saba?" (Saba oder Siaba oder Schaba entspricht dem Jerima der Haussa, ist der Kronerbe, der vom Edsu selbst noch bei Lebzeiten erwählt wird.) Ein Bursche sagte: "Von den beiden ist der Saba der stärkere, denn er hat eine sehr schöne und starke Frau und einen sehr reichen und starken Freund!" Der Monafiki ging zu der starken und schönen Frau des Saba, gab ihr eine schöne Perlenschnur und sagte zu ihr: "Diese Perlen sendet dir der Freund deines Mannes. Du sollst sie tragen. Er bittet dich, du möchtest zu ihm kommen und bei ihm schlafen. Er möchte oft mit
dir schlafen." Die Frau nahm die Perlen und fragte: "Wann soll ich zu ihm kommen?" Der Monafiki sagte: "Du sollst am Salafesttage zu ihm kommen, wenn dein Mann in der Massalatschi (Moschee) ist." Die Frau sagte: "Es ist gut."Der Monafiki nahm das Gewehr. Er ging zum Freund des Saba und sagte zu ihm: "Dieses Gewehr hier sendet dir die Frau des Saba. Wenn sie auch die Frau deines Freundes ist, möchte sie doch mit dir schlafen. Die schöne und starke Frau will zu dir kommen." Der reiche und starke Freund sagte: "Wann will diese schöne und starke Frau zu mir kommen?" Der Monafiki sagte: "Sie will am Salafesttage zu dir kommen, wenn ihr Mann, der Saba, in der Massalatschj ist." Der reiche und starke Freund sagte: "Es ist gut."
Das war aber fünf Tage vor dem Salafeste. Am gleichen Abend ritt der Monafiki zu Edsu Masu (der anscheinend belagernd vor Edsu Zurugis Stadt lag), suchte ihn auf und sagte: "In fünf Tagen ist das Salafest. An dem Tage wird der Streit unter den Leuten der Stadt ausbrechen. Halte dich bereit!" Der Monafiki ritt in die Stadt zurück.
Fünf Tage später war das Salafest. Alle Leute gingen in die Massa. latschi. Der Saba ging in die Massalatschi. Als der Saba gegangen war, ging die schöne und starke Frau des Saba zu dem reichen und starken Freund des Saba. Der reiche und starke Freund empfing sie. Er führte sie zu seinem Bette. Er umfaßte sie. Als die schöne und starke Frau des Saba in das Haus des reichen und starken Freundes gegangen war, ritt der Monafiki eilig zur Massalatschi. Er sprang vom Pferd. Er ging in die Massalatschi. Er ging zu dem Saba; er warf sich neben ihm (zum Gebet) nieder. Der Monafiki sagte zum Saba: "Was machst du hier, während dein reicher und starker Freund deine schöne und starke Frau beschläft?" Der Saba stand auf. Er ging hinaus. Er bestieg sein Pferd. Der Monafiki bestieg sein Pferd. Der Saba ritt mit dem Monafiki zu dem Hause des Freundes. Der Saba war sehr zornig. Er ging in das Haus hinein.
Im Hause fand der Saba seine schöne und starke Frau in den Armen des reichen und starken Freundes. Er zog sein Schwert hervor. Er schlug seiner Frau den Kopf ab. Er schlug dem Freunde den Kopf ab. Die Leute des Hauses schrien: "Unser Herr ist erschlagen! Unser Herr ist erschlagen!" Der Sohn des getöteten Freundes sprang mit Pfeil und Bogen aus seinem Hause. Der Saba wollte sein Pferd besteigen und fortreiten. Der Sohn des Freundes schoß einen Pfeil auf ihn ab. Der Saba ward getroffen. Der Saba stürzte vom Pferde. Der Saba starb. Alles Volk lief in Verwirrung durcheinander.
Da ging der Monafiki hin. Mit einem Feuerbrande zündete er erst das Gehöft des Saba, dann das des Freundes, dann das des Edsu Zurugi an. Es waren große Feuer. Alle Leute rannten wild durcheinander. Jeder Mann suchte seine Sachen aus dem Hause zu tragen. Jede Frau suchte ihre Sachen aus ihrem Hause zu tragen. Das Feuer griff um sich. Edsu Masu sah das Feuer von seinem Lager aus. Er ließ die Pferde besteigen. Er ritt mit seinen Leuten auf die Stadt Edsu Zurugis zu. Sie kamen ungehindert in die Stadt. Die Leute Edsu Masus stürzten sich hier auf einen Haufen Menschen und fingen sie. Sie stürzten sich dort auf einen Haufen Menschen und fingen sie. Sie machten viele Sklaven. Niemand entging ihnen. —So wurden alle Leute Edsu Zurugis zu Sklaven gemacht. Auch Edsu Zurugi selbst ward Edsu Masus Sklave. Danach ward Edsu Masu der einzige König im Nupeland.
c) Edsu Masu und sein Sohn Audu (Abudu)Edsu Masus Sohn und Saba war Audu. Edsu Masu wurde sehr alt. Als Edsu Masu ganz alt geworden war und nicht mehr recht gehen konnte, war sein Sohn Audu herangewachsen. Es waren in Jirna noch drei andere angesehene junge Leute, das waren: Egi-Majaki (= Sohn des Galadimas), der hieß Abu, Egi Maliemi (= Sohn des Mauern oder Alfa), der hieß Mamudu und Egi Atadjiri (der Sohn eines reichen Mannes), der hieß Suman (also eigentlich Usman). Die vier jungen Leute stritten viel miteinander. Jeder suchte den andern zu übertreffen. Jeder wollte mehr haben als die andern. Jeder wollte mehr sein als die andern. Sie stritten miteinander und machten schlechte Streiche. Der schlimmste und letzte aber war dieser:
Audu kam zu seinem Vater und sagte: "Ich bin der Sohn des Edsu Masu, ich bin dein Sohn! Gib mir ein Gewehr!"Damals gab es nur sehr wenig Gewehre im Lande. Der Edsu gab seinem Sohne ein Gewehr. Der Sohn des Majaki kam zu seinem Vater und sagte: "Ich bin der Sohn des Majaki. Ich bin dein Sohn! Audu, der Sohn des Edsu, hat ein Gewehr. Kaufe mir auch ein Gewehr!" Der Majaki sagte: "Was der Edsu für seinen Sohn tut, kann ich auch für meinen Sohn tun!"Der Majaki kaufte ein Gewehr und gab es seinem Sohne. Der Sohn des Mauern kam zu seinem Vater und sagte: "Ich bin der Sohn des Mauern, ich bin dein Sohn! Audu, der Sohn des Edsu, hat ein Gewehr. Abu, der Sohn des Majaki, hat ein Gewehr. Kaufe mir auch ein Gewehr!"Der Mauern sagte: "Was der Edsu und der Majaki
für ihre Söhne tun, kann ich auch für meinen Sohn tun!" Der Mauern kaufte ein Gewehr und gab es seinem Sohne. Als Suman das sah, lief er zu seinem Vater und sagte: "Ich bin der Sohn eines Atadjiri, ich bin der Sohn des reichsten Mannes. Ich bin dein Sohn. Audu, der Sohn des Edsu, hat ein Gewehr. Abu, der Sohn des Majaki, hat ein Gewehr. Sogar Mamudu, der Sohn des Mauern, hat ein Gewehr. Was die haben, kann ich nicht haben?" Der reiche Mann sagte: "Gewiß! Was der Edsu, der Majaki und der Mauern für ihre Söhne tun, kann ich auch für den meinen tun. Ich bin ein reicher Mann. Ich kann noch mehr!" Der Atadjiri kaufte zehn Gewehre und schenkte sie seinem Sohne Suman.Audu, der Sohn des Edsu, ging mit seinem Gewehr auf den Markt. Er sagte zu den Leuten: "Ich bin der Sohn des Edsu! Ich vermag mehr als andere. Seht, was ich kann!" Dann schoß Audu fünf Leute tot. Die Leute liefen zum Likali (= dem Alkali, dem Richter) und sagten: "Wir müssen uns beklagen. Audu hat fünf Leute totgeschossen." Der Likali sagte zu den Leuten: "Audu ist der Sohn des Königs Der Edsu Masu hat nichts dazu gesagt. Seid ihr also auch still und geht auseinander! Beruhigt euch!" Das Volk ging auseinander.
Der Sohn des Majaki ging auf den Markt. Er sagte: "Audu hat fünf Leute erschossen. Was der Sohn des Edsu kann, kann ich auch. Niemand hat Audu bestraft. Auch mich wird niemand bestrafen!" Dann schoß der Sohn des Majaki fünfzehn Leute tot. Die Leute liefen zum Edsu und sagten: "Der Sohn des Majaki hat auf dem Marktplatze fünfzehn Leute erschossen. Was ist nun Recht?" Der Edsu sagte zu den Leuten: "Dieser Abu ist jung. Dieser Abu ist der Sohn meines Majaki. Mein Majaki könnte den Krieg gegen mich eröffnen, wenn ich seinen Sohn bestrafe. Seid also still, beruhigt euch und geht auseinander!" Das Volk ging auseinander.
Der Sohn des Mauern ging auf den Markt. Er sagte: "Audu hat fünf Leute erschossen! Abu hat fünfzehn Leute erschossen. Audu ist nicht bestraft, Abu ist nicht bestraft. Was der Sohn des Edsu und der Sohn des Majaki dürfen, darf ich auch. Mich wird auch niemand strafen, denn mein Vater ist der Mauern!" Dann schoß der Sohn des Mauern zwanzig Leute tot. Die Leute liefen zum Edsu und sagten: "Der Sohn des Mauern hat zwanzig Leute erschossen. Was ist nun Recht?" Der Edsu sagte zu den Leuten: "Dieser Mamudu ist jung. Der Mamudu ist der Sohn unseres Mauern. Der Mauern hat den Katun (Koran). Wir alle verehren den Katun und den Mauern. Weshalb sollen wir den Mauern kränken dadurch, daß ich seinen Sohn
bestrafe! Seid also still! Beruhigt euch und geht auseinander!"Das Volk ging auseinander.Der Sohn des reichen Mannes ging auf den Markt. Er sagte: "Audu hat fünf Leute erschossen. Abu hat fünfzehn Leute erschossen. Mamudu hat zwanzig Leute erschossen. Audu ist nicht bestraft, Abu ist nicht bestraft, Mamudu ist nicht bestraft. Was der Sohn des Edsu, der Sohn des Majaki und sogar der Sohn des Mauern dürfen, darf ich auch. Ich kann sogar mehr, denn ich bin der Sohn des reichsten Mannes. Niemand darf mich bestrafen, denn mein Vater ist der reichste Mann!" Dann schoß Suman fünfzig Leute tot. Als Suman das tat, liefen alle Leute von dannen. Sie rannten aus den Häusern und stürzten in den Busch. Alle Welt verließ die Stadt. Die Leute des Edsu kamen zu Edsu Masu und sagten: "Alle Leute haben die Stadt verlassen und sind in den Busch gelaufen, denn Suman, der Sohn des reichen Mannes, hat auf dem Marktplatze fünfzig Menschen erschossen. In Jirna sind keine Menschen mehr!" Darauf sandte der Edsu Boten in den Busch und ließ den Leuten sagen: "Beruhigt euch und kommt zurück!" Darauf kamen die Leute nach Jirna zurück. Sie gingen zum Edsu und fragten: "Wie willst du den Suman bestrafen?" Der Edsu sagte: "Der Vater dieses Burschen gibt mir Geld, wenn ich es brauche. Ich mag seinen Sohn nicht strafen."
Danach rief Edsu Masu Audu, Abu, Mamudu und Suman zusammen und sagte zu ihnen: "Ihr habt viel miteinander gestritten und dabei Schlechtes getan, um euch zu überbieten. Seid in Zukunft Freunde und sucht euch im guten zu übertreffen!" Damit war der Streit zu Ende. Sie wurden wirklich gute Freunde.
Eines Tages besuchte Audu Suman in dem Hause des Atadjiri. Er sah einen großen Schafbock. Er hatte noch nie einen Schafbock gesehen, der so groß war wie dieser. Audu sagte zu Suman: "Schenke mir diesen Schafbock!" (Die Nupe hatten früher die Sitte, besonders schöne Widder wie wir etwa Haushunde zu ständigen Gefährten heranzuziehen. Sie waren mit kostbarem Halsband geschmückt und bekamen auch von dem Fürsten selbst ihre Nahrung vorgesetzt. Diese Tiere galten gewissermaßen als heilig. In Gbarra sollen Gräberverehrer solcher heiligen Fürstenwidder sein.) Suman sagte: "Der Schafbock gehört nicht mir. Er gehört meinem Vater. In dieser Nacht will ich aber in das Haus meines Vaters gehen. Ich will den Schafbock stehlen und ihn dir bringen!" Audu ging. Inder Nacht schlich Suman sich in das Gehöft seines Vaters und stahl den Schafbock. Dann brachte er ihn seinem Freunde Audu.
Am andern Morgen sah der Atadjiri sich nach seinem Schafbock um. Er fragte: "Wo ist mein Schafbock?" Die Leute suchten den Schafbock. Sie fanden ihn nicht. Sie kamen zu dem Atadjiri zurück und sagten: "Der Schafbock muß gestohlen sein!" Der Atadjiri wurde zornig und sagte: "Sendet nach allen Seiten Leute, die danach sehen, wer meinen Schafbock gestohlen hat! Diesen Dieb will ich haben!" Die Frauen des Atadjiri kamen aber zu ihm und sagten: "Mache keinen großen Streit mit der Sache. Wir sahen deinen eigenen Sohn gestern mit dem Schafbock!" Der Atadjiri ließ seinen Sohn rufen. Er fragte ihn: "Weißt du, wo der Schafbock geblieben ist?" Suman sagte: "Gewiß weiß ich das. Mein Freund Audu, der Sohn des Edsu, wollte den Schafbock gerne haben. Da habe ich ihn ihm gegeben!" Der Atadjiri sagte: "So bringt mir meinen Kuti. Ich will jeden töten, der von dem Schafbock gegessen hat!" Suman sagte: "Wenn du den Kuti aufforderst, wird er alle töten, die von dem Schafbock gegessen haben. Das ist nicht gut. Du kannst nicht wissen, wer dabei war. Laß die Sache ruhen!" Der reiche Mann sagte: "Gut, ich will die Sache ruhen lassen!"
Am andern Tage kam Suman in das Haus Audus, um seinen Freund zu besuchen. Suman sagte zu Audu: "Du batest mich gestern um etwas. Ich gab es dir. Heute komme ich zu dir mit einer Bitte." Audu sagte: "Was willst du?" Suman sagte: "Ich möchte bei einer der Frauen deines Vaters schlafen!" Audu sagte: "Es ist gut, ich will dir die Frau selbst zuführen!" Am andern Tage ging Edsu Masu in die Massalatschi. Als sein Vater in die Massalatschi gegangen war, ging Audu in das Gehöft seines Vaters. Er rief die Frau seines Vaters herbei, die Suman genannt hatte. Audu sagte zu ihr: "Komm! Mein Freund will dich besitzen! Sei ihm zu Gefallen!" Die Frau sagte: "Was willst du? Mach, daß du fortkommst! Ich werde nie darauf eingehen!" Audu sagte zu der Frau: "Es ist gut. Aber mein Vater ist alt. Wenn mein Vater stirbt, werde ich Edsu werden und du sollst dann die erste Frau sein, die ich töten lasse! Es ist gut!" Die Frau sagte zu Audu: "Wenn du mich töten läßt, werde ich wenig davon haben. Dein Vater ist alt, ich habe nichts von ihm. Dein Freund ist stark. Laß deinen Freund kommen. Sage ihm, daß ich hier in der Katamba (=Durchgang; Torhaus = Sauri) auf ihn warte!" Audu lief schnell zu seinem Freunde. Er sagte zu Suman: "Geh schnell in die Katamba! Die Frau wartet auf dich!" Suman ging hinein. Er traf die Frau in der Katamba. Die Frau nahm ihn mit in das Gehöft. Suman beschlief die Frau. Dann ging er über den Hof zurück.
Edsu Masu hatte sein Gebet in der Massalatschi beendet. Er bestieg sein Pferd. Er ritt nach Hause. Er ging durch die Katamba hinein. Er ging über den Hof. Er begegnete Suman. Er sagte zu seinen Leuten: "Nehmt diesen jungen Mann gefangen. Er hat sicher eine meiner Frauen beschlafen!" Die Leute nahmen Suman gefangen. Sie banden ihn. Es kamen Leute zu Audu und sagten: "Dein Vater hat deinen Freund Suman gefangen." Audu ging zu seinem Vater und sagte: "Du hast meinen Freund Suman in deinem Gehöft getroffen und gefangen. Ich habe ihn aber selbst hierhergebracht. Wenn du also meinen Freund tötest, so töte ich dich auch!"
Dann ging Audu zu dem Hause, in dem Suman gefesselt gefangen gehalten wurde. Das Haus war verschlossen. Audu sagte zu den Wächtern: "Laßt mich hinein!" Die Wächter sagten: "Der Edsu hat verboten, daß wir irgend jemand hineinlassen!" Audu ging fort. Abends kehrte er zurück und legte Feuer an dem Gehöft und an dem Hause an. Das Feuer flammte auf. Dann kamen aber viele Leute und löschten das Feuer aus. Audu konnte nicht zu seinem Freunde gelangen. Als er das einsah, bestieg er sein Pferd. Er ritt in den Busch, um einen Boagi (Meerkatzenart) zu fangen.
Edsu Masu rief alle alten Leute zusammen. Alle alten Leute kamen zusammen. Edsu Masu kam dann selbst. Er ließ Suman bringen. Suman war gefesselt. Edsu Masu sagte zu den versammelten Leuten: "Diesen Suman fing ich, als ich aus der Massalatschi heimkam, auf meinem Gehöft. Sicher ist er bei einer meiner Frauen gewesen, um bei ihr zu schlafen. Ich will ihn deswegen töten lassen. Mein Sohn Audu hat aber gesagt, er sei es selbst gewesen, der den Suman in mein Gehöft gebracht habe. Deshalb müssen wir warten, bis mein Sohn Audu kommt. Wir müssen Audu hören." Audu hörte, daß sein Vater die alten Leute zusammengerufen habe. Er sprang auf sein Pferd und ritt schnell nach der Stadt zurück. Er ritt bis zu der Versammlungsstätte.
Audu sprang vom Pferde. Er zog sein Schwert. Er trat mit entblößter Klinge herein. Er wollte seinen Vater töten. Er sah sich um. Er sah Suman stehen. Audu sagte: "Ich danke dir, mein Vater, ich danke dir. Du hast Suman angeklagt, daß er einer deiner Frauen wegen in dein Gehöft gekommen sei. Das ist aber unrichtig. Suman war in dem Gehöft, um einen Baschiko (oder Bajiko =Armring mit Zauberingredienzien) zu erlangen, den du in deinem Hause hast!" Edsu Masu sagte: "Wenn die Sache so ist, so wollen wir sie lassen.
Bindet Suman los. Er soll mit seinem Freunde Audu gehen!"Suman ward freigelassen. Wenig später starb Edsu Masu und sein Sohn Audu wurde Edsu.d) Edsu Audu und der Jäger LanduduEinmal unternahm Edsu Audu einen Krieg gegen die Stadt Nakoti, die liegt im Nordosten von Bida, in der Richtung auf Uschischi zu. Dieser Krieg währte drei Jahre. Edsu Audu streifte mit seinen Leuten im Lande umher und fing Leute ein. Von Zeit zu Zeit aber kam er nach Nakoti, schloß die Stadt ein und fing die Leute, die ein- oder ausgingen.
Die Leute von Nakoti sagten: "Was können wir gegen diesen Edsu Audu ausrichten! Wir können allein nichts machen. Wir wollen den Jäger Landudu um Hilfe bitten!" Der Jäger Landudu wohnte in der Landschaft Ebodji, die nahe dem Kaduna ist. Die Boten machten sich auf den Weg und kamen zu dem Jäger Landudu. Die Boten sagten: "Wir sind seit drei Jahren mit dem Edsu Audu im Kriege. Wir können aber nichts gegen ihn ausrichten. Deshalb kommen wir zu dir und bitten dich, uns zu helfen!" Der Jäger Landudu sagte: "Es ist gut. Ich will euch antworten. Erst muß ich aber einmal Ege (Guineakornbier) trinken." Die Frauen des Jägers brachten ihm Bier. Landudu setzte den Topf an. Er trank ihn aus. Er setzte den leeren Topf beiseite und sagte: "Nun will ich antworten! Ihr wollt meine Hilfe gegen Edsu Audu. Ihr sollt meine Hilfe haben. Wenn er wieder gegen eure Stadt rückt, so bleibt nur ganz ruhig daheim. Rührt euch gar nicht. Ich will ganz allein mit diesem Audu fertig werden. Ruft mich nur, wenn er wieder nach Nakoti kommt!" Die Boten gingen.
Nach einiger Zeit kamen fünftausend Reiter Edsu Audus und umlagerten die Stadt. Sie ritten um den Wall. Die Nakotileute sandten sofort eine Botschaft an Landudu. Die Boten sollten sagen: "Edsu Audus Reiter sind wieder da. Komm und hilf uns!"Die Boten kamen bei Landudu an. Landudu hatte die Angewohnheit, immer drei Tage zu schlafen und drei Tage zu wachen. Als die Boten ankamen, schlief Landudu gerade. Die Boten riefen Landudu an. Landudu hörte nicht. Landudu schlief. Die Boten schrien Landudu an. Landudu hörte nicht. Landudu schlief. Die Boten nahmen zwanzig Stöcke und begannen auf Landudu zu schlagen. Landudu fühlte nichts. Landudu schlief. Die Boten zündeten um Landudu ein Feuer an. Das Feuer
verbrannte den Jäger. Landudu aber fühlte nichts. Er wachte nicht auf. Er schlief weiter. — Die Boten fragten die Frauen Landudus: "Wie macht ihr es, wenn ihr Landudu wecken wollt?" Die Frauen sagten: "Man braucht nur die Saiten seiner Dungeru (Gitarre, Jägergitarre) zu berühren, dann wacht er auf." Die Boten schlugen gegen die Saiten seiner Dungeru. Da wachte Landudu auf.Landudu fragte die Leute: "Was wollt ihr denn?" Die Boten sagten: "Wir sind die Boten aus Nakoti. Edsu Audus Reiter sind wieder da. Komm und hilf uns!" Landudu erhob sich. Er nahm einen Pfeil. Den Pfeil legte er zum Schusse auf die Sehne. Er schoß den Pfeil in der Richtung auf Nakoti ab. Dann legte er sich hin und schlief weiter. Der Pfeil Landudus flog bis nach Nakoti. Er traf den Anführer der Reiter Edsu Audus. Der Anführer fiel sogleich vom Pferde. Er sagte zu den andern: "Sagt Audu, daß der Pfeilschuß gut traf! Ich sterbe!" Der Anführer starb. Dann aber begann einer der Reiter Audus nach dem andern zu sterben. Die letzten ritten fliehend von dannen, um Edsu Audu zu berichten, was sich ereignet hatte. Die Leute von Nakoti aber sandten eine Botschaft an Landudu und ließen ihm sagen: "Wir danken dir sehr, Landudu! Wir danken dir sehr!" Sie schickten ihm zweihunderttausend Kauri.
Die letzten Reiter kamen zu Edsu Audu zurück. Sie sagten zu Edsu Audu: "Die Leute von Nakoti haben mit einem Jäger Landudu Freundschaft geschlossen. Der schoß einen Pfeil von Ebodji aus ab. Der Pfeil traf unseren Führer. Der Führer starb. Alle andern starben auch. Nur wir konnten noch entrinnen." Als Edsu Audu das hörte, wurde er sehr zornig. Er sagte zu seinen Leuten: "Paßt mir auf, wenn Landudu auf die Jagd geht! Wie kann ich den Mann, der mir so Schlimmes zugefügt hat, strafen! Paßt mir gut auf, wenn er zur Jagd geht!" Edsu Audu versammelte vierhundert Reiter. Er sagte zu den vierhundert Reitern: "Geht dahin, wo Landudu zur Jagd weilt, und fangt ihn!" Die vierhundert Reiter machten sich auf den Weg. Sie kamen in Landudus Gebiet. Landudu war im Dickicht. Er trank gerade Klibombo (Haussa =Gonda; Joruba =Abo: scheinen Früchte einer Landolphia zu sein). Die vierhundert Reiter kamen ganz dicht an ihn heran. Als Landudu sie sah, kniete er nieder. Er legte einen Pfeil auf den Bogen und zielte. Er zielte nur nach den Reitern hin. Er schoß nicht. Aber bis auf zwei stürzten alle vierhundert Pferde und Reiter tot zu Boden. Die zwei übrigen fielen vor Landudu auf die Erde und baten ihn: "Was sollen wir zwei gegen dich tun, wo du so leicht fast vierhundert Reiter getötet hast. Laß
uns am Leben!" Landudu sagte: "Kehrt zu Edsu Audu zurück und erzählt ihm alles!"Die zwei Reiter kamen zu Edsu Audu zurück und sagten: "Alle andern sind von dem Jäger Landudu durch ein Zielen getötet. Nur uns ließ er am Leben, um dir das zu sagen!" Edsu Audu rief seinen Saba (Jerima) und sagte: "Reite zu dem Jäger Landudu; bitte ihn dessentwegen, was ich gegen ihn vorhatte, um Verzeihung und schließe Frieden mit ihm!" Der Saba machte sich auf den Weg. Er kam zu dem Jäger Landudu und sagte zu ihm: "Edsu Audu schickt mich zu dir. Er bittet dich dessentwegen, was er gegen dich vorhatte, um Verzeihung. Er will mit dir Frieden machen!" Der Jäger Landudu sagte: "Es ist gut." Dann nahm er aus seiner Medizinalkalebasse ein weniges heraus und hielt es den dreihundertachtundneunzig Pferden vor das Maul und den dreihundertachtundneunzig Reitern vor den Mund. Hierauf sprangen die Pferde und Reiter wieder auf und ritten mit dem Saba zurück zu Edsu Audu nach Jirna.
Die Leute Edsu Audus besprachen nun untereinander: "Wie können wir diesen Jäger Landudu töten ?" Ein Mann ging zu Edsu Audu und sagte: "Laß ein Loch in die Erde graben. Breite eine Matte darüber aus. Rufe den Jäger Landudu zu dir. Laß ihn sich auf die Matte setzen. Wenn er hinabgestürzt ist, wirf die Grube mit Steinen zu. So verliert Landudu das Leben." Edsu Audu sagte: "Das ist gut." Edsu Audu ließ auf der Veranda seiner Katamba ein tiefes Loch graben. Er breitete eine Matte darüber aus. Man sah nichts von der Grube. Er sandte eine Botschaft zu dem Jäger Landudu. Der Bote kam zum Jäger Landudu. Der Bote sagte: "Edsu Audu läßt dich zu ihm rufen. Edsu Audu will mit dir Frieden machen." Der Jäger Landudu sagte: "Ich werde kommen!"
Der Jäger Landudu kam nach Jirna. Die Leute führten ihn zu der Matte über der Grube. Die Leute sagten: "Nimm auf dieser Matte Platz. Edsu Audu wird sogleich kommen." Der Jäger Landudu trat auf die Matte. Er stürzte mit der Matte in die Grube. Edsu Audu rief: "Werft schnell Steine auf ihn! Füllt die Grube mit Steinen aus!" Die Leute taten es. Sie schleppten Steine herbei. Sie bedeckten den Körper des Jägers Landudu mit Steinen. Sie füllten die Grube mit Steinen aus.
Als die Leute mit der Arbeit fertig waren, sagten sie: "Heute haben wir den Jäger Landudu bewältigt!" Die Leute wandten sich um. Da sahen sie den Jäger Landudu von außen her auf das Haus des Edsu Audu zukommen. Er trug einen schweren Knüppel über der Schulter.
Der Jäger Landudu kam heran und sagte: "Der Edsu Audu hat mich durch Boten gebeten, hierherzukommen. Hier bin ich. Willst du etwas gegen mich unternehmen?" Edsu Audu sagte: "Ich bitte dich um Verzeihung; ich will nun nichts mehr gegen dich unternehmen."Der Jäger Landudu sagte: "Was hast du gegen mich? Was willst du gegen mich unternehmen?" Edsu Audu sagte: "Du hast mir vor Nakoti viele Leute getötet. Du hast mich gekränkt. Ich hatte dir nichts getan. Deshalb wollte ich dich töten!" Der Jäger Landudu sagte: "Du hast recht! Ich habe damit begonnen, dir Schlimmes zu tun. Du hast recht. Nimm mich und töte mich. Ich gebe mich dir freiwillig." Edsu Audu rief seine Leute zusammen. Er sagte zu ihnen: "Bindet den Jäger Landudu!" Die Leute banden den Jäger Landudu. Edsu Audu sagte: "Werft ihn in den Niger!" Die Leute trugen ihn an den Niger, banden ihm Steine um und warfen ihn in das Wasser. Die Leute sahen ihn im Wasser versinken. Die Leute gingen nach Haus.
Als die Leute in Edsu Audus Haus kamen, saß der Jäger Landudu neben Edsu Audu auf der Matte. Der Jäger Landudu sagte zu Edsu Audu: "Was hast du nun noch weiter mit mir vor?" Edsu Audu sagte: "Ich will dir nun nichts mehr tun. Ich will nichts mehr gegen dich unternehmen. Ich bitte dich um Verzeihung. Wir wollen Freunde sein. Ich will dir eine Frau geben!" Der Jäger Landudu sagte: "Dann werde ich dir auch eine Frau geben. Wie es meiner Frau ergehen wird, ebenso soll es mit deiner Frau sein."
Edsu Audu gab dem Jäger Landudu ein Mädchen zur Frau. An dem Tage, an dem dieses Mädchen geboren war, hatte die Mutter einen Schmied gerufen und ihm den Auftrag gegeben, um den Hals des Mädchens einen Ring zu schmieden. Der Schmied hatte dem Mädchen um den Hals einen Ring geschmiedet und hatte gesagt: "An dem Tage, an dem das Mädchen heiratet, werde ich den Ring wieder abnehmen!" Als das Mädchen nun dem Jäger Landudu zugebracht war, kam der Schmied und sagte: "Ich will diesen Ring wieder abnehmen, denn das Mädchen heiratet jetzt." Der Schmied versuchte, den Ring dem Mädchen über den Kopf zu ziehen. Es gelang aber nicht, denn das Mädchen war nun erwachsen und hatte einen zu großen Kopf. Die Leute Landudus sagten: "Man muß den Ring zerschneiden!" Der Schmied sagte: "Nein, ich habe den Ring als ganzen gearbeitet und will ihn wieder ganz zurückhaben. Man muß eben dem Mädchen den Kopf abschneiden." Die Leute Landudus
sagten: "Das Mädchen ist Landudus. Er will das nicht!"Der Schmied sagte: "Kommt, wir wollen den Richter fragen!"Sie gingen zum Richter. Der Richter sagte: "Dann müssen wir eben dem Mädchen den Kopf abschneiden." Man schnitt dem Mädchen den Kopf ab. Der Schmied erhielt seinen Ring zurück. Der Jäger Landudu hatte die Frau aber wieder verloren.Der Jäger Landudu sandte an Edsu Audu das Mädchen. Sie bauten dem Mädchen ein Haus, das hatte neben der Türe eine Luke zum herausblicken. Als dem Mädchen, das der Jäger Landudu von Edsu Audu erhalten hatte, der Kopf abgeschnitten war, sandte der Jäger Landudu drei Jäger. Diese drei Jäger gingen an dem Hause des Mädchens vorbei, das der Jäger Landudu dem Edsu Audu geschenkt hatte. Das Mädchen sah die drei Jäger Landudus. Es sah sie vorübergehen. Es wollte ihnen nachsehen. Es zwängte den Kopf zur Luke neben der Tür heraus und sah ihnen nach. Als die Jäger vorbeigegangen waren, wollte das Mädchen den Kopf wieder zurückziehen. Sie konnte aber den Kopf nicht wieder durch die Luke zurückzwängen. Der Kopf schwoll. Das Mädchen schrie. Es kamen Leute Audus. Die Leute versuchten, den Kopf zurückzupressen. Die Leute sagen: "Das geht nicht; wir müssen die Mauer zerbrechen!" Die drei Jäger Landudus kamen dazu und sagten: "Das Haus darf nicht zerbrochen werden. Das Haus haben die Leute Landudus für das Mädchen gebaut." Die Leute Edsu Audus sagten: "Wir bekommen den Kopf des Mädchens aber nicht wieder durch die Luke!" Die drei Jäger Landudus sagten: "Dann muß man eben dem Mädchen den Kopf abschneiden!" Die Leute Edsu Audus sagten: "Das Mädchen gehört dem Edsu. Der Edsu will nicht, daß man ihm den Hals abschneidet." Die Leute Landudus sagten: "Kommt, wir wollen zum Richter gehen!" Sie gingen zum Richter. Der Richter sagte: "Dann muß man dem Mädchen eben den Kopf abschneiden."Man schnitt dem Mädchen den Kopf ab. Der Edsu Audu hatte die Frau wieder verloren.
Darauf begann Edsu Audu gegen den Jäger Landudu einen Krieg. Der Jäger Landudu starb in diesem Kriege. Der Edsu Audu starb in diesem Kriege. Damit ist das zu Ende.
e) Volkserzählungen über Edegis GerechtigkeitEdsu Edegi hörte von dem Streit. Edegi sagte: "Bringt mir alle drei hierher!" Man brachte Djama, Tanquollo und Bidingako herbei. Edsu Edegi sagte zu Djama: "Du sagst, du seist dabei gewesen, als Gott die Erde machte? Wie kannst du das beweisen?"Djama sagte: "Als meine Mutter mich geboren hatte, war die Erde noch nicht hart. Sie war noch weich. Meine Mutter sagte deswegen zu mir: ,Mache keine schnellen Bewegungen, sonst könntest du in dem Schlamme versinken. Geh immer ruhig!' Aus dieser Zeit stammt der langsame Gang, den ihr heute noch an mir sehen könnt. Daraus siehst du, daß die Erde vor meinen Augen gemacht ist." Edsu Edegi sagte: "Du hast recht. Setze dich!"
Edsu Edegi sagte zu Tanquollo: "Du sagst, du warst da, ehe die Welt fertig war. Wie willst du das beweisen?"Tanquollo sagte: "Als meine Mutter mich gebar, waren nur einzelne Spitzchen von Erde da. Hier eines und da eines und dazwischen war noch alles hohl. Auf einer solchen kleinen Erdspitze gebar mich meine Mutter. Als meine Mutter mich geboren hatte, sagte sie zu mir: ,Die Erde ist noch nicht fertig. Es sind erst einige Häufchen. Dazwischen ist alles hohler Raum. Wenn du also deinen Platz wechseln willst, so hüte dich, daß du nicht in den hohlen Raum fällst. Springe von einem Erdhäufchen über die hohlen Räume weg zum andern!' Aus der Zeit habe ich den hüpfenden Gang behalten. Daraus siehst du, daß ich da war, ehe die Erde fertig war!" Edsu Edegi sagte: "Du hast recht, setze dich!"
Edsu Edegi sagte zu Bidingako: "Du sagtest, du wärest da gewesen, ehe die Welt überhaupt vorhanden war. Wie willst du das beweisen?"Bidingako sagte: "Als meine Mutter mich gebar, war
überhaupt noch keine Erde da. Es war alles und allenthalben Wasser. Meine Mutter hat mich auf dem Wasser geboren. Nachdem meine Mutter mich geboren hatte, starb sie. Ich nahm meine tote Mutter auf den Kopf und lief überall umher, nach einem Erdplatz suchend, auf dem ich sie begraben könne. Während zwölf Jahren suchte ich so. Inzwischen verfaulte meine Mutter auf meinem Kopfe. Das ist aber der Grund, warum ich heute noch stinke. Daraus siehst du, daß ich da war, ehe die Erde fertig war." Edsu Edegi sagte: "Du hast recht, setze dich! Bidingako ist älter als ihr andern alle!"Ein Fremder kam in Edsu Edegis Stadt. Es war ein Haussamann. Edsu Edegi wies ihn einem angesehenen Manne zu. Der gab ihm eine Hütte in seinem Gehöft. Nach einiger Zeit bekam der Mann Hunger. Er ging hinaus auf den Markt. Er kaufte von einer Frau einen Issa (gleich den Furra der Haussa, das sind Ballen aus Guineakornmehl). Der Haussa nahm den Issaballen. Er wollte die zwanzig Kauri aus seiner Tasche nehmen, um ihn zu bezahlen. In die Tasche war ein Skorpion geschlüpft. Der Skorpion stach den Mann in die Hand. Dann lief er durch die Falten auf den Rücken des Mannes und stach ihn in den Rücken. Der Haussa zog nun schnell den Rock aus. Die Frau, von der er den Issa gekauft hatte, erschrak. Sie schrie. Das hörte der Mann der Frau. Er kam herbeigelaufen. Er sah den nackten Mann vor seiner Frau. Er fragte nicht, was sich ereignet habe. Er begann auf den Haussa loszuschlagen. Das sah der Hausherr des Haussa. Er rief: "Man schlägt den Fremden Edsu Edegis!" Er rannte dazu und schlug auch auf den Ehemann ein, ohne zu fragen, was sich ereignet habe.
Edsu Edegi hörte von dem Streite. Er ließ alle vier Leute zu sich kommen. Edsu Edegi fragte den Ehemann: "Was hat sich ereignet? Weshalb hast du meinen Fremden geschlagen?" Der Ehemann sagte: "Ich hörte meine Frau schreien. Ich eilte herbei. Ich sah deinen Fremden vor ihr. Ich fragte nicht, was sich ereignet habe. Ich schlug auf den Fremden ein."Edegi sagte: "Setze dich!"Edegi fragte den Haussamann: "Wie kam es, daß die Frau schrie?" Der Haussa sagte: "Ich hatte Hunger. Ich ging auf den Markt. Ich kaufte bei der Frau einen Issa. Ich griff in die Tasche, um die zwanzig Kauri herauszunehmen. Ein Skorpion stach mich in die Hand. Der
Skorpion lief mir auf den Rücken und stach mich da. Ich warf schnell die Kleider ab. Da schrie die Frau. Der Mann kam und schlug mich." Edegi sagte: "Setze dich!"Edegi fragte den Hausherrn: "Wie kam es, daß du den Mann der Frau schlugst?" Der Hausherr des Haussa sagte: "Du hast mir den Fremden zugewiesen, daß ich für ihn Sorge. Ich habe ihm ein Haus gegeben. Ich sah, wie der Mann dort auf ihn zusprang und ihn schlug. Ich sagte: ,Das ist ein Fremder des Königs, den der mir zugewiesen hat!' Ich fragte nicht, was sich ereignet habe. Ich sprang heraus und schlug den Ehemann."Edegi sagte: "Setze dich!"Edegi fragte die Frau: "Nun sage du mir, weshalb du geschrien hast?" Die Frau sagte: "Der Haussa kaufte bei mir einen Issa. Ich dachte, er würde ihn mir bezahlen. Aber plötzlich sprang er auf und warf die Kleider ab. Da schrie ich, denn ich dachte, er sei verrückt." Edsu Edegi sagte: "Ich kann bei keinem von euch ein Unrecht finden. Ihr könnt alle gehen."Der Mann machte sich auf den Weg nach Lapai. Kurz vor der Ankunft in Lapai traf er am Flußufer auf eine Frau, die hielt da Schnupftabak feil. Der Mann sagte: "Kann ich ein wenig von dem Schnupftabak bekommen?" Die Frau sagte: "Nimm dir nur selbst!" Der Mann sagte: "Ich werde mir doch nicht nehmen. Wenn du mir gibst, so bin ich froh darüber!" Die Frau gab ihm. Der Mann schnupfte. Den Rest steckte er in die Tasche. Er sagte: "Ich danke!" Dann ging er nach Lapai. Die Frau ging auch in die Stadt und ging zum Edsu: "Der Mann hat meinen Tabak genommen, ohne ihn zu bezahlen!" Der König ließ ihn rufen. Er sagte zu ihm: "Du bist ein Dieb. Du hast der Frau den Tabak genommen!" Der Mann sagte: "Nein, ich bin kein Dieb. Die Frau hat mir erst gesagt, ich soll den Tabak nehmen. Ich habe das abgelehnt. Dann hat sie mir den Tabak selbst gegeben. Ich schnupfte ein wenig und steckte den Rest in die Tasche." Der König fragte die Frau: "War es so ?" Die Frau sagte: "Es war so." Der König sagte zu dem Manne: "Ich kann nichts Unrechtes an dir finden. Du kannst gehen!"
Der Mann ging weiter. Er begab sich auf den Weg nach Agaye.
Auf dem Wege nach Agaye traf er drei Mädchen, die trugen Wasser. Der Mann sagte zu einem der Mädchen: "Gib mir ein wenig Wasser zu trinken!" Das Mädchen gab ihm. Der Mann nahm. Er trank. Er ging weiter. Als er ein Stück weitergegangen war, rief das Mädchen ihn zurück und sagte: "Komm noch einmal!" Der Mann kehrte um und kam zurück. Er sagte: "Was soll ich?" Das Mädchen sagte: "Auf meinem Rücken ist eine schlechte Fliege. Schlage sie tot!" Der Mann sagte: "Sieh, ich habe hier einen Ring (mit einem dicken Knauf) am Finger. Wenn ich damit nun deinen Rücken treffe, so kann ich dich vielleicht totschlagen. Deshalb will ich es lieber nicht tun. Verscheuche nur die Fliege!" Das Mädchen sagte: "Nein, du bist mir verpflichtet, denn ich habe dir auch Wasser gegeben. Nun schlage mir die Fliege tot. Das andere ist meine Sache." Der Mann sagte: "Wenn du darauf bestehst, so ist es deine Sache!" Der Mann schlug. Die Fliege war tot und fiel herab. Das Mädchen fiel aber auch hin und war tot. Darauf liefen die andern beiden Mädchen nach Agaye hinein. Sie liefen zum König und sagten: "Ein Fremder hat am Fluß ein Mädchen erschlagen." Der König ließ den Mann kommen. Der König sagte: "Der Mann hat ein Mädchen erschlagen. Tötet ihn!" Der Mann sagte: "Töte mich nicht, sondern höre mich erst!" Der König sagte: "So sprich!" Der Mann sagte: "Ich traf am Fluß drei Mädchen. Ich war durstig. Die Mädchen hatten Wasser geschöpft. Ich bat um Wasser. Das eine Mädchen gab mir Wasser. Ich dankte und ging weiter. Das Mädchen rief mich zurück. Sie verlangte von mir, daß ich ihr eine Fliege auf dem Rücken totschlagen sollte. Ich sagte, daß ich es töten könne, weil ich diesen Ring am Finger trüge. Das Mädchen sagte, ich sei ihm verpflichtet, weil es mir Wasser gereicht habe. Ich solle also die Fliege totschlagen, das übrige sei seine Sache. Ich schlug die Fliege tot. Das Mädchen fiel hin und war auch tot." Der König fragte die andern beiden Mädchen: "War es so?" Die Mädchen sagten: "Es war so!" Der König sagte zu dem Manne: "Ich kann nichts Unrechtes an dir finden. Du kannst gehen!"Der Mann ging weiter. Er kam nach Bida. Er ging zu einem Sohne des Königs, der zwei junge hübsche Frauen hatte. Der Sohn des Königs gab ihm ein Haus. Als es Abend war, kam der Mann zu dem Sohne des Königs und sagte: "Gib mir einen Strick!" Der Sohn des Königs sagte: "Was willst du haben?" Der Mann sagte: "Gib mir einen Strick!" Der Sohn des Königs sagte: "Ich habe keinen Strick. Was willst du denn mit dem Strick ?" Der Mann sagte: "Ich will damit mein Glied festbinden. Denn mein Glied geht nachts im Gehöft,
in dem schöne Frauen sind, immer umher und will die Frauen beschlafen. Damit nun nichts geschieht, will ich es festbinden!" Der Sohn des Königs sagte: "Ich kann jetzt nicht nach einem Strick suchen. Schlafe diese Nacht einmal ohne ihn!" Der Mann ging fort. Als es dann Nacht wurde, ging der Sohn des Königs in das Haus einer seiner Frauen, um mit ihr zu schlafen. Gleich darauf kam der Mann auch in das Haus. Er sagte: "Siehst du, das kommt davon, daß mein Glied nicht aufgebunden ist. Nun richtet es Unheil an. Das ist deine Sache!" Der Sohn des Königs sprang auf, um den Mann zu schlagen. Der Mann packte ihn aber und warf den Sohn des Königs heraus. Dann beschlief er die junge schöne Frau. Am andern Morgen ließ der König den Mann zu sich kommen und fragte ihn: "Was hast du diese Nacht für eine schlechte Sache gemacht?" Der Mann sagte: "Wenn eine schlechte Sache geschehen ist, so ist dein Sohn daran schuld. Ich hatte bei ihm Wohnung. Abends kam ich zu ihm und bat ihn um einen Strick, damit ich mein Glied festbinden könne. Mein Glied geht in Gehöften, in denen schöne Frauen sind, immer umher. Dein Sohn wollte mir keinen Strick geben. Er sagte, ich solle diese Nacht ohne Strick schlafen. Dann ging nachts mein Glied herum und beschlief eine Frau. Es war nicht meine Schuld. Das ist alles." Der König fragte seinen Sohn: "War es so?" Der Sohn des Königs sagte: "Es war so." Der König sagte zu dem Manne: "Ich kann nichts Unrechtes an dir finden. Du kannst gehen!"Der Mann ging weiter. Er ging auf Lafiagi zu. Als er ganz dicht bei Lafiagi war, begegnete er einem Reiter. Der Reiter sagte: "Halte mit der Hand mein Pferd!" (und zwar Ladogo-bagoa, das heißt sowohl "Halte mit der Hand" als "Schneide mit der Hand", und in diesem Doppelsinne dialektisch unklarer Ausdrucksweise beruht der Witz). Der Mann sagte: "Nein, das tue ich nicht! Nachher habe ich nur Unannehmlichkeiten davon!" Der Reiter sagte: "So halte doch nur mit der Hand mein Pferd. Ich will absteigen, ich muß mich entleeren!" Der Mann sagte: "Du zwingst mich also?" Der Reiter sagte: "Es muß sein!" Der Mann sagte: "Dann steige ab." Der Reiter stieg ab und ging in den Busch. Kaum war der Reiter im Busch, so zog der Mann das Messer heraus und schlug dem Pferde die vier Füße ab. Der Reiter kam zurück. Er sah sein zerschnittenes Pferd. Er sprang auf den Mann zu. Der Mann schlug wieder. Andere Leute kamen dazu. Sie schleppten den Mann in die Stadt zum König. Der Reiter sagte: "Dieser Mann hat meinem Pferde die Füße abgeschlagen!" Der König sagte: "Was hast du dazu zu sagen?" Der Mann
sagte: "Der Reiter hat es selbst von mir verlangt. Er sagte zu mir: "Ladogo-bagoa!" Ich lehnte es ab und sagte, ich hätte nachher nur Unannehmlichkeiten davon. Dann zwang er mich dazu und sagte: "Es muß sein!" Der König fragte den Reiter: "War es so?" Der Reiter sagte: "Es war so." Der König sagte zu dem Manne: "Ich kann nichts Unrechtes an dir finden. Du kannst gehen!"Der Mann ging weiter. Er ging auf die Stadt Zunga zu. Unterwegs fing er am Flusse eine Eschi. (Das ist eine Art Ratte, die am Flußufer haust. Der Scherz dieses Abschnittes beruht darin, daß mit Eschi nicht nur die Rattenart, sondern auch der Koitus bezeichnet wird.) Der Mann steckte die Eschi in seine Tasche. Er ging dann zur Stadt hinein und suchte im Gehöft des Königs Wohnung. Der König gab ihm ein Haus. Er sagte zu einer seiner Frauen: "Gehe hin und bring dem Fremden eine Schüssel mit Essen!" Die Frau bereitete das Essen. Dann brachte sie eine Schüssel mit Essen dem Mann in sein Haus. Sie stellte ihm die Schüssel hin. Der Mann fragte die Frau: "Kannst du Eschi (also doppelsinnig, sowohl Rattenart als Koitus) gebrauchen?"Die Frau sagte: "Laß den König nicht dieses Wort hören! Wenn er es hört, wird er dich töten!" Der Mann sagte: "Ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Sage mir lieber, ob du ein Eschi gebrauchen kannst. Du kannst sogleich in diesem Hause eine Eschi von mir haben. Willst du es?" Die Frau schrie. Sie lief hinaus. Sie lief zum König. Sie sagte zum König: "Der Fremde, den du in dein Haus genommen hast, hat mich soeben gefragt, ob ich von ihm beschlafen sein wollte." Der König sagte zu seinen Leuten: "Bringt mir den Mann her!" Die Leute gingen und holten den Mann. Der König sagte zu ihm: "Du hast soeben meine Frau verführen wollen." Der Mann sagte: "Das weiß ich nicht. Das muß wohl ein anderer gewesen sein." Der König sagte: "Du hast ihr soeben einen Eschi (Beischlaf) angeboten." Der Mann sagte: "Also das ist es. Auf dem Wege nach Zunga fing ich am Flusse eine Eschi (= Ratte). Als die Frau zu mir kam, fragte ich sie, ob sie sie gebrauchen könne. Ich könne sie ihr sogleich im Hause geben. Die Frau hat etwas anderes gedacht, als ich gesagt habe. Hier ist die Eschi!" Der Mann nahm die Eschi aus der Tasche und legte sie vor den König hin. Der König sagte zu dem Mann: "Das ist ein Mißverständnis. Nimm deine Eschi. Ich kann nichts Unrechtes an dir finden. Du kannst gehen."
Der Mann ging weiter. Er ging auf die Stadt Illorin zu. Er ging durch die Farmen der Stadt Illorin. Er kam an eine Farm, auf der
hackten die Leute Jams aus der Erde. Er sagte zu den Leuten: "Könnt ihr mir ein wenig von eurem vielen Jams abgeben?" Die Leute gaben ihm fünf Jamsknollen. Der Mann sagte: "Ich danke euch. Womit kann ich mir nun ein Feuer anzünden, um meinen Jams zu rösten?" Die Leute sagten: "Du kannst alles nehmen, was um die Farm herumliegt, um dein Feuer zu machen." Der Mann sagte: "Ich danke euch." Der Mann kam an das Ende der Farm. Da hatten die Leute ihre Schuhe hingelegt. Er nahm die Schuhe. Die Leute hatten da ihre Kleider abgelegt. Er nahm ihre Kleider. Die Leute hatten da ihre Hüte hingelegt. Er nahm ihre Hüte. Die Leute hatten da ihre Hacken hingelegt. Er nahm ihre Hacken. Die Leute hatten da ihre Körbe hingelegt. Er nahm ihre Körbe. Die Leute hatten da ihre Kalebassen hingelegt. Er nahm ihre Kalebassen. Die Leute hatten da ihre Stöcke hingelegt. Er nahm ihre Stöcke. Der Mann legte die Schuhe, die Kleider, die Hüte, die Hacken, die Körbe, die Kalebassen, die Stöcke auf einen großen Haufen. Er zündete das alles an und legte seine fünf Jamsknollen darauf. Er röstete sie. Die Leute auf der Farm sagten: "Was ist das für ein Geruch?" Sie gingen hin. Sie sahen, daß alle ihre Schuhe, Kleider, Hüte, Hacken, Körbe, Kalebassen, Stöcke verbrannt waren. Der Mann saß daneben und aß seinen gerösteten Jams. Die Leute packten und nahmen ihn mit zur Stadt. Sie führten ihn zum König und sagten: "Wir haben diesem Manne fünf Jamsknollen geschenkt. Darauf hat er uns alle unsere Schuhe, Kleider, Hüte, Hacken, Körbe, Kalebassen und Stöcke genommen und hat sie verbrannt." Der König sagte: "Was hast du dazu zusagen?" Der Mann sagte: "Die Leute schenkten mir fünf Jamsknollen. Ich fragte sie: ,Womit kann ich nun mein Feuer anzünden, um meinen Jams zu rösten?' Die Leute sagten mir: ,Du kannst alles nehmen, was um die Farm herumliegt, um dein Feuer zu machen.' Sie sagten mir nicht, daß ich Feuerholz nehmen solle. Sie sagten mir, ich solle alles nehmen, was um die Farm herumliegt. Da sammelte ich alle Schuhe, Kleider, Hüte, Hacken, Körbe, Kalebassen, Stöcke auf und machte mein Feuer damit. Mit Feuerholz hätte ich weniger Arbeit gehabt."Der König fragte die Leute: "War es so?" Die Leute sagten: "Es war so." Der König sagte zu dem Manne: "Ich kann nichts Unrechtes an dir finden. Du kannst gehen!"Der Mann ging weiter. Er ging auf die Stadt Saragi zu. Er kam nach Saragi. Er ging auf den Markt und kaufte bei einer Frau für hundert Kauri Jams. Dann ging er zu einer andern Frau, die hatte
einen ganzen, großen Topf voll Öl da. Der Mann wollte etwas Öl zu seinem Jams kaufen. Der Mann fragte die Frau: "Kann ich etwas von dem Öl bekommen? Willst du mir etwas Öl zu meinem Jams verkaufen?" Die Frau vor dem großen Öltopf antwortete: "Eloloschj!" (Eloloschi hat wieder doppelten Sinn. Es soll heißen "alles zusammen", d. h. also, die Frau wollte nur das ganze Öl en gros verkaufen. Eloloschi kann aber auch heißen "Hineingehen".) Der Mann fragte: "Was? Eloloschi ?" Die Frau sagte: "Ja, Eloloschi!" Der Mann sagte: "Das kann ich ja auch tun!" Er zog seine Kleider aus, legte sie beiseite und setzte sich mit einem Sprung mitten in den Öltopf. Der Topf zerschellte sofort und das Öl floß nach allen Seiten auseinander. Die Frau schrie. Die Frau lief sogleich zum König und sagte: "Ein fremder Mann ist auf dem Markt mitten in meinen Öltopf gesprungen, hat ihn zerbrochen und all mein Öl vertan!" Der König ließ den Mann kommen. Er sagte zu dem Manne: "Diese Frau sagt mir, daß du ihren Öltopf zerbrochen und ihr Öl verschüttet hättest." Der Mann sagte: "Ich habe nichts Unrechtes getan, denn ich habe nichts anderes getan, als was die Frau selbst gewollt hat. Ich kam von Illorin. Ich war hungrig. Ich ging auf den Markt. Ich kaufte bei einer Frau für hundert Kauri Jams. Ich ging zu dieser Frau, um dazu ein wenig Öl zu kaufen. Ich fragte die Frau, ob sie mir von dem Öl verkaufen wolle. Sie sagte, ich solle mich hineinsetzen. Ich fragte nochmals, ob ich richtig verstanden habe. Sie wiederholte ,Eloloschi'. Da habe ich meine Kleider ausgezogen und habe mich mit einem Sprung hineingesetzt. Wenn sie dabei etwas verloren hat, so ist sie doch selbst für den Verlust verantwortlich." Der König fragte die Frau: "War es so ?" Die Frau sagte: "Es war so." Der König sagte zu dem Manne: "Ich kann nichts Unrechtes an dir finden. Du kannst gehen!"Der Mann ging. Er ging zur Stadt Edegis. Er ging zu Edsu Edegi und sagte: "Du hast zu mir gesagt: Wenn du siebenmal Streit hervorgerufen hast, ohne daß du bestraft wirst, will ich dir eine Frau geben. Ich war in Lapai, habe eine Frau um ihren Tabak betrogen und wurde vom König freigesprochen. Ich war in Agaye, habe ein junges Mädchen totgeschlagen und wurde vom König freigesprochen. Ich war in Bida, habe den Königssohn herausgeworfen, seine Frau beschlafen und wurde vom König freigesprochen. Ich war in Lafiagi, habe dem Pferde eines Reiters die Füße abgeschlagen und wurde vom König freigesprochen. Ich war in Sunga, habe einer Frau des Königs den Beischlaf angeboten und wurde vom König
freigesprochen. Ich war in Illorin, habe den Farmleuten ihre Schuhe, Kleider, Hüte, Hacken, Stöcke verbrannt und wurde vom König freigesprochen. Ich war in Saragi, bin mitten auf dem Marktplatz in den großen Öltopf einer Frau gesprungen, so daß der Topf zersprang und alles Öl auseinanderfloß und wurde vom König freigesprochen. Ich habe also siebenmal Streit angefangen und wurde nicht bestraft. Ehe ich dich aber um meine Frau bitte, will ich noch einmal etwas im Haussaland anrichten!"Der Mann ging. Er ging in das Haussaland. Auf der Straße traf er einige Haussa. Die sagten ihm den Gruß der Haussa: "Sanu! Sanu!" (Sanu heißt soviel als Gruß wie Heil! Segen! Andererseits heißt "Sanu" aber auch "langsam, bequem".) Der Mann sprang auf die Haussa zu. Er rief: "Was, ihr wollt mich einen Langsamen, einen Faulen nennen? Was, ihr wollt mich beschimpfen?" Die Haussa schrien: "Sanu! Sanu!" Der Mann nahm darauf seinen Stock und schlug auf die Haussa drein. Die Haussa liefen in die Stadt und sagten zum König: "Ein Nupemann hat uns geschlagen!" Der Haussakönig ließ den Mann zu sich kommen und sagte zu ihm: "Du hast mit meinen Leuten Streit angefangen!" Der Mann sagte: "Sie sagen, ich habe Streit angefangen? Haben sie mir nicht zugerufen, ich sei ein Langsamer, ein Fauler? Habe ich nicht aufbegehrt? Haben sie mich da nicht wieder beschimpft und gerufen: ,Sanu! Sanu!' Ich bin aber nicht faul. Ich bin fleißig. Ich lasse mich nicht beschimpfen und mir sagen, ich sei ein träger Mann! Deshalb bin ich zornig geworden, weil sie mich einen Faulen geschimpft haben." Der König fragte die Leute: "War es so ?" Die Haussa sagten: "Wir haben nur Sanu! Sanu! gerufen." Der Mann sagte: "Ja, sie haben mich einen Langsamen genannt." Der König sagte: "Ich kann kein Unrecht an dem Manne finden. Es ist ein Mißverständnis. Der Mann kann gehen."
Der Mann ging zu Edsu Edegi. Edsu Edegi sagte zu ihm: "Du bist ein ordentlicher, kluger Mann. Ich werde dir die Frau geben." Edsu Edegi gab dem Mann ein Mädchen und sagte: "Nimm sie! Gehe aber nicht mit dieser Frau in das Land Sauadji. Wenn da einer deine Frau beschläft, oder wenn sie sie dir da wegnehmen, so ist das deine Sache." Der Mann sagte: "Es ist gut!" Der Mann heiratete das Mädchen. Dann ging der Mann mit seiner jungen Frau nach dem Lande Sauadji und sagte: "Dieses Land Sauadji, vor dem mich Edsu Edegi so warnt, muß ich doch kennen lernen. Sollten die Leute mich an Klugheit übertreffen?" Der Mann ging mit seiner Frau nach dem Lande Sauadji.
Der Mann kam mit seiner Frau in der Stadt Sauadji an. Die Leute von Sauadji suchten immer nach Frauen. Sie konnten nie genug bekommen. Als der Mann ankam, gaben sie ihm ein Haus für sich, seine Frau aber schickten sie zur Sonja (Magaji in Haussa; Jalode in Joruba = Frauenrichterin und Aufseherin). Am andern Tag ging der Mann mit den jungen Leuten baden. Er kam zurück zu seiner Frau. Die Frau sagte: "Warum warst du fort? Warum hast du nicht mit mir geschlafen?" Der Mann sagte: "Ich wollte die Penisse dieser jungen Leute sehen. Deshalb war ich mit ihnen baden. Jeder von ihnen hat nicht wie ich einen, sondern sieben Penisse und jeder einzelne ist scharf wie ein Messer. Deshalb haben sie auch so viele Frauen nötig, weil soviele sterben."
Der Saba (Thronfolger) der Stadt hatte die Frau des Mannes gesehen. Er sagte zu seinen Leuten: "Seht euch nach der jungen Frau aus Edegis Stadt um. Ich will mit ihr schlafen." Die jungen Leute kamen zu dem Manne. Der Mann sagte zu ihnen: "Seht meine Frau an. Sie hat fünf Männer vor mir gehabt. Ich bin der sechste. Jedem der ersten fünf hat sie mit einem einfachen Handstrich Penis und Skrotum abgeschnitten." Als die jungen Leute das hörten, bekamen sie Angst. Sie gingen zum Saba und sagten es ihm. Der Saba aber sagte: "Ich muß diese Frau haben, ehe sie geht, und wenn sie mir auch alles abschneidet." Der Saba nahm siebentausend Kauri und schickte sie der Frau. Er ließ ihr sagen, daß er sie besitzen wolle. Die Frau sagte zu dem Boten: "Ich bin bereit. Mein Mann ist aber schlecht. Er beginnt mit jedem Streit. Gebt also meinem Mann erst vielen Palmwein, ehe wir zusammenkommen." Der Saba sandte vielen Palmwein. Der Mann trank ihn. Der Mann ward betrunken. Dann nahmen ihn die Leute, trugen ihn in ein Haus und schlossen das Haus hinter ihm zu.
Der Saba rief die Frau nun zu sich. Die Frau ging hin. Der Saba sagte zu ihr: "Setze dich!" Die Frau setzte sich. Die Frau dachte an die sieben Penisse, die scharf wie Messer waren, und hatte Angst. Der Saba dachte an den Handstrich, mit dem fünf Männer schon Penis und Skrotum verloren hatten, und hatte Angst. Der Saba ging hinaus und rief vier Segi (=Pagen, gleich den Segi der Haussa, laufen mit roten Tüchern über der Schulter vor den Herren her). Von diesen Segi sagen die Nupe, früher seien sie dem Edsu zuerteilt worden, daß er sie wie Frauen von hinten beschlafe. Die Haussa sagen, solches sei heute nicht mehr in den Koareländern Sitte, wohl aber in Bornu. Er sagte zu ihnen: "Je zwei von euch stehen hinter je einer Tür.
Wenn ich schreie, kommt herein und reißt die Frau von mir, so daß sie mir nicht Penis und Skrotum abschneiden kann." Dann ging der Saba wieder hinein.Beide lagen auf dem Lager. Der Saba dachte: "Ob das mit dem Handstrich wahr ist?" Die Frau dachte: "Ob das mit den sieben Penissen, die scharf wie Messer sind, wohl wahr ist?" Die Frau dachte, der Saba schliefe. Die Frau dachte: "Ich muß einmal nachfühlen." Sie führte die Hand zu dem Saba hin. Der Saba fühlte den Handstrich. Der Saba dachte: "Jetzt schneidet sie!" Der Saba schrie. Die vier Segi kamen herein, rissen die Frau vom Lager und warfen sie zur Tür hinaus.
Die Leute gingen hin und öffneten das Haus, in dem der Mann lag. Sie nahmen den Mann heraus. Am andern Morgen wachte er auf. Er ging zu seiner Frau und sagte: "Pack die Sachen. Nun können wir wieder gehen." Sie gingen. Wo sie durch die Straßen kamen, liefen die jungen Männer weg. Der Mann lachte.
Der Mann kam zu Edsu Edegi zurück. Edsu Edegi sagte: "Du bringst deine Frau wieder mit? Erzähle mir!"Der Mann erzählte alles. Edsu Edegi schenkte ihm zwei Sklaven und zwei Pferde, damit er bei ihm bliebe. Edsu Edegi sagte: "Ich danke dir; ich habe einen klugen Mann kennengelernt."
f) Der Monafiki der Issazeit
In der Zeit, da Edsu Issa (es scheint der Issa des vorigen Jahrhunderts zu sein) herrschte, waren zwei Leute miteinander befreundet. Der eine von ihnen war sehr reich. Der andere von ihnen war sehr arm. Der Reiche hatte vierhunderttausend Kauri, der Arme hatte nur tausend Kauri. Der Reiche sagte eines Nachts zu dem Armen: "Ich möchte dich um etwas bitten." Der Arme sagte: "Was kann ich, der Arme, dir, dem Reichen geben?" Der Reiche sagte: "Wirst du es mir geben, wenn du es hast?" Der Arme sagte: "Wir sind Freunde. Ich werde dir alles geben, was ich habe." Der Reiche sagte: "Du hast ein schönes Glied (eba). Gib mir deinen Eba!" Der Arme sagte: "Nimm ihn dir!" Der Reiche schnitt den Eba des Armen ab und steckte ihn in die Tasche.
Am andern Tag kam der Arme zu dem Reichen und sagte: "Du hast mich gestern nacht gebeten, ich habe dir gegeben. Ich komme heute und bitte dich." Der Reiche sagte: "Was willst du von mir haben?" Der Arme sagte: "Ich habe nun keinen Eba mehr. Ich will
den Rest meines Lebens wenigstens angenehm leben. Gib mir alles, was du besitzt." Der Arme nahm alles Geld des Reichen. Er lud die Säcke mit Kauri auf Esel und trieb alles zu sich.Am andern Tag kam der (frühere) Reiche zu dem (früheren) Armen. Der Reiche sagte: "Wir sind Freund. Gestern hast du mich gebeten und ich habe dir gegeben. Heute komme ich und bitte dich." Der Arme sagte: "Was willst du von mir haben?" Der Reiche sagte zu dem Armen: "Ich will deine beiden Augen haben!" Der Arme sagte: "Nimm sie!" Der Reiche nahm ein Messer und schnitt dem Armen die Augen aus. Er nahm die Augen und steckte sie in seine Tasche. Der Arme konnte nun nicht mehr sehen. Der Reiche nahm alles Geld, das er gestern dem Armen gegeben hatte. Der Reiche nahm die Esel, die er gestern dem Armen gegeben hatte. Der Reiche lud die Säcke mit dem Geld auf die Esel und trieb die Esel wieder in sein Haus. Der Arme war blind, er konnte nichts sehen. Er konnte es nicht hindern. Der Reiche kam zurück. Er hatte dem Armen Eba und Augen geraubt. Er warf ihn nun aus dem Gehöfte. Er jagte ihn fort und sagte: "Nun geh' zum Edsu Issa!"
Der Arme tastete sich weiter fort. Er kam in den Busch. Er tastete sich von einem Platze zum andern. Er ging jeden Tag ein Stück weiter. Er kam in ferne Länder. Er irrte drei Jahre lang umher. Der Reiche aber ging als Händler von Stadt zu Stadt. Er kaufte hier, er kaufte dort. Er verkaufte dies, er verkaufte das. Der Reiche wurde immer wohlhabender. Er hatte viel Geld und Sklaven. Er ging in die Stadt Edsu Issas und wohnte da.
Der Arme irrte im Busch weiter. Er kam eines Tages an einen Baum. Er stieß an den Baum. Auf dem Baume hatte der König der Aasgeier (gulu, in Haussa: angulu) sein Nest. Der König der Gulu sagte: "Wer stieß gegen mein Haus?"Der Arme sagte: "Verzeih mir, ich bin aber blind." Der König der Gulu sagte: "Was willst du von mir?" Der Arme sagte: "Ich bin blind, ich kann nicht sehen. Zeige mir bitte den Weg." Der König der Gulu fragte: "Wie bist du blind geworden?" Der Blinde sagte: "Ich war arm. Ich war mit einem reichen Manne befreundet. Der Reiche bat mich um meinen Eba. Ich gab ihm meinen Eba. Am andern Tage bat ich den Reichen um seinen Reichtum. Der Reiche gab mir seinen Reichtum. Am nächsten Tage bat mich der Reiche um meine Augen. Ich gab ihm meine Augen. Dann nahm mir der Reiche wieder allen Reichtum. Er warf mich heraus und trieb mich in den Busch. Drei Jahre lang bin ich im Busch herumgeirrt."Der König der Gulu sagte: "Ich will besser zu dir sein
als dein reicher Freund."Der König der Gulu breitete seine Flügel aus. Er stieg in die Luft. Der König der Gulu sagte: "Lege deinen Kopf zurück, wende dein Gesicht dem Himmel zu!" Der Blinde tat es. Der Gulu entleerte sich. Der Schmutz fiel gerade auf die Augen des Armen. Der Arme konnte wieder sehen. Er wandte sich um. Er konnte alles sehen. Er sah wieder wie früher. Der König der Gulu kam herab. Er flog von seinem Hause herab. Er gab dem Armen ein Paket von seinen Exkrementen. Der König der Gulu sagte zu dem Armen: "Stecke dies in deine Tasche. Gehe damit auf die Wanderschaft. Wenn du Menschen findest, die an den Augen leiden, so tue von diesem darauf. Du kannst viele Menschen gesund machen und dadurch reich werden." Der König der Gulu flog fort. Der Arme nahm von den Exkrementen des Königs der Gulu und steckte sie in die Tasche.Der Arme ging in die nächste Stadt. Er wandte sich seiner Stadt zu. Er begegnete dem Reichen. Er fragte den Reichen: "Kennst du mich nicht?" Der Reiche sagte: "Nein, ich habe dich noch nicht gesehen." Der Arme sagte: "Ich bin der, der dir seinen Eba und seine Augen gab." Der Reiche sagte: "Jetzt weiß ich, wer du bist. Wir sind Freunde." Der Reiche fragte den Armen: "Wo gehst du hin?" Der Arme sagte: "Ich gehe, wie du mir früher sagtest, in die Stadt Edsu Issas."
Der Arme ging weiter. Er kam an Edsu Issas Stadt. Er ging in die Katamba des Edsu Issa. Der König fragte den Armen: "Was willst du?" Der Arme sagte: "Ich bin nur ein Armer." Der König fragte: "Was arbeitest du ?" Der Arme sagte: "Ich suche Blinde. Ich mache sie sehend." Der König sagte: "Ich habe eine erste Frau. Meine erste Frau ist blind. Ich habe alles versucht, sie sehend zu machen. Ich habe schon fünf Sklaven dafür ausgegeben, es ist aber nicht besser geworden." Der Arme sagte: "Wenn du willst, werde ich es versuchen." Edsu Issa sagte: "Versuche es!" Der Arme sagte: "Bringt mir eine kleine Schale mit Wasser!" Sie brachten ihm eine kleine Schale mit Wasser. Der Arme nahm aus seiner Tasche das Bündel mit den Exkrementen des Königs der Geier. Er brach etwas davon ab. Er warf das Abgebrochene in das Wasser. Der Arme sagte: "Kann ich deine erste Frau einmal sehen?" Der König führte den Armen in das Haus der ersten Frau. Der Arme goß das Wasser über die Augen der Frau. Die Frau hob den Kopf auf. Sie konnte wieder sehen. Die Frau sagte: "Ich danke dir! Ich danke dir! Ich danke dir!"
Der König Issa sagte zu dem Armen: "Ich danke dir!" Der König Issa gab ihm fünf Sklaven. Er gab ihm ein starkes altes Pferd. Er gab ihm ein starkes junges Pferd. Der König machte den Armen zu seinem Schentali (Verwalter eines Stadtteils; in Haussa: adjia). Der König rief den Schentali jeden Morgen. Der Schentali mußte ihm in allem raten. Der Schentali wurde ein angesehener Mann. König Issa nahm vier junge Mädchen. Er schenkte die vier jungen Mädchen dem Schentali zu Frauen.
Der Reiche sah das. Der Reiche begann die Arbeit des Monafiki (Hetzers). Der Monafiki (also der Reiche) kam zum König Issa und sagte: "Der Schentali hat keinen Eba. Du hast ihm vier Frauen gegeben. Aber was soll er mit ihnen tun? Er hat mir früher seinen Eba geschenkt. Ich habe ihn ihm abgeschnitten." Der Monafiki zog den Eba des Schentali aus der Tasche und zeigte ihn dem König. Der Schentali kam jeden Morgen zum Edsu. Wenn der Schentali weggegangen war, kam der Monafiki und sagte: "Der Schentali hat keinen Eba. Du hast ihm vier Frauen gegeben. Aber was soll er mit ihnen tun? Er hat mir früher seinen Eba geschenkt. Ich habe ihm den Eba abgeschnitten." Der Monafiki zog den Eba aus der Tasche und zeigte ihn dem König. Der Schentali kam jeden Morgen zum Edsu. Wenn der Schentali fortgegangen war, kam der Monafiki.
Eines Morgens sagte der König: "Es ist gut. Morgen sollen alle Männer der Stadt zum Flusse gehen, um Fische zu fangen. Sie sollen alle Kleider ablegen und nackt in das Wasser steigen. Dann werde ich sehen, ob der Schentali einen Eba hat oder nicht." Der Edsu ließ das allen Leuten in der Stadt sagen. Der Monafiki sagte: "Nun wirst du es selbst sehen!" Als der Bote mit der Nachricht zum Schentali kam, begann der Schentali zu weinen. Der Schentali weinte die ganze Nacht. Der Schentali schrie die ganze Nacht.
Der Schentali weinte. Das große starke Pferd fragte den Schentali: "Was hast du?" Der Schentali sagte: "Als ich jung war, hatte ich einen Freund, der war reich. Der Reiche bat mich um meinen Eba. Ich gab ihm meinen Eba. Am andern Tage bat ich ihn um seinen Reichtum. Der Reiche gab mir seinen Reichtum. Am nächsten Tage bat mich der Reiche um meine Augen. Ich gab ihm meine Augen. Dann nahm mir der Reiche wieder allen Reichtum. Er warf mich heraus und trieb mich in den Busch. Drei Jahre lang bin ich im Busche herumgeirrt. Ich kam zum König der Gulu. Der König der Gulu machte mich sehend. Er gab mir Heilmittel. Ich kam hierher. Ich machte die Frau des Edsu Issa sehend. Der König schenkte mir
Sklaven und Pferde. Der König machte mich zum Schentali. Der König schenkte mir vier Mädchen. Der Reiche kam und ward zum Monafiki. Der Monafiki sagte zum König, daß ich keinen Eba habe. Der König verlangte, daß alle Leute nackt zum Fischfang kommen sollten. Die Leute werden sehen, daß ich keinen Eba habe. Ich werde mich schämen. Ich werde sterben." Der Schentali weinte. Der Schentau schrie.Das große Pferd sagte zu dem Schentali: "So weinst du also, weil du keinen Eba hast?" Der Schentali sagte: "So ist es." Das große Pferd sagte zu dem kleinen Pferd: "Hast du die Sache unseres Herrn gehört?" Das kleine Pferd sagte zu dem großen Pferd: "Ich habe alles wohl gehört. Du bist von uns beiden das größere. Was du als Großes darin tust, wird gut sein."
Das große Pferd sagte zum Schentali: "Lege mir eine Schnur um den Hals und steige auf meinen Rücken." Der Schentali legte dem großen, starken Pferd eine Schnur um den Hals und stieg auf seinen Rücken. Das große Pferd begann wegzulaufen. Das große Pferd lief aus der Stadt. Das große Pferd lief so schnell, wie kein Pferd sonst laufen kann. Das große Pferd lief an Kano vorbei. Das große Pferd lief immer noch. Das große Pferd stand still. Das große Pferd sagte: "Jetzt sind wir da." Der Schentali sah um sich. Ringsum war ein großer, großer Markt. Auf dem Markte wurden nur Eba feilgehalten. Die Eba, die so groß waren wie aufgerollte Schlafmatten, wurden für drei Kauris verkauft. Die Eba, die so groß waren wie Stuhlbeine (natürlich sind Stühlchen der Nupe gemeint), wurden für zwei Kauri verkauft. Die Eba, die so groß waren wie ein Finger, wurden für einen Kauri verkauft. Diese kleinen Eba waren für Kinder bestimmt.
Der Schentali stieg ab. Er ging umher und betrachtete die Eba. Er wählte einen schönen Eba für zwei Kauri. Er sagte zu der Frau (Händlerin): "Diesen Eba möchte ich kaufen." Er zahlte zwei Kauri. Die Frau sagte: "Ist der Eba für dich?" Der Schentali sagte: "Er ist für mich." Die Frau sagte: "So ziehe deine Hosen aus und lege dein Kleid ab! Stelle dich nackt in einiger Entfernung hin, spreize die Beine!" Der Schentali zog seine Kleider aus. Er ging in einige Entfernung und stellte sich der Frau zu auf. Er spreizte die Beine. Die Frau nahm den Eba. Sie warf den Eba gegen den Mann. Der Eba traf den Mann in der Spreize. Der Eba saß am Manne. Der Eba stand dem Schentali groß und dick wie ein Stuhlbein. Der Schentalj bekleidete sich. Der Schentali konnte die Hose nicht zubinden.
Der Schentali ging zu dem großen Pferde zurück. Der Schentali stieg auf den Rücken des Pferdes. Das Pferd begann zu laufen. Das große Pferd lief vom Marktplatze weg. Das große Pferd lief, wie kein Pferd laufen kann. Das große Pferd lief zurück. Das große Pferd lief an Kano vorbei. Das große Pferd lief, bis es daheim angekommen war. Das große Pferd lief in das Gehöft des Schentali. Der Schentali lief in das Haus, in dem das erste Mädchen schlief, das ihm der Edsu geschenkt hatte. Er beschlief es. Der Schentali lief in das Haus, in dem das zweite Mädchen schlief, das ihm der Edsu geschenkt hatte. Er beschlief es. Der Schentali lief in das Haus, in dem das dritte Mädchen schlief, das ihm der Edsu geschenkt hatte. Er beschlief es. Der Schentali lief in das Haus, in dem das vierte Mädchen schlief, das ihm der Edsu geschenkt hatte. Er beschlief es. Dann lief der Schentali zu dem großen, starken Pferd und sagte: "Ich werde dir in Zukunft nicht Sorghum zu fressen geben, sondern Honig und alles Gute, was du von mir haben willst. Ich werde dich in Zukunft nicht mehr reiten, sondern dich stehen und gehen lassen wie du willst. Bis du stirbst, sollst du keine Arbeit mehr verrichten." Dann ging der Schentali in sein Haus und schlief ein.
Am andern Tage kamen die Leute an den Fluß, zogen die Kleider aus und gingen nackt in das Wasser. Der Schentali kam nicht. Der Schentali blieb daheim. Der Monafiki ging zu den Leuten im Wasser. Er sah, daß der Schentali nicht dabei war. Er ging in die Stadt. Er ging zu Edsu Issa und sagte: "Alle Leute sind in das Wasser gestiegen. Alle Leute sind nackt. Alle Leute haben einen Eba. Der Schentali ist nicht gekommen. Der Schentali ist daheim geblieben. Der Schentali hat keinen Eba. Der Schentali hat mir seinen Eba geschenkt. Ich habe den Eba in der Tasche. Jetzt kann der Schentali nicht nackt vor den Leuten ins Wasser gehen. Der Schentali schämt sich!" Alle Leute versammelten sich bei Edsu Issa. Alle Leute hörten es.
Der Schentali erwachte. Der Schentali zog sieben Hosen an. Der Schentali zog ein Kleid an. Der Schentali bestieg ein Pferd. Der Schentali ritt zu Edsu Issa. Er stieg ab. Er ging in die Katamba des Königs. Der König fragte den Schentali: "Warum warst du nicht draußen beim Fischen! ?" Der Schentali sagte: "Ich habe heute gegen Morgen meine vier Frauen beschlafen. Da war ich müde und habe es verschlafen." Der Monafiki sagte: "Du lügst! Du kannst keine Frau beschlafen. Du hast keinen Eba. Du hast mir deinen Eba geschenkt. Ich habe dir deinen Eba abgeschnitten. Hier habe ich
deinen Eba!" Der Monafiki zog den Eba des Schentali aus der Tasche.Der Schentali sagte nichts. Der Schentali zog die erste Hose aus. Alle Leute sahen hin. Der Schentali zog die zweite Hose aus. Alle Leute sahen hin. Der Schentali zog die dritte Hose aus. Alle Leute sahen hin. Der Schentali zog die vierte Hose aus. Alle Leute sahen hin. Der Schentali zog die fünfte Hose aus. Alle Leute sahen hin. Der Schentali zog die sechste Hose aus. Alle Leute sahen hin. Der Eba des Schentali war unter den Hosen aufgestiegen. Als nun noch eine Hose ihn zurückhielt, zerriß er diese Hose. Der Eba stand groß und dick da wie ein Stuhlbein. Alle Leute sahen es. Der Schentau sagte: "Mit diesem Eba soll ich die Frauen nicht beschlafen können, die mir der König geschenkt hat?!" Als die Leute diesen Eba sahen, bekamen sie Angst.
Edsu Issa sagte: "Nehmt den Monafiki. Bindet ihn. Bringt ihn auf den Marktplatz. Tötet ihn!" Die Leute nahmen den Monafiki. Sie banden ihn. Sie brachten ihn auf den Marktplatz. Sie töteten ihn.
g) Edsu Njikako und sein AdoptivsohnAls Edsu Njikako in Jeni König war, wurde jedes Kind acht Tage, nachdem es geboren war, zu ihm gebracht, und der König gab ihm dann einen Namen. Ein ganz armer Mann heiratete. Der Mann hatte nichts. Die Frau hatte nichts. Die Frau ward schwanger. Die Frau gebar am Freitag ein Kind. Das Kind war ein Knabe. Edsu Njikako hörte davon. Edsu Njikako sagte: "Bringt mir heute schon das Kind her." Man brachte das Kind zu Edsu Njikako. Edsu Njikako schenkte dem Knaben zehn Sklaven und zehn Stück Stoff. Edsu Njikako sagte: "Bringt das Kind am nächsten Freitag wieder zu mir." Am nächsten Freitag brachte die Mutter das Kind wieder zu Edsu Njikako. Edsu Njikako schenkte dem Kinde zehn Ochsen, zehn Pferde, fünf Sklaven und zehn Gewehre. Edsu Njikako sagte: "Das Kind soll Mama heißen." Dann sagte Edsu Njikako: "Bringt mir das Kind jeden Freitag und zeigt es mir!"
Das Kind wuchs heran. Der Knabe Mama war erst jeden Freitag im Hause des Königs. Nachher war der Knabe jeden Tag im Hause des Königs. Der König hielt ihn wie seinen eigenen Sohn. Die Leute sagten: "Ist Mama nicht der Sohn des Edsu ?" Als Mama zehn Jahre alt war, suchte der Edsu ein ordentliches Mädchen. Das Mädchen gab er Mama zur Frau. Mama heiratete das Mädchen. Sie ward
Mamas erste Frau. Mama ritt (eines Tages) durch die Stadt. Er sagte zu einer Frau: "Komm zu mir!" Die Frau kam zu Mama. Mama beschlief sie. Mama sagte: "Bleibe bei mir!" Die Frau blieb bei ihm. —Nach drei Monaten war die erste Frau schwanger. Nach drei Monaten war die Frau schwanger, die er zu sich genommen hatte. Nach neun Monaten gebar die erste Frau ein Kind, es war ein Knabe. Nach neun Monaten gebar die Frau, die er zu sich genommen hatte, ein Kind, es war ein Knabe.Mama hatte auf seinem Kopfe von vorn nach hinten sieben Haarschöpfe. Diese sieben Haarlocken hütete er sehr. Jede der sieben Haarlocken hatte einen eigenen Namen. Mama war klug. Der Edsu Njikako sagte: "Wir wollen Esi (Mangallaspiel, Brettchenspiel) spielen." Edsu Njikako spielte mit Mama. Mama spielte gut. Edsu Njikako sagte: "Wir wollen jeden Morgen Esi spielen."Jeden Morgen ging Mama zu Edsu Njikako und spielte mit ihm. Eines Tages sagte Mama: "An dem Tage, an dem du die Namen meiner sieben Haarzöpfe erfährst, kannst du mich töten! Ich gebe mich in deine Hand!"Edsu Njikako sagte: "Es ist gut. Ich werde sehen, ob ich sie in Erfahrung bringe." Jeden Morgen spielte Mama mit König Njikako. Jeden Morgen sagte er: "An dem Tage, an dem du die Namen meiner sieben Haarzöpfe erfährst, kannst du mich töten. Ich gebe mich in deine Hand."Jeden Morgen antwortete König Njikako: "Es ist gut. Ich werde sehen, ob ich sie in Erfahrung bringe."
Edsu Njikako sandte Mama fort. Mama sollte Edsu Njikakos Gruß einem andern König bestellen. Mama sattelte sein Pferd. Er ritt fort. Als Mama fortgeritten war, rief Edsu Njikako Mamas erste Frau. Mamas erste Frau kam. Edsu Njikako ließ vier Millionen Kauri bringen. Edsu Njikako gab der ersten Frau die Säcke mit Kauri und sagte: "Dieses Geld und zehn Sklaven gehören dir, wenn du mir sagst, welches die Namen der sieben Haarzöpfe Mamas sind." Die erste Frau sagte: "Die Namen der sieben Haarzöpfe Mamas darf ich dir nicht sagen. Nimm dein Geld wieder!" Die erste Frau schob dem König das Geld hin und ging wieder zurück. Als sie nach Hause kam, sagte sie zu der Frau, die Mama zu sich genommen hatte: "Der König hat mir vier Millionen Kauri und zehn Sklaven geboten, wenn ich ihm die Namen der sieben Haarzöpfe Mamas nenne."
Die Frau, die Mama zu sich genommen hatte, lief zu Edsu Njikako und sagte: "Was möchtest du von Mama wissen?" Edsu Njikako sagte: "Wenn du mir die Namen der sieben Haarzöpfe Mamas nennst, gebe ich dir eintausend Kauri und einen Sklaven." Die
Frau, die Mama zu sich genommen hatte, sagte: "Es ist gut. Sobald Mama zurückgekommen ist, werde ich es wissen. Dann werde ich es dir sagen."Mama kam wieder. Nachts ging er zu seiner zweiten Frau, um mit ihr zu schlafen. Mama legte sich zu ihr. Die Frau, die Mama zu sich genommen hatte, sagt: "Laß mich! Ich will dich nicht!" Mama sagte: "Was hast du denn?" Die Frau sagte: "Du hast mir die Namen deiner sieben Haarzöpfe nicht gesagt. Weshalb hast du sie mir nicht gesagt? Hast du mich nicht von der Straße her zu dir genommen? Bin ich etwa deine erste Frau? Muß ich mich nicht schämen, so bei dir zu wohnen?" Mama sagte: "Komm."Die Frau sagte: "Ich will an einem andern Orte schlafen!" Mama sagte: "Bleib hier. Ich will dir die Namen der sieben Haarzöpfe auf meinem Kopfe nennen. Der erste Haarzopf heißt: Bana awuonuna haga schinogo (die Stelle der Farm, an der man die Pflanzenarbeit beginnt). Der zweite Haarzopf heißt: Sana agbako ja nisagi adesalaja (man soll seine Geheimnisse [in Wahrheit Geheimnisse seines Bauches, bako Bauch] nicht den Frauen erzählen, sonst weiß sie bald alle Welt). Der dritte Haarzopf heißt: Udjischoko gabosa soko gadakun (jedem Sklaven Gottes [Soko] kann in seiner Not geholfen werden). Der vierte Haarzopf heißt: Sudan mutun (einen Mann fürchte). Der fünfte Haarzopf heißt: Baueje una je kudan haga (soweit man sieht, kein Weg da). Der sechste Haarzopf heißt: Eboga-ona, gabaea dafi (wenn eine Sache ganz heiß ist, wird sie auch wieder kalt). Der siebente Haarzopf heißt: Ikudji-aui jagba gabaea ejele (eine hilflose Waise muß still sein, wenn sie lange leben will)." Mama sagte diese Namen der Frau, die er zu sich genommen hatte. Mama fragte: "Ist es jetzt gut?" Die Frau sagte: "Es ist gut." Die Frau nahm Mama zu sich. Mama beschlief sie. Nachdem Mama die Frau, die er zu sich genommen hatte, beschlafen hatte, schlief er ein.
Die Frau, die er zu sich genommen hatte und der er die Namen seiner Haarzöpfe gesagt hatte, schlief aber nicht ein. Als Mama eingeschlafen war, stand sie auf. Sie ging aus dem Hause. Sie ging aus dem Gehöft. Sie ging in das Gehöft Edsu Njikakos. Sie sagte zu dem Wächter: "Weckt den Edsu Njikako. Ich habe ihm etwas zu sagen." Die Wächter weckten den König. Der König kam. Der König sagte: "Du hast es eilig. Was willst du?" Die Frau sagte: "Du wolltest die Namen der Haarzöpfe auf Mamas Kopf wissen." Edsu Njikako sagte: "So ist es. Weißt du sie?" Die Frau sagte: "Ich weiß es. Was gibst du mir dafür ?" Der König gab ihr tausend Kauri und einen
Sklaven. Die Frau, die Mama zu sich genommen hatte, erzählte dem König alle Namen. Der König sagte: "Es ist gut." Die Frau lief fort. Sie lief in Mamas Gehöft. Sie lief in das Haus. Mama schlief noch. Sie legte sich neben Mama auf die Erde. Mama wachte erst am Morgen auf.Am andern Morgen stand Mama auf. Mama ging in Edsu Njikakos Gehöft. Mama begrüßte den König. Edsu Njikako sagte: "Was hast du mir jeden Tag gesagt?" Mama sagte: "Ich habe dir jeden Tag gesagt: ,An dem Tage, an dem du die Namen meiner Haarzöpfe erfährst, kannst du mich töten. Ich gebe mich in deine Hand!"Edsu Njikako sagte: "So hast du gesagt!" Mama sagte: "Wenn du die Namen kennst, so sage sie." Edsu Njikako sagte: "Der erste deiner sieben Haarzöpfe heißt: Die Stelle der Farm, an der man die Pflanzenarbeit beginnt. Der zweite deiner Haarzöpfe heißt: Man soll seine Geheimnisse nicht den Frauen erzählen, sonst weiß sie bald alle Welt." Mama rief dem Edsu Njikako zu: "Höre auf! Das genügt! Ich weiß jetzt, daß du sie alle kennst. Laß mich jetzt töten!" Edsu Njikako sagte: "Es ist gut. So werde ich es tun."
Edsu Njikako nahm alle Sachen Mamas. Er nahm Mama alles wieder, was er ihm vorher gegeben hatte. Er nahm ihm seine Sklaven, seine Pferde. Edsu Njikako rief seine Dogari (Schutzmänner; Haussa: do). Er sagte ihnen: "Nehmt Mama gefangen! Bindet Mama! Führt Mama zum Tore hinaus! Tötet Mama!" Der Anführer der Dogari hieß Mama fangen. Er ließ Mama binden. Er zog mit dem gefesselten Mama zur Stadt hinaus.
Der Serki Dogari ritt mit dem gefangenen Mama zum Tore hinaus. Viele Menschen liefen nebenher. Sie wollten sehen, wie Mama getötet wurde. Neben dem Serki Dogari lief der kleine Sohn der Frau, die Mama zu sich genommen hatte. Er war Mamas zweiter Sohn. Der Sohn der Frau, die Mama zu sich genommen hatte, sagte zum Anführer der Dogari: "Wenn du meinen Vater totgeschlagen hast, gib mir seine Mütze!" Auf der andern Seite lief der Sohn der ersten Frau Mamas. Der Sohn der ersten Frau Mamas lief neben dem Anführer der Dogari her und rief: "Wenn du den Vater tötest, töte auch den Sohn. Schlage mich mit meinem Vater tot." Der Sohn der mitgenommenen Frau schrie: "Wenn du meinen Vater totgeschlagen hast, gib mir seine Mütze!" Der Sohn der ersten Frau schrie: "Wenn du den Vater tötest, töte auch den Sohn. Schlage mich mit meinem Vater tot!"
Sie kamen an den Platz, an dem Mama getötet werden sollte. Der
Serki Dogari zog sein langes Schwert. Der Serki Dogari holte zum Schlage aus. Der Serki Dogari wollte Mama den Kopf abschlagen. Der Sohn der ersten Frau Mamas sprang Mama an den Hals. Er umschlang den Vater. Er schrie: "Töte mich mit dem Vater!" Der Serki Dogari schlug zu. Die Klinge schlug flach auf den Körper des Sohnes der ersten Frau Mamas. Der Serki Dogari sagte: "Ich habe den Auftrag, einen Mann zu töten. Ich habe nicht den Auftrag, zwei Leute zu töten. Wir wollen zurückgehen und den Edsu Njikako fragen, was ich tun soll."Der Serki Dogari ließ wieder zur Stadt marschieren. Sie zogen durch die Straßen der Stadt. Viele Leute liefen nebenher. Sie wollten hören, was der König sagen werde. Der Serki Dogari kam mit seinen Leuten und Mama zu dem Edsu Njikako zurück. Der Serki Dogari sagte zu dem Edsu Njikako: "Du befahlst mir, Mama zu töten. Ich wollte Mama töten. Dieser Knabe kam und schrie, man solle ihn mit töten. Der Knabe hing sich dem Mama an den Hals. Als ich Mama totschlagen wollte, traf mein Hieb diesen Knaben. Du hast mir gesagt, ich solle einen Mann töten. Du hast mir nicht gesagt, daß ich auch den Knaben töten solle. Deshalb bin ich zurückgekommen." Edsu Njikako sagte zu Mama: "Was ist es für eine Sache mit diesem Kind?" Mama sagte: "Es ist der Sohn der Frau, die du mir gegeben hast. Es ist mein Sohn." Edsu Njikako fragte: "Hast du nur diesen einen Sohn?" Mama sagte: "Ich nahm noch eine Frau mit zu mir. Ich beschlief sie. Sie ward schwanger. Von ihr habe ich einen andern Sohn." Edsu Njikako fragte: "Wo ist der andere Sohn?" Mama sagte: "Dort steht er." Edsu Njikako fragte den Serki Dogari: "War dieser Junge auch mit draußen?" Der Serki Dogari sagte: "Dieser Junge lief auch nebenher. Er rief: ,Wenn du meinen Vater totgeschlagen haben wirst, gib mir seine Mütze."
Der Edsu Njikako sagte: "Ruft mir die erste Frau des Mama! Ruft mir die Frau, die Mama zu sich genommen hatte." Die Dogari riefen beide Frauen. Die erste Frau kam. Sie weinte. Die Frau, die Mama zu sich genommen hatte, hatte sich ein neues Kleid gekauft. Edsu Njikako fragte die erste Frau Mamas: "Was war zwischen uns?" Die erste Frau sagte: "An dem Tage, an dem du Mama mit dem Gruße an den andern König wegsandtest, riefst du mich zu dir. Du fragtest nach dem Namen der Haarzöpfe Mamas. Du botest mir vier Millionen Kauri und zehn Sklaven an. Ich sagte dir, daß ich das nicht sagen dürfe. Ich ging." Edsu Njikako fragte die Frau, die Mama zu sich genommen hatte: "Was war zwischen uns?"Die Frau
sagte: "Die erste Frau sagte mir, daß du die Namen der sieben Haarzöpfe wissen wolltest. Ich ging zu dir und fragte, ob das wahr sei. Du botest mir tausend Kauri und einen Sklaven, wenn ich es dir sage. Am Tage, als Mama zurückkehrte, schlief er bei mir. Er wollte mich beschlafen. Ich sagte, ich müsse die Namen der Haarzöpfe wissen. Er sagte sie mir. In der Nacht noch lief ich zu dir und sagte dir die Namen. Du gabst mir tausend Kauri und einen Sklaven dafür. Für die tausend Kauri kaufte ich mir dieses Kleid."Edsu Njikako stand auf. Er ging zu der ersten Frau. Er sagte zu ihr: "Ich danke dir! Ich danke dir! Ich danke dir! Gott schütze dich! Gott schütze dich! Kehre heim. Nimm deinen Sohn. Er wird ein guter Mann werden." Edsu Njikako sagte zu Mama: "Ich gebe dir alle deine Sachen wieder. Du hast eine gute Frau. Du hast einen guten Sohn." Edsu Njikako sagte zu dem Serki Dogari: "Nimm die Frau, die Mama zu sich genommen hat. Sie hat für tausend Kauri und einen Sklaven das Schlechte getan, was die erste Frau Mamas nicht für vier Millionen und zehn Sklaven tun wollte. Nehmt ihren Sohn, der nur die Mütze seines Vaters haben wollte. Tötet sie beide."
Edsu Njikako befahl, daß nur ordentliche Hochzeiten zu feiern seien. Er setzte das Fest (das Fest der neuen Frau) ein. Damit sollen gute Kinder kommen.
h) Edsu Jimada und Alaru KubaruZur Zeit des Edsu Jimada heiratete ein Mann eine Frau. Die Frau ward schwanger. Die Frau ging in die Farm und gebar in der Farm ein Kind, ein Mädchen. Das Mädchen ward genannt Alaru Kubaru. Der Vater ließ in der Farm an der Stelle, da seine Frau seine Tochter geboren hatte, ein Gehöft bauen und das Gehöft von einer Mauer umgeben. In der Mauer war keine Tür, und wer heraus oder herein wollte, der mußte mit dem Pferde hinüberspringen. Hinter dieser Mauer wuchs das Mädchen Alaru Kubaru heran, ohne daß ein Mann es jemals zu Gesicht bekommen hatte. (Im weiteren Verfolg läßt die Legende die Idee der Unübersteigbarkeit und Durchgangslosigkeit der Umfassungsmauer fallen.)
Eines Tages ging ein Pferdejunge (doko; Haussa: dandoko; Joruba: aquaqueschi) des Königs Jimada vor das Tor der Stadt und schaute in den Farmen nach gutem Pferdefutter um. Er kam in die Nähe des Gehöftes, in dem Alaru Kubaru wohnte. Er kam an die Mauer, die das Gehöft umgab. Er schaute über die Mauer und er-
blickte Alaru Kubaru. Alaru Kubaru war herangewachsen. Alaru Kubaru war sehr schön (udje njassa-njassain; Haussa: detjau; Joruba: oda). Alaru Kubaru war so schön, wie kein Mädchen vorher.Der Pferdebursche kam an die Mauer. Er sah über die Mauer. Er sah Alaru Kubaru. Er wandte sich um. Er lief in die Stadt zurück. Er lief zu Edsu Jimada. Der Pferdebursche sagte zu Edsu Jimada: "Ich kam in die Farm. Ich traf auf eine Mauer. Ich blickte über die Mauer. Ich sah ein Mädchen. Das Mädchen ist so schön, wie nie vorher ein Mädchen war." Edsu Jimada sagte: "Wir haben viele schöne Mädchen, die du nicht kennst!"Edsu Jimada sagte zu seinen Leuten: "Laßt hundert schöne Mädchen zusammenkommen." Die Mädchen kamen zusammen. Edsu Jimada fragte den Pferdeburschen: "Ist hier nicht ein Mädchen darunter, das so schön ist, wie Alaru Kubaru ist?" Der Pferdejunge betrachtete sie alle. Der Pferdejunge sagte: "Nein, es ist kein Mädchen darunter, das so schön ist wie Alaru Kubaru." Edsu Jimada sagte: "Wir haben viele schöne Frauen, die du nicht kennst." Edsu Jimada sagte zu seinen Leuten: "Laßt hundert schöne junge Frauen zusammenkommen!" Die hundert schönen jungen Frauen kamen zusammen. Edsu Jimada fragte den Pferdeburschen: "Ist hier nicht eine junge Frau darunter, die so schön ist wie Alaru Kubaru ?" Der Pferdejunge betrachtete sie alle. Der Pferdejunge sagte: "Nein, es ist keine Frau darunter, die so schön ist wie Alaru Kubaru."
Edsu Jimada rief seinen Mejaki (Kriegsobersten; Haussa: Maijaki; Joruba: Balogun). Edsu Jimada sagte zu dem Mejaki: "Mein Pferdejunge hat draußen in der Farm eine Mauer gefunden. Hinter der Mauer lebt Alaru Kubaru, ein Mädchen. Kein Mädchen und keine Frau in meiner Stadt ist so schön wie Alaru Kubaru. Hier hast du vierhunderttausend Kauri. Hier hast du Kleider. Hier hast du Bogen und Pfeil. Bringe das alles hinaus und gib es den Eltern der Alaru Kubaru. Sage den Eltern Alaru Kubarus, daß ich das Mädchen heiraten will. Bitte die Eltern, mir das Mädchen zur Frau zu geben." Der Mejaki sagte: "Es ist gut. Ich werde das erledigen."
Der Mejaki ritt mit hundert Reitern hinaus zu den Farmen. Er hatte alle Geschenke für die Eltern der Alaru Kubaru bei sich. Der Mejaki kam an die Mauer, hinter der Alaru Kubaru wohnte. Der Mejaki kam hinein. Er sah Alaru Kubaru. Als der Mejaki das Mädchen sah, vergaß er alles, was er bestellen sollte. Alaru Kubaru war schöner als irgendeine andere Frau, die der Mejaki kannte. Der Mejaki kehrte um und kam zu Edsu Jimada zurück. Er sagte zu Edsu
Jimada: "Alaru Kubaru ist so schön, daß ich alles auszurichten vergaß, was du mir bestellt hast. Sende einen andern Boten. Ich bin hierzu nicht tauglich."
Edsu Jimada ließ nun die alten angesehenen Leute zusammenkommen. Er gab ihnen die Geschenke, die der Mejaki wieder mitgebracht hatte, und sagte zu ihnen: "In den Farmen draußen steht eine Mauer. Hinter der Mauer lebt Alaru Kubaru, ein Mädchen. Kein Mädchen und keine Frau in meiner Stadt ist so schön wie Alaru Kubaru. Hier habt ihr viele Geschenke. Bringt sie hinaus und gebt sie den Eltern der Alaru Kubaru. Sagt den Eltern der Alaru Kubaru, daß ich das Mädchen heiraten will. Bittet die Eltern, mir das Mädchen zur Frau zu geben." Die alten angesehenen Leute sagten: "Es ist gut. Wir werden das erledigen!"
Die alten angesehenen Leute ritten hinaus zu den Farmen. Sie hatten alle Geschenke für die Eltern der Alaru Kubaru bei sich. Die alten angesehenen Leute kamen zu der Mauer, hinter der Alaru Kubaru wohnte. Die alten angesehenen Leute kamen herein. Alaru Kubaru wusch sich gerade das Gesicht. Die alten angesehenen Leute kamen dazu. Sie sahen es, sie fielen sogleich in Schlaf. Als sie wieder erwachten, war Alaru Kubaru weggegangen. Die alten angesehenen Leute kehrten zurück zu Edsu Jimada. Sie sagten zu Edsu Jimada: "Alaru Kubaru ist so schön, daß wir bei ihrem Anblick in Schlaf verfielen und nicht ausrichten konnten, was du uns befahlst. Sende andere Boten, wir sind hierzu nicht tauglich."
Edsu Jimada ließ nun alle vornehmen Leute seines Reiches zusammenkommen. Er übergab ihnen die Geschenke, die die alten angesehenen Männer wieder mitgebracht hatten, und sagte zu ihnen: "In den Farmen draußen steht eine Mauer. Hinter der Mauer lebt Alaru Kubaru, ein Mädchen. Kein Mädchen und keine Frau in meiner Stadt ist so schön wie Alaru Kubaru. Einige vergaßen bei ihrem Anblick alles, was sie hätten bestellen sollen. Andere verfallen bei ihrem Anblick in Schlaf. Hier habt ihr nun viele Geschenke. Ich werde mit euch hinausreiten. Gebt diese Geschenke den Eltern der Alaru Kubaru. Sagt den Eltern der Alaru Kubaru, daß ich das Mädchen heiraten will. Ich werde die Eltern bitten, mir das Mädchen zur Frau zu geben." Die vornehmen Leute sagten: "Wir werden dich alle gern begleiten."
Edsu Jimada und die vornehmen Leute ritten hinaus zu den Farmen. Sie hatten alle Geschenke für die Eltern der Alaru Kubaru bei sich. Edsu Jimada kam mit seinen Vornehmen an die Mauer, hinter
der Alaru Kubaru wohnte. Edsu Jimada kam mit seinen vornehmen Leuten zu ihr. Alaru Kubaru wusch sich gerade den Leib. Edsu Jimada und seine vornehmen Leute kamen dazu. Sie sahen Alaru Kubaru im Bade. Edsu Jimada fiel sogleich vom Pferde. Seine Vornehmen fielen sogleich vom Pferde. Sie lagen ohne Leben am Boden. Als Alaru Kubaru sich gewaschen hatte, kleidete sie sich an und ging fort. Edsu Jimada stand auf. Die Vornehmen standen auf. Sie stiegen auf die Pferde. Sie ritten heimwärts.Sie kamen auf dem Wege zur Stadt an einer alten Frau vorbei. Die alte Frau sagte: "Edsu Jimada, wo kommst du her?"Edsu Jimadas Leute sagten: "Wozu sollen wir das dieser alten Frau erzählen?" Edsu Jimada sagte: "Nein, erzählt der alten Frau alles!" Die Leute Edsu Jimadas sagten zu der alten Frau: "In den Farmen steht eine Mauer. Hinter der Mauer lebt Alaru Kubaru. Alaru Kubaru ist schöner als alle Mädchen der Stadt. Edsu Jimada sandte den Mejaki mit Geschenken zu den Eltern der Alaru Kubaru, um das Mädchen für sich zur Frau zu erbitten. Als der Mejaki das Mädchen sah, vergaß er alles, was er bestellen sollte, und kam zurück. Edsu Jimada sandte alte angesehene Leute mit Geschenken zu den Eltern der Alaru Kubaru, um das Mädchen für sich zur Frau zu erbitten. Als die alten angesehenen Leute das Mädchen sahen, wusch es sich gerade das Gesicht. Da fielen alle in Schlaf und kamen nachher zurück, ohne etwas bestellt zu haben. Edsu Jimada ritt nun selbst mit uns, den Vornehmen, hinaus. Edsu Jimada kam dazu, als Alaru Kubaru sich badete. Edsu Jimada und alle andern fielen vom Pferde. Alle lagen leblos am Boden. Als Edsu Jimada und wir andern erwachten, war Alaru Kubaru fortgegangen. Jetzt reiten wir heim."
Die alte Frau sagte: "Ich werde es machen. Kehrt ihr in die Stadt zurück. Versteckt einige Reiter mit verbundenen Augen vor den Toren der Stadt." Edsu Jimada ritt mit den Vornehmen zur Stadt zurück. Die alte Frau ging in die Farm. Sie setzte sich vor der Mauer Alaru Kubarus hin und weinte. Alaru Kubaru kam und fragte die Alte: "Was ist dir? Weshalb weinst du?" Die alte Frau sagte: "Ich habe zu Hause ein krankes Kind. Das Kind hat nichts zu essen. Ich selbst bin krank. Ich gehe herum und suche Holz. Aber ich bin so schwach. Ich kann nicht gehen. Ich kann keine Holziast zusammensuchen. Ich kann sie nicht nach Hause tragen."Alaru Kubaru sagte: "Warte, ich will dir helfen." Alaru Kubaru ging in das Haus. Alaru Kubaru holte zweitausend Kauri. Sie holte ein Kleid. Sie brachte eine kleine Last Feuerholz. Sie brachte das der Alten. Sie schenkte
das der Alten. Die alte Frau sagte: "Ich danke dir! Ich danke dir! Ich danke dir!" Alaru Kubaru half der Alten die Last auf den Kopf nehmen. Die Alte weinte und sagte: "Stütze mich ein wenig, bis ich näher der Stadt bin."Alaru Kubaru tat es. Alaru Kubaru begleitete sie ein Stück; dann sagte sie: "Nun muß ich umkehren." Die Alte weinte und bat: "Komm noch ein wenig mit mir!" Alaru Kubaru ging noch ein wenig mit ihr. Sie kamen an die Stelle, an der die Reiter mit verbundenen Augen versteckt lagen. Alaru Kubaru ging mit der Alten vorbei. Die Reiter kamen heraus. Die Reiter nahmen Alaru Kubaru auf das Pferd und ritten mit ihr fort. Sie brachten Alaru Kubaru in das Frauengehöft Edsu Jimadas.Nach drei Tagen heiratete Edsu Jimada Alaru Kubaru. Der Vater Alaru Kubarus wartete auf ihre Rückkehr. Alaru Kubaru kam nicht. Der Vater Alaru Kubarus sagte: "Erst war der Mejaki des Edsu Jimada hier. Dann waren die alten angesehenen Leute des Edsu Jimada hier. Dann war Edsu Jimada mit seinen vornehmen Leuten hier. Dann kam die alte Frau. Edsu Jimada hat meine Tochter Alaru Kubaru sicher rauben lassen und dann geheiratet. Edsu Jimada wird mit meiner Alaru Kubaru freundlich sein, sonst bleibt sie nicht bei ihm."
Edsu Jimada heiratete Alaru Kubaru. Er ließ ihr ein großes, schönes Haus bauen. Er schenkte ihr einen schönen Stuhl aus Gold. Er schenkte ihr ein Bett aus Gold (Gold: Nupe: djinalia; Haussa: djinalia; Joruba: okukwa). Edsu Jimada hatte einen Ring am Finger. Alaru Kubaru sagte eines Tages zu ihm: "Schenke mir den Ring!" Edsu Jimada sagte: "Den Ring kann ich dir nicht schenken."Edsu Jimada gab ihr nicht den Ring.
Eines Tages kam eine Frau in Edsu Jimadas Katamba. Die Frau sagte, sie wolle den Edsu Jimada allein sprechen. Er sprach mit der Frau. Die Frau sagte: "Zeige mir den Ring, den du am Finger hast." Edsu Jimada zog den Ring vom Finger und reichte ihn der Frau. Die Frau betrachtete den Ring. Die Frau sprach mit Edsu Jimada. Edsu Jimada vergaß den Ring. Edsu Jimada sprach mit der Frau. Die Frau ging. Sie nahm den Ring mit. Sie steckte den Ring an den Finger. — Alaru Kubaru sah die Frau. Sie sah den Ring, den Edsu Jimada ihr nicht hatte geben wollen, am Finger der andern Frau. Alaru Kubaru fragte Edsu Jimada: "Wo ist der Ring, den du mir nicht hast geben wollen?" Der König sagte: "Warte, ich werde ihn dir zeigen." Das war fünf Tage vor dem großen Sala (Nupe und Haussa: sola; Joruba: jurun).
Am großen Sala bestieg der König sein Pferd, um in die Moschee zu reiten. Alaru Kubaru bestieg ihr Pferd, um zur Moschee zu reiten. Alle vornehmen und angesehenen Leute stiegen zu Pferde und ritten zur Moschee hinaus zum großen Gebet.
Alaru Kubaru kniete vor der Moschee nieder. Sie scharrte Sand vor sich zusammen. Alaru Kubaru sprach. Alle Leute hörten Alaru Kubaru. Alaru Kubaru sagte zu Edsu Jimada: "Ich habe mit Edsu Jimada vor allen Leuten zu sprechen. Alle Leute sollen hören, was ich Edsu Jimada zu sagen habe. Edsu Jimada hat eine alte Frau geschickt, die lockte mich zur Stadt. Vor der Stadt hat Edsu Jimada Reiter mit verbundenen Augen aufgestellt. Die Reiter nahmen mich und brachten mich zu Edsu Jimada. Edsu Jimada hat mich mit Gewalt genommen. Ich bat Edsu Jimada um einen Ring. Edsu Jimada gab mir den Ring nicht. Jetzt trägt eine andere Frau den Ring. Ich bin jetzt fertig mit Edsu Jimada!" Alaru Kubaru verneigte sich und sagte: "Salem aleikum." Sie verneigte sich und sagte: "Salem aleikum." Sie verneigte sich und sagte: "Salem aleikum." Die Erde spaltete sich. Die Erde hatte eine große Öffnung vor Alaru Kubaru. Alaru Kubaru ging in die Erde.
Edsu Jimada brachte dem obersten Mauern achthunderttausend Kauri und sagte: "Sieh, ob du Alaru Kubaru zurückgewinnen kannst!" Der Priester warf sich auf den Boden, berührte mit der Stirn den Boden und betete: "Alla-(ru)-kubar-(u)! Alla-(ru)-kubar-(u)! Alla-(ru)-kubar-(u) !" Aber Alaru Kubaru kam nicht wieder. Seitdem beten die Islamiten immer in dieser Weise und beginnen so auch ihr Gebet.
i) Der Mauern Edsu MadjiasEdsu Madjia rief eines Tages alle seine Leute zusammen und sagte: "Heute ist Freitag. Aber es soll auf den Farmen gearbeitet werden." Er sandte eine Botschaft in das Land und ließ überall sagen: "Heute ist Freitag, aber es soll gearbeitet werden." Er rief alle Trommler zusammen. Allenthalben ward alle Welt zur Arbeit gerufen, trotzdem Freitag war.
Alle Leute in der Stadt sagten: "Wir gehen heute nicht zur Arbeit, denn es ist Freitag." Alle Leute auf dem Lande sagten: "Wir gehen heute nicht zur Arbeit, denn es ist Freitag. Nur ein Malla kam zur Arbeit. Dieser Malla (Mauern) ging hinaus zu den Farmen. Er setzte sich auf ein hohes Jamsbeet. Er saß da einige Zeit. Da kam aus
einer Öffnung im Boden eine kleine giftige Schlange. Der Malla sprang auf. Der Malla rannte davon. Die Schlange lief hinter dem Malla her. Der Malla rannte. Der Malla sagte: "Ich sehe es. Es ist ein Unrecht am Freitag zur Arbeit zu gehen. Die Schlange treibt mich fort!"Der Malla rannte so schnell er konnte von dannen. Aber die Schlange lief schneller als der Malla. Die Schlange holte den Malla ein. Die Schlange schlang sich um das Bein des Malla. Der Malla blieb stehen. Er wagte es nicht weiterzugehen. Der Malla fragte die Schlange: "Was treibt dich dazu, zu mir zu kommen? Weshalb läufst du hinter mir her und nicht hinter irgend etwas anderem?" Die Schlange sagte: "Ich lief vor dem großen Kranich fort, der so gerne Schlangen frißt. Der große Kranich wollte mich fressen." Die kleine giftige Schlange bat den Malla und sagte: "Sei mein Freund und verstecke mich vor dem grauen Kranich!" Der Malla sagte: "Das will ich gerne tun!" Der Malla machte ein tiefes Loch. Er warf die Schlange in das Loch und sagte: "Da unten wirst du gut geschützt sein." Die Schlange sagte: "Grabe mich nicht ein. Verstecke mich in deinem Munde. Da kommt schon der Jiwjiwa (graue Kranich) !" Der Malla sah, daß der graue Kranich kam. Da nahm er die kleine giftige Schlange und versteckte sie in seinem Munde.
Der graue Kranich kam. Der graue Kranich fragte den Malla: "Hast du nicht die kleine giftige Schlange gesehen?" Der Malla sagte: "Die kleine giftige Schlange habe ich gesehen. Sie ist vor langer Zeit hier vorbeigelaufen." Darauf tief der Kranich weiter, so schnell er konnte. Er hatte es nicht bemerkt, daß der Malla die kleine giftige Schlange im Munde hatte.
Als der graue Kranich weit fort war, sagte der Malla zu der kleinen giftigen Schlange: "Der graue Kranich ist weit fort. Komm nun wieder heraus aus meinem Munde." Die kleine giftige Schlange sagte: "Nein, ich werde nicht aus deinem Munde gehen. Dein Mund ist so vorzüglich für mich geeignet, daß ich noch länger darin bleiben werde." Der Malla sagte: "Ich will aber nach Hause gehen." Die kleine giftige Schlange sagte: "Bleib hier! Wenn du einen Schritt weiter gehst, werde ich dich in deine Zunge beißen. Du wirst sterben und also doch hierbleiben." Der Malla blieb stehen. Er wagte nicht, einen Schritt weiter zu gehen. Er hatte nichts zu essen. Er hatte nichts zu trinken. Aber die giftige kleine Schlange erlaubte ihm nicht irgendwohin zu gehen, um nach Speise und Trank zu suchen.
Der Malla blieb in der Farm. Als der Malla aus der Farm nicht wiederkam,
sagten die Leute des Malla: "Der Malla ist in die Farm gegangen. Er ist nicht wiedergekommen. Es muß ihm etwas zugestoßen sein. Wir wollen in die Farm gehen und nach ihm suchen." Die Leute gingen in die Farm. Sie schrien nach dem Malla. Der Malla wollte antworten. Die giftige kleine Schlange sagte: "Wenn du ein Wort laut rufst, beiße ich dich und du wirst sterben!" Der Malla schwieg. Er wagte nicht zu schreien. Die Leute des Malla sagten: "Er ist nicht in der Farm. Wir wollen wieder nach Hause gehen. Wir finden ihn nicht." Die Leute gingen nach Hause. Der Malla blieb in der Farm. Er hatte nichts zu essen. Er hatte nichts zu trinken.Boadji (wohl die Zibetkatze) kam durch die Farm. Boadji sagte zu dem Malla: "Weshalb stehst du dort? Was ist mit dir?" Der Malla sagte: "Die kleine giftige Schlange bat mich, sie vor dem grauen Kranich zu verstecken. Ich versteckte sie in meinem Munde. In meinem Munde ist sie nun und will nicht wieder heraus. Sie sagt, ich dürfe nicht fortgehen, sonst würde sie mich beißen. Ich muß hierbleiben. Ich habe seit sieben Tagen nichts gegessen und getrunken. Ich werde aber bald sterben."Boadji sagte: "Ich könnte dir jetzt von der Schlange helfen. Aber ich weiß, daß du mir an einem andern Tage Schlechtes tun willst. Ich weiß das und werde dir doch helfen."
Boadji nahm Honig. Boadji strich von dem Honig auf die Lippen des Malla. Boadji strich von dem Honig auf des Mallas Kleider bis auf die Erde hin. Auf der Erde schüttete sie den Honig aus. Die kleine giftige Schlange begann den Honig von den Lippen des Malla abzulecken. Sie kam mit dem Kopfe aus dem Munde des Malla und leckte auch den Honig von den Kleidern. Die kleine giftige Schlange kam immer weiter herab und kroch auf die Erde. Auf der Erde begann sie den ausgeschütteten Honig aufzulecken.
Als die Schlange den Mund des Malla verlassen hatte und auf der Erde fortlief, fiel der Malla um. Er hatte kein Leben mehr. Boadji lief weg. Boadji holte Wasser. Boadji tropfte das Wasser auf das Gesicht des Malla. Der Malla wachte auf. Boadji lief hin und holte Fleisch. Boadji gab dem Malla das Fleisch zu essen. Der Malla ward wieder kräftig. Der Malla sagte zu Boadji: "Ich will dir fünftausend Kauri schenken!"Boadji sagte: "Was soll ich mit Geld? Behalte es!" Der Malla sagte: "Ich will dir zwei Gewehre schenken!"Boadji sagte: "Was soll ich mit den Gewehren? Behalte sie!" Der Malla sagte: "Was soll ich dir dann geben? Du hast mir das Leben erhalten. Ich muß dir etwas geben!"Boadji sagte: "Gib mir dann Erdnüsse!" Der Malla sagte: "Komm mit zu mir und nimm Erdnüsse!" Der
Malla und Boadji gingen zusammen zur Stadt. Sie gingen zusammen bis zu Mallas Gehöft. Der Malla sagte: "Komm mit zu mir herein und nimm die Erdnüsse!"Boadji sagte: "Nein, ich bleibe besser draußen. Ich bleibe hier an der Ecke. Bringe mir die Nüsse! Wenn ich mit dir in das Gehöft gehe, werden mich die Hunde anfallen und beißen." Der Malla ging allein weiter. Boadji blieb an der Ecke stehen und wartete.Eine der Frauen des Malla war schon seit langen Monaten schwanger. Während der Malla im Busche war, hatten die Wehen begonnen. Sie konnte aber nicht gebären. Die Frau sandte zu einem Bassanschi (Wahrsager) und ließ fragen, was man tun könne, daß sie gebären könne. Der Bassanschi antwortete: "Die Frau kann gebären, wenn das Fell einer Boadji untergelegt wird. Geschieht das aber nicht, so wird sie nie gebären können." Die Frau ließ nach dem Fell einer Boadji umfragen. Niemand hatte das Fell einer Boadji.
Der Malla kam nach Hause. Die Leute sahen ihn. Die Leute riefen: "Der Malla ist da! Der Malla ist nicht gestorben! Wo warst du?"Der Malla sagte: "Ich war in der Farm. In der Farm war ich krank geworden. Nun geht es aber wieder gut. Wie geht es meiner Frau?" Die Leute sagten: "Deiner Frau geht es nicht gut. Deine Frau ist in die Wehen gekommen. Sie kann jedoch nicht gebären. Sie hat zum Bassanschi geschickt und hat fragen lassen, was sie tun könne, daß sie gebären könne. Der Bassanschi antwortete: ,Die Frau kann gebären, wenn das Fell einer Boadji untergelegt wird. Geschieht das aber nicht, so wird sie nie gebären können.' Deine Frau ließ nach dem Fell einer Boadji umfragen. Niemand hatte aber das Fell einer Boadji."
Der Malla sagte: "Holt mir meinen Jäger!" Der Jäger wurde geholt. Der Malla gab dem Jäger vierhunderttausend Kauri und sagte: "Geh um die Ecke des Gehöftes. An der Ecke wartet eine Boadji. Wenn du diese Boadji erschießt und mir das Fell bringst, damit meine Frau darüber gebären kann, so schenke ich dir die vierhunderttausend Kauri." Der Jäger nahm die vierhunderttausend Kauri und ging damit aus dem Gehöft. Er holte seinen Bogen und seine Pfeile und ging an die Ecke. Er sah an der Ecke die Boadji stehen. Der Jäger wollte die Boadji erschießen. Boadji sagte: "Schieß nicht. Hör' erst. Geh zu dem Malla und sage ihm, ich hätte ihm das Leben gewahrt und Gutes getan. Er soll mich jetzt von dir frei kaufen. Geh zu dem Malla! Er soll für mich sprechen. Er wird es tun."Der Jäger ging in das Haus des Malla zurück. Er sagte zu dem Malla: "Boadji
sagte, ich solle zu dir gehen. Boadji hat dir das Leben gewahrt und dir Gutes getan. Du sollst sie jetzt von mir frei kaufen. Du sollst für mich sprechen. Wenn Boadji dir das Leben gewahrt hat, mag ich sie nicht erschießen. Ich gebe dir die vierhunderttausend Kauri wieder. Du kannst das auch allein tun und brauchst mich nicht!" Der Jäger ging fort.Der Malla nahm seinen Speer. Er ging selbst vor das Haus. Er ging um das Gehöft zu der Ecke, an der Boadji wartete. Der Malla nahm den Speer. Er wollte Boadji selbst töten. Er warf den Speer nach Boadji. Der Malla traf sie aber nicht. Boadji sagte: "Ich tat dir Gutes. Ich habe dir das Leben gerettet. Ich sagte dir: ,Ich weiß, daß du mir an einem andern Tag Schlechtes tun wirst. Ich will dir aber doch von der Schlange helfen.' Du bist aber nicht gut zu mir, wie ich es gegen dich war. Ich weiß, deine Frau kann nicht gebären, und deshalb willst du mein Fell haben. Ich habe aber eine bessere Medizin. Nimm dies und gib es deiner Frau. Wenn sie sie genommen hat, wird sie gebären können."Boadji gab dem Malla die Medizin. Der Malla nahm sie. Boadji lief fort. Der Malla hatte ihm keine Erdnüsse gebracht. Boadji ging und sagte: "Gott packe den Malla!"
Der Malla ging hinein. Er gab seiner Frau die Medizin. Die Frau nahm die Medizin. Sie konnte gebären. Am andern Morgen aber war der Malla verrückt. Am dritten Tag starb der Malla. Die Leute erzählten die Erlebnisse des Malla dem Edsu Madja. Der Edsu Madja rief alle Leute zusammen und sagte: "In Zukunft soll Freitags nicht mehr gearbeitet werden. Freitag ist kein Tag für die Arbeit!"
14. Kapitel: Die Tradition der Nupe vor hundert Jahren*
(von 1786-1911)
Die eigentlich historische Kenntnis des Nupevolkes von seiner geschichtlichen Vergangenheit umfaßt kaum hundert Jahre. Diese hundert Jahre bilden bis zum Eingreifen Englands eine Periode der Vernichtung und Zerstörung. Vor dieser Periode, die wir entsprechend den Leitern des Vernichtungswerkes als Fulbeperiode bezeichnen können, lag eine Zeit ungetrübten Glanzes, eine Periode des Reichtums, ein Zeitraum, den die Nupe im Gedächtnis haben als ihr goldenes Zeitalter. Nach dem Fürsten, der diesen Zustand des wohlhabenden Glückes hervorrief, und nach dem Namen seiner Familie wird man diese Periode als Edegiperiode bezeichnen müssen. Edegi
Dieser kurze, aber hochwichtige Vermerk sagt vieles. Er bestätigt die Mitteilungen der Eingeborenen: Nupe hat in der Periode der arabischen Kulturinvasion so gut wie nichts übernommen, blieb heidnisch und seinen alten Industrien treu. Gewiß gibt es auch hier in neuerer Zeit ein gewisses Streben, alles Höhere und Bedeutendere von "Mekka", vom Quell des Islam, herzuleiten. Aber der gesunde Volksgeist widerspricht dem. Die Innung der Glasarbeiter behauptete mir gegenüber: "Wir stammen aus Gabas, aus dem Osten, von den Arabern." Aber der greise Nachkomme des letzten echten Nupekönigs lachte grimmig und spöttisch, nannte Leute, die das behaupten, bubu, d. h. verrückt und dumm. Wenn wir aber von solchen allgemein sudanischen Ausdrücken der Mekkaabstammungssucht absehen, so finden wir übereinstimmende Überzeugung von der selbständigen Blüte des Nupelandes und der Edegiperiode, zumal auf dem Gebiete des Handwerks und des Kunsthandwerks. Wir hören immer wieder davon, daß solche Blüteperiode schon früher gewesen sei, aber daß die Jorubainvasion deren Beständigkeit unterbrochen habe.
In der Fulbeperiode ist diese alte Blüte, dieser alte Glanz so gut wie vernichtet bis auf den einen Keim, der in der Gesundheit und der Kraft Bidas und seiner Innungen wohnt. Was die arabische Invasion des Mittelalters also nicht vermochte, das glückte den schlauen Fulbe. Die Fulbe haben nun dieses Werk aber nicht aus eigener Kraft vollbracht, sondern die Nupe haben selbst nicht wenig dazu beigetragen, die durchaus schwierige Aufgabe, die gewaltige Nupevolkskraft zu brechen, beschleunigt zu lösen. Und zwar lag die Quelle des Unglücks wie so häufig in den dynastischen Schwierigkeiten, in Familienzwisten, in dem leidigen Konflikt matriarchalischer und patriarchalischer Rechtseinteilung.
Der alte Lilie in Mokwa begann seinen Bericht über die geschichtliche Entwicklung des Nupelandes mit den fast klassisch klingenden Worten: "In alter Zeit war hier (im Nupeland) kein Recht des Vaters; nur die Mutter und ihr Bruder hatten etwas über die Kinder
zu sagen." Das heißt also: dem Vater folgte nicht der eigene Sohn in der Herrschaft, sondern der Sohn der Schwester. So wurden die beiden Söhne Edegis, Ebako und Ebagi, nicht die Könige in Gbarra, der ersten Residenzstadt der Edegiperiode, sondern sie wurden mit dem Mokwa-Rabadistrikt beliehen, während Ramatu, die Schwester Edegis, anscheinend in Gbarra als Königin thronte und ihren Sitz dann, als ihr Sohn mündig und Oberherrscher wurde, nach Sugurma verlegte. — In der alten, guten Edegizeit erledigte sich die Thronfolge auf dieser Grundlage durchaus glatt und selbstverständlich. Dann aber rückte das Patriarchat dem Nupelande näher und näher. Waren es die Songhai, die es brachten? War es eine vorislamische oder die arabisch-islamische Sozialanschauung, die die patriarchalische Idee, diese lockende Annehmlichkeit für väterlichen und mütterlichen Ehrgeiz, einführte? Jedenfalls ist so viel sicher, daß schon vor der eigentlichen Nupezeit Abweichungen von der matriarchalischen Erbfolge vorkamen, daß z. B. Edsu Masu gegen den Willen seiner Familie und seines Volkes seinen Sohn Audu zum Saba, d. h. Thronfolger ernannte.1785-1830. — Jedenfalls setzte die Unglücksperiode der letzten hundert Jahre mit einem solchen Bruch des Erbschaftsgesetzes ein und hörte mit dem Verbote des altehrwürdigen Matriarchats auf. Im Jahre 1785 wurde Ismada endgültig der Edsu des Nupelandes. Er regierte bis 1799, und zwar zumeist in der Stadt Ragada bei Patigi. Seine älteste Schwester war verheiratet mit einem gewissen Umoru, einem vornehmen Manne vom Edegistamme. Als Sohn dieses gebar sie Madjia, der damals der eigentliche Thronerbe nach dem Edegigesetz war. Elf Jahre aber, nachdem er König geworden war, ernannte er nicht Madjia, sondern seinen eigenen, noch ganz jungen Sohn Issa (nach Fulbeaussprache Edrissu) zum Saba, d. h. zum Thronfolger.
Daraufhin erklärte Madjia seinem Oheim den Krieg. Die eigene Mutter soll es gewesen sein, die ihn zu solchem Vorgehen aufstachelte, und die vornehmen Familien, die streng auf Einhaltung des Gesetzes sahen, schlossen sich ihm an. Edsu Ismada steht in der Tradition als ein ungeschickter Mann da, von dem mir einmal gesagt wurde, er habe zwar viele Weiber, aber wenig Kinder gehabt, während Edsu Madjia, sein Neffe, wenig Frauen und dreihundert (!) Kinder gehabt haben soll. So verstehen wir es, daß ein gewisser Abudu Romanu eine Gegenpartei aufzubringen wußte, deren Macht nicht unbedeutend war und erst 1806 von Mauern Dando gebrochen wurde.
Im Jahre 1802 besiegte Madjia den Edsu Ismada endgültig und tötete ihn, wie es heißt, eigenhändig. Er wurde zum König ernannt
und auch als König anerkannt, natürlich mit Ausnahme der Anhängerschaft des getöteten Ismada. Diese Leute nahmen sich vielmehr des offiziell zum Saba erhobenen jungen Sohnes Edsu Ismadas, des Issa, an und brachten den Knaben nach Ademalelu, wo er versteckt gehalten wurde, damit der König Madjia, der als grausam galt, ihn nicht töten könne.Damit wäre nun auch diese Episode überwunden und gleich vielen ähnlichen älteren ohne Nachwirkung verlaufen gewesen, wenn sich nicht inzwischen eine stille und unscheinbare andere Gesellschaft im Nupelande eingefunden hätte, die neue Strömungen hervorrief. Das waren die Fulbe. Sie tauchten in diesem Lande ebenso leise und unmerklich auf wie anderweitig. Ich konnte nicht das Jahr ihres Eintreffens erfahren. Nach der Angabe eines in Kabba aufbewahrten Manuskripts langte Mauern Dando im Jahre 1806 im Nupelande an und begann seine Tätigkeit damit, daß er den Edsu Abudu Romanu, der damals die Oberhand hatte, durch "Zauber" tötete.
Die Fulbe erzählen: Zwei Brüder, die Söhne des Fulbe Fate, zogen von Gandu nach Süden; beide waren Mauern. Der eine war Mauern Auimi, der ging nach Illorin, schmeichelte sich durch seine Wunderkunst bei den Joruba schnell ein und ward König. Dieser Mauern Auimi war ein Magier, ein Wulli. Der andere, jüngere, der Mauern Dando oder, wie die Nupe ihn kurzweg nennen, "Manko" ließ sich mit einigen Anhängern in Raba nieder. Aber während der ältere Bruder das Ziel aller Fulbeemigranten jener Zeit schnell erreichte und König von Illorin wurde, geriet Mauern Dando bald mit Edsu Madjia in Konflikt. Der Konfliktgrund ist sehr klar. Erst kamen die Leute zu Edsu Madjia und sagten: "Es hat sich ein Fulbe Mauern in Illorin und ein Fulbe Mauern in Raba niedergelassen." Edsu Madjia: "Sagt mir, ob er und seine Leute Gutes tun!" Die Leute sagten: "Sie tun Gutes!" Nach einiger Zeit kamen die Leute wieder zu Edsu Madjia und sagten: "Der Fulbe Mauern, der sich in Illorin niedergelassen hat, hat die Joruba als Monafiki (Hetzer) gegeneinander aufgebracht und ist jetzt König von Illorin." Edsu Madjia sagte: "Dann nehmt Pferde und Waffen und verjagt die Fulbe, die sich im Nupeland, in Raba niedergelassen haben."
Das ist klar. Der Erfolg des einen Bruders machte dem andern die schnelle Vollendung seines Werkes unmöglich. Und ebenso selbstverständlich ist es, daß die vertriebenen Nupefulbe sich zu den glücklicheren Illorinfulbe zurückzogen, um hier eine neue Angriffsmethode auszuhecken. Edsu Madjias Truppen verjagten Mauern Dando aus Raba nach Illorin und verfolgten ihn hier in jenes Gebiet, um womöglich auch dieses gefährliche Nachbarschaftsnest auszunehmen. Mauern Auimi nahm die fliehenden Rabafulbe freundlichst auf. Er sagte zu ihnen: "Ich bin Wulli (Magier), ich schütze euch.
Kein Pfeil soll euch hier treffen. Ihr aber könnt die Nupe, wenn sie hierher kommen, mit der bloßen Hand fangen." Die Nupesoldaten Edsu Madjias kamen vor Illorin an. Mauern Auimi sammelte alle Fulbe um sich und ritt aus dem Tore den Nupe entgegen. Da flohen die Nupe. Die Illorinfulbe verfolgten sie bis Eggan am Niger. Madjia selbst soll in Raba die Rückkehr seiner Truppen abgewartet und, als die Nachricht vom verlorenen Gefecht kam, sich nach der Jebbagegend, nach Batsua, dann nach Laquata gewandt und drei Monate dort gelegen haben.Die Illorinfulbe waren nun bei weitem nicht mächtig genug, gegen die Nupemacht selbst einen Vorstoß übernehmen zu können, und so wandten sie denn ihre Zuflucht zu einer List, zu dem berühmten Lehrsatze: "Teile und herrsche!" Als Mauern Dando mit dem Scheich Auimi in Illorin zusammen war, fragte Auimi den jüngeren Bruder: "Gibt es denn keinen Nupe, der ein Recht und den Wunsch hat, in Nupe König zu werden?" Darauf sandte Mauern Dando eine Botschaft nach Gbara und ließ sagen: "Allah hat mir gesagt, daß Issa (Edrissu), der Sohn Edsu Ismadas, König über Nupeland werden wird." Das hörten die Nupe in Gbara. Das hörten die alten Leute, die den Sohn Edsu Ismadas in Ademalelu versteckt hatten. Die alten Leute sagten: "Vielleicht können wir Edsu Ismadas Sohn so als Edsu einsetzen. Die Fulbe müssen die Erlaubnis eines Nupekönigs haben, um wieder ins Land und nach Raba kommen zu können. Die Fulbe werden also den Edsu Issa unterstützen. Wir wollen uns an die Fulbe wenden." Die alten Leute sandten also die Fulbe nach lllorin um Botschaft. Sie sprachen mit den Fulbe in Illorin. Die Fulbe sagten: "Edsu Issa soll unser König sein. Wir wollen ihm in diesem Kriege helfen." Es ward eine Kriegsmacht aufgebracht. Den Grundstock bildeten Nupe des Ostens. Aber auch Joruba aus Illorin fochten unter der Führung der Fulbe mit. Die Fulbe mit ihrem Organisationstalent gaben den Ausschlag. Madjia wurde von Issa geschlagen. Edsu Madjia zog sich nach Mule in der Sugurmaregion zurück, und als die Fulbe mit Edsu Issa noch weiter vorrückten, ließ er sich bis nach Angbarra im Gebiet der Kemberri oder Kambali verjagen.
Danach ging der siegreiche Edsu Issa nach dem Osten zurück. Er ließ sich in Edda im Transkaduna (westlich von Bida) nieder und führte einen Wall auf. Mauern Dando hatte sich nach Issas Erfolg wieder in Raba niedergelassen. Aber andere Fulbe nahmen der alten Fulbepolitik entsprechend am Hofe des neuen Königs, in Edda, Wohnung. Hier hetzten sie den König weiter gegen Madjia auf, denn es war selbstverständlich, daß ihr Ziel war, die Könige der alten Nupedynastie gegeneinander aufzuwiegeln, sie gegenseitig zu Tode zu hetzen. Eines Tages nun sprachen die Fulbe in einem Hause darüber. Ein alter Sklave Edsu Issas war im Hofe. Er hörte, wie ein
Fulbe sagte: "Diesen Edsu Issa werden wir leichter überwinden als den Edsu Madjia." Der alte Sklave ging zu Edsu Issa und wiederholte diesem die Worte des Fulbe. Edsu Issa gab darauf den Befehl, die Fulbe aus Edda zu vertreiben.Edsu Issa rüstete einen starken Kriegshaufen aus und sandte ihn gegen Raba, um gegen die Fulbe einen vernichtenden Schlag auszuführen. Es gelang auch, Raba zu umzingeln und einzuschließen, Die Stadt war stark befestigt und hielt Widerstand, war aber schlecht verproviantiert. Edsu Issa hoffte, sie aushungern zu können. Dem kam aber Mauern Dando zuvor. Dando sandte nachts eine Botschaft nach dem Norden zu Edsu Madjia und ließ ihm sagen: "Komm nach Raba und falle Edsu Issa in den Rücken. Dann kannst du ihn vernichten." Edsu Madjia kam, und kaum tauchte er auf, so zog sich die ganze Mannschaft Edsu Issas ohne Bogenschuß nach der befestigten Stadt Edda zurück. Als Edsu Issa die Botschaft vom Zusammenschluß der Fulbe und Edsu Madjias erhielt, floh er Hals über Kopf aus Edda nach Esa (das liegt nahe bei Eting und Charati, einem Platz an der Eisenbahnlinie). Edsu Madjia verfolgte ihn. Edsu Issa brach wieder auf und zog sich nach dem Osten zurück. Er nahm Aufenthalt in Ekadji, das liegt bei Kadja und im Gebiet von Agaye.
Madjia kehrte zunächst nach Raba zurück. Er machte mit den Fulbe Freundschaft. In dieser Zeit starb nun der Mauern Dando, und die Fulbe sandten deswegen nach Gandu eine Botschaft, die um weitere Instruktionen bat und alle Vorgänge schilderte. Edsu Madjia blieb längere Zeit mit den Fulbe zusammen. Um den Frieden zu besiegeln, schenkte er den angesehensten Fulbe drei seiner eigenen Töchter zu Frauen. Die erste erhielt Mutafa, der ein jüngerer Sohn Mauern Dandos, aber kein kriegerischer Mann, sondern ein sehr angesehener und einflußreicher Priester war. Die zweite erhielt Usman Saki, einer der älteren Söhne und später der erste König in Bida. Die dritte gab er dem Mejaki, dem Kriegshauptmann der Fulbe, das war ein Fulbe mit Namen Uallagan, der mächtig, aber mit der Familie Mauern Dandos nicht verwandt war. Nachdem die großartigen Hochzeitsfeste verstrichen waren, begab sich Edsu Madjia wieder auf den Kriegszug. Er marschierte hinter Edsu Issa her und trieb ihn über den Niger bis nach Toji.
Als Edsu Madjia so hinter Edsu Issa herjagte, fiel inzwischen in Raba die Entscheidung. Die Boten aus Gandu kehrten zurück und mit ihnen ein hoher Abgesandter des Gandukaisers. Edsu Madjia wurde zu einer Unterredung nach Raba gerufen. Er folgte dem Rufe. Er traf eine ganze Armee gewappneter und gepanzerter Reiter als Begleiter des Ganduboten. Die Tradition von dem Pompe, den der Gandubote entwickelte, hat sich im Volksgedächtnis erhalten. Dem Edsu Madjia wurden prachtvolle Gewänder geschenkt, wie er sie
vorher nicht gesehen hatte. Es war das die Verzuckerung der bitteren Pille, der bittersten, die Madjia zuteil werden konnte. Der Gandukaiser erkannte seine Herrscherwürde in dem Sinne der alten Nupedynastie nicht an. Der Gandubote sagte, der Islam könne eigentlich nur den Sohn als Nachfolger anerkennen, nicht den Neffen. Also im Sinne des Islam sei tatsächlich Edsu Issa König, und zwar natürlich in der alten Edegistadt Gbarra. Da er, Edsu Madjia, aber mit den Fulbe Freundschaft geschlossen, ihnen seine Töchter zu Frauen gegeben habe, so wolle man ihm das Sugurmagebiet als Königreich überlassen. Im übrigen solle das Nupeland von Madjigi, einem Sohne des verehrungswürdigen verstorbenen Mauern Dando, verwaltet werden; Madjigi solle nach Gandu kommen und weitere Instruktionen holen.Diese Entscheidung war so schlau wie nur irgend möglich. Sie erhielt die beiden feindlichen Parteien aufrecht, schränkte die Machtsphäre beider gebührend ein und gab den Fulbe die Zügel in die Hand. Und unter der Maske des pomphaften Wohlwollens gegen Edsu Madjia gewann die Fulbemacht so die Zügelführung.
Eine möglicherweise später eingeführte Tradition hat noch folgende Einzelheit aus den Friedenstagen verzeichnet. Als die Vornehmen unter dem Vorsitze des Ganduboten und in Anwesenheit des Edsu Madjias über diese Dinge verhandelten, soll ein Fulbe jüngling den Madjianupen eine demütigende, schimpfliche Geste gemacht haben. Ein junger Nupe, der hinter Edsu Madjia stand, soll sich da voll Wut den Finger abgebissen und ihn dem Fulbe ins Gesicht geschleudert haben mit den Worten: "Nimm erst dieses! Später werde ich dir Pfeilspitzen zu fressen geben!" Der Fulbe, der die verächtliche Geste machte, soll der spätere König Usman Saki, der Nupejüngling der fürchterliche Edsu Zado gewesen sein. Alle Teile waren damit einverstanden, weil sie sich wohl oder übel dem Willen der Fulbe fügen mußten. Edsu Madjia kehrte nach Sugurma zurück und verbrachte seine Tage in Frieden. Er soll nur noch kleine Sklaven-Züge gegen die Kamberri unternommen haben. Edsu Issa ging nach Gbarra und baute die Befestigungen der Stadt aus. Madjigi, der Sohn des Mauern Dando, ging nach Gandu, um sich seine Bestätigung zu holen. Er kam mit großer Festlichkeit von Gandu zurück und starb drei Tage später. Darauf wurde Usman Saki Herrscher in Raba.
1830-1846. — Raba entwickelte sich zu jener Zeit sehr schnell zu einer der ersten Städte des gesamten Sudan. Damals blühten noch viele Städte Nupes, vor allem das kunstgewerblich so bedeutsame Gbarra. In jener Zeit, sagte ein alter Nupe, hatte das Nupeland noch hundertundzwanzig Städte, die so groß waren wie heute Bida. Nupe brachte mehr Kleider hervor als die Haussaländer. Aber an der
Spitze aller Nupestädte stand Rabe. Raba war uralt, stammte aus der Zeit vor Edegi. Raba war aber nicht so alt wie Mokwa, welches als Mutter Rabas bezeichnet wurde, und Raba wurde erst durch Edsu Madjia (oder Magia) mit einem Ebang versehen, und zwar um den Anfang des Jahrhunderts herum, ehe noch die Fulbe nach lllo. rin getrieben waren. Die Fulbe, zumal Mauern Dando und seine Söhne, hatten Edsu Madjia bei dem Bau der Festungswerke und bei dem Bau des Palastes mit Rat und Tat zur Seite gestanden. In jener Zeit war Raba schon so groß und seine Bevölkerung so wohlhabend und dicht, daß in Raba vierzehnhundert Pferde standen.Als nun Usman Saki in Raba König ward, d. h. um das Jahr 1831, nahm die Bedeutung Rabas noch zu. Usman Saki muß, besonders in seiner Jugend, einen ungemeinen Einfluß auf seine Altersgenossen ausgeübt haben. Schon als sein Vater vor seiner Vertreibung als einfacher Mauern in Raba lebte, versammelte sich allabendlich die Jugend um Usman Saki, dem sie auf den Fingerwink gehorchte. Usman Saki war kein großer Krieger. Er war ein Redner, ein geschickter Massenleiter, ein Mann, der die Massen in ihren Empfindungen zu lenken verstand, dabei aber ebensowenig ein anständiger Charakter wie irgendeiner seiner Brüder oder Nachkommen. Als er nun Edsu war, übte er seinen ganzen Einfluß aus, die Bedeutung Rabas zu heben, und allgemein wird gesagt, daß Usman Saki in den ersten sechzehn Jahren seiner Regierung die Bedeutung des Nupelandes gehoben habe. Man sagt, daß er mehrfach seinen jüngeren Bruder Massaba arg geschädigt habe, weil dieser im Nupelande selbst Sklavenzüge veranstaltete. Usman Saki hoffte offenbar, das reiche Land auf friedlichem Wege allmählich unter seine Hoheit zu bekommen. Er sagte seinen Brüdern: "Wenn ihr Sklaven jagen wollt, geht zu den Bunu, geht zu Kukuruku. Aber laßt die Nupe in Frieden. Die Nupe sollen Kleider machen, daß sie reich werden!" Er sandte seinen Bruder Massaba nach Lade, um von da aus gegen Bunu und Igbirra Züge zu unternehmen.
Usman Saki wollte das Nupeland auf seine Weise in seine Hand bekommen. Man sagt, er habe Edsu Madjia zweimal zu vergiften versucht. Einmal soll eine Frau statt Edsu Madjia gestorben sein, einmal aber soll Massaba, der Bruder des Usman Saki, die warnende Botschaft hiervon dem Sohne Edsu Madjias, dem Zado, gemacht haben. Und mit diesem Edsu Zado tauchte dann die charaktervollste, imposanteste, in ihrer brutalen Art wirklich einzig großartige Gestalt des Dramas auf.
Im Jahre 1847 starb der Edsu Madjia eines natürlichen Todes in Sugurma, nachdem zwei Versuche Usman Sakis, ihn und seinen Sohn zu vergiften, gescheitert waren. Sowie Edsu Madjia tot War, sandte Massaba an seinen Bruder Usman Saki die Botschaft: "Edsu
Madjia ist gestorben. Nimm die goldenen (?) Krakas (Trompeten), den silbernen (?) Sattel und die andern Schätze Edsu Madjias in Besitz, denn sie sind zu gut für die Nupe." Er sandte auch eine Botschaft an Edsu Zado und ließ ihm sagen: "Mein Bruder hat mich schlecht behandelt. Er hat deinen Vater und dich vergiften wollen. Laß uns Freundschaft schließen. Mein Bruder Usman Saki wird jetzt sowieso gegen dich ziehen, um dir die goldenen Trompeten und den silbernen Sattel und die andern Sachen wegzunehmen."Man erzählte mir von Zado eine sehr charakteristische Geschichte. Wenn sie nicht wahr ist, was möglich ist, so beleuchtet sie doch den Charakter dieses Königs, wie er heute noch im Kopfe alter Nupe lebendig ist, ausgezeichnet. Edsu Zado sagte, als sein Vater gestorben und die Botschaft Massabas angekommen war, zu seinen Freunden: "Ich will das Nupeland wieder für die Kinder Edegis von den Fulbe rauben. Zehn mutige Männer sind mir mehr wert, als hundert mit schwachen Herzen. Macht morgen früh auf der einen Seite der Stadt Kriegslärm und sagt: ,Usman Saki kommt!' und kommt dann zu mir auf die andere Seite und helft mir die Tapferen von denen schwachen Herzens teilen!" So geschah es. Als die Nachricht vom Herannahen Usman Sakis auf einer Seite Sugurmas auftauchte, flohen alle Feiglinge zum andern Tore hinaus. Auf der Seite lag aber Zado mit seinen Getreuen im Busche und schoß einen Flüchtling nach dem andern nieder.
Dann nahte die Truppenmacht Usman Sakis in Wirklichkeit, und Zado nahm einen kleinen Sohn und eine kleine Tochter mit und — floh! Es war die grauenvollste Flucht, von der ich je gehört habe! Mit seinen beiden Kindern und seinen Getreuen floh der König zu den berühmtesten Magiern des Landes. Er floh nach Kanji oder Kanschi, das ist eine Ortschaft, die bei Bussa auf einer Insel im Niger liegt. Er kam zu diesen als Magiern bekannten Leuten und bat: "Helft mir gegen Usman Saki !" Die alten Leute sagten: "Was können wir, die Alten, dir, dem König helfen? Bist du nicht stärker als Usman Saki, wie sollen wir es sein? Wenn wir dir nun aber eine Tschigbe (magisches Instrument; Haussa: magirri oder asirri) geben, wird dir das nützen?" Edsu Zado sagte: "Das ist es, was ich von euch haben will!" Die alten Leute fragten: "Willst du uns deinen ältesten Sohn und deine älteste Tochter geben?" Edsu Zado sagte: "Ich habe sie deswegen mitgebracht. Nehmt sie!"
Alle Leute von Kanji kamen zusammen. Es wurde ein großes Feuer angezündet. Edsu Zado stand neben dem Feuer. Neben dem Feuer töteten die Kanjileute durch Keulenschläge Edsu Zados Sohn und Tochter. Der Vater stand daneben. Sie zogen die Haut vom Rücken des Sohnes und spannten sie über eine Trommel. Der Vater stand daneben. Sie zogen die Haut vom Rücken des Mädchens und
spannten sie über eine Trommel. Sie verbrannten die beiden Leichen, mischten die Asche mit magischen Mitteln und füllten sie in die Trommelsärge. Dann pflöckten sie die Häute fest. Edsu Zado stand daneben. Er sah bei allem zu. Als die Trommeln fertig waren, gaben die Kanjileute sie dem Edsu Zado. Edsu Zado nahm die Trommeln und sagte zu seinen Leuten: "Sagt in allen Nupestädten, welche Tschigbe ich jetzt habe. Diese Trommeln sollen geschlagen werden, bis Raba zerstört ist!"Die Nachricht von diesem fürchterlichen Opfer, das der König Zado der Nupedynastie dargebracht hatte, verbreitete sich mit Windeseile über das ganze Land. Von allen Seiten strömten die Leute zusammen, denn derartig grauenvolle magische Instrumente mußten den Sieg bringen. Nur die Mokwaleute blieben dem König Usman Saki treu. Sie kamen von Mokwa nach Raba und sagten zu Usman Saki: "Der Edsu Zado kommt! Er hat seine eigenen Kinder geopfert. Alle Nupe kommen zu ihm!" Usman Saki fragte die Mokwaleute: "Weshalb geht ihr denn aber nicht zu Edsu Zado ?" Die Mokwaleute sagten: "Wir können dich nicht verlassen, um zu Edsu Zado zu gehen!" — Die Fulbe haben diese Treue der Mokwaleute in schöner Weise später vergolten!
Der König Usman Saki stellte ein größeres Heer auf und sandte es unter Soadjia nach Jebba, um erst diesen Vorposten Edsu Zados zu brechen. Zado sandte eine starke Hilfsmannschaft nach Jebba; der Soadjia wurde mit List auf die Insel gelockt; er wurde überwältigt und gefesselt. Die Nupe schlugen dann den erschrockenen führerlosen Heerhaufen und brachten Soadjia nach Jeni, das nahe Sugurma liegt, an diesem Platze hatte Zado seine wichtigsten Kräfte vereinigt.
Dieser Soadjia war bei den Nupe ganz besonders verhaßt, denn er war der Haufenführer Usman Sakis, den dieser bei jeder Gelegenheit zur Abstrafung unbotmäßiger Nupe ausgesandt hatte. Soadjia hatte dann ganze Ortschaften vernichtet, die Bewohnerschaft in die Sklaverei verkauft und sich so bereichert. Als nun Usman Saki nach dem hinterlistigen Wegfange seines Anführers bei Jebba eine noch bedeutendere Heeresmacht nach Jeni schickte, ließen die Nupe Zados an Soadjia ihre ganze Wut aus und erschreckten durch außerordentliche Brutalität die Usman Sakileute. Angesichts der Rabaleute ward ein großes Feuer entzündet.
Zuerst zeigten Zados Leute den Rabatruppen den gefangenen Soadjia und schrien: "Den habt ihr uns geschickt! Nun nehmt ihn euch doch wieder!" Sie trommelten auf den beiden heiligen Trommeln, tanzten um das Feuer und sangen: "Hier! Das ist der Soadjia, der immer die Leute gefangen und verkauft hat! Er hat sich mit der Arbeit viel Geld verdient. Nun wollen wir sehen, wie er sich im Feuer
fühlen wird!" Dann schlugen sie Soadjia die Arme ab und warfen sie ins Feuer. Sie schnitten dem Soadjia die Füße ab und warfen sie ins Feuer. Dann schnitten sie den Leib in der Mitte quer durch und warfen beide Teile ins Feuer; so daß alles verkohlte. Zado stand bei alledem daneben und blickte zu.Als der Soadjia so geopfert und verbrannt war, ergriff das Heer Zados die Waffen und stürmte auf das Lager der Rabaleute los. Die erschrockenen Rabatruppen wurden aufgerieben und eilten nach ihrer Hauptstadt zurück. Usman Saki rüstete noch ein Heer aus. Edsu Zado, dem nun immer mehr Kriegslustige zuströmten, führte seine Truppen von Jeni zwischen Bokani und Mokwa (näher letzterem Platze) hindurch nach Kwota. Der Maejaki oder Majaki (General) Usman Sakis, Dagana mit Namen, führte die andere Armee ebenfalls dahin, und in Kwota kam es dann zum dritten Gefecht, das Zado selbst leitete und gewann. Der Rest der Leute Usmans floh nach Raba. Eine Armee konnte Usman Saki nicht mehr aufstellen. Alle Beredsamkeit, alles Aussenden von Boten nützte nichts mehr; Edsu Zados Name war überall gefürchtet. Niemand wagte ihm mehr im offenen Gefecht entgegenzutreten. Ganz Transkaduna gehörte Edsu Zado, und der unternahm nun den letzten Schritt. Er belagerte Raba.
Raba war ohne Heere. Usman Saki hatte es vorgezogen, beizeiten das Weite zu suchen. Er entfloh erst nach Agaye, von da aus dann nach Gandu. Erst hoffte er, hier mit neuen Mitteln ausgerüstet zu werden. Aber seine Kriegsuntüchtigkeit war wohl zu deutlich, auch entwickelten sich die Verhältnisse im Nupelande und unter den Fulbe des Nupelandes so eigenartig, daß Usman Saki elf lange Jahre in Gandu im Exil schmachtete und erst 1858 nach Nupe zurückkehren konnte.
Die Belagerung von Raba spielt in der Erinnerung der alten Nupe eine ganz eigenartige Rolle. Man erzählte mir gern davon. Zado hatte um Raba regelrecht eine neue Stadt errichtet. Er hatte überall Posten, die regelmäßig abgelöst wurden. Wer aus der Stadt entweichen wollte, ward gefangen und verkauft. Auch die Wasserseite ward abgesperrt. Der Hunger quälte bald die Leute. Es starben viele. Die Leute in der Stadt begannen einander tot zu schlagen. Auch teilten sie untereinander das Fleisch der Erschlagenen und verzehrten es. Zuletzt entfloh der Rest der Überlebenden auf eine nicht erklärliche Art und Weise. Edsu Zado zog in die Stadt ein. Edsu Zado zerstörte die Stadt von Grund auf. Zado sagte: "Nun habe ich meinen Willen erreicht. Diese Leute werden mir nichts mehr tun. Jeder kann jetzt heim und an seine Arbeit gehen!" Edsu Zado entließ sein Heer.
Nach meiner Berechnung müßte die Einnahme und Zerstörung
Rabas 1846 stattgefunden haben. Meyer hat sie auf 1845 angegeben (Paul Constantin Meyer, Erforschungsgesgeschichte und Staatenbildungen des Westsudan, S. 55). Es ist dies ein so geringer Unterschied, daß mir diese Genauigkeit für die Richtigkeit des Ganzen eine wesentliche Probe mit günstigem Resultat darstellt. —Mit dem Untergange Rabas und dem ersten Sturze der Fulbedynastie endet der zweite Abschnitt der Fulbeperiode.1846-1852. — Dies war der letzte Augenblick, in dem Gelegenheit zur Neuschöpfung oder zur Wiederherstellung des alten Nupereiches gegeben war. Die Fulbe waren nach Süden über den Niger gedrängt und ihre Macht gebrochen. Der eigentliche Nupeherrscher war nach Gandu entflohen, in Lade am Südufer des Niger weilte nur noch sein Bruder Massaba, ein Ränkeschmied erster Ordnung, ein blutgieriger Geselle, aber weder Krieger noch Organisator. Er hatte die letzten Anhänger seines Vaters um sich versammelt und führte ein nur auf persönliche Bereicherung hinzielendes Raubmörder- und Sklavenjägerleben.
Also das eigentliche Nupeland war frei. Im Osten herrschte Edsu Zado, im Westen Edsu Jissa, ein Sohn des inzwischen verstorbenen Edsu Issa. Einige Berater sollen dem Edsu Zado geraten haben, erst nach Gbarra zu marschieren und den Edsu Jissa zu töten, dann den Krieg gegen Massaba zu beginnen. Im Interesse und Sinne der glücklichen Entwicklung des Nupestaates wäre das fraglos gewesen, denn Edsu Zado hätte sicherlich beide Gegner mit seinem persönlichen Geschick, mit der Menge seiner Truppen und vor allen Dingen mit dem ungeheuren Ansehen, das ihm alle Nupe entgegenbrachten, ohne große Schwierigkeit beiseite gedrückt. Aber Edsu Zado war kein zielbewußter Fulbe, sondern eben ein schwerfälliger Nupe, ein Mann, der genug getan hatte. Er lehnte alle derartigen Ratschläge ab. Er wollte nun in Frieden leben.
Edsu Zado lebte nicht lange. Er starb um das Jahr 1850, und zwar in der Stadt Borodji oder Borogi, die zwischen Ebako und Gjikum liegt. Da diese Stadt auf dem Wege nach Gbarra gelegen ist, behaupten einige, er habe sich doch noch zu dem Kriege gegen Edsu Jissa entschlossen. Mit Edsu Zados Tod war das Unglück des Nupelandes besiegelt. Nunmehr zog die Zerstörungszeit mit Riesenschritten ein. Die nun folgende Zeit ist es gewesen, in der das arme Nupevolk am meisten gelitten hat. Mit erstaunlicher Geschicklichkeit manövrierten nunmehr die Fulbeintriganten, in deren Händen die schwächlichen letzten Nupekönige nicht viel mehr als Schachfiguren waren.
Nach Edsu Zados Tode wurde dessen Sohn Surugi König. Er muß ein kümmerlicher Patron gewesen sein. Sein Vater hatte ihm eingeschärft: "Geh nie mit einem Fulbe!" Kaum war der Vater gestorben,
so erschien eine Botschaft der Fulbe bei Edsu Surugi. Edsu Surugi nahm sie an. Surugi weilte damals in Jangi, nahe Raba. Er soll den Gedanken gehabt haben, Raba neu aufzubauen. Die Fulbebotschaft kam von dem Ränkeschmied Massaba. Massaba hetzte Surugi zu dem Schritt, den Zado hätte tun müssen: zum Krieg gegen Edsu Jissa. Ob aber ein Zado den Krieg unternahm oder ein Surugi, war eine ganz verschiedene Sache. Zado war Krieger, erfahren, angesehen, großzügig; Surugi war jung, unerfahren, kleinlich und entbehrte noch jedes Ansehens. Wenn Zado den Krieg unternommen hätte, hätte er ihn zum Abschluß großzügiger Pläne aus dem Wunsche seines Nupeadels heraus unternommen. Surugi aber unternahm den Zug auf Anraten des Erbfeindes der Nupe, auf Rat der Fulbe, und in dieser Tatsache lag allein schon die Ursache des, Mißlingens. Massaba hatte Surugi sagen lassen: "Ich möchte mit dir Freundschaft machen. Behalte dir das Nupeland. Ich will dann Kaba und die Igbirraländer nehmen. Du mußt aber als mein Freund alleiniger Herrscher des Nupelandes sein. Edsu Jissa mußt du vernichten. Edsu Jissa hat in Gbarra die Fahne, den Ring und das Bett Edegis (gewissermaßen die Kroninsignien). Diese Dinge gehören in deinen Besitz. Gehe hin und hole sie. Wenn du Edsu Jissa geschlagen hast und die Fahne, den Ring und das Bett Edegis hast, komm zu mir nach Lade! Da wollen wir dann Freundschaft schließen!" Und Edsu Surugi fiel auf diese Intrige glatt herein. Er antwortete Massaba: "Ich komme!"Kaum hatte Massaba diese Zusicherung in der Tasche, so sammelte er alle Anhänger der Fulbe, die Freunde des verjagten Usman Saki usw. und marschierte nach Süden ab. Er unternahm einen Sklavenraubzug in der Gegend von Kaba. Surugi aber marschierte gegen den Edsu Jissa, der in Gbarra residierte. Massaba behielt die Bewegung der gegeneinander aufgehetzten Vettern im Auge. Kaum war er seiner Sache sicher, so sandte er eine Nachricht nach Gandu, die lautete: "Die Nupekönige sind wieder im Streite gegeneinander. Es ist an der Zeit einzugreifen und die Fulbevorherrschaft wieder herzustellen." Der damalige Ganduherrscher hieß nach Nupeangabe Malle-Ualelu. Malle Ualelu fragte erst Usman Saki, ob er die Gelegenheit ergreifen wolle, nach Nupe zurückzukehren. Usman Saki sagte: "Er wolle erst zurückkehren, wenn der Krieg am Ende sei."
Usman schlug den jungen Umoru als tüchtigen Führer vor. Umoru aber lehnte ab, da er mit Massaba sich überworfen habe (?) und nun nicht Seite an Seite mit diesem kämpfen könne. Darauf bestimmte der Emir von Gandu, daß Situ, der Fulbekönig von Illorin, die Nupeangelegenheiten ordnen solle. Situ kam dieser Aufforderung sogleich nach. Er traf mit vielen Reitern und großem Troß in Nupe ein. Surugi wurde geschlagen, er und sein Heer flohen nach Jeni
zurück. Surugi starb noch im selben Jahre, und zwar anscheinend eines natürlichen Todes. Situ "ordnete" inzwischen die Verhältnisse im Nupelande nach seiner Weise. Er raubte und plünderte allenthalben und begann somit die endgültige Verwüstung, die dann andere fortsetzten.Als Edsu Surugi gestorben war, ernannten die Westnupe Masa zum König. Edsu Masa erklärte, ebenfalls in Jeni residieren zu wollen. Die Nachricht ward nach Gandu gesandt. Der Emir bestätigte die Wahl Edsu Masas und rief Situ zurück, zumal Massaba, der alte Intrigant, gemeldet hatte, Situ verwüste das Nupeland derart, daß wohl im nächsten Jahre keine Abgaben nach Gandu gezahlt werden konnten. Damit trat etwa 1853 wieder Friede in Westnupe ein.
1852-1856. — Mit dem Ganduheere unter Situ war ein außerordentlich tüchtiger Befehlshaber gekommen, ein Haussaführer mit Namen Omar. Dieser Omar war bald durch seine Geschicklichkeit berühmt geworden, und als Situ nach Illorin zurückkehrte, wußte Massaba diesen tüchtigen Mann zu überreden, in seinem Dienste zu bleiben und den Befehl über den Heerhaufen Massabas in Lade zu übernehmen.
Dieser Omar ist in diesem Jahrhundert der zweite wirklich großartig veranlagte Mann, dessen Charakter einige sehr bemerkenswerte Züge zeigte. Omar war ritterlich; das geht aus dem Vertrage hervor, den er mit Massaba schloß, und das geht aus der Art des Zwiespaltes hervor, der ihn später von Massaba trennte. Omar erklärte sich bereit, dem Massaba die Truppen gegen die Nupe zu führen; er bedingte sich dabei einen bestimmten Lohn aus, erklärte aber, sich nicht auf Skiavenraubzüge einlassen zu wollen. Diese Angabe der Nupe ist hochinteressant. Man ersieht daraus, daß auch damals —schon oder noch —vornehmere Gesinnungsart in diesem Stück Afrikas vorkam. Daß die Fulbe im Gegenteil den Omar aber als einen bluttriefenden Tyrannen schildern möchten, entbehrt jeder Begründung. Daß Omar wirklich in seiner Ritterlichkeit auch den Nupe zusagte und daß sie Massaba wegen seiner Grausamkeit haßten, geht daraus hervor, daß sie später Omar gegen Massaba zum Nupekönig wählten und sich ihm anschlossen und ihn erst verließen, als er seinen letzten Pyrrhussieg gewonnen hatte.
Diesen wertvollen Mann also fesselte Massaba, der Fuchs, an sich, und sowie er diesen tüchtigen General hatte, wagte er es zum ersten Male, einen Krieg gegen die Nupe zu führen. Er brach ihn vom Zaune. Er sandte von Lade aus an Edsu Jissa nach Gbarra die Nachricht: "In Zukunft sind alle im Nupelande wachsenden Kolanüsse (die sog. Labodji) an mich abzuliefern." Edsu Jissa ließ sagen: "Mein Vater, der immer ein Freund der Fulbe war, hat die Labodji gegessen. Ich, der ich immer dein Freund war, werde die Labodji
auch essen dürfen." Edsu Jissa wußte noch nicht, daß Massaba den General Omar engagiert hatte.Edsu Jissa erschrak, als ihm gesagt wurde: "Massaba hat Omar gegen dich gesandt!" Omar war sehr gefürchtet. Jissa ging nach Lobodji und befestigte diese Stadt. Aber er vermochte sich nicht gegen den gefürchteten General zu halten. Der Krieg dauerte nur fünf Monate. Edsu Jissas Hilfsquellen waren dann in Labodji erschöpft. Seine Leute flohen. Der König mußte fliehen. Edsu Masa öffnete ihm die Tore Jenis. Jissa schlüpfte unter den Schutz, den der Vertreter der feindlichen Vetternfamilie ihm bot. Die erste Episode dieses Aktes hatte damit ihren Abschluß gefunden.
In dem Kriege gegen Jissa soll nun Massaba mit seinen Leuten immer den Spuren Omars gefolgt sein. Massaba empfing bei den Nupe den Namen Makundulu, Hyäne, weil er überall da, wo Omar das Land unterworfen hatte, sich beeilte, nach rechts und links seine Sklavenzüge zu unternehmen. Massaba muß fürchterlich gehaust haben, denn die Erinnerung an seine Grausamkeiten haftet heute noch im Gedächtnis des Volkes fester als irgendein anderes Ereignis. Aber augenscheinlich hatten die Nupe das Vertrauen zu ihrer Edegidynastie verloren. Das Natürliche wäre gewesen, daß alle alten Familien sich zu gemeinsamem Vorgehen gegen die fremden Eindringlinge, zu Edsu Masa, zusammengezogen hätten, zumal ja auch Edsu Jissa jetzt in Jeni blieb. Aber das Vertrauen nach dieser Seite fehlte. Auf der andern Seite muß schon damals die Achtung vor Omars ritterlicher Kriegskunst groß gewesen sein, denn eine große Deputation von Nupeedlen kam nicht zu Edsu Masa, sondern zu Omar, dem fremden Feldherrn der Fulbe aus dem Haussalande.
Die Nupe sagten zu Omar: "Wir bitten dich, eine Botschaft nach Gandu zu senden. Wir bitten den Emir zu Gandu, dich zu unserem Edsu zu ernennen. Wir werden, wenn Massaba so weiter unsere Familien und Farmen vernichtet, sonst alle zugrunde gehen." Omar aber sagte: "Gut, ich will euch helfen!" Omar hielt Wort. Er wandte seine Heeresmacht zurück und marschierte gegen seinen eigenen Herrn, den Fulbe Massaba. Er ließ ihm sagen, daß Massaba selbst den Vertrag gebrochen habe (?).Von nun ab sei er (Omar) König des Nupelandes. Gleichzeitig sandte Omar eine Nachricht mit eingehender Erklärung nach Gandu. Der Emir von Gandu war zu klug, so schnell eine Entscheidung zu treffen. Er wollte abwarten, auf welche Seite der Sieg fallen würde. Inzwischen ward Massaba nach Mali oder Man gedrängt. Sein Onkel, der Nupekönig von Illorin, nahm dann den Fliehenden auf.
Aber nach Omars Botschaft traf noch eine andere Nachricht in Gandu ein. Madjigi, der erste Fulbekönig von Raba, der daselbst drei Tage nach seiner Bestallung starb, hatte u. a. zwei Kinder hinterlassen,
einen Sohn Moru oder Umoru und eine Tochter Abiba, die unverheiratet blieb. Umoru war mit Usman Saki nach Raba vertrieben. Abiba aber war in Nupe geblieben. Sobald nun Omar den in der ganzen Familie Mauern Dandos anscheinend gleich unbeliebten Massaba vernichtet hatte, sandte sie eine Nachricht an ihren Bruder, die lautete: "Der Haussa Omar hat unseren Onkel Massaba vertrieben. Es ist kein Fulbe mehr im Nupeland. Komm!" Diese Botschaft zeigte so recht das solidarische Gefühl der Fulbe, das übrigens in der Geschichte der Senegal-Nigerländer ebenso klar und deutlich auftritt wie in den Niger-Benuegebieten. "Es ist kein Fulbe mehr im Land"oder "es ist noch kein Fulbe im Land" ist immer die Aufforderung, einen Angelhaken auszuwerfen, der die betreffende Landschaft dem Fulbemagen sichern soll. Umoru machte sich sogleich auf den Weg. Er traf in Mali oder Man ein und sammelte hier die Weiber, Kinder und Sklaven Massabas auf. Er sandte diesen Besitz seinem Oheim nach Illorin und stieß dann mit dem von Gandu mitgebrachten Volk zu Omar.Eine Aufklärung zu gewinnen über das Verhältnis, in dem Omar und Umoru anfangs standen, und darüber wie sich dasselbe umbildete und entwickelte, war ganz außerordentlich schwierig. Die Angaben der Fulbe und Nupe waren sehr widersprechend. Aber ich glaube, aus allen Mitteilungen den einen Schluß ziehen zu können, daß nämlich Omar durch die Ankunft des Prinzen nicht sehr beglückt war und auch wohl nicht sein konnte.
Wenn Umoru auch wohl nicht als offizieller Gesandter des Gandu-Emirs, als Familienersatz für den augenblicklich unmöglich gewordenen Massaba übersandt wurde, so lag doch in den Empfehlungen, die er mitbrachte, und in dem reichen Troß, den der Emir ihm mitgegeben hatte, ein Wink für Omar, der summa summarum, wenn auch nicht in Worte gefaßt, lautete: "Du bist ein tüchtiger General, aber wenn es sich darum handelt, einen König einzusetzen, dann wollen wir Fulbe doch lieber einen aus unserer Mitte haben."Und Omar folgte dem Winke. Er sagte zu Umoru: "Wenn ich hier Seki oder Edsu werde, sollst du mein Jerima oder Saba sein!" Und der Fulbe Umoru soll darauf geantwortet haben: "Ich glaube nicht, daß du das willst!" — Dieses in der Tradition bewahrte Gespräch und seine einfache Überlegung scheinen mir zu belegen, daß das Verhältnis des Generals zum Prinzen von Anfang an kein sehr erfreuliches gewesen ist.
Im übrigen erwies sich Umoru, der spätere fürchterliche Emir Umoru, schon damals im Intrigenspiel seiner übrigen ehrenwerten Familie durchaus ebenbürtig. Er sandte an Edsu Jissa, der zu Edsu Masa geflohen war, heimlich und ohne Kenntnis Omars eine Botschaft, die lautete: "Wenn du König über Nupe werden willst, so
liefere uns Edsu Masa aus, komme uns entgegen. Richte deine Botschaft an Omar."Omar hatte erst nach dem Kriege mit Edsu Jissa in Ischegi oder Etschegi bei Sagbe und Kutigi gelegen. Er hatte sich dann bei Tatungbafu bei Dabba gelagert und hielt dieses Lager ein Jahr. Hier traf Umoru zu dem General. Hier spielte sich die oben entwickelte Besprechung ab. Von hier aus sandte Umoru seine verräterische Botschaft an Jissa. Hier traf auch Edsu Jissas Antwort aus Jeni ein. Edsu Jissa ließ Omar sagen: "Mein Vater war ein Freund der Fulbe. Edsu Masas Vater Zado war ein großer Feind der Fulbe wie kein zweiter. Ich will euer Freund sein und weil ich glaube, daß ihr mich ebenso freundlich bedenken werdet wie meinen Vater, sage ich dir, Omar, daß Edsu Masa einen Krieg gegen dich plant und der Edsu in ganz Nupe werden will. Komm also!"
Und Omar fiel geradeso auf die List Umorus herein wie der dumme Edsu Jissa. Er setzte sich mit Umoru und seinem Heere in Bewegung und traf prompt in Etzegi(ng), das etwa zwei englische Meilen von Jeni entfernt liegen soll, ein. Die Nupe forderten nun Edsu Masa auf, gegen den Feind zu ziehen. Anscheinend hätte die Sache zunächst nicht schlecht gestanden. Aber Masa hatte allzuwenig vom kriegerischen Geiste seines Vaters geerbt. Er selbst blieb mit seinen Kerntruppen in dem wohlbefestigten Jeni. Er sandte kleine Kriegshaufen hier und da zur Beunruhigung des Lagers von Etzegi(ng) aus und schob dadurch die Entscheidung während sechs Monaten hinaus. Dann aber entschied eine große Verräterei den Untergang der Edegidynastie ein für allemal.
Eines Tages lief Edsu Jissa aus der Stadt Jeni, in der Masa ihm großmütig Unterkunft gewährt hatte und zeigte Omar den Weg in die Befestigung. Omar holte zu einem gewaltigen Streich aus. Die Nupe wurden geschlagen. Sie flohen Hals über Kopf nach Kpatatschi bei Lieba. Edsu Masa floh ganz allein zu Pferde aus Jeni. Er erreichte glücklich Sugurma. Hier sah ihn eines Tages ein Haussa. Der Haussa erkannte den König und schlug ihm auf dem Marktplatze unversehens den Kopf ab. Den Kopf brachte er Omar. —So endete der letzte König aus der Edegidynastie.
Damit war die Nupemacht endgültig gebrochen. Die alten und edlen Nupeleute flohen über den Niger zu den Borgana Borgus. Sie nahmen den Weg über Bussa. Dort drüben ernannten sie nicht wieder einen Edegisprossen zum König, sondern Baba, den Sohn Schaibus. Die Wahl fiel auf ihn, weil Schaibus Frau, Babas Mutter, eine Borgana war, und damit hofften die Nupe eine freundliche Beziehung zu ihrem derzeitigen Gastherrn zu gewinnen.
Der treulose Jissa wurde von Freund und Feind verachtet, er lief immer in Omars Gefolge und starb als mißachteter Mann in Bida.
1856-1859. Dann zog Omar nach Mofange, von Mofange nach Modschupa ins Kambarriland. Er unterwarf die Landstriche, machte dann Kehrt und maschierte nach Satagi, dann nach Mule und endlich nach Egbe (ng) oder Egbei nahe Sugurma. Als ich die ersten Berichte über diese Episode hörte, fiel mir schon eine eigentümliche Inkonsequenz auf. Während in den vorhergehenden Zeiten Omar in der Tradition der Völker als eine ganz außerordentlich sympathische Figur erhalten ist, machen ihn viele Erzählungen für die Zeit nach der Vertreibung der Nupekönige zu einem Scheusal ersten Ranges, einem Bluthund. Daß es sich hier um irgend etwas ganz Außerordentliches handelt, geht daraus hervor, daß die Nupe kurze Zeit später von Omar abfielen.Glücklicherweise erzählte mir ein gesprächig gemachter, auf die Zeit seines Volkes stolzer Fulbe, wie der Vorgang in Wahrheit war. Genau wie vordem Massaba, so zog auch jetzt Umoru, der Prinz, hinter dem Soldatenkönig her. Und genau wie vordem der Oheim Massaba, so vernichtete jetzt der Neffe aller Orten jenes Besitztum. Umoru, der wahrscheinlich der grausamste aller Fulbeführer in Nupe war, begnügte sich nicht mit der Ausraubung der Eingeborenen und mit dem Einfangen von Sklaven. Umoru ließ Menschen zusammenbinden und ins Feuer werfen. Er stieß alten Leuten die Augen aus, schnitt Geschlechtsteile ab, goß Häuptlingen flüssiges Eisen in den Mund; einmal trieb er einer Frau, die nach alter Sitte eine Ortschaft regierte, einen Eisenpfahl in die Geschlechtsteile und sagte: "Mit diesem Geschlechtsglied wirst du mir einen eisernen Sohn gewinnen!" Alle diese Scheußlichkeiten beging er aber "im Auftrag des Edsu Omar". Umoru ging dabei mit der raffiniertesten Schlauheit vor, die man sich denken kann. Einmal fing er öffentlich, "im Auftrag Omars" einen hochangesehenen Mann ein. Der Mann ward in der Sonnenhitze an einen Pfahl gebunden. Nachts schlich sich dann Umoru zu ihm, schnitt ihn los und hieß ihn schnell fliehen; auch dürfe es nie jemand erfahren, daß er, Umoru, aus gutem Herzen gegen den Willen Omars den Mann freigelassen habe. Derart wußte er Omars angesehene Stellung zu untergraben. Umoru sagte zu den Nupeführern: "Früher war Omar milde, bis ihr ihm geholfen habt, die Nupekönige zu vertreiben. Jetzt aber will er das Land ausrauben. Ich muß für ihn alles wegnehmen und wegfangen. Ich muß ihm alles abliefern. Omar ist schon ein reicher Mann. Omar wird hier noch alles vernichten."
Umoro bereitete sein Feld sorgfältig vor. Immer mehr Nupeführer schlossen sich den nächtlichen Versammlungen, die er veranstaltete, an. Die Verschwörung wurde auch so geschickt geheimgehalten, daß ihre Frucht voll ausgereift war, als Omars Faust zu schütteln begann. In Egbei hörte Omar von den Räubereien Umorus. Er rief den
Prinzen zu sich und machte ihm Vorhaltungen. Umoru warf aber die Maske des Bescheidenen ab und beschimpfte Omar. Umoru sagte: Omar, er, Omar, habe hier nichts zusagen, könne nie Königwerden, denn sein Vater sei nur ein Krämer gewesen; wenn der Krämersohn auch als Feldherr eingesetzt sei, so werde er doch nie etwas ihm, dem Umoru, dem Sohn der Fulbe, des ersten Fulbekönigs in Umoru, vorschreiben können.Der Feldherr rief zu den Waffen. Der Feldherr Omar wollte Umoru und seine Fulbe- und Ganduleute verjagen, wie er schon Massaba verjagt hatte; da mußte er wahrnehmen, daß seine Leute ihn im Stich ließen. Alle Nupe gingen zu Umoru über. Omar war verraten. Umoru verjagte seinen Feldherrn. Omars Flucht wurde mir von einer alten Frau sehr anschaulich geschildert. Omar war in einem letzten Gefecht, das er gewagt hatte, nach Daba verdrängt worden. Er sagte seinen letzten Getreuen nachts, sie sollten sich halten und nicht schlagen. Sie sollten sich vor Umorus Truppen immer zurückziehen, bis er mit einer neuen Macht, die er nun sammeln wollte, wiederkehre. Dann floh der Feldherr, nur begleitet von seiner Frau und seinem Sohn Albadji, nach seiner Vaterstadt Kamuku. Dort warb er. Es scheint in jenen Zeiten nach den Fulbehaussakriegen und bei dem Vordringen dieses Staatengründers nach Adamaua usw. sich eine Art Landknechtstum ausgebildet zu haben, eine Art Söldnerberuf. Diese Söldlinge liefen bald zu dieser Partei, bald zu jener, immer dahin, wo am reichlichsten Beute zu erhoffen war.
Omars Name war nun damals schon berühmt in den Haussaländem. Sein Aufruf führte nicht nur eine bedeutende Macht zusammen, sondern zog wie ein Magnet auch nachher noch Leute zu sich, als er wieder im Nupeland angelangt war. Bei seinem Eintreffen lag Umoru selbst in Edjigi, sein Heer aber bei Tatung. Omar drang auf dieses Heer ein und warf es nach Daba zurück, griff es hier nochmals an und drängte es nach Sakbe. In Sakbe stieß zwar Umoru zu seinen Leuten, aber viele Nupe und alte Omaranhänger hatten sich doch mittlerweile den Fall schon näher überlegt und waren zu der Überzeugung gekommen, daß es doch wohl mit Umorus Warmherzigkeit gegenüber den Nupe so eine Bewandtnis habe. Viele Nupe liefen hier in Sakbe schon zu Omar über.
Bei Sakbe kam es dann zu einer wirklichen Schlacht. Auf beiden Seiten soll hier mit großer Tapferkeit und schweren Verlusten gekämpft worden sein, und wenn Omar siegte, so war es entschieden ein Pyrrhussieg. Es war offenkundig, daß seine Söldlinge einmal die Masse der Nupe, die vor Umoru stand, zurückdrängen konnte, zweimal aber nicht. Denn der Söldlinge Gewinn und Vorteil bestand darin, daß der Feind in rasender Flucht weglief. Dann konnte man Beute und Sklaven machen und plündern usw. Aber Omar vermochte
nicht die Nupe und Fulbe in die Flucht zu schlagen. Er drängte sie gewaltig beiseite. Aber dann zog Umoru, anscheinend sehr wohigeordnet, über den Kaduna nach Bida zurück. Als der Feldherr das gesehen hatte, soll er sehr traurig gewesen sein. Als er in sein Lager kam, begrüßten ihn alle Männer und Weiber jubelnd als Sieger mit dem Zuruf: "Saki! Saki! Saki !" Omar stieg ab, ging zu seiner Frau hinein und sagte: "Packe deine Last. Gehe zu deiner Mutter zurück. Mit diesen Soldaten werde ich nicht zweimal gewinnen können." Wenn dieser kleine Zug wahr ist, so wirft er wieder ein klares Licht auf die Ungewöhnlichkeit dieses "Negers". Ist er aber erfunden, so ist die Erfindung sehr gut in das Bild eingefügt, das das Volk sonst von ihm hat.Genau so wie Omar sah auch Umoru die Sachlage an. Er schlug in der Nähe Bidas sein befestigtes Lager auf; während Omar Bida selbst besetzte und auszubauen begann. Das Lager Umorus lag auf dem Hügel, auf dem heute die englische Residenz sich befindet. Umoru befestigte das Lager. Omar griff aber diese Befestigung an und Umoru zog seine Truppen heraus. Er überließ die befestigte Stellung dem Feinde und zog sich selbst nach Bida hinein, welches er weiter ausbaute. Somit tauschten sie die Stellung aus. Übrigens benutzte Umoru die Zeit von fünf Monaten, die er der feindlichen Macht gegenüberlag, so gut wie möglich aus. Er sandte an sämtliche Angehörige seiner Familie Botschaften. Zuerst schickte er an Usman Saki nach Gandu die Botschaft: "Komm jetzt! Der Sieg ist bald gewonnen. Ein Nupekönig ist nicht mehr. Bring aber doch lieber Edsu Babu mit, du sollst dann Emir von Nupe sein." An Massaba nach Illorin aber schickte er die Nachricht: "Wir wollen unsern alten Streit vergessen. Das Emirat von Nupe ist eine allgemeine Fulbesache. Deshalb muß dein Bruder Usman Saki jetzt Emir werden. Der Sieg wird bald gewonnen sein. Komm also!"
Der schlaue Umoru wird wohl ganz genau gewußt haben, daß er sich auf das wirkliche Kommen seiner Oheime nicht verlassen konnte, daß diese vielmehr wie die Aasgeier aus sicherer Ferne aufpassen würden, bis der Löwe wirklich verschieden sein würde. So kam es auch. Aber doch hatte Umoru eine Absicht, die er auch vollkommen erreichte: Die Aasgeier hüpften um einige Flügellängen näher, als sie Wind von dem Todesröcheln bekamen. Und das erschreckte nicht Omar, wohl aber die Nupe.
Usman Saki brach von Kabi bei Gandu, wo er nun elf Jahre im Exil gelebt hatte, auf. Ein Beamter des Gandu-Emirs begleitete ihn. Er sandte eine Botschaft an Edsu Babu. Edsu Babu, der auch von der Konzentration der Fulbe hörte, stellte seine ganze Macht Usman Saki zur Verfügung. Und Usman Saki sandte diese Truppen, die aus den letzten Anhängern der Madjiafamilie bestanden, in der Richtung
nach Bida ab. Usman Saki folgte diesen Truppen in guter Entfernung. Erst im letzten Moment traf er auf dem Felde der Entscheidung ein. Ähnlich machte es Massaba. Die Illorinfulbe stellten ihm einige Truppen, und Massaba sandte sie vor sich her. Er schickte die Truppen zu Umoru nach Bida und blieb als vorsichtiger Mann in der Ortschaft Edschu am Niger.Als Umoru sich so einerseits mit Truppen, vor allem aber durch das Gerücht vom Heranrücken weiterer Fulbeführer gestärkt sah, holte er zu einem letzten Schlage aus. Er rief alle Nupeführer zusammen und sagte ihnen: "Wenn ich noch einmal geschlagenwerde, dann werdet ihr diesen Omar mit seinen Straßenräubern zum Herrn haben. Dann müßt ihr euch eines solchen Herrn schämen. Wenn ihr mich verlaßt, werde ich vielleicht geschlagen, dann werden aber die andern Fulbe und Edsu Babu kommen und euch vernichten!"
Es kam zur Schlacht. Omar lagerte am Tscheckten, Umoru am Landribach. Dann griffen die Nupe Umorus die Söldlinge Omars an. Omar ward geschlagen. Er zog sich zum Bakobache zurück. Die Flucht ward allgemein. Als Omar mit seinem Pferd durch den Tschatschakabach schwimmen wollte, wurden Roß und Reiter von den geschwollenen Wellen fortgerissen. Seine Leiche ward von zwei Soldaten Umorus aufgefischt, die sie dem siegreichen Fürsten brachten. Dieser ließ sie enthaupten und den Kopf auf dem Wall Bidas aufstellen. Die einzig wirklich edle Erscheinung in dieser Geschichte von hundert Jahren verkam wie eine ersäufte und aufgespießte Ratte.
Das Nupeland hatte aber seine Zwingherren endgültig. Das war im Jahre 1857.
1857-1859. Usman Saki. — Der große Eroberungskrieg war zu Ende. Edsu Babu, dem falsche Versprechungen gemacht waren, sah sich gänzlich eliminiert. Er verkroch sich an den Grenzen "seines" Reiches und wartete auf bessere Zeiten. Umoru aber, der wirkliche Sieger in diesem Kriege, ließ nun seine Brüder zu sich kommen. Er sagte: "Usman Saki ist von uns der älteste. Usman Saki ist von Mauern Hallelu noch zum Emir von Raba bestimmt gewesen. Er war sechzehn Jahre Emir in Raba. Wir wollen ihn nun zum Emir von Bida machen. Wenn du, Massaba, nun damit einverstanden bist, dann will ich dich als zweiten anerkennen und dritter sein." Damit waren die andern zufrieden. So ward, während Edsu Babu in Zuafu (im Abevaland nahe Bokani), Usman Saki König von Nupe.
Usman Saki war dann zwei Jahre König. Er lebte mit den Nupe in Frieden, und blieb überhaupt immer in Bida ansässig. Nun sandte er seine Brüder zur Fehde aus, denn das "wirtschaftliche System" dieser Reichsgründer beruhte auf Sklavenkriegen und Lösegeldern. Zuerst
brach Umoru allein auf. Er hatte einen tüchtigen Kameraden in Naqua Madje, einem Sohn des Sokotofürsten. Naqua Madje hatte nur zwanzig Pferde, soll aber ein sehr tüchtiger Krieger gewesen sein. Mit diesem zusammen führte Umoru einen fröhlichen Kriegszug ins Gwariland, und zwar erhob er das dort gelegene Buji zum Ausgangspunkt seiner Razzien.Dann kehrte er nach Bida zurück und bereitete eine zweite Kampagne vor, auf der ihn diesmal auch Massaba begleitete. Die beiden Fulbe bezogen in Dem bei Minna ein Lager. Aber kaum hatten sie die Vorbereitungen zum ersten Kriegszug getroffen, so erreichte sie die Nachricht vom Tode Usman Sakis. Massaba wollte nun eiligst nach Bida zurückkehren, um sich krönen zu lassen. Aber Umoru überredete ihn, noch hier zu bleiben, er könne auch im Kriegsiager zum König erhoben werden. So ward es. Die Fulbe stürzten erst auf Minna. Ein Teil der Eingeborenen eilte fliehend auf die Berge und wurde da durch Aushungerung vernichtet. Ein anderer ward gefangen und versklavt. Minna ward zerstört. Dann kehrten sie nach Bida zurück.
1859-1873. Massaba. —Massaba ward auf einem Kriegszuge Emir. Die Periode seiner Emirates war dementsprechend. Der Emir von Gandu bestätigte ihn nach seinem Eintreffen in Bida. Dann folgten drei Jahre des Friedens.
Das Blut der Erobererzeit wallte aber noch. Drei Jahre nach seiner Ernennung zum Emir beschloß Massaba eine große Unternehmung zur weiteren Ausdehnung des neuen Nupereiches. Er richtete sie nach Südosten, in welcher Gegend noch außerordentlich wohlhabende, kulturstarke und kulturalte Völker wohnten. Massaba schlug in Kwalleke ein Lager auf und Umoru mußte nach allen Seiten Raubzüge in die Gebiete der Bassa, Igbirra und Korro unternehmen. Umoru verwüstete in gewohnter Weise den Wohlstand dieser Länder aufs gründlichste und machte den ganzen Länderstrich tributpflichtig. Massabas Plan der Ausdehnung seiner Macht war somit nach dieser Richtung erfüllt. Er sagte aber: "Ich will selbst den Ukarifluß (den Fluß, an dem Wukari liegt) sehen!" Und somit machte er selbst im Gefolge des siegreichen Umoru einen Inspektionsritt bis Wukari und kehrte dann nach Bida zurück. Im ganzen währte der Krieg fünf Monate.
Kurze Zeit nachher stieg in Massaba neue Wanderlust auf. Er beschloß eine Reise nach seiner Vaterstadt Gandu. Er brach auf und kam mit seinem prächtigen Gefolge bis Kontagora. In Kontagora erreichte ihn die Nachricht vom Verscheiden des derzeitigen Gandukönigs Hallelu. Somit kehrte er um und nach seiner Hauptstadt Zurück. Ein Jahr weilte er nun in Bida, ohne Wanderungen und kriegerische
Unternehmungen zu beschließen. Dann aber tauchte im Südosten eine bedeutende Gefahr für das Nupereich auf.Massaba hatte selbst nach Süden die Ausdehnung Nupes durch Eroberung der Länder der Jagbatschi und der Bunu vervollständigt. Dieses Vorgehen der Nupefulbe und auch der Illorinfulbe hatte eine gewisse Gegenbewegung von seiten der Joruba zur Folge. Vor allem tat sich ein ganz großer Sklavenjäger und -händler der Joruba Ibadans, ein gewisser Adje hervor. Dieser Adje hatte eine Kriegsmacht von etwa viertausend Flinten und da er außerdem der Waffen- und Pulverzufuhr von der Küste her bedeutend näher wohnte als die Nupe und Fulbe, so war sein Auftreten in Bagi im Akokolande (nahe Bunu) für letztere durchaus nicht unbedenklich. Die Leute Adjes standen zudem im Rufe jugendlicher Kraft, Frische und Unbeugsamkeit. Also schlossen sich alle Fulbe zusammen, sobald die Nachricht von dem weiteren Vordringen Adjes nach Norden drang. Sollte doch einem Gerücht zufolge Adje auch mit dem letzten, mißvergnügten, weil verdrängten Nupekönig, mit Edsu Baba, in Beziehungen wegen eines Trutzverhältnisses gegen die Fulbe getreten sein.
Sogleich sandte Massaba Umoru gegen Adje und regelte auch einen regelmäßigen Nachschub von Waffen, Munition und Truppen über den Koarra. Fernerhin rückte Usman Lufadi der Mejaki dem Herrn von Illorin zur Hilfe heran, so daß sich Adje bald arg bedrängt sah. In seiner Not sandte Adje eine Botschaft an den Bale von Illorin. Adje gab trotz der Vorzüglichkeit seines Fußvolkes bei dem Vorrücken dieser Reitermassen den Widerstand auf. Sein Gesuch an den Ibadan König ging dahin, zu intervenieren und Frieden zu stiften, ehe der eigentliche Krieg ausbrechen würde. Ogumula-Are, der König (are-Bale) von Ibadan, erklärte sich hilfsbereit und sandte an Umoru die Nachricht, daß er Adje aus dem Akokolande nach Ibadan zurücknehmen wolle, wenn die Fulbe vom Kriege ließen. So geschah es denn auch, denn die Fulbe fühlten sich dieser Macht gegenüber durchaus nicht ganz sicher. Der Zug ward abgebrochen. Umoru kehrte nach Bida zurück.
Aber Umoru war noch keine vier Freitage nach Bida zurückgekehrt, da traf wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel die Nachricht vom Aufstande der gesamten Transkaduna in Bida ein. Anstifter waren einige alte Nupehäuptlinge, denen die Art der Abgabeneinziehung der Fulbe durch Wegfang armer Leute nicht zusagte. Die Alten hatten den Edsu Baba aufgestachelt, sich zu erheben, und insgeheim war die Angelegenheit sehr geschickt angelegt, als Umoru ins Akokoland abgereist war. Der einzige alte Nupe, der das Fruchtlose dieses Unternehmens einsah, war der Ndeji (Älteste) des Königs Baba. Er wohnte in Boada. Von Boada sandte er eine warnende Nachricht an Baba, der in Egbe (oder Egbeng) residierte. Edsu Baba
antwortete darauf, indem er mit seinen Truppen von Egbe aufbrach und gegen Boada zog. Der Ndeji floh. Er eilte nach Bida zum Fulbeherrscher, und dieser sandte sogleich einen Kriegshaufen unter der Anführung eines gewissen Massalatschi gegen die Aufständigen. Die Hauptmasse der Truppen sollte folgen.Es war das aber in der Höhe der Regenzeit und die Nupe hatten nicht ohne Berechtigung geschlossen, daß in dieser Zeit die Kriegsführung nicht ganz so leicht sein würde. So kam es denn, daß die Hauptmacht Massabas in Jipa Lager beziehen mußte. Aber Massaba wollte nicht lange zögern. Er forderte den Wasserhäuptling Kuta von Moregi auf, Boote auf dem Koarra zu stellen. Er rüstete also eine Flotte aus, die vor allem auch reichlich Pulver ins Aufstandsgebiet bringen sollte. Tschoada, Kutas Bruder, wurde der Admiral dieses Vorstoßes. Aber Tschoada war nicht vorsichtig genug. Er näherte sich allzusehr dem feindlichen Gestade. Babas Leute warfen einige geschickte Schüsse, und das Pulverschiff explodierte. Tschoada kam ums Leben.
Als Massaba das hörte, kam er selbst nach Jipa. Er brachte Umoru mit und übertrug dem die Heeresführung. Umoru rückte nach Bjegi, ward der Situation aber nicht Herr, so daß Massaba zum zweitenmal auf die Kampfwiese kam und nach Kascheka rückte. Umoru aber legte einstweilen den Oberbefehl über seine Truppen in die Hände seines Bruders Kotu. — Inzwischen konzentrierte sich die Nupemacht in Nuele (oder Nuelo). Nur der feige Baba selbst war nicht dabei. Er war in Egbe (Egbeng) geblieben. Massaba war nun wieder in Bida, und Umoru leitete die entscheidende Schlacht ein.
Diese Schlacht spielte sich am Ekaflusse, an dem auch Sugurma liegt, ab, und zwar bei der Stadt Bedja. Als Umoru ankam, fand er sie so gut wie menschenleer. Umoru setzte über und kampierte nachts auf dem andern Ufer. Die Nupe folgten am andern Ufer, und zwar ließen sie ihre Pferde beim Übergang zurück. So hatte Umoru bei seinem plötzlichen Angriffe die Sache leicht. Babas Heer ward geschlagen. Umoru schlachtete viele Menschen und nahm ebenso viele gefangen.
Edsu Baba, dessen Kriegsführung hauptsächlich im Fliehen bestanden zu haben scheint, zog sich auch hier schnell genug über den Koarra zurück nach Liaba. Umoru rückte erst wieder in Massabas Hauptlager und von da aus mit frischen Truppen ins Sugurmagebiet. Nun erfolgte die Bestrafung der Anführer. Es sollen 703 Ortschaften in weitem Umkreise um die ebenfalls der Zerstörung anheimgegebene Stadt Sugurma von Grund auf in fulbischer Art zerstört worden sein — es fand ein so grausames Gemetzel statt, daß der Rest der Fulbe zu Baba über den Koarra entwich. Mit dieser Hilfe rief Edsu Baba die Joruba, Borgana und andere zum Kampfe auf. Er hatte
wieder ein Heer vereinigt, da tauchten Umoru und Massaba im Kanuja (Bedegebiet in Nupe) auf. Baba hatte den Mut, nach der Liabavorstadt auf dem Nordufer des Niger überzugehen. Da stießen die Heere aufeinander. Der erste Kampftag verlief ohne Entscheidung. Ja, es fiel sogar ein angesehener Nupefürst, so daß die Stimmung in Umorus Nachtlager nicht die rosigste war. Aber dieser Edsu Baba war zu feige. Nachts entwich er über den Niger. Umoru sandte aber an die Joruba Babas eine Botschaft: "Kennt ihr kein Geld?" Die Joruba sagten: "Wir wollen doch Geld!" Antwort: "Dann fangt Babas Leute und macht Sklaven!" So wurden Babas Jorubaverbündete die schlimmsten seiner Verfolger. Umoru machte einen Vorstoß über den Niger, und es entstand eine allgemeine Sklavenfängerei. Dann ging Umoru zurück, nach Kanja, wo Massaba noch immer das Hauptlager innehatte. Edsu Babas erster Versuch, sich zu erheben, war gescheitert.Die in Kannja oder Kanja vereinten Nupefürsten kehrten aber nicht nach Bida zurück. Es entwickelte sich damals im Anschluß an den Nupeaufstand Unruhen im Jauri-Kambellilande. Jauri gehörte nicht zum Nupeemirat. Es regierte da ein eigener Fulbe mit Namen Memadu Me Karifi, ein Rigio (oder Riglio), der der Kämpfe offenbar nicht allein Herr ward. Kotu blieb im Hauptlager. Massaba stieß nach Saka im Kambellilande vor, folgte dann aber einer Einladung des Jauriemirs und ging nach Mamba. Darauf erhob sich der in Ibeto ansässige Oberhäuptling der Kambelli, Ibellu. Ibellu versuchte bei Fulbe Madu Mekarifi und Massaba zu bekriegen, aber Massaba wandte sich gegen ihn und der Jauriemir trieb ihn fort.
In jenen Tagen vereinigten sich dann viele Fulbe in der Stadt Ibeto im Kambellilande. Es waren da Massaba und Umoru aus Bida, es war da der Emir Mamadu Mekarifi aus Jauri-Mamba. Dann kam aus dem Süden der Jorima des Illorinreiches, Alleu mit Namen, der selbst nie König wurde, aber der Vaterbruder des nachfolgenden Königs Mama und Vater des abermals folgenden Königs Sule war. Alleu brachte die Abgabe für Gandu (Abgabe: Edu; Haussa: Gandu; Joruba: Oole). Dann kam aber auch der Mauro (Tributeintreiber; Nupe: Tutschi; Joruba: Oni-pasche) aus Gandu, nahm von den Vertretern aller dreier Emirate den Sandu in Empfang und kehrte heim.
Auch die andern trennten sich. Massaba kehrte mit Umoru nach Bida zurück, das keiner der beiden zu Massabas Lebzeiten wieder verließ; wenn Massaba auch noch mehrere Kriegs- und Sklavenzüge in das Kukuruku-(Ig)birra- und Akokoland aussandte.
1873-1884. Umoru. — Zu Massabas Zeiten erreichte Nupe die größte Ausdehnung, eine Form, die es nach allgemeiner Volksvorstellung als Emirat heute noch hat, wenn England die Verwaltung
durch Abtrennung vieler Provinzen auch gänzlich geändert hat. Im Norden gehörten zweihundert Kambelli- oder Kambarriortschaften zu Nupe, die andere Hälfte zum Emirat Jauri. Ebenso zahlte von den Gwari die südliche Hälfte an Nupe, die nördliche dagegen, die unter Naqua Madje, also der Kontogoraprovinz stand, an Sokoto Tribut. Die angesehene Stadt Sadi gehörte dagegen zu Nupe. Das eigentliche Reich der Korro oder Korrorofa (Korrorauwa!) war Saria zuzurechnen, wogegen Bassa, westlich Igbirra, alle Kabba oder Bunu, Kukuruku und bei diesen zumal Alagwele oder Alagwete und Jagba (bei Nupe Jagbatschi) zum Nupeemirat gehörten. Ebenso zahlten unter den Joruba die Meri nur an Nupe Tribut, wogegen Ilescha, Ife und Ibadan dem Ojoreiche zugehörten. Am Niger selbst rechnete man Jebba und Tscharagi zu Nupe, Bussa aber zu Borgu, und Borgu wurde von einem wenig bedeutungsvollen Fulbe namens Kaoje regiert.Dies war der Umfang des Nupereiches, das Umoru um 1886 übernahm. Umorus Vorleben war nicht derart, daß er zu einem friedlichen Emir prädestiniert gewesen wäre. Das erste Jahr seiner Regierung verbrachte er in einem Kriege mit Igbirra, den er im Bündnis mit Igbadan- und Illorinleuten führte. Im nächsten Jahre trieb ihn ein Befehl aus Gandu gegen Djirro im Haussalande, und nachher sehen wir ihn auf eigene Rechnung gegen den Häuptling Anifi von Oka im Okokoland aufbrechen. Dieser Kriegszug ward während fünf Monaten betrieben, und von den vergifteten Pfeilen der Akoko fielen viele Nupe. Umorus Leute kamen in eine gefährliche Lage, aber die alten Nupeedlen überschätzten die Schwierigkeit. Sie reizten den braven Edsu Baba auf, sich nochmals zu erheben, und vergaßen, daß Edsu Baba alt, daß Nupe kriegerisch verbraucht und die Fulbeherrschaft genügend befestigt war. Die größte Torheit beging anscheinend der Emir von Kontagora, Bubaker, der Sohn Naqua Madjis, der alte Kampfgenosse Umorus. Er muß mit seinen alten Nupefreunden zerfallen gewesen sein. Jedenfalls unterstützte er den dummen Edsu Baba Bubaker. Als echter Fulbe sandte er allerdings an Umoru die Mitteilung, daß Edsu Baba einen neuen Kriegszug begonnen habe.
Umoru empfing die Nachricht von der neuen Erhebung der Nupe in Oka. Sogleich brach er den Akokokrieg ab und eilte heim. Edsu Baba war nach Mokwa gegangen, von da nach Laboji, und hier hatte er alle seine Leute versammelt. Als dann aber Umoru von Bida her nahte, floh er nach Sugurma. Die Fulbearmee zog nach Liaba, dem alten Stützpunkt Edsu Babas, und hier fiel denn auch Edsu Baba seinem Schicksal anheim. Der letzte König der Nupe wurde getötet.
Diesen Krieg führte Umoru nicht selbst, Maliki, der Sohn Usman Sakis, war sein Mejaki und Saba. Maliki führte den Vernichtungskampf
am Koarra, und es wird behauptet, daß der erste Europäer in Lokoja oder Gbaebe (Maibirra?) zwei Dampfer zur Verfügung gestellt haben soll, auf denen Maliki übersetzte und gegen die Aufrührer vernichtende Schläge führte. Jedenfalls war dieses Aufbäumen der Nupe ebenso Sinn- wie erfolglos.Eine Einzelschilderung aus diesem Kriege verdient aber Beachtung, weil sie ein scharfes Licht auf diese in diesen Ländern übliche Kriegsführung wirft. Es war die Nachricht, daß Edsu Baba in Mokwa Unterkunft gefunden hatte, natürlich auch nach Bida gelangt. Darauf sandte Umoru einen Fulbe namens Usman Zadu mit vier Reitern nach Mokwa zur Erkundung. Die erbosten Mokwaleute packten die Boten und schlugen sie in Fesseln. Dann schlugen sie ihnen die Köpfe ab. Umoru ward das hinterbracht. Er sandte sofort einen Kriegshaufen und ließ Mokwa ausnehmen und zerstören. Man brachte den (heute noch lebenden) Lilie und alle angesehenen Leute nach Bida. In Bida wurden dem Lilie Makulo, dem Schechu Magani, dem Goro Dadan und dem Mama Mdatschako die Köpfe abgeschlagen und die blutigen Häupter auf dem Marktplatze aufgestellt — auf den vier Ecken einer erhabenen rechteckigen Tafel. Damit sollte eine Warnung gegeben werden. Alle andern Mokwaedlen, auch der Lilie, wurden nach dem Haussalande in Verbannung gesandt, und von da kamen sie erst nach Eintritt der englischen Okkupation nach Mokwa zurück. —Überhaupt kann man wohl mit Recht sagen, daß beim Eingreifen Englands das Nupeland so gründlich zerstört und entvölkert war wie nur möglich.
Als Maliki in Lafia am Niger gegen die letzten Reste der Nupeempörung kämpfte, starb Umoru in Bida.
1884-1895. Maliki. —Maliki, der Sohn Usman Sakis, eilte heim, ward Nupeemir und als solcher von Gandu bestätigt. Maliki war an sich von allen Fulbe der umgänglichste und menschlichste. Allerdings ließ er Sklavenkriege führen, aber Nupe schonte er. Seine ersten vier Sklavenkriege führte Mamudu, der Sohn Massabas. Das waren: I. ein Krieg gegen die Jagba oder Jabatschi, 2. ein Zug gegen Kotonkarifi am Benue, 3. von Banigi aus ins Bassaland, 4. von Tauari aus ins Bassa- und Igbirraland. Dann starb Mamudu und ernannte Bukari, den zweiten Sohn Massabas, zum Saba und Kriegsherrn. Der führte nun den fünften Feldzug gegen Ibe im Kukurukuland.
Im allgemeinen gilt Maliki als ein großer Freund der Weißen. Er führte als Emir nie einen Krieg.
1895-1897. Bubaker. —Bubaker, der Sohn Massabas, war das Opfer Mamadus. Mamadu, der heutige Emir und Sohn Umorus, der seinem Vater durchaus ebenbürtig, verfiel dem Andrang der Engländer.
Mamadu war damals schon ein Intrigant sondersgleichen. Bukari trug die Kosten und ward zum Emir ernannt. Er starb Januar 1901 in der Verbannung in Lokoja.1897-1912ff. — Im Jahre 1897 ward Bukari abgesetzt. Mamadu ward Emir und ist es noch heute. Die Geschichte seiner Regierung werden am besten die Engländer schreiben können. Ich habe noch nie einen so knickerigen König kennengelernt wie diesen Mamadu.
15. Kapitel: Traditionen der Mossi*
Der Chronist Abderahman Ben Abdallah Ben Imran Ben Amir Es-Sadi teilt in seinem Geschichtswerke mit, daß Timbuktu im Jahre 1329 von den Mossi zerstört wurde. Die Tradition der Mossipriester gibt an, daß die Zerstörung von dem eigentlichen Gründer des Mossireiches, von Uidi Rogo ausgeführt wurde, daß der Herrscher dies im vierzigsten Jahre seiner im ganzen vierundfünfzig Jahre währenden Regierungszeit ausführte, und daraus geht hervor, daß die Entwicklung des Mossireiches im Jahre 1289 ihren Anfang genommen hat.
In diesem Jahre 1289 gab es in den östlichen Gebieten des Nigerbogens vier Reiche, nämlich:
1. das Songhai-Reich, welches sich von Niameane stromaufwärts am Niger hinzog und im Westen an das Mande-Reich grenzte;
2. das Reich Borgu, das am Niger, südlich des Songhai-Reiches lag;
3. das Reich Bingo (von nördlichen Stämmen Gurina genannt), welches sich westlich von Borgu bis an das heutige Dagombaland erstreckte, und
4. endlich das Gambaka-Reich, welches im nördlichen Teile der englischen Kolonie der Goldküste gelegen war.
Von diesen vier Reichen hatte der Tradition nach Borgu (oder Bussa) die größte Macht besessen. Bingo (oder Gurina) hatte seinen Haupteinfluß über die Länder des Nigerbogens, in welchem seine Heerführer viele Kriege ausführten. Gambaka hatte aber nach der Überlieferung schon damals eine Stadt, in welcher die Diula oder Mande Handel trieben. Im übrigen war das Bogenland südlich des Niger bewohnt von einer Unzahl kleiner Stämme, deren Kulturzustand dem entsprach, wie wir ihn heute noch in der Dafina, der Provinz der Bobovölker, studieren können. Außer den vier Reichen gab es schon einige kleine Provinzen oder selbständige Fürstentümer, die in ihrer Art sehr eigentümlich organisiert gewesen sein
Über die geschichtlichen Ereignisse in diesen Ländern erzählt uns die Überlieferung der Mossi:
1. Bericht der Mossi von Wagadugu1. Uidi Rogo. Der Gambaka-naba hatte eine ganze Reihe von Töchtern, aber keinen Sohn. Einer alten Sitte entsprechend, hatte er seiner ältesten Tochter, welche den Namen Njallanga oder nach andern Jendanga führte, verboten zu heiraten. Dieses Mädchen war vielmehr mit der Aufgabe betraut, als kriegerische Fürstin vor den Soldaten des Gambaka-naba herzuziehen und den Krieg in fremde Länder zu tragen. Nur mißmutig verzichtete die Prinzessin auf die Ehe. Ein Streit entspann sich zwischen dem Vater und der Tochter, und sie bestieg eines Tages in wildem Zorne ihren Hengst und ritt von dannen. Der Streit hatte sich entsponnen um das Recht der Ausplünderung des Quartiers der Mandekaufleute, welche der Gambakanaba durchaus schonen wollte. Die Prinzessin sagte: "Mein Vater, du verbietest mir zu heiraten und erlaubst mir nur Kriege zu führen. Nun aber willst du mir auch nicht mehr meinen freien Willen in der Kriegführung lassen und willst mir nicht erlauben, daß ich diese Mande-Diula, die ich hasse, vernichte. So werde ich denn den Krieg dahin tragen, wo es mir gefällt, und werde meine Sitten einrichten, wie es mir paßt!" Die Prinzessin ritt von dannen.
Sie ritt weit fort, bis in die Gegend des Landes Namba. Dort traf sie einen mächtigen Jäger, welcher der Sage nach entweder Riale oder Riaele oder auch Torse oder Tonsa genannt wird. Er war der Sohn des Königs von Bingo, entstammte also dem uralten Geschlechte der Gurmafürsten. Die Prinzessin verliebte sich, ähnlich wie in der Sage der Kalunda- und Bihestämme, in diesen Prinzen und blieb bei ihm. Der Ehe entsproß dann der gewaltige Recke Uidi Rogo. Das Grab des Stammherrn Tonsa wird mit aller Bestimmtheit an den Ort Komtoiga verlegt.
Uidi Rogo erbte den Haß der Mutter gegen die Mande und gegen die Marenga, wie die Songhai bei den Mossi genannt werden. Er sammelte, sobald er erwachsen war, viele Leute um sich, ward Naba in Namba und begann als Namba-naba seine Feldzüge nach den verschiedensten Himmelsrichtungen. Er drängte überall im Lande die Marenga und die Jarsi zur Seite, gelangte auf diesem Zuge immer weiter nach Norden und erreichte im vierzigsten Jahre seiner Regierung den Niger, überschritt ihn und zerstörte die mächtige Handelsempore des Nordens, das altberühmte Timbuktu. Die Leute von Timbuktu erzählen hiervon heute noch. Sie sagen, daß vordem ein
mächtiges Wasser von der Sahara her an der Stadt Timbuktu vorüber dem Niger zugeeilt wäre, daß Timbuktu im Schatten mächtiger Wälder von Borassuspalmen gestanden und geblüht hätte. Der gewaltige Mossirecke schüttete aber den Fluß zu. Er ließ Wälder mit Beilen umschlagen und den Flußlauf mit den Stämmen und mit Erde anfüllen. Er machte die Stadt dem Erdreich gleich und brachte auf ihren Trümmern der schwarzen Fahne, die ihm vorangeweht hatte, ein Opfer dar. Langsam nur erholte sich Timbuktu von diesem Schlage, langsam nur wuchsen die Palmen wieder empor und konnten so das Holz geben, aus dem später der mächtige Songhaikaiser seine Kriegsflotte baute.Nach diesem Kriege kehrte Uidi Rogo nach dem Süden zurück. Im nördlichen Lande des Nigerbogens ließ er seine beiden Söhne, den Rava-naba und den Sonima-naba, zurück. Es war das ein Geschlecht von mächtigen Recken, die zunächst aber nicht mehr im Zusammenhang mit den nach Süden sich ausdehnenden Mossistämmen wirkten. Die Volkslegende weiß, daß es nicht nur kriegerische Leute waren, die hier aus diesem Stamme entsproßten, sondern daß sie auch große Bauwerke auszuführen verstanden. Sie waren außerordentlich grausam und gewalttätig und zwangen mit aller Macht, über die sie verfügten, die Eingeborenen zu mächtigen Kulturleistungen. Am lebendigsten blieb den Eingeborenen die Erinnerung an den Uamtanangonaba im Gedächtnis, der als Schrecken des Landes und grausamer Vorkämpfer des Mossitums geschildert wird. Man erzählt von ihm, daß er die Gebiete um Nderaogo Djitti und Gurga beherrscht hätte. Da er nun häufig nach Sabunu hin und zurück wanderte, weil daselbst eine Frau wohnte, die er über alles liebte, so veranlaßte ihn die Unebenheit des Weges, der gebirgiges Terrain durchschnitt, eines Tages alle Schmiede zusammenkommen zu lassen. Er verlangte von ihnen, daß sie einen guten Weg bauten. Sie kamen dem Befehle nach und buben einen Hohiweg aus, der nach Kapitän Noirdes übereinstimmendem Bericht vierzig Meter obere und zwanzig Meter untere Breite hatte und der heute noch zu sehen sein soll. Der Fürst war über alle Maßen grausam. Eines Tages traf er eine Frau mit einem Kinde auf dem Rücken am Mörser damit beschäftigt, Korn zu stampfen. Der Naba verlangte, daß sie das Kind im Mörser zerstampfe. Die geängstigte Frau legte das Kind in den Mörser; als es ihr aber fröhlich daraus entgegenlachte, warf sie die schon erhobene Mörserkeule fort, sprang dem Fürsten an den Hals und erdrosselte ihn. So kam er ums Leben.
2. Naba Djungulana. —Während im Norden die Söhne des Reichsgründers in dieser Weise wirtschafteten, setzte Uidi Rogo bei seinem Tode seinen Enkel Djungulana als Groß-naba ein. Dieser führte gegen die Völker im Westen des Reiches die Ursprungskriege. Diese
Stämme nannte man Ninisi. Zuerst versuchte Djungulana den Krieg mit Pfeil und Bogen. Aber der Pfeilkrieg brachte ihm keinen Vorteil. Er vermochte nicht zu siegen. Da wandte er sich an ein anderes Volk, an die Njonjonsi, und sagte: "Wenn ihr euch in einen Wind verwandelt und diese oder jene Stadt umbiast, so will ich euch ein gutes Gericht vorsetzen." Dann verwandelten sich die Njonjonsi in Winde und bliesen die Stadtmauern und alle Häuser der Ninisi um. Oder Djungulana bot den Njonjonsi Ochsen oder Kaurimuscheln, für die sie ihm auch derartige Dienste erwiesen. Man sah damals viele Leute zusammengekauert und mager und ständig schlafbedürftig im Lande umherhocken. Wenn man die Leute aufweckte und fragte: "Was hast du denn?", so antworteten sie: "Das ist die Kunukungu (Schlafkrankheit), die haben die Njonjonsi auf Naba Djungulanas Befehl auf uns herabgeblasen." Viele Leute bekamen geschwollene Beine oder Arme oder sonst geschwollene Körperteile. Das alles war das Werk der Njonjonsi, die sich auf Naba Djungulanas Befehl in Wind verwandelten. Und so drängte dieser Herrscher die Ninisi nach Westen.3. Naba Ubri. — Ihm folgte Naba Ubri, der insofern mit Recht als Gründer des Mossireiches genannt wird, als er die Hauptstadt Wagadugu erbaute. Sein Vorgänger hatte gegen die Stämme im Süden, gegen die Gurunsi, erfolglos gekämpft. Ubri setzte dieses Ringen mit doppelter Kraft fort und war fast ununterbrochen im Kriege; zuweilen verbrachte er vierzig Tage im Busche, ohne ein Dach über sich zu haben. Aber er ruhte nicht eher, als bis er die Gurunsi weit über den Volta nach Westen verdrängt hatte, und pflanzte die Fahne als Grenzzeichen in Boroma auf. Weiterhin eroberte er auf weitausgreifenden Kriegszügen einige Provinzen im Norden. Im Nordosten gelangte er bis zu einem Orte, den man sehr einfach Tenga (d. i. Erde), nachher aber Ubri-Tenga nannte.
Eines Tages wollte Ubri die Stadt Kudugu erobern, sah aber, daß er dazu nicht imstande war. Da befiel ihn die Furcht vor einem schlimmen Ende dieses Krieges und er floh nach Nanjali zurück. Hier befiel ihn eine Krankheit, an der er starb. Seine Leute nahmen den Leichnam auf den Kopf und trugen ihn fort. Sie wollten ihn nach Tenkodugu tragen und dort bestatten, kamen aber mit dem Leichnam nur nach Tenga. Die Leute von Tenga sagten: "Bestattet doch den Naba in unserem Orte!" Sie antworteten: "Nein, wir wollen ihn zurück bis nach Tenkodugu bringen." Die Leichenträger waren aber zu ermüdet, um gleich weiterzuwandern, legten sich hin und schliefen ein. Während sie schliefen, buben die Tengaleute schnell das Grab aus, bereiteten alles gut vor und stahlen den Leichnam des Naba. Das vollbrachten sie um Mitternacht und machten es ganz heimlich. Als die Leichenträger erwachten, war ihr Naba Ubri bestattet,
ohne daß die Leute wußten wo. Da blieb ihnen nichts weiter übrig, als ohne die Bürde weiterzugehen und nach Tenkodugu zurückzukehren. Die Leute von Tenkodugu fragten: "Wo ist der Naba Ubri ?" Die Leichenträger sagten: "Er wollte die Stadt Kudugu angreifen, kehrte dann aber nach Nanjali zurück, wurde dort krank und starb. Wir nahmen ihn auf die Köpfe und wollten ihn hierher zurücktragen. Als wir aber nachts ermüdeten und im Tengagebiete ausruhten, stahlen die Leute von Tenga den Leichnam und bestatteten ihn heimlich in ihrem Orte." —Seit jenem Tage nennt man den Ort nicht mehr einfach Tenga, sondern Ubri-Tenga oder Naba-Ubri-Tenga. Die Eingeborenen des Ortes genießen aber bis heute ein eigenartiges Vorrecht: sie dürfen königliches Eigentum stehlen.4. Naba Sorroba. — Ubri folgte sein ältester Sohn, der Naba Sorroba, dessen erste Handlung war, daß er die Großen des Reiches, also den Uidi-naba, den Lachale-naba, den Gunga-naba, den Tansoba-naba, den Kamsogo-naba und den Ballum-naba zu sich kommen ließ. Nachdem sie aber sechs Tage bei ihm verweilt hatten, sagte der Kaiser: "Ich werde jetzt auf dem Grabe meines Vaters Ubri einen Ochsen schlachten. Hört, was ich euch sage: in Zukunft soll man jedem Mogo-naba (d. h. Kaiser), der gestorben ist, in dieser Zeit einen Ochsen darbringen. Auch soll der Mogo-naba seiner verstorbenen Mutter ein Stück Vieh opfern. Das soll in Zukunft Recht und Sitte sein!" Auf diese Weise war durch Sorroba das Basagafest eingesetzt. — Der Naba Sorroba gab überhaupt viele Gesetze. So richtete er die Sitte der drei Tänze Uarraba, Tschigiba und Uando ein. Er war ein großer Organisator, der sein Leben in Lugusi, südwestlich des Wagadugugebietes, verbrachte.
5. Naba Nasikiemde. 6. Naba Narimtori. —Von den beiden nachfolgenden Kaisern Nasikiemde und Narimtori ist nicht viel zu sagen, wohl aber erfuhr das Mossireich unter dem siebenten Kaiser, dem Naba Nasibirri, eine bedeutende Entwicklung. Unter seiner Regierung haben die beiden Provinzen Kajo und Jatenga, deren Hauptstadt Uahiguja ist, ihre eigentliche Entwicklung erfahren. Es ist hierbei sehr eigenartig und nicht ohne Rechtsstreitigkeiten zugegangen. Um das, was die Eingeborenen sich erzählen, zu verstehen, muß man wissen, daß jedesmal, wenn ein Mossikaiser eine neue Provinz schuf, indem er einem seiner Söhne die Lehnsgewalt über ein zu eroberndes oder neu zu besetzendes Landgebiet übertrug, ein gewisses Zaubermittel von dem Mittelpunkte des Reiches aus leihweise in die neue Stadt getragen wurde.
7. Naba Nasibirri. — Dieser Nasibirri hatte nun außer seinen Söhnen noch eine Tochter, welche Pawere oder Bi-Kajo hieß. Von ihr erzählt die Sage eine Überlieferung, deren Sinn sowohl die Ja. tenga wie die Kajoleute für sich in Anspruch nehmen. Trotzdem
man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, daß die entsprechenden Ereignisse Jatenga betrafen, erhielt ich von Kajoleuten die bessere Version, die ich im folgenden wiedergebe. Sie erzählen, daß es am Hofe des Kaisers Nasibirri ein Zaubermittel gegeben habe, das "Pemtiga" hieß und das, wie alle andern Staatszaubermittel, der Oberaufsicht des Gungu-naba unterstellt war. Dieses Medikament wirkte gegen Pfeilschußwunden, ja auch gegen Pfeilgifte. War jemand verwundet, so brauchte er nur ein wenig von Pem-tiga abgekratztes Pulver auf die Wunde zu streuen, um seiner Genesung sicher zu sein. Oder aber auch, man wandte sich, bevor man in den Kampf zog, an dieses Zaubermittel und sagte: "Wenn ich aus diesem Kampfe unverletzt zurückkehre, so will ich dir ein weißes Huhn zum Geschenk machen." Man war in solchen Fällen des Schutzes Pem-tigas sicher. Nun hatte der Naba Nasibirri der Sitte gemäß seine Söhne mit Gebieten an der Grenze des Reiches belehnt, und zwar da, wo ein ständiger Kampf mit den kriegerischen Alteingeborenen vorauszusehen war. Besonders der in Kajo angesiedelte Sohn war einem stetigen Kampfe ausgesetzt und verlor im Pfeilkampfe mit den Eingeborenen viele Leute, wie auch sein eigenes Leben ständig bedroht war.Da beschloß die Schwester des Kajo-naba, das noch als Pogo-Bi-Kajo in der geschichtlichen Erinnerung sehr lebendige Mädchen, dem älteren Bruder einen Schutz zu verschaffen und ihrem Vater das Zaubermittel Pem-tiga zu rauben. Sie führte ihr Vorhaben in einer dunklen Mitternacht aus. Der Gungu-naba sah das Mädchen, die Kaisertochter, eines Abends bei sich eintreten. Er konnte sich nichts Schlimmes denken. Am andern Tage besichtigte er aber die Reichszaubermittel und fand die Pem-tiga nicht. Er begab sich sogleich zum Mogo-naba und fragte: "Hast du die Pem-tiga an dich genommen?" Naba Nasibirri sagte: "Nein; sind sie nicht mehr vorhanden?" Der Gungu-naba sagte: "Die Pem-tiga sind nicht mehr bei mir. Allerdings sah ich gestern abend die Pogo-Bi bei mir eintreten, ich weiß aber nicht, ob sie etwas weggenommen hat." Der Mogo-naba schickte sogleich Reiter mit dem Gunga-naba ab, um das Entwendete oder die Diebin zu suchen. Die Reiter suchten die ganze Gegend ab, fanden aber nichts mehr. Pogo-Bi war schon zu weit. Sie war zu ihrem Bruder nach Kajo entflohen und hatte dem die Pem-tigas gegeben. Als sie das getan hatte, sandte sie selbst eine Nachricht an Naba Nasibirri, ihren Vater, den Mogo-naba von Wagadugu, und ließ ihm sagen: "Ich war es, die die Pem-tiga stahl. Mein Vater hat meinen ältesten Bruder nach Kajo geschickt, und hier gibt es so viele Pfeilschüsse, daß er seines Lebens nicht sicher ist. Deshalb habe ich meinem älteren Bruder die Pem-tiga gebracht, daß er sie anwende. Wenn Naba Nasibirri die Pem-tiga wieder erlangen will, dann muß er sie schon selbst holen!" Während nun einige
sagen, daß der Naba Nasibirri die Sache dabei hätte auf sich beruhen lassen, erzählen andere eine sehr eigentümliche Fortsetzung.Naba Nasibirri sagte: "Die Pem-tiga mag da bleiben, wo sie jetzt ist. Ich will aber auf jeden Fall diese Pogo-Bi, meine Tochter, die die klügste und tapferste unter den Frauen der Mossi ist, zurückgewinnen. Ich werde ihr folgen, bis ich sie wiedererlangt habe." Nasibirri machte sich mit einem gewaltigen Heere auf den Weg. Die Prinzessin sammelte ihre Streiter und Reiter um sich. Sie floh über den Niger und kam in die große Stadt der Marenga. Der Kaiser folgte ihr. Er eroberte die Stadt, nahm seine Tochter gefangen und kehrte mit ihr zurück. Die Pogo-Bi ward darauf die kriegerische Vorkämpferin des Nabatums.
Der Schluß der Mossiversion ist deswegen so interessant, weil wir in der Songhaichronik für das Jahr 1480 verzeichnet finden, daß der Kaiser der Mossi im Juli in der Stadt Biro angelangt sei, ihre Krieger überwunden und sie nach einem Monat wieder verlassen habe. Merkwürdigerweise erzählt die Chronik, daß er von den Eingeborenen eine Frau verlangt hätte und daß dies die Tochter eines sehr gelehrten Mannes gewesen sei. Er habe sie geheiratet. Es heißt, daß der Mossikönig zuerst die Bewohner von Biro überwunden und ihre Familien in Gefangenschaft gesetzt, die Gefangenen nachher aber im Kampfe wieder verloren habe.
Daß wir hier ein historisches Ereignis, das von zwei Seiten beleuchtet wird, vor uns haben, geht aber noch daraus hervor, daß der Herrscher sich nicht mit dieser Tatsache begnügte. Vielmehr rüstete er im Jahre 1498 einen Zug gegen diesen Kaiser, der in der Chronik als Na-Asirra, in der Tradition der Nordmossi aber als Naba Asirri aufgeführt ist. Der Songhaikaiser verlangte vom Mossikaiser die Annahme des Islam. Dieser erklärte, daß er mit seinen Ahnen Rücksprache nehmen wolle, begab sich in den entsprechenden Tempel und erlebte es, daß sich ein Greis aus der Tiefe erhob. Die Mossi warfen sich anbetend vor dem Verstorbenen nieder, und dieser erklärte dann im Namen der Vorfahren, daß sie nie damit einverstanden sein würden, wenn die Mossi Islamiten würden; sie sollten vielmehr bis zum letzten Augenblick gegen die islamitischen Heere kämpfen. In der Tat vermochten die Heere des Kaisers das Mossivolk nicht zu überwinden.
8. Naba Njiginjem. — Diesem historisch so wichtigen Herrscher folgte Njiginjem, von dem die Sage nichts anderes zu verzeichnen weiß, als daß er die Großen des Reiches bestach, auf daß sie gegen das Herkommen seinen Sohn zum Nachfolger machten. Dieser, der Naba Kundumje, hat auch in der Tat eine ganz bedeutende Rolle gespielt; ihm ist die eigentliche Festigung und Organisation des Landes, die Einteilung in große Provinzen, zuzuschreiben. Er führte
sehr viele Kriege und wußte selbst den Bogen geschickt zu handhaben. Er setzte seine eigenen Söhne als Provinzverwalter ein. Vor allen Dingen unterwarf er zunächst den Nordwesten und gründete die Provinz des Bussama-naba, der seinerseits dann seinen jüngeren Bruder Mani-naba mit einem Distrikte belehnte. Kundumje war aber auch der erste, der gegen aufrührerische Mossifürsten, also gegen eigene Verwandte, umfangreiche Kriege führen mußte, und vor allen Dingen machten ihm die immer sehr selbständigen Herren des Nordens, der Provinz Jatenga, das Leben schwer. So gründete er denn die Provinz Jako, die in der Mitte zwischen Jatenga und der Wagaduguprovinz lag. Dann rief er noch die Städte Kumkiesse Tenga, dann Tanga und im Süden Gjellogo und Pauam-Ture ins Leben. Der Poa-naba verließ als Kurita das Land.Jedesmal nämlich, wenn ein neuer Kaiser auf den Mossithron gesetzt wurde, wurde der älteste Volibruder des neuen Herrschers förmlich und feierlich mit den Kleidern des verstorbenen Vaters gewissermaßen investiert. Er erhielt den Titel Kurita, während die andern Volibrüder als Kurita-damba galten. Der Kurita ward aber der König der verbannten Vollbrüder. Sobald die Krönung stattgefunden hatte, wurden nämlich Kurita und Kurita-damba verjagt und für die ganze Lebenszeit aus der Reichshauptstadt verbannt. Ihr Leben ist ein sehr merkwürdiges. Der Kurita wird vom Mogo-naba im allgemeinen gefürchtet. Sein Name und Titel wird bei Hofe nicht genannt. Der König der Verbannten und seine Brüder haben nämlich irgendwo in entfernt liegenden Gegenden Ländereien inne. Sie brauchen keinerlei Abgaben zu zahlen und werden für ihre Taten, die denen des alten Raubrittertums gleichkommen, nie bestraft. So können sie z. B., wenn es ihnen gelingt, ungestraft Herden des Mogo-naba anfallen und auch Boten, die dem Herrscher Abgaben bringen, berauben. Niemand zieht sie zur Rechenschaft. Auf solche Weise ward manche Provinz des Reiches selbständig. Vom Bulsi-naba erzählt es die Sage und vom Jatenga-naba können wir es annehmen. Manche von diesen Kuritas gingen aber früher aus dem Lande und eroberten dem Mossitum neue Provinzen. Folge dieser Sitte ist auf der einen Seite Ausdehnung des Mossivolkes, auf der andern Seite langsam und sicher vor sich gehende Abtrennung einzelner Reichsteile und Auflösung des eigentlichen Mossireiches.
9. Naba Kudumfe. — Der Kaiser Kudumje hatte mit seinen Feld-Zügen ganz außerordentliches Glück. Wenn er kriegerischen Mutes war, so gab er dem Tapo-Rane, dem Fahnenträger, den Befehl, die Tapo-Kaore, die Reichsfahne, herbeizubringen. Der Fahnenschaft wurde mit Opfern und Medikamenten behandelt und dann das Banner auf freiem Felde entfaltet. Nun achtete der Mogo-naba genau darauf, nach welcher Richtung der gerade herrschende Wind die
Fahne flattern ließ. In der hierdurch gegebenen Richtung brach er dann mit seinen Truppen auf, indem er sie anfeuerte und sagte: "Nach dort fliegt unsere Tapo-Kaore. Nach dort wollen wir ziehen. Dort werden wir jedenfalls siegreich sein!" Und wirklich siegte Naba Kundumje immer. Unter seiner Regierung fielen viele Krieger im Kampfe. Aber sonst war er kein roher Herrscher, und in Wagadugu hat er wenig Leute hinrichten lassen. Dagegen war er außerordentlich freigebig, gab jedem Tonsaba (General) reichlich Sklaven und Weiber und trachtete nicht danach, selbst Schätze aufzuspeichern. Seine Residenz hatte er in Kiu im Südsüdwesten von Wagadugu. Er starb nicht im Kriege, sondern daheim eines friedlichen Todes. Er war es, der das eigentliche Kaiserreich Wagadugu ausbaute und organisierte.10. Naba Kuda. — Von seinem Sohne Kuda weiß die Sage zu berichten, daß er viele Kriege geführt und seine Söhne als Landesverwalter eingesetzt habe. Er galt als ausgezeichneter Kaiser von großer Klugheit, der allerhand übernatürliche Fähigkeiten anzuwenden wußte und endlich als hochgeehrter Herrscher in Wagadugu starb.
11. Langoegoma. — Sein Sohn und Nachfolger Langoegoma entwickelte die übersinnlichen Fähigkeiten seines Vaters in noch höherem Maße. Die Summe der Traditionen, die sich um den Namen dieses Herrschers gesammelt hat, beginnt schon mit seiner übernatürlichen Geburt.
Langoegoma war schon zu Lebzeiten seines Vaters ein mächtiger und gefürchteter Tansoba (General). Oftmals blieb er lange von Wagadugu fern, um einen entlegenen Landstrich zu unterwerfen. So war er auch abwesend, als sein Vater, der Naba Kuda, starb, und infolgedessen setzten die Großwürdenträger seinen jüngeren Bruder, den Naba Jotembussuma, auf den Thron. Langoegoma fand also bei seiner unerwarteten Rückkehr den ihm zukommenden Platz besetzt. Er begab sich sogleich in das große, im Westen des Herrscherhofes von Wagadugu gelegene Haus seines Vaters und setzte sich darin nieder. Die Nachricht von seiner Heimkehr verbreitete sich schnell, und am andern Morgen erschienen die Großen des Reiches, um ihm ihren untertänigen Gruß zu entbieten. Naba Langoegoma herrschte sie aber an und fragte: "Wie kommt ihr dazu, ohne einen Befehl von mir abzuwarten, meinen jüngeren Bruder zum Mogo-naba zu ernennen ?" Die großen Fürsten warfen sich demütig zu Boden und sagten: "Verzeihe uns, aber du warst so lange im Kriege auswärts, daß wir nicht wußten, ob du noch lebtest. Darum haben wir deinem jüngeren Bruder Jotembussuma die Herrschaft anvertraut." Naba Langoegoma sandte nun sogleich zu seinem jüngeren Bruder, dem Naba Jotembussuma, und ließ ihm sagen: "Mein jüngerer Bruder
soll sogleich Wagadugu verlassen und fliehen, damit ich ihn nicht etwa zu sehen bekomme." Zornig saß er im Kreise der Großen im großen Hause seines Vaters. Er schnaubte; da fuhr Feuer auf die Erde und breitete sich auf dem Boden aus. Dann sagte er: "Führt mich zum Grabe meines Vaters, ich will das Grab meines Vaters sehen und will weinen." Die Großfürsten führten ihn dahin. Als Langoegoma an dem Grabe stand, tropften aus seinem linken Auge Blutstropfen, aus seinem rechten Tränen. Während dessen rief der Naba Jotembussuma die Großfürsten zu sich und sagte: "Ich danke euch für alles, was ihr für mich getan habt. Ich habe aber die Botschaft meines Bruders, des Naba Langoegoma, empfangen und werde jetzt gehen. Ich werde Wagadugu verlassen. Wenn mein ältester Bruder sterben sollte und ihr dann glaubt, daß ich hier am Platze bin, so könnt ihr mich wieder rufen." Dann ging Naba Jotembussuma von dannen. Als dies Naba Langoegoma hinterbracht wurde, sagte er: "Ich habe mich geirrt. Ich habe geglaubt, mein jüngerer Bruder habe mir einen bösen Streich spielen wollen. Nun aber sehe ich, daß ich mich geirrt habe und daß mein jüngerer Bruder ein rechtlich denkender Mann ist. Wenn ich also einmal sterbe, so wählt nur keinen meiner Söhne zum Nachfolger, sondern meinen Bruder, den Naba Jotembussuma."Naba Langoegoma führte glückliche Kriege und bewährte sich dabei als mächtiger Bumbande (Zauberer). Wenn er eine Stadt angriff, verwandelte er sich in aller Eile in einen gewaltigen Wirbelwind und brauste über die feindliche Stadt hin. Dann zerstörte er die Mauern und Häuser und machte alle Leute krank. Der eine hatte einen Beinbruch, der andere eine Bauchschwellung, der dritte ein Augenleiden, der vierte die Schlafkrankheit, der fünfte Rückenschmerzen usw. Viele Berichterstatter sagen, solche grausamen Kriege habe er aber nur geführt, ehe er in Wagadugu Mogo-naba ward und nachher nicht mehr. Vielmehr ist er nachher ein friedliebender und sehr guter Herrscher gewesen. Als er seinen Tod herannahen fühlte, rief er seine beiden Söhne und sagte zu ihnen: "Ich habe seinerzeit meinem jüngeren Bruder Unrecht getan, denn ich dachte, er hätte Schlechtes vorgehabt und mich vom Throne verdrängen wollen. Es ist aber nicht so gewesen. Nun verlange ich von euch beiden, daß ihr nicht danach trachtet, meine Nachfolger zu werden. Ich will, daß Naba Jotembussuma mir nachfolge. Auch wenn der Naba Jotembussuma sterben sollte, verlange ich von euch, daß weder ihr, noch eure Nachkommen zum Throne drängen; denn ich will nicht, daß es zwischen meinen und Naba Jotembussumas Nachkommen zu einem Streite komme. Ich werde nach eurem Glauben mit meinem Leibe unter der Erde sein. Ich werde aber doch auch in der Luft gegenwärtig sein. Fragt also, wenn ihr nicht sicher
seid, die Erde über meinem Grabe, was mein Wille sei, und ich werde euch meinen Willen bekanntgeben."Danach starb Naba Langoegoma. Man wollte ihn nun bestatten und grub eine Grube. Inzwischen bewachten die Schwestern den Leichnam. Als man aber den Toten holen wollte, um ihn in die Grube zu versenken, war er verschwunden. Man suchte und suchte, man fand ihn aber nicht mehr. Er war in der Luft verschwunden. Man weiß, daß er auch heute noch in der Luft umherschwebt. Aber damals suchte man ihn vergeblich, und weil man nicht das leere Grab schließen wollte, opferte man ein Huhn und einen Widder und legte beide Opfer in den Grabkanal.
12. Nabci Jotembussuma. — Dem Willen des älteren Bruders entsprechend, ward Naba Jotembussuma zurückgerufen und zum Herrscher gemacht. Er war sehr gut und ständig bestrebt, den Wünschen des älteren Bruders nachzukommen, von dem er wußte, daß er ihn umschwebe und alle seine Maßnahmen überwache. Er herrschte in Wagadugu.
13. Naba Jandefo. — Sein Nachfolger Jandefo soll nicht weniger als sechzig Jahre lang Herrscher in der Reichshauptstadt gewesen sein. Schon als jüngerer Monarch war er wenig kriegslustig und wich schon hierin von der Art der andern Mossikaiser ab. Hatte er einen Widersacher, so trachtete er danach, ihn nicht durch kriegerische Gewalttätigkeit, sondern auf geheimnisvolle Weise aus dem Leben zu schaffen. Er lud die, die seine Gegner waren, ein, zu ihm nach Wagadugu zu kommen. Auf dem Wege, auf dem sie seine Hofburg erreichen mußten, vergrub er Zaubermittel. Wenn der Fuß des Herannahenden dann die Stelle streifte, so starb er.
Als er nun alt war, stellten sich allerhand Schrullen bei ihm ein. Eines Tages sagte er z. B. zu seinen Leuten: "Ich bin schon so lange Mogo-naba, und ihr habt mir im Laufe der Zeit schon so viele Kaurimuscheln, Steinperlen, Stoffe usw. geschenkt, daß ich reich genug und dieser Dinge überdrüssig bin. Bringt mir also in Zukunft als Zeichen eurer Unterwürfigkeit und Treue etwas anderes. Bringt mir Asche und Kohlenabfall. Das werft dann vor meinem Hofe auf eine Stelle zusammen." Die Leute taten so, und daraufhin häufte sich jener kleine Abfallberg auf, der heute noch in Wagadugu als Tampure des Naba Jandefo gezeigt wird. Er liegt im Westen der Stadt. Es ist ein regelrechter Kjökkemöddinger, wie solche weiter im Süden, im Lande der Gurunsi, häufig sind, und wie ich sie später am Benue in Djenn und in Adamaua als häufiges Vorkommnis feststellen konnte.
14. Naba Naijeng. — Der Kaiser Natjeng gilt als überaus gütig und durchaus vorbildlich. Er wurde sehr geschätzt, und man sagt, daß er seinen Ruf auch verdient habe, denn es wären viele Fremde
in seinen Dienst getreten, und er habe viel ausländisches Handelsvolk in Mossi zusammengezogen. Er war so religiös, daß er die üblichen Opfer auf den Gräbern verdoppelte. Er brachte zwei Ochsen statt einen, zwei Hühner statt eines, zwei Hunde statt einer Ziege dar —und üppiger kann man im Mossilande nicht sein, denn Hunde gelten als wertvollste Opfergabe unter dem Kleinvieh. Er verbrachte sein Leben in Dassuri und ist daselbst, nachdem er zehn Jahre regiert hatte, auch gestorben.15. Naba Namego. 16. Naba Kiba. 17. Naba Kimba. —Vom Naba Namego wird noch berichtet, daß er fünf Jahre regierte und während dieser Zeit eine große Reihe von Kriegen gegen die Bussangsi und gegen Bussuma geführt habe. Seine Kriege richteten sich besonders gegen Osten, und während eines Krieges ist er auch gestorben. Sein Sohn Kiba herrschte zwei Jahre lang und hatte als Nachfolger Naba Kimba, der schon sehr alt war, als er zur Regierung kam. Er hatte die Herrschaft nur sechs Jahre lang in kraftlosen Händen.
Nach Naba Kimbas Tode erhoben die Großfürsten erst den Naba Sana, von den Mande auch Naba Djana oder Naba Gana genannt, auf ihren Herrschersitz. Aber sowie er zu seiner Würde gelangt war, begann eine ernste und schwere Zeit für das Land. Es hörte auf zu regnen. Dieser unselige Zustand währte drei Jahre, und in dieser Zeit hat das Mossireich seine Kraft eingebüßt. Die Wahlfürsten des Reiches versammelten sich daher, hielten eine lange Besprechung ab und fanden nach der Befragung der Priester heraus, daß der Naba Sana dem Lande nur Unglück bringe. So veranstalteten sie denn eine Opferung und gingen dann zu dem Mogo-naba, um ihm zu sagen: "Du bringst nur Unglück über das Land! Willst du freiwillig gehen oder sollen wir dich töten?" Naba Sana sagte: "Ich gehe freiwillig." Die Großen gaben ihm einige Sklaven und Frauen und was er sonst zum Leben nötig hatte, und er verließ Wagadugu und sein Land.
18. Naba Gobaga. —Darauf setzten die Wahifürsten den Naba Gobaga auf den Thron, der zehn Jahre herrschte. Er war eine Geißel für alle Großfürsten, denn er sandte an alle Pewere-Soba (Inhaber schwerer Zaubermittel) im Lande die Nachricht: "Kommt an meinen Hof", und als sie kamen, schloß er mit ihnen Freundschaft und ein Bündnis, das gegen die Großfürsten seiner Umgebung gerichtet war. Mit den Pewere-Soba zusammen, d. h. also unter Ausübung ihrer Zauberkräfte, begann er alle Großen im Lande zu töten. Während seiner Regierungszeit war keine Henkersnot, aber alle alten Würdenträger des Reiches wurden vernichtet. — In jener alten Zeit war es Sitte, daß, wenn gute Herrscher einen Sohn hinterließen und wenn sie im Lande bei einem Kriegszug verstarben, ein Sohn die Leiche des Herrschers nach Wagadugu bringen und selbst die Herrscherwürde in Empfapg nehmen durfte. Als nun Naba Gobaga in
Ubri-Tenga starb, sah man von diesem Brauche ab, begrub ihn in dem Orte seines Verscheidens und erlaubte nicht, daß seine Leiche nach der Reichshauptstadt überführt wurde. Denn alle Würdenträger waren seine Gegner und freuten sich seines Todes.19. Naba Sana. — Danach berief man den Naba Sana wieder auf den Thron nach Wagadugu. Er war noch einmal sechs Jahre lang Herrscher. Kaum aber begann seine Regierung, da hörte wieder der Regen auf. Die Ernte versagte. Es war wieder das alte Elend, und mit Sehnsucht wartete man auf seinen Tod, der ihn in Wagadugu erreichte.
20. Naba Giliga. 21. Naba Ubi. 22. Naba Muatuba. —Naba Giliga soll einer der grausamsten Herrscher gewesen sein. Während man vordem die Eunuchen aus Gambaka bezog, führte er die Sitte der Verstümmelung im Lande selbst ein und begann Eunuchen zu exportieren. Nachdem er in Wagadugu verschieden war, kam in Ubi wieder ein beliebter und ausgezeichneter Monarch zur Herrschaft, der während acht Jahren das Land regierte und in der Hauptstadt starb. Zuweilen rief er alle seine Großen zusammen und schlachtete an hundert Stück Rindvieh. Er veranstaltete viele Opferfeste, beschenkte und speiste die Großen und pflegte zu sagen: "Mein Vater brachte dem Lande viel Unglück. Ich will versuchen, es anders zu machen." Ihm folgte sein Sohn Muatuba, der acht Jahre herrschte und wenige, unbedeutende Kriegszüge nach Westen unternahm, in deren Verlauf er auch auswärts verschied.
23. Naba Uaraga (der Name soll heißen: "der Regen macht"). — Uaraga regierte ungefähr sieben Jahre und soll einer der schlimmsten Herrscher in Wagadugu gewesen sein. Er begann in Saptenga einen Feld- und Zerstörungszug, den er ungefähr bis La fortsetzte. In jedem neu eroberten Orte — es scheint, daß die ganze Nordlinie im Aufstande war — nahm er die hübschesten Mädchen für sich in Beschlag und kastrierte einige Eingeborene, sie dadurch zu Eunuchen und Oberaufsehern seines Harems zu machen. Als er in La ankam, sagte er: "Diese Gegend gefällt mir ganz besonders."Er baute da eine große Stadt und richtete sich wieder einen großen Harem ein.
Mit vielen seiner Großen war er unzufrieden, und besonders der Häuptling von Kombissiri sagte ihm gar nicht zu. Er ließ diesen zu sich kommen. Er schlug ihm dann den Kopf ab und setzte darauf seinen zweiten Sohn als Kombissiri-naba ein. Dann brach ein Krieg zwischen ihm und dem Nanon-naba aus. Der Kampf der beiderseitig arg mitgenommenen Parteien währte sieben Tage. Fast hätte der Naba von Nanon gesiegt. Im letzten Augenblicke aber ward dem Kaiser noch der Sieg zuteil. Er ließ nun dem aufständigen Fürsten den Kopf abschlagen und setzte seinen vierten Sohn als Nanon-naba ein.
Von diesen Kriegszügen kehrte er nach Wagadugu zurück, lebte hier noch ein Jahr und starb dann in der Hauptstadt. Ihm folgte sein Sohn:
24. Naba Dumburi oder Djumburi, das soll heißen: "so stark wie Pfeffer". — Er regierte dreißig Jahre lang, und zwar war er ein friedlicher Herrscher, der es versuchte und verstand, die religiösen Institutionen des Landes für die Regentschaft nutzbar zu machen. Im Lande lebten damals —zumal an den Orten Boassa, Tengondogo (Tenkodugu?) und Sangadogo, erstere beide im Osten, letzterer Ort im Süden, —die Njonjonsi, ein Volk, das seit Alters im Ansehen stand, besonders kenntnisreich und mächtig in allen religiösen Kultusangelegenheiten zu sein. Er sandte nun überall dahin, wo noch diese alten Anwohner in blühenden Anwesen ihren Kultus übten, eine Botschaft und ließ ihnen sagen: "Ich habe gehört, daß ihr ganz besondere Fähigkeiten beherrscht, daß ihr zum Beispiel Wind machen könnt, daß ihr imstande seid, euch in einen Leoparden zu verwandeln, daß ihr Krankheiten bereiten könnt, daß ihr die Erde im Orakel zu befragen versteht. Kommt also alle nach Wagadugu und zeigt mir, was ihr könnt, damit ich euch die entsprechende Ehre erweisen kann." Darauf machten sich die Njonjonsi auf und kamen auch nach Wagadugu. Der Naba Dumburi sagte: "Nun zeigt mir, ob ihr Wind machen könnt." Die Njonjonsi hatten ihre kleine heilige Axt, deren Griff mit Opferblut und Federn bedeckt ist, die Tobaga, mitgebracht, und der Träger legte sie auf die Mauer. Er sagte: "Ich brauche ein weißes Huhn." Man brachte das weiße Huhn. Der Kultuszelebrant trat vor die Tobaga und sagte: "Hier bringe ich dir ein weißes Huhn, ich will es dir gerne opfern. Aber siehe: der Mogonaba hat uns hierhergerufen, damit wir zeigen, was du kannst. Nun tue es so!" Der Mann opferte das Huhn. Sogleich erhob sich ein starker Wind.
Der Mogo-naba sagte nun zu den Njonjonsi: "Nun lest das Erdorakel und sagt mir, wer in meiner Umgebung schlecht und wer in meiner Umgebung gut ist." Die Njonjonsi lasen das Erdorakel. Darauf sagte einer: "Der und der will dir nicht wohl. Der und der will dir wohl." Ein anderer verbesserte und sagte: "Es ist nicht so oder so, sondern so oder so." Der Naba Dumburi achtete genau auf alles, und als er sah, daß ein Stümper darunter war, wies er ihn heraus, die aber, die ihm von den weisen Leuten als schlechte Menschen seiner Umgebung bezeichnet wurden, die setzte er schlechtweg ab und ergänzte den Hofstaat durch würdigere Leute. Er machte es aber nicht wie seine Vorgänger, die unredliche Leute einfach köpfen ließen.
Danach sagte Naba Dumburi zu den Njonjonsi: "Ich habe gehört, daß ihr es auch regnen lassen könnt. Ist das wahr?" Die Njonjonsi
sagten: "Wir wollen es dir zeigen. Gib uns ein weißes Huhn."Darauf reichte man den Njonjonsi ein weißes Huhn. Der Herr der Tobaga wandte sich an die kleine heilige Axt und sagte zu ihr: "Wir wissen, daß du unseren Vätern und Großvätern (dabei zählte er alle Namen auf) nur Gutes getan hast. Der Naba Dumburi möchte, daß es regnet. Das ist etwas Gutes. Zeige, daß du es regnen lassen kannst. Ich will dir auch dies weiße Huhn opfern." Nachdem das Opfer dargebracht war, begann es zu regnen. — Sieben Tage blieben die Njonjonsi bei dem Naba Dumburi. Dann schenkte ihnen der Mogo-naba Vieh, Kauri und Kleider und sagte: "Kehrt jetzt heim. Wenn ich euch brauche, werde ich euch wieder kommen lassen." Die Njonjonsi gingen. Der Naba Dumburi ließ sie aber oft nach Wagadugu kommen und fragte sie um Rat, beschenkte sie und blieb so in ständigem Verkehr mit ihnen.Naba Dumburi wurde sehr alt. Es störte ihn, daß auf dem Markte, der nordöstlich des heutigen Platzes lag, ständig Streit und Zwiespalt entstand. Er sagte: "Der Markt soll auf den Platz verlegt werden, der neben meinem Hofe gelegen ist." So kam er an die Stelle, wo er heute noch abgehalten wird. Ihm folgte sein Sohn:
25. Naba Korn 1. (sein Name soll so viel heißen wie "Wasser"). — Korn war sieben Jahre Mogo-naba. Seine Mutter war eine Mohammedanerin, und so war es naheliegend, daß er im Gegensatz zur Politik seines Vorgängers, der den alten eingeborenen Priestern große Macht einräumte, den Mohammedanern sehr häufig das Ohr lieh. Und zwar kam das so. In der ersten Zeit war der Monarch gewalttätig und ließ ohne Ansehen von Recht und Billigkeit alles hinschlachten, was ihm im Wege stand. Eines Tages aber legten sich die Mohammedaner ins Mittel und sagten ihm: "Gewiß ist es richtig, wenn schlechte Leute schlimmes Schicksal haben. Du sollst aber nie töten, ohne in einer Gerichtssitzung Recht und Unrecht nachgeprüft. zu haben." Das überlegte er sich. Von da an machte er den Salaam und ward ein milder und gerechter Mogo-naba, der sehr beliebt ward. Ihm folgte sein Sohn:
26. Naba Saga (Saga soll so viel heißen wie "Regen"). — Er herrschte im ganzen sechs Jahre, aber den größten Teil seines Lebens hatte er in schweren Kämpfen mit seinen Vater brüdern zu verbringen, —Kämpfe, die schon anfingen, lange ehe er auf dem kaiserlichen Hofe in Wagadugu Einzug hielt.
Als er noch ein Junge war, sandte ihn sein Vater, der Naba Korn an den Hof des im Süden wohnenden Giba-naba (oder Gipo), der sein Verwandter war, nämlich der fünfte Sohn des Naba Uarraga. Der Giba-naba warf den Neffen aber einfach heraus, doch war es mir nicht möglich, die Gründe hierfür in Erfahrung zu bringen. Der junge Saga kam als Flüchtling nach Wagadugu, vergaß aber die
ihm zugefügte Schmach nicht. Ohne Wissen seines Vaters, des Herrschers, rüstete er eines Tages einen Heerhaufen und griff den Oheim an. Er mußte aber erfolglos zurückkehren. Drei Jahre lang zog er jährlich einmal gegen den Onkel zu Felde. Beim dritten Zuge gewann er die Oberhand. Er eroberte die Ortschaft und zerstörte sie. Viele Eingeborene flohen nach Gurunga. Er aber tötete seinen Oheim und kehrte nach Wagadugu zurück.Ein Jahr später starb sein Vater und die Großen des Hofes erwählten ihn zum Mogo-naba. Kaum war das aber ruchbar geworden, da taten sich alle Nachkommen des Naba-Uarraga zusammen und zogen gegen den Naba-Saga zu Felde. Sie sagten, erst kämen die Vaterbruder und dann die Söhne zur Regentschaft. Den Uarragasöhnen gegenüber vereinten sich die Komsöhne, um für ihren Bruder und sich das Recht geltend zu machen. Es kam zu einem langen, erbitterten Kriege. Der Erfolg schwankte. Erst gewannen die Uarragasöhne die Oberhand. Sie gelangten bis Wagadugu, setzten den Naba-Saga ab und führten ihn in einem schmachvollen Aufzuge, nämlich auf einen Esel gebunden, nach dem Süden, bis nach Sapone. Dort blieb der arme entthronte Kaiser drei Jahre lang. Dann erst gelang es seinen Brüdern, die Oberhand zu gewinnen und ihm die Möglichkeit zu bieten, als Herrscher wieder in Wagadugu Einzug zu halten. Dann hatte er noch eine ungetrübte Regierungszeit von drei Jahren. Ihm folgte der älteste Sohn:
27. Naba Lulugu (Lulugu soll ein Vogel, und zwar ein Stelzvogel, der Dibong der Mande, sein, dessen Flug hie und da als Omen beobachtet wird). — Er regierte etwa neunundzwanzig Jahre, aber er führte so viele Kriegszüge, daß er im ganzen kaum einen Monat in Wagadugu zubrachte. Den Anfang dieser fortlaufenden Kriegsperiode scheint das Ringen mit Bussuma-naba gewesen zu sein. Er zerstörte dessen Macht und Ansehen, dann zog er weiter. Die Kumtegaleute, die zuerst auch aufständig gewesen zu sein schienen, unterwarfen sich ohne starken Widerstand. Dann zog der Herrscher weiter nach Garango und zerstörte auch diese Ortschaft. Dann hub der große Krieg gegen die Bussanga an. Als sie unterworfen waren, kehrte er zurück nach Mani. Hier kam es wieder zu einem Kampfe, in dessen Verlauf der Mogo-naba einen Pfeilschuß erhielt. An den Folgen der Wunde starb er. Seine Leiche wurde nach Wagadugu gebracht und hier beigesetzt. Im folgte sein ältester Sohn:
28. Naba Sagadogo (Sagadogo soll so viel bedeuten wie gewitterreiche oder gute Jahreszeit). — Er regierte im ganzen siebzehn Jahre, von denen er die ersten zehn Jahre in guter, den Rest in sehr schlechter Gesundheit verbrachte. Er war anscheinend Diplomat und ein sehr vorsichtiger Mann. So erzählte man von einem Getränk besonderer Art, das er jeden Morgen genossen habe. Viele schwierige
Familienangelegenheiten wußte er geschickt in Ordnung zu bringen. Seine Krankheit ward zuletzt so schlimm, daß er das Ende des Lebens in der Hütte verbrachte, unfähig zu sprechen oder sich zu bewegen. Ihm folgte sein ältester Sohn:29. Naba Karfo (Karfo soll so viel bedeuten wie dunkeiblauer Stoff oder gleichfarbiges Gewand). —Er regierte sieben Jahre. Auch er wieder hatte mit einem Aufstand eigener Verwandten zu tun. Der Sondere-naba, Koliogo mit Namen, schloß Freundschaft mit dem Widi-Naba, und diese beiden suchten unter den Großen am Hofe nach Anhang, um den Naba Karfo zu beseitigen. Die andern Großen aber widersetzten sich dem Plane und machten dem Mogo-naba Mitteilung von dem Anschlag. Naba Karfo rüstete sogleich einen Feldzug und rückte nach Osten gegen die vereinte Truppenmacht der Aufständigen vor. Er schlug sie auch und jagte sie bis nach Bassoko (im Osten). Viele Leute kamen in diesem Kriege um das Leben. Als der Mogo-naba nach Wagadugu zurückgekehrt war, traf bald darauf auch der rebellische, aber zurückgeschlagene Widi-naba ein, um sich zu unterwerfen — was der Mogo-naba auch annahm.
Der fernere Verlauf dieser Sache ist ungemein charakteristisch für die Negerpolitik im allgemeinen und das Verhältnis der Abhängigkeit, in dem der Mogo-naba von Wagadugu zu seinen Reichsgroßen, nenne man sie nun Fürsten oder erbliche Minister, stand. Naba Karfo wagte es nicht, die Unterwerfung des Widi-naba abzulehnen und ihn zu kassieren. Er wagte es nicht, einen andern an die Stelle des aufrührerischen Beamten zu setzen, und doch wollte er sich seiner entledigen, gleichwie auf welche Art. Er wandte sich also an einige als Getreue bekannte Leute mit der Frage: "Dem, der es wagt, den Widi-naba schnell auf anständige Weise aus dem Leben zu schaffen, will ich ein Pferd, eine Frau und hunderttausend Kauri schenken. Wer wagt es?"Darauf meldete sich ein tapferer Mann mit Namen Daogo. Daogo sagte: "Ich will es unternehmen."Naba Karfo fragte: "Wie willst du es ausführen?"Daogo sagte: "Gib mir zwei Pfeile." Naba Karfo gab ihm zwei schwer vergiftete Pfeile und sagte: "Sage mir nun aber genau, wie du die Angelegenheit erledigen willst?"Daogo sagte: "Ich will mich abends um sechs Uhr in den Hof des Widi-naba einschleichen. Dann werde ich dem Pferde alles Heu wegnehmen und das Heu beiseite werfen, dahin, wo der Mond hinscheint. Dann werde ich mich verstecken. Nachts wird das Pferd wiehern, weil es das Heu, das nahe bei ihm liegt, nicht erreichen kann. Der Widi-naba als guter Pferdeherr wird erwachen, auf den Hof treten, nach dem Heu sehen, das Heu aus dem Winkel im Mondlicht nehmen und dem Pferd hinwerfen wollen. Das wird ein guter Augenblick für meine Pfeile sein."Naba Karfo sagte: "Es ist gut so; geh!" Der tapfere Daogo ging und machte alles, wie er es vorher
gesagt hatte. Als der Widi-naba in den Mondschein trat, das Heu zu ergreifen und dem Pferde hinzuwerfen, legte er gleich beide Pfeile auf die Sehne des Bogens und schoß auf den Widi-naba. Dann lief er sogleich in die Hofburg des Mogo-naba und sagte ihm: "Ich habe es ausgeführt. Der Widi-naba stirbt." In der gleichen Nacht starb der Widi-naba. Am andern Tage schenkte Naba Karfo dem Daogo ein Pferd, ein Weib, hunderttausend Kaurischnecken und außerdem noch ein schönes Kleid.Zum vollendeten Beispiel afrikanischer Kaiserpolitik wird die Geschichte durch den Abschluß, den die ganze Sache nahm. Nach einigen Tagen überlegte sich der Mogo-naba die Sache und kam zu dem Schlusse: "Dieser Daogo ist ein gefährlicher Mensch." Und er gab den Befehl, ihn zu töten. Da ward der tapfere Daogo getötet. Auf Naba Karfo folgte sein Oheim:
30. Naba Bongo oder Banko (Bongo soll soviel heißen wie Gewässer). — Er regierte etwa fünf Jahre in Wagadugu und gilt als ein sehr schlechter Kaiser. Man sagt ihm vor allem nach, abends oder gegen Nacht habe er sich häufig in alte lumpige Gewänder gehüllt und sei dann so in die Stadt geschlichen. In der Stadt habe er umhergelauscht, was man rede. Und wenn er hörte, daß irgend jemand Schlechtes oder Mißachtendes von ihm, dem Mogo-naba, sage, so habe er ihn am andern Tage mit den bekannten drei Keulenschlägen töten lassen. Überhaupt stand auf dem geringsten Vergehen gegen seinen Hof- und Hausbesitz die Todesstrafe. So ließ er Hühnerdiebstahl und alles vergelten. Weiterhin wird ihm nachgesagt, daß er zu schlimm getrunken habe. Endlich führte er emsige Kriegs- oder vielmehr Beutezüge gegen Garango im Bussangogebiet aus. Er ließ die Sklaven von dort holen, wie der Metzger Schlachtstücke aus der Rinderherde nimmt. Ihm folgte der Neffe:
31. Naba Kutu (Kutu soll soviel heißen wie Eisen). — Dieser wieder recht fruchtbare Herrscher hatte siebzehn Söhne. Naba Kuta soll etwa siebzehn Jahre regiert haben. Das wesentlichste Ereignis in dieser Zeit ist ein Krieg gegen die Stadt Surruku im Südsüdwesten von Wagadugu. Der Naba dieses Gemeindewesens war gestorben und die Städter sandten zu Naba Kutu, ihn um die Entsendung eines würdigen Nachfolgers bittend. Naba Kutu sandte seinen eigenen Sohn hin. Doch dieser führte sich derart schlecht auf, daß die Surrukuleute nach einiger Zeit beschlossen, ihn herauszutun und diesen Beschluß auch in die Tat umsetzten. Danach wählten die Städter sich einen eigenen Anführer. Als Naba Kutu das hörte, blieb ihm, wenn er das Ansehen seines Willens und seiner Familie aufrecht erhalten wollte, nichts anderes übrig, als einen Kriegshaufen gegen die aufrührerische Stadt zu entsenden. Der Stadtherr nun, den die Einwohner sich selbst gewählt hatten, besaß Energie genug, dem
kaiserlichen Willen Widerstand zu leisten und sich den Truppen des Mogo-naba entgegenzustellen. Die Folge davon war, daß Surruku durch die Truppen des Naba Kutu vollkommen zerstört und der Stadtnaba getötet wurde. Im folgte sein ältester Sohn:32. Naba Sanum (Sanum oder Sanam[a] soll so viel bedeuten wie Gold). Er regierte achtzehn Jahre. Er führte heftigen Krieg gegen Bussuma und Bulsi, das auch Bulsena genannt wird. Unter seiner Regierung kamen die ersten beiden Europäer nach Wagadugu, und zwar stieg der erstere bei "Maliki", der letztere bei Manam ab. Der Herrscher beschaffte reiches Sklavenmaterial im Osten. Er starb in Wagadugu und wurde auch daselbst bestattet. Im folgte sein Bruder:
33. Naba Uobogo (Uobogo soll so viel heißen wie Elefant). —Naba Uobogo regierte in Wagadugu etwa acht Jahre, und zwar in der Zeit, die die französischen Okkupisten jener Periode lachend als die "Zeit der Fahnenkriege" bezeichnen. Damals suchte manche Vertreterschaft europäischer Großmächte in verschiedener Art Kolonialausdehnung zu gewinnen. Diesem Fahnenkriege fiel wohl Naba Uobogo zum Opfer. Die näheren Umstände historisch festzustellen, wird vielleicht einmal die französische Kolonialgeschichtsschreibung unternehmen. Jedenfalls ward er nach dem Süden verjagt.
Diese Tatsache hat für mich übrigens eine ausgezeichnete Folgeerscheinung gezeitigt. Da der Fürst hinausgeworfen war, so sprachen sich die Wagaduguleute freier und unbefangener über sein Privatleben aus, als das einem andern Herrscher gegenüber geschehen wäre. Da kam ich denn hinter eine eigenartige Sitte: Seit den Zeiten des Naba Ubri, d. h. des eigentlichen Reichsgründers, ist es Brauch, daß der Mogo-naba einige oder mehrere seiner eigenen Töchter beschläft, während eine, anscheinend die älteste, unbedingt Jungfrau bleibt, solange er Herrscher und am Leben ist.
Dieser blutschänderischen Sitte huldigte auch der Naba Uobogo. Er beschlief seine drei Töchter Habibu, Laie und Kuka. Sie folgten ihm auch als Kebsweiber in das Exil, und eine von ihnen, die Kuka, ward auch von ihm schwanger. Die unehrliche Leibesfrucht wurde aber bald nachher zum Sterben gebracht. Die Mossi schämten sich sehr beim Vortrag dieser Tatsachen. Der Kaiser starb im Exil und ward im Ausland begraben.
34. Naba Sigirri (der Name scheint irgendwie mit dem Anfange der Regenzeit zusammenzuhängen). — Er regierte in Wagadugu zehn Jahre. Während dieser Zeit bekamen die französischen Truppen ohne Schwierigkeit die Herrschaft in die Hand, denn Naba Sugirri brachte den Europäern alle erdenkliche Freundlichkeit und biegsamen Geist entgegen. Er starb und ward begraben in Wagadugu. Schon er war keine Persönlichkeit mehr. Ihm folgte sein Sohn:
35. Naba Korn II. — Mit diesem körperlich voll entwickelten und geistig kümmerlichen Herrn ist das Ende der eigentlichen Herrscherkraft unter der französischen Regierung offenkundig erreicht. Zur Zeit meiner Anwesenheit in Wagadugu (November 1908) regierte er etwa dreieinhalb Jahre.
Dieser Naba starb im Dezember 1908 oder Januar 1909 gelegentlich einer Epidemie, die im Mossilande ausbrach, während wir in Nordtogo weilten und arbeiteten. Man schrieb diese Epidemie der Tatsache zu, daß die heiligen Masken das Land verlassen hatten.
2. Bericht der Mossi von WahigujaAuch die geschichtlichen Erinnerungen und Sagen der Mossi von Jatenga sind scharf und klar. Nur die Anfangslegende, die Angabe über den Ursprung ist etwas variantenreich. Die Genealogie der Herrscher ist konturenrein und bei vielen Typendarstellungen fällt das Streben, porträtähnlich herauszumeißeln, in die Augen. Vieles und wahrscheinlich mancherlei vom wesentlichsten fehlt in diesen Überlieferungen. So vermißt man hier im Norden die Erwähnung von Kriegszügen der Mossi gegen Timbuktu, von dem die alten Autoren mit Schrecken berichten. Aber für die Mossi Wahigujas selbst war dieses kleine Ereignis entschieden bedeutend weniger wichtig als für die mohammedanischen Propagandisten, die die Blüten einer islamitischen Saat zertreten sahen, ehe der Samen herausgereift war. — Der Name "Jatenga" für dieses nördlichste Königreich früher sicher eine Provinz des Mogo-naba von Wagadugu wird einstimmig auf Jadaga, den Reichsgründer, zurückgeführt. Uns fällt die Ähnlichkeit des Namens Jatenga mit der einundvierzigsten Hofwürde und dem Titel des Jam-tenga-Naba auf. Das ist in Wagadugu der Oberherr der Wildlieferung. — Die Mossi von Wagadugu nennen dies abgefallene Königreich Jatiga.
Ein wesentlicher Zug in der Geschichte dieses Landes besteht in den ständig wiederholten Kriegen gegen Jako, gegen den Naba von Jako, dessen Residenz am Südrande Jatengas lag, und der zeitweise ein selbständiger Fürst, zeitweise ein Vasall von Wagadugu, zeitweise einer von Wahiguja war. Wir werden sehen, daß besonders die Anfänge der historischen Berichterstattung in Wahiguja mancherlei Detail bieten, das nicht einmal in Wagadugu wieder zu finden war, aber durchaus Anspruch auf Beachtung hat.
Vorgeschichte. Der erste Mossi überhaupt war Uidi Laogo oder Widi Laogo. Widi heißt Pferd, Widi Laogo heißt Hengst. Von seinem Ursprunge erzählt die Sage zwei Varianten:
1. Aus Gambaga soll ein Mann mit Namen Riaele gekommen sein. Das war ein Naba. Eines Tages war ein Hengst desselben entlaufen.
Ein Sklave ging ihm nach, ihn zu suchen, fand im Busche eine Frau, beschlief sie. Die Frau ward schwanger. Als das Kind geboren war, nannte man es Uidi Laogo, weil es gelegentlich der Suche nach dem Hengst gefunden war. Diese Version hat nicht viel Wert; sie ward mir von Kurumi-nkobe vorgesetzt.2. Die Version der eigentlichen Mossi von Jatenga lautet: In Garnbaga herrschte der erste Naba der Mossi, Gambaga Naba genannt. Er hatte eine Tochter, die hieß Jendenga. Der Naba wollte nicht, daß diese, seine Tochter, heirate und verlangte von ihr, daß sie wie ein Mann ein Pferd besteige und als Heerführer große kriegerische Taten vollbringe. Derart zog denn Jendenga aus. Sie führte Kriege. Sie unterwarf andere Stämme. Eines Tages aber traf sie einen Jäger mit Namen Riaele. In diesen verliebte sie sich. Sie schlief bei ihm. Sie sagte: "Wenn auch mein Vater mir verboten hat, je zu heiraten, so will ich dich doch und trotz allem zum Manne haben." Sie heiratete den Jäger Riaele. Sie schlug mit ihrem Manne ihr erstes Lager in Bito auf. Dort ward das Kind, der Stammherr der heutigen Mossi, geboren. Weil nun Jendenga ihren Mann auf dem Pferde reitend gewann, nannte man das Kind Widi Laogo, den Hengst. Seine Nachkommen aber nannten sich Mogosi, d. h. Menschensame, und das soll heißen, daß sie die ersten Menschen seien.
Widi Naba hatte zwei Söhne, nämlich:
1. Naba Rawa. Dieser führte Krieg nach Norden hin. Er ver- drängte die Habe, die im heutigen Jatenga ansässig waren und er- oberte das Land Jatenga für die Mossi. Sein Lager schlug er in der Sanga auf, die ich auf dem Wege zwischen Tu und Tiu kennen lernte. Er hatte einen
Naba Sonima, der den Ort gleichen Namens gründete. Weiter wissen die Mossi Jatengas von Familie nichts zu sagen.
2. Naba Sungarana. Dieser blieb erst in Bito, dann siedelte er nach Tenkodugu über. Dieser hatte einen Sohn, der hieß Ubri. Mit diesem Naba Ubri beginnt die Geschichte des eigentlichen Kai-Ortschaft serreichs Wagadugu. In jenen alten Zeiten soll es nämlich Sitte gewesen sein, daß jeder Nach-Sohn komme den Siedelplatz des ver. storbenen Vorgängersverließ und einen eigenen Ort gründete. Die von Ubri gegründete oder ausdieser erwählte neue Wohnstatt war Wagadugu.
Der Sohn Naba Ubris war Naba Naskiembj. Auch der herrschte in Wagadugu. In die Zeit von dessen Regierung im Süden fallen die Großtaten des Uamtanango Naba im fernen Norden. Ob derselbe aus Rawar oder Sungaranas oder aus noch anderem Stamme ist, konnte ich nicht feststellen, jedenfalls denken selbst die Mossi, noch viel mehr aber die älteren Einwohner dieses Landes, mit Schrecken an
diesen grausamen Vorkämpfer des Mossitums zurück. Man erzählt von ihm: Er beherrschte die Distrikte Uderaogo, Djitti und Gurga im Norden Jatengas. Da er nun, anscheinend weil er daselbst ein Liebesverhältnis hatte, häufig nach Sabunu und zurück pilgerte, so störte ihn die Unebenheit des Weges, der über ein gebirgiges Terrain führte. So ließ er denn eines Tages alle Schmiede zusammenkommen und verlangte von ihnen, daß sie einen guten Weg bauten. Sie kamen dem Befehl nach und hoben einen Hohiweg aus, der nach Kapitän Noirées gleichlautenden Nachrichten eine Tiefe von 40 m bei 40 m oberer und 20 m unterer Breite hatte und der heute noch zu sehen sein soll. Dieser Fürst war über alle Maßen grausam. Eines Tages traf er eine Frau mit dem Kinde auf dem Rücken am Mörser. Er verlangte, daß sie das Kind im Mörser zerstampfe. Die Frau legte das Kind auch wirklich hinein, als es ihr nun aber fröhlich entgenlachte, warf sie die schon erhobene Mörserkeule fort, sprang dem Fürsten an die Kehle und erwürgte ihn. So kam er ums Leben.Dem Naba Naskiembi folgte in Wagadugu dessen Sohn Naba Narimiori. Dem Naba Narimtori folgte in Wagadugu dessen Sohn Naba Nasibirri. Nasibirri verlegte die Residenz nach dem Orte La.
Naba Nasibirri hatte drei Kinder, nämlich: Naba Gurndunje, der in Wagadugu Herrscher ward, die Tochter Pawere und den jüngsten Sohn Jadaga. Besagter Jadaga war der Gründer des Königreichs Jatenga.
1. Naba Jadaga. Die Geschichte der Gründung resp. Absonderung Wahigujas oder Jatengas spielte sich folgendermaßen ab. Nasibirri verteilte das Land unter seine Söhne. Seine Tochter Pawere war in La verheiratet; Jadaga erhielt Gursi. Gumdumje war zunächst in Bussuma ansässig und zeugte daselbst einen Sohn. Dann ging er nach Wagadugu. — Es sei gleich hier betont, daß die direkte Abstammung Jadagas aus Sungarana-Nasibirris Stamm mir nicht ganz sicher ist. Denn die Überlieferung berichtet: Jadaga wurde zu Lebzeiten Naba Nasibirris am Hofe des Minima-Naba erzogen. Der Minima-naba war aber ein Urenkel des Naba-Rawa. Jadaga war eigentlich zur Thronfolge in Wagadugu bestimmt. Da er aber zur Zeit des Todes Naba Nasibirris gerade beim Minima-Naba und somit von Wagadugu fern war, so benutzte Gumdumji oder Kumdumji die Gelegenheit und schwang sich auf den Thron von Wagadugu. In dieser verdrängten Lagerung fand aber Jadaga in seiner Schwester Pawere eine Helferin, die ihm ein angenehmes Plätzchen, wenn auch nicht in Wagadugu, so doch im Norden bereitete. Das absolute Recht am Kaiserstuhle von Wagadugu hing nämlich ab vom Besitz der Reichsamulette, der sog. Tido. Pawere stahl nun eines Tages dem Kumdumje diese Tido und brachte sie ihrem andern Bruder Jadaga. Jadaga brachte sie in Gursi unter und dort werden
sie heute noch aufbewahrt. Nun beschloß Jadaga die Gründung eines eigenen Reichs. Er sandte eine Botschaft an den Minima-Naba und ließ ihn bitten, zu ihm zu kommen und ihm zu helfen. Die Aufforderung lautete nach den Worten der Sage: "Komm, hilf mir, mein Kleid auszumessen." Der Minima-Naba ließ antworten, er werde kommen. Darauf ließ Jadaga eine tiefe Grube ausheben. Die Erde ward fortgeschafft und die Grube mit Matte bedeckt, so daß niemand den Tatbestand kannte. Als der Minima-Naba kam, lud ihn Jadaga ein, auf der Matte Platz zu nehmen. Der Minima-Naba trat darauf, die dünne Matte gab nach, der Minima-Naba stürzte in die Grube. Dann ließ Jadaga durch seine Frauen brühendes Wasser auf den Minima-Naba herabgießen. Darauf riß Jadaga die ganze Herrschaft an sich, und seitdem nennt man nach ihm das Land Jataga-tenga oder Jatenga. Nach Jadagas Tod regierte über Jatenga:2. Naba Jaulo Fagama, ein jüngerer Bruder Jadagas, über den nichts Besonderes zu erfahren war. Nach diesem regierte:
3. Naba Kurita, der war ein Sohn Jaulo Fagamas. Soviel ist sicher, daß Kuritas Recht auf den Königsstuhl nicht unbestritten war, daß vielmehr noch ein Sohn Jadagas am Leben war, der hieß Djedda und gab sich alle Mühe, den Kurita von dem Platze, der ihm, dem Djedda, zukomme, zu verdrängen. Auf folgende Weise erreichte er sein Ziel:
In jener alten Zeit war es Sitte, daß jeder Jatenga-König erst ein "Tido-logo", ein Haus voll heiliger Zaubermittel, das in La stand, aufsuchen mußte. Er mußte zu Fuß dorthin wandern und empfing im Umkreise dieser Tida seine eigentliche Weihe. (Man sieht also, daß Kurita sich nicht in Gursi, sondern in La weihen lassen wollte.) Als Kurita diese Pilgerfahrt angetreten hatte, verbreitete Djedda möglichst schnell im Lande die Kunde, der Kurita sei auf der Pilgerfahrt ums Leben gekommen. Als alles Volk von der Nachricht erfüllt war, war es klar, daß man ihn, den Djedda, als zukünftigen König begrüßte und Djedda wußte sich sogleich dadurch beliebt zu machen, daß er die jungen "Witwen"Kuritas unter die Großen des Hofstaates verteilte. Die nahmen dankbar die Gabe des neuen, freien Königs an. Djedda nahm also keine der Frauen für sich selbst. Kurze Zeit später ward es bekannt, daß Kurita gar nicht gestorben, sondern vollkommen gesund, am Leben und im Begriff sei, auf Wahiguja zu marschieren. Sogleich verbreitete sich nun große Furcht unter allen denen, die eine Frau des Naba Kurita in ihr Haus bekommen hatten. Sie kamen zu Djedda und fragten: "Was sollen wir tun?"Djedda sagte: "Mich geht das eigentlich nichts an, denn ich habe mit keiner der Frauen etwas zu schaffen gehabt. Das ist eure Sache. Am besten wäre es für euch, wenn der Naba Kurita nicht lebend hier ankommt,
damit ihr nicht tot von hinnen zu gehen braucht." Diesen Wink verstanden die Großen. Sie töteten Kurita-naba am Wege, ehe er an den Hof zurückkam und dann ward König:4. Naba Djedda, der Sohn Jadagas. Durch die Erfahrung seiner Vorgänger gewitzigt, versammelt Djedda sogleich alle Großen seines Reiches und ließ an alle Dorfhäuptlinge die Nachricht ergehen, alle großen Zaubermittel seien nach Gursi zu bringen und dort in einem Hause, in jenem Heiligtum, in dem auch die von Pawere in Wagadugu gestohlenen Insignien aufbewahrt wurden, zu vereinen. So geschah es. Vordem mußte der neugekrönte Naba während sieben Jahren in einem derartigen Tida-logo zubringen, von nun ab ward es Sitte, daß der neue Mogo-naba von Jatenga nur sieben Tage im Heiligtum von Gursi schläft. — Nach Djedda bestieg ein weiterer Sohn Jadagas den Thron, nämlich:
5. Naba Puschinga, der seine Residenz nach Sai verlegte und in Sai verblieb. Sonst wird nichts Besonderes von ihm gesagt. Nach ihm regierte noch ein Sohn Jadagas, der hieß:
6. Naba Sonda, der regierte in Dombori. Sonst wird nichts Besonderes von ihm berichtet. Nach ihm bestieg der letzte Sohn Jadagas den Thron, nämlich:
7. Naba Untibaregum, der regierte in Sumjaga. Es wird nichts Besonderes von ihm berichtet. Mit ihm ist die Reihe der Söhne Jadagas abgeschlossen und nun kommen Herrscher an die Reihe, von denen gesagt wird, "daß sie länger regiert hätten als die Söhne Jadagas." Es folgte zunächst der Sohn Naba Uantibaregums, das ist:
8. Naba Lamboiga, von dem nichts weiter berichtet wird, als daß er in Tangai lange Zeit regiert habe. Ihm folgte der Sohn Lamboigas:
9. Naba Sungunum, von dem nichts weiter berichtet wird, als daß er in Bugunam residierte. Ihm folgte sein Sohn:
10. Naba Sangajella, der regierte in Arrasogoma. Unter seiner Regierung soll das Reich Jatenga den Gipfelpunkt seiner Macht erreicht haben und weder vor noch nach ihm soll ein Mogo-naba von Jatenga gleichen Hofpomp entfaltet haben. Die Legende erzählt sehr umständlich:
Naba Sangajella hatte an seinem Hofe einen Elefanten, einen Löwen und einen Panther, die waren alle drei zahm und in allen Ländern sprach man von diesem wunderbaren Besitze, der ein Zeichen der ungeheuren Macht des Naba Sangajella war. Auch der Mogo-naba von Wagadugu hörte von dem Pomp und von der Pracht, die am Hofe des Naba Sangajella herrschten. Er ward eifersüchtig und ließ zwei Fulbe und einen Mossi kommen. Zu denen sagte er: "Geht zusammen nach Jatenga an den Hof des Naba Sangajella. Man sagt mir, daß Naba Sangajella mehr Pracht biete und über größere Macht verfüge als ich." — Die Boten brachen sogleich auf.
Als sie nach Arrasogonla kamen, wurden sie freundlich empfangen. Sie sahen sogleich den Reichtum, der hier herrschte, denn ihre Pferde wurden nicht an gewöhnlichen Holzpfählen festgepflöckt, sondern an Ringen festgebunden, die aus purem Kupfer bestanden. Auch wurde ihnen gesagt, daß der König sie am nächsten Tage empfangen wolle. —Am andern Tage wurden die Boten zum Empfangsplatze geführt. Sie warteten ein wenig, dann brachte man einen mächtigen Elefanten. Dann brachte man einen Panther herbei, der legte sich im Schatten des Elefanten nieder. Dann führte man einen Löwen herbei, der legte sich auch in dem Schatten des Elefanten nieder. Endlich kam der Naba Sangajella selbst. Die Leute legten ein Kissen in den Schatten des Elefanten zwischen den Panther und den Löwen. Darauf nahm der Naba Sangajella Platz, so daß er im Schatten des Elefanten lag und daß seine eine Hand auf dem Panther und die andere auf dem Löwen ruhte. Und der Naba fragte die Boten: "Ihr kommt von Wagadugu. Wie geht es dem Naba von Wagadugu?" Nachher entließ er die Boten. Sie kehrten nach Wagadugu zurück. Als sie zum Mogo-naba kamen, fragte der sie sogleich: "Ist es wahr, daß der Naba von Jatiga (Jatenga) so mächtig ist? Wer ist mächtiger, ich oder er?" Der Mossibote sagte: "Du bist mächtiger."Die beiden Fulbeboten aber sagten sogleich: "Das ist nicht wahr. Der Mossi, der mit uns war, und der dasselbe sah, was wir gesehen haben, lügt." Die beiden Fulbeboten fragten dann den Mogo-naba von Wagadugu: "Hast du je im Schatten eines Elefanten gelegen? Hat deine eine Hand je auf einem Panther, deine andere je auf einem Löwen ausgeruht? Nein, das vermochtest du nie. Du hast das nie gesehen und gekonnt. Das sahen wir aber am Hofe des Herrschers von Jatenga. Also ist der Herrscher von Jatenga mächtiger als du es bist." —Nach ihm erhielt die Königswürde von Jatenga ein Sohn Sungunums, der hieß:
11. Naba Kissum. Er schlug seine Residenz auf in Kissamba. Es war nichts Besonderes über ihn zu erfahren. Ihm folgte der eigene Sohn:
12. Naba Nabassere, der regierte in Bissigai und war ein gar kriegerischer Herr. Wie viele seiner Vorgänger und Nachfolger führte er mit dem Naba von Jako Krieg. Gelegentlich eines solchen Kriegszuges ward er von einem Pfeil getroffen und starb an der Wunde in Tugung. Ihm folgte ein zweiter Sohn Naba Kissums, nämlich:
13. Naba Njobo, der schlug seine Residenz in Sissamba auf. Es wird nichts Besonderes von ihm erzählt. Man sagt nur, daß er mit Geschick dem eigenen Sohne zur Nachfolge verhalf, das war:
14. Naba Parima, der in Uomssum residierte. Ihm folgte wieder ein Sohn Kissums:
15. Naba Kumjpaugung, der residierte in Ligi. Ihm folgte wieder ein Sohn Kissums:
16. Naba Tossedo, der residierte in Jalaka. Ihm folgte der letzte Sohn Kissums:
17. Naba Schieni, der residierte in Jeka. Ihm folgte ein Sohn des Naba Sungunum, der hieß:
18. Naba Jemba und residierte selbiger in Sitigo. Er war uralt und nicht imstande, sich zu bewegen. Darauf bestieg den Thron der erste Sohn Nabasseres:
19. Naba Pigo, der in Ubissige residierte; danach folgte ein zweiter Sohn Nabasseres:
20. Naba Kango. Die geschichtlichen Erinnerungen der nördlichen Mossistämme haften an keiner Persönlichkeit fester, als an diesem Manne. Ein Legendengewirr von typischer Üppigkeit hat sich um diesen Mann gesponnen. Das mag zum Teil in der sehr wichtigen Tatsache seinen Grund finden, daß Naba Kango der erste Herrscher Jatengas war, der sich in Wahiguja. fest ansiedelte und dieser Stadt zu einer Blüte verhalf, deren Blätter leider zum größten Teil im Winde der verschiedenen modernen Ereignisse abgerissen und verweht wurden. Es ist sicher, daß zur Zeit dieses Naba Wahiguja eine außerordentliche Entwicklung nahm, daß seine Bevölkerung sich vervielfachte, der Handel zunahm und ein großer Stapelplatz von Salzniederlagen hier entstand — und daß trotzdem die Sage fast nichts Gutes von dem Manne zu berichten weiß.—Vor allem erbaute er ein Schloß, ein Tuku. Tuku ist soviel wie ein Soro bei den Mande, d. i. ein großer Verteidigungsturm, wie ich ihn z. B. in Falaba schräg gegenüber von Sigirri photographiert habe. Bei dem Bau seines Schlosses entwickelte Kango einen ganz besonderen Ehrgeiz. Er sagte: "Ich will mein Tuku so hoch bauen, daß ich von hier, von Wahiguja aus, den Niger und Djenne sehen kann."Allerdings begann er den Bau des Schlosses, dessen Ruinen heute noch als imposante Massen aus den Feldern und Hainen emporragen, erst, nachdem er sich seines Thrones endgültig versichert hatte. Und das ist ihm, allen Anschein nach, schwer genug geworden oder gemacht worden.
Zunächst hatte der Naba Kango schwere Kämpfe mit den Naba Uabugu in Sitiga zu bestehen. Naba Kango ward geschlagen und mußte fliehen. Kango kam auf der Flucht zu dem Tenga-demba-Häuptling von Luguri. Er fragte ihn: "Sag' mir doch, was aus mir werden soll und ob ich nicht wieder Herr von Jatenga werden kann!" Der Häuptling sagte: "Ich will das Orakel befragen und ein Opferhuhn schlachten. Wenn das verendete Huhn mit dem Kopfe nach Osten auf dem Rücken liegend verendet, wirst du wieder Mogo-naba von Wahiguja werden. Wenn solcher Fall nicht eintritt, ist keine
Hoffnung für dich." — Das Huhn ward geschlachtet. Es verendete mit dem Kopf nach Westen und mit der Brust auf dem Boden liegend. Naba Kango sah dieses schlechte Zeichen und befahl: "Töte noch ein Huhn!" Der Tenga Demba opferte noch ein Huhn und dieses verendete mit dem Rücken auf dem Boden liegend und dem Kopf nach Osten. Dieses Mal war das Orakel also günstig.Darauf machte sich Naba Kango nochmals auf den Weg und floh bis nach Kong. In der Stadt Kong lebten und herrschten die gelehrten, einflußreichen und alleswissenden Mohammedaner. Naba Kango ging zum ersten unter ihnen und sagte: "Ich bin aus Wahiguja geflohen. Der Dorfchef von Luguri hat aus dem zweiten Orakelhuhn herausgefunden, daß ich wieder Mogo-naba von Wahiguja werden würde. Ich kann also nicht ohne eure Hilfe und ohne euren entscheidenden Rat, die große Schwierigkeit der Wiedereroberung meines Landes mit Mut und Hoffnung beginnen." Der große Marabut von Kong sagte: "Bring' mir einen weißen Hahn herbei."Naba Kango tat es. Der Marabut nahm den Hahn, er tötete ihn, er zerschnitt ihn in ganz kleine Stücke, er füllte sie insgesamt in einen Topf. Auf den Topf stülpte er einen Deckel, der fest schloß. Darauf sagte er zu Kango: "Warte nun sechs Tage." Am siebenten Tag hob Kango den Topf deckel empor. Da flog der weiße Hahn lebendig hervor, als ob nichts mit ihm geschehen sei. Der Marabut aber sagte: "Du hast gesehen, was ich mit dem weißen Hahn vermochte; um dich wieder zum Mogo-naba von Wahiguja zu machen, bedarf es desselben Verfahrens." Naba Kango sagte: "Wenn es nötig ist, tue es!" Der Marabut nahm den Naba Kango wie ein Opfertier. Er schlachtete, er zerschnitt den Naba Kango in lauter kleine Stückchen; er warf alle kleinen Stückchen zusammen in einen Topf. Dann stülpte er einen Deckel darüber. Hierauf ließ er den Topf sechs Tage lang stehen. Als er am siebenten Tage den Deckel lüftete, kam Naba Kango unbeschädigt, wohlerhalten an allen Gliedern und gesund wieder aus dem Topf heraus. Das alles sah der Naba Saga mit an. Der Naba Saga war der jüngere Bruder des Naba Kango, der hatte ihn auf seiner Reise bis hierher begleitet. Der Marabut sagte zu: Naba Kango: "Nun kehre getrost in dein Land Jatenga zurück. Allah wird dir alles geben, was du brauchst. Nur eines ist dir versagt. Dein Sohn wird nicht alt genug werden, um dir auf den Thron folgen zu können." Naba Kango sagte: "Das macht mir nichts, denn mein jüngerer Bruder Saga, der mich begleitet, kann mir nachfolgen und seine Kinder gelten mir ebensogut wie die meinen. Sorge du nur, daß er einen Sohn habe." Darauf wurde der Naba Saga mit vielerlei Medikamenten gewaschen, auf daß ihm Nachkommen erwüchsen.
Der Marabut sagte noch allerhand zu den beiden Nabas, dann verließen
die beiden Kong. Sie reisten nun beide nach Segu. Naba Kango führte einen Strauß mit sich. Als er mit seinem Bruder und dem großen Vogel nach Segu kam, fragten ihn die Leute: "Was ist das für ein Vogel, den du da bei dir führst?" Naba Kango sagte: "Das ist ein Huhn aus Jatenga." Die Leute in Segu fragten: "Sind alle Hühner in Jatenga so groß?" Naba Kango sagte: "Ja, sie sind alle so groß." Die Leute sagten: "Laß uns mit dir gehen, damit wir auch solche Hühner kaufen und essen können." Der Naba Kango sagte: "Es ist gut, kommt nur mit mir." Es schlossen sich ihm viele an. Er kam aus einem Orte in den andern. In allen Städten und Dörfern bewunderten die Leute das große Huhn, erkundigten sich nach seinem Ursprung, baten um die Erlaubnis mitzugehen und schlossen sich ihm an. So wuchs die Zahl seiner Begleitung von Tag zu Tag.Der Marabut in Kong hatte dem Naba Kango ein kleines Gewehr, eine Feuersteinpistole, gegeben und gesagt: "Nimm dieses kleine Gewehr mit. Wenn du nach Jatenga zurückkommst, wird dir ein Tansoba mit Truppen entgegenkommen. Auf den schieße mit dem kleinen Gewehr. Wenn dann beim Abschießen dein eigener Daumen weggerissen wird, so betrachte dies als gutes Zeichen, dann ist dir der Sieg sicher. Bleibt aber deine eigene Hand unversehrt, so ist das schlecht, so ist das ein Zeichen, daß deine Zeit noch nicht gekommen ist." Mit dem kleinen Gewehr aus Kong und seiner Truppenmacht aus Segu marschierte Naba Kango nun auf Jatenga zu. Zwischen den Dörfern Gomboro und Tangare kam ihm der feindliche Tansoba entgegen. Dieser Tansoba rief ihm zu: "Komm zurück! Dein Bruder tut viel Schlechtes im Lande und alle Leute hoffen auf dich!" Naba Kango gedachte aber der Aufforderung des Marabut in Kong. Er schoß mit dem kleinen Gewehr auf den feindlichen Heerführer und als der Schuß losging, ward ihm der eigene Daumen abgeschlagen. Das war ein gutes Zeichen. Er schlug seinen Bruder, den Usurpator, und jagte ihn bis nach Jako. Er selbst aber ward wieder Mogo-naba von Jatenga. —
Nunmehr begann er das Schloß zu bauen, das so hoch werden sollte, daß er von dessen Dache aus bis nach Segu und dem Niger schauen könne. Er ließ zum Baue viele Leute aus allen Teilen seines Landes zusammen kommen. Als der Hauptturm einige Stock hoch aufgeführt war, stürzte er zusammen und begrub viele Leute in seinen Trümmern. Er sagte: "Das ist mir gleich, beginnt von neuem!" Darauf ward wieder begonnen. Der Turm stürzte oft ein und begrub oft fünfzig und hundert Bauleute unter sich. Der Naba Kango sagte aber stets: "Es ist mir gleich, beginnt von neuem!"
Eine besondere Sache hatte Naba Kango mit den Fulbe im Norden zu erledigen. In Homburi wohnte ein großer Fürst der Fulbe, der hatte zahlreiche Herden und viele Hirten. Ein Diawando des Fürsten
pflegte seine Herden weit nach dem Süden zu treiben. Da war ein Ort, an dem gab es sehr viele Strauße und Perihühner und der Diawando suchte hier deren Eier. Deshalb nannte man den Ort Djellegobi (d. i. Djelgoddi der Habe und der Karte). Der Diawando sandte von den Eiern häufig an seinen Fürsten nach Homburi. Der Hornburifürst freute sich hierüber, nahm die Geschenke an und machte dem Diawando Gegengeschenke. Auch kam er dann und wann nach Djellegobi zu Besuch. So nahm durch eigene Tüchtigkeit und durch das Wohlwollen seines Fürsten die Macht des Diawando immer mehr zu, so daß er zuletzt eine große Selbständigkeit erreichte und versäumte, seinem Fürsten seine Besuche zu machen. Das hatte aber zur Folge, daß der Fulbefürst von Homburi dem Diawando eines Tages den Befehl zukommen ließ, nach Homburi zurückzukehren.Der Diawando kam diesem Befehl nicht nach. Vielmehr sandte er eine Botschaft nach Wahiguja zu Naba Kango, dem Mogo-naba von Jatenga und ließ ihm sagen: "Ich will meinem Herrn, dem Fürsten von Homburi nicht mehr gehorchen! Hilf du mir, ihm Widerstand zu leisten!" Der Naba Kango ließ dem Diawando antworten: "Ich kann dir zur Zeit keine Leute leihen. Ich habe aber von Kong ein Zaubermittel von außerordentlicher Kraft mitgebracht, das stelle ich dir für deinen Feldzug zur Verfügung. Es ist das ein heiliger Bare, Pferdepflock, der den Namen Kirre hat. Er besteht nicht wie andere Pferdepflöcke aus Holz, sondern aus Eisen. Schlage den Kirre in der Mitte deines Gehöftes ein und du wirst einen großen Erfolg sehen. Es wird dir niemand etwas anhaben können." Der Diawando bot darauf hin seinem Fürsten Trotz. Der Fürst sandte Truppen. Die Truppen wurden vom Diawando geschlagen. So ward der Diawando mit Hilfe des Kirre selbständig.
Nach einiger Zeit sandte der Naba Kango an den Diawando eine Nachricht und ließ ihm sagen: "Ich habe dir mit meinem Kirre gegen deinen Fürsten geholfen. Nun sende mir entweder den Kirre zurück oder zahle mir hinfort Abgabe." Der Diawando ließ darauf antworten: "Ich bin dir für deinen Kirre sehr dankbar. Möglicherweise brauche ich ihn auch in Zukunft und deshalb kann ich ihn dir nicht wiedergeben. Abgaben werde ich dir aber nicht zu zahlen brauchen, solange der Kirre in meinen Händen ist." Als Naba Kango diese schnöde Antwort erhielt, rüstete er sogleich Truppen und gab den Befehl den widerstrebenden Diawando zu züchtigen, ihm den Kirre wieder abzunehmen und ihn zu zwingen, in Zukunft Abgaben zu zahlen. Die Truppen machten sich auf den Weg und kamen nach Djellegobi. Sie wollten die Plünderung beginnen. Aber jede Kuh, die die Krieger wegführen wollten, jeder Ochse, den sie wegtreiben wollten, warf sich zu Boden und niemand vermochte es, die Tiere wieder emporzubringen, so fest lagen und hafteten sie am Boden.
Das war die Wirkung des Kirre, den Naba Kango aus Kong mitgebracht und den er dem Diawando geliehen hatte. Die Leute suchten den Kirre, aber sie konnten ihn nicht finden. Sie kehrten unverrichteter Sache nach Wahiguja zurück. Seitdem aber besteht zwischen den Mossi von Jatenga und den Fulbe von Djellegobi Krieg. Bis heute ist kein Friede zwischen beiden Völkern geschlossen.Eines Tages beschloß der Naba Kango mit dem Mogo-naba von Wagadugu Krieg zu führen. Er rüstete eine starke Truppenmacht und stellte diese unter den Befehl seines Bruders, des Naba Saba. Er begleitete mit seinen eigenen Truppen seinen Bruder ein gutes Stück weit und sandte dann den Naba Saga weiter, daß er die Sache mit Kraft anfasse. Er selbst blieb mit seinen Leuten liegen. Er erwartete in seinem Lager eine Nachricht von seinem Bruder, dem Naba Saga. Die Botschaft ließ sehr lange auf sich warten. Im Lager Kangos entstand daher Unruhe. Eines Tages sangen die Pendaga, Spielleute, vor dem Naba Kango: "Der Mogo-naba von Wagadugu ist zu mächtig; wir werden in dem Kampfe unterliegen. Es ist besser für uns, wenn wir heimkehren." Der Naba Kango antwortete: "Ich will hier abwarten, bis mein Bruder Naba Saga zurückgekehrt ist. Eher werde ich diesen Platz nicht verlassen." Er blieb mit seinen Leuten liegen. Eines Tages kam der Naba Saga in großer Hast angejagt. Sein Pferd war von sechzehn Pfeilen getroffen, die ihm im Leibe steckten. Als Naba Saga vor dem Naba Kango angekommen war, brach das schwer verwundete Pferd zusammen, überschlug sich und starb. Naba Kango fragte seinen Bruder: "Ist in Wagadugu für uns etwas zu machen?" Naba Saga sagte: "Du siehst es ja selbst. Betrachte mein Pferd und urteile. Wenn du es aber willst, bin ich natürlich bereit, den Krieg fortzusetzen." Naba Kango sagte: "Ich sehe die sechzehn Pfeile, das genügt mir. Wir wollen zurückkehren." So kehrte er mit seinem Bruder von dem Feldzuge gegen Wagadugu unverrichteter Sache zurück. —
Eines Tages sandte Naba Kango eine Botschaft nach dem Dorfe Sabuni und ließ sagen: "Die Bewohner von Sabuni sollen mir Luftziegel herstellen, denn ich will bauen." Die Bewohner von Sabuni hielten eine Versammlung ab und sagten unter sich: "Das hat noch niemand von uns verlangt; das ist nicht unsere Sache. Wir wollen es dem Mogo-naba mitteilen." Sie sandten den Boten zurück und ließen dem Mogo-naba sagen: "Noch niemals hat man von uns verlangt, Luftziegel zu machen. Du bist aber unser Mogo-naba, verlangst du unwiderruflich, daß wir Luftziegel machen?" Der Naba Kango ließ antworten: "Ja, ich verlange unbedingt, daß ihr mir Luftziegel macht." Die Leute von Sabuni sagten: "Wir werden also deinem Befehle nachkommen. Du wirst aber erstaunt darüber sein, was passiert!" Die Sabunileute machten sich sogleich an die Arbeit.
Sie fertigten fünftausend Luftziegel an. Sie sagten: "Wir haben, dem Befehl des Mogo-naba nachkommend, fünftausend Luftziegel gemacht. Nun wollen wir diese fünftausend Luftziegel auch nach Wahjguja marschieren lassen." Dann schnitten die Sabunileute Stöcke und begannen auf die Luftziegel loszuschlagen. Darauf begannen die Luftziegel zu laufen. Sie liefen so schnell sie konnten. Die Luftziegel begannen immer schneller zu laufen. Die Sabunileute jagten sie, jagten sie, bis sie ohne alle andere Hilfe auf Wahiguja zu marschierten. Die Sabunileute trieben sie einfach vor sich her, sowie die Hirten eine Ochsenherde treiben. Sie trieben die fünftausend Luftziegel bis zum Dorfe Juba. Als sie so weit gekommen waren, kam beim Naba Kango eine Botschaft an, die lautete: "Die Sabunileute haben fünftausend Luftziegel bereitet, sie treiben sie jetzt wie die Hirten eine Ochsenherde vor sich her. Die Luftziegel laufen ganz von selbst und sind schon beim Dorfe Juba angekommen." Als der Naba Kango das hörte, befiel ihn große Furcht. Er sandte sogleich eine eilige Nachricht und ließ sagen: "Die Luftziegel der Sabunileute sollen sogleich, da wo sie sind, liegen gelassen werden. Ich will sie nicht mehr haben und will sie überhaupt nicht sehen." Der Bote mit der Nachricht rannte auf dem kürzesten Wege so schnell wie möglich von dannen. Aber als er nach Juba kam, waren die Ziegel schon weitergetrieben. Der Bote lief hinterher und traf sie erst, als sie schon ganz dicht bei Wahiguja angekommen waren. Als die Sabunileute die Nachricht vernahmen, trieben sie die Ziegel nicht weiter. Sie blieben alle zusammen auf einem Haufen liegen. Sie bildeten einen Hügel, den man noch heute sehen kann. Er ist im Lande wohlbekannt und hat den Namen Kabine-Tanga.Eines Tages sandte der Naba Kango an die Bewohner des Ortes Ninga eine Botschaft, die lautete: "Stellt sogleich Kalebassen her und sendet sie umgehend, denn ich benötige sie für den Haushalt meiner Frauen!" Als die Ningaleute die Nachricht empfingen, hielten sie eine Versammlung ab und sagten: "Wir haben diese Gewohnheit nicht. Wir sind Tanga-Dumba. Wir machen keine Kalebassen. Wir wollen das dem Mogo-naba sagen." Alle sagten: "Wir wollen das dem Mogo-naba sagen." Sie sandten eine Botschaft an den Mogo-naba, die lautete: "Wir Leute von Ninga sind nie Kalebassenmacher gewesen, wir sind Tenga-Dumba." Der Naba Kango ließ ihnen aber antworten: "Ich verlange von euch die Kalebassen für den Haushalt meiner Frauen." Als die Leute in Ninga die Nachricht empfingen, pflanzten sie sogleich einen Kürbiskern. Dieser Kürbiskern keimte augenblicklich, und sehr schnell sprossen Zweige aus dem Keime hervor, der pflanzte sich mit großer Schnelligkeit fort; er schlängelte sich in der Richtung auf Wahiguja fort, langte dort an, ließ Blüten aufgehen und dann zwanzig Kürbisse keimen.
Der Mogo-naba wußte nichts davon. Als eine Spanne Zeit verstrichen war, sandte er eine neue Botschaft nach Ninga, die lautete: "Vor längerer Zeit habt ihr den Auftrag erhalten, Kalebassen für den Haushalt der Frauen des Mogo-naba nach Wahiguja zu schaffen. Wo bleiben die Kalebassen ?" Die Leute von Ninga antworteten: "Der Mogo-naba soll hinter seinen Hof sehen. Die Kalebassen sind schon lange angelangt. Wir sind nicht so mächtig als Naba; wir wissen aber unsere Angelegenheit doch auch in besonderer Weise zu regeln." Der Mogo-naba empfing die Botschaft; er schaute hinter seinen Hof und sah die Kürbisranke aus Ninga und daran die zwanzig Kürbisse. Da bekam er Angst und sagte zu den Ningaleuten: "Behaltet lieber eure Kalebassen." —Bei den Mossi war es in jener alten Zeit Sitte, daß nur die Großen und die Vornehmen lange Beinkleider trugen. Das niedere Volk mußte sich mit kurzen, zwischen den Beinen hosenartig durchgezogenen Zeugstreifen begnügen. Ein Aufseher der Sklaven des Königs war nun groß und angesehen geworden und der Mogo-naba hörte, daß der Mann die Angewohnheit angenommen hatte, bei sich zu Hause lange Hosen zu tragen. Der Naba Kango dachte: "Dieser Mann wird mir zu groß, ich werde ihn beiseite bringen." Er sagte einem Boten: "Laufe sogleich zu dem Sklavenaufseher und sage ihm, er soll schnell zu mir kommen, das Fleisch herzurichten." Der Bote lief hin. Er traf den Sklavenaufseher in seinem Hause, angetan mit langen Beinkleidern. Er sagte: "Naba Kango ruft dich. Du sollst sogleich zu ihm kommen, um Fleisch zu zerlegen." Der Sklavenaufseher sagte: "Ich komme sofort." Er wechselte schnell die lange Hose (Kurugu genannt) mit dem kürzeren Lendenhöschen (Pogei genannt), nahm seine Fleischaxt auf die Schulter und machte sich auf den Weg zum Mogo-naba. Naba Kango sah ihn an und sagte: "Es ist dein Glück, daß du im Sklavenkleid kommst. Andernfalls wärst du verloren gewesen. Nun geh, ich habe genug Leute zum Fleisch zerteilen." —
Eines Tages ward eine der Frauen Kangos guter Hoffnung. Es war aber keine sittengemäß geheiratete Frau. Man verkündete das weit im Lande, und als das Kind glücklich geboren war, brachten die Leute von allen Seiten Geschenke, zumal Stoffe, Kleider und dergleichen herbei, damit alles recht feierlich und großartig hergehe. Die großen und vornehmen Minister der Umgebung des Naba Kango sagten aber: "Dieser Mogo-naba, Naba Kango, ist ein ungemein grausamer und gewalttätiger Mann. Es wäre schlimm, wenn solchem Herrscher ein noch schlimmerer Nachkomme folgen würde." Dann trugen sie, gleich wie bedacht auf Ehrung dieses Kindes, viele Stoffe und Kleider herbei. Sie riefen: "Man gebe dem Kinde, was ihm zukommt" und häuften so lange Kleider und Stoffe über ihm auf, bis
es erstickt war. Dann sagte man dem Naba Kango: "Dein Kind ist geboren, es ist aber auch wieder gestorben." Der König antwortete: "Man sagte mir schon in Kong, daß ich keinen Nachfolger aus eigenem Blute haben würde." —Naba Kango war über alle Maßen streng und sehr grausam. Von seinem Turme aus konnte er weit über das Land sehen. Er sah, wenn abends die Skiavinnen und Arbeiterinnen seines Hofes fort und Zwischen den Feldern hingingen, um Wasser oder Holz zu holen. Wenn dann ein Vorübergehender nur mit diesen Hofsklavinnen nichts weiter als ein freundliches Wort wechselte, so ließ er ihn zu sich kommen, sagte ihm, daß er gegen die Ordnung gehandelt hätte, indem er mit den Hofsklavinnen sprach, und ließ ihn töten.
Solchergestalt tötete er viele Leute. Eines Tages sagte er: "Ich habe genug getötet, ich habe genug Leute auf die gewöhnliche Weise hinrichten lassen. Von jetzt ab will ich nicht mehr so töten wie sonst, sondern ich will einmal verbrennen." Darauf ließ er in der Nähe von Pinschi die Schmiede viel Holz schlagen und zu einem großen Haufen zusammenwerfen. Darin ließ er Männer und Weiber in großer Menge verbrennen. Seit der Zeit aber wächst an dem Platze kein Holz mehr.
Naba Kango regierte im ganzen dreißig Jahre. Nach seinem Tode bestieg den Thron sein Bruder.
21. Naba Saga. Es war der gleiche, der den Naba Kango auf der Reise nach Kong begleitet hatte. Er residierte in Tsiga. Dauer seiner Regierung unbekannt. Nach ihm bestieg den Thron in Jatenga ein vierter Sohn Nabasseres:
22. Naba Kanko, der nicht mit dem Naba Kango zu verwechseln ist. Er regierte nur sehr kurze Zeit in Kumsidiga. Im folgte ein Sohn des Naba Saga:
23. Naba Tunguri, der regierte unbekannte Zeit in Wahiguja. Ihm folgte wieder ein Sohn des Naba Saga:
24. Naba Tanga, der regierte fünf Jahre lang in Wahiguja. Ihm folgte wieder ein Sohn des Naba Saga:
25. Naba Ragongo, der regierte unbekannte Zeit in Wahiguja und hatte zum Nachfolger abermals einen Sohn Naba Sagas.
26. Naba Saguru, der regierte unbekannte Zeit in Wahiguja. Er gründete Nabasinigama, "den Platz der Könige". Ihm folgte wieder ein Sohn des Naba Saga:
27. Naba Totebalebo, der residierte in Siga. Er führte einen schweren Krieg mit Rischiam bei Koroko, Sabaseing und Korra. Er verbrannte alle Städte und jagte den feindlichen Fürsten auf den Berg. Nun bat der so geflüchtete Rischiam um Frieden. Rischiam ließ sagen: "Wir sind Verwandte und bei der ganzen Sache handelt es sich doch nur um eine Frau!" Naba Totebalebo war damit einverstanden.
Der Friedensschluß kam zustande, und der Mogo-naba von Jatenga machte sich wieder auf den Heimweg. Diesen Rückmarsch benutzte Jembe, der Bruder Totebalebos, den Herrscher aus dem Wege zu räumen und sich selbst auf den Thron zu bringen.Man erzählt, Totebalebo sei blind gewesen. Als der führende Fulbe den Mogo-naba nun auf das Dorf Darrigima beim See Bama zuleitete, verbreitete Jembe im Hintergrunde, d. h. unter dem Nachtrabe, plötzlich das Gerücht, Rischiam habe den Friedensvertrag gebrochen und greife plötzlich die abziehende Armee Totebalebos im Rücken an. Sogleich bemächtigte sich der Leute eine große Panik. Alles drängte nach vorn, und der mit fortgerissene blinde Naba Totebalebo jagte unversehens auf das Ufer des Sees zu, indessen Schlamm er erstickte. Jembe hatte seinen Zweck erreicht. Er bestieg als Nachfolger Totebalebos den Thron. Somit regierte wieder ein Sohn Naba Sagas:
28. Naba Jembe. Obgleich man das nach der hinterlistigen Weise, in der er seinen Bruder ums Leben und sich auf den Thron gebracht hatte, nicht glauben sollte, gilt er als der beste Mogo-naba, der je über Jatenga herrschte. Er regierte siebenundzwanzig Jahre lang in Wahiguja. Unter seiner Regierung unternahm eines Tages der Fulbekönig Balobo von Tenekung, Kako und Konari einen anscheinend religiösen Kriegszug gegen die Fulbe von Djellegobi. Die Fulbe von Djellegobi flohen zu Naba Jembe nach Wahiguja und baten um den Schutz des Herrschers von Jatenga. Der ward ihnen zuteil. Naba Jembe sandte seinen Tansoba gegen Balobo, und der gewann den Sieg. Jembe gründete Diniuokoro und andere Ortschaften. Sein Nachfolger war ein Sohn Naba Kankos, nämlich:
29. Naba Sannurn, der nur zwei Jahre in Sisamba regierte und von dem nichts Besonderes gesagt wird. Ihm folgte ein Sohn des Naba Tuguri:
30. Naba Ngoboga, der residierte fünf Jahre in Wahiguja. Ihm folgte ein Sohn des Naba Totebalebo:
31. Naba Pigo, der nur sieben Monate in Wahiguja residierte und dem folgte nach ein Sohn des Naba Jembe:
32. Nabo Baogo, regierte von 1884 bis 1895 in Wahiguja. Das wichtigste Ereignis in seinem Leben war ein sehr schwieriger Krieg gegen Mamadu Laki, den mohammedanischen Fulbeherrscher in Bandiangara. Naba Baogos Lage ward dadurch so schwierig, daß ihm im eigenen Lande in Bagare, in einem Sohn des Naba Tunguri ein gefährlicher Widersacher erwuchs, der sich im Jahre 1894 mit dem Fulbeherrscher vereinte und Naba Baogo zwang, auswärts eine Hilfe zu suchen. Sein Appell an den damals eingesetzten französischen Militärchef von Bandiangara hatte zur Folge, daß beiden Königsparteien Friedenshaltung anbefohlen wurde. Naba Baogo war damit nicht gedient. Nach Darstellung der Mossi ward er durch die
Fulbe nochmals zum Kampfe gezwungen, der sich bei Tiu abspielte. Nach Angabe der Fulbe hat Naba Baogo den Kampf nochmals begonnen. Jedenfalls ward der Naba Baogo bei dem Streite durch einen Pfeilschuß verwundet und starb kurz nach dem Wiedereintreffen in Wahiguja an den Folgen dieser Verwundung. Ihm folgte sein Widersacher Bagare, der als Mogo-naba von Jatenga den Namen annahm:33. Naba Bulli (der Sohn Tunguris), der vom 26. Januar 1896 bis 1899 in Wahiguja regierte. Das Eintreten in die Regentschaft ward ihm sehr schwer gemacht, da die wichtigste Partei im Lande gegen den "Bundesgenossen der Fulbe"eingenommen war. Ja, er soll nach den alten Landesgesetzen nicht einmal erbberechtigt gewesen sein. Die Nachkommen des Naba-Saga befehdeten ihn und machten ihm die Lage so schwierig, daß er seine alten Bundesgenossen, die Fulbe in Massina und die französische Regierung zur Hilfe in Anspruch nahm. Sie verhalfen ihm im Jahre 1898 zur rechtmäßigen Anerkennung und Königsweihe zu Gursi. — Ihm folgte wieder ein Sohn des Naba Tunguri:
34. Naba Ligidi, der regierte vom 4. Februar 1899 bis zum 12. Februar 1902. Er war ein bequemer, nach jeder Richtung seniler und stumpfer Mann, dem das Mogo-nabatum ganz gleichgültig war und der dem "Rufe des Volkes" nur Folge leistete, weil seine Großwürdenträger es verlangten. Diese nämlich fürchteten, die Oberherrschaft ihrer Familien aus den Händen zu verlieren, wenn jetzt, was evtl. geschehen konnte, ein Sagasproß ans Ruder käme. Ihm folgte ein Sohn Naba Ngobogas:
35. Naba Kaboga, der am 28. Februar 1902 in Wahiguja die Weihe empfing und bis zur Zeit meiner Abreise herrschte. Er ist ein alter, ziemlich stumpfsinniger Herr, dem am Absynth mehr liegt als an selbständiger Herrscherwürde. Er wird der französischen Regierung jedenfalls keine Schwierigkeiten bereiten.
3. Bericht der Mossi von TenkoduguDie Traditionen der Mossi von Tenkodugu führen zurück bis nach "Bingo", das dem heutigen Fada-Gurma entsprechen soll. Der Sage nach zogen die Ahnen aus dieser Heimat Bingo nach Gambakko, das im englischen Goldküstengebiet liegt. Näheres ist unbekannt. Von Gambakka erfolgte die Wanderung der Mossi nach Tenkodugu, von Tenkodugu endlich zur heutigen Reichshauptstadt Wagadugu. Von der Auswanderung aus Gambakka erzählt der Volksmund.
Der Gambakka-naba hatte viele Töchter. Allen gab er Männer, nur einer nicht; das war Njallanga, seine Älteste. Sie sollte unbemannt bleiben. Njallanga war darob entrüstet und pflanzte eine Mana, eine lange Aubergine. Die Mana keimte, wuchs auf und trug
oben an der Spitze endlich eine lange schöne Manafrucht. Die Frucht wuchs hoch oben. Njallanga aß aber diese Frucht nicht. Sie betrachtete sie, pflegte sie, aber nahm sie nicht ab. Der Gambakka-naba fragte sie eines Tages: "Du hast eine schöne Mana. Weshalb bereitest du keine Speise davon?"Njallanga sagte: "Es soll ihr so geschehen wie mir. Alle meine Schwestern sind verheiratet. Nur ich habe keinen Mann. So mag meine Mana auch ungenützt bleiben gleich mir." Der Vater und die Tochter stritten sich zuletzt darüber. Endlich aber stahl Njallanga eines Tages das Pferd ihres Vaters und ritt heimlich von dannen in den Busch. Im Busch wußte sie nicht Bescheid. Großer Durst befiel sie. Endlich entdeckte sie das Lager eines Jägers. Der hieß Riala. Riala war vorn Stamme der Dagana. (Wo die Dagana heimisch sind, konnte mir keiner der Leute sagen.) Njallanga verliebte sich in Riala. Riala verliebte sich in Njallanga. Sie schliefen und blieben beieinander. Als Sohn ward ihnen der erste Sprosse der Mossi geboren, den nannten sie Uidi Rogo. Das war der erste "Mossiknabe". Den von da ausstrahlenden Stammbaum zählten mir die Tenkoduguleute folgendermaßen auf:1. Uidi Rogo 2. Naba Jungurana 3. Naba Ubri 4. Naba Bondogo 5. Naba Mallaka 6. Naba Tjemmogo 7. Naba Rabuile 8. Naba Bugu 9. Naba Sigilli 10. Naba Djigimpolle 11. Naba Jemde 12. Naba Bongo 13. Naba Sailugo 14. Naba Djigimde 15. Naba Sapellema 16. Naba Sannam-Saare 17. Naba Karongo, gestorben 1907 18. Naba Korn, zur Zeit meiner Durchreise Herrscher. Alle diese Herrscher sollen jeder immer der Sohn des Vorhergehenden gewesen sein. |
Die historische Vergangenheit der Stämme von Bingo oder Fada-Gurma beansprucht ganz besonderes Interesse, denn sie stellt
den Übergang zwischen den Mossi und den Ostsonghai dar. So war es mir denn eine große Freude, als der Administrateur der französischen Station Fada-Gurma meiner Bitte Raum gab und mir einige alte, in der Geschichte wohlbewanderte Leute zu Studienzwecken nach Wagadugu sandte. Später konnte ich selbst noch einiges im Mobalande hören und endlich hatte auch Hauptmann Mellin die Freundlichkeit, den auf deutsches Gebiet entflohenen König von Pama abzuhören. Wie nachgehend an der Hand des Stammbaumes gezeigt werden wird, entsprechen meine in Wagadugu gesammelten, und die von Hauptmann Mellin in Mangu gesammelten Stammbaumangaben einander vollkommen.Die Bingoleute Gurmas nennen sich selbst Binumba (Sing. Bina) und berichten von ihrem Ursprunge folgendes:
Djaba, der erste Mensch, fiel vom Himmel zur Erde herab. Damals war die Erde noch weich, und so drückten sich seine Glieder tief in die Erde ein. Man kann diese Stelle heute noch sehen. Otiennu, das ist Gott, sandte noch andere Menschen alidort herab, und so ward das Menschenvolk. Vor allen war aber Djaba der erste. Als er kam, hatte er seine Kalebasse bei sich. Er verließ den Platz, an dem er herniedergekommen war, und baute sich andern Ortes an. Da errichtete er Häuser. Aber jener Ort des ersten Herniederkommens wird heute noch heilig gehalten. Er heißt Lompodenni und liegt etwa vier Tagereisen nördlich von Fada-Gurma. Kein Mensch darf daselbst seinen Acker bauen. Bis vor kurzer Zeit (die heutige Landeshauptstadt ist ein wenig weit entfernt und so hat man den Brauch aufgegeben) wurden daselbst große Opfer dargebracht und viele heilige Zeremonien abgehalten. — Djaba gilt auch als erster Gesetzgeber und Ordner. An dem Tage, da er herniederfiel, sagte er: "Meine Leute sollen nicht Usuano (Vampyrmenschen, in Mande Subaga) werden. Sie sollen auch nicht Djondjonne (Diebe) sein." Fernerhin sagte er: "Bis heute sind es nicht viele Menschen. Aber es werden deren sehr, sehr viele werden. Ihr sollt andere Völker bekriegen, aber unter euch sollt ihr immer Frieden halten." Im Anfange bestellten die Binumba nicht den Acker. Djaba und seine Leute gewannen Korn, Vieh, Frauen und Kleider nur durch Kriege. Die Vornehmen sind bei dieser Lebensweise geblieben und lassen heute noch die Sklaven arbeiten, selbst nichts anderes tuend als befehlen.
Eines Tages wurde Djaba krank. Er war sehr lange krank und starb endlich. Man packte ihn auf ein Pferd und führt ihn so ans Flußufer, wo der Strom eine große Höhle in den Felsen gefressen hatte. Ein Pferdejunge führte das Pferd mit der wertvollen Last dahin. Der Junge kam nicht wieder. Man weiß nicht, wo Leiche, Pferd und Pferdejunge geblieben sind. Auch kennt man die Stelle nicht
mehr, an die die Leiche gebracht war. Nur erinnert man sich noch recht genau der Einkleidung der Leiche. Es war ein Stier getötet, seine Haut abgezogen und dahinein die Leiche gehüllt worden. Darauf hatte man sie auf einen Pferdesattel gesetzt und ihr ein weißes Gewand umgehängt, so daß es war, als wenn ein Lebender ritte. Auf dem Pferdesattel war er festgebunden und fortgeführt.Ihm folgte sein ältester Sohn Tidafo oder Tidabo. Man betrachtet ihn, glaube ich, als den ersten König von Fada-Gurma. Der Sohn dieses Obato (Obato soll das alte Wort für König sein) ging nach Gambakka. Er gewann viele Anhänger, indem er an tapfere, aber arme Leute Kleider, Pferde und auch wohl ein Weib vergab. Als er so ein starkes Gefolge beisammen hatte und eines Tages von einem Großen, namens Djamfallama, hörte, versammelte er die sorgsam gewonnenen Freunde, überfiel jenen und zerstörte dessen Markt. Djamfallama war der Herr eines Kanibalenvolkes, das weit im Süden, weit südlicher als Djuggu oder Dsuggu (Wangara) wohnte. Möglicherweise ist dieser Name aber nicht der eines Königs, sondern der eines Volkes. Nach diesem Kriege lebte er außerordentlich friedlich. Ihm folgte sein Sohn Untani.
Von dem Obato Untani erzählte man sich sehr merkwürdige Sachen. Er soll ein riesengroßer und grausig starker Mann gewesen sein. Er hatte die Gewohnheit, am Morgen Pfeil und Bogen zu nehmen und auf die Jagd zu gehen. Gemeiniglich erlegte er einen Elefanten, und von dem verspeiste er dann die Hälfte. Er war so stark, daß er einen Elefanten auf dem Kopfe zu tragen vermochte. Über den Arm gestreift trug er einen Litandi genannten Steinring, der war von so mächtigem Umfange, daß ihn kein gewöhnlicher Mensch über den Arm zu streifen vermochte. Ähnliche Steinringe werden übrigens heute noch in Billanga hergestellt. Untani war nur Jäger und führte keine Kriege. Von seinen Jagden aber werden ganz erstaunliche Sachen erzählt. So sollte er eines Tages einen Elefanten lebend fangen. Er packte ihn an einem Zahn. Er hielt ihn fest. Unter dem Sträuben des Elefanten brach das Elfenbein. Der Zahn blieb in der Hand Untanis, und der Elefant lief von dannen.
Ihm folgte sein Sohn Banjiroba, der war im Gegensatz zu seinem Vater außerordentlich kriegerisch. — Leider brach an dieser Stelle die Geduld meiner Legendenerzähler ab. Ich mußte froh sein, die historischen Angaben schon vorher verzeichnet zu haben.
Indem ich hier den Stammbaum mit der Angabe der Gebietseinnahme wiedergebe, betone ich, daß in Gurina, ebenso wie im alten Mossi jeder Herrscher eine neue Provinz aufgesucht zu haben scheint, die sein Sohn (vielleicht als Kurita) besiedelte.
Mellins Reihe,
Die von mir in Wagadugu aufgenommene aufgenommen
Reihe in Sansanno Mangu |
1. Djaba, lebte in Lompodenni. Siehe oben. Fehlt
2. Tidafo oder Tidabo, sandte seinen Sohn nach Tiderpo
Gambakka. Nachkommen sollen heute
noch im Dorfe Madjoali wohnen.
3. Untani sandte seinen Sohn nach Tenkodugu. Untah
Nachkommen sollen noch in Piete oder
Piedo wohnen.
4. Bairoba sandte seinen Sohn nach Bulsi oder Banyidoba
Bulsena. Nachkommen sollen heute noch
in Konguaung wohnen.
5. Labetieto sandte seinen Sohn nach Bilanga. Labedeto
Nachkommen sollen noch in Toboga wohnen.
6. Tedi Utueteba sandte seinen Sohn in das Tantodeba
Land Djaforri, d. i. die Gegend von Sansannu
Mangu. Die Leute nennen ein Dorf
"Kankambo". Sollte das das Konkombavolk
sein? Jedenfalls ward dieser Sproß
Djaforrinaba genannt. Nachkommen sollen
noch in Sabodaga wohnen.
7. Tokurum sandte seinen Sohn in das Land Takurmu
Boko, das westlich von Fada Gurina liegen
soll. Nachkommen sollen noch in Jirine
leben.
8. Nima sandte seinen Sohn nach Janga zwi- Nyima
sehen Tenkodugu oder Pama. Wohl gleichbedeutend
mit Sanga. Nachkommen noch
in Nagali.
9. Bogali sandte seinen Sohn nach Gajelli, das Goli (offenbar
zwischen Fada-Gurma und der französi- mit dem Fol.
sehen Nigerortschaft Njame gelegen ist. genden ver-Nachkommen
noch in Logobu. tauscht)
10. Goli sandte seinen Sohn in die gleiche Rich- Borle (offenbar
tung nach Boti oder Botu, das auch nach mit dem Vor-Njame
oder Niamey hin liegt. Nachkom- hergehenden
men noch in Kinde-komu. vertauscht)
11. Kambambi sandte seinen Sohn nach Kallungu Kambamba
oder Djallungu, das in gleicher Gegend
liegen soll. Nachkommen noch in Tanga.
Mellins Reihe,
Die von mir in Wagadugu aufgenommene aufgenommen
Reihe in Sansanno
Mangu |
12. Tantjalli oder Tankjalli sandte seinen Sohn Tantyall
nach Kantamballi, das in gleicher Gegend
liegen soll. Nachkommen noch in Bjau.
13. Lessuangi sandte seinen Sohn nach Se-dani, Yesonge
das nahe Fada-Gurma liegt. Nachkommen
noch in Djemu.
14. Jendabelli sandte seinen Sohn nach Kualla, Yendabli
einer Landschaft, die südlich Doris liegt.
Nachkommen noch in Njambi.
15. Jembillima sandte seinen Sohn nach Dsuggu Yembilmq
oder Djuggu im Borgugebiet. Nachkommen
noch in Guellesaga.
16. Bau gama sandte seinen Sohn nach Boanganti, Bangama
einer Landschaft, die auch nach Don-Liptako,
aber weiter als Bilanga gelegen
ist. Nachkommen leben noch in Guarna.
17. Jengama sandte seinen Sohn nach Naga, das Jengama
in der Richtung auf Djuggu in Borgu, und
zwar in den Bergen gelegen ist. Nachkommen
noch heute in Tamonsa.
18. Jenkirrima sandte seinen Sohn nach Koba, Yenkilma
das in der Gegend von Naga liegen soll.
Nachkommen noch heute in Odju.
19. Jenkabilli sandte seinen Sohn nach Tjaung- Yentyable
batu oder Tschaungbatu (Batu-Land), das
wieder in der Richtung auf Don zu liegt.
20. Jempabo sandte seinen Sohn nach Jambi, das Dyempabu
in der Richtung auf Bussuma zu liegt.
Nachkommen heute noch in Namudjungu.
21. Jampatogo sandte seinen Sohn nach Jen- Dyabampadegu
quam, einem Ort, der zwischen Wagadugu
und Fada-Gurma liegt. Nachkommen leben
heute noch in Kongimadu.
22. Jonkuoli sandte seinen Sohn nach Namum, Dyenkoli
einem Lande (daher Namumbatu), das
einen Tag östlich von Fada-Gurma liegt.
Nachkommen noch in Kuoli oder Kuali.
23. Bansanti, heutiger Machthaber von Fada- Baniyanti
Gurina.
Ich möchte nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß die sämtlichen
Ortschaften oder Länder, in die die Söhne "gesandt" wurden (vielleicht
soll es auch heißen, daß sie da geboren wurden, daß also die
Väter dort ansässig waren), in einer bestimmten Gegend liegen. Sie
nehmen nämlich nach den Fada-Gurmaleuten ganz genau den zwischen
dem Niger-kualla und dem Mossilande gelegenen Landstrejfen
ein. |
Die schöne Übereinstimmung der Linie Hauptmann Mellins mit der meinen wird noch durch folgende Nachricht Mellins (vom 30. Januar 1909) vertieft: "Der Ahn der Gurma-Königsfamilie ist Lumpo. Nach seinem Tode wurde das Reich unter Tiderpo (Fada Gurina) und Tyima (Pama) geteilt. Eine dritte Linie soll nach Bilanga nordwestlich von Gurina gewandert sein. Von dieser Linie sowie über die Lage von Bilanga können nähere Angaben nicht gemacht werden. Mein Gewährsmann Bangama will keine Familienbeziehungen zu Mossi und Dagomba haben, kennt auch nicht die Bingosage. Gurina wird auch Bima genannt. Die Gurma-Königsfamilie ißt nicht: "Wildschwein, schwarze und rote Affen, Hund, Riesenschlange, Esel, Pferd." Letzteres anbelangend habe ich für Fada-Gurma als vererbtes Speiseverbot notiert: Ziege (Unguabo), Elefant (Uolummo und Hund (Uosanguanlo). Den königlichen Beamten von Fada-Gurma ist die historische Abhängigkeit des Mossireiches besser bekannt als den Pamaleuten. Sie sagen: "Wenn der Wagadugu-Mogonaba stirbt, senden die andern Naba nach Fada-Gurma: ein Pferd, einen Sklaven, das Sitzfell des verstorbenen Königs und Salz. Dazu sagen sie: "Dein Sohn ist gestorben; gib uns einen andern Sohn." Das ist streng gewahrtes Gesetz. —Allerdings haben die Mossi von Wagadugu mir das bestätigt.
PamaDie Reihe der Pamaherrscher nach Hauptmann Mellins Nachforschungen ist:
1. Tyima, 2. Mintoba, 3. Yesongoa, 4. Yeson, 5. Tobinen, 6. Konkonbi, 7. Tanyimpama (erster Regen), 8. Tuntanenkago (große Kalebasse), 9. Marebi, 10. Bongama, 11. Burkiti (war ein großer Krieger), |
12. Tampiegu, 13. Nimberi, 14. Dyemo, 15. Gontili, 16. Fayegu, 17. Gentima, 18. Senadar, 19. Hamadigu, 20. Jentyabile, 21. Saare, 22. Jantama, 23. Jentugri, 24. Yangarma, 25. Bangama (jetziger König von Pama-Borgu; seine Brüder heißen: 1. Jeloba, 2. Gabliga, 3. Kodenduri, 4. Sontyabu, 5. Alisuma, 6. Minilaba, 7. Dyedam). |
1. Nadjundi. — Die Eingeborenen geben an, seit Menschengedenken in diesem Orte gewohnt zu haben. Einmal war aber Hungersnot. Da flohen sie nach Kantinti. Alle Kantintileute stammen aus Nadjundi. Der nicht sehr vollständige Stammbaum lautet:
1. Lantipirri war der erste in Nadjundi lebende Herrscher, 2. Kanjemandi 1 waren seine Nachfolger, beides Söhne Lanti-3. Siepamba 5 pirris, also Brüder, 4. Mentirri ward Nachfolger, Sohn Kanjemandis, 5. Djampatogo " " " Siepambas, 6. Djenntjabirri " " " Mentirris, 7. Djemboto " " 8. Namidjuguri " " " Djampatogos, 9. Djemtemba " " " Mentirris, 10. Lasongi " " " Djenntjabirris, 11. Djennfauna " " " " 12. Djenntuguri " " " Djembotos, lebt und regiert noch heute in Kantinti. |
2. Dapong. — Die Dapongleute behaupteten, nicht nur ihre eigenen Könige zu kennen, sondern auch eine Ahnenreihe dieser Gurinakönige,
oder wie sie sagen, "dieser Könige in Bingo", von denen sie abstammen. Diese Liste lautet:1. Jentode, 7. Djabo(ng),
2. Kentewure, 8. Dammure,
3. Bambilanga, 9. Banesunde,
4. Jengelim, 10. Demogere,
5. Kollane, 11. Tingedane,
6. Kollane, 12. Aguare,
13. Njamtante, Bruder des vorigen,
14. Jenkirrima,
15. Billanda Pilli (der war es, der aus
Bingo nach Dapong übersiedelte). |
Merkwürdigerweise behaupten die Häuptlinge in Dapong, aber nicht von Billanda Pilli, sondern von seinem Bruder Njamtantes abzustammen, und zwar zählen sie die in Dapong geborene Häuptlingslinie wie folgt her:
1. Dude, 2. Laie, Sohn des vorigen, 3. Sanjuogo, 4. Jiboanga, " 5. Jakabo, " 6. Jinde, " 7. Jankare, " " " heutiger Häuptling von Dapong. |
3. Bogu. — Die Moba von Bogu geben einstimmig an, daß ihr Ahnherr Nangmua seinerzeit aus dem Lande Bingo in ihren heutigen Wohnsitz gekommen sei. Als Stammbaum zählen sie fernerhin auf:
1. Nagmua oder Nangmwa. 2. Lelange, Sohn Nangmuas, ward Nachfolger, 3. Jiale-Biego, ebenfalls Sohn Nangmuas, ward Nachfolger. 4. Mago ward Nachfolger, sein Vater nicht feststellbar. 5. Njagumpa(p), Sohn Lelanges, ward Nachfolger, 6. Kumbenkure, " Jiale-Biegos, 7. Kampenanga, " Kumbenkures, 8. Kungaduenn, " Kampenangas, 9. Lankobogas, " Kungaduenns, " 10. Bandammere, " Lankobogas, " " 11. Barrimbarrum, " " " 12. Naquego, " Bandammeres, " " 13. Londajarrungu, " Kungaduenns, " " 14. Kannatane, " Barrimbarrums, " " 15. Lukumpiri, " Naquegos, ist der heutige Beherrscher des Distriktes Bogu oder Buogo. |
Aus diesem Typus unregelmäßig sich abwechselnder Brüder und Söhne kann man sich sehr wohl ein Alter der ganzen "Bogudynastie" berechnen.
4. Geschichtliche Überlieferung der Dagomba
Für uns von Hauptmann Mellin gesammelt in Jendi
Die Leute gaben ihm eine Kalebasse. Er nahm sie und ging zum Teiche. Er wollte sie füllen. Der Büffel hörte das Geräusch. Er kam auf den Jäger zugestürmt. Torse, der Jäger, nahm einen Pfeil, er legte ihn auf den Bogen und schoß ihn dem Büffel ins Herz. Das Tier stürzte tot hin. Torse schöpfte nun Wasser. Dann nahm er seine Axt ab und schlug dem Büffel das rechte Horn ab; es war aus Silber. Er schlug das linke Horn ab; es war aus Gold.
Dann machte er sich auf den Rückweg. Er ging zurück und kam zum Hause der Frau. Er gab der alten Frau Male genug ab, daß sie trinken könne. Die Alte fragte: "Wo hast du das Wasser herbekommen?" Torse sagte: "Ich habe den Büffel getötet." Dann zog er aus seiner Tasche die Hörner und den Schwanz des Büffels hervor. Als die alte Frau das sah, wurde ihr Herz weiß vor Freude. Sie gab ihren Kindern und Enkeln Kalebassen, daß sie darauf trommelten.
Der König von Bingo, Mule Maliia, hörte das und ließ die alte Frau rufen. Er fragte sie: "Warum läßt du denn trommeln und tanzen?" Die alte Frau antwortete: "Es ist ein weißer Jäger mit Namen Torse gekommen, der hat den Büffel am Wasser getötet." Der König sagte: "Du hast selbst nichts und willst den Fremden beherbergen?" Er ließ Torse zu sich holen und sagte zu seinem Tumptere, d. i. der Oberste der Reiter: "Nimm den Torse in dein Haus."
Vier Tage lang war Torse im Hause Tumpteres. Dann sagte er: "Mein König, ich will jetzt wieder heimkehren. Ich bitte mir ein Geschenk aus. Unter deinen Töchtern ist eine, die hat keine Beine. Gib mir die zur Frau." Der König sagte: "Ich habe viele Kinder und hübsche Mädchen und du willst gerade diese, die keine Füße hat?" Torse sagte: "Ja, gerade die." Er nahm das Mädchen Gulyen (?) Wobega auf seine Schultern und trug sie fort. Er ging mit ihr zu der alten Frau, um von ihr Abschied zu nehmen. Er
sagte: "Ich gehe nach Hause." Die alte Frau fragte: "Hat Maljja dir niemand als Geleit mitgegeben?" Der Jäger sagte: "Ich bat nicht darum." Dann ging er von dannen.Die Alte nahm ihre zwei jungen Söhne und sagte: "Dort geht Torse von dannen. Folgt ihm unbemerkt, bis er daheim angekommen ist, so daß ihr seine Heimat kennt und den Weg, der dahin führt." Die Jünglinge folgten Torse bis Sonnenuntergang. Als die Sonne unterging, reinigte er eine Stelle im Busche und setzte daselbst Wobega nieder. Dann nahm er Pfeil und Bogen. Er ging auf die Jagd und schoß Palbua — so nennen die Dagomba eine kleine Antilope -; er schlug Feuer; er briet das Fleisch; sie aßen.
Am andern Morgen trug er seine Frau Wobega weiter. Die Jünglinge folgten ihm ständig und unbemerkt auf dem Fuße. Torse trug seine Frau immer weiter, und so kamen sie zuletzt an eine Berghöhle, in der der Jäger wohnte. Die Höhle soll hinter dem Lande Gurina, man weiß aber nicht mehr genau die Gegend und noch viel weniger den Ort, gelegen haben.
Dort kehrten die beiden Jünglinge um. Sie gingen heim zu der Alten und sagten ihr: "Wir folgten dem Jäger; er ging in seine Höhle, wir kennen jetzt den Weg."
Die beiden Männer gingen. Sie schliefen wieder am gleichen Lagerplatz im Busche und gingen am andern Morgen weiter. Dann kamen sie an Torses Höhle. Sie traten ein. Sie sahen ihn nicht. Sie sahen auch nicht seine Frau. Sie sahen nur Lumbu; das war Torses Sohn. Lumbu fragte die Leute: "Woher kommt ihr?" Die Männer sagten: "Dein Vater Torse kam in unseren Ort. Der König Maliia gab ihm seine Tochter zur Frau. Jetzt überziehen Heiden das Königreich mit Krieg. Der König sendet uns hierher, Torse zu bitten, daß er uns errette, wie er uns seinerzeit von dem Stier befreit habe."
Lumbu sagte darauf: "Es ist wahr, daß Torse mein Vater und Wobega meine Mutter waren. Aber mein Vater und meine Mutter sind beide gestorben. Aber mein Vater Torse hat euch geholfen, ohne daß er Maliia kannte. So will ich jetzt auch meinem Großvater helfen. Laßt uns gehen."
Lumbu ging mit den Leuten zum Königsdorfe. Lumbu schlug die
Heiden in die Flucht und tötete deren viele. Sodann zog Lumbu mit den Kriegern Maliias nach Biali. Tindana (?) war ein König in seinem Orte. Zu ihm ging Lumbu mit seinen Kriegern. Er blieb am Flusse nahe dem Orte Tindanas, um auszuruhen. Er blieb da mit seinen Kriegern liegen.Tindanas hatte (gerade damals) von seinen Großleuten Arbeiter eingefordert, die ihm bei der Landbestellung helfen sollten. Die Großleute hatten sie ihm gegeben, hatten aber gesagt: "Laß Donnerstag nichts auf den Feldern arbeiten. Denn Donnerstag ist ein heiliger Tag. Laß deine Frauen auch nicht Wasser aus dem Fluß holen." Tindana kümmerte sich um diese Warnung nicht, sondern ließ am Donnerstag arbeiten wie an jedem andern Tage. Tindana ließ am Donnerstag auf dem Felde arbeiten.
Nun war ein Sohn von Tindana, der hieß Oaschiero, der hatte eine Tochter Tindanas mit Namen Meschisobra zur Braut. Meschisobra ging an die Stelle, an der die Leute im Busche ihre Feldarbeit verrichteten. Sie sah, daß ihr Liebster durstig war und kein Wasser hatte. Da nahm sie einen Topf, um an den Fluß herabzugehen und Wasser zu schöpfen. Sie kam an den Fluß und sah dort Lumbu sitzen.
Sie bekam bei dem Anblick einen solchen Schrecken, daß sie den Topf hinwarf und fortlief. Lumbu rief ihr nach und sagte: "Fürchte dich nicht! Laufe nicht fort!"Als sie zurückkam, fragte er: "Warum liefst du fort, als du mich sahst?" Meschisobra sagte: "Mein Vater hat Feldarbeiter, die sind durstig, ich ging zum Flusse herab, um Wasser zu schöpfen." Er sagte: "Schöpfe dein Wasser, trage es auf das Feld, und sage dann deinem Vater, ich, Lumbu, säße hier am Bache."
Das Mädchen schöpfte Wasser, brachte es aufs Feld und erzählte ihrem Liebsten, was sie erlebt hatte. Ihr Liebster erzählte es den Großleuten. Die Großleute aber gingen zu Tindana und sagten: "Nun siehst du es! Wir haben es dir immer gesagt, du sollst am Donnerstag nicht das Feld bearbeiten und nicht Wasser tragen lassen. Nun es aber einmal so geschehen ist, sende zum Flusse und laß Lumbu Wasser geben."
t Tindana nahm einen Topf, schöpfte Wasser und füllte den Topf. Er nahm das und ging mit dem Ältesten zum Flusse hin, wo Lumbu saß. Er kam zu Lumbu. Lumbu sagte: "Du bist Tindana und bringst mir Wasser in diesem Topfe? Der Topf ist nicht gut!" Dann nahm Lumbu Lehm vom Flusse und gab ihn Tindana. Er sagte: "Forme daraus ein Gefäß von der Gestalt einer Kürbisflasche." Lumbu nahm eine Ähre Sorghum, gab sie Tindana und sagte: "Pflanze sie noch heute, sie wird noch heute aufgehen, aufwachsen und Frucht tragen." Lumbu nahm einen Kürbiskern, gab ihn Tindana und sagte:
"Pflanze ihn; er wird aufgehen, wachsen und noch heute eine Kürbisfiasche zeitigen." Dann sagte Lumbu: "Aus der Frucht, die das gepflanzte Sorghum tragen wird, soll deine Tochter Mehl mahlen. Das soll sie in die Kürbisflasche füllen. Wasser soll sie mit dem eben geformten Flaschentopf holen. Beides soll sie mir bringen."Tindana ging und tat, wie Lumbu ihm geheißen hatte. Das Korn und der Kürbiskern wurden gepflanzt und gingen auf und wuchsen und trugen Früchte. Der Topf in Form einer Kürbisfiasche ward geformt, und gegen Mittag ging Tindanas Tochter zum Flusse, Wasser zu schöpfen. Das Wasser goß sie auf das Mehl in der Kürbisflasche. Sie mischte es und brachte es Lumbu.
Als das geschehen war, sandte Tindana zu Lumbu und sagte: "Mein Sohn, komm zu mir, ich will dir ein Haus geben." Lumbu folgte der Aufforderung und erhielt das Gehöft Tindanas als Wohnstatt angewiesen. Tindana sagte zu seiner Tochter: "Ein Hund, der ein Ei frißt, muß dafür aufkommen! Du warst es, der Lumbu hierher gebracht hat. Infolgedessen werde ich dich ihm zur Frau geben."
So erhielt Lumbu die Tochter Tindanas zur Frau. Die gebar einen Sohn. Das Kind wuchs zum Knaben heran, der mit seinem Onkel in den Busch ging, um die Rinder zu hüten. Der Knabe sah eines Tages ein Rebhuhn. Er erlegte es mit einem Pfeilschuß. Der Onkel sagte: "Mach ein Feuer, wir wollen das Rebhuhn braten!" Der Knabe tat es. Dann brieten sie es. Der Onkel gab seinem Neffen aber nur den Kopf und ein Bein ab. Das andere aß er selbst.
Als der Knabe nach Hause kam, erzählte er es seiner Mutter: "Ich habe ein Rebhuhn geschossen. Der Onkel hat mich dann Feuer machen lassen. Wir haben es gebraten. Er hat mir dann nichts als ein Bein und den Kopf abgegeben und das andere hat er selbst gegessen." Die Mutter sagte: "Schweig und sag' es nicht dem Vater."
Am andern Morgen ging der Knabe wieder mit seinem Onkel in den Busch, das Vieh zu hüten. Der Knabe erlegte ein Perihuhn mit einem Pfeilschuß. Der Onkel sagte: "Mach Feuer an." Der Knabe machte Feuer. Der Onkel briet das Perihuhn. Dann aß er es, dem Knaben gab er nur ein Bein und den Kopf ab. Als sie heimkamen, erzählte der Knabe der Mutter: "Ich habe ein Perihuhn geschossen. Der Onkel hat mich Feuer machen lassen. Er hat das Perlhuhn gebraten. Dann hat er mir nur ein Bein und den Kopf abgegeben. Das andere hat er selbst gegessen." Die Mutter sagte: "Schweig und sag' es nicht dem Vater."
Am andern Morgen ging der Knabe mit dem Onkel wieder in den Busch, um das Vieh zu hüten. Der Knabe erlegte einen Hasen mit einem Pfeilschuß. Der Onkel sagte: "Mach Feuer an." Der Knabe machte Feuer. Der Onkel briet den Hasen. Dann aß der Onkel den Hasen und gab dem Knaben nur ein Bein und den Kopf ab. Als sie
heimkamen, sagte der Knabe das nicht seiner Mutter, sondern seinem Vater Lumbu. Er sagte ihm alles, was vorgekommen war.Lumbu hörte es und ging zu Tindana. Er sagte: "Mein Sohn hat Jagdbeute erlegt. Man hat ihm aber das Fleisch fortgenommen. Wenn du nun in Zukunft einen Ochsen schlachtest, so verzichte ich auf das Fleisch und will weiter nichts als Schwanz und Fell haben." So geschah es. Jedesmal, wenn Tindana Ochsen schlachtete, erhielt Lumbu das Fell und den Schwanz. Das geschah so oft, bis deren zwölf waren.
Als Tindana zwölfmal die (erniedrigende) Teilung in dieser Form vorgenommen hatte, fragte Lumbu eines Tages den Sohn Tindanas: "Wenn dein Vater Ochsen für den Fetisch geschlachtet hat und die Jugend tanzt und singt, — wo hält sich dann dein Vater auf?" Der Sohn Tindanas sagte: "Mein Vater liegt dann oben unter dem Dache."
Als nun der nächste Ochse geschlachtet werden sollte, schärfte Lumbu heimlich sein Messer und verbarg es im Ärmel. Dann schlich er sich in den Oberraum des Hauses, in dem Tindana schlief. Er schnitt Tindana den Hals durch. Dann ging er nach Hause.
Als am andern Morgen Tindanas Frau ihrem Gatten heißes Wasser bringen wollte, daß er sich waschen könne, fand sie den König tot. Sie schrie laut auf. Sie schrie so, daß alle Leute zusammenliefen. Alle riefen: "Wer hat Tindana getötet?" Lumbu trat darauf hervor und sagte: "Ich habe ihn getötet." Er fuhr fort: "Wessen Sohn nennt ihr Yornesorberi? (Mann des Busches). So heißt nicht mein Sohn. Mein Sohn heißt Nyergele, auch ich heiße Nyergele, d. h. ich habe Rache genommen für die Beleidigungen, die ihr meinem Sohne zugefügt habt."
Als Lumbu Tindana getötet hatte, wurde er, Lumbu, "König". Lumbu zeugte noch einen Sohn und nannte ihn Namsisheri, einen dritten Hergensang, einen vierten Oyipupolla, einen fünften Gui, einen sechsten Kemtili, einen siebenten Foroth, einen achten Bena.
16. Kapitel: Die Sunjattalegende der Malinke*
Dies ist die Sunjattalegende, der Sang vom ersten Emir Diarra, dessen Mutter aus dem Stamme der Diarra war. Er hatte demnach seinen Namen nicht nach dem Stamme des Vaters (wie es islamischer Brauch erfordert hätte), sondern nach libyschem Vorbilde nach dem der Mutter. Also beginnt die Glanzzeit der islamischen Periode mit Namengebung in heidnisch-libyschem Sinne. Deutlich
Die Namengebung und Thronfolge ist libysch, die Königsbezeichnung die einer libyschen Dynastie. Wir werden sehen, daß die ganze Ausgangsidee des Sanges libysch ist, und das ist so wichtig, weil wir uns ja klar machen wollen, wie der Islam sich auf den Wegen, mit den Machtmitteln und im Sinne der vorislamischen Kulturwelt im Sudan einnistete, nicht aber als neue, sondern als umformende, umbildende und verjüngte Kulturwerte spendende Kraft.
Heilige Geschichtsüberlieferung der Malinke, berichtet vom Dialli Kieba Koate genannt Korongo (nach einer Schlange).
1. Ursprung1. Mamatas, dessen Sohn war:
2. Bilali, dessen Sohn war:
3. Liatakalabe, dessen Sohn war:
4. Kalabebumba, dessen Sohn war:
5. Kalabedoroma.
Danach kommt die Geschichte Sunjattas. Das alles hat sich abgespielt
im Dorfe Kirrikoni im Lande Niarasola, welches gegen Kita
hin liegt. Man sagt, diese Stadt sei nicht besonders groß, aber sie
bleibe sich stets gleich, weil, wenn jemand stürbe, auch jemand geboren
werde. |
Auch wird gesagt, daß das Land Sunjattas Sangara sei.
2. Die Koba
Ein Jäger machte sich auf den Weg und wollte die Koba töten. Er streifte umher. Er jagte elf Tage und vermochte die Koba nicht zu töten. Danach machten sich zwei andere Jäger auf mit Pfeil und Bogen. Die beiden sagten: "Der eine jagt das Tier, der andere kann es dann schießen." Man kannte damals die Pferde noch nicht, sondern jagte nur zu Fuß. Man nannte die Pferde "Donwe". Die zwei Jäger vermochten die Koba nicht zu erreichen. Es machten sich also drei Jäger auf den Weg, um sie endlich zu vernichten. Je einer der jäger stammte aus einem andern Dorfe. Als die drei Jäger nun auszogen, trafen sie auf die Koba. Sie griff aber jeden einzeln an, so daß jeder einzeln in den Busch gedrängt wurde und nicht wieder heimkehrte.
Die Leute sagten: "Das ist keine gewöhnliche Koba. Das ist keine Buschkoba!" Der Dodugu (Landesherr) Niamorodiote sagte: "Wer die Koba tötet, der mag unter den Mädchen von zwölf Dörfern die schönste, oder welche ihm am meisten zusagt, auswählen und heiraten." Es waren viele Menschen im Lande. Der Landesherr Niamorodiote hatte aber eine Tochter, die zwar jung, deren Körper aber mit Beulen und Schwären bedeckt war. Dieses junge Mädchen hieß Sugulunkurmang. Die war abschreckend häßlich.
Damals waren Frauen sehr teuer oder schwer zu haben. Deshalb war das Angebot eines Mädchens, das man selbst auswählen konnte, sehr verlockend. So machten sich denn zwei Brüder, Damba Masaulomba (der ältere) und Damba Saulandi (der jüngere), die beiden Onkel der Traore, auf den Weg, um die Jagd zu unternehmen. Zunächst allerdings befragten sie das Kengebugurilala (das Sandorakel), auf welche Weise man die Koba wohl erwischen könne. Kengebugurilala antwortete: "Im Busch nebenan lebt eine alte Frau, die nie ein gutes Wort sagt, die alle beschimpft, die sich ihr nähern. Diese alte Frau ist die einzige, die Auskunft geben kann. Man darf ihren Schimpf nicht erwidern. Dann wird die Frau sagen, wie man die Koba töten kann. Nachher dürft ihr nicht das schönste Mädchen der zwölf Dörfer nehmen, sondern ihr müßt die Beulenbedeckte vorziehen."
Die beiden Traore machten sich auf den Weg und suchten im Lande nach der alten Frau. Sie kamen in den Busch, in dem sie gerade weilte und Brennholz suchte. Die beiden Jäger sagten: "Guten Tag!'
Die alte Frau sagte: "Macht, daß ihr wegkommt!" Die Jäger sagten: "Wir sind gekommen, dir Holz suchen zu helfen." Die Alte sagte: "Gestern, als ich Holz suchte, wart ihr nicht da. Macht nun heute, daß ihr fortkommt." Die beiden Jäger lasen unbekümmert das Holz auf und trugen es hinter ihr her. Die Alte sagte: "So, jetzt, wo ihr das Holz angefaßt habt, mag ich es nicht mehr; macht, daß ihr wegkommt! Macht, daß ihr wegkommt!" Die Jäger gingen unbekümmert hinter ihr her. Sie kamen zu einer Hütte im Walde und fragten: "Ist dies das Haus?" Die Alte antwortete nicht. Sie ging in das Haus hinein. Da legten die beiden Jäger das Holz auf den Boden und gingen.Die beiden Traore gingen zu dem Dodugu Niamorodiote. Sie sagten: "Wir haben deine Botschaft gehört und sind gekommen, um den Versuch zu machen, die Koba zu töten." Niamorodiote sagte: "Gut, so mögt ihr denn hier schlafen. Allerdings habt ihr wenig Aussicht auf Gelingen des Unternehmens. Es kamen schon viele Jäger, aber keiner vermochte die Koba zu erlegen. Diese Koba ist eine andere als irgendwelche Koba, die je ein Mensch gesehen hat. Sie hat einen Schwanz von Gold. Es ist ein Jäger ausgezogen, sie zu erlegen. Dann sind zwei Jäger ausgezogen, sie zu töten. Dann sind drei Jäger ausgezogen, sie zu töten, aber alle drei mußten nach verschiedenen Richtungen fliehen und sind im Busche verlorengegangen. Ihr seid nun die beiden einzigen eurer Familie; sterbt ihr, so zerbricht euer Haus. Ich warne euch, damit nicht das Haus eurer Mutter zerbricht. Denn ihr werdet das nicht können."
Zur Nacht machte man eine gute Kalebasse mit Reis und Fleisch für die beiden Traore. Damba Masaulomba sagte: "Wir wollen der Frau etwas von unserem Essen bringen." Damba Saulandi sagte: "Mein älterer Bruder, sie wird es nicht nehmen." Der andere entgegnete: "Nun, so kann man ihr wenigstens die Speise und den guten Willen zeigen. Nimmt sie es nicht, so nimmt sie es nicht. Wir wollen es aber versuchen." Der Jüngere sagte: "Es ist recht." Sie machten sich also mit Reis und Zukost auf den Weg und gingen in den Busch zu der Alten. Sie klopften gegen die Tür und riefen: "Guten Abend, Mutter!" Die Alte antwortete: "Was willst du da draußen?" Damba Masaulomba antwortete: "Dodugu Niamorodiote hat uns Reis und Fleisch als Zukost gegeben. Nun sind wir gekommen, dir ein wenig zu geben, wenn du es annehmen willst." Die Alte entgegnete: "Kanibukenkenkan Ntafe (muß ein sehr schmutziges Schimpfwort sein, denn niemand will es übersetzen)! Ich will nicht. Für mich gibt es
kein Fleisch in diesem Lande. Alles, was ich wie Fleisch esse, sind Pilze." Damba Masaulomba entgegnete: "Ich weiß es, aber wir wollen dir ein Geschenk bringen, weil du eine alte Frau bist." Die Alte sagte: "Legt das Essen draußen auf das Brennholz und schert euch weg!" Die Brüder taten es und gingen.Die Traore erhielten darauf Milch. Der ältere Bruder sagte: "Wir wollen der Alten etwas von unserer Milch bringen." Damba Sau-. landi sagte: "Sie wird es nicht annehmen und uns wieder beschimpfen." Damba Masaulomba sagte: "Wir wollen es versuchen. Das Kengebugurilala hat gesagt: Man darf ihren Schimpf nicht erwidern; dann wird die Frau sagen, wie man die Koba töten kann. Also müssen wir es versuchen." Der Jüngere sagte: "Es ist richtig." Die Brüder brachten der Alten die Milch.
Am dritten Tage rief die alte Frau die beiden Traorejäger und sagte: "Kommt einmal her!" Die beiden gingen hin. Die Alte sagte: "Ich will euch mein Leben geben!" Die Troare sagten: "Wir sind nicht gekommen, um nach deinem Leben zu jagen." Die Alte sagte: "Nun, was wollt ihr denn anders?" Die Jäger sagten: "Wir sind gekommen, um dich zu bitten, uns bei der Jagd auf die Kobazu helfen." Da lachte die Alte und sagte: "Ich bin ja selbst die Koba. Nun habt ihr mir Geschenke gebracht, und ich habe euch beschimpft. Ihr habt nicht in gleicher Weise geantwortet, sondern habt mir weiter Gutes getan. Wenn jemand einem Gutes erweist, so soll man es erwidern. Ihr habt mir viele Geschenke gemacht, und ich will euch jetzt bei der Jagd auf die Koba helfen. Ich habe mich jeden Morgen in die Koba verwandelt, weil mich meine zwölf Brüder stets schlecht behandelt haben. Meine Brüder haben alles Gute, Dörfer, Sklaven, Reichtümer, mir gaben sie nicht einen Sklaven, daß er mir Wasser bringe und Feuerholz sammle. Und deshalb habe ich mich jeden Morgen in eine Koba verwandelt und in jedem Dorfe meiner zwölf Brüder einen Mann getötet. Abends bin ich dann zurückgekommen in meinen Busch und wieder Mensch geworden. Wenn ihr die Koba jetzt töten wollt, so merkt, daß kein Eisen ihre Häute durchdringen kann, wenn nicht am Pfeilschaft ein Baumwollfaden befestigt ist. Besorgt euch also einen Knäuel Baumwollfaden und bindet Baumwollfäden (Gendakalla) an eure Pfeile. Nicht wahr, das wußtet ihr nicht?" Die Traorebrüder sagten: "Nein, das wußten wir nicht."
Die Alte sagte weiter: "Wenn ihr nun nach der Koba schießt und sie auch trefft, so könnt ihr ihrem letzten Zorne doch nicht schnell genug entfliehen. Darum nehmt drei Steine mit, die als Herd unter
einem Kochtöpfe dienten. Wenn die Koba euch folgt, so werft die Steine hinter euch. Es wird ein Berg entstehen, den die Koba überklettern muß. Die Koba wird euch wieder erreichen. Nehmt ein Ei und werft es hinter euch. Es wird ein Schlammland entstehen, das die Koba nur langsam zu durchwaten vermag. —Nun bin ich müde. Meine Arbeit ist fertig. Ich will schlafen. Morgen müßt ihr früh aufstehen und zu dem Busche gehen. Dort werdet ihr die Koba treffen." Die Brüder gingen zurück.Am andern Morgen machten sie sich ganz früh auf den Weg. Sie nahmen drei Steine mit, die um das Feuer eines Herdes gelegen hatten, und ein Ei. Sie banden an ihre Pfeile Baumwolifäden. Sie gingen damit zu dem Busch, den ihnen die Alte bezeichnet hatte. — Damba Saulandi sah die Koba zuerst; er hielt den Bruder am Arm fest und sagte: "Da, da ist die Koba!" Der Ältere sagte: "Es ist richtig!" Sie krochen nun auf den Knien langsam und behutsam auf die Koba zu. Sie kamen ganz dicht heran. Damba Masaulomba legte einen der mit Baumwolifäden geschmückten Pfeile auf den Bogen und schoß. Er traf die Koba. Die Koba sprang auf. Beide Brüder flüchteten in den Busch. Die Koba umkreiste, mit den Nüstern die Fährten aufwirbelnd, das Gehölz, dann folgte sie der Spur der Brüder.
Die Traore flüchteten, aber die Koba kam ihnen immer näher. Da warfen die Brüder die drei Steine, und es entstand ein mächtiger Berg zwischen ihnen und der Koba. Sie flohen von dannen. Die Koba rannte den Berg hinauf und dann auf die Brüder zukommend, wieder hinab. Sie war wieder ganz nahe. Damba Saulandi rief: "Wirf das Ei", und der ältere Bruder warf das Ei hinter sich. Es entstand ein mächtiges Schlammfeld zwischen den Jägern und der Koba. Die Brüder flohen. Die Koba konnte in dem Schlamm nur langsam weiter laufen. Der Jüngere sah zurück und rief: "Mein älterer Bruder, die Koba ist gefallen!" Sie blieben stehen, und der ältere Traore sagte: "Es ist richtig! Sie ist gefallen. Wir wollen aber nicht gleich hingehen; denn die Koba könnte noch nicht ganz tot sein." Sie warteten eine Weile. Dann gingen sie hin und schnitten der Koba den goldenen Schwanz ab. Der ältere Bruder steckte ihn in seinen Schultersack, und sie gingen zurück zur Stadt.
Die Traore gingen zu dem Dodugu Niamorodiote. Damba Masaulomba sagte: "Wir haben im Busche etwas getötet. Versammle alle Leute der Dörfer. Wir wollen es zeigen und fragen, ob das nicht die Koba ist, die jahrelang so schlechte Sachen gemacht hat."Dodugu
Niamorodiote sagte: "Wegen nichts rufe ich nicht die Leute, die auf den Feldern sind, von der Arbeit weg. Wahrscheinlich habt ihr irgendein falsches Tier getötet. Denn die Koba war viel zu schlau, als daß ihr sie hättet erlegen können." Die Jäger sagten: "Wir verlangen, daß du die Leute zusammenrufst, sonst zeigen wir die Koba nicht. Wenn wir nicht die richtige Koba erlegt haben, so reisen wir eben ohne Lohn wieder ab." Darauf ließ der Dodugu alle Leute aus den zwölf Dörfern zusammenrufen, und als alle beisammen waren, sagte Damba Saulandi: "Mein älterer Bruder, alle Leute sind gekommen. Erhebe dich." Damba Masaulomba stand auf und sagte: "Reiche mir den Beutel." Der jüngere Bruder gab ihm den Schultersack. Der ältere Traore riß den goldenen Schwanz heraus, hielt ihn hoch in der Luft und rief: "Was ist das?" Da schrien alle Leute: "Das ist die ganz große Sache. Das ist die Koba! Wir sind befreit und wieder in sorgloser Ruhe. Wir brauchen keine Furcht mehr zu haben, daß die Koba uns alle Tage die Leute aus den Dörfern holt. Diese zwei Brüder haben das Unglück vom Lande genommen. Das ist die große Sache!"3. Sugulunkurmang
Dodugu Niamorodiote ließ alle jungen Mädchen aus dem Lande zusammenkommen. Er sagte: "Die beiden Traore sollen ein Mädchen auswählen!" Alle Mädchen kamen. Als auch Sugulunkurmang sich hinaufbegeben wollte, sagte Niamorodiote, ihr Vater: "Du bleib nur fort. Du bist mit deinen Beulen und Schwären zu häßlich." Früher waren die Diarra und die Traore einig, nun aber begannen sie sich zu beschimpfen. Das kam aber so:
Die Brüder gingen die Reihe der Mädchen entlang und betrachteten sie. Der Ältere sagte: "Das Kengebugurilala hat gesagt: ,Nachher dürft ihr nicht das schönste Mädchen der zwölf Dörfer nehmen, sondern ihr müßt die Beulenbedeckte vorziehen.' Ein solches Mädchen ist nicht dabei." Der ältere Traore fragte den Landesherrn: "Sind denn alle Mädchen des Landes hier?"Dodugu Niamorodiote sagte: "Ja, es sind alle da, bis auf Sugulunkurmang. Die ist zu Haus geblieben, weil sie zu häßlich ist." Die Brüder fragten: "Weshalb ist sie zu Haus geblieben?" Die Leute antworteten: "Weil sie zu viele Beulen und Schwären hat." Die Traore sagten: "Das wird die rechte sein!" Da lachten die Leute. Sie führten Sugulunkurmang herbei. Sie war sehr häßlich. Damba Masaulomba trat von rechts heran und
legte seinen linken Arm um ihren Nacken. Damba Saulandi trat von links heran und legte seinen rechten Arm um ihren Nacken, und die Traore sagten: "Das ist die rechte!" Da riefen die Diarra: "Oh, ihr Dummen! Ihr wißt ja nicht, was gut und schön ist. Ihr laßt die schönen Mädchen und wählt das häßliche. Oh, ihr Narren! Ihr Dummköpfe!" Die Traore sagten aber: "Ihr Törichten, was wißt ihr denn, was nachher gut sein wird, was für die Zukunft richtig ist?" So beschimpften sich Diarra und Traore zum ersten Male, und seitdem haben sie sich immer beschimpft bis auf unsere Tage.Am Abend wollten sie sich niedersetzen. Damba Saulandi sagte zu Damba Masaulomba: "Du bist der ältere Bruder. Du hast keine Frau, und ich habe keine Frau. Da du aber der ältere bist, so lege dich mit Sugulunkurmang schlafen." Damba Masaulomba ging mit dem Mädchen beiseite. Als ihn nun die Lust ankam, es zu beschlafen, fuhr er mit der Hand über ihren Leib. Es stach ihn aber irgend etwas sehr stark. Er fuhr entsetzt mit der Hand zurück und sagte: "Was hast du an deinem Kleide? Du hast mich verletzt." Damba Masaulomba hatte nun Furcht. Er legte sich seitwärts des Mädchens zur Ruhe. Am andern Morgen wollte Damba Saulandi mit seiner Schwägerin Sugulunkurmang scherzen und strich ihr lachend mit der Hand über den Leib. Er fuhr aber mit der Hand zurück und rief: "Ach, du stichst! Du hast etwas Stechendes im Kleid!"Sugulunkurmang sagte: "Oh, das war gar nichts. Aber bei Nacht ist es schlimm. Frage nur deinen Bruder! Oh, bei Tage hat es noch nichts zu bedeuten!" Da ging der jüngere Traore zum älteren und sagte: "Mein älterer Bruder, ich glaube, das kommt daher, daß wir nur einfache Leute, dieses aber das Kind aus einer Königsfamilie ist. Ich glaube dieses Herrscherkind aus Sangara ist gut für den Mandekönig." Damba Masaulomba sagte: "Mein jüngerer Bruder, ich glaube, du wirst recht haben. Wir wollen dieses Mädchen zum Farkuma Kakenji bringen."
Die Traore gingen mit Sugulunkurmang von dannen.
Sie brachten Sugulunkurmang zum Farkuma Kakenji, dem Könige des Mandelandes, und dieser gab ihnen dafür ein anderes Weib. Am Abend sagte Damba Masaulomba zu dem Mädchen: "Mädchen, mache in diesem Zimmer Feuer."Sugulunkurmang sagte: "Ich habe Furcht!" Er fragte: "Was gibt es?" Sie entgegnete: "Ich habe Furcht!" Der Jäger sagte: "Ach, jetzt wirst du einen fürstlichen Gatten haben. Du brauchst keine Furcht mehr zu verspüren."Sugulunkurmang ging hinein. Farkuma ehelichte sie. Sugulunkurmang
ward sogleich guter Hoffnung. Gleichzeitig ward aber auch die erste Frau des Königs guter Hoffnung, der Herrscher aber hatte bis dahin noch keine Kinder.4. Sunjattas GeburtDamals gab es in Mande Subaga mussu Kononto (neun Zauberinnen), die hießen:
1. Sititi, das war die Führerin,
2. Sototo, das war ihre Adjutantin,
3. Djalimussu tumbumannia, die den Toten das Lied singt,
4. Muruni-pempete, die mit dem Messer den Kopf abschneidet,
5. Sumussu sungana niamorodjote, das hervorragend kluge und starke Zauberweib, das der Adjutantin untergeordnet ist,
6. Dagani kuboga, die den kleinen Zaubertopf auswäscht,
7. Djinbi djamba, die während der Nacht Nachrichten bringt und alles zuerst sagen muß,
8. Miniamba, die sich als Schlange in den Weg legt, um den Verurteilten durch einen Biß zu töten,
9. Kulutugubaga, die gebrochene Arme wieder herzustellen, Fleischwunden zu schließen vermag und tote Menschen wieder lebendig macht.
Als nun Sulugunkurmang Mutter wurde, war Djalimussu tumbumannia mit acht Frauen gegenwärtig. Das Kind schrie viermal. Alle Kinder schreien, wenn sie geboren werden, nur dreimal, aber das Kind Sugulunkurmangs schrie viermal. Beim vierten Male fielen die acht Frauen tot hin, und die Mutter des Kindes starb fast. Der König hörte den Lärm und fragte: "Was ist im Dorfe?"Einige Alte kamen hin und sahen in die Hütte. Sie kehrten zurück und sagten: "Eine Frau wird Mutter. Das Kind schreit so, daß acht alte Frauen starben, und auch die Mutter fast umkommt." Der König sagte: "Njete maninjoro jataji" (so etwas habe ich noch nie gesehen). Da der König nun dem Kinde keinen andern Namen gab, so nannte man es Sunjatta.
Als das Kind geboren war und die Mutter sich wieder ein wenig bei Kräften fühlte, sagte sie zu Djalimussu tumbumannia: "Geh zum Könige und sage ihm, daß ich ihm den ersten Sohn geboren habe." Djalimussu tumbumannia machte sich auf den Weg. Sie kam gerade zum Könige, als derselbe aß. In jener alten Zeit aßen die Mandeleute nur Reis. Die Subaga entbot den Gruß, der damals Sitte war, sie
sagte: "Konkondogosso!" Der König antwortete mit dem Gruße, wie er damals Sitte war, er sagte: "Tantumberre! Komm, ißmitmir," Djalimussu tumbumannia setzte sich beim Könige zum Essen nieder. Dabei vergaß sie aber vollständig, ihre Botschaft auszurichten.Am gleichen Tage, aber einige Stunden später, gebar auch die erste Frau des Königs ein Kind. Die Mutter dieses Prinzen rief Muruni pempete herbei und sagte zu ihr: "Gehe zum Könige und berichte ihm, daß ich ihm einen Sohn geschenkt habe." Muruni pempete machte sich auf den Weg. Sie kam zum Könige, als er gerade aß. Sie sagte: "Konkondogosso!" Der König antwortete: "Tantumberre! Komm her und iß mit mir!" Die Subaga sagte: "Wer schnelle Füße hat, soll auch eine schnelle Zunge haben. Deine erste Frau sendet mich und läßt dir sagen, daß sie dir einen Sohn geschenkt habe." Der König sagte: "Das ist sehr schön!"Djalimussu tumbumannia sprang aber auf und sagte: "Ich habe ja auch eine Bestellung auszurichten. Oh, über dem Essen habe ich ganz vergessen, mich meines Auftrages zu entledigen. Deine Frau Sungulunkurmang sandte mich, um dir zu sagen, daß sie dir den ersten Sohn geschenkt habe. Dieser Sohn ist der Erstgeborene." Der König sagte: "Du kommst jetzt zu spät. Von dem ich zuerst hörte, das ist der ältere!" Man nannte das Kind der ersten Frau des Königs Massa Dangaratuma. Der König sagte: "Massa Dangaratuma ist mein ältester Sohn." Das war aber nicht wahr, denn der ältere war Sunjatta. —
5. Sunjattas BeschneidungDie Kinder wuchsen miteinander auf. Sunjatta war schwach auf den Füßen, Massa Dangaratuma aber war stark. Sunjatta blieb immer am Boden hocken, und Massa Dangaratuma lernte bald laufen. Als sie schon ein wenig herangewachsen waren, kaufte sich jeder von beiden einen Hund. Massa Dangaratuma nannte den seinen Dindofollobiulukorote (der zuerst Geborene, aber nicht ältere). Sunjatta den seinen Sobekonssante (gut herangewachsen, aber im nötigen Augenblick unglücklich). Wenn sie aßen, reichten sie ihren Hunden je eine Handvoll Essen hin. Sobekonssante war schnell; er schluckte nicht nur die eigene Speise herunter, sondern nahm auch eilig noch Dindofollobiulukorote das Essen fort. Massa Dangaratuma sagte zu Sunjatta: "Wenn das dein Hund noch einmal macht, werde ich ihn totschlagen. Ich werde ihn töten!"Sunjatta sagte: "Wenn du das
tun solltest, werde ich etwas unternehmen und etwas tun, davon soll ganz Mande reden!" Massa Dangaratuma sagte: "Was willst du! Ich werde ja doch König, und du bist nichts!" Er suchte einen dicken Knüppel und legte ihn neben sich. Als abends das Essen kam, fraß Sobekonssante wieder sein Essen und das des andern Hundes auf. Da nahm Massa Dangaratuma den Knüppel und schlug ihn tot. Nun war Sunjatta ja schwach auf den Beinen (solche Kinder nennt man Nammara) und blieb auch lange Jahre so am Boden hocken. Er war aber am Oberleibe sehr stark. Er packte seinen Bruder an der Ferse und preßte ihn, daß fast die Knochen brachen und er sich vor Angst und Furcht in die Hosen machte. Er preßte ihn sehr, bis Djalimussu tambumannia dazu kam und sagte: "Laß den Fuß deines Bruders los!" Da ließ Sunjatta den Fuß los.Die Kinder wuchsen heran. Der König sah es, daß zehn der Knaben kräftig und tüchtig waren, während Sunjatta noch immer nicht vom Boden aufzustehen vermochte, trotzdem er schon dreizehn Jahre alt war. Farkuma-Kakenji sagte: "Die Kinder können bis auf Sunjatta nun bald beschnitten werden."Sugulunkurmang hörte das. Sie weinte, weil ihr Sohn nicht schneller heranwuchs. Sunjatta tröstete sie und sagte: "Weine nicht, denn mein Vater kann meine Brüder nicht vor mir beschneiden lassen. Wenn der Vater den Boten mit der Nachricht sendet, so sage ihm, daß er mir die Nachricht selber bringe." Nach einiger Zeit kam der Bote zur Mutter und sagte: "Farkuma-Kakenji will alle Knaben bis auf Sunjatta beschneiden lassen, weil der immer noch am Boden hockt." Sugulunkurmang sagte: "Sage es meinem Sohne selbst. Dort ist er am Boden." Der Bote ging zu Sunjatta und sagte: "Djata Djata Ninkanja."Sunjatta sagte: "Ja, ich bin Djata Djata Ninkanja. Ja, ich bin Jatta Jatta Njatauliballi, der die Knochen zerschlägt, aber nicht aufstehen kann." Der Bote sagte: "Farkuma-Kakenji will deine Brüder beschneiden lassen, aber nicht dich, weil du noch am Boden herumhockst." Sunjatta sagte: "Antworte meinem Vater, daß, wenn meine Brüder endgültig vor mir beschnitten werden, er etwas erleben wird, was man nie hörte, seit Mande entstand. Mande wird dann zergehen und keiner kann es je wieder gründen." Der Bote ging hin und sagte es dem König. Der aber erwiderte: "Das Gerede ist mir gleich. Aus meinem Harn kann nicht ein Kaiman kommen, der mich verschlingt." (Soll heißen: "Meine Nachkommenschaft kann nicht stärker sein als ich es bin.") Der König fuhr fort: "Man lasse seine Brüder beschneiden, komme, was da komme!"
In der folgenden Nacht begann der Tamtam. Sugulunkurmang weinte wieder. Sie sagte: "Du bist der Älteste und hast immer unglück. Mußt du denn immer zuletzt kommen?" Sunjatta sagte: "Der Vater kann das nicht durchführen. Du wirst das sehen." Sugulunkurmang sagte: "Du wirst sehen, daß es der Vater doch kann." Inzwischen rief der König neun Numu (Schmiede) und gab ihnen den Auftrag, die zehn Knaben zu beschneiden. Also beschnitten acht Numu je einen, der neunte aber zwei Knaben. So wurden die Knaben beschnitten, und die Frauen sangen jubelnd den heiligen Beschneidungsgesang. Sugulunkurmang weinte wieder und sagte: "O mein armes Kind! Mein armes Kind!"Sunjatta sagte zur Mutter: "Laß nur; wir werden sehen, daß es der Vater nicht kann."
Die Numu kamen zu Farkuma-Kajenji und sagten: "Wir sind fertig, zahle uns!" Der König sagte zu einem von ihnen: "Geh jetzt zu Sunjatta und sage zu ihm, die Beschneidung seiner Brüder sei vollbracht. Er könne jetzt tun, was er vorhabe." Der Bote ging hin und sagte es so zu Sunjatta. Sunjatta sagte: "Ehe ich dir meine Antwort gebe, geh zur Seite und laß dein Wasser!" Der Numu ging hin, aber als er sein Glied anfaßte, sah er, daß er nicht mehr beschnitten, sondern daß ihm plötzlich wieder die Vorhaut gewachsen war. Er lief entsetzt zum König zurück. Farkuma-Kakenji fragte: "Nun, welche Antwort hat Sunjatta gegeben ?" Der Numu sagte: "Ehe ich dir antworten kann, mußt du mir die Hände binden lassen." Der König ließ den Mann fesseln. Dann sagte der Numu: "Alle die wir gegen den Willen Sunjattas die Knaben beschnitten haben, wir alle werden wohl wieder eine Vorhaut haben und nicht mehr beschnitten sein. Wenigstens ich bin nicht mehr beschnitten."Alle andern Numu gingen beiseite und sahen und kamen zurück und jeder sagte: "Laß mich binden, ich habe beschnitten und bin selbst nicht mehr beschnitten." Farkuma-Kakenji sagte: "Das ist eine eigene Sache." Er ging selbst hin, um zu urinieren und da sah er, daß er nicht mehr beschnitten war. Das kam so, daß ein Numu zwei Knaben beschnitten, und somit reichte der Zauber für den König mit.
Farkuma-Kakenji kam zurück und sagte: "Bindet mich, denn ich bin auch nicht mehr beschnitten." Darauf gingen der König und alle Schmiede zu Sunjatta und begrüßten ihn als ihren "Kuntigi" (Kopf oder Chef gleich Chef im allgemeinen) und baten ihn um Entschuldigung. Da begann Sunjatta das Spottlied: "Ankatulunke Mande amanji" (amüsieren wir uns Mande schlecht), d. h. etwa: Verspotten
wir das heruntergekommene (schlechte) Mandeland. Viele Leute sangen das Spottlied. Inzwischen kam Djallimussu tumbumannia und sagte: "Laß deinen Vater nunmehr frei. Er ist müde. Man weiß jetzt, daß du stärker bist als er." Sunjatta sagte: "Ich will meinen Vater unter der Bedingung frei lassen, daß die andern Knaben nicht vor mir beschnitten werden!" Man sagte es Farkuma-Kakenji. Darauf gingen seine Vorhaut und die der Numu wieder zurück; die zehn Knaben hatten dafür aber wieder die ihre, und nun waren sie nicht mehr beschnitten.Die Mutter Sunjattas bat ihre Nebenfrau: "Gib mir von deinen Sira-(Affenbrotbaum-("Blätter."Die andere Frau sagte heftig: "Heute will ich dir noch geben, dann ist es aber zu Ende. Dein Sohn ist älter als der meine; laß ihn doch auf den Sirabaum klettern und Hals und Knochen beim Klettern riskieren. Der meine sucht für mich. Weshalb rutscht dein Sunjatta immer auf der Erde herum?" Sunjatta hörte draußen, daß seine Mutter mit jemand stritt, und fragte: "Was sprichst du da mit den andern Frauen?"Sugulunkurmang sagte: "Ach, es ist nur wegen der Sirablätter, die ich von einer Nebenfrau erbat."Sunjatta sagte: "Gibt es denn in Mande keine Schmiede? Hat mein Vater keine Schmiede?" Seine Mutter sagte: "Ja, dein Vater hat Schmiede." Da erwiderte Sunjatta: "So sollen sie mir jetzt einen Eisenstab machen, an dem ich mich aufrichten kann." Die Numu (Schmiede) bauten sieben Ganso (Hochöfen), um das Eisen zu einem starken Stabe zu schmelzen. Sie schmiedeten den Stab und brachten ihn Sunjatta. Er nahm den Stab und zerbrach ihn zwischen den Fingern wie ein Rohr. Er sagte: "Das kann mir nichts nützen. Gibt es in Mande keine rechten Schmiede?" Die Leute sagten: "Ja, es gibt Schmiede." Sunjatta sagte: "Dann sollen sie mir einen ordentlichen Eisenstab machen, der hier kann mich nicht tragen." Die Numu bauten nun siebzehn Ganso, um das Eisen zu dem Stabe zu schmelzen. Sie schmiedeten den Stab und brachten ihn Sunjatta. Dieser stemmte ihn nur gegen die Erde, da bog er sich krumm wie ein Bogen. Er warf den Stab weg und sagte: "Nun bringt mir endlich etwas Ordentliches. Derartiges kann mir nichts nützen." Darauf bauten die Schmiede siebenundzwanzig Ganso, um das Eisen zu einem einzigen Stabe zu schmelzen. Sie schmiedeten den Stab und viele Leute trugen ihn. Er war dick wie ein Baumstamm. Sunjatta stützte sich auf ihn; er wollte sich aufrichten. Der Stab war aber nicht ganz stark genug und bog sich wieder ein wenig. Da rief Sunjatta: "Schnell, Mutter, komm, hilf mir!" So stützte er sich links
auf die Schulter seiner Mutter und rechts auf den Eisenstab. Die Mutter sang jubelnd: "Heute ist ein schöner Tag, der gute Gott hat mir noch keinen gleichen gegeben."Damals gab es in Mande einen einzigen großen Sirabaum. Wer einen Kern aus der Frucht dieses Baumes verschluckte, der wurde in Mande König. Sunjatta ging mit seinen Leuten zu dem Baume. Viele Leute hatten es schon versucht, mit Knüppeln da hinauf zu werfen, um eine Frucht zu erhalten. Keiner aber hatte soweit hinauf getroffen. Sunjatta aber ergriff statt eines Stockes einen Menschen. Er packte ihn bei den Beinen, aber als er ihn packte, brach dem armen Tropf ein Bein. Unter diesem Baume stand Balla-Fasege-Kuate, ein uralter Sänger (von dem noch heute viele Sänger ihre Herkunft ableiten). Der sang: "Sinkate Namara Konate!" (Bein. zerbrecher Namara-Familie). So erhielt Sunjatta einen seiner Namen. Der hinaufgeworfene Mensch schlug gegen eine Frucht, brach sie und schleuderte sie herab. Dann fiel er auf der andern Seite selbst wieder zu Boden und zerbrach dabei einen Arm, so daß Balla-Fasege-Kuate sang: "Bulukati Namara Konate!" (Armzerbrecher Namara-Familie), was wiederum ein Name Sunjattas wurde. Als die Frucht herunterfiel, begnügte sich Sunjatta nicht damit, wie andere es getan hätten, einen einzelnen die Königsherrschaft spendenden Samenkern zu verschlucken, sondern er schluckte die ganze Frucht so, wie sie war, hinab und verhinderte so, daß ihm ein Rivale entstand. Dann aber ergriff er den ganzen riesigen Baum, wie er vor ihm stand, riß ihn aus der Erde, wie andere ein kleines Pflänzlein gepackt hätten, trug ihn in die Stadt und setzte ihn in das Gehöft seiner Mutter. Er sagte: "Bisher mußte sich meine Mutter an andere wenden, um Sirablätter zu erhalten. Jetzt sollen die andern zu meiner Mutter kommen, wenn sie Sirablätter begehren." Er ließ den Baum im Gehöft seiner Mutter stehen.
Der Vater hörte das und sagte: "Aha, Sunjatta ist jetzt auf, und man kann daran gehen, ihn zu beschneiden." Nun war es Sitte, daß man in feierlichem Zeremonial dem ersten unter den Beschnittenen damals die Kongoton (Mütze) aufsetzte und den Muruffe Durruki (Mantel aus rotem Stoff) umhängte. Kongoton und Muruffe Dur. ruki waren aber so schwer, daß man den Menschen, den man damit geschmückt hätte, gleichzeitig erdrückt hätte, und somit begnügte man sich damit, den Mantel dreimal um seine Schultern und die mit dreihundertdreiunddreißig Köpfen von Tauben (Tubani) und drei. hundertdreiunddreißig Köpfen von Kronenkranichen (Koma) geschmückte
Kongoton dreimal über seinen Kopf zu halten. —So hielt man auch den Muruffe Durruki über ihn, einmal, nahm ihn wieder weg, zum zweiten Male und nahm ihn wieder weg, da rief Sunjatta: "Nun laßt ihn aber schnell auf meine Schultern fallen, sonst passiert etwas Schlimmes in Mande!" Man ließ ihn auf ihn fallen und der Mantel, der andere zerdrückt hätte, zerriß ein wenig auf den Schultern Sunjattas, so mächtig war er gebaut. Man hielt die Mütze Kongoton über ihn, einmal, man hob sie fort, zweimal, man hob sie fort. Sunjatta rief: "Nun setzt sie aber schnell auf meinen Kopf, sonst passiert etwas Schlimmes in Mande!" Man setzte sie auf seinen Kopf und die Mütze, die jeden andern unter sich zermalmt hätte, sie zerriß auf seinem Haupte, sie war zu eng, zu zart — so mächtig war das Haupt Sunjattas!Dann wurde Sunjatta in diesem Kleide beschnitten.
6. Sunjattas FluchtDrei Jahre waren nach der Beschneidung Sunjattas vergangen. Einmal war Djalimussu tumbumannia verreist, da einigten sich die andern acht der neun Subaga auf Veranlassung von Verwandten Sunjattas und verwandelten ihn in einen Turani (Stier). Dann führten sie den jungen Turani heraus und schnitten ihm den Kopf ab, sie töteten ihn; sie zerlegten ihn und machten neun Teile daraus. Jeder nahm seinen Teil, und das neunte Teil für Djalimussu tumbumannia hoben sie auf und gaben es der (Sunjatta schützenden) Subaga, als sie wiederkam. Djalimussu tumbumannia nahm ihren Teil und fragte: "Was ist das für Fleisch ?" Die andern Subaga antworteten: "Das ist das Fleisch Sunjattas, des Sohnes Sugulunkurmangs, den wir in einen Turani verwandelt und dann zerlegt haben."Djalimussu tubumannia sagte: "Was ist mehr Fleisch, ein junger Turani oder neun große Buschbüffel ?"Die acht Subaga antworteten: "Neun große Buschbüffel haben mehr Fleisch!"Djalimussu tumbumannia sagte: "Gut, dann bringt morgen sämtliche Knochen und Sehnen eurer Teile herbei, ich will euch dann jeder einen großen Buschbüffel dafür geben." So ward es; man brachte am andern morgen alle einzelnen Teile des Knochen- und Sehnengerüstes herbei und setzte den Turani wieder zusammen. Es wurde wieder ein junger Ochse daraus. Djalimussu tumbumannia schlug ihn auf den Schwanz, und er wurde wieder Sunjatta. Djalimussu tumbumannia sagte zu ihm: "Laufe schnell von dannen. Bleibe nicht! Gehe aus dem Mandelande! Die
junge Schlange muß sich verstecken, wenn sie nicht von den Menschen getötet und so jung ums Leben gebracht werden soll."Sunjatta machte sich mit seiner Mutter auf und ließ durch einen bekannten Mann das Kengebugurilala, das Sandorakel, über sein Schicksal befragen. Das Orakel sagte: "Ehe du dahinkommst, wohin du willst, wirst du dreimal in Zorn geraten. Wenn du dich aber nicht vom Zorn wirst hinreißen lassen, dann wirst du König des Mandelandes werden. Zunächst gehe hin und verstecke dich im Lande Merna." Da machte sich Sunjatta auf den Weg und zog von dannen. Er nahm mit sich seine Mutter Sugulunkurmang, seine kleine Schwester Killikillimadjumasuko und seinen jüngeren Bruder Simbombatanganjati, der auch ein großer starker Mann war. Mit diesen dreien entfloh er und zog aus dem Mandelande.
Er floh auf dem Wege, den das Orakel angegeben hatte und kam zunächst in das Land Dabo, in dem jeder Mann als "guten Tag" "dabo"sagte, und der Häuptling als Kissima Dabo bezeichnet wurde. Die Daboleute hatten drei verschiedene Arten von Baschi (Heiligtümer). Zunächst hatten sie die "Do", das waren Getränke wie das Dolo (Sorghumbier), aber von verschiedener Stärke. Einige konnten nur die Biere vertragen, welche einen Monat alt waren, andere die von fünf Monaten, andere die von sechs Monaten und andere gar die von zehn Jahren Alter. Das waren aber ganz starke Menschen, und nach dem Genuß waren sie müde und betrunken. Das zweite Baschi wurde genannt Tulu Kavuli Faga Kono, das war ein großer Topf, in dem viel Öl gekocht wurde. Wer nun etwas beschwören wollte, der zog seinen Ring vom Arm, warf ihn in das kochende Öl und zog ihn mit entblößtem Arme wieder heraus. Wer falsch geschworen hatte, dem verbrannte das kochende Öl den Arm bis auf die Knochen. Wer aber die Wahrheit gesagt hatte, dem konnte das Öl nichts anhaben. Zum dritten hatten sie das Baschi Binje, das bestand aus sieben doppelten Türen, die stellte man vor einen Baum von der Art des Bamanju (d. i. ein Bananenbaum). Vor diesen Türen schwor man. Wer richtig geschworen hatte, dessen Pfeil drang durch je zwei, ja drei Türen. Wer aber falsch geschworen hatte, dessen Pfeil konnte nicht einmal in das Holz der ersten Tür eindringen.
Die Leute von Dabo sahen aus der Ferne Sunjatta mit seinen Begleitern kommen. Sie sagten: "Was ist das? Es ist ein Fremder, wir wollen ihm den Do von einem Monat Alter geben." Sie reichten ihn Sunjatta, um zu sehen, wie stark er sei. Sunjatta nahm den Becher, und reichte ihn gleich weiter an Killikillimadjumasuko und sagte:
"Das mag gut sein für ein kleines Mädchen. Für mich ist das nichts." Die Schwester nahm das Gefäß, setzte es an die Lippen und warf dann Becher und Trank fort. Sie sagte: "Pfui, das ist schmutziges Wasser, aber kein Getränk!" Die Leute von Dabo sagten: "Wir wollen ihnen zweijährigen Do geben." Sie reichten ihn Sunjatta. Er setzte es an die Lippen und sagte: "So etwas gibt man bei uns Kindern. Meine Schwester mag das versuchen." Man reichte den Trank Killikillimadjumasuko. Das Mädchen trank davon, warf Trank und Schale fort und sagte: "Das taugt nichts. Die Frauen von Dabo verstehen kein Bier zu brauen." Die Daboleute sagten: "So sollen sie den Do von zehn Jahren versuchen." Sie reichten eine kleine Schale Sunjatta hin. Er versuchte davon und sagte: "Für Frauen mag das gehen, für Männer nicht. Gebt den Trank Killikillimadjumasuko!" Man gab dem Mädchen den Trank. Killikillimadjumasuko setzte die Schale an die Lippen, trank sie aus und sagte: "Gut ist das nicht. Wenn es aber nichts Besseres gibt, wenn die Frauen von Dabo nichts Besseres zu machen wissen, so kann man damit leidlich den Durst löschen. Man bringe mir also den großen Topf." Da brachte man einen ganz großen Topf mit dem zehnjährigen Do, und den trank das Mädchen aus, um damit den Durst zu löschen.Die Leute von Dabo sagten: "Das sind starke Leute. Dieser Mann soll den Tulu Kavuli Faga Kono versuchen. Man bringe ihn herbei." Die Leute brachten den Topf mit Öl herbei. Sunjatta zog seinen Ring vom Arme, warf ihn in das kochende Öl und sagte: "Njatta, Njatta, Njatta ninkanja, Njatta Namara! Das bin ich. Als ich noch unter dem Herzen meiner Mutter ruhte, da mag sie ein Vogel im Busch erschreckt haben, und sie mag erschrocken sein. Das ist dann nicht mein Fehler. Meine Mutter mag damals erschrocken sein, wenn ein Löwe brüllte. Das kann ich nicht wissen. Damals mag sie vor dem Djinna (Teufel) erschrocken sein. Davon weiß ich nichts. Das gehört nicht in meinen Schwur. Wenn der Donner grollte, wenn der Vater mit ihr schalt, dann mag sie erschrocken sein, und das nehme ich nicht in meinen Schwur auf. Aber seitdem ich meine rechte und meine linke Hand unterscheiden kann, bin ich nicht erschrocken. So mag das jetzt als mein Schwur gelten und alle Haut und Fleisch mag von meinem Arme brennen, wenn ich falsch schwöre. Wenn es aber so ist, dann mag mein Arm so bleiben, wie er ist." Er steckte die Hand in die kochende Flüssigkeit und zog sie wieder empor. Es war alles wohl erhalten, nur ein Härchen war verbrannt. Darüber lachten die Daboleute. Wie die Leute lachten, wurde Sunjatta grimmig
und wütend. Seine Schwester aber nahm ihn zur Seite und sagte: "Das Kengebugurilala hat gesagt: ,Wenn du dich aber nicht vom Zorne wirst hinreißen lassen, dann wirst du König des Mandelandes werden.' Sei also auf deiner Hut. An der Angelegenheit aber bist du selber schuld. Warum hast du mir nicht vorher deine Absicht gesagt. Ich bin nur ein schwaches Mädchen, eine Frau, aber ich vermag viel. (Das Mädchen verfügte nämlich auch über große Zauberkräfte.) Also sage mir vorher immer alles und ich werde dir behilflich sein." Sunjatta sagte: "So werde ich noch einmal schwören."Sunjatta ging hin und schwur nochmals. Seine Schwester stand daneben. Er steckte den Arm in das kochende Öl und zog ihn wieder heraus. Da war das Härchen, das vorher verbrannt war, wieder hergestellt.Die Leute von Dabo brachten nunmehr das Binje herbei. Sie stellten die sieben Türen vor dem alten Bananenbaum auf und sagten: "Sunjatta, nimm Pfeil und Bogen und schieß auf die sieben Türen." Da rief er seine Schwester und sagte: "Killikillimadjumasuko, sieh, ich will auf diese sieben Türen schießen." Sie kam herbei. Die Leute sprachen zu ihm: "Wenn du reinen Blutes bist, wenn du das Kind deines königlichen Vaters bist, so magst du getrost auf diese sieben Türen schießen, dann wird dein Pfeil zwei, oder gar drei Türen durchschlagen. Sonst aber wird er das Holz nicht zu durchboren vermögen." Man stellte die Türen auf. Sunjatta nahm seinen Pfeil auf die Bogensehne und sprach: "Wenn ich nicht reinen Blutes bin, so mag de! Pfeil zurückkehren und mich töten." Er schoß; der Pfeil sauste von dannen und zerschlug nicht nur alle sieben Türen, sondern drang auch noch mit voller Wucht in die Wurzel des Baumes, vor dem die Platten standen und warf den Baum um. Da schrie Kissima Dabo der König des Landes Dabo, laut auf, und sogleich war der Baum wieder aufgerichtet an seinem Platze wie vorher. Sunjatta schrie der Baum fiel wieder hin. Der König schrie — da stand der Baum wieder auf. Beide schrien, da fiel der Baum zur Hälfte um, die andere Hälfte blieb stehen. Und so ist es bis heute. Alle Bananenbäum stürzen nach und nach ein.
Die Leute von Dabo sagten aber: "Dies ist ein tapferer und starker Mann", und sie zeigten ihm den Weg nach Merna.
7. Sunjatta in der VerbannungDas Kengebugurilala hatte zu Sunjatta gesagt: "Zunächst gehe hin und verstecke dich im Lande Merna." Faran Tungara, der
erste Tungara von Merna, war an einer Kette vom Himmel gestiegen. Ihm folgte Farambram oder Brain Tungara, diesem Mene Tungara, diesem Menemene Tungara, diesem Kundu Tungara. Zu jener Zeit herrschte Farambram, der erste Nachfolger Faran Tungaras. Zu ihm kam Sunjatta und vertraute sich ihm an. Er sagte: "Ich komme mit meinen Angehörigen zu dir, weil ich in Mande die Subaga und meine Verwandten fürchten muß." Zunächst blieb er in diesem Lande.In das Mandeland fiel damals Susu Sumanguru ein. Sumanguru, der König der Susu, hatte seinen Namen, weil er von zwei Müttern geboren worden war. Seine beiden Mütter hießen Sansu und Dabi. Als diese schwanger waren, war die eine es immer tagsüber, und die andere immer nachtsüber und dafür die eine zu dieser Zeit nicht trächtig. So wechselten sie immer ab. Nachts verließ der Knabe den Mutterleib und lief im Hause herum. Aber die Frauen konnten das Kind nicht gebären. Da wandten sie sich an das Orakel und fragten, was dazu tun sei. Das Orakel antwortete: "Stellt in dem Zimmer, in dem die beiden Frauen Sansu und Dabi schlafen, einen großen Holzmörser auf, wie ihr ihn zum Stampfen gebraucht. Dann wartet ab, was sich ereignen wird!" Wie das Orakel es angab, so wurde im Hause der beiden schwangeren Frauen ein Holzmörser aufgestellt. Wie immer schlüpfte in der Nacht Sumanguru aus dem Mutterleibe und lief umher. Nachher wollte er in den Leib der andern Mutter zurückkehren, er traf aber auf den Holzmörser und setzte sich in den Mörser. Beide Frauen saßen dabei aufrecht im Bette, auch entfloß beiden Blut wie bei der Entbindung, was man Ulodjoli (Ulo = sich legen; djoli = Blut) nennt. Darauf sagten die Leute: "Sansu und Dabi haben geboren." Sie nannten den Knaben Susu Sumanguru und erzählten von ihm, daß er zwei Mütter habe. Die beiden Mütter stritten aber miteinander. Sansu sagte: "Er ist mein Sohn." Dabi sagte: "Er ist mein Sohn." Sie stritten sich hin und her. Sumanguru wurde groß und stark. Wenn Sunjatta von ihm hörte, sagte er: "Es wird sich niemand mit Sumanguru schlagen können."Sumanguru aber sagte: "Niemand kann Sunjatta widerstehen."
Susu Sumanguru wurde groß und begann seine Kriege, als Sunjatta in Merna weilte und in Mande Mansa Dangaratuma herrschte. Er begann den Krieg gegen Mande, fiel in das Land ein und eroberte einen Teil nach dem andern. Es weilte noch eine kleine Schwester Sunjattas im Lande, namens Sigassuko. Sumanguru taufte sie um und nannte sie Taffesiga (Ta-Feuer, fe-blasen, Siga ist
der Name. — Die Massari nennen die Frauen Siga, die Männer Keita). Er packte fernerhin Balla Fasege Kuate, den Sänger. Massa Dangaratuma floh und kam mit seinen Leuten in das Land Nkissi (Nkissi heißt "Wohlbefinden"). Da ließen sie sich nieder, und es entstand das Volk der Nkissi. Mande verfiel, und die Leute sagten: "Wenn Sunjatta nicht bald zurückkehrt, ist Mande für immer verloren." Andere sagten: "Man soll Sunjatta rufen." Andere aber sagten: "Wie sollen wir Sunjatta finden?" Sie dachten nach und einige sagten: "Alle Mali essen für ihr Leben gern Sirabulu (Sirablätter), die es in keinem andern Lande gibt. Nun soll man Sirabulu auf alle Märkte senden und ausrufen: "Sirabulu, Sirabulu!"Sogleich werden Sunjatta und seine Leute herbeikommen und die Blätter kaufen wollen. Daran erkennt man sie und kann ihnen die Botschaft berichten. Das schien allen gut, und man sandte die Leute aus. Susu Sumanguru hörte aber davon und ließ eine Last Gold bereiten. Er sandte diese Last an Farambram und ließ ihm sagen, er solle Sunjatta töten lassen. Farambram liebte über alle Maßen das Siggispiel, ein Spiel, bei dem es darauf ankommt, auf welche Seite die ausgeworfenen Eisenwürfel fallen. Er rief Sunjatta zum Siggispiele, schüttelte das Eisen in der Hand und sagte: "Wenn mir jemand seinen Vater gibt, daß ich ihn töte, so töte ich ihn. Wenn mir jemand seine Mutter gibt, daß ich sie töte, so töte ich sie. Wenn mir jemand seine Verwandten gibt, daß ich sie töte, so töte ich sie." Mit diesen Worten warf er. Sunjatta ergriff das Eisen, schüttelte es in der Hand und sagte: "Wenn dir jemand eine schlechte Arbeit gibt und Gold, so laß die schlechte Arbeit und laß das Gold." Mit diesen Worten warf er. Sunjatta gewann.Sunjatta und sein jüngerer Bruder Simbombatangajagati waren einmal auf der Jagd nach wilden Büffeln und von Merna abwesend. Da kamen die Mandeboten und hielten die Sirabulu laut rufend feil. Killikillimadjumasuko ging über den Markt. Sie hörte die Rufe und ging hin. Sie nahm die Sirabulu in die Hand und sagte: "Das sind Blätter aus meinem Lande." Sie fragte die Leute: "Woher kommt ihr?" Und sie antworteten: "Wir kommen aus Mande." Sie fragte die Leute: "Weshalb reist ihr im Lande umher?" Da sagten sie: "Wir suchen Sunjatta. Wir wollen ihn zurückrufen. Wenn er nicht kommt, wird das Mandeland zerfallen."Killikillimadjumasuko sagte: "Ich will euch das Haus Sunjattas zeigen. Kommt mit mir." Sie führte die Boten in das Haus und sagte: "Ich werde euch sogleich etwas Essen bereiten." Sunjatta und sein Bruder hatten inzwischen
neun Büffel erlegt. Die Schwester wußte das (infolge ihrer Zauberkräfte). Sie zog die Herzen und Lebern aus den neun Büffeln, ging nach Merna und machte daraus für die Boten ein Gericht. Das setzte sie den Männern vor. Im Busch schnitten die beiden Jäger den ersten Büffel auf. Sie fanden kein Herz, keine Leber darinnen. Simbombatanjagati sagte: "Was ist das? Hier ist keine Leber, kein Herz?" Sie schnitten alle Büffel auf. Es war in keinem ein Herz, in keinem eine Leber. Sunjatta sagte: "Das hat unsere Schwester Killikillimadjumasuko getan. Es ist sicher ein Bote gekommen, dem sie ein gutes Essen vorsetzen wollte." Die beiden Brüder machten sich auf den Heimweg. Vor den Toren trafen sie die Schwester. Simbombatanjagati schlug die Schwester ins Gesicht, daß ihr Kleid zerriß und sagte: "Was hast du mit den Lebern und den Herzen unserer Büffel gemacht?" Die Schwester sagte: "Du hast mich beleidigt."Killikillimadjumasuko sagte zu Sunjatta: "Es ist eine Botschaft aus Mande gekommen. Susu Sumanguru ist ins Land gekommen, hat den König verdrängt, und jetzt zerstört er es. Die Leute aus Mande lassen dir sagen, wenn du nicht bald kämst, würde das Reich vollständig zerstört werden. Die Leute sind gekommen, dich zurückzurufen." Sunjatta sagte: "Ich kann jetzt nicht dahin zurückkehren, denn meine Mutter ist alt und kann den weiten Weg nicht mehr zurücklegen." Sugulunkurmang sagte: "Du willst mein Leben nicht für eine ungewisse Sache auswerfen. Deshalb gehe hin und schwöre, daß du mein Leben nicht für nichts hingeben willst, daß du nicht etwas Unsicheres unternehmen willst. Wenn du König werden wirst, so werde ich sterben. Wirst du nicht König, so werde ich am Leben bleiben."Sunjatta ging aus der Stadt und in den Busch. Er schwor: "Ich schwöre, daß ich nicht fortgehen werde, wenn ich nicht König von Mande werde."Sunjatta ging aus dem Busch wieder nach Haus, und als er heimkehrte, war seine Mutter gestorben.
Darauf ging Sunjatta zu Farambram und sagte: "Meine Mutter ist gestorben, ich will sie begraben." Der König sagte: "Du kannst deine Mutter begraben, du mußt aber das Land und die Erde kaufen, um darin Sugulunkurmang zu begraben. Tust du das nicht, so mußt du ihre Leiche zurückführen bis Mande."Sunjatta fragte: "Was kostet die Erde ?" Farambram sagte: "Land und Erde kostet Mutukaili (hundert Gramm Gold)." Sunjatta sprang auf und sagte: "Ich werde dir das Land und die Erde bezahlen, damit ich meine Mutter begraben kann." Er ging hin und brachte das Geld auf; dann tat er aber in eine Kalebasse eine Feder von einem Perihuhn, eine Feder
von einem Feldhuhn, ein kleines Stück einer zerbrochenen Kalebasse, ein kleines Stück eines alten zerbrochenen Topfes, eine eiserne Gewehrkugel, denn damals kamen die ersten Gewehre auf (da die Tradition Vorgänge aus dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts schildert, so muß die Einschiebung der Verwendung von Gewehren eine ziemlich späte sein). Diese Dinge tat er in eine Kalebasse und sandte die mit dem Gelde zusammen zu Farambram.Als Gold und Kalebasse ankamen, saßen die drei alten Weisen bei dem Könige. Er fragte sie: "Was ist denn das in dieser Kalebasse?" Die drei Weisen waren Kemoro-kubelong (der alles kennt), Kemoro-kubakurosi (der alles merkt und versteht) und Kemoro-komabefu (der alles sagt und verkündet). Als der König so gefragt hatte, beugte sich Kemoro-kubelong über die Kalebasse, blickte hinein und sagte: "Ng!" Kemoro-kubakurosi beugte sich vor und sagte: "Ich weiß es!" Kemoro-komabefu aber hob den Kopf und sagte: "Die Stücke einer zerbrochenen Kalebasse sollen bedeuten, daß Sunjatta einstmals wieder nach Merna kommen und das Land dann zerbrechen könne; das Stück eines zerschellten alten Topfes soll sagen, daß Merna zerspringen würde wie ein morsches, altes Gefäß; die Feder eines Perlhuhns und die Feder eines Feldhuhns sagen, daß die wilden Tiere ihre Nahrung in den Ruinen Memas suchen werden; die Gewehrkugel sagt, daß deine Leute unter diesem Geschosse fallen und auseinandergetrieben werden." Als Kemoro-komabefu das gesagt hatte, schob Farambram das Gold und die Kalebasse zurück und sagte zu Sunjatta: "Ich will nicht dein Gold. Nimm dein Gold und bestatte deine Mutter. Du brauchst die Leiche Sugulunkurmangs nicht in das Land Mande zurückzutragen." Da bestattete Sunjatta die Leiche seiner Mutter und sagte: "Nun will ich in mein Land zurückkehren."
8. Sunjattas RückkehrSunjatta machte sich auf den Heimweg. Er kam an im Lande Mande, sandte einen Boten an Sumanguru und ließ ihm sagen: "Komm mit deinen Kriegern nach Kankinja, da wollen wir uns schlagen." Sumanguru kam mit seinen Helden nach Kankinja. Bei Kankinja schlugen sich die Mande und die Susunke neunmal. Bei Kankinja weinten die Leute aus Mande, aber die Susu lachten (d. h. gewannen die Schlacht). Sunjatta sandte seine Boten an Sumaflguru und ließ ihm sagen: "Komm, wir wollen uns in Djendjenfe schlagen."
Sumanguru kam mit seinen Kriegern nach Djendjenfe. Bei Djendjenfe schlugen sich die Mande und die Susu neunmal. Bei Djendjenfe weinten die Leute von Mande und die Susu lachten. Sunjatta sandte Boten an Sumanguru und ließ ihm sagen: "Komme mit deinen Horden nach Djabefuga, da wollen wir uns schlagen." Sumanguru kam nach Djabefuga. Bei Djabefuga schlugen sich die Mande und Susu neunmal. Bei Djabefuga weinten die Mande und lachten die Susu. Sunjatta sandte an Sumanguru eine Nachricht und ließ ihm sagen: "Komm nach Tingambare, da wollen wir uns schlagen." Bei Tingambare schlugen sich die Heere neunmal. Bei Tingambare weinten die Mande und lachten die Susu. Sunjatta sandte Boten an Sumanguru und ließ ihm sagen: "Komme mit allen deinen Heeren und Kriegern nach Dagadjalla, da wollen wir unsere Kräfte erproben." Sumanguru kam. Die Schlacht bei Dagadjalla begann. Neunmal schlugen sich die Heere. Bei Dagadjalla lachten die Mande und die Susu wurden geschlagen. Sumanguru und die Susu mußten das Land verlassen. Sunjatta ward König von Mande.Sunjatta rief Sirmangande, den Ahnherrn der Turre. herbei und sagte zu ihm: "Es gibt in der Welt etwas, das heißt Donfe (so wurde damals das Pferd genannt). Geh in das Land Djolof und kaufe für Gold Pferde, damit ich sie meinen Kriegern geben kann." Sirmangande Turre machte sich auf den Weg. Er suchte das Land des Djolofemansa (Mansa = König) auf, gab dem König das Gold und sagte: "Sunjatta, der König von Mande, schickt dieses Gold, damit du ihm dafür Pferde sendest." Der Djolofemansa ließ für das Gold fünfhundert Büffelhäute und fünfhundert Kobahäute bringen und legte sie an Stelle der Pferde vor den Boten Sirmangande. Er sagte: "Sage Sunjatta, daß die Malinke Jäger und Trinker sind, die besser Sandalen tragen als auf Pferden reiten. Sage Sunjatta, er solle aus diesen Fellen Sandalen für seine Leute machen. Die Pferde sind für wirkliche Könige. Die Pferde sind für den Djolofemansa." Damit entließ der König der Wolof den Boten.
Sirmangande kam zurück. Er traf zuerst Ulali Brahima, den Ahnherrn der Garanke, und sagte zu ihm: "Geh zu Sunjatta und sage ihm, daß der König der Wolof seine Botschaft verspottet hat und ihm sagen läßt, die Malinke seien Jäger und Trinker, aber keine Krieger, und die Pferde kämen nur wirklichen Königen zu." Ulali Brahima sagte: "Ich bin ein Arbeiter und arbeite meine Sachen stets gern und gut, aber ich bin kein Mann, der solche Sachen gut reden und vortragen kann."Sirmangande traf dann Fosana, den
Ahnherrn der Fina, und sagte zu ihm: "Geh du zu Sunjatta und sage ihm, daß der König der Wolof seine Botschaft verspottet hat und ihm sagen läßt, die Malinke seien Jäger und Trinker, aber keine Krieger, und die Pferde kämen nur wirklichen Königen zu." Fosana sagte: "Ich schlage gern die Trommel und spiele gern, aber ich bin nicht geeignet, schlechte Worte zu sagen."Sirmangande traf dann Dumfaila, den Ahnherrn der Numu, und sagte: "Geh du zu Sunjatta und sage ihm, daß der König der Wolof seine Botschaft verspottet hat und ihm sagen läßt, die Malinke seien Jäger und Trinker, aber keine Krieger, und die Pferde kämen nur wirklichen Königen zu." Dumfaila sagte: "Ich bin ein Numu (ein Schmied) und verrichte jede Arbeit gern, die dem Numu zukommt. Solche Schimpfworte zu übertragen, schändet aber, und das mag ein anderer tun." Sirmangande traf dann auf Surrakata, den Ahnherrn der Djalli (der Sängerkaste). Er sagte: "So geh du denn zum König Sunjatta und sage ihm, daß der Djolofemansa seine Botschaft verspottet hat und ihm sagen läßt, die Malinke seien Jäger und Trinker, aber keine Krieger, und die Pferde kämen nur wirklichen Königen zu."Surrakata sagte: "Ich könnte es sagen, aber es wird jetzt Nacht, und die Geschichten der Nacht sind stets lang. Ich will aber zum Könige gehen und ihm sagen, daß ich ihm am Morgen die Botschaft bringen würde."Surrakata ging zu Sunjatta und sagte: "Narremaga!"Der König anwortete: "Njatta, Njatta Ninkanja, Njatta, Njatta Namara!"Surrakata sagte: "Ich habe dir lange Worte zu überbringen, darum kann ich es dir heute abend nicht mehr berichten. Was ich zu sagen habe, ist nicht kurz. Sobald die Sonne den Osten rot macht, werde ich es dir sagen."Sunjatta sagte: "Sage es gleich, ich habe nicht die Gewohnheit, lange aufzuschieben, sage es!" Surrakata sagte: "Warte bis die Sonne den Osten rötet." Sunjatta hatte einen kleinen Sklaven mit Namen Djonfissiko (Djon = Sklave), zu dem sagte er: "Rufe alle meine Diener, sie sollen im Osten viel Holz aufschichten und es anzünden, damit der Himmel rot wird und man glaubt, die Sonne gehe auf." Der Knabe ging hin und tat so. Als der Himmel rot war, sandte Sunjatta zu Surrakata und ließ ihm sagen: "Der Himmel ist rot, komm und sage deine Worte!" Surrakata sagte: "Ich habe noch nicht die Hähne krähen hören. Es wird jemand Holz angezündet haben und davon wird der Himmel rot sein."Sunjatta sagte zu seinem Sklaven: "Geh hin und laß die Hähne schlagen, so daß sie krähen." Der Knabe ging hin und tat so. Als die Hähne
krähten, sandte Sunjatta zu Surrakata und ließ ihm sagen: "Die Hähne krähen, komm und sage deine Worte!"Surrakata sagte: "Ich habe noch nicht die alten Leute husten hören. Es wird jemand die Hähne geschlagen haben, so daß sie krähen. Warte bis zum Morgen." Sunjatta sagte zu Djonfissiko: "Geh hin und laß die alten Leute schlagen, so daß sie husten." Der Sklave ging und ließ die alten Leute schlagen, so daß sie husteten. Dann sandte Sunjatta zu Surrakata und ließ ihm sagen: "Die alten Leute husten, komm und sage deine Worte!" Surrakata sagte: "Ich habe noch nicht die Sonne selbst gesehen. Es wird jemand die alten Leute haben schlagen lassen, so daß sie husten." Da wartete Sunjatta, bis die Sonne aufging.Als die Sonne aufging, kam Surrakata und sagte: "Du hast Sirmangande in das Land der Wolof mit Gold gesandt, daß er es dem Könige bringe und dafür Pferde kaufe. Sirmangande ist hingegangen und hat das Gold dem Djolofemansa überreicht. Der hat vor ihm fünfhundert Büffelhäute und fünfhundert Kobahäute ausbreiten lassen an Stelle der Pferde und hat gesagt: ,Sage Sunjatta, daß die Malinke Jäger und Trinker sind, die besser Sandalen tragen als auf Pferden reiten. Sage Sunjatta, er solle aus diesen Fellen Sandalen für sich und seine Leute machen, die Pferde seien für wirkliche Könige. Die Pferde sind für den Djolofemansa.' Mit diesen Worten hat der Djolofemansa dich verspottet und deinen Boten entlassen!"
Es waren damals um Sunjatta versammelt: zum ersten die Tuntjontaniuoro, das sind die sechzehn unterworfenen Stämme, dann die Djabefedjonani, das sind vier fremde, und die Morikantalulu, das sind fünf islamische Völker oder Familien, und endlich die Ngaranani, die vier Helden Surrakata, Dumfaila, Ulali-brahima und Fosana mit ihren Anhängern. Von allen diesen galten die vier Helden als die klügsten.
Alle diese waren um Sunjatta versammelt, als Surrakata die beschimpfenden Worte des Königs der Wolof wiederholte.
Als der Djalli vollendet hatte, sagte Sangaradambinjakonte: "Laß mich diesen Schimpf rächen und gegen den Djolofemansa zu Felde ziehen!"Sunjatta sagte: "Das ist eine Sache, die ganz allein ich ausführen muß."Fagolibarma, der Großvater der Sussoro, sagte: "Laß mich diesen Schimpf rächen und gegen den Djolofemansa zu Felde ziehen."Sunjatta sagte: "Das ist meine Sache, die ganz allein ich ausführen muß."Tiramaga, der Großvater der Traore, sagte: "So laß mich denn diesen Schimpf rächen und gegen Djolofemansa
zu Felde ziehen."Sunjatta sagte: "Der Schimpf ist zu groß, ich muß es selbst ausführen."Tiramaga sagte: "Wenn du mir das nicht erlaubst, so will ich mich selbst töten und begraben lassen."Sunjatta sagte: "Ich werde es selbst tun."Tiramaga ließ darauf sein Grab graben und hüllte sich in die Totenkleider. Er sagte nochmals zu Sunjatta: "Erlaube es mir!" Sunjatta sagte: "Ich muß es selbst tun." Da ging Tiramaga hin und legte sich in sein Grab. Er sandte einen Boten an Sunjatta, der sagte: "Tiramaga liegt im Grabe. Man wird es jetzt zuwerfen."Balla-Fasege-Kuate, der weise Sänger, stand bei Sunjatta, als die Botschaft ankam. Er sagte zu ihm: "Laß es jetzt genug sein und erlaube ihm, gegen den König der Wolof zu Felde zu ziehen."Sunjatta sagte: "So mag es denn sein."Tiramaga hörte die Nachricht, stand auf und sammelte seine Leute. Er zog von dannen in den Krieg. Tiramaga erschlug im Kriege selbst den Djolofemansa und hieb ihm den Kopf ab. Die Wolof stampften inzwischen wie wilde Büffel den Boden. So zerstörte Sunjatta das Wolofreich und erhielt Pferde.Seitdem singt man folgendes Lied: "Tiramaga wird nie verletzt. Nie trifft ihn ein Pfeil. Nie trifft ihn ein Ball. Nie trifft ihn ein Messer. Wenn das Wasser steigt, kann Tiramaga es durchschreiten. Wenn ein Sumpf entsteht, so wird Tiramaga durch ihn hindurchgehen."
9. Weitere KriegszügeBalla-Fasege-Kuate fragte Sunjatta: "Weshalb hast du den Djolofemansa töten lassen?" Sunjatta sagte: "Weil er mich einen Trinker geschimpft hat."Balla-Fasege-Kuate sagte: "Das hat nicht nur Djolofemansa gesagt, das sagte auch Ulimansa." Ulimansa war ein König, der nahe dem Lande Djolof wohnte. Sunjatta sagte: "So werde ich diesen Schimpf ebenso rächen", sandte eine Kriegsschar gegen den Mansa von Uli, ließ ihn töten und seine Herrschaft zerstören. Bald darauf hörte man, daß auch Njanimansa einen gleichen Schimpf gewagt hatte. Da sandte Sunjatta eine Kriegsschar gegen ihn und ließ ihn töten und seinen Kopf abschlagen.
Damals sagte man sich noch "Konata" als guten Tag und noch nicht "Keita", d.h. "Erbe"(in Wahrheit heißt Kei-taoder Koita "Glied der Königsfamilie"). Nachdem aber alle diese Kriege gewonnen waren, sagte man "Keita" statt "Konate", und so veränderte die Familie ihren Namen. Das Land war groß und die Krieger Sunjattas waren mit Pferden ausgerüstet.
Kante Numu aber war ein Schmied, dem Sunjatta kein Pferd gegeben hatte. Deswegen war er sehr erbittert. Er sandte darum eine Nachricht an Susu Sumanguru und ließ ihm sagen: "Sende mir einen Pfeil!" (d. i. bildlich und soll eigentlich heißen ein Pfeilbündel und bedeutet eine Streitmacht), so will ich gegen Sunjatta zu Felde ziehen."Sumanguru empfing die Botschaft und war damit einverstanden. Er sandte eine Kriegsschar zu Kante Numu, der von Sunjatta abfiel und gegen ihn einen Krieg begann.
Sunjatta versammelte die Tuntajontanniuorro, die Morikantalulu, die Djabifedjonani, die Ngaranani und zog in den Krieg. Es kam zur Schlacht. Kante Numu sandte einen Pfeil auf Sunjatta, der den König an der Stirn verletzte. Die Leute wollten auf Kante Numu stürzen, um ihn zu töten. Sunjatta aber hielt sie zurück und sagte: "Laßt ihn, ich werde das selbst machen. Laßt ihn noch." Er nahm zwei Pfeile und schoß einen nach dem andern auf Kante Numu. Es waren Zauberpfeile und Sunjatta hatte zu ihnen gesagt: "Folgt Kante Numu, dem Abtrünnigen. Tötet ihn zunächst nicht, aber bleibt immer über seinem Haupte. Reitet oder geht er, so folgt seinem Wege, schläft, steht, sitzt, ruht er, so bleibt schwirrend über seinem Haupte. So bleibt bei ihm, bis er zu Sumanguru, dem Herrscher der Susu, seinem neuen Herrn kommt. Wenn er dort den Mund öffnet, um zu erzählen, daß er mich mit einem Pfeil getroffen habe, dann trefft, dann tötet den Abtrünnigen."Sunjatta schoß. Er schoß den ersten Pfeil. Er schoß den zweiten Pfeil.
Kante Numu war geschlagen, seine Truppen waren zersprengt. Er floh nach Süden (?),wollte zu Susu Sumanguru reisen. Die beiden Pfeile Sunjattas folgten ihm. Sie töteten den Abtrünnigen zunächst nicht, aber sie folgten ihm überall, wohin er ging, wo er stand. Sie blieben ständig über seinem Haupte. Ritt und wanderte er, so folgten sie ihm. Ruhte, lag, saß, stand er, so kreisten sie schwirrend über seinem Haupte. So blieben sie während der Reise immer bei ihm und verließen ihn nie. Mit den beiden Pfeilen im Gefolge kam er bei Sumanguru, dem Herrscher der geschlagenen Susu an. Sieben große Torbauten, die zusammen Bulungoulongola (ulongola = sieben) hießen, führten zum Regierungsplatze des Königs. Das erste Haus hieß Bulumbaualanta. Kante Numu trat hinein. Die Pfeile folgten ihm. Er schritt zur andern Seite heraus. Die beiden Pfeile traten mit ihm heraus. Das zweite Hofgebäude hieß Kiebalesigibung. Kante Numu trat hinein. Die Pfeile kamen mit ihm hinein. Er verließ das Torgebäude. Die Pfeile verließen es mit ihm. Er trat in das dritte,
vierte, das fünfte, das sechste Torgebäude. Die Pfeile verließen ihn nicht, sondern blieben bei ihm. Das letzte Torgebäude hieß Gadaferubulong. Kante Numu trat hinein. Die Pfeile folgten ihm. Er durchschritt das Haus und trat auf der andern Seite ins Freie. Die Pfeile verließen mit ihm das Haus. Er durchschritt den Hof, die Pfeile folgten ihm.Kante Numu trat vor den König. Die beiden Pfeile kreisten schwirrend über seinem Haupte. Kante Numu begrüßte den König und begann zu erzählen: "Du hast mir Krieger gesandt, mit denen zog ich gegen Sunjatta. Der hatte um sich Tuntjontaniuoro, die Djabifedjonani, die Morikantalulu, die Ngaranani. Es kam zur Schlacht. Sunjatta hatte viele Streiter. Wir fochten hin und her. Ich ergriff im Gefecht einen Pfeil und — In diesem Augenblick schossen die beiden Pfeile auf Kante Numu herab denn Sunjatta hatte ihnen gesagt, sie sollten den Abtrünnigen in dem Augenblicke töten, in dem er erzählen wollte, daß sein Pfeil den König der Mali getroffen habe. Kante Numu sank tot zu den Füßen des Königs Sumanguru. Dieser verfügte auch über starke Zauberkraft. Er ergriff seinen Baschiku (heiligen Kuhschwanz, Zeichen des Regenten) und wedelte mit ihm über dem Toten hin und her. Kante Numu erhob sich wieder. Susu Sumanguru sagte: "Sprich weiter." Kante Numu sagte: "Ich ergriff im Gefecht einen Pfeil und" — dann fiel er wieder tot zu Boden. Susu Sumanguru ergriff wieder den Baschiku und wedelte über ihn hin. Kante Numu erholte sich wieder. Susu Sumanguru sagte: "Sprich weiter!" Kante Numu sagte: "Ich ergriff im Gefecht einen Pfeil und — dann fiel er wieder tot zu Boden. Susu Sumanguru ergriff nochmals den Baschiku. Noch einmal konnte er Kante Numu zum Leben erwecken. Das viertemal gelang es nicht wieder, denn der Leib des Burschen war dann in Staub zerfallen. So erfuhr es Susu Sumanguru nie, daß einer seiner Pfeile Sunjatta verletzt habe. Der Krieg mit ihm nahm ein Ende. Die Susu waren geschlagen. Der König Susu Sumanguru ist bei Kulikorro in einen Berg verwandelt, der heute noch zu sehen ist. Der Ort ist heilig. Kein Fremder darf ihn betreten. Noch heute werden in der Umgebung bestimmte Zeremonien abgehalten.
Zu jener Zeit erschien oftmals ein Zwerg (Gotte) in den Träumen Sunjattas und erschreckte ihn bald mit einem, bald mit mehreren, bis zu sieben Köpfen. Sunjatta mußte im Schlafe weinen. Die Zwerge (Gotteni) gab es als lebendige Menschen in großer Menge in jener alten Zeit. Dies war ein ganz besonders gefährlicher. Es war Fakolobarama,
der Vater der Koromagafamilie, der den Zwerg tötete und den König von der Plage befreite. —Ein Bruder Sunjattas, der Fatigi oder Fatjigi hieß, kam einst zum König und sagte: "Ich will nach Maka gehen. (Maka liegt im Osten und ist ein mythisches Land. Die Reihenfolge ist von West nach Ost: Medina, Maka, Dame Same, das Land, in das alle Toten gehen.) Es liegt sehr weit fort. Ich will aber alle Baschi und Komma suchen."Fatigi ging von dannen und holte tausendundvier Komma und Sanene, das sind die Urahnen der Komma, dann tausendundein verschiedene Baschi, und vor allem die Großväter der Baschitubalala, die Großväter der Tubalala, die aus goldenen Kuhstatuetten bestehen. Weiterhin brachte er die Großväter der Djakarri, d. h. der Hühner, die noch nicht bekannt waren, und die kleinsten Torre (Küken). Mit den Torre nährte er die Tubalala. Weiterhin kamen die Niginikonta, die Großväter der Bosso (Fischer) mit.In Mossi brachte Fatigis Frau auf dem Heimwege einen kleinen Sohn zur Welt. Fatigi sagte: "Wie soll ich die beiden nach Mande bringen? Ich werde sie hier lassen." Er ließ Frau und Kind da, und von denen stammen die Mossi ab. —Er kam aber mit allen Baschi und mit den Komma in Mande wieder an.
17. Kapitel: Ergänzungen zur Sunjattalegende*
Mitteilungen des alten Hansumana Kuate und einiger anderer Dialli in Kankan. — Das Land der Koba wird als "Do"bezeichnet. Es umfaßte die drei Länder Kirn, Maffadugu, Do "und reichte nach Norden". Die Bewohner dieses hier also nicht Sangarra [sondern Do] genannten Landes wurden mir hier als Konne, Konte oder Kanute angegeben und als Name ihres Herrschers wird Dumogoniamago Dierra genannt. Dieser herrschte über zwölf Dörfer, in denen zwölf Geschwister (?) lebten. Jeden Morgen kam eine Kobaantilope mit Namen Dang, die tötete jeden Morgen einen Mann aus den Dörfern. Diese Dang hatte Zähne, Ohren, Schwanz, Leib, Füße und alles auf der einen Seite aus Gold, auf der andern Seite aus Silber. —Das war die Koba, die von den beiden Traore getötet wurde. —
Einige interessante Ergänzungen zur ältesten Kulturkenntnis brachte der greise Hansumana Kuate. Er sagte: "Heute sind die Diarra oder Dierra sehr einflußreich. Die Mande sind aber viel, viel älter in allen diesen Ländern." Weiterhin: "Es gab in uralten Zeiten drei große Städte im Norden, die lagen dicht beieinander. Die größte war Njani Mba; dieser Ort hatte schon bei seiner Gründung dreihundert Häuser. Im Westen von Njani-Mba lag die Stadt Susu, um die die Jogofamilie wohnte und aus der Susu Sumanguru kam. Dann gab es noch Surru, eine Stadt, von der ich nicht weiß, wo sie liegt. In ihr lebte Sutige Sirama, der Ahnherr des Mbueta-Stammes (die Kayesleute sagen Mgueta statt Mbueta). Das war ein mächtiger König und der erste, der Pferde hatte. Vor Sutige Sirama kannte man die Pferde nicht und die Mande hatten damals keine Pferde. Alle diese großen Städte lagen direkt beieinander."
Zu Susu Sumanguru ist noch verschiedenes hinzuzufügen, das wichtige Angaben über sein Machtbereich und die ihm untergebenen Stämme bietet. Sumanguru hieß Kante. Er führte aber nach der Eroberung Mandes und Njani Mbas den Gruß "Bammana" ein. Erstaunt über diese neue Angabe fühlte ich dem alten Kuate energisch auf den Zahn. Der ehrliche Alte blieb aber fest bei seiner Angabe und brachte die zweite überraschende Neuheit, daß in seiner Jugend noch ein Buch existiert habe*, das aber von Samori, seinem Lehrmeister, geraubt worden sei. Darin habe das und alles andere gestanden. Leider tat ihm diese Angabe nachher selbst leid und er leugnete sie wieder, weswegen weiß ich nicht. Jedenfalls verstimmte es ihn, daß er so weit mit seinen Mitteilungen über die Quellen gegangen war. Immerhin klärte er mir folgendes auf: Susu Sumanguru schuf in Njani Mba das ältere Bammanareich. Die Kulloballi, die die Herrscher des mehr südlich gelegenen Mareiches waren, wurden verdrängt (siehe unten) und als Sunjatta dann kam, gründete er das Malli-reich am Niger.
Um wieder auf den Gruß zu kommen, so wurde mir gesagt, daß die Kulloballi sich heute "Diarra"entbieten, sich früher aber mit "Keita" anredeten und daß Sunjatta, der entweder Konate oder Keita gewesen sein soll (!), den Gruß "Keita"aussprach. Wie weit hierin ein Widerspruch liegt, wird später kritisch zu beleuchten sein. (Diese Anrede "Kulloballi-Diarra" wird in Bamako energisch bestritten.)
Jedenfalls ward Mansa Dangaratuma, der Ziehbruder Sunjattas (der Legende), als König von Mande und Oberhaupt der Kulloballi durch Susu Sumanguru in den großen Wald bei Kissi gedrängt. Die
1. Die Nachkommen Kano Simbos sind Dialli geworden und führen heute den Stammesnamen Duguno.
2. Die Nachkommen Kaniojo Simbos leben als Kulloballi heute auf dem rechten Nigerufer im Fiegebiet.
3. Die Nachkommen Simbomba Marentas leben heute verstreut unter dem Namen "Keita".
4. Ein großer Teil der Kulloballi lebt im südwestlichen Nkissigebiet, andere in Kaartu, Segu usw.
Wurden die Kulloballi des Mandereiches derart durch Susu Sumanguru vertrieben, so scheint er andererseits den Bewohnern des nördlichen Gamareiches nichts Schlimmes angetan zu haben, und deren Auswanderung beginnt nach meinen Berichterstattern aus Kankan mit dem Auftreten Sunjattas. Sicher ist, daß die Jogostämme dieses Nordgebietes, auf die wir gleich näher zu sprechen kommen werden, zunächst mit Susu Sumanguru gegen Sunjatta kämpften.
Die sechzehn, die Tuntjontanninoro, hießen:
1. Kudujo oder Kudujogo oder Kurrujogo, heute DiaIli,
2. Sujo oder Sussorojogo (=Sussogojogo Bammana),
3. Bajo oder Ballajogo (=Baga jogo in Bammana),
4. Jajo oder Jarajogo,
5. Sunjo oder Sumojogo,
6. Kuruma oder Korromaga,
7. Kokaffare, von Fakoli abstammende Korromaga,
8. Deteba unter Dedebalu, heute in Gadugu und Bandiagadugu,
9. Deteba unter Kanu Simba,
10. Konte oder Konne unter Djibami,
11. Mantuma unter Sakolibimba,
12. Traore unter Tiramaga,
13. Bosso unter Sansaro Dabo
14. Bosso unter Bundiuru Diawage,
15. Deteba unter Jere Lengung,
16. Kammara unter Simbara Koliki.
Ferner befehligte der große König "vier Fremde", die Djabifedjonani. Wie Sunjatta zu diesen kam, berichtet die Legendenkunst in Kankan folgendermaßen: Als Sunjatta nach Merna floh, sandten seine Feinde vor ihm her eine Botschaft an den Tungara, die diesen aufforderte, den Flüchtling zu töten. Die ältere Schwester der Tun. gara verliebte sich aber in den Königssohn und lieh ihm ihren Schutz. Sie war es, die ihm die Djabifedjonani gab, die nachher die Grundlage von Sunjattas siegreicher Kriegerschar repräsentierte. Die "vier Fremden" waren:
1. Kokossimobong,
2. Simbenkoko,
3. Faifra San,
4. Kulabankunjama.
Für die Geschichte der "sechzehn Völker" erhielt ich nachfolgende ergänzende Mitteilungen.
Die Deteba waren ihrem Ursprunge nach Mande und nicht Mauren. Sie wohnen zwischen Kankan und dem Bafing und zwar z. B. in Kirima, in Gadugu, in Bandiagadugu. Sie zerfallen heute in drei Stämme, nämlich: 1. Kamasogo, 2. Kiabu und 3. eine Dialligruppe, deren Name aber meinen Berichterstattern entfallen ist. Sie waren von alters her Heiden (im Gegensatz zum Mohammedanismus) und sind es noch heute.
Die Jogo, von denen oben fünf aufgezählt sind, waren ursprünglich zwölf Heiden. Der Stammvater war Nanjerra, dessen Sohn Fakoli.
Sirra Missa, dessen Nachkommen und Stammesmitglieder waren die zwölf Jogo, von denen oben fünf als Tributäre Sunjattas aufgeführt wurden. Von den andern kann ich nichts erfahren. Der Stammesherr Sirra Missa war Zeitgenosse Sunjattas. Die fünf Jogo standen erst auf der Seite Sumangurus, der, wie sie, Heide war. Die Jogo wurden geschlagen und mußten fliehen. Sie zogen sich zurück nach Konian, Bafing, nach Buguni hin und so weiter.
Von drei weiteren wichtigen Stämmen hören wir, daß es vor Sunjattas Siegen im Süden des Reiches Susu Sumangurus drei große Könige gab, nämlich:
1. Siajerra, der Herrscher der Konate,
2. Farinkamma, der Herrscher der Kammara,
3. Tiramaga, der Herrscher der Traore. Die Traore waren den andern beiden überlegen und die Konate wie die Kammara zahlten an Tiramaga Tribut. Tiramagas Sitz war Samaja auf dem rechten Nigerufer südlich der Fiemündung. Die Nachkommen Tiramagas zerfielen in vier Gruppen. Der erste Sohn des großen Traorefürsten blieb in Samaja, der zweite ging nach Kenjeba, das ich zwischen Samaja und Ballandugu zur Seite liegen ließ, der dritte ging nach einem Orte Kenjeba auf der linken Nigerseite und der vierte und letzte endlich führte seine Horden nach Westen in das Gebiet zwischen Sigirri und Kita usw. Diese Traore aus Bransas Stamm sind die Bambugu, Bewohner des Landes Bambuk. Wir hören von vier verschiedenen Zweigen, nämlich:
1. Gadugu
2. Baniagadugu
3. Gangaran Die vier Bransazweige.
4. Bafing
Alle Traore bezeichnen sich als echte Mande. Eigentümlich ist folgender Widerspruch zwischen den Tannas der westlichen und östlichen Traore. Während im Segugebiet die Traore (oder Damele) geschworene Freunde der Diarra sind und beide stets soweit Hand in Hand gehen, daß sie dasselbe Tannä haben (z. B. Tie-udo, eine kleine Feldhuhnart), dürfen die Traore in Bambuk die Diarra nicht sehen, nicht mit ihnen essen, nicht mit ihnen in einem Dorfe schlafen oder sprechen. Das Tannä der Traore im Segugebiet, das sich auf Menschen bezieht, sind die Baru, ein mißachtetes Volk der Kalebassenverfertiger. In Torong hatten die dortigen Traore das gleiche Tannä wie der Stamm der Korrongo, die mit den Baru identisch sind.
Den Bericht, betreffend die erste Pferdeerwerbung, gibt Hansumana in anderer Weise als Korrongo. Nach Hansumana ließ Sunjatta Pferde im Norden bei den Sonninke kaufen. Während des Transportes überfiel der Djolofi-Mansa den Zug und raubte alle Pferde. Darauf ließ er an Sunjatta beschimpfende Worte sagen. Als Sunjatta diese Nachricht überbracht wurde, sagte er: "Nun, so werde ich die Pferde nicht kaufen, sondern erkämpfen." Damit begann er diesen Krieg, und das war der letzte Krieg seiner Regierung.
1. Traore, abstammend von Mfali,
2. Fofana, " " Sidiki,
3. Sisse 1 " " Hammara,
4. Turre .1
5. Saganogo, " " Hansumana Bulabana.
|
Ein Volk, das früher ein Maurenstamm war und einmal Rabio (arabisch) sprach, sind die Berte. Ich erhielt für das Milogebietfolgende Angaben:
1. Sah Maga na Farisi (Sah, Fürst im Dorf Farisi) war der Stammvater der Berte. Er lebte sehr weit im Norden. Er war ein kriegerischer Apostel des Mohammedanismus.
2. Tummono Manjaga Berte war sein Sohn. Er lebte zur Zeit Sunjattas.
3. Faram Berte, Sohn des Vorigen,
4. Nanjerra Berte,
5. Abulai Berte,
6. Simaila Berte,
7. Mamari Berte,
8. Mussa Berte,
9. Sirima Berte,
10. Dianka Muru Berte,
11. Nassu Dianka Berte, " " " lebt heute in Tinti Ulu.
Ehe die Berte nach Tinti Uhu kamen, waren sie in Dalaba ansässig. Saran (Mutter) Suarra Mori (er selbst) hat sie nach dem Süden geführt. Die Berte haben am Milo und zwar von seiner Mündung bis zur Quelle folgende Dörfer inne: Dalaba, Sunkurrung, Bafele, Dierra, Kurra, Damissa, Mamfarra. Tinti Ulu liegt im Inland.
Als wichtigste Marabutstämme werden nachher aufgezählt: Berte, Sisse, Djanne, Kassama, Sanogo.
Turre werden nochmals als Rabio sprechende Mauren (Surraka) bezeichnet.
1. Kalabi. Als dieser starb, war sein Weib schwanger und der zweite Kalabi, des ersten Kalabi Sohn wurde nach seinem Tode geboren. In jedem derartigen Fall nimmt die Volksanschauung an, daß der nachgeborene Sohn nichts anderes ist, als der wiedergeborene Geist des verstorbenen Vaters. So wurde denn dieser Sohn Kalabis ebenfalls genannt: Kalabi.
2. Kalabi. Um aber die beiden Kalabi zu unterscheiden, bezeichnet man sie als Kalabibumba (Vater) und Kalabidogoma. —Nach nicht ganz verständlichen Angaben des Dialli Hansumana Kuate muß jedenfalls angenommen werden, daß von diesen beiden Kalabi die Bezeichnung Kulloballi abstammt, oder daß sie die ersten Kulloballi waren.
3. Tubi la Wal war der Nachfolger und Sohn Kalabidogomas. Tubi heißt "Zivilisiert". Vielleicht soll es bedeuten, daß er der erste Mohammedaner war. Wal war sein Name. Jedenfalls unternahm er eine Reise nach Medina und das war, ehe Mohammed geboren war. Jedoch wußte Tubi la Wal infolge dieser Reise voraus, daß Mohammed geboren werden würde und erklärte deshalb, daß der erste Sproß, der nach seiner Rückkehr geboren werden würde, den Namen Mamadu erhalten solle. Die Verworrenheit dieser Angaben, wurde von Dialli noch dadurch bunter gemacht, daß er sagt: "Mekka war damals noch kein heiliger Ort." —Als er zurückkam, wurde Kanu als sein Sohn geboren und somit Mamadu genannt.
4. Mamadu Kanu, der ein großer Herrscher gewesen ist und anscheinend der wirkliche mohammedanische Fürst nach Volksanschauung ist.
5. Mansa Mballa Blindana. Bei diesem Herrscher fällt auf, daß die Dialli immer das Wort Mansa zufügen, welches den andern ja natürlich auch zugehört, aber nicht so fest mit dem Namen verbunden tragen. Von Mansa Mballa Blindana wird außerdem einmal erzählt, daß er der zweite mohammedanische König gewesen sei*.
6. Kanu Simbong. 7. Kanu Njoro Simbong. 8. Simbong Mba Marenta. Sollen alle drei Brüder und Söhne Mansa Mballa Blindanas gewesen sein. Sehr interessant ist es, daß auf den König Simbong Mba Marentas das Mali-Tanna zurückgeführt wird, indem erzählt
9. Mbello, Sohn und Nachfolger des Vorigen.
10. Mbello Bakong, Sohn und Nachfolger des Vorigen.
11. Kunfata Komaga Kenji, Sohn und Nachfolger des Vorigen. Wird schlechtweg auch Fara Maga Kenji genannt. Sein Sohn und Nachfolger war der berühmte:
12. Sunjatta. Für die Herrschaft dieses mythischen Helden des Malireiches konnte ich in Kankan verschiedene Ergänzungen erhalten. Zunächst erscheint es mir wichtig, daß ein Widerspruch besteht. Einige behaupteten, daß alle diese Fürsten schon in Njani Mba geherrscht hätten. Aber die Mehrzahl, und sie wird Recht haben, bestritt das. Sie sagte, bis dahin hätten alle Fürsten nur in "Mande" geherrscht. Betrachten wir die geographische Lage der einzelnen Orte und Landschaften:
Am weitesten im Süden lag das Land Sankara, das heute noch in der Landschaft Sankarang erhalten ist. Die Hauptstadt war Do. Nördlich davon lag Nkirri, Land und Stadt. Die Stadt ist heute noch erhalten in dem Orte Kirrikorroni, der in der Nähe Kangabas liegt (also nördlich Bamakos). Diese beiden Provinzen bilden den Schauplatz der Koba-Geschichte. Die beiden Traorejäger kamen aus Nkitri nach Do. Do ward dann Sankarang und Nkirri Mande. Im Norden davon nahe dem Niger lag Njani Mba, wenig westlich davon Soso und Susu, das Land der Kante, also Susu Sumangurus. Während alle diese Länder westlich des Niger lagen, befand sich Dabo und Merna auf dem rechten Nigerland. Aus Merna, das jenseits von Segu lag, kamen die Tungara, die heute eifrige Mohammedaner und weit über das Land versprengt sind. Genauere Angaben über die Lage Dabos und Memas habe ich auch hier nicht erhalten können.
Natürlich herrscht in allen Angaben über die Reihenfolge der einzelnen Herrscher Konfusion, die Angaben über die geographische Lage der Länder sind aber immer als ziemlich richtig zu bezeichnen, Ferner scheint mir aus den einzelnen Mitteilungen als Volksanschauung hervorzugehen:
A. daß alle diese "Mande"herrscher bis auf Sunjatta nur in Nkirri (als Mande) herrschten,
B. daß Simbong Mba Marenta den "Mali-Verband" schuf,
C. daß Sunjatta der erste war, der in Njani Mba König, daß er überhaupt ein großer Usurpator war,
D. stelle ich als sehr interessante Tatsache fest, daß alle Kulloballi früher und zum Teil auch heute noch nicht das Mali essen, also sicher zum alten "Malibunde"gehörten.
13. Djurli-nkung war der älteste Sohn und Nachfolger Sunjattas. Er hatte seinen Namen nach der ersten Frau Sunjattas, die Djurli hieß.
14. Nkung-Mamadi, Sohn und Nachfolger des Vorigen.
15. Bate-Mande-Mori, Sohn und Nachfolger des Vorigen.
16. Suru-Mansa-Mamudu, Sohn und Nachfolger des Vorigen. Damit ist die Reihe der Herrscher, die das ganze Malireich beherrschten beendet. Es löst sich unter den sechs Söhnen dieses sechzehnten Fürsten auf, und zwar erhielten wir folgende Angaben:
A. Futa Ngamu Nkansigama war der erste Sohn Suru Mansa Mamudus. Er zog nach Futa (Dialon oder Toro?) und wurde anscheinend ein einflußreicher mohammedanischer Lehrer. Von seinem Stamme ist hier nichts weiter zu hören.
B. Ka Mori Mbakorro. Er war der erste König in Kangaba (südlich Bamako), ihm folgte sein Sohn 'Mansa Tora Mori, dem folgte dessen Sohn Terenagimba, dem folgte dessen Bruder Terena Mambi, dem folgte Terenagimbas Sohn Mansina Kamori, der außerordentlich viele Kriege führte, dem folgte dessen Sohn Minamba, dem folgte dessen Sohn Nakani Mambi, der im Kriege mit Samori nach Westen gedrängt wurde und in Kayes zuletzt lebte und auch starb.
C. Niamaga, dessen Stamm (Kulloballi) heute noch das alte Gebiet Sendugu (Faraba, Balandugu, Diallakorro, Keniera usw.) auf dem rechten Ufer des Niger inne hat.
D. Mansa Kurru nahm den Westen in Besitz. Seine Nachkommen sitzen heute noch im Gebiet von Kita am oberen Senegal.
E. Mansa Nganda nahm ein Gebiet bei Kankaba ein. Seine Nachkommen wohnen heute noch in Narena.
F. Fina Dukuma. Seine Söhne sind Suru Mansa Mamudu, Kenjeraba, Oronina, dessen Nachkommen alle heute noch auf dem linken Nigerufer wohnen.
1. Dubila Wali oder Bilali war der erste Mohammedaner,
2. Kubara, Sohn des Vorigen,
3. Mamari Kani, " " "
4. Farakomarimfakeni, " "
5. Marang Sunjatta, " " " oder Mangsa (Mansa) Sunjatta,
6. Njani Mansa Mainuru, Sohn des Vorigen,
7. Djuranangung,
8. Kuma man,
9. Bata Mande Mori,
10. Nyamarang, " ',
11. Mansa Kurru, "
12. Fakandah, "
13. Tenengkung, "
14. Seriborih,
15. Njumatenebori, " " ,'
16. Kasa Mesa, " " " kämpft gegen die von Sendugu nach Süden ziehenden Fulbe,
17. Kambo,
18. Dongfodie 1,
19. Senebamang,
20. Dongfodie II,
21. Sakoba,
22. Flamoro,
23. Kamori.
Danach kamen die Sarakole ins Land, die sich des Reiches Mali bemächtigten und von folgenden Fürsten regiert wurden: Djemori Kumang, Wassaba Kenne, Sirala Mini, Domu, Djo Mori, Nang Kumang, heute im Dorfe Kunjang Chef.
Susu Sumanguru wohnte östlich von "Niani Mba"in einer großen Stadt namens Susu, die aber nicht so bedeutend war wie Niani Mba, das 1441 Gehöfte zählte, deren jedes mit einer kleinen Tata umgeben war und die alle um das Gehöft des Königs gruppiert waren. Sumanguru war Kante. Heute trifft man noch Kante z. B. in Ballandugu am rechten Nigerufer südlich der Fiemündung. Die Leute Sumangurua redeten sich mit Bammana an. Sumanguru war Heide. Als seine Horden durch Sunjatta geschlagen waren, flohen sie sehr weit nach Süden. Sumangurus Niani Mba wurde nur eingenommen und nicht zerstört. Neben diesen beiden Städten gab es noch eine große Stadt, die hieß
Surru. Sie wurde bewohnt von den Kueta oder Gueta, die sich als Gruß mit "Mangallu" anredeten. Der Nachkomme (Sohn?) Sun-. jattas mit Namen "Niani Mansa Mamuru" zog von Niani mba aus und führte gegen Sirra Mamba Kueta, den Stammesherrn der Gueta, und gegen Surru einen glücklichen Krieg. Anscheinend wurde Surru zerstört, doch wußte das mein Dialli nicht genau.Hier hörte ich von einer neuen Episode der Sunjattalegende, die sich in der Zeit zwischen der Rückkehr aus Merna und dem Zusammenstoßen mit Susu Sumanguru abgespielt haben soll. Sunjatta hatte in seinem Dienste nur die "vier Fremden", die er durch die Tungaraschwester erhalten hatte. Unterwegs begegnete er unter einem Diallakorro (einem alten Diallabaume) nahe dem Dorfe Tabu oder Tabung (wo diese Ortschaft lag, konnte ich nicht erfahren) zwölf Jägern. Er stieß mit ihnen in einem harten Gefecht scharf zusammen und überwand sie. Darauf leisteten sie ihm Heeresfolge im Kriege gegen Sumanguru und zeichneten sich durch große Tapferkeit aus. Die zwölf Jäger waren:
1. Sia Jatta Kumba (Stamm Konate)
2. Tamfara Sujogo,
3. Segimfara Sujogo,
4. Konontofara Sujogo, (alle sechs Konne oder Diarra)
5. Somfara Mussa,
6. Kumantige Djarra Djang,
7. Koro Mansa Turrukule,
8. Bammana Mansa Dangu, (Stamm Dumbia oder Korromaga)
9. Bammana Mansa Kosila,
10. Buturi Dyanguaki Ode, Sansaralo Dabu (aus Sumanas (alle vier Kammara) Geschlecht),
11. Kamadjang Gummare,
12. Tamogo Djonikia, Als Morikantalulu, d. h. als die fünf mohammedanischen Stämme im Gefolge Sunjattas gab der Dialli mir folgende Reihe:
1. Turre,
2. Kaba oder Diagite,
3. Sisse,
4. Sila,
5. Serefu.
Sehr interessant ist hierbei, daß die Kaba als Diagite aufgeführt wurden. Der Berichterstatter blieb fest bei der Betonung der Identität und fügte hinzu: "Die Malinke nennen die Kaba Diagite, die Fulbe Diagate."
Als Stammherrn der Garanani oder Ngaranani, der vier gelehrten Stämme, wurden hier angegeben:
1. Abudu Mundulubi Sarifu, der arabische Weisheit besaß (wahrscheinlich ist Sarifu = Scherif).
2. Abudu Lahi (=Abdulahi), der Sohn des Vorigen.
3. Surrakata (=Surrukuta), der Sohn des Vorigen, Stammvater der Kuate.
Die Kuate sind die eigentlichen Träger der alten Weisheit, die eigentlichen Dialli. Es gibt Dialli aus allerhand anderer Stammeswurzel, aber ihr Wissen ist minderwertig, und sie sind (das ist richtig) in der Ausübung ihres Berufes von allen Leuten nicht als so hoch qualifiziert erachtet wie die Kuate. In alter Zeit konnten die Dialli schreiben und hatten Bücher (!). Im Laufe der vielen Kriege gingen diese aber verloren und heute gibt es in den südlichen Mandingoländern sicher nicht einen einzigen Dialli, der zu schreiben oder zu lesen verstünde. — Im übrigen soll es Dialli aus folgenden Stämmen geben:
1. Kuate,
2. Kurrujogo,
3. Djebagate (aus Traorestamm),
4. Njingung,
5. Konte,
6. Kuruma,
7. Duguno,
8. Dante,
9. Kante,
10. Kammara.
Über verschiedene Stämme und Stammesgruppierungen war hier noch folgendes aufzuzeichnen. Die Traore nennen sich auch Dambele und stehen den Konne oder Diarra sehr nahe. Die Traore waren ursprünglich Mohammedaner. Als Malinke wurden sie wieder Heiden. Sie waren früher sehr mächtig, aber stets von den Keita oder Koita beherrscht, die immer die Herren des Mandelandes waren. Im Gegensatz zu den Traore waren die Keita früher nicht Mohammedaner, auch nicht Surraka(Mauren), welchen Ursprunges sich manche Traore rühmen. Als Ahnenreihe der Traore erhalte ich:
Kanjumarang (erster Traore)
Damasauulennj Damasaulamba 4,
Tira-maga, Diabagate, Fürst der Traore zu Sun- Stammherr der Diallijattas Zeit. gruppe, die noch heute diesen Namen führt.
Die beiden Söhne Kanjumarangs waren jene beiden Traorejäger, die die Mutter Sunjattas nach Mande brachten.
Von den Keita hörte ich noch, daß sie sich früher in ein Nilpferd (Mali) zu verwandeln wußten. Demnach sind sie wohl auf das engste mit der Entstehung des Malireiches verbunden. Sehr interessant ist es, daß, wie in Konian und Torong Sonninke gleich bedeutend mit Heide ist, im Sigirrigebiet Malinka der Gegensatz zu Moriba ist und auch Heide bedeutet.
Verschiedene Stammesnamen. Wenn sich in den Mandingoländern zwei Leute begegnen, so stellen sie sich sogleich unter Nennung ihres Stammesnamens vor. Das Merkwürdige bei dieser Namensnennung ist, daß der selbst genannte Stammesname nicht immer mit der Stammesbezeichnung übereinstimmt, die die andern anwenden. So stellen sich z. B. vor: die Konate als Siadjerra, die Konne als Dierra oder Diarra, die Kulloballi als Keita, die Dumbia oder Sussoko als Kuruma oder Koromaga, Traore als Dambele, Mbueta oder Gueta (Surru) als Mangallu, Kante als Bammana.
Dagegen sagen die Kammara auch Kammara, die Kuate auch Kuate.
1. Debi Kante. Er hatte seinen Namen nach dem kleinen Vogel Debi, der statt zwei vier Flügel haben soll. Er ist ein halb mystischer Vogel, der in gewissem Sinne gefürchtet wird. Wenn heute die Milch einer Kuh schlecht ist und mehrere Tage lang schlecht schmeckt, so sagt man: "Die Kuh ist sicher über den Debivogel gegangen." Der schlechte Geschmack kann von acht Tagen bis zu einem Monat währen.
2. Mansa Kante, der Sohn des Vorigen, anscheinend der erste große König des Susureiches.
3. Oninge Kante, Sohn und Nachfolger des Vorigen.
4. Kunjang Kante, Sohn und Nachfolger des Vorigen.
5. Susu Sumanguru, der Sohn Kunjangs, der das Reich zur höchsten Blüte brachte und dann von Sunjatta gestürzt wurde. Die Susu wurden dann nach Süden verdrängt, und wohnen zum größten Teil im Lande südlich Futa Djallons. Nicht unwichtig ist es aber, daß man auch heute noch Kante im Maligebiet antrifft, die aus dem alten Susureiche stammen.
18. Kapitel: Legenden der Bammana
Mit die interessantesten Probleme der Legenden-Forschung sind die der Neubildung. Beobachtungen nach dieser Richtung sind im Süden häufig. Es scheint wünschenswert, die Volksüberlieferungen einer ganz jungen Volks- und Staatenbildung, nämlich der Bammana, im Zusammenhang mit den Resten absterbender alter Traditionen und zum Vergleich mit diesen hier wiederzugeben.
Die Geschichte Bitons, Königs von Segu
Biton war aus dem Stamme der Kulloballi hervorgegangen. Sein eigentlicher Name soll Sunu Mamari gewesen sein. Seine Mutter, Sunu Sako, stammte aus Kamba. Biton wanderte nach Djundia. Erst schlug er sich als Jäger durchs Leben.
Segu bestand damals aus den vier Dörfern Segu, Segu-bugu, Segu-kurra und Segu-sikollo, welches seinen Namen nach einem mächtigen Butterbaume (Se-korro) erhalten hatte. Biton beschloß, sich in Segu niederzulassen. Er begann diese Unternehmung auf folgende Weise: Auf der Jagd fand er eines Tages sehr schönen Honig. Er bereitete daraus ein ausgezeichnetes Honigbier (Li-dollo). Er machte sich dann mit seiner Mutter und dem Li-dollo auf den Weg nach Segu, wo er schon verschiedentlich Fleisch von seiner Jagdbeute verkauft hatte. Er bat nun die Leute von Segukorro, die vordem von seinem Wildbret gekauft hatten, heute mit ihm den Li-dollo zu trinken. Die Leute taten es gerne und fanden sich bei diesem Trinkgelage ganz außerordentlich wohl. Das erste Trinkfest, welches Biton in Segu zum besten gab, fand an einem Donnerstage statt.
Die Segu-korro-Leute fanden das Fest ganz ausgezeichnet gelungen, und als am folgenden (zweiten) Donnerstage Biton wieder mit einer großen Menge Honigbier erschien, da hatte sich die Zahl seiner Gäste ungemein vermehrt und diese verabredeten untereinander, daß, wenn am nächsten (dritten) Donnerstag Biton wieder ein solches Gelage veranstalten würde, ihm zur Revanche jeder Gast ein Geschenk von zwanzig Kaurimuscheln darbringen sollte. Und SO geschah es. An diesem dritten Donnerstage tötete Biton aber für seine Gäste eine Ziege.
Die Folge dieser aufmerksamen Handlungsweise war, daß die bewirteten Bewohner Segu-korros verabredeten, am nächsten Donnerstage dem Biton ein weit größeres Geschenk zu machen, indem
jeder diesmal hundert (kemme kemme, in Wahrheit achtzig, gilt aber als hundert) Kaurimuscheln beisteuern sollte. Nun gab es bei Segu ein Dorf namens Sando. Die Einwohner Sandos sagten unter sich: "Heute hundert Muscheln, das kann ja mit der Zeit eine schöne Abgabe werden. Nein, wir gehen da nicht hin. Wir bleiben diesem Gelage fern und brauchen somit auch keine Kauri zu senden. Wir glauben überhaupt, daß das mit diesem Biton eine ernste Sache werden wird, mit der wir nichts zu tun haben wollen."Am kommenden (vierten) Donnerstage tötete Biton für seine Freunde in Segu einen Ochsen, um sich für das letzte Kopfgeschenk von zwanzig Kauri zu revanchieren. Außerdem brachte er heute noch größere Mengen von Li-dollo mit, und da dieses sehr gut und sehr stark und die Vergnüglichkeit sehr groß war, so wurde zum Schlusse die Bewohnerschaft Segu-korros in eine arge Betrunkenheit versetzt. Im Zustande dieser Bezechtheit fiel es einigen Leuten auf zu fragen: "Wer ist heute nicht gekommen? Wer hat unserem Biton heute keine Kauri (= kullung) gebracht?" Andere sagten: "Hallo, die Leute von Sando haben heute Biton ja kein Dankesgeschenk gebracht." Wieder andere riefen: "Das ist zu undankbar —das können wir nicht dulden —wir wollen sie mit Krieg überziehen." Andere sagten: "Ja, das wollen wir."
Darauf rüsteten sich die Leute von Segu und fielen über die Ortschaft Sando her. Die Bewohner des Weilers wurden von den Erzürnten sehr schnell überwunden und insgesamt nach Segu in Gefangenschaft geführt. Daheim wieder angekommen, sagten die Kriegerischen: "Wir wollen die Hälfte der Beute Biton abgeben, der das schöne Gelage am Donnerstag veranstaltete und dazu einen Ochsen schlachtete." Somit brachten sie die Hälfte der gefangenen Weiber und die Hälfte der gefangenen Burschen dem Biton. Biton verkaufte allsogleich alle Weiber und schaffte dafür Stoff an, aus dem er Überhänge und Hosen für die eben erhaltenen männlichen Sklaven machen ließ. Die machten auf diese Weise einen gar stattlichen Eindruck.
Inzwischen kamen die Bewohner des Dorfes Surroba, die bis dahin auch an dem Umtrunke, der Donnerstags stattfand, teilgenommen hatten, zusammen und sagten: "Die Abgaben für die Gastmahle und Gelage des Biton werden uns nachgerade zu hoch. Außerdem scheint uns diese Sache in einer andern Weise enden zu wollen, als man bisher annehmen konnte. Es nimmt für uns Landbewohner kein gutes Ende. Wir wollen nicht mehr hingehen. Wir wollen nächsten Donnerstag fernbleiben." Und bei diesem Vorsatze blieben sie.
Dieser nächste Donnerstagabend gestaltete sich zu einem großen Feste, denn die Bewohner von Segu hatten die Ortschaft Sando bewältigt und damit eine hübsche Einnahme erzielt, die man dem Umtrunke bei Biton verdankte. Also entsprach der freudigen Stimmung auch bald eine gründliche Bezechtheit. Und als die Bürger soweit waren, fragten einige: "Wer fehlt denn heute beim Umtrunke ?"Andere fragten: "Hat jemand auch nur einen Bürger aus Surroba gesehen?" Und dann fragten die Bürger insgesamt Biton: "Willst du, daß wir gegen die Bürger von Surroba mit Waffen und bewaffneten Sklaven zu Felde ziehen? Sieh, sie haben dich beleidigt, indem sie insgesamt fortgeblieben sind." Biton sagte: "Dieses ist nicht meine Sache, denn ich will mich nicht derart rächen, aber wenn ihr glaubt, daß die Eingeborenen euch damit gekränkt haben, und daß das euer Vorteil ist, dann will ich euch mit meinen Sklaven und meinen Waffen gern begleiten."
Daraufhin eilten alle von dannen, ergriffen die Waffen und machten sich ungesäumt auf den Weg, die Bewohner Surrobas mit Krieg zu überziehen. Diese Unternehmung war abermals vom Glücke begünstigt, und alle Surrobaner kamen in Gefangenschaft. Mit reicher Beute kamen sie heim und sagten: "Wir verdanken diese Vermehrung unseres Besitztums Biton und seinen fröhlichen Gelagen. Deshalb wollen wir ihm die Hälfte unseres Besitzes abgeben." Somit brachten sie Biton wieder die Hälfte der gewonnenen Sklaven und Sklavinnen als Geschenk dar. Biton aber verkaufte wieder die Sklavinnen, handelte dafür Kleider, Bogen (Kalla) und Pfeile (Binje) ein und stattete seine Leute herrlich aus. Viele Leute kamen nun, ihm kleine Geschenke darzubringen und Biton ihren Respekt zu erweisen. Er gab allen Kleidung und Waffen, so daß sie seine guten Anhänger wurden. Dann errichtete er eine hohe Kugu (Mauer).
Faro sagte: "Wenn meine Mutter dir ein Amulett anbietet, damit du viele Sklaven gewinnst, so nimm das nicht an. Wenn meine Mutter dir ein Medikament anbietet, damit du viele Kühe gewinnst, so nimm das nicht an. Fordere aber von meiner Mutter eine Firma (Lampe) und Fini (Fognons). Dieses beides wird dir zu großer Macht und zu großem Ansehen verhelfen." Beide machten sich dann auf und kamen zur Mutter Faros.
Die Mutter Faros sagte: "Ich will dir ein Amulett geben, damit du viel Gold gewinnst." Biton sagte: "Das habe ich nicht nötig." Die Mutter Faros sagte: "Ich will dir ein Amulett geben, damit du viele Sklaven gewinnen kannst." Biton sagte: "Das habe ich nicht nötig." — Die Mutter Faros sagte: "Ich will Dir ein Amulett geben, damit Du viele Kühe gewinnen kannst." Biton sagte: "Das habe ich nicht nötig."
Die Mutter Faros sagte: "Ja, was willst du denn gern haben?" Biton sagte: "Gib mir eine Firma und Fini." Die Mutter Faros sagte: "Wer hat dir diesen Rat gegeben?" Biton sagte: "Diesen Wunsch habe ich aus mir selbst." Darauf gab ihm die Mutter die Lampe und den Fini und sagte: "Für den Fini bereite ein Feld am Niger. Wenn er aufgegangen ist und reif ist, iß ihn nicht, sondern überlaß ihn den Vögeln und Affen." Bita sagte: "Es ist gut." Er nahm beides und ging damit nach Hause. —
Er kam heim und sagte zu seiner Mutter: "Der Dieb deines Nkojo war der kleine Faro. Ich erwischte ihn und ging mit ihm zu seiner Mutter. Faro hatte mir gesagt, ich sollte nicht die Amulette seiner Mutter für Vermehrung des Goldes und der Sklaven und der Kühe annehmen, sondern sollte mir eine Firma und Fini ausbitten. Das tat ich. Die Mutter Faros sagte mir, ich solle für den Fini ein Feld am Ufer des Niger herrichten und sollte nachher den Fini nicht essen, sondern das Korn für Affen und Vögel stehenlassen." — Sunu Sako sagte: "Die Mutter Faros hat dir einen guten Rat gegeben. Denn der Vogel fliegt weit, und die Samenkörner, die er in einem
Lande aufnahm, trägt er weit fort bis in sein Heimatland. Die Affen aber ziehen weit herum, und wo der Mist dieser Affen zu Boden fällt und soweit die Vögel die Samenkörner deines Ruhmes tragen, wird dein Ruhm und die Kenntnis deiner Macht getragen werden."Biton verfuhr nach diesem Ratschiage. Seine Macht und sein Ansehen breiteten sich bald mächtig im Lande aus. Die Lampe brennt noch heute daselbst und heute noch kann man in Sekorro die ganze Nacht hindurch das Licht von Faros Lampe sehen.
Hierzu bemerken die anwesenden Malinke unter allgemeiner Bestätigung, daß bei allen Malinke bis in die jüngste Zeit hinein nur Holzfackeln als Leuchte gedient hatten, daß man aber da, wo man eine Lampe sah, sagt: "Die kommt aus Segu." Ebenso soll sich auch das Korn "Fini" von Segu aus in das obere Mandeland ausgedehnt haben.
Inzwischen ließ Biton in seinem Hofe in einem Winkel ein großes und vor allem sehr tiefes Loch graben. Er sagte zu seinen Leuten: "Paßt genau auf: Wenn einer der Alten von mir fortgesandt wird, damit er in einem Winkel seinen Rausch ausschiafe, dann stoßt ihn nur einfach in diese Grube. Schlagt ihm aber vorher den Kopf ab, damit er nicht allzusehr schreit."
Am besagten Montagabend kamen alle Alten aus den Dörfern Konno Dimini, Gara, Diado und Dugukuna. Biton hatte ein sehr wohlschmeckendes, aber schweres Honigbier bereiten lassen. Dazu gab es gute Gerichte zu essen, derart, daß alsbald eine große Heiterkeit entstand und die Betrunkenheit anhob. Als der erste Alte SO weit betrunken war, daß er nicht mehr recht stehen und sitzen konnte, sagte Biton: "Geh, mein Alter, schlafe jetzt in jenem Winkel deinen Rausch aus." Der Alte ließ sich gerne dahin führen, wo das Loch war, und dort schlugen die Sklaven ihm den Kopf ab und warfen ihn dann in die Grube. So ging es mit einem der Alten nach
dem andern, bis zuletzt alle alten Gäste in dem tiefen Loche versammelt waren.Am andern Tage rief Biton alle Seguleute zusammen und fragte sie: "Wer ist jetzt König von Segu?" Darauf riefen alle: "Du bist König von Segu." Biton sagte: "Wenn ihr wollt, daß ich euer König sei, so will ich das sein."
So ward Biton König.
Der Bruder Bitons, Massa Kulloballi, lebte in Sundiana (die Malinke sprechen es bezeichnenderweise Sunsana aus) bei Segu. Als er vernahm, wie sein Bruder zu Macht und Ansehen kam, überfiel ihn ein Schrecken und er floh, um einem bösen etwaigen Schicksal zu entgehen, nach Kaarta in das Dorf Girinkume, in dem er sich ansiedelte. Sein Sohn Manso Sita oder Mansa Sata floh mit ihm.
Biton war nun uneingeschränkter Herrscher und von vielen Seiten ward ihm freiwilliger oder unfreiwilliger Tribut überbracht.
Eines Tages trugen die Leute Njolas ihre Abgabe zu dem Könige Biton. Sie bestand in Hirse. Aber in jener Zeit war die Hirseernte nicht geraten. Der König Biton war deswegen sehr ungnädig, und da man seinen Zorn sehr fürchtete, so sagten sie: "Der Knabe Ngolo Diarra ist bei uns. Wenn es dir recht ist, wollen wir ihn als Geisel bei dir lassen. Du magst ihn behalten, bis wir unsere Abgaben voll aufgebracht haben werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt." König Biton sagte: "So laßt den Knaben hier." —So kam Ngolo an den Hof des Königs Biton.
In Segu gab es damals vier große Baschi (Zaubermittel), die waren über alle Maßen stark. Diese vier waren:
1. Mba Kungoba (angeblich der große Wald),
2. Nangoloko (nichts über den Sinn des Namens zu erfahren),
3. Sammanere (nere =Frucht; samma = hoch ?),
4. Binjadjugu (= Horn großer Ochsen). Wenn man das Fest dieser vier Baschi feiern wollte, so bedurfte es eines gefangenen Häuptlings und eines Ochsen. Beide wurden in gleicher Weise geschlachtet und aus dem Fleisch beider wurde ein ausgezeichnetes Essen bereitet. Es war eine Suppe, in der die einzelnen Fleischstückchen durcheinanderlagen. Diese Fleischstückchen waren schon geschnitten, so daß man nicht nötig hatte, noch ein Messer zu verwerten oder mit den Zähnen abzubeißen. Zu dem heiligen Zeremonial dieses Mahles setzte sich die Anhängerschaft der vier mächtigen Baschi in einem kleinen Kreise eng gedrängt nieder, und zwar mit dem Rücken nach innen, mit dem Antlitz nach außen.
Alsdann griff ein jeder viermal in die Schüssel mit der Speise hinter sich. Er nahm einen Fleischbrocken aus der Tunke und führte ihn, ohne ihn anzusehen, zum Munde. Dazu sagte er: "Mbakungoba sugu, sugu bombali" (Mbakungoba = das erste Baschi, sugu = Fleisch, bombali nicht kennen, d. h. Fleisch des Mbakungoba, das Fleisch kenne ich nicht). Er nahm wieder einen Fleischbrocken aus der Tunke und führte ihn, ohne ihn anzusehen, zum Munde. Dazu, sagte er: "Nangoloko sugu, sugu bombali." Er nahm einen dritten Fleischbrocken aus der Tunke und führte ihn, ohne ihn anzusehen, zum Munde. Dazu sagte er: "Sammanere sugu, sugu bornbali." Er nahm einen vierten Fleischbrocken aus der Tunke und führte ihn, ohne ihn anzusehen, zum Munde. Dazu sagte er: "Binjadjugu sugu, sugu bombali." —Diejenigen, die diese Mahlzeit gemeinsam genossen hatten, gehörten zusammen und waren unterund miteinander zu Brüderschaft verbunden.
Das Blut der Opfer dieser vier Baschi galt als ganz besonders wertvoll und geeignet, die Zaubermittel damit zu besprengen. Besonders Biton wußte die Macht dieser Baschi zu schätzen, und in jeder Mitternacht wusch er sich mit Wasser, das durch die vier Baschi eine besondere Kraft erhalten hatte. Das tat er auf dem Dache des Hauses, und er verfuhr dabei so, daß er das Wasser von vorn gegen sich und von oben über seinen Rücken hinter sich schüttete.
Der Knabe Ngolo, der sehr klug war, erkannte bald, welche Kraft ihm diese Baschiwäsche verleihen mußte, wenn es gelang, sie ZU gewinnen. So hockte er denn eines Nachts, als Biton sich wusch, hinter dem Könige nieder und ließ sich von dem nach hinten geschleuderten Baschiwasser bespritzen. In der nächsten Nacht machte
er es ganz ebenso. Aber Biton sah einmal am Ende des Bades hinter sich, und da gewahrte er, daß der Knabe Ngolo sich von ihm mitbesprengen ließ. Deshalb brachte er in der dritten Nacht eine Lanze mit, und als er gegen Ende der Zeremonie hinter sich sah und wieder Ngolo erblickte, schleuderte er seine Waffe nach ihm. Ngolo ward durch die Lanze berührt, aber sie vermochte nicht, ihn zu verwunden, so stark hatten die Bäder mit dem Baschiwasser schon auf ihn gewirkt.Aber Ngolo mußte fliehen. Ein Moriba (Marabut) nahm sich seiner an und führte ihn mit sich nach Kong. In Kong erlernte Ngolo das Kaufmannsgewerbe und kam nach einigen Jahren als ein angesehener und wohlhabender Kaufmann nach Segu zurück. Er schenkte Biton, dem Könige von Segu, die Hälfte aller seiner Waren, und Biton schloß Freundschaft mit ihm. Diese Freundschaft hielt an, bis Biton Kulloballi starb. Nachher ward Ngolo Diarra König von Segu.
Nachtrag: Verschiedene Angaben des Dialli Fabu Kuate
Erster Herrscher von Segu: Der Name "Biton" ist eine arge Verstümmelung der Bezeichnung Ton-tigi, die man diesem Biton beilegte. Ton-tigi ist ein Chef, der Verbote erteilt. Man spricht nicht nur im Staatsieben, sondern auch im sozialen Bundleben von Tontigis. Der Stammbaum Bitons:
Fasine Kulloballi, erster (?) Ahnherr im Segugebiete. Dorf unbekannt.
Nongondu, dessen Sohn. Dieser hatte drei Söhne: 1. Biton, 2. Kenjerra Massa, 3. Kaarta Massa.
Biton erklärte, als er zur Macht gekommen war, mit seinem zweiten Bruder von Kenjerra, dessen Nachkommen jetzt noch in Tentu leben sollen, dem dritten den Krieg. Der dritte Bruder wurde geschlagen und nach Kaarta (Grinkume) gejagt, wo sein Stamm eine neue Linie gründete, die heute noch in Kaarta lebt.
Biton, erster König von Segu, Dekorro Kulloballi zweiter König von Segu, Bruder des Vorigen, Bakari Kulloballi, dritter König von Segu, Bruder des Vorigen, Monsong Da, regierte 28 Jahre, Kiefollo regierte 14 Jahre, Njana Mba regierte nur 9 Monate, Be aus dem Dorfe Kiranko regierte 8 Jahre, Narinkuma regierte 4 Jahre, Massala Demba regierte 5 Jahre, Nangombelle regierte 8 Jahre, Bin Ali regierte 8 Jahre 6 Monate. Dann kamen die Fule aus Futa Toro unter Ladi-Umaru (Hadj Omar), dem folgte sein Sohn Amadu.
Vor Fasine soll in Segu Siramaga-Kueta-Mangallu Herrscher gewesen sein, dessen Nachkommen heute noch in Kayes und bei Njoro leben.
19. Kapitel: Waldvölker*
Waldhultur. — Für den echten, alten Sohn des Manding, für den alten Mande, gibt es weder nach Osten noch Norden noch Westen eine Grenze im historischen Ausschauen, im Handeitreiben oder im geographischen Sinne. Desto schärfer, klarer ausgesprochen oder bewußter ist die Ausschaltung der Südländer aus dem Interessengebiete der Mandingo. Für mein westliches Reisegebiet liegt die Grenze etwas nördlich der Wasserscheide des Nigertributäre und der Westflüsse, etwa 9° 30 nördlicher Breite. Was südlich liegt, heißt der Tukorro oder Tukotto, der große Wald. Das ist das Land der Barbaren, der Menschenfresser, der Madumu, wie die Bammana sagen, der Mogodumu nach Malinkebezeichnung, das ist auch das Land der Zwerge. Der Tukorro mit seinen mächtigen Wäldern und Bergen und mit seinem Überfluß an Abflüssen ist gewissermaßen ein Märchenland, und ist es noch nicht gar so lange her, daß sich kein Mande da hineintraute. Es sei denn, daß ein im Kriege unterlegenes Volk gedrängt und zum äußersten getrieben nach jener Richtung entfloh. Das war zwar nicht selten, aber eine Beziehung ward damit nicht angeknüpft. Die Verdrängten gingen im Waldnegertume auf, rechteten und kämpften mit ihnen um Hegemonie, sie schüttelten aber jedesmal den Staub der Heimat von sich. Sie waren nun Tukorromenschen geworden und blieben es. Früher lag übrigens die Grenze der Tukorro weiter nördlich und die Alten erzählen, daß Konian in alter Zeit ein Waldland gewesen sei, eine Provinz, die heute kaum noch genug alte und breite Baumstämme bietet, um ordentliche Türen daraus zu schnitzen.
Zum Tukorro, zum Waldlande, rechnet das Mandingovolk in diesen Längen heute noch von Westen nach Osten die Gebiete der Kissi, Tomma, Gersse, Mabu und was südlich von diesen wohnt. Von diesen Stämmen gelten die Mabu im Sassandragebiete als wüsteste und unzivilisierteste Kannibalen, die Gersse als Sklaven der Tomma, die Tomma als kriegerische und gewaltigste und die Kissi als Tributäre der Kulloballi, d. h. als Mandingountertanen. Mit Recht werden die
Ich lernte besonders Gersse und Tomma näher kennen, und auf diese erstreckt sich die nachfolgende Beschreibung.
Zu einem mehr geschichtlichen Werke über die Vergangenheit und den Ursprung aller dieser Stämme läßt sich mancherlei berichten, soweit die Leute selbst davon noch wissen. Das, was danach zutage tritt, entspricht genau den Verhältnissen, auf die uns die geographische Gesamtlage schließen läßt. Mischung, Mischung, abermals Mischung. Was sich auf dem mächtigen Mandingoplateau seit alter Zeit abgespielt hat, werden wir natürlich nie erschöpfend erfahren, aber soviel wissen wir heute schon, daß dieses Plateau von Norden her durch eine Welle nach der andern überspült wurde und daß mit jedem Wogengange eine ältere Dünenstrandung über die Wasserscheide hinweg nach Süden in den Tukorro gejagt wurde. Samori suchte in den Tukorro zu entkommen, die Kulloballi flohen zu den Kissi vor den Susu — die Soni-nke flohen vor den Malinke nach Süden — die Ganaleute sollen vor den Soni-nke hierher entflohen sein und so leiten die Gersse ihre Herkunft ab; Kammara flohen vor den Dia und siedelten sich als Tomma usw. an. Wann werden wir erst alle jene vielen und verschiedenartigen Verschiebungen kennenlernen?
Es genügt uns, von den Waldvölkern zu hören, was wir von anderen vordem gehört haben, und nach dem Kulturbesitze schließen zu können: es sind gut zusammen- und durcheinandergeflossene, also verschmolzene Reste nördlicher Kultur- und Völkerverschiebungen, aufgegangen in der Mischung mit alteinheimischer Art der Waldvölker. Mit dieser Formel erklären wir den Zustand am besten, und nachdem der Ethnograph diese Tatsache betont hat, wird es eine interessante Arbeit für den Ethnologen sein, diese Kulturkörper zu analysieren und die einzelnen Elemente klar herauszukristallisieren.
Wenn ich von Wogen und Wellen der Völkerbewegung spreche, so soll das nicht immer auf rauhen Krieg und Zerstörung bezogen werden. Gerade jetzt spielt sich unter den Eingeborenen ein Prozeß der Volksbeziehung am Waldrande und Walde selbst ab, der unser ganzes Interesse in Anspruch nehmen muß, weil er vollkommen friedlicher Natur ist. In allen Dörfern der Gersse und Tomma traf ich mehrere Konia-nke-Famihien an. Sie hatten sich fest eingebürgert, brachten den Eingeborenen einiges von ihrer Art und lernten auch von ihnen Waldgesittung. Es waren keine Flüchtlinge, sondern freiwillige
Auswanderer, die nur gekommen waren, den Kolahandel in die Hand zu nehmen und so einen Handelsverkehr zu vermitteln, für dessen direkte Abwicklung die Waldleute niemals zu haben gewesen waren.Und doch! Mögen im Blute dieser Menschen 20, 30, 50, 90, 95 Prozent vom Blute nordischer Steppenvölker sein, es sind, es bleiben Urwaldvölker, gleicher Art, wie ich sie im großen Kongowalde gesehen habe, wie sie andere Reisende aus andern afrikanischen Waldgebieten beschreiben. Es ist ein Typus für sich, eine Menschenart, die nicht aus dem Dorfbanne heraus mag, die an Umgrenzung gewohnt, sich selbst in jeder Bewegung begrenzen. Es sind schwerfällige Menschen, die scheu sind. Es sind Menschen, die selten lachen, jedenfalls nicht vor den Fremden —Menschen, die an den kleinsten Kreis menschlicher Gemeinschaft gewöhnt sind und die demnach den Fremden ängstlich, ärgerlich, mißtrauisch ansehen. Sie haben ein wenig vom Katzengeschlechte, von dessen Lauern und Schleichen und von dessen Blutdurst und Gewalttätigkeit. Sie sind, wenn unsereiner erscheint, düster und scheinen stumpfsinnig. Ich buche diesen Eindruck, ich glaube aber, daß er täuscht. Ich habe so ganz aus dem Verborgenen bei den Waldleuten ebenso impulsiv hervorgerufene Bewegungen (z. B. Umarmung, wenn sich Freunde oder Verwandte plötzlich wiedersehen) auch sentimentaler Art gesehen wie bei den Steppenmenschen. Aber der Steppenbewohner gibt sich ungezwungen, frei, unbefangen, gibt seiner Laune unbekümmert um die Anwesenheit anderer Ausdruck, während der Waldbewohner solches nicht nur ungern den andern sehen läßt, sondern auch vor den eigenen Leuten verheimlicht.
Die gewaltigen Mauern, die der Urwald um den Weiler der Buschmenschen baut, die Unsicherheit des Weges, die allzu große Übung im Bogenkampfe mag viel dabei tun. Wiederum wirkt die längere Regenperiode in den Waldgegenden beeinflussend. Aber es kommt hier im Westen noch ein Moment hinzu, das den schwersten Schaden an dem Gemüts- und Geisteszustand der Waldvölker verursacht, das ist die primitiv kümmerliche Arbeitsteilung. Alle diese Völker folgen dem gleichen Gesetze, nach dessen strenger Innehaltung dem Weibe alle Last der Familien- und der Feldfruchtfürsorge zufällt, während der Mann einer mehr oder weniger stumpfsinnigen Heimarbeit und Hausgrübelei überlassen ist. Diese bummelnde Grübelei hat nichts gemein mit dem Geistesleben großer Männer, Religionslehrer, Philosophen und Künstler der Kulturvölker. Für schöpferische Intuition oder irgendeinen höheren Geistesaufschwung fehlt diesen Menschen jede Vorbedingung. Zu eng ist der Kreis der Erfahrungen, zu niedrig der Umfang der Kenntnis, zu primitiv die Erziehung, zu plump der Mechanismus unter der Hirnschale. Und wenn
auch eine höhere Idee in diese primitive Denkwelthineingeschleudert wird, so muß sie verkümmern wie jedes Samenkorn, das auf einen toten Fels gelegt wird, von dem nur törichte Menschensehnsucht Wurzel, Blätter und Blüten erhoffen kann, die doch nur auf fettem Wiesenlande emporsprießen können.Der Wald ist zu üppig, der Mann zu frei, das Weib überlastet — die Kultur kann so nicht gedeihen.
Das beides aber ist es, was diese Waldvölker miteinander verbindet: einmal die gemeinsame Erziehung durch das Leben im Walde, dann, daß hier im Walde noch Reste einer alten, andersartigen Kulturform heimisch sind, die, wenn auch in noch so schwachen Dosen zugegeben, aus jeder in den West-Wald getragenen neuen Mischung herauszuschmecken sind. Dazu gehört z. B. Frauenfleiß und Männerfaulheit. Das Westwaldleben vereinigt zu einer Einheitlichkeit im Stil und deshalb betrachte ich hier die Waldvölker, wie ich sie fand, als Träger eines Typus.
Im folgenden wird nun die Beschreibung im einzelnen gegeben.
Äußeres der Menschen und Ortschaften. — Als Rasse sind Gersse und Tomma verschieden. Allen beiden Völkern ist nicht das so oft und übertrieben betonte Schwarz der westafrikanischen Küstenvölker eigen, sie sind sogar auffallend hell, nähern sich weit mehr den Fulbe als den Wolof. Aber der Gersse ist kurz, gedrungen, mit rundem, dickem Schädel versehen, hat mächtigen Brustkasten und Beine —Gerssebeine ist bei uns später zum Sprichwort geworden. Ich habe diese dicken, starken Beine früher bei Basokko vom Kongo, bei Kru von der Westküste gesehen. Es sind wohlgeformte, aber ganz ungewöhnlich stark gemuskelte und bepolsterte Beine. Die Tomma haben viel weniger Charakteristisches in ihrem leiblichen Äußeren. Aber bei den Tomma herrscht ein rüder, mürrischer, gemeiner und gemeingefährlicher Gesichtsausdruck vor und ist weit häufiger zu sehen als bei den Gersse. Die Gersse sind sklavischer. — In der Haartracht bevorzugt der Gersse die Helmtracht —während der Tomma mehr dem Troddelbau zuneigt. In der Tätowierung unterscheiden sie sich dadurch von den Mande, daß ihr Wangenschnitt blau ist. Die Farbe wird durch eingeriebene Kohle mit Palmöl erzielt. Die Richtung der Linienführung ist die gleiche wie bei den Bammana, aber es besteht ein großer Unterschied. Beim Gersse besteht der Linienschnitt aus vier bis sechs nebeneinanderlaufenden, jedesmal aus zwei Parallellinien bestehenden Zeichen, beim Tomma aus drei parallel laufenden Bändern, die aus vielen einzelnen kleinen Strichelchen zusammengesetzt sind.
An Kleidersitten bemerkte ich, daß die Männer sich meist mit einem vorn und hinten durch den Lendenstrick gezogenen Zeugstreifen
begnügen, bei feierlichen Gelegenheiten aber einen feierlichen Überwurf aus selbstgewebtem und zusammengenähtem Achselhernd aus blau und weiß gefärbten Baumwolistreifen tragen. Es ist ein einfacher langer Zeugmantel, der bis an die Lenden reicht. Ärmel fehlen. An den Seiten ist er offen. In Wahrheit ist es ein langes, rechteckiges Laken, das in der Mitte mit einem Loch zum Kopfdurchstecken versehen ist. Die Frauen tragen einen um die Lenden geschlungenen Pagne und darunter merkwürdigerweise stets ein Höschen. Als Schmuck der Männer fielen mir Armringe auf, die aus der dicken Sohlenhaut des Elefanten geschnitten und zuweilen noch mit eingeschlagenen Eisennägeln eigener Fabrikation geschmückt sind. —Das Blau für die Baumwollstoffärbung gewinnen die Gersse und Bammana von einem Kara genannten, im Walde wild wachsenden Baume. —Über die Zustutzung der Zähne und die Tätowierung des Körpers werde ich bei Gelegenheit des Geheimbundes und der Beschneidungssitten noch mehr zu sagen haben.Werfen wir nun einen Blick auf Ortschaft und Haus.
Die Ortschaften der Gersse sind ebenso geschlossen und gesichert angelegt wie die der Tomma. Beide streben Verborgenheit im Walde, Nähe von Rinnsalen und nach Möglichkeit den Schutz tiefer gelegener Sumpf- und Urwaidtäler an. Sie liegen also auf Höhen, aber nicht auf den mit Savannen bedeckten Bergen, sondern auf waldigen Hügeln. Die Gerssedörfer sind bei weitem nicht so stark befestigt wie die Weiler der Tomma, die die Zugänge zu ihren Wohnsitzen auf Kilometer hinaus mit einer Barrikade nach der andern versehen. Die Gersse haben Verteidigungslinien, jedoch nur einen Lehmwall mit einem flachen Graben davor.
Nähern wir uns dagegen einer Tommaortschaft. Schon eine oder anderthalb Stunden, ehe wir uns ihr nähern, treffen wir nach Überschreitung eines Sumpfes im Walde auf eine Barrikade, die durch tief in die Erde gelassene, nebeneinander kerzengerade aufgeschichtete Stämme uralter Olpalmenbäume gebildet ist. Nur ein ganz schmaler Weg ist gelassen und wir sehen, daß seitwärts Baumstämme und altes Bindematerial liegen, bereit, im Moment der Annäherung eines Gegners, eines Feindes als Füllung der Lücke verwendet zu werden. Innerhalb dieser Schutzvorrichtung liegen irgendwo in Dickicht und in Sumpfniederung versteckt die Reisfelder des Ortes.
Wir gehen zwanzig Minuten, überschreiten wieder einen Sumpfbach und kommen, die Böschung hinaufschreitend, an eine vielleicht noch festere Befestigungslinie, nämlich an ein Dickicht dicht nebeneinander angepflanzter Pandamusstämme, die auf allen Seiten ein üppiges Laubwerk zeigen. Auch hier ist der Durchgang eng. Auch hier liegt zur Seite alles, was nötig ist, um im Falle der Gefahr die Lücke zu füllen. Das geht so weiter, eine Barrikade nach der andern
ist zu passieren, bis wir endlich an den Befestigungskranz kommen, der die Stadt selbst umgibt.Ein Querschnitt durch eine solche Befestigung bietet etwa folgendes Bild. Wenn man vom Bache aus die Höhe emporsteigt, trifft man zunächst auf eine Glacishöhe, die mit starkem Buschwerk bepflanzt ist. Erdaufwurf zirka drei Meter. Vierzehn bis fünfzehn Meter vor der Hauptmauer beginnt eine etwa zwei Meter hohe Schanze, die durch Deckung der dahinter liegenden zwei bis drei Meter tiefen Graben läuft, von dessen Sohle früher die Hauptmauer bis zu sechzehn und achtzehn Meter Höhe aufragte. Allerdings ist es eine ganz gemeine Lehmmauer, aber gegen Pfeile, Schüsse aus Feuersteinflinten und sogar gegen moderne französische Büchsenschüsse haben sich diese bis vier Meter dicken Lehmsockel bewährt. Der obere Rand der Lehmmauer ist übrigens durch ein Strohlager gegen die schädlichen Einflüsse des Regens geschützt.
Da, wo die Wege in diese nicht zu verachtenden Festungsgewerke der "Waldwilden" hineinführen, sind mächtige Torbauten angelegt, die bis acht Meter hoch, bis zehn Meter tief und bis drei Meter breit sind. Es sind einfache Hallen, in denen zwei bis fünf schwere Holztüren als Bohlen (aus einem Stamm geschnitzt) mit Zapfen oben und unten eingelassen sind. Ich bemerke übrigens, daß ich diese inneren Mauer-Dimensionen an den heutigen Tommafestungen nicht mehr fand. Unser ausgezeichneter Führer zeigte uns aber gelegentlich der Wanderung zum Diani die waldüberwachsenen, letzten Reste einer alten Tommafeste, die diese Maße aufwies. Das höchste an Mauer scheint bei den heutigen Tomma ein Lehmwerk von 4,20 Meter Höhe zu sein. Aber Bussedugu, das den Franzosen so lange Widerstand leistete, soll viel bedeutendere Höhe an Mauerwerk aufgewiesen haben.
Die Städtchen sind mehr oder weniger kreisrund, haben je nachdem zweihundert bis fünfhundert Meter Durchmesser. Entsprechend den Verkehrsverbindungen sind zwei, meist aber vier Tore vorhanden, die ebensovielen Wegen entsprechen. Die Hütten liegen in Abständen von eineinhalb bis zehn Metern unordentlich, ohne bestimmte Anlage rund herum. Je nach Familienbeziehung bildet sich hier ein Platz mit umliegenden Hütten, da ein Winkel. Den Toren zu befinden sich die Versammlungshäuser der Alten. Wo ein kleiner, freier Raum entsteht, ist ein Gärtchen angelegt, auf ausgedehnterem, freierem Raum ist die Bahn, auf der ein Weber sein Handwerk übt. Die Hallen der Schmiede endlich sind vor den Toren der Ortschaft, meist nahe den Torhallen zwischen Glacis und Graben, angelegt. Das geschieht wegen der mit dem Schmiedehandwerk verbundenen Feuergefährlichkeit.
Dieser Eindruck von der Einfachheit der Konstruktion wird aber gründlich vernichtet, wenn wir unter die Dachveranda treten und nun wahrnehmen, daß das Dach ja gar nicht wie sonst auf den Lehmwänden aufliegt, sondern vielmehr auf einem Lattenlager, welches wagerecht über die Mauer wegragt. Folgen wir diesem Fingerzeige und treten näher, so sind wir zuerst ganz verwirrt, —denn im Innern sind wir inmitten eines fast quadratischen Hauses.
Und in der Tat haben wir das Gerüst einer rechteckigen Hauskonstruktion vor uns, die nur dadurch in Stilverwirrung geraten ist, daß das Rundspitzdach dazugekommen ist.
Das Grundgerippe sind vier Säulen, die die beiden Hauptbalken tragen; über diesen liegt das Deckengebälk. Der Gedanke des rechteckigen Baues wurde in kurzen, den Rundmauern zuführenden, von den vier Säulen ausgehenden Stützen zunächst beibehalten. Auch blieb dieser unbedingt mit einem rechteckigen Bau verbundene Gedanke des Zwischenbodens in der wagerechten Decke bestehen. Man schnitt in diese wagerechte Decke ein Loch, durch welches man mit einer primitiven Leiter hinaufsteigen kann. Dann schnitt man aber diese Decke kreisrund aus und setzte soweit Tür- und Fensteraussparung das nicht beanspruchten, den Kreis aus in die Erde gerammten Stämmchen zusammen, die mit Lehm beworfen wurden, was übrigens auch den ersten Quermauern im Innern widerfuhr. Diese äußere Rundmauer stützte nun ebenfalls das Deckenlager, das eigentlich schon von dem quadratischen Innengerüst der vier Säulen getragen wird.
Mit Lehm, dem Baumateriale des Sudan wurden nun auch die letzten Füllungen und Brüche hergestellt. An einem neuen Hause kann man nicht sehen, daß die runde Kreiswand sowie die vier kleinen Außenwände aus Stangenwerk bestehen. Erst wenn der Lehmputz nach Verlauf eines Jahres abfällt, kommt das wahre Konstruktionsmaterial zutage.
Es sei gleich erwähnt, daß hier bei den Tomma die Kappe des Daches, das Stangengerüst zwar auf der Erde geflochten wird, daß die Strohdeckung aber stets erst erfolgt, wenn die Gerüste auf das Haus gesetzt sind. Wir wissen, daß bei den Malinke das Verfahren ein anderes ist. Dort wird Gerüst und Deckung des Daches vorgenommen, ehe das dann fertige Dach auf die Mauern gehoben wird. Schon in Kankan kann man aber zuweilen sehen, daß auf dem Hause gedeckt wird, und nach Süden zu nimmt diese Sitte immer mehr zu. Ich glaube den Grund darin suchen zu müssen, daß die Süddächer viel mächtiger, nämlich sowohl höher, als im Durchmesser weiter sind. Soll doch das Dach ziemlich weit über die Mauern wegragen und eine Veranda bilden.
Auch diese Veranda nimmt von Norden nach Süden zu. Den Anfang dieser Ausgestaltung sah ich in Bissandugu. Es handelt sich hier um eine Veranda vor der Haustür, die nicht ganz unähnlich den gewölbten Toreingängen der Paläste in Uganda und im Zwischengebiete überhaupt ist. Die Veranda Konians weicht übrigens nicht nur insofern von der der Tomma ab, daß sie nur an der Fassade zu beobachten ist, sondern auch dadurch, daß sie von stützenden Säulen getragen wird. In letzterer Hinsicht hat sie fraglos eine weit größere Ähnlichkeit mit dem Säulenbau der Versammlungshäuser der alten Tommafamilienväter, die wir nachher besichtigen werden. Aus der äußeren Säulenreihe dieser Gebäude dürfte das Verandenstützwerk der Konianfürstenhäuser hervorgegangen sein. Man vergesse nicht, daß vor den Kammara in Konian Völker (Waldvölker) ansässig waren, die zu den Tomma in verwandtschaftlichem Verhältnis standen.
Eine zweite Entwicklungsrichtung in architektonischer Beziehung können wir in der Herstellung des Mauerwerkes sehen. In Beledugu und den Nachbarländern gab es nichts anderes als Lehmmauerwerk — nur Lehm! Im Fiegebiete stieß ich schon auf Landhäuser, auf deren Erhaltung kein Wert gelegt war. In den Malinkestädten sah ich das nie, etwas ähnliches nur einmal in Uolossubugu, wo ins Mauerwerk Stützensäulen aufgenommen waren, die den Dachring trugen. Aber auch das war nur bei einem sehr großen Hause zu bemerken. In Torong und vor allem in Konian mehrte sich das Vorkommen des Stangenwerkes im Lehmgewand und im eigentlichen Walde konnte man als solide Lehmmauer nur noch die Stadtmauern sehen. Sonst war jede Hauswand aus Stangenwerk hergestellt.
Im übrigen ist im Tommahaus dem Lehm als Sohle und Bank eine weitgehende Verwendung zugelassen. Durch die Tür- und Fensterseitenstützen, dann durch die vier Säulen ist ein Gang geschaffen, der auch in der Höhe der Haussohle freigelassen wird. Aber zwischen den Querwänden ist zur rechten und zur linken ein vierzig Zentimeter
höherer Lehmsockel geschaffen, der dem Hausherrn zur einen, der Hausfrau zur anderen als Schlafstätte dient. Zwischen beiden, auf dem Gang, unter der Spitze des Hauses ist der Feuerplatz. Ein zweiter Sockel, eine richtige Bank, ist zwischen den Querwänden und dem Fenster in gleicher Höhe aufgefüllt. Es ist eine Fensterbank, in der auch einige kleine Mulden angebracht sind, damit dort Töpfe (die stets einen gewölbten Boden haben) stehen können. Gekocht wird in dem Winkel links (für den Eintretenden) nahe der Tür. Rechts, im Winkel bei einer Säule steht allerhand Gerät wie Bogen und Pfeile, ein Trinkkrug usw. Zum Zwischenboden steigt man auf einer Leiter empor, die vor der Fensterbank angelehnt ist. Die Decke, die aus dem herrlichsten Materiale der Palmblattrippen gebaut ist, weist hier eine Lücke auf.Hieran anschließend gehe ich sogleich zu der Schilderung des Gerssehauses über, das nichts anderes ist, als eine Kümmerform der üblichen Tommawohnung. Diese Verkümmerung ist auf eine gewisse "Vereinheitlichung" des Hauses zurückzuführen. Zieht man durch die Mitte eines Gerssehauses eine Linie in der Achse, so liegen die beiden Türen auf der einen, der Bettplatz mit seinen zwei Außenwänden auf der andern Seite. Denn das Gerssehaus hat nicht Tür und Fenster, sondern zwei Türen, es hat nicht zwei Bettplatze, sondern einen, es hat nicht vier Außenwände, deren Endsäulen tragen, sondern nur zwei und der Feuerplatz liegt nicht in der Mitte des Hauses, sondern in der Mitte des Raumes, den beim Tommahaus der andere Bettplatz einnimmt. Also ist das Gerssehaus zwar bedeutend einfacher, aber deswegen doch nicht ursprünglicher — man muß solche Fälle hervorheben —denn so oft und so selbstverständlich erscheint das Einfachere als das Ursprünglichere. Es ist eine Kümmerform. Im übrigen wird auch beim Gerssehaus das Dach nicht von der Hausmauer, sondern von den Enden der Zwischenbodendecke getragen.
In die gleiche Gruppe von Kegeldachbauten gehört eine Art von Werken, die zuweilen den runden Mandingohütten weit verwandter sind: die Versammlungshäuser der Alten. In Dandando sah ich ein sehr merkwürdiges, dem Einstürze nahes Gebäude, aus würdigerer Vergangenheit stammend. Zwei Reihen von Pfeilern, d. h. zwei in Abständen von zirka achtzig Zentimeter konzentrisch angelegte Säulenreihen, tragen zwei in die Gabelenden gelegte, starke Flechtringe. Auf diesen Flechtringen ruht das Kegeldach, genau wie bei den Mandehütten. Der Raum zwischen den Säulen war etwa bis zur halben Höhe des äußeren Pfeilers mit einer Lehmbank ausgefüllt, auf der in alten Zeiten die beratenden alten Herren Platz nahmen, während in der Mitte ein Feuer brannte. Der Name dieser Gebäude ist Kota.
Nach mehreren Richtungen war die Lehmbank unterbrochen und
gab so einem angenehmen Zugange Raum. Dieses Bauwerk ist es, welches so stark an die allerdings nur sehr einseitige Verandabildung der Konian erinnert. Anders war die Kota von Gumbauela, ein neueres Bauwerk, konstruiert. Hier lag auf einem einzigen, nur durch eine Säulenreihe getragenem Flechtring erst eine Zwischenbodendecke aus Palmblattstengeln mit Luke, und auf den ziemlich weit herausragenden Stangenenden das Dach auf. Diese Kota war also im Stil den Tommawohnhäusern weit ähnlicher.Unter allerhand Spielformen treten diese Prinzipien der Bauweise im Zusammenfließen mehrerer Stile hervor und verraten allerhand geschichtliche Kulturbewegungen. Und doch wieder eine sinnvolle Einheit: der Typus der Häuser der Waldbewohner. Wenn ich dem Leser nun noch versichert habe, daß in allen diesen Häusern, deren Decken nie gereinigt werden, der Schmutz und anscheinend auch der Wasserreichtum, der Mauerdreck, das Spinnengewimmel, der Rauchgeruch usw. unheimlich ist, so habe ich alles gesagt, was an dieser Stelle zu bemerken ist.
Zu erwähnen sind Ställe und Schmiedehütten. Letztere sind Hallen von der Form der Mittelspitzhäuser. Wände haben sie nicht. Für die Hühner und Ziegen bauen diese Gersse unter der Veranda ihrer Wohnhäuser aus Palmblattstengeln Hütten, die an Gebilde erinnern, die ich bei Fulbe in Koba sah, nur waren sie nicht mit Lehm beschmiert. Bei den Tomma umgestülpte Strohtrichter oder Netz-Spannungen, oder Tüten aus geflochtenen Palmblattstreifen über einem Stück Matte, die geeigneten Vorrichtungen für Glucken und Küken. — Hammel hausen in kleinen Rundhütten mit Balkenwänden.
Endlich muß eine Vorrichtung erwähnt werden, die sich hinter jedem anständigen Tommahause findet und die den Orten einen gewissen Charakter verleiht. Das sind etwa zwei Meter im Quadrat haltend etwa zwanzig bis vierzig Zentimeter vom Boden erhobene, auf Gabelhölzern ruhende Plattformen, unter denen in der Erde ein Loch angebracht ist. Doch, indem ich auf die Verwendung dieser eigenartigen Bauwerkchen eingehe, gelange ich auf ein Gebiet, das einen besonderen Abschnitt beansprucht, ich komme damit zur Schilderung des Volkslebens der Waldvölker Nordliberias.
Es ist nicht nur das Seltsame an dieser Sitte, was mich veranlaßt, dies Bild diesem Absatz an die Spitze zu stellen. Etwas anderes kommt hier wie während des ganzen Tages- und Jahres- und Lebenslaufes zum recht klaren Ausdruck, das ist die Knechtschaft des Waldweibes. "Arbeite und bringe Kinder hervor, ernähre sie und sorge für das Einkommen vom Vater bis zum jüngsten Nachkommen", das ist das Gesetz, das weibliches Wesen und Leben hier beherrscht. Diese Waldmenschen leben noch mitten in dem Zeitalter, in dem die Arbeitsteilung eine ursprüngliche ist. Der Mann beschützt das Gemeinwesen im Kampfe, und im übrigen arbeitet in Kulturarbeit die Frau das, was notwendig ist, und der Mann das, was seiner Laune ansteht.
Damals, als wir in den Dörfern Nordliberias umherreisten, fiel es uns nicht auf. Als wir dann aber wieder nach Norden kamen zu den gebildeten Kammara und gar erst zu den Kaba, da waren wir oft verblüfft, wenn eine Frau auf dem Wege an uns vorübergehend ihren freundlichen Gruß uns lachend zurief und dazu harmlos, freimütig und fröhlich Rede und Antwort stand, eine Frucht als Weggabe reichte oder gar unbekümmert um unsere Eigenart als Männer und Weiße uns nach vorausgegangenen Gefährten oder so fragte. Dann sahen der Maler und ich uns oft erstaunt an und manchmal fiel auch der Ausdruck der Verwunderung: "Wenn das einmal ein Waldweib wagte!" — Unmöglich! In diesem Unterschied kommt einer ganzen Kulturperiode Gegensätzlichkeit von Anfang und Ende zur Erkenntnis. Oder ist es nur der Unterschied zweier nebeneinander lebender Kulturformen, deren Grenze zwischen Wald und Steppe liegt?
Höchstens, wenn es gilt, ein neues Feld zu roden, greift der Männerarm einmal zu. Sonst bestellt, arbeitet und verwertet das Weib das Reisfeld. Aber auch dann fällt alle Arbeit den jungen Burschen zu. Die Alten sind eben die Würdigen und Geehrten. Und es gibt Alte. Darin sieht man den Einfluß nordischer Kultur (des Südens). Die Alten werden nicht "weggeräumt", wie bei vielen Kongovölkern. —
Im Gegenteil. Die Alten, zumal die Familienältesten, spielen sogar eine ganz hervorragende Rolle. Wenn es eine wichtige Sache gibt, kommen die Korolo-tie (die alten Männer) der Tomma auf der Kota zusammen, hocken sich auf die Lehmbank und beraten. Davon hängt viel ab, oft Krieg und Frieden — denn nur sie können über den Krieg entscheiden.Doch sehen wir einmal an, was bei den Tomma unter Familienältesten zu verstehen ist. In den Geschichtsüberlieferungen (siehe nachher) werde ich darauf hinweisen, daß bei den Tomma eine etwas komplizierte Volkseinteilung besteht. Zum ersten gibt es verschiedene "Engassi", das sind Stämme, die von Norden in den Wald gedrängt und von den Waldvölkern absorbiert wurden. Da sind z. B. die Kammara, Falega, Massa, Maua, Mbare, von denen jeder sein eigenes Ngiena (Speiseverbot) hat. Es scheint, daß diese Engassi und ihre Ngiena nur da noch eine Rolle spielen, wo ein gewisses monarchistisches System durch ihr Übergewicht und ihre Herrschaft aufrechterhalten wird. Aber der Wald ist kein Land für Staatenbildung. Der Wald ist der gegebene Ort und Boden für separierte Städtewirtschaft und Kommunalverwaltungen, und in meinem Studium über die Entwicklung des Staates lernte ich nie mehr, als wenn ich abwechselnd das Leben auf der Steppe und in den Wäldern zu beobachten Gelegenheit hatte.
So gehen denn bei dem ewigen Streite der abgeschlossen angelegten Waldsiedlungen alle mehrere Gemeinwesen verbindenden Staaten und Staatchen gar bald in dem verbindungsarmen Lande unter und es treten die Kommunalverfassungen wieder hervor und auch die Engassi mit ihren Ngiena gehen unter in der anderen Einrichtung des "Beni".
Die Beni sind Familien in totemistischem Sinne. Indem ich die Grenze Liberias überschritt, war ich im Lande des wohlerhaltenen Totemismus angelangt und hatte so ein hochinteressantes Gebiet erreicht. Unter den Tomma erfuhr ich von folgenden totemistischen Familien:
Tie, ihre Mitglieder essen nicht Hühner, Gieorgi, " " " Hunde, Nikeogi, " Ochsen, Blieona, " Ziegen, Koiona, " Panther, Kariona, " " Schlangen, Sakosa, " " " Rotspatzen*, Sieoga, " Elefanten. |
Auffallenderweise spricht das Mädchen zwar kein Wort mit, wenn ein Ehevertrag einläuft, aber sie entscheidet. Das geht so vor sich: Der Ehesüchtige sucht sich einen Kiela (Brautwerber) aus. Er sagt zu ihm: "Nimm einen Gure (Baumwollschurz, er ist für die Schwiegermutter bestimmt), eine Siege (Überhang), Tuguli (Kolanüsse), Dona (Palmwein), (alles das kommt dem Vater der Braut zu) und gehe zu dem N. N. (nennt das Elternpaar). Gehe hin und sage, daß ich ihre Tochter X zur Frau haben möchte." Der Kiela führt seinen Auftrag aus. Wenn das Mädchen das hört und eine der Kolanüsse in den Mund steckt, so sagt man: "das Mädchen will den Mann nehmen"; damit ist dann die Sache erledigt. Die beiden heiraten. (Penis = togo; Hoden = porro; Vagina = ngama kurru; Clitoris = sombe; Labia = kurru suve.) Und mit dieser einen Willensäußerung ist es für das Weib ein für allemal in diesem Kapitel zu Ende. Sie hat nichts mehr zu wollen. Sie gebiert Kinder, nährt sie, arbeitet, wäscht ihren Mann, sucht ihm Flöhe und Wanzen ab usw. Der Mann aber wird, wenn er alt genug und die andern Männer der Beni überlebt, ein Mitglied der Altersgenossenschaft, die in der Kota regiert. Wie weit ein Erbrecht dabei zur Sprache kommt, werden wir sehen, wenn die Beschreibung der Bestattung uns sowieso diesem Thema näherbringt.
Kasten gibt es bei den Gersse und Tomma nicht. Schmied kann jeder werden, und den Barden kennen die Völker nicht. Bei den Gersse unterscheidet man in Jamaluj (Freie) und Due (Unfreie), aber bei den Tomma fällt das auch fort aus Gründen, die später ZU schildern sind.
Um nun aber den rechten Maßstab dafür zu gewinnen, inwiefern diese Alten frei oder nach den Gesetzen einer eng genug begrenzten Weltanschauung regieren, müssen wir uns erst nach der wichtigsten Einrichtung dieser Kulturkörper umsehen, nach dem Masken- und Geheimbundwesen, das hier blüht.
Von Zeit zu Zeit wird in jedem Distrikt des Kissigebietes die Nachricht verbreitet: "Loea kommt! Er will die Kinder essen!" Das bezieht sich auf die Knaben, die zehn bis zwölf Jahre alt sind, und der die Nachricht bringt, das ist ein Schmied, ein "Sumunda", der bei dieser Sache dieselbe Rolle spielt wie der Seema bei den Beschneidungsfesten der zentralen Mandingoländer. Alle Knaben von zehn bis elf Jahren werden alsdann unter der Führung des Sumunda (Schmiedes) in den Wald gebracht. Der Abschied wird den Müttern sehr schwer, — denn gleich werden wir hören, welch schreckliches Schicksal den Burschen nach dem Volksglauben bevorsteht.
Im Walde wird für die Burschen ein hübsches, sehr großes Haus eingerichtet, und dann lernen sie den Loea Doni kennen, das ist der Sumunda selbst, der tanzt vor ihnen in einer Maske, die wird Mossolo genannt. Sie besteht aus Leopardenfell, das mit Ziegenhaar und rotem Stoff besetzt ist und das vorn über das Gesicht fällt, während der Leib in ein flatterndes Fasergewand gehüllt ist. Der Anblick entsetzt die Knaben zunächst sehr. Sie werden von Loea Doni auch geschlagen und er sagt ihnen, daß sie sogleich für ewig sterben würden, wenn sie je ein Wort davon verraten sollten, was sie sahen. Die nun ohne Sumunda ganz sich selbst überlassenen Knaben müssen offenbar eine furchtbare Angst in diesen Tagen durchmachen, durch die sie, ganz gehörig vorbereitet, gehorsame Mitglieder eines geheimen, machtvollen Bundes werden. Viele würden auch wohl entfliehen, aber sie kennen die wenigen Wege nicht, die aus dem Walde führen, und sollte je einer in diesen Tagen dem Waldzauber zu ent
fliehen und in das Dorf zu entkommen wissen, so ist er für sein Leben ebenso geschädigt, wie ein Knabe, der bei den Bammana-Malinke.. Beschneidungsfesten schrie. Er muß außer Landes gehen.Eines Tages heißt es in den Dörfern: "Loea, Doni, odji", d. h. "Loea" Doni hat die Kinder gefressen. Schon von den Zeiten des alten Dapper wissen wir, daß solcher Glaube an der Westküste Afrikas herrschte, aber anscheinend ist solchem Gedankengange im Inlande seit alters her nicht nachgegangen worden. Mir wurde aber von den Leuten dieses Volkes wie von den Tomma versichert, daß der Maskengeist, die gewaltige Waldfigur, die zum Reifefest bestimmten Kinder verzehrt und sie dann in seinem Leibe hat. Der Maskengeist ist schwanger und bringt gebärend dieselben Knaben wieder hervor.
Also der Sumunda bringt die Nachricht ins Dorf: "Loea Doni hat die Knaben gegessen, und da er nun schwanger ist, gilt es, ihn gut zu ernähren, damit die Burschen gesund und lebend wiedergeboren werden können. Deshalb soll von heute an jede Mutter, die in der Burschenschaft einen Sohn hat, Malo (roten Reis) nehmen und ein gutes Gericht Momo (gekochten Reisbrei) bereiten. Die Schüssel mit Momo soll sie vor die Haustür stellen und abends sollen dann alle Weiber und Kinder in die Hütten gehen und sich hinter den Hüttentüren wohl verrammeln." Mit großer Emsigkeit wird dem Befehle Folge geleistet und auch wohl solche Weiber, die zur Zeit kein eigenes Kind im Leibe des Waldunholdes wissen, richten einen Brei vor, sei es aus Furcht vor heurigen Ereignissen, sei es für die Zukunft vorzubauen, jedenfalls um bei dem Ungeheuerlichen in Gnaden zu stehen. Wenn dann die Sonne untergegangen ist, bietet das Dorf einen toten Eindruck dar. Nur die alten Männer und vordem schon in den Bund aufgenommenen Burschen wandern zwischen den Häusern herum. Sogar Hunde und Hühner sind verschlossen.
Etwa um sieben Uhr kommt "es" dann aus dem Walde heran, ein Kreischen und Brüllen und Schreien und Stampfen, so daß die in den Hütten verschlossenen Weiber meinen mögen, es sei eine große Menge der unheimlichen Geister. So klingt es ihnen, wir wissen es ganz genau, daß es nur der eine fürchterliche Loea Doni ist, der umherstreift, um für sich und die Kinder in seinem Leibe Nahrung zu suchen. Wenn sie sehen würden — was ihnen aber die Angst verbietet — so würden sie den tollen Zug des Sumunda sehen. Der ist in die Mossi-lo gekleidet. Hinten und um ihn springen, tanzen, hopsen, grölen, singen, randalieren die Burschen, "die verschlungen" sind. Der Zug geht von einem Hause zum andern, überall werden die Momoschüsseln aufgenommen, und dann geht es mit guter Ladung zurück in den Wald. An der Waldgrenze entkleidet sich aber der Sumunda, kehrt in gewohntem Aufzuge in die Ortschaft zurück
und ruft aus: "Jetzt können alle Leute wieder aus den Häusern kommen. Loea Doni hat sein Essen gefunden und ist zufrieden."Wo viele Knaben gleichzeitig diesen Kursus durchmachen, da kann man das alle Tage erleben, wo es wenige sind, erscheint die wilde Waldjagd nur alle zwei Tage. Und das geht so zwei bis drei Jahre. Während dieser Zeit verbringen die Burschen, nachdem sie erst einmal den großen Schrecken überwunden haben, im Walde offenbar eine Zeit herrlicher Ungebundenheit. Daß sie viel Zeremonial durchmachen oder viel lernen, glaube ich nicht. Aber eines lernen sie: Es gibt im Kissiwalde viele Schlangen von der "Kewo"genannten Art. Die Kewo sollen giftig sein. Von diesen Schlangen nun werden viele unter der Leitung des Sumunda eingefangen, ihres Giftes beraubt (?) und die Knaben lernen, mit ihnen zu spielen. Das soll eine besondere Kunst sein, die zu erlernen nicht leicht ist, und die Knaben benötigen viel Zeit, sich mit ihr abzufinden.
Ferner machen die Knaben im Anfange anscheinend eine etwas grausame Peinigungserziehung durch. Sie werden geschlagen. Vor allem werden ihnen Messerstiche auf Brust und Bauch beigebracht. Die Narben bleiben für das ganze Leben bestehen, es sind gleichmäßig verteilte kleine Schwellungen. Dem Volke wird gesagt: "Das sind die Überreste der Wunden, die von den Bissen des Loea Doni stammen. Als Loea Doni die Burschen fraß, biß er mit den Zähnen zu. Daher kommen diese Narben."
Dieses Leben währt drei Jahre. Während der drei Jahre wird den Knaben im Busch nicht das Kopfhaar geschnitten. Eines Tages kommt nun der Sumunda wieder in das Dorf und ruft aus: "Loea Doni ossora djua", d. h. "Loea Doni" hat die Kinder wieder geboren. Gleichzeitig fügt er hinzu: "Die Knaben haben aber lange Haare, die Haare müssen geschoren werden." Da beeilt sich denn jede der überaus glücklichen Mütter dem Sumunda zehn bis zwanzig Kola zu schenken, ihm für die gute Nachricht zu danken und ihn zu bitten, den Haarschnitt vorzunehmen. Ist die Zeremonie des Haarschneidens vollendet, dann steht einer Rückkehr in das Dorf nichts mehr entgegen.
Das ist dann ein großes Fest! In allen Familien hat der Sumunda verkündet, daß an dem und dem Tage die Knaben aus dem Walde des Loea Doni von ihm ins Dorf zurückgeführt werden. Alle Familien haben sich gerüstet. Mit Trommeln und Tanzen sind sie vor das Dorf gezogen in der Richtung nach dem Loea Doni-Walde zu. Aus dem Walde kommt der Zug der nun erwachsenen Knaben unter der Leitung des Sumunda herausgetanzt. Es wäre gegen Negerart, wenn die Burschen gerührt in die Arme der Mutter sinken würden, es ist aber Negerbrauch, daß die Liebe sich zunächst in kräftigem Traktament mit Speise und Leckerbissen dokumentiert. Im Jubel
und unter vielem Getrommel und Getanze begibt sich der Zug in den Ort.Hier nun führen die neuen und nun als erwachsen geltenden Zöglinge des Loea Doni ihr Kunststück vor. Sie haben Körbe mitgebracht, in denen sind viele Kewoschlangen — besonders in der letzten Zeit waren sie emsig beim Fange der Reptilien. Die Körbe werden nun geöffnet und die Schlangen kommen heraus. Die Burschen spielen und tanzen mit ihnen. Fragen die Weiber erstaunt, wieso sie gefahrlos und unerschrocken die gefährlichen Tiere anfassen können, so sagen sie: Loea Doni habe ihnen dafür ein besonderes Kooa (d. h. Zaubermittel, entspricht dem Baschi der Bammana) gegeben. Wenn ein Alter nun auch eine Kono anfaßt, so sagt man: "Man erkennt, daß der den Loea gesehen hat."Wagt aber ein Alter nicht, den Kono näherzukommen, so sagt man: "Ah so, der hat den Loea Doni nicht gesehen." Derart unterscheidet sich jedes Mitglied des Bundes von einem Nichtzugehörigen.
Dem Sumunda werden viele Geschenke an Kola gemacht und damit ist diese Aufnahmezeremonie abgeschlossen.
Die Sage erzählt ähnlich, wie wir das gleich bei den Gersse sehen werden, daß die Frauen eines Tages beim Fischen die erste Sogo (Maske) fanden. Es wird ausdrücklich betont, daß die Maske beim Fischen gefunden ward und daß sie lebendig war und sprach. Sogo war nicht nur eine geschnitzte Maske, es war eine weibliche Maskengestalt, und die Frauen forderten Sogo auf, mit in das Dorf zu kommen. Sogo kam mit. Die Frauen brachten Sogo in ein Haus und sagten zu ihr: "Bleibe erst hier im Hause." Dann gingen die glücklichen Frauen (Fischerinnen) im Dorfe umher und forderten alle Weiber auf, indem sie sagten: "Heute abend kommt alle zusammen, heute abend wollen wir eine große Versammlung abhalten." So ward es alle Frauen kamen am Abend zusammen und hockten rund herum. Dann gingen die Fischerinnen in die Hütte, in der Sogo verborgen war, und sagten zu Sogo: "Nun komm und sprich, denn alle Frauen sind jetzt auf dem Platze versammelt."Sogo kam heraus, Sogo war aber ganz still. Die Frauen fragten: "Du sprichst nicht?" Sogo antwortete nicht. Darauf fragten die Frauen (nochmals): "Sogo, du sprichst nicht?" Darauf begann Sogo zu tanzen und zu schreien und vollführte einen so fürchterlichen Lärm, auch war sie so schrecklich anzusehen, daß alsogleich eine entsetzliche Furcht unter den Weibern entstand und sie entsetzt und kreischend nach allen Seiten auseinanderfuhren. Dadurch wurden die Männer aufmerksam, sie kamen herzu und fragten: "Was gibt es denn?" Die Frauen kreischten aber nur: "Sogo! Sogo!" Die Männer sahen nun, was es gab — sie sagten sogleich unter sich: "Das ist nicht gut für die Frauen. Das ist eine Männersache! Das ist eine ernste Sache! Damit kann man gegen die Matta (das sind die Subaga der zentralen Mandingo) und gegen anderes Schlechte wirken. Wir wollen Sogo an uns nehmen und ihm einen Wohnsitz geben." So kam Sogo von den Frauen zu den Männern und die Männer bauten im Busche den Baffai. Darum sind heute alle Masken im Busche. Die Männer gründeten aber auf solche Weise den Afuta Mangrie, das ist der geheime Männerbund. In jedem Tommadorfe soll es eine weibliche und eine männliche Afumaske geben. Die weibliche heißt anscheinend Afu Sang. Die Masken der Tomma und Gersse sind ganz gleich gebildet, und es sind besondere Künstler, die sie sowohl an Tomma wie an Gersse verkaufen.
Eine merkwürdige Mitteilung lautet, daß im Tommalande anfangs nur die Kammara Masken hatten und daß der erste Maskenbesitzer Massa hieß.
Ehe der Tommabursch in den Afuta Mangrie aufgenommen werden
kann, muß er die verschiedensten Operationen an seinem Körper durchmachen, deren Spuren man — früher war diese Forderung obligatorisch, während sie heute schon mehr fakultativ geworden ist — an seinem Leibe tragen muß, wenn er von den Tomma als Mann betrachtet sein will. Dazu gehört vor allem Porrogi, die Beschneidung, die hier mit dem Reifefest nichts zu tun hat. Zweitens ist anzuführen Kuanga-Neng, die blaue Gesichtstätowierung, von der im Anfange schon die Rede war. Drittens aber rechnet hierher eine Verunstaltung der Zähne.Abgesehen von den Stämmen des Mossiplateaus, deren vier oberste Schneidezähne auch spitz gefeilt sind, habe ich bis heute im zentralen Sudan noch nicht Vertreter von Völkern gesehen, die eine Umformung der Zähne vornahmen. Von den zentralen Maningo kann ich mit Bestimmtheit sagen, daß hier solche Sitte nicht geübt wird. Dagegen stößt man schon im südlichen Uassulu dann und wann und noch häufiger in Konian auf Individuen, welche alle vier oberen Schneidezähne zugespitzt haben. Bei den Tomma nun ist die Zahndeformation direkt altes Stammesgesetz, und hier kommen zwei Formen nebeneinander vor:
1. koi-nji oder koi-nke, oben ganz gespitzt;
2. kari-nji oder kari-nke, oben eine Lücke eingeschnitzt. Die koi-nji oder koi-nke, d. h. Leopardenzähne, genannte Form zeigt die vier oberen Schneidezähne gefeilt. Die kari-nji oder karinke, d. h. Fischzähne, genannte Form wird erreicht, indem zwischen den mittleren oberen zwei Schneidezähnen eine Lücke, ein Dreieck ausgemeißelt wird. Heutzutage wird die Wahl unter einer der beiden Verschönerungsvorrichtungen dem einzelnen Individuum überlassen, in bezug auf das "Früher"möchte ich das nicht glauben, jedoch waren die Angaben der alten Leute über diesen Punkt unklar, unverständlich und auch widersprechend, so daß ich der Sache nicht auf den Grund zu kommen vermochte.
Sind die Burschen nun mit diesem Stammesabzeichen versehen, findet sich im Kreise einer Gruppe befreundeter Dörfer eine genügende Anzahl von zehn- bis vierzehnjährigen Burschen zusammen, so wird in irgendeinem Teile des Waldes ein Lager von kleinen Häuschen errichtet, in denen die jungen Bundeskandidaten dann während sieben, sage sieben Jahren Aufnahme finden. Der Volksglaube nimmt an, daß die Gesellen vom Maskengeiste Afuta Mangrie verschluckt würden. Bis zum dritten Jahre hausen sie im Kropfe des Waldungetüms, dann rücken sie langsam in den Körper hinab und endlich nach langen Jahren werden sie wiedergeboren.
In dieser Zeit werden die Burschen mit der Pollo-Pai, der Körpertätowierung, versehen. Pollo-Pai besteht aus vielen erhabenen Knötchen auf der Haut des Oberkörpers, die durch Messerstiche hervorgerufen
werden. Das darf aber der Volksglaube nicht wissen. Der nimmt an, die Pollo-Pai-Narben stammten von den Zähnen der Waldgeister Afuta Mangries und seien entstanden, als das Ungetüm vor dem Verschlingen zugebissen habe.Nach sieben Jahren wird der Mann entlassen. Er tanzt nun mit den andern Bundesmitgliedern im Baffai. Im Baffai halten die Bundesmitglieder ihre Beratungen und Feste ab.
Ja, ich kann nicht einmal ganz scharf den Namen des Bundes wiedergeben. Einige versicherten, er laute Ga-kullu, die Konia-nke nannten ihn Niana und die Gersse Maganas behaupteten, er hieße Niamu oder Niannu-kullu oder Niamu-kurru resp. Niamu-kurra. Die Gersse in Koledugu endlich erklärten, die Maskengeselischaft hieße bei Gersse Niamu und bei Tomma Affui. Sicher kann ich nur eines angeben: die männlichen Masken werden Niamu-sineni, die weiblichen Niamu-nenu genannt. Wenn wir den Namen Niamu beibehalten, werden wir der Wahrheit am nächsten bleiben.
Auch die Gersse wissen eine ähnliche Ursprungssage, ihre Maskensitte betreffend, zu erzählen wie die Tomma. Sie behaupten, die Gerssefrauen hätten eines Tages in einem Flusse gefischt und da hätten sie mehrere Masken herausgezogen. Sie banden die Masken unter den Lendenschurz und gingen dem Dorfe zu. In der Nähe der Ortschaft versteckten sie sie aber im Gebüsch. Die betreffenden Frauen kamen dann heim. Sie gingen zu allen andern Weibern und sagten: "Heute nacht wollen wir Frauen alle eine Versammlung abhalten, denn wir haben etwas ganz Besonderes gefunden, und dann wollen wir uns ansehen, was das eigentlich ist." So kamen denn alle Weiber zusammen. Als die Frauen aber nun im Gebüsche die Masken herauszogen, da riefen andere sehr laut und kreischend: "Wir haben es, wir haben es!" Das klang in der Stille der Nacht sehr schauerlich und deshalb flohen die Weiber entsetzt nach allen Seiten auseinander.
Die Frauen kamen wieder heim in ihr Dorf und eine jede erzählte ihrem Manne, was vorgefallen war. So gingen denn die Männer ihrerseits
hin und betrachteten die Dinge. Es war unter den Männern einer mit Namen Sogobassa Komma. Der war sehr anmutig. Er nahm ein Maskenbild auf und kleidete sich hinein. Deshalb so erzählten die Gersse Nensos — sagen die Gersse und Tomma heute noch, wenn sie einen Maskierten ankleiden und ihm Nahrungsmittel reichen: "Hier, mein Sogobassa Komma, hast du ein wenig Kola, hier, mein Sogobassa Komma, hast du ein wenig Huhn" usw. Somit spricht man bis heute den Namen des ersten Maskenträgers dabei aus.Diese Erzählung macht einen viel weniger ursprünglichen Eindruck als der dementsprechende Bericht der Tomma. Nicht nur, daß es viel mehr im Sinne der Legende liegt, wenn die Maske schreit der Schrei der Gersseweiber, der Sinn des Wortes "Wir haben es" und die grausige Wirkung scheinen lauter Mißverständnisse in der Überlieferung zu sein — sondern vor allem hat der Name des ersten Maskenträgers Sogobassa Komma alle Spuren des Diebstahls an sich. "Komma" stammt von den zentralen Mandingo. Sogo heißt "Maske' und "Weib" bei den Tomma und "bassa" hat eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Namen der ersten Maskenträger der Tommma, mit "Massa"!
Niemand kann Mitglied des Bundes Niamu werden, der nicht die Beschneidung durchgemacht hat. Vorher kann er auch die Masken nicht sehen —denn wenn sie tanzen, muß er sich wie die Frauen und Kinder in die Häuser zurückziehen. Will er eintreten, so zahlt er zunächst zehn rote Kolanüsse (Duguli bu), ein Huhn (Te-olo), eine Matte (Saba), aber erst drei Jahre später bekommt er die Masken zu sehen.
Der Aufenthalt des Novizen im Walde soll früher sehr lange gewährt haben; wenn man heute drei Jahre Mindestzeit angibt, so halte ich das für übertrieben. Während die Burschen im Walde des Niamu leben, sagt man: "Der Niamu ist schwanger." Die Hauptzeremonie, der Ritterschlag, der auch hier nicht ohne vorhergegangene Prügel und Einschüchterung verabfolgt zu werden scheint, besteht auch hier in der Tätowierung mit kleinen Schnittchen auf Schultern, Leib und Bauch. Die Angabe über die "Schwangerschaftserklärung" und die Tatsache, daß diese Körpertätowierung, hier Donganja genannt, vorgenommen wird, beweisen, daß hier gleiche Anschauungen wie bei den Tomma und Kissi herrschen.
Neu ist die Angabe über gewisse Opfer. Das Blut, das beim Donganjaschnitte herabtropft, wird aufgefangen und mit gekauten Kolanüssen gemischt. Der Brei wird unter Hersagung des Namens der Novizen der tanzenden Maske auf den Kopf geschmiert. Die Angabe kann richtig sein, denn auf mehreren Masken sah ich solche Opferreste. Die Novizen genießen übrigens selbst etwas von den nachher
zusammengerührten Resten dieses Opfers, und so werden sie durch Genuß des gemeinsam verlorenen Blutes gewissermaßen fest untereinander verbunden. Gleichzeitig versichert man den Burschen, daß, wenn sie je etwas von diesem Zeremonial oder von dem Bundeswesen ausplaudern wollten, ihnen die Todesstrafe sicher sei.Dann kommt der große Tag, an dem die Burschen den Wald verlassen und ins Dorf zurückkehren. Das geschieht in einer Nacht. Es kehren aber nicht alle zurück, und hier muß ich von einer Gemeinheit berichten, wie ich sie sonst nicht unter diesen Völkern traf. Die Alten haben sich besonders früher die Abgeschlossenheit, in der die Jugend draußen lebt, zunutze gemacht und haben den einen oder anderen Burschen aus angesehener Familie in die Ferne oder Sklaverei verkauft. Kommt nun die Nacht der Rückkehr, so wird über die Dachspitze des Hauses, in dem die Mutter des armen Jungen lebt, ein alter Topf gestülpt. Erwacht die Mutter am andern Morgen und sieht das Zeichen, dann weiß sie, daß ihr Sohn nicht wieder heimkehren wird. Sie weint und klagt und sagt: "Niamu hat meinen Sohn getötet."
Das größte Heiligtum des Niamu ist der Wald, in dem er haust. Früher wurde jede Ziege oder jedes Haustier, das ein Blatt am Rande abriß, getötet. Leute, die ihn betraten oder eine Pflanze verletzten, wurden getötet. Heute ist man nicht mehr so streng, man begnügt sich mit Auferlegung einer Zahlung im Werte bis zu einer Kuh. In diesem Walde sind die Maskenkleider verborgen. Ein Anzug besteht immer aus der Hose (Bellei), einem Rock (Ssege) und einem Faserlendenbehang mächtiger Ausdehnung (Dusi). Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß die Masken von den Schmieden, den Ngaibonnai, geschnitzt werden. Weiterhin gehört zur Maskenausstattung Fogue, d, i. ein Büffelhorn mit drei Löchern, über die starke Spinnengewebe gezogen sind. Auf diesem Fogue bläst der Waldgeist Niamu. —— Fernerhin gehört dazu Berrebarri, ein Schüttel- oder Schwinginstrument aus einer Frucht, das gelegentlich der Beschneidung in Bewegung gesetzt wird. Weiter zu erwähnen sind Stäbchen vom Tammiholze, mit denen bei gleicher Gelegenheit die Maskierten um sich schlagen und die treffen, die nicht an den Niamu glauben. Weiterhin ist da der Stab Baturrugue, mit dem die Urumui (entsprechend den Subachen der Zentralmande) geschlagen werden. Trifft sie solch Schlag aus Niamuhand, so sterben diese Vampirgeister. Der Krieg gegen sie ist eine wesentliche Aufgabe der Niamu.
Endlich gehören in den Maskentanz dieser Bünde noch zwei Steine ganz besonderer Art. Der erste ist Kote, ein phallusartiger Stein. Er wurde früher mit Menschenhaut überzogen. Die Fürsten trugen ihn früher zum Zeichen, daß sie die Hauptwürdenträger der Niamu seien, in der Hand, wenn sie im Pompe auftraten. Der zweite Stein war bei
Niamu der Gersse und Niaffui (= Afuta Mangrie) der Tomma im Gebrauche. Er hatte ein Loch und darauf blies der Maskentänzer. Von Niamu wird gesagt, daß er früher sehr viele, allerdings vorsichtigerweise weniger angesehene Leute getötet habe, um mit deren Blut seine Larri und Sale (das sind Heiligtümer) zu beleben und mit ihrer Haut den phallusartigen Kote zu überziehen. —Über den Kote kann ich nähere Auskunft geben. Es ist ein —wie die Gersse selbst sagen — zuweilen in der Erde beim Ackerbau gefundener Gegenstand, ein prähistorischer Rindenstoffklopfer. Das letztere ist natürlich den schnell vergessenden Menschen unbekannt, aber den Kennern solcher Dinge ist solches bald klar. Ich habe einen Kote gesehen. Den zweiten Stein kann ich nicht erklären; da er auch in der Erde gefunden wurde, muß er gleichen Ursprungs sein.Wenden wir nun noch einige Worte auf, um zu sagen, bei welchen Gelegenheiten der Niamu erscheint. Das sind immer Feste. Zunächst einmal Kaguke, das Beschneidungsfest, das immer an einem Sonnabend stattfindet. Am Kaguke kommen Niamumasken aus verschiedensten Gegenden zusammen, um eine große Veranstaltung zu feiern, und ihre Kleider aus Stoff (Jege) sind dann ganz besonders schön. Ferner kommen die Niamu zum Begräbnis, und man sagt, daß, wenn ein "Alter"stirbt, dann der Niamu auch stirbt; aber was das heißt, weiß ich nicht. — Tritt der Maskengeist bei solcher Gelegenheit auf, dann werfen ihm Bundesglieder Kolanüsse in das klappbare Mundwerk. Die männliche Maske dürfen nur Bundesbrüder, die andere auch andere Menschenkinder sehen. —Endlich tritt der Niamu, wie schon erwähnt, auf, um die Urumi, die Vampirgeister, zu verscheuchen.
Ein interessanter Punkt ist zum Schluß noch zu erwähnen, die Frage, ob den männlichen auch weibliche Bünde entsprechen. Erledigen wir zunächst die Frage, ob die Gerssefrauen beschnitten werden.
Das ist im allgemeinen mit "Ja" zu beantworten, allerdings nur ganz im allgemeinen, und außerdem geschieht es oft so spät, daß eine Mutter und ihre fast erwachsene Tochter gemeinsam die Prozedur durchmachen. Manche mag es sich aber auch lange vornehmen und nie dazu kommen. Eines ist hierfür charakteristisch: der gewöhnliche Gruß der Gersse und Tomma besteht darin, daß die beiden sich die rechten Hände reichen und beiderseits dann mit dem Mittelfinger schnipsen. Eine ganz besondere Form haben Gerssefrauen, die beschnitten sind, untereinander. Wenn eine beschnittene Frau in einen Kreis kommt, in dem sie fremd ist oder auch Bescheid weiß, daß sie Schicksalsgenossinnen trifft, streckt sie beide Hände aus. Jede Frau, die auch beschnitten ist, kommt darauf auf sie zu, reicht auch beide Hände, beide ziehen sich aneinander, beide schnipsen
sich mit beiden Händen, jede zieht die Hände der andern an ihre Nase und spricht einige freundliche Worte. Jede beschnittene Frau wechselt mit der ankommenden diesen Gruß, doch ist die Sitte der Beschneidung so selten, daß man ihn fast nie zu Gesicht bekommt.Aus dem Vorkommen dieser Sitte erhellt, daß die beschnittenen Frauen besonders zusammenhalten und auch demnach eine Art Bund bilden, dessen Basis die Beschneidung ist. Aber es wird auch gesagt, daß es einen einflußreichen Bund unter Gersse- und Tommafrauen gibt, der auf den Tommanamen Segele hört. Man sagt ja, man sagt nein. Man sagt auch, daß die Männer die Segele sehr fürchten. Ich glaube das nicht recht. ——
Mir wurde mehrfach mit Ernst von achtbaren Leuten mitgeteilt, daß bei den Waldvölkern die Mädchen, die aus der Beschneidungszeit im Walde in ganz unerwarteter Weise mit einem Kind unter dem Herzen oder im Arm kommen, besonders geachtet und solche kleinen Geschöpfe religiöser Waldbacchanalien besonders geschätzt sind. Ich halte das für sehr wahrscheinlich, wenn ich auch keine besonderen Einzelheiten bieten kann, mit aller Bestimmtheit bestätigen zu können.
Viele zukünftige Reisende werden sich ebenso wie wir über die vielen verschiedenartigen Hausspitzen wundern, die in diesem Lande heimisch sind. Zuweilen ist ein artiges kleines Wimpelspiel von Flechtwerk und Ringen angebracht oder es ragen Pfeile nach oben oder Pfeil und Bogen, und dann ist der Bogen oft gespannt angebracht. Das ist zum größten Teil geistiges Rüstzeug gegen die Matta oder Mata. Eine besondere Art dieser Tomma (Subachen der Mande) sind bei den Malinke bekannt als Kikian, bei Bammana als Gingi (Eule), bei Tomma als Gingi. Es sind Vampirgeister, Menschen, die sich in diesem Falle in große Vögel verwandeln und vom Himmel als solche herunterkommen, um sich auf Bäumen, Befestigungsmauern und Dachspitzen niederzulassen. Und das letztere ist sehr gefürchtet. Die Gingi kommen durch die Dachspitze in das Haus und nehmen von den ihnen überlieferten Opfern Besitz. Und als Schutz gegen solches Eindringen ist dies eigenartige Zierwerk von Pfeil und Bogen, Ringen, Flechtereien angebracht.
Ein Gingi kann nicht über jeden Menschen einfach herfallen. Vielmehr muß ein Verwandter des Opfers ihm gesagt haben: "Da, nimm den!" Solche Ansicht herrscht hinsichtlich jeder Besitzergreifung — so erklärten es die Mande. Ehe man Ziege, Huhn oder Ochsen nehmen
kann, muß der Besitzer gesagt haben: "Nimm es." Das ist eine Glaubenssache, die in bestimmte Besitzgefühle übergegangen ist. Nur Räuber befreien sich davon durch starke Amulette, die sie schützen. Also wenn ein Verwandter dem Gingi-Matta das Opfer überwiesen hat, so dringt er durch die Dachspitze ein und verwandelt die Seele des Opfers in ein Tier, einen Ochsen. Den Ochsen verspeist der Matta dann draußen langsam und behaglich mit seinen Genossen. Nur den Kopf heben sie auf. Nach acht Tagen wird der Mensch krank, er wird matt und schlapp. Wenn die Dorfbewohner das sehen, sagen sie: "Seht, die Matta haben ihn." Dann aber verbrennen die Matta den Kopf des Ochsen, und nun stirbt der Mensch.Was bei den Tomma die Matta sind, sind bei den Gersse die Urumui. Man fürchtet sie sehr. Es werden viele San gegen sie hergestellt. Das bekannteste San (Baschi der Bammana) solcher Art ist bei den Gersse das Ue, ein phallusförmiger schwarzer, aus bestimmter Rinde und Erde hergestellter Gegenstand. Jeden Morgen nimmt der Kenner hiervon ein wenig, mischt es mit Wasser und reibt es um den Hals. Dieses Verfahren heißt Uejenna. Beim Reiben am Halse oder in Krankheitsfällen an irgendeiner andern Stelle des Körpers muß man darauf achten, daß man den Strich von sich aus nach außen fortrichtet, damit ein etwa von einem Urumui beigebrachtes Übel auf einen andern übergeht. Streicht man auf sich zu, so lenkt man die Leiden auf seine Person. Ferner genießt man ein wenig davon und endlich tut man auf die Spitze ein wenig gekaute Kola. Diese Prozedur führt man jeden Dienstag aus. Hergestellt wird das Medikament von alten Gersse, die es besonders gut verstehen; aber nicht nur bei den Gersse ist es bekannt. Diese Ue werden verkauft und wandern bis zum Senegal. Die Malinke nennen es Mosso und halten viel davon. Wenn die Urumui oder Subachen das Medikament am Halse eines Menschen sehen, so sagt man, stürben sie.
Noch einige San der Gersse: Will man einem Frauenzimmer, das einem offenbar mit einem San etwas Böses zugefügt hat, auch etwas Schlimmes antun, so macht man hier ein Bolue, bei den Malinke aber Taffu genanntes Medikament, das bringt man ihr bei und darauf hat sie dann ununterbrochen die Menstruation (Gersse =Njanigumgana). Im Gegenteil weiß man sich die Liebe eines Weibes nicht mit einheimischer Zauberkunst zu erwerben. Man wendet sich an einen Morimu (Marabuten), der das Niebremu (Erdorakel) veranstaltet, und gibt ihm dafür Geschenke an Huhn, Kola, Salz und dergleichen. Darauf praktiziert man etwas von der Erde der Erdorakelstelle in die Speise der Geliebten und darauf wird die sehr verliebt. Auf mehr weltlichem Wege sucht man eine Liebe dadurch zu erobern, daß man das Gachahagonni genannte Instrument (eine Sansa) klimpert. Zeigt trotz entsprechender Vorbedingungen und
redlicher Pflichterfüllung seitens der Ehegatten die Familienmutter keinen Beweis keimender Familienvermehrung, so wendet man sich an eine weise, alte Frau, die mit solchen Dingen Bescheid weiß und im Walde Medikamente sucht, die man zwei- oder dreimal in das Essen der Frau bringt. Darauf wird sie dann schwanger. Zwillinge (Alogaferi) werden mit Freuden begrüßt.In das religiöse Leben spielt auch eine Art Gottesgericht hinein, das bei den Gersse Kirn heißt. Man kocht Palmöl und tut gewisse Ingredenzien hinein. Wenn einer nun Diebstahl oder Raub oder Mord oder gar der Beziehung zu den Urumui angeklagt ist, muß er diesen Kirritrank schlürfen. Dem, der unschuldig ist, schadet es nichts, er bricht ihn wieder aus. Wehe aber dem, der die Tat in Wahrheit beging, der wird sehr krank, und daran erkennt man ihn, oder aber er stirbt auf der Stelle, und dann ist die Sache ohne weiteres entschieden. Der so ertappte Nugomu (Dieb; nu Mensch) zahlt für einen gestohlenen Lendenschurz drei, für wertvollere Sachen bis zu zwei Kühen. Diese Abgaben fallen dem Konami (Dorfchef) zu, der Richterstelle einnimmt. Nupamu(nu Mensch; pamu =töten), der Mörder, wird von der Volksmenge gehascht und getötet.
San kann jeder machen, der es versteht. Man sieht sie hier und da am Pferde, zuweilen am Peretangana (Gersse), am Kreuzwege, fast nie im Hause, meist auf den Termitenhaufen, und auf diesen wie auch stets auf Gräbern findet man Opfergaben. Wenn einer seinen Acker bestellt und auf einen großen Termitenhaufen stößt, so wirft er ein wenig Kola auf den Hügel und sagt: "Wenn ich eine gute Ernte mache, sollst du reichlich haben." Nach der Ernte gilt es allerdings dann sein Wort zu erfüllen und dem Termitenhaufen seinen Reis und andere Erzeugnisse zuteil werden zu lassen. Noch ausgesprochener als dieser Erddienst tritt uns aber bei den Gersse der Totendienst entgegen.
In alter Zeit bestattete man anders als heute. Man machte ein rundes Loch von ziemlicher Tiefe und legte auf den Boden erst ein Fell, darüber eine Matte und zu oberst einen Schurz, auf den der Verstorbene mit ausgestreckten Füßen zu sitzen kam. Über den Leichnam kam wieder ein Schurzkleid und ein Fell, dann eine Holzdecke, die es verhütete, daß die darübergeworfene Erde den Toten berühre. In Seitengräbern (Kanalgräbern) wurden früher und heute nur Fürsten beigesetzt. Gewöhnliche Sterbliche werden heute in Stoffe gehüllt und lang ausgestreckt auf eine Matte gelegt. Sie werden mit warmem Wasser gewaschen. Die Töpfe kommen später auf das Grab. Mit dem Bestatten wartet man, bis alle Familienmitglieder da sind, also bis zum andern Morgen spätestens. In das Grab wirft jeder fünf bis zehn Kolanüsse und sagt dabei ihren Namen. Am gleichen Abend ist dann Umtrunk, Tanz und große Festlichkeit zu
Ehren des Verstorbenen. Die Gersse opfern nicht Gott, sondern dem Nupokko (nu = Mensch, pokko = verstorben), dem Verstorbenen. Die Seele des Nupokko geht zu Njonata. Sie heißt Nang. Ngahikana ist der Traum. Die Nang erscheint dem Überlebenden oft im Ngahikana und sagt ihm Wünsche. Geschieht das, so stellt man vor allen Dingen ein Gemisch von allen möglichen Speisen her und wirft das auf den Kreuzweg. Sonst erfüllt man die geäußerten Wünsche. Im übrigen wird jeder Gersse von allen zu Gastereien bereiteten Speisen ein wenig auf die Gräber seiner Toten tun. Er nennt das Moberaken. Im Skizzenbuch XIV ist gezeichnet, wie ein Gersse seine Kola auf einem Grabe opfernd reibt. —Im übrigen herrscht der weit verbreitete Brauch, daß man Kinder, die bald nach dem Tode des Vaters geboren werden, mit seinem Namen begabt und annimmt, daß in ihnen die Seele des Vaters weiterlebt. Im übrigen soll Gott nach der Ansicht der Gersse die Menschen aus Erde machen, in der vordem andere bestattet wurden. Auch bei den Malinke finden wir ähnlichen Glauben.Bei den Tomma wird der Tote gewaschen, gekleidet und in eine Matte gewickelt. Hier wird nicht nur (wie bei den Gersse) für die Fürsten in der Grabtiefe ein Seitenkanal angelegt, sondern für jeden Toten ein solches Überzimmer, in das die Erde nicht eindringt, geschaffen. Hier hinein wird die lang ausgestreckte Leiche geschoben. Die Familien tauschen Geschenke an Kola aus und Vornehme sollen die Totenfeste durch starken Umtrunk feiern. Der Tote heißt ngowe, die Seele: nsevu, Gott: griollo-galla, der Himmel: griollo. Wo die Seele hingeht, weiß man nicht, aber auch hier werden Grabopfer dargebracht. Den Erben fällt die Hochhaltung der Gräber zu. Die Erbschaft wird aber folgendermaßen geteilt: die Witwen fallen dem jüngeren Bruder des Toten zu und ebenso alles Besitztum des Verstorbenen. Die Kinder werden oft und meist vom Onkel (mütterlicherseits) erzogen, kehren als Erwachsene aber wieder in die Vatersfamilie zurück. -—-Mit dem Totendienst sollen kleine Miniaturmasken, sog. Lavaribana, zusammenhängen, die früher jedermann als Schutzmittel im Kriege bei sich führte, die aber seitdem selten geworden sind. In der Innenseite waren Opfergaben und Zauberingredenzien angebracht.
Bei den Tomma ragt anscheinend noch ein typisches Monument aus der alten Zeit der tieferen Totenverehrung in die Jetztzeit herüber, der Koti Basai genannte Dolmenplatz, den ich in jedem alten Waiddorfe, am größten aber versteckt in Steppe und Wald zwischen den einzelnen Siedlungen gefunden habe. Auch in Konian sind sie häufig, wenn auch unbedeutender. Um einen mit Steinplatten belegten Platz ragen nach außen gebogen die Rand- oder Standplatten empor. Auf dem Koti Basai halten heute die Alten ihre
Sitzungen ab. Sie lehnen sich gegen die Dolmen, doch das Volk meint, hier und da sei ein Toter darunter begraben. Aber ob es wahr ist?Mit Bestimmtheit kann ich aber angeben, daß viele Steinfiguren, die man heute noch bei den Kissi trifft, dem Ahnendienste entspringen. In uralten Zeiten wurden in Kissi, wenn hervorragende Frauen oder Männer starben, Porträts in Stein, Steinfiguren von ihnen hergestellt. Bei der Herstellung achtete man auf die Tätowierung. Diese Powana genannten Steinfiguren wurden nicht mitbegraben, sondern dem ältesten Sohne zur Aufbewahrung anvertraut, und der gab sie wieder seinem Sohne und so weiter. Bei den Kissi wurden die Totenopfer nicht auf den Gräbern wie bei den andern Waldstämmen Nordliberias und auch bei den Mande dargebracht, sondern auf und vor den Steinfiguren.
Das Kapitel des eigentlich Religiösen schließen wir ab mit der Schilderung der Anschauung und Gedanken von Welt und Himmel, die mir ein alter Gersse in behaglicher Plauderstunde zum besten gab. Einzelne Worte darin verstehe ich nicht und waren auch meinem Interpreten nicht übersetzbar. Also: Die Sonne kommt morgens aus dem Horroboladji und geht abends nach Horrotorrobele. "Wie sie vom Abend zum Morgen von einer Seite zur andern kommt, weiß ich nicht." Der Mond kommt aus Njaninjatobeperre. Die Mondsichel, ob abnehmend oder zunehmend, ist Njanitonino, Vollmond Njaninaforrakana. Wie der Wechsel zustande kommt, hat mein alter Berichterstatter nicht überlegt, hat sich auch keine Gedanken darüber gemacht, aber die Mande haben ihm einmal erzählt, daß eine Kurro, eine Katze komme, den Mond zu fressen. Wie das Gewitter entsteht, ist ihm unverständlich, aber daß der Turrokadegi (Donner) mit Benango (dem Blitz) die Benakau (die Donnerkeile) herabschleudert, das ist bedeutsam. Man findet sie (diese alten Steinwerkzeuge) zuweilen im Acker und dann hebt man sie sorgfältig auf und legt sie als San auf das Saatkorn. — Wichtig sind Perregou, Sternschnuppen. Wenn es ein großer Stern war, der dahinfiog, so sagt man: "Das ist ein großer Häuptling, der stirbt." Wenn er bis auf die Erde kommt, so sagt man: "Er starb heute." Wenn er nur ein Stück des Himmels durchschnitt, so sagt man: "Er wird bald sterben."
Damit gab ich alles. Wenn Mande und Konian zunächst einiges, wie z. B. den Kannibalismus, bei den Waldvölkern für religiös erklären, so kann ich das als unrichtig bezeichnen. Was die Gersse in ihren Guele oder Gueledjo (Fabeln) von Sauni (dem Kaninchen) und die Tomma in ihren Perrege (Fabeln) von Sabe (auch Kaninchen) erzählen, soll ganz das gleiche sein, was die Mandingo als Fabelschatz bewahren, und es wird heutzutage sicher nicht als religiös zu bezeichnen sein.
Mbele, das Menschenfleischessen, ist bei den Tomma nicht rehgiös,
aber es bringt auch bei ihnen gewisse Seiten des Innern in so starke Bewegung, daß sie mit Zagen davon erzählen, wie grausig es dabei zugehe. Sie haben es mir aber ganz genau berichtet: Die Tomma essen nur das Fleisch der im Kampfe gefallenen Gegner. Erst zieht man ihnen die Haut ab, dann zerlegt man sie. Einmal wird das Fleisch abgekocht, dann die Brühe aber weggegossen, weil sie so fett ist. Mit neuem Wasser wird das Gericht zu Ende gekocht und dann in ganz kleine Stücke geschnitten. Diese kleinen Stücke werden durch die Gebißpforte sogleich in den Mund geworfen. Man kaut das Menschenfleisch, man beißt es aber nicht mit den Zähnen ab. Anders werden die Füße zubereitet. Sie werden nicht im Gelenk abgetrennt, sondern man schlägt die Schienbeine in der Mitte durch und schneidet hier ab. Die Sohlen der Füße werden alsdann aufgerissen und ordentlich Salz hineingerieben. Alsdann hängt man die Füße in den Rauchfang und läßt sie in der Mitte des Hauses über dem Feuer im Tagai (Räuchertopf) hängen, bis sie gut sind. Männer und Frauen beteiligen sich bei den Tomma in gleicher Weise am Menschenfleischmahle. Die Tomma hatten früher keine Sklaven. Es wurden im Kriege auch keine Gefangenen gemacht. Tötete man im Streite zu viele Feinde, um sie gleich aufessen zu können, so verschenkte man einige Tote an Nachbardörfer und andere räucherte man ein. Diese Sittengruppe ist, wie man sieht, zu praktischen Geistes, um engere Beziehungen zu religiösen Dingen zu haben.a) Ursprung. Die Gersse geben mit aller Bestimmtheit an, früher in einer riesengroßen Stadt gewohnt zu haben, welche sie "Bagana" nennen. Bagana lag nördlich von Kulikorro, woher die Konianke gekommen sein sollen. Als Namen für das Land um Bagana glaube ich auch Kurungo gehört zu haben. Doch kann das ein Irrtum sein. Aus Bagana sollen sie vertrieben sein von Morige Sirani oder Moribe Sirani. Damals hießen die Gersse nicht Gersse, sondern Sanjogo oder Sonjogo. Von Bagana wurden sie weit nach Süden in den Tukotto, in den Wald verdrängt.
b) Tannä. Ich erhielt zwei Darlegungen über die Tannä oder,, Dege" der Gersse, und zwar eine in Uenso und eine in Boda oder Bogola. Jede der beiden Bevölkerungen bestreitet die Richtigkeit der andern.
Die Uensoleute erzählen, daß einmal ein großer Krieg alle Gersse vereinigt hatte, und daß es ihnen sehr schlecht ging. Sie wurden alle
in die Flucht geschlagen. Ein Gersse, namens Duala, sah auf der Flucht am Fege einen Bussard, einen Gere, aus einer Höhle aufsteigen und wurde so diesen Schlupfwinkel gewahr. Er kroch schnell hinein. Im Innern gewahrte er zu seinem Entsetzen eine mächtige Tummu, eine Boaschlange. Er kauerte sich mit gekreuzten Armen vor ihr nieder, und sie tat ihm nichts. So konnte er in der Höhle verweilen, bis alle Gefahr vorüber war, dann kam er heraus. Inzwischen waren alle Gersse außer ihm niedergemetzelt worden. Nur Duala blieb als Stammvater der Gersse am Leben. Aus Dankbarkeit erklärte er, daß Gere, der Bussard, der ihm den Schlupfwinkel gezeigt hatte, und Tummu, die Boa, die ihm nichts getan hatte, in Zukunft die Dege der Gersse sein sollten. Das Volk selbst aber erhielt nach dem Gere oder Gerre seinen Namen.Die Boolaleute erzählen, daß einer der Saniogo (Stammväter der Gersse), die aus Bagana vertrieben wurden, Do Geresse oder Djo Gereserri geheißen haben. (Do oder Djo heißt Kamerad.) Auf der Flucht sah er seitwärts vom Wege aus einer Höhle eine Toa-antilope (bei Malinke Kungani genannt) herausspringen und wurde so auf diesen Schlupfwinkel aufmerksam. Er kroch in die Höhle hinein und fand darin eine Tummu, eine Boa (Schlange bei Gersse =Kale; die Boa heißt bei Malinke Tutu, bei Bammana Dangala). Die Kale Tummu tat dem Flüchtling aber nichts, und er konnte in der Höhle bleiben, bis alle Gefahr vorüber war. Die andern Saniogo wurden getötet. Als die Verfolger an die Höhle kamen, sagten sie: "Dies ist der Aufenthalt einer Toa, man sieht es an den Fußspuren. Es kann kein Mensch darin sein." So wurde er gerettet und der Stammvater der Gersse. Toa und Tummu wurden aber so die Dege der Gersse, die in den großen Wald nach Süden flohen.
Des weiteren erfuhr ich noch einen Teil einer Ahnenreihe der herrschenden Familie in Gonongalai. Sie sagten, das älteste Gerssedorf wäre Gorla, zwischen Boola und Uensa. Da wäre der erste Markt (= Logo) abgehalten worden. Diesen ersten Markt richtete eine Verwandte Balfrus ein. Der Name dieser Verwandten war Dia, und so nennt man den heute dort noch am Donnerstag abgehaltenen Markt Dialogo. Die Hauptglieder dieser alten Familie, die das Vorrecht im Uensogebiet hat, sind etwa folgende:
1. Balfu (floh aus Bagana).
2. Diaboba oder Diagoba.
3. Diagomara.
4. Gere oder Gele.
5. Gosso, der heute noch in Gonangalai lebt. Die Leute geben selbst an, daß das nur die bemerkenswertesten Familienführer, aber bei weitem nicht die ganze Ahnenreihe des Familienoberhauptes darstelle.
Dieser Teil der Tommabevölkerung zerfällt in fünf verschiedene "Engassi" (=Diamu im Norden, Stämme), nämlich in 1. Kammara 2. Falega, 3. Massa, 4. Maua und 5. Mbere oder Mbera. Während einige Kammara, trotzdem sie von einigen als älteste Einwanderer bezeichnet werden, in der Masse des Volkes aufgegangen oder nach Süden gedrängt zu sein scheinen, und somit nicht viel von ihnen zu erfahren ist, konnte ich über die andern Stämme einige wichtige Notizen erzielen, die sich auf das Tannä beziehen.
a) Das Ngiena (=Tannä). Falega, der Urahn des Falegastammes, unternahm eines Tages einen Krieg. Der Krieg verlief unglücklich, und die Leute Falegas wurden alle getötet. Falega floh und fand keinen andern Zufluchtsort als eine Ziegenhorde. Er versteckte sich unter den Ziegen. Die Feinde verfolgten Falega und riefen: "Seht! Er ist zwischen die Ziegen gelaufen." Nach einiger Zeit löste sich ein Bock von der Herde ab und lief von dannen. Die Feinde Falegas sagten: "Seht, da läuft Falega hin", und stürzten hinter dem Ziegenbock her. Falega fand sich so von seinen Verfolgern unbeobachtet und hatte Gelegenheit, sich nach anderer Richtung zu retten. Aus Dankbarkeit und zur Erinnerung an die Errettung erklärte er, daß niemals einer seiner Nachkommen je Ziegenfleisch essen oder eine Ziege töten dürfe. So ward die Ziege das Ngiena der Falega.
b) Das Ngiena der Massa. Massa, der Urahne des Massastammes, ging einmal mit seiner Frau, die ein kleines Kind hatte, auf den Acker zur Arbeit. Sie legten das kleine Kind an einem Baume nieder und entfernten sich, um die Arbeit zu fördern. Als das Kind allein war, kam eine große Schlange zu ihm gekrochen. Das Kind, das nicht wußte, daß das Tier gefährlich war, faßte die Schlange beim Schwanze. Die Schlange wand sich um den Arm des Kindes. Das Kind lachte. Die Schlange kroch ein wenig fort, um das Kind herum und ließ sich auf der andern Seite greifen. Das Spiel wiederholte sich und begann von neuem. Die Frau horchte bei der Arbeit auf und sagte: "Was ist das? Das Kind lacht. Es muß einen Spielkameraden gefunden haben." Die Frau schlich mit dem Mann zu dem Gebüsch, und sie schauten vorsichtig hinüber. Sie sahen, wie das Kind mit der Schlange spielte, sie griff, sich umwinden ließ und scherzte. Vater und Mutter hatten solche Angst, das Tier möchte ihr Kind beißen, daß sie nicht näher zu treten wagten, und so sahen sie bis zum Sonnenuntergange zu, ohne sich zu bewegen. Als die Sonne unterging, schlüpfte die Schlange fort. Die Eltern holten das Kind und der Vater
erhob zur Erinnerung an dieses Ereignis die Schlange zum Ngiena der Massa.c) Das Ngiena der Maua. Gagaragassi, der Stammvater der Maua, lebte in der Landschaft Gankuna (westlich von Konian). Eines Tages war er mit Pfeil und Bogen auf der Jagd. Er sah sich nach einer Beute um. Er sah eine Dopa (eine Antilope) vor sich im Gebüsch aufspringen. Sogleich folgte er ihr. Er folgte ihr lange Zeit. Er legte den Pfeil auf den Bogen und wollte schießen. Die Antilope wandte sich jedoch um und sagte zu dem Jäger: "Gagaragassi, töte mich nicht. Eines Tages werden deine Nachkommen eine große Familie darstellen, wenn du mich verschonst und nicht tötest." Der Jäger sagte: "Ich werde dir nichts tun; du kannst ungeschädigt von dannen ziehen." Die Antilope lief von dannen. Gagaragassi erhob die Dopa zum Ngiena des Mauastammes. Die Maua hatten viele Söhne und gewannen mächtig an Ansehen.
d) Das Ngiena der Mbere oder Mbera. Mbere, der Urahn des Stammes, führte eines Tages Krieg. Er hatte kein Glück. Seine Leute wurden zum größten Teil durch die Pfeile der Feinde erschossen. Er war fast allein in der Stadt und wußte nicht, was zu tun sei, denn er sah voraus, daß die Feinde am andern Tage eindringen und morden würden. In der Nacht kamen jedoch die Ratten (Ninaji) und fraßen die Sallena (Zaubermittel, Baschi der Bammana) auf, und knapperten die Bogensehnen der Belagerer durch. Als die Feinde das gewahr wurden, befiel sie große Angst. Sie flohen alsogleich von dannen und überließen die Stadt Mbere. Als Mbere am andern Morgen erwachte, sah er, daß die Belagerer abgezogen waren. Er war gerettet, und er und seine Nachkommen ernannten deswegen die Ratte zum Ngiena des Mberestammes.
Sehr zu beachten ist, daß die Engassi nicht mit den Beni verwechselt werden dürfen, und daß Engassi und Beni verschiedene und gleiche Ngiena haben können. Engassi sind Stämme, die durcheinandergewürfelt wurden, Beni Familien, die exogamisch leben.
e) Hierauf mögen die wenigen Angaben folgen, die ich über die Herrscher des oben näher bezeichneten Landstriches erhielt.
I. Kessuelle Kone war der erste Einwanderer in das Tommagebiet. Er entstammt, wie schon aus dem Namen hervorgeht, den Kammara und war ein Djemu, im Balagebiet heimisch. Dahin war er aus Konia gekommen.
2. Sarra Mollo oder Morro folgte ihm. Er scheint auch ein Kammara gewesen zu sein. — Die Nachkommen dieses Sarra Morro sollen heute noch weiter südlich im Tommalande wohnen.
Die nächsten Herrscher sind unbekannt. Die Kammara verschwinden jedenfalls mit Sarra Morro aus dem Gedächtnis des Volkes, und dafür erscheint ein anderer Stamm von Machthabern.
3. Boggi Falega führte die Falega von Mussadugu her aus dem Norden in das uns interessierende Gebiet. Die Kammara scheinen damit als Herrscher verdrängt zu werden.
4. Die nächsten Nachkommen der ersten Falega sind unbekannt. Das volle Interesse des historischen Gedächtnisses nimmt erst wieder Daurunia, der das Gebiet von Dandandi bis Severa oder Sebela und weit darüber hinaus energisch regierte, ein. Er scheint den kriegerischen Geist der nördlichen Tomma durch manchen glücklich geführten Kriegszug gewaltig geschürt und genährt zu haben. Dem Berichte der alten Leute zufolge war diese Glanzzeit etwa vor einem halben bis einem viertel Jahrhundert und wurden in dieser Periode mehr Gersse, Konianke, Gankunanke und feindliche Tomma getötet und verspeist als je zuvor. Nach ihm zerfiel der aufgeregte Geist in Zersplitterung, und es trat eine allgemeine Anfeindung ein. Nur Gumbaela und Dandando hielten treu zueinander.
5. Djogueleki und 6. Mirrssuba waren nachgeborene Brüder, der Stolz der Nordtomma, aber der heute noch regierende Mirrissuba ist ein geradezu trauriger Geselle.