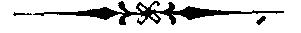Revision und Reorganisation.
Bern. Max Fiala's Buchhandlung (Otto Kaeser). 1882.
Rectoratsrede, gehalten bei Anlass der jährlichen Stiftungsfeier der Berner-Universität, 12. November 1881.
"Pflüget neu, säet nicht unter die Dornen."
Die Berner-Hochschule feiert heute die 47ste Wiederkehr jenes Tages, an welchem sie gestiftet wurde, nicht allein um, an Stelle der ältern Academie, den Wissenschaften eine würdige und den modernen Anforderungen entsprechende Stätte zu bereiten, sondern wesentlich auch, um dem Bernischen Volke, das sich in jenen Tagen kraftvoll aus dem politischen Schlummer der unmittelbar vorangehenden Zeit erhoben hatte, Männer zu erziehen, die im Stande seien, die Grundsätze der wiedererwachten Demokratie, welche damals noch einem principiellen Widerstand in grossen Kreisen begegnete, — durchzuführen und dauernd am Leben zu erhalten.
Die bernische Universität hat diese Aufgabe gelöst.
Die Demokratie — wie sie einem republikanisch organisirten Volke natürlich ist — steht festbegründet auf diesem schwerbeweglichen burgundischen Boden, dergestalt eingewurzelt, dass schon die zweite Generation, welche diese Hochschule herangebildet hat, es wagen durfte, auch mit der autoritären Anschauung von links
 zu brechen und den Schwerpunkt des Staates, die Entscheidung
der wichtigsten Fragen und Geschicke des
Landes, wieder in das gesammte Volk selbst zu verlegen,
dahin, wo er in der ältesten Verfassungsperiode gelegen
hatte. 1)
zu brechen und den Schwerpunkt des Staates, die Entscheidung
der wichtigsten Fragen und Geschicke des
Landes, wieder in das gesammte Volk selbst zu verlegen,
dahin, wo er in der ältesten Verfassungsperiode gelegen
hatte. 1)
Die bernische Universität hat auch diejenige Staatsverfassung des Landes vorbereitet, die gegenwärtig noch zu Recht besteht und in mehreren ihrer besten Bestimmungen der Ersten Eidgenössischen Bundesverfassung zum Muster diente.
Sie hat überhaupt in Bälde und mit klarem Blicke die höhere Aufgabe erfasst, auch dem Eidgenössischen. Geiste zum Durchbruch zu verhelfen und in allen ihren bessern Stunden und Männern hat ihr stets das grössere Ziel vorgeschwebt, eine Eidgenössische Hochschule im geistigen Sinne des Wortes zu werden — eingedenk der Anweisung eines alten Berner-Staatschronisten, welcher den tiefwahren Ausspruch thut: «Der Bär müsse immer zuerst anbeissen in der Eidgenossenschaft», dann folgen. auch die andern Wappenthiere nach.
Ich folgere aus dieser Stellung der Universität zum gesammten Leben des Bernischen und Eidgenössischen Volkes die Berechtigung, an ihrem Jahresfeste vor einem hochgebildeten Kreise von Männern und Frauen aus allen Theilen der Eidgenossenschaft und von edeln Freunden und «Zugewandten» derselben, ein Thema in academischer Form zu behandeln, das einen unmittelbaren Bezug auf Staatsverhältnisse der Gegenwart besitzt.
Das «academische» hat zwar mitunter, wo es sich um politische Tagesfragen handelt, einen gewissen an das «doctrinäre» anstreifenden Nebenbegriff und der Beruf der Professoren bringt es allerdings mit sich, dass sie geneigt sind, den Lehrstuhl mit der Kanzel zu verwechseln und dogmatische Wahrheit zu verkünden, die in der Politik nicht besteht.
Andrerseits ist es doch auch belehrend, bedeutende Tagesfragen, bevor sie in das brausende Meer der politischen Agitation hinausgeschleudert werden, in einem kleineren Kreise, ruhig und nach ihrer historischen Entwicklungsgeschichte zu prüfen.
Denn das bleibt doch allgemein wahr, was ein angesehener Kirchenhistoriker in der Lebensgeschichte eines mittelalterlichen Heiligen, in Rücksicht auf sein Thema sagt: «Keiner versteht die Gegenwart und kann wahrhaft selbstthätig in ihre Entwicklung eingreifen, der nicht zuerst durch den stillen vertrauten Umgang mit der historia, vitae magistra, dazu sich vorbereitet hat.»
Und lassen Sie mich gleich noch hinzufügen: Alles wahre geistige Leben eines Volkes und jeder grosse Gedanke, der in dasselbe hineintritt, geht doch im Grunde immer nur von einzelnen Menschen aus.
Er entsteht, aus dem Schosse der ewigen Wahrheit hergeleitet, in einem individuellen Geiste, versucht seine
Flügel zuerst in einem kleineren, berufenen Kreise, findet Anklang, Boden, Wachsthum und Läuterung daselbst, tritt dann erst gekräftigt hinaus in das weitere Volksbewusstsein,. wird durch Kampf und Widerstand hindurch Eigenthum und Geschichte eines besonderen Volkes und zuletzt Schatzgut der Menschheit.
Die Ideen, die nicht diesen Ursprung haben, sondern von vornherein aus einem Conglomerat vielstimmiger Tagesmeinungen bestehen, haben kein dauerndes Leben, es fehlt ihnen gewissermassen die Vertiefung, die Originalität und Genialität, die den Gedanken des Menschen allein dauernde Lebenskraft durch alle Zeiten und Stürme hindurch einflösst und die nicht darin besteht, dass etwas neu und unerhört ist, sondern dass es vollkommen empfunden und innerlich wahrhaft ist, nicht bios angelernt und nachgesprochen.
Das ist auch die fortdauernde Berechtigung einer gewissen Aristokratie, selbst in einem demokratischen Volksleben wie das unsere.
Es muss Kreise geben, die die Fragen, von denen das staatliche Leben abhängt, tiefer zu erfassen und gründlicher für Alle zu verarbeiten und vorzubereiten im Stande und in der Lage sind, als dies nachmals bei ihrer Discussion vor dem gesammten Volke geschieht, welche nothgedrungen stets ein wenig mit der Breitaxt arbeitet.
Das sind, ohne Verfassung und besondere Wahlsysteme, die natürlichen Führer des Volks, die auch thatsächlich nie fehlen und, wenn sie nicht egoistisch sind, stets Anerkennung finden. Und einen andern Rechtsboden hat im Grunde auch die historische Aristokratie in der Eidgenossenschaft niemals gehabt.
Wenn wir nun von diesem Standpunkte aus einen Blick in die Eidgenössische Verfassungsgeschichte thun wollen, so muss diese Betrachtung mit dem heutzutage sehr trivialen Satze beginnen, dass dies eine Entwicklungsgeschichte ist, die bei einem Volke, ziemlich genau, so wie bei einem einzelnen Menschen, durch vielerlei rückläufige Bewegungen, Irrthum und Rückkehr zu seinem eigentlichen und bessern Selbst hindurchgeht.
Die historische Auffassung von der allmäligen Entwicklung eines Volkes, wobei es blos fleissig in den sogenannten «Spiegel der Vergangenheit» zu blicken und vor einstmals gemachten und hart gebüssten Fehlern sich zu hüten hat, ist jetzt so allgemein geworden und dabei wirklich ein so unfehlbares Recept politischer Weisheit, dass man sich im Ganzen nur wundert, wie wenig wirksam es ist und dass die Geschichte auch bei uns noch immer eines der Bücher ist, die Jedermann rühmt und die nur Wenige gelesen haben.
Der Fehler liegt aber doch nicht allein an der mangelhaften Kenntniss der Geschichte, sondern eben auch daran, dass ein Volk doch nicht ein Individuum ist, mit dem Selbstbewusstsein und der Erinnerungsfähigkeit eines solchen.
Sondern ein complicirtes und sich beständig in seinen einzelnen Bestandtheilen auswechselndes Wesen, in dem die Erinnerung an begangene Fehler, die bei dem einzelnen Menschen natürlich ist —(da er ja sehr wohl weiss, dass und wo er gefehlt hat und wo er die eigentliche Lebensarbeit wieder aufnehmen muss) — künstlich erhalten, durch berufene Hände von einer Generation zur andern überliefert und vor Vergessenheit oder falscher Auffassung geschützt werden muss.
Ganze Lebensperioden eines Volkes können dabei eintreten, in denen ihm seine Lebensaufgabe völlig unbekannt oder unverständlich ist, oder wo es, durch eine blosse Art von Instinct geleitet, auf dunkeln Abwegen schmerzlich nach dem Rechten sucht. Und wenn wir heute in einem der glücklichsten Abschnitte unserer Geschichte leben, so ist dies auch weit weniger unser Verdienst, als dasjenige der allmälig dahinsterbenden Generation von Männern, welche die Eidgenossenschaft von 1848 aus schweren Kämpfen heraus, nach ältesten und besten Mustern neu gegründet haben.
Für uns ist es blos eine dringende Aufforderung, den Schatz dieser Errungenschaften treu zu bewahren und weiter zu reichen. Denn darnach werden wir einst gerichtet werden. Das klare Bewusstsein der geschichtlichen Thatsachen, die sich auf dem Boden, auf dem wir jetzt leben, vollzogen haben, ist Sache der jeweiligen schweizerischen Staatsmänner und Volksvertreter, die diesen Namen verdienen.
Und der Herd, auf dem dieses ewige Licht stets unterhalten wird, unbeirrt von den Windrichtungen des Tages mit ruhiger Flamme weiter brennt und alle Gemüther, nicht blos die der aufstrebenden Jugend, erwärmt und erleuchtet, das sind die Universitäten des Landes.
Dafür haben wir auch eigene Universitäten.
Wäre das nicht, das blosse Handwerksgeheimniss aller sieben freien Künste liesse sich allfällig auch anderwärts erlernen.
Die ältere Eidgenossenschaft bis 1798, auf welche die moderne wie ein Pfropfreis auf einen alten, nicht mehr fruchtbringenden Stamm aufgesetzt ist, war kein Staatswesen mit einer bestimmten Verfassung, wie wir uns ein solches heute vorstellen. Sondern ursprünglich eine blosse Vereinigung zu begränzten Zwecken innerhalb eines Staats — wie es zur Zeit ihrer Entstehung noch verschiedene ähnliche Bundesgenossenschaften gab, von denen sich jedoch keine andere zu einem eigentlichen Bundesstaate ausgebildet hat. —
Wir dürften vielleicht sogar die Vermuthung aufstellen, dass die ursprünglichsten Eidgenössischen Verbindungen diesen staatsrechtlichen — nicht völkerrechtlichen — Charakter und ihre gewissermassen provisorische Natur deutlicher, als uns jetzt lieb sein würde, an der Stirne getragen haben.
Unzweifelhaft wenigstens haben vor dem 1. August 1291 schon Verbindungen zwischen den Kernländern des Eidgenössischen Bundes bestanden, die jetzt ihrem genauen Inhalte und Wortlaute nach unbekannt sind, und der Fall ist keineswegs undenkbar, dass solche auch in schriftlicher Ausfertigung vorlagen. 1)
Es sind bekanntlich auch mehrere der jetzt bestehenden Eidgenössischen Bundesbriefe nicht mehr die
ursprünglichen, sondern nach der Befestigung der Eidgenössischen. Verhältnisse ausgetauschte, mit Weglassung der durch die Zeit erledigten ursprünglichen Bestimmungen oder Vorbehalte. (Vgl. bes. E. A. I, pag. 17, 263, 278.)
Die alte Zeit ging in solchen Dingen überhaupt von einem etwas anderen Gesichtspunkte aus, als die moderne.
Sie betrachtete Brief und Siegel als gefährliche Instrumente, so lange sie existirten, die man nicht etwa blos um eines «historischen Interesse's» willen conserviren dürfe, sondern die als Dinge von lebendiger, fast selbstständiger Kraft, immer wieder aufleben und sich geltend machen könnten. —
Es war vielfach geradezu Staatspraxis, Actenstücke, die Streit veranlasst hatten, nach der Schlichtung oder sonstigen Erledigung zu vernichten.
Dergestalt, dass die Eidgenossen z. B. 1415 bei der Einnahme des Stein's von Baden, in dem sich die vorderösterreichischen Urkundensammlungen befanden, die für sie nachtheiligen Documente verbrannten, bevor der Rest an die österreichischen Archive ausgeliefert wurde, wo er sich noch befindet. 1)
Wenn indess auch in Folge dieser mehr praktischen als gelehrten Denkungsart unserer Vorväter manche Theile der ursprünglichen Geschichte unseres Landes bei näherer Besichtigung einiges Problematische behalten, so geht diess nach andern Richtungen hin, und. steht doch der Charakter der ursprünglichen Eidgenossenschaft als einer staatsrechtlichen Verbindung innerhalb des allgemeinen Deutschen Reiches fest, die in dieser Weise factisch bis zu dem Schiedsspruch des Herzogs Lodovico Maria Sforza (vom 22. September 1499), den man gewöhnlich den Frieden von Basel nennt, theoretisch bis zum Westfälischen Frieden (24. October 1648) dauerte.

Selbst später noch, im Jahr 1650, weigerte sich die kaiserliche Kanzlei zu Wien, die altherkömmliche Anrede «Liebe und Getreue» auf Wunsch einer Eidgenössischen Gesandtschaft, die sich zu diesem Zwecke nach Wien begab und vorstellig machte, dass in einer solchen Anrede nach Ansicht der Franzosen und Venezianer «eine Subjection und Unterwürfigkeit» liege, in «Liebe und Besondere» abzuändern, und erst seit 1688 wurden wir vom Deutschen Reiche als «Besonders Liebe» angeredet, was wir denn auch jederzeit gerne und ohne Besorgniss für unsere Selbstständigkeit bleiben wollen. —
Auch der officielle Titel der Verbindung hiess in der älteren Zeit niemals «Schweizerische Eidgenossenschaft», sondern der «alte grosse Bund in oberdeutschen Landen, les Cantons de la vieille ligue de la haute Allemagne, partes magnae ligae veteris Alemanniae altae.»
So wurde sie von den fremden Mächten, beispielsweise von Frankreich, in den älteren Verträgen titulirt. 1)
Das Wort «Eidgenossenschaft» bedeutete nichts anderes als den staatsrechtlichen Begriff einer auf eidlicher Bekräftigung beruhenden Bundesgenossenschaft und war keineswegs, wie jetzt, der Eigenname eines Staats.
Ebenso gab es keinerlei Eidgenössisches Wappen auf Thoren, Fahnen, oder Münzen. Sondern das weisse
Kreuz war blos ein öfter, aber nicht ausschliesslich gebrauchtes Erkennungszeichen im Feld 1) (das auch schon in. der Schlacht bei Laupen ohne Eidgenossenschaft vorkommt), die Münzen und Stadtthore aber trugen das. deutsche Reichswappen.
Sie können dies heute noch mit eigenen Augen erblicken. Die sogenannte Neubrücke in unserer nächsten. Nähe, die in ihrer jetzigen Form in der Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut wurde, trägt an beiden Eingängen noch jetzt den Reichsadler über dem Bären. — Wie denn auch die Berner überhaupt noch mehr als 200 Jahre nach ihrem Eintritt in den Bund ihre Stadtverfassung und sonstige Privilegienbriefe regelmässig allen deutschen Kaisern., zuletzt Ferdinand I. 1559, zur Bestätigung vorzulegen pflegten.
Diese Verbindung unter den Eidgenossen, mit ursprünglich nicht völkerrechtlichem Charakter, war auch formell genommen keine sehr enge. Die Bundesbriefe. sind sämmtlich (mit Ausnahme der jetzt bekannten von Zug und Zürich, die nicht die ursprünglichen sind) verschiedenartigen Wortlautes und Inhaltes. Das Uebereinstimmende darin ist nur die Verpflichtung zu gegenseitiger Hülfe und der Ausschluss der Fehde durch Einrichtung eines schiedsrichterlichen Rechtsgangs. Einzig die drei Länder hatten von 1291 ab einen gemeinsamen.
 Brief 1) mit engeren, fast bundesstaatsrechtlichen Bestimmungen,
beispielsweise den Grundlinien eines gemeinsamen
Criminalrechts, wie sie noch heute in der
Eidgenössischen Verfassung fehlen. Auch der dem Datum
nach folgende Brief von Luzern enthielt noch das positive
Verbot für die Stadt, andere politische Verbindungen
ohne Wissen und Willen der Eidgenossen einzugehen.
Brief 1) mit engeren, fast bundesstaatsrechtlichen Bestimmungen,
beispielsweise den Grundlinien eines gemeinsamen
Criminalrechts, wie sie noch heute in der
Eidgenössischen Verfassung fehlen. Auch der dem Datum
nach folgende Brief von Luzern enthielt noch das positive
Verbot für die Stadt, andere politische Verbindungen
ohne Wissen und Willen der Eidgenossen einzugehen.
Dagegen behielt sich bereits der Bürgermeister Brun von Zürich in seinem Bundesbrief von 1351 andere Verbindungen noch neben der Eidgenössischen vor und ebenso bestimmt war der diesfällige Vorbehalt von Bern zu Gunsten seiner selbstständigen Politik, so dass der Eintritt dieser Glieder, der auf der Einen Seite der Eidg. Verbindung eine viel grössere Bedeutung verlieh, für ihren inneren Zusammenschluss nicht günstig gewesen ist. Jedenfalls liegt hier der Punkt, wo der lockere, staatenbündische, Charakter des werdenden Staates beginnt und es ist wohl gegenwärtig wenig mehr im Bewusstsein aller Eidgenossen, dass die Entscheidungsschlacht unserer Geschichte, deren 500jähriges Gedächtniss wir 1886 feiern und ohne die wir kaum bestehen würden, ohne Bern und thatsächlich auch ohne Zürich geschlagen worden ist. 2)
Während Bern sich noch längere Zeit mit seinen ältern Verbündeten Solothurn und Freiburg enger verbunden fühlte, als mit den Waldstätten (vgl. E. A. II, 701), schwankte der thatsächliche Vorort der alten Eidgenossenschaft, Zürich, mehrmals bedenklich zwischen der Verbindung mit der Eidgenossenschaft und derjenigen mit ihrem vieljährigen Erbfeinde.
Im Zürcher Archiv liegt noch jetzt der Bundesbrief des Bürgermeisters Rudolf Brun mit Oesterreich gegen die Eidgenossenschaft, vom 4. August 1350, fix und fertig bis zum Einhängen der Siegel (E. A. I, pag. 271). Ebenso der Schiedsspruch der Königin Agnes von Ungarn, vom 12. October 1351, zu Gunsten der österreichischen Ansprüche auf Luzern und innerhalb der Waldstätte, nebst der Formel der Annahms- und Vollziehungsversicherung von Zürich, die glücklicherweise von den andern Ständen nicht genehmigt worden ist (E. A. I, pag. 32), und nur wenige Jahre darauf, 18. August 1355, schloss Zürich allein den sehr ungünstigen Regensburger Frieden, den die Eidgenossen (nach Eidg. Abschiede I, 40) «annehmen mussten, um nicht von der verbündeten Macht Oesterreichs und Zürichs erdrückt zu werden 1). » 1356 folgte diesem Frieden ein
Bündniss Zürichs mit Oesterreich zur Aufrechthaltung seines Besitzstandes, und Bürgermeister Brun selbst starb als österreichischer Rath und Pensionär. Ein späterer Zürcher Bürgermeister, Rudolf Schön, schloss mit Leopold IV., dem Sohn des bei Sempach gefallenen Fürsten, am 4. Juli 1393 einen geheimgehaltenen Vertrag, durch den Zurich sich verpflichtete, in dem nächsten Kriege. Oesterreichs gegen die Eidgenossen neutral zu bleiben, und es gelang nur durch die Erregung eines Auflaufes unter dem gemeinen Volke der Stadt Zürich, diese gefährliche Verbindung zu beseitigen, deren Erinnerung noch heute der sog. Sempacherbrief, die erste eidgenössische Kriegsordnung, bewahrt, die daraufhin erlassen wurde. 1) Ein dritter Bürgermeister, Rudolf Stüssi, schloss dann den 17. Juni 1442 den ewigen Bund mit Friedrich III. und dem Hause Oesterreich, welcher dem Wesen nach eine Erneuerung des ursprünglichen Brun'schen Gedankens und ein förmlicher Austritt Zürichs aus der Eidgenossenschaft gewesen ist. (E. A.. II, 788-801.)
Die ersten Vorsteher der alten Eidgenossenschaft und die städtische Aristokratie blieben somit bis zu Ende des alten Zürichkriegs, 1450, ein volles Jahrhundert nach dem Eintritt Zürichs in den Bund, sehr unentschieden in ihrer politischen Haltung, und es ist wohl zumeist der Stimmung der untern Volksklassen zu verdanken (obwohl dieselben des Oefteren durch geheime Artikel
über den wirklichen Sinn solcher Verträge getäuscht wurden), wenn die Verbindung mit der Eidgenossenschaft immer wieder das Uebergewicht behielt. Ganz das Nämliche war übrigens auch in Luzern der Fall.
Diese lockere Art der Verbindung zwischen den alten Eidgenossen, die wir uns nicht immer mehr richtig vorstellen und die ganz von dem Charakter und Geist der jeweiligen Bevölkerung abhing, erlaubte es ebenfalls, dass ein rechtmässiger Verbündeter, Weggis, das gleichzeitig mit Luzern in den Bund eintrat und in einem förmlichen Briefe von 1359, 31. August, noch als Bundesglied anerkannt worden war, trotz dieses Briefes schon 21 Jahre später von seinem Mitverbündeten Luzern zum Unterthan herabgedrückt und von den Eidgenossen nicht aufrechtgehalten wurde. 1) Andere älteste Eidgenossen gehörten zu der Verbindung umgekehrt factisch, ohne jemals als Verbündete gezählt zu werden. So Gersau, das zwar auch den gleichen Bundesbrief wie Weggis hatte, niemals aber als eidgenössischer Stand aufgeführt worden ist, sondern einfach thatsächlich den Mahnungen Luzerns und der Waldstätte in die eidgenössischen Kriege 2) folgte und im Uebrigen eine vollständige Republik bis schliesslich zum 22. Juli 1817 blieb, an dem es erst definitiv Schwyz einverleibt wurde. Noch sonderbarer waren die Verhältnisse der geistlichen Fürsten von Einsiedeln und Engelberg, die gar keinen Bundesvertrag hatten, sondern als
territoriale Enclaven eidgenössischer Stände einfach zur denselben gezählt wurden, obwohl sie mit Schwyz resp. Nidwalden in beständigem Streite lagen und der Abt von Engelberg beispielsweise noch im Jahre 1413 mit der Behauptung auftrat, «er habe Briefe von vier Kaisern und sechs Päpsten, dass keine irdische oder weltliche Person über das Gotteshaus und das Ihrige etwas zu befehlen habe.» 1) (E. A. I, 134.)
Auch die anerkannten Glieder der ältern Eidgenossenschaft standen nicht alle mit einander in Verbindung.. Blos die Waldstätte allein hatten direkte Bundesbriefe mit allen andern. Zürich war bis 1423 mit Bern in keinerlei Bundesverhältniss. Luzern niemals mit Glarus, Zug nicht mit Bern und Glarus. Glarus nur mit den Waldstätten und Zürich. Bern anfänglich blos mit den Waldstätten allein, später noch mit Zürich (1423), Luzern (1421), mit Zug und Glarus aber nie.
Erst die seit 1480 beitretenden Orte wurden zur Verhütung von Sonderbünden, wie das damalige Burgrecht der Städte von 1477 einer war, gemeinsam aufgenommen. Aber sie erhielten deshalb keineswegs gleiche Rechte wie die ältern Orte, sondern traten in eine bundesrechtliche Stellung, die ursprünglich derjenigen der sogenannten «Zugewandten» ziemlich ähnlich war. Der Eid, den man den nächstaufgenommenen, Freiburg und Solothurn, schwor, die ihr 400jähriges Jubiläum in diesem Jahre feiern, war nicht der gemeineidgenössische, die
Bundeshülfe, die man ihnen versprach, eine ausdrücklich auf einen gewissen Umkreis beschränkte und auch sonst keineswegs unbedingte, und noch zwei Jahre nach der Aufnahme, im Juni 1483, beschloss die Tagsatzung ausdrücklich, sie nicht zu den Tagsatzungen einzuladen, ausser in Fällen, die sie selbst betreffen, also genau so wie die minderberechtigten Zugewandten. Ja Uri drohte mit dem Austritt aus dein Bund, wenn dagegen gehandelt werde (E. A. III, 154). Bern hingegen schloss mit Freiburg einen förmlichen Sondervortrag ab, wonach der alte Bund zwischen beiden Städten trotz der nunmehrigen eidgenössischen Verbindung in Kraft erhalten werden und dem eidgenössischen Bündnisse «luter vorgehen» solle (E. A. III, 701). Erst allmählig und factisch sind diese Stände in die Stellung gewöhnlicher eidgenössischer Orte hinein gewachsen, die ihnen der Stanzerbrief kaum zu geben beabsichtigte. Die drei späteren Orte Basel, Schaffhausen und Appenzell wurden wieder unter ganz eigenthümlichen Bedingungen aufgenommen, die es ihnen beispielsweise nicht gestatteten, an einer eidgenössischen Parteiung theilzunehmen, sondern es ihnen ausdrücklich zur Pflicht machten, in solchen Fällen «stille zu sitzen» und keinem Theile zuzuziehen, wovon wir ein Beispiel noch sehen werden.
Vollends der noch weitere Kreis der Eidgenossenschaft, die sog. «zugewandten Orte» und Unterthanen, aus denen fast die Hälfte der jetzigen Cantone entstanden ist, stand in ganz verschiedenartiger und ungleicher Verbindung mit den eigentlichen 13 Orten. Nur zwei einzige zugewandte Orte, und zwar gerade diejenigen, welche wir jetzt nicht mehr besitzen, Mühlhausen und Rottweil am Neckar, waren mit allen 13 eidgenössischen Orten verbündet, und das letztere ist niemals förmlich
aus der Eidgenossenschaft ausgeschieden. 1) Bei einzelnen Zugewandten, wie den Graubündnern, waren sogar nur einzelne Landestheile (Bünde) und zwar mit verschiedenen Eidgenössischen Orten verbündet; blos Bern ganz allein hatte einen Vertrag mit dem ganzen Freistaat. Von den Unterthanenlanden vollends hatte kein einziges alle 13 Orte zu Herren und bei allen bestanden die verschiedenartigsten, zum Theil seltsamsten und widersprechendsten Rechtsverhältnisse, eine ganze Musterkarte von Rechten und Freiheiten, von der nahezu vollen municipalen Freiheit der aargauischen Städte bis zur barsten Willkür in den italienischen Vogteien des heutigen Cantons Tessin.
Die Regierungsformen dieses ganzen Staatenconglomerats, das gewissermassen, äusserlich betrachtet, vier concentrische Kreise, einer innerhalb des andern, bildete (Waldstätte, 8 Orte, 13 Orte, Zugewandte und Unterthanen), waren ebenso verschieden, wie Natur und Lebensgewohnheiten. Bedeutende Handelsstädte, die in lebendigster geistiger Verbindung mit der ganzen damaligen Weltcultur und Weltpolitik standen, fanden sich durch das Eidgenössische Bündniss mit Hirtenländern vereinigt, die nur in tiefster Zurückgezogenheit und einfachsten staatlichen Verhältnissen sich zufrieden fühlen
konnten. Jede mögliche Verfassungsform, von der rittermässigen Aristokratie, durch die verschiedenen Formen des bürgerlichen Zunftregimentes hindurch, bis zur reinsten, oft sogar wildesten und unbändigsten Landsgemeinde-Demokratie, fanden sich im engsten Raume neben einander gestellt. 1) Zwei Glieder der weitern Eidgenossenschaft, der Abt von St. Gallen und der Bischof von Basel, waren sogar Monarchen, genau wie die deutschen geistlichen Kurfürsten, neben ihrer Verbindung mit der Eidgenossenschaft deutsche Reichsfürsten und bis 1798 in der deutschen Reichseintheilung für grosse Theile ihrer Besitzungen förmlich inbegriffen. So dass z. B. der Abt von St. Gallen je nach Bedürfniss heute ein Eidgenosse war, morgen aber, wie man zu sagen pflegte, «seine Schwabenhosen anzog» und Kaiser und Reich gegen die ketzerischen Bundesbrüder in Bewegung setzte.
Dieser «alte grosse Bund» inmitten des deutschen Reiches war, juristisch angeschaut, anfänglich genau das Gleiche, was jetzt die albanesische Liga ist und wahrscheinlich noch werden wird, eine durch die Umstände hervorgerufene Verbindung von ursprünglich meist stammverwandten und durch gemeinsame Interessen geeinigten kleinem Völkerschaften innerhalb eines zerfallenden Reiches. Zunächst zum Zwecke gemeinsamer Abwehr einer neuen, ihren Bedürfnissen nicht entsprechenden Landesherrschaft, woraus sich dann mit Wahrscheinlichkeit neue Staatsverhältnisse entwickeln, und es ist auffallend,
welche innere Verwandtschaft die bekannt gewordenen Stipulationen dieser Liga mit unsern ersten Bundesbriefen besitzen.
Die Eidgenössische Bundesverfassung bestand daher niemals, bis 1798, aus Einem alle wesentlichen staatsrechtlichen Bestimmungen enthaltenden Actenstücke, wie wir es heute zu sehen gewohnt sind, sondern zunächst aus dem Complex der sämmtlichen Verträge und verbrieften Rechte der Orte, Zugewandten und Unterthanen, sodann einzelnen gemeinsamen Verfassungsbriefen, wie dem Pfaffenbrief von 1370, dem Sempacherbrief von 1393, dem Stanzerverkommniss von 1481 und in späterer Zeit dann noch den sogenannten vier Landfrieden von 1529, 1531, 1656 und 1712 und dem Vertrag oder Eidgenössischen Schiedsspruch von Baden von 1632, die das Eidgenössische confessionelle Bundesstaatsrecht seit der Reformation enthielten. (Vergl. das Project von 1655, Beilage I, Eingang.) Vieles, sogar das Wichtigste mitunter, wie z. B. das Eidgenössische Interventionsrecht und die allezeit etwas zweifelhafte Grenzlinie zwischen eidgenössischer und cantonaler Souveränität und Competenz, beruhte gänzlich auf Gewohnheitsrecht, sogenanntem «Eidgenössischem Herkommen», und ist durch dasselbe, wie in den bekannten Streitigkeiten von Nidwalden und Zug, in der praktischen und plastischen Ausdrucksweise der damaligen staatsrechtlichen Sprache definirt worden. 1)
Ebenso wenig als eine gemeinsame Verfassungsurkunde besass der Eidgenössische Bund eine eigentliche Organisation. Seine sogenannten Tagsatzungen waren nichts Anderes als ursprünglich ganz zufällige und unverbindliche Zusammenkünfte von Abgesandten der Orte. Jeder konnte sie ausschreiben, der ein Bedürfniss hatte, sich zu berathen. Sogar der französische Gesandte schrieb öfters Tagsatzungen an seinen Hof in Solothurn aus, und sie waren nicht die unbeliebtesten und wenigstbesuchten, indem es dort dann immer auf Kosten des Königs von Frankreich sehr hoch herging und daneben noch allerlei Douceurs, Pensionen, Ehrenketten, Offizierstellen für Söhne u. dergl. für die Herren Boten abzufallen pflegten. An jedem beliebigen Orte konnten Tagsatzungen abgehalten werden und ebenso wenig als Ort und Zeit waren Zahl oder Qualitäten der Abgesandten, oder Vollzähligkeit der Stände irgendwie bestimmt
und erforderlich. Fehlten Einzelne bei wichtigem Verhandlungen aus Trotz oder aus andern Gründen, so wurden ihre nächsten Freunde beauftragt, sie «gründlich zu unterrichten» und zur Nachgiebigkeit zu bereden, was dann auf diesem Wege meistentheils auch gelang. 1) Für die völlige Gleichgültigkeit der Person der Tagsatzungsboten liefert ein sprechendes Beispiel der Abschied vom 12. April 1469, also aus der Zeit zwischen dem Waldshuter- und dem ersten Burgunderkriege, wo unter den am Kopf des Abschieds üblichermassen aufgezählten Boten als Vertreter von Glarus blos «ein Junger» genannt wird. Der ehrbare Schreiber der Tagsatzung hatte offenbar an dem Platze eines ihm wohlbekannten grauen Ehrenhauptes der Glarner mit Missfallen einen völligen homo novus noch allzu jugendlichen Aussehens erblickt. Er verschmäht es daher vollständig, um seinen Namen sich zu erkundigen, und die sämmtlichen damaligen und heutigen Eidgenossen erfahren blos, dass ein namenloser Jüngling den Stand Glarus an jener Tagsatzung vertreten hat.
Bei dieser Natur der Tagsatzungen, die reine Gesandtencongresse waren, an denen auch in der ältern Zeit ebenso oft fremde Fürsten und Städte wie Eidgenossen und ihre ständigen Verbündeten theilnahmen, 2) muss es auch nicht verwundern, wenn deren Verhandlungen, die uns in den sogenannten «Eidgenössischen Abschieden» in nuce vorliegen, oft die bedeutendsten
unmittelbar neben den kleinlichsten Gegenständen enthalten. 1)
Zeitweise, wie etwa in der spätem Periode der Burgunderkriege, sind die Eidgenössischen Tagsatzungen Europäische Friedenscongresse der wichtigsten Art, in denen die Eidgenossen mit Würde und Geschickt ja mit dem Nachdrucke eines Befehlenden, die Schiedsrichter zwischen den divergirenden Interessen Frankreichs, Italiens und Deutschlands spielen. Zu andern Zeiten kommen massenhaft die kleinsten, oft die lächerlichsten Winkelstreitigkeiten, oder gar Privatangelegenheiten, Injurienhändel von einzelnen Bürgern, Unterstützungsgesuche u. dgl. darin vor, die übrigens auch mit grossem Ernste abgehandelt werden, und ohne dass die Tagsatzung immer sehr ängstlich nach den Grenzen. ihrer Competenz fragt, wenn die öffentliche Wohlfahrt klar im Spiele liegt. Ich will hier blos Weniges und weniger Bekanntes von jeder Art als Beispiel für sich selbst reden lassen.
1403, 26. März, beschliesst die Tagsatzung einhellig wegen «vil Gebresten» der Leute in der Eidgenossenschaft und Anderer, daher rührend, dass Wein, den sie ankaufen, nit «suber noch rein» nach Haus gelange, es sollen Alle, welche in der Eidgenossenschaft und besonders am Zürichsee Wein kaufen oder verkaufen, die Fässer «suber zuofüllen mit suberem wol gesmaken
Win» und Niemand, namentlich Fuhrleute oder «Winzugel», soll weder «mit spulen noch roeren» Wein herauslassen, noch daraus trinken, bei 5 Fr. Buss ohne Gnade, und wenn sie solche nicht zahlen können, so müssen sie bis zur Zahlung die Eidgenossenschaft meiden. (E. A. I, 102.) Was würden heute die Weinhändler am Zürichsee und. anderswo dazu sagen, wenn die Bundesversammlung ein solches Gesetz erlassen wollte? —
1532, 10.-16. Mai, wird noch nachdrücklicher für das Wohl gemeiner Eidgenossen durch folgende Beschlüsse gesorgt, die namentlich auch die Herren Studenten interessiren werden:
«für ein Mahl soll kein Wirth mehr als 6 gute Kreuzer und für die Morgensuppe, das Abendbrot und den Schlaftrunk je 3 Kreuzer fordern, es wäre denn, wenn Jemand gar zu viel (unziemlich) trinken würde, in welchem Falle der Wirth die Zeche nach Verhältniss der Leistung stellen darf.
«Um das Zutrinken, das in der Eidgenossenschaft leider so sehr überhandgenommen, und woraus so viele Laster und Ungehorsam entstehen, zu verhindern, sollen in allen gemeinen Unterthanenlanden folgende Vorschriften als unerlässlich gelten:
«Wer einem andern «eins bringt» oder «wartet», wird um 10 Batzen bestraft.
Wer dermassen trinkt, dass er's «wiedergibt», muss 50 Batzen geben.
Ist Einer zu arm zur Zahlung, so soll er bei Wasser und Brod für Zutrinken 1 Tag und 1 Nacht, für Uebertrinken hingegen 4 Tage und 4 Nächte im Thurm sitzen, ohne Gnade. —
Und damit dem Allem dest besser nachgelebt werde, so sollen alle Wirthe und ihre Bediensteten zu Gott und
den Heiligen schwören, jeden anzuzeigen, der sich dagegen verfehlt.» (E. A. Bd. IV, Abth. I, B, p. 1339.)
1423 wird ein Injurienhandel, der an die Tagsatzung compromittirt ist, so entschieden, dass der Verurtheilte, Heini Stoss von Schwyz, selber schwören muss, dass seine Rede erlogen sei, und zudem soll er in 4 Kirchen, in Sins, Zug, Uri und Unterwalden je an einem Sonntag öffentlich erklären, dass er aus Luzern und allen seinen Aemtern solange weichen werde, bis man ihm freiwillig die Rückkehr gestattet. (E. A. II, 23.)
1424, 11. Juni, wird beschlossen, dass auf einer Matte zu Niederbaden, die Heinrich Schinder seligs gewesen ist, Jedermann, in welch' Ehren und Würden er sei, Jung und Alt, Herren und Frauen, zu jeder Zeit allda tanzen oder andere ziemliche Kurzweil treiben möge, und wer den Schindershof inne hat, soll auch die Tanzstühle auf der Matte machen und in Ehren halten und niessen was auf der Matte wächst, ohne Jemand an Kurzweil, Steg und Weg zu hindern. (E. A. II, 36.)
Für unsere Universitätsverhältnisse wird interessiren, dass die Tagsatzung, gerade vor 400 Jahren, 1481, 2. Juli, beräth, «von Förderung der Studenten zu Paris» halber, die der König von Frankreich angeboten hat, ob man das «abslachen» oder annehmen wolle. (E. A. III, Abth. I, 99, 101.) In unseren Tagen wendet man sich desshalb unsererseits und vergeblich an Frankreich.
Damit auch die Damen nicht ganz leer ausgehen, beschliesst die Tagsatzung 1472, 24. Februar, also unmittelbar vor dem grossen Burgunderkrieg, über die kleinen Kriege Folgendes: «wenn zwei Männer in der Grafschaft Baden gegen einander in Frieden kommen, so sollen auch ihre Eheweiber gegen einander Frieden
halten» und ob diese einander friedbrüchig wurden, so sollen sie die gewöhnliche Busse geben, doch ist der Vogt berechtigt, nach Gestalt der Sache (— nicht der Person —) sie auch «gütlich zu halten». (E. A. II, 430.)
Auch mit der besondern Species der Herren Studenten von allzu vielen Semestern beschäftigt sich löbliche Eidgenossenschaft. 1655 wurde auf der Sondertagsatzung der Eidgenössischen Städte zu Aarau der Gräfin von Hohenlohe «für die Studien ihres Sohnes», die sich etwas stark in die Länge gezogen zu haben scheinen, eine Unterstützung von 88 Ducaten zu den 12, die sie schon von St. Gallen erhalten hat, bewilligt, «doch soll diese Unterstützung die letzte sein.» (E. A. VI, 1, 1, 246.)
Selbst der deutsche Wortschatz ist mitunter von der Tagsatzung durch bezeichnende Erfindungen bereichert worden. So haben 1468 die beiden Unterwalden Streit mit Schaffhausen und Rheinau, eines «Nams» wegen, den einer der ihrigen den Waldshutern genommen. Raub wollen die lieben Eidgenossen das Ding lieber nicht nennen und so gebrauchen sie für die missliebige Sache den unschuldiger klingenden Namen «Nam», den sie dann, ihrer Erfindung froh, noch mehrmals in ähnlichen Fällen wiederholen. (E. A. II, p. 375, 430.)
Diess sind einige wenige Beispiele, die sich sehr vermehren liessen; die interessantesten sind indessen nicht immer mittheilbar. Die Frische und Ursprünglichkeit der Eidgenössischen Verhandlungen während der Periode namentlich vor den confessionellen Zwistigkeiten, ist ganz unvergleichlich, und der gesunde Menschenverstand, der da so oft das rechte Wort aus ursprünglicher Natur heraus für das findet, was alle unsere theoretische Wissenschaft über Bundesstaat und Staatenbund nur unvollkommen ausdrückt, herzerquickend. So dass man
noch heute, nach vielen hundert Jahren, die Tagsatzungsprotocolle wie ein unterhaltendes Buch liest, was, fürchte ich, von unsern Urenkeln trotz aller höheren Bildung unserer Zeit nicht geschehen wird. Die Jugendfrische eines Volkes lässt sich eben leider so wenig ersetzen oder nachahmen, als die eines einzelnen Menschen, und wir seufzen vergeblich: «O Traum der Jugend, o goldner Stern»!
Eine Revision einer solchen Bundesverfassung war in alter Zeit kaum denkbar. Es fehlte in der Ersten Periode, bevor der Geist entflohen war, der diese mannigfaltige Unvollkommenheit belebte und zusammenhielt, das Bedürfniss dazu, später eben der Geist, der zu einer Verfassungsrevision nothwendig gehört, und auch die Organe.
Die Tagsatzung konnte weder Gesetze beschliessen noch Bünde revidiren, 1) folglich erforderte jeder solche Beschluss Einstimmigkeit der Stände, ausgesprochen durch ihre heimischen Landesvertretungen, die für ein so complicirtes Staatswesen in wichtigen Dingen geradezu ein Ding der Unmöglichkeit war. Selbst die in den Bünden vorgesehene periodische allgemeine Neubeschwörung, die eine Art formeller Erneuerung derselben darstellte, fand nur vier Male, 1393, 1398, 1417 und 1520 statt. Nach dieser Zeit wollten die reformirt gewordenen Stände die alte Schwörformel «bei Gott und den Heiligen»
nicht mehr gebrauchen und die Katholiken keine andere gestatten, so dass man sich schliesslich 1543 zusagte, jeder Ort solle periodisch die Bundesbriefe (wozu man gemeinhin auch Pfaffenbrief, Sempacherbrief und Stanzerverkommniss zählte) den Seinen vorlesen, und dabei blieb es bis zum 25. Januar 1798, an welchem Tage zu Aarau die letzte — unnütze — Bundsbeschwörung stattfand.
Alle Revisionen der Eidgenössischen Bundesverhältnisse bis auf den heutigen Tag sind daher Revolutionen und in ihrem schliesslichen schriftlichen Ausdrucke Friedensschlüsse — nach vorangegangenen tiefeingreifenden Kämpfen — unter auf friedliche Art. unvereinbaren Gegensätzen gewesen. Die Erste ist das sogenannte Stanzerverkommniss vom 22. Dezember 1481, das zunächst den lebensgefährlichen Sonderbund der drei Eidgenössischen Städte mit Freiburg und Solothurn vom 23. Mai 1477 (E. A. II, 929) aufhob und eine Erweiterung der Eidgenossenschaft gestattete, und das Bündniss der 5 katholischen Orte mit dem Bischof von Constanz vom 12. Januar 1477 (E. A. II, 924). Aus ihm datirt auch die Vorstellung von «Obrigkeiten und Unterthanen» in den Ständen der Eidgenossenschaft selber, aus welcher heraus der alte Bund wirklich allmälig ein «Herrenbund» geworden ist, der jetzt erst seine letzten Epigonen, in den abnehmenden Anhängern des reinen Repräsentativsystems, verliert. Das Stanzerverkommniss ist das einer Bundesrevision ähnlichste Actenstück der alten Geschichte, welches allein etwa als Beispiel einer solchen aufgeführt werden könnte. Den Charakter von partiellen Bundesrevisionen haben die vier Landfrieden und der Vertrag von Baden.
Im Weitern sind solche Friedensschlüsse nach den vorübergehenden helvetischen Verfassungen von 1798
und 1802, die nur die Revolution selber sind, die fremden Vermittlungsacten von 1803 und 1815, und den Schluss bildet die Verfassung von 1848, welche, nach einem heftigen vorangegangenen Kampf, die grosse Revolution zum Bundesstaat abschliesst, an welcher die ganze Eidgenössische Geschichte unter wechselnden Verhältnissen gearbeitet hat. 1)
Ausser und neben diesen allgemein bekannten Revolutionen hat es nur ein einziges Mal in der ganzen Eidgenössischen Geschichte einen ernstlichen Versuch gegeben, eine friedliche Bundesrevision im heutigen Sinne herbeizuführen. Und auch dieser viel zu wenig bekannte Versuch wurde nur gewagt im Momente dringendster Noth, nach einem grossen innern Kriege der Eidgenossenschaft und unmittelbar vor einem andern. Zu Beseitigung der beiden Spaltungen der Eidgenossenschaft, die sie noch heute am meisten bedrohen, der socialen und der confessionellen, — von denen die Eine ihren Ausdruck soeben in dem socialdemokratischen Volksbunde der Unterthanen, verschiedener Cantone zu Liestal, Summiswald und Hutwyl von 1653 gefunden hatte, die andere den ihrigen in dem sogenannten goldenen oder «borromäischen» Bunde der VII
katholischen Orte vom 5. October 1586, dem Vorläufer und Muster des Sonderbundes. In den wenigen drei Jahren von 1653 bis 1656 entschied sich damals innerlich bereits — was erst 1798 äusserlich zu Tage trat, die Unfähigkeit der alten Eidgenossenschaft zu einer Reform nach beiden Richtungen hin und daher —wie immer in solchen Fällen — die Nothwendigkeit der Revolution, die fortan nur eine Frage der Zeit war.
Die Uebelstände, an denen die Eidgenossenschaft seit alter Zeit bis auf den heutigen Tag ernstlich leidet und die sie überwinden oder sterben muss, sind die .sociale Missstimmung einzelner Volksclassen gegen den bestehenden Staat, und das Ueberwuchern des confessionellen Geistes über den patriotischen. 1)
Die erstere hatte sich von Zeit zu Zeit in Aufständen Luft gemacht, namentlich seit es Unterthanen schweizerischer Republiken gab, die unter dem doppelten politischen und ökonomischen Drucke von bäurischen Landvögten seufzten (besonders 1489, 1513, 1531, 1570, 1591 u. s. f.). Der grosse Ausdruck dieser ebensowohl wirthschaftlichen als politischen Bestrebungen war schliesslich der Bauernkrieg von 1653, eine «Allianz der Völker gegen den Bund der Herren», die u. A. auch Abschaffung der Bodenzinse, Erlass der Schulden und Aufhebung des Rechtstriebs bezweckte und zuletzt an die Stelle der bisherigen Bünde eine förmliche neue Unterthanen-Bundesverfassung (zu Hutwyl 14. Mai 1653) setzte.
Die grosse Tagsatzung zu Baden, die am 29. Februar 1653 begann und wohl alle angesehenen regierenden Personen der Eidgenossenschaft umfasste, vermochte es nicht, sich mit den Abgesandten der damaligen schweizerischen Socialdemokratie zu einigen und die Entscheidung erfolgte zuletzt mit dem Schwert, bei Wohlenschwyl, und besonders am Pfingsttag zu Herzogenbuchsee. — Die Anhänger der Verbindung wurden nunmehr allenthalben schonungslos verfolgt. Ueber 300 Personen wurden zu Zofingen gemeinsam gerichtet und in den einzelnen betheiligten Ständen folgten noch besondere Strafgerichte. Viele wurden getödtet, andere grausam verstümmelt, oder auf Lebenszeit auf die venetianischen Galeeren verkauft. Das Bundeshaupt der socialen Revolution, der Obmann Leuenberger von Rüderswyl, wurde am 6. September 1653 in Bern selbst geviertheilt, die einzelnen Theile an den vier Hauptstrassen ausgehängt, der Kopf mit sammt der Bundesurkunde von Hutwyl an den Galgen genagelt. Ein einziger wesentlich Betheiligter von Allen, Walter Meier, wurde zu Luzern auf Ersuchen des Abtes von Einsiedeln
gänzlich begnadigt, weil er besonders gute Pasteten backen konnte und daher dem Staate sowohl, wie der Kirche, unentbehrlich war. 1)
Die kirchlichen Angelegenheiten waren wo möglich noch unerfreulicher und verworrener. Der zweite Landfriede von 1531 20. November (zwei Acte mit Zürich und Bern separat abgeschlossen, E. A. IV, Ib, 1567),. hatte eine kleinliche Parität der beiden sich bekämpfenden Religionsbekenntnisse in allen eidgenössischen Dingen eingeführt, während in den einzelnen Orten selbst die schroffste Glaubenseinheit und Glaubensverfolgung herrschte, soweit. sie nicht nachmals durch den goldenen Bund im Interesse. der Glaubenseinheit beschränkt war. Und zwar hatten sich in dieser Hinsicht, sowie in Bezug auf ungescheute Verbindung mit dem Ausland gegen die andersglaubenden Bundesbrüder, die beiden allein privilegirten Bekenntnisse gegenseitig wenig vorzuhalten. Wenn die Katholiken in Bezug auf Zelotismus noch etwas voraus haben, so ist es meistentheils auf Rechnung ihrer ungebändigten demokratischen Landsgemeinden, der im Auslande erzogenen Priester und einzelner taktloser Amtsleute in den gemeinsamen Unterthanenländern zu setzen, die die Evangelischen etwa zwingen wollten, bei dem Ave-Marialäuten oder vor Heiligenbildern und Prozessionen die Hüte abzuziehen, ihnen auch mitunter solche Bilder mit boshafter Berechnung an besonders von ihnen benutzten Strassen oder Flussübergängen hinsetzten. Man wird es jetzt z. B. kaum glaublich finden, dass auch die aufgeklärten Genfer in kurzer Frist vor der Zeit, von
der wir sprechen (vor dem Jahre 1652 nämlich), mehr als 500 Menschen wegen Bündniss mit dem Teufel hinrichten liessen, oder dass im Jahre des Vertrages von Baden, 1632, der Pfarrer von Divonne, Nicolaus Antoine, «wegen erwiesener absonderlicher Beschäftigung mit Philosophie und daherigen fluchwürdigen Ansichten» (über christliche Dogmen) in Plainpalais verbrannt wurde, während an der Genfer Academie gleichzeitig (schon seit 1611) ein Lehrstuhl für Philosophie bestand.
In dieser trostlosen Zeit, wo Herren gegen Unterthanen und Reformirte gegen Katholiken beständig auf dem Piket standen und bald Abordnungen der einen Religionspartei, gegen die Miteidgenossen hülfebegehrend, an Cromwell und die holländischen Generalstaaten abgesendet wurden, bald solche der andern an die Spanier in Mailand, den Kaiser und den Kurfürsten von Bayern, oder den Herzog von Savoyen, rafften sich einige Patrioten zu dem einzig dastehenden Versuche auf, die verschiedenartigen und halb obsolet gewordenen eidgenössischen Bünde in Eine Urkunde zusammenzufassen und dadurch kräftig zu erneuern.
Doch hatte auch dieser Versuch, auf einer Conferenz der Evangelischen zu Aarau im März 1655, zunächst ein confessionelles Gepräge, indem anfänglich blos davon die Rede war, die Bündnisse der evangelischen Orte in Einen Act zusammenzufassen und zu erläutern und dies sogar sorgfältig geheim gehalten wurde 1) (E. A. VI, I, I, p. 239, 246 und 1752).
Es ist bezeichnend und wohl nicht ganz zufällig, dass in den Eidgenössischen Abschieden unmittelbar darauf eine Conferenz der Städte Luzern, Freiburg und Solothurn zu St. Urban folgt (p. 241), bei welcher eine geheime Schrift in Chiffern (die noch jetzt vorhanden ist, E. A. VI, I, Abth. II, p. 1750) verabredet, ein geheimer Kriegsrath ernannt und für den Fall einer «Ruptur» mit Bern bereits die Vereinigung mit Wallis, Burgund, Savoyen, dem Bischof von Basel und andern vertrauten Nachbaren beschlossen wird.
Unter diesen gespannten Verhältnissen fanden nun zunächst die Verhandlungen der Evangelischen Stände über die Bundesrevision vom 31. März bis 2. April 1655 zu Königsfelden statt und wurde dann das Project, welches von Bürgermeister Waser von Zürich und General Sigmund v. Erlach von Bern wesentlich ausgearbeitet war, am 13. Mai zu Aarau vorläufig von Zürich, Bern und Basel angenommen (abgedruckt E. A. IV I, II, l750). Auf der gemeineidgenössischen Jahresrechnungs-Tagsatzung zu Baden, 4. bis 29. Juli, wurde dann der Vorschlag in der neuen Form eines allgemeinen Bundesrevisionsprojects, an Stelle der Neubeschwörung der Bünde, vorgelegt (Abdruck E. A. VI, I, II, 1760) und verabredet, dass jeder Ort bis Martinstag seine Erklärung an Zürich abgeben solle. Nur Uri wollte von vornherein die Sache «auf bequemere Zeit» verschieben.
Dieses Bundesrevisionsproject, das einzige Actenstück dieser Art in unserer alten Geschichte, liegt im hiesigen Staatsarchive und enthält nach einer interessanten Aufzählung aller Bundesbriefe und allgemeinen politischen Urkunden (zum Theil mit andern Daten, als die jetzt allgemein angenommenen) wesentlich eine Zusammenfassung aller Bestimmungen der Bünde des
Stanzerverkommnisses, des Pfaffen- und Sempacherbriefs, über die gegenseitige Hülfeleistung im Krieg und über die innere Rechtsordnung, die letztere mit namhaften Zusätzen oder Verallgemeinerungen der Bestimmungen einzelner Bundesbriefe, z. B. über Erbrecht, Forum der Schuldner, Verruf von criminell Verfolgten. Sodann den Ausschluss neuer Zölle, Eidgenössisches Schiedsgericht in allen Streitigkeiten der Kantone, oder von Privaten gegen Kantone und Eidgenössische Garantie der kantonalen Rechte über die Unterthanen, jedoch bezeichnenderweise nicht der Unterthanen gegen die Regierungen. —(Vgl. Beilage I.)
Die Revision kam jedoch nicht zu Stande.
Schon am 9. Juni, bevor der Antrag an die Tagsatzung gelangt war, empfiehlt der eben neu angelangte Nuntius Friedrich Borromeo zu Luzern vorsorglich schon den katholischen Orten Aufmerksamkeit gegen die Bedrückungen von Zürich in den Unterthanenländern und verheisst ihnen «nach dem Beispiel des Cardinals Borromäus, des besondern Patrons und Protectors der Eidgenossenschaft», seinen Rath und Beistand in allen Fällen. Und die conferirenden Stände setzen demzufolge in den Abschied einen Anzug des frühern Nuntius Caraffa, es solle der h. Carl Borromäus als Protector der ganzen katholischen Eidgenossenschaft angenommen und zugleich die Heiligsprechung des Bruders Claus und die Beatification des belgischen Jesuitenpaters Canisius befördert werden (VI, I, I, 248). Eine ganze Menge von Klagen kennzeichnen schon die herrschende Stimmung.
Freiburg klagt, Bern habe ein Kreuz auf Freiburger Gebiet in odium religionis niederreissen lassen; katholisch Glarus behauptet, die Reformirten wollten nicht mehr dem ehrwürdigen Panner des h. Fridolin
zur Näfelser Fahrt folgen; Schwyz berichtet, einer der Seinigen, Fähndrich Schorno, sei in Glarus ungerechterweise um 800 Kronen gebüsst worden, weil er «in der Weinfeuchte» nur geäussert, die Glarner seien schon sieben Mal meineidig geworden. Nun habe aber glücklicherweise auch Landvogt Blumer von Glarus bei einer Anwesenheit im Gasterlande «sich verschwatzt» und sie hätten denselben nun um 1000 Gulden gebüsst u. s. w.
Die Sache hatte denn auch den nach solchen Präludien wahrscheinlichen Verlauf nach geschehener Vorbringung bei der gemeineidgenössischen Jahresrechnungstagsatzung zu Baden, 4.-29. Juli 1655 (p. 253). Der päpstliche Legat schreibt zunächst an die katholischen Stände: «Es möge zwar recht und gut sein, Einigkeit zu suchen, die katholischen Stände sollen sich aber wohl hüten, etwas einzugehen, was zur Benachtheiligung der Religion führen könne, worauf es protestirender Seits wohl abgesehen sei», und bei der spätem Conferenz der katholischen Orte zu Luzern, 15.-17. September, reist er aus Graubünden herbei und hält einen mündlichen Vortrag, worin er es als dringende Nothwendigkeit bezeichnet, den borromäischen Bund neu zu beschwören, um die Gunst des h. Vaters zu gewinnen und den Protestanten einen Zaum anzulegen, was denn auch in der That beschlossen wird (p. 263) und womit factisch, an Stelle eines allgemeinen, bereits der Sonderbund beschlossen war.
Den 3. October 1655 wurde wirklich dieses «christliche Verkommniss und vertrauliche Bruderschaft von 1586» zu Luzern im Beisein des Bischofs von Lausanne als Vertreter des Nuntius, der wieder in Chur war (von dort aus aber einen Steinbock als Geschenk sendete),
erneuert und katholisch Glarus in diesen katholischen Bund aufgenommen. Und «nachdem — wie der Abschied ferner lautet — das gottselige Werk wie 1586 in der Hauptkirche zu St. Leodegar mit Eid bestätigt und die Majestät des ewigen Gottes angerufen worden, um die löbliche Verhandlung mit dem gnadenreichsten Segen zu beglücken», wird sodann noch die Erneuerung der Verbindungen mit Wallis 1) und mit dem Bischof von Basel beschlossen, 2) dagegen das Bundesrevisionsproject mit der trockenen und ironischen Bemerkung abgelehnt,
dass, wenn die Orte der andern Religion solches wieder vorbringen, man sich darauf beschränken wolle, zu erinnern, dass es genüge, die alten Bünde besser als bisher zu halten (p. 267).
Zu einer solchen Erklärung kam es jedoch gar nicht, denn inzwischen (23. September) hatten auch die bekannten Unruhen in Arth wegen der Entdeckung von dortigen heimlichen Reformirten stattgefunden, von denen dann einige hingerichtet, andere der Inquisition in Mailand überliefert wurden, noch andere nach Zürich entflohen waren und eifrig von diesem in Schutz genommen wurden. Während der zwei nächsten allgemeinen Tagsatzungen zu Baden (21. November bis 24. Dezember), die noch durch Vermittlung des französischen Gesandten zusammengebracht wurden, liegt der kommende Krieg schon deutlich in der Luft, und es behandeln die neben den allgemeinen Verhandlungen hergehenden speciellen Conferenzen der beiden Religionsparteien schon lauter Kriegsmassregeln.
So soll der Landvogt von Baden eine scharfe Axt und ein «Schärmesser» bereit halten, um die Seile der Fähre in der Stilli abzuschneiden.
Uri soll die Graubündner im Obern Bund ersuchen, gutes Aufsehen gegen «unsere Stüffbrüoderen» zu halten.
Der Landvogt im Thurgau soll die «Protestirenden», falls sie Zürich zuziehen wollten, mit Strafen an Leib, Gut und Blut bis in den fünften Grad bedrohen.
Wie bei der Kappelerschlacht, sollen aus jedem der katholischen Orte sechs andächtige Frauen nach Einsiedeln pilgern, um dort abwechselnd ohne Unterbruch Gottes Hülfe und seiner seligen Mutter Fürbitte anzurufen.
Dem Abt von St. Gallen ist zu berichten, «waß unß an die Hand wachst», damit er den Obersten Kaspar in Bregenz an sein (jetzt unbekanntes) Anerbieten erinnere.
Mit dem Grafen von Hohenems ist zu tractiren, dass er sich des Passes an der Luciensteig gegen Graubünden bemächtige, und «waß man allhie trakthiere, dass man by geschwornen Eyden darzu schwyge» (p. 281).
Am 24. Dezember 1655 «verritten» die Gesandten von Zürich und Schwyz ohne stattgehabte Vermittlung,. und im Januar 1656 standen schon die beiderseitigen Heere im Feld und waren alle auswärtigen Verbündeten, Kaiser, Papst, Spanien, Oesterreich, Burgund und Savoien auf der einen, der Lordprotector von England auf der andern Seite, um Hülfe gemahnt. Die Basler versuchten zwar noch mit Beihülfe von Freiburg, Solothurn und Schaffhausen, nach Maßgabe ihres Bundesbriefs, eine unparteiische Vermittlung und sandten zu diesem Zwecke den Rathsherrn Andreas Burkhard und Rathsschreiber Joh. Rud. Burkhard in das katholische Lager. Dieselben berichten aber, sie hätten viel Volk in Baar angetroffen und «von dem gemeinen halbrasenden Manne und etlichen ungestümen Pfaffen viel ungute Worte hören müssen», und schliessen ihren Bericht mit den für alle unsere innern Kämpfe bis auf den heutigen Tag bezeichnenden Worten, es sei zwar beiden Parteien «schlechter Ernst», doch werde es zum Kriege kommen und man müsse denken, dass unser Herrgott unser Vaterland heimsuchen und sich dazu des gemeinen «erwildeten» Mannes bedienen wolle, vor dessen Toben und Wüthen guter Patrioten vernünftige Consilia nicht stattfinden können (p. 313).
Die Folge war nun zunächst bekanntlich die fruchtlose Belagerung von Rapperswyl durch die Zürcher unter Werdmüller, das durch den Schwyzer Wiget tapfer vertheidigt
wurde, und sodann die Schlacht von Vilmergen, 23. Januar 1656, in welcher 9000 Berner und Waadtländer unter Erlach, dem Mitverfasser des Bundesprojectes, durch 3000 Luzerner und einige Freienämterbauern unter dem Befehl von Christoph Pfyffer von Luzern mittelst Ueberraschung völlig geschlagen wurden. Es hatte sich hiebei wirklich der «schlechte Ernst», der bei der Sache war, und daneben der ganze trostlose Verfall des eidgenössischen Kriegswesens gezeigt. 1) Die bernischen Offiziere befanden sich grösstentheils in Lenzburg, getrennt von ihren Truppen, von der Artillerie waren beim Beginn der Schlacht nur zwei Kanonen mit Pulver für zwei Schüsse zur Hand, 2000 Mann blieben unthätige Zuschauer des Gefechtes, andere 10 Compagnien zogen sich ohne Gegenwehr zurück. Eine grosse Anzahl Berner waren sogar, als der Ueberfall erfolgte, mit Kuchenbacken beschäftigt, von denen daher ein Spottlied auf die Vilmergerschlacht singt:
"Muoss warlich schier des Bären lachen, Der ze Vilmergen wollt Küechli bachen."2)
Der General von Erlach, obwohl noch nach der verlorenen Schlacht in grosser Uebermacht, versuchte keinerlei Restitution des Kriegsglückes und der Krieg artete fortan in ein blosses planloses Rauben aus, bei welchem u. A. der Befehlshaber der Züricher, Thomas Werdmüller, die vielgerühmte höhere Bildung der Reformirten dadurch schlagend bewies, dass er die schöne Bibliothek des Klosters Rheinau in den Rhein werfen liess. Am 13. Februar 1656 kam auf Zureden der fremden Gesandtschaften wieder eine Tagsatzung in Baden zusammen, und dort wurde schliesslich am 26. Februar und 7. März der dritte Landfriede — der schlechteste von allen -— vereinbart, statt einer Bundesrevision die unheilbare Trennung der Eidgenossenschaft in zwei confessionelle Theile (E. A. VI, I, II, 1633).
Die Bundesverfassung der sämmtlichen Katholiken in der Schweiz und der katholischen zugewandten Orte blieb fortan beständig der borromäische Bund, der
noch wiederholt, besonders 1714, unter ihnen erneuert wurde und seine Tagsatzungen in Luzern hielt. 1) Die Reformirten nahmen ihr anfängliches Project.
eines reformirten Bundes zwar nicht wieder auf, hielten aber ebenfalls ihre Sondertagsatzung mit den reformirten Zugewandten in Aarau. Die Eidgenössischen Tagsatzungen in Baden, später in Frauenfeld, wurden leere Vogtei-Jahrrechnungen fast ohne allen politischen Gehalt und ohne Interesse. Viele Tausende von reformirten Schweizern, besonders aus den Unterthanenländern, kehrten damals dem rettungslos gespaltenen Vaterlande den Rücken und wanderten, besonders nach den Niederlanden, nach Brandenburg und der Pfalz, aus. Zürich gründete sogar sechs förmliche Colonien solcher Leute in Brandenburg (Neustadt-Eberswalde, Lindau, Ludersdorf, Neu-Ruppin, Lehnin und Lunau), deren Nachkommen sich ihrer Abstammung schwerlich mehr bewusst sind. Von einer politischen Eidgenossenschaft war im Innern kaum mehr ernstlich die Rede, sie wurde eigentlich nur noch durch die schlechtesten Mittel (die insoweit auch einmal etwas Gutes an sich hatten) zusammengehalten, die unauflösbare gemeinsame Beherrschung von. Unterthanen und das gemeinschaftliche Interesse der auswärtigen Soldverträge, namentlich der französischen, die die grossen Einkommensquellen, besonders der kleinen Cantone, waren. Bei Anlass der Erneuerung eines solchen, 1776, ist denn auch noch der letzte, übrigens ebenfalls vergebliche, Versuch gemacht worden, die Eidgenössischen Stände zu diesem rein äusserlichen Zweck durch ein gemeinsames Band, eine Art von Revision der Bundesverträge, zu verbinden. —
Und doch gab es auch unter den confessionell getrennten Schweizern des 17. und 18. Jahrhunderts auf beiden Seiten edle Patrioten von der Weitherzigkeit beispielsweise eines Franz Urs Balthasar von Luzern, der
uns die «patriotischen Träume eines Eidgenossen über die Mittel, die veraltete Eidgenossenschaft zu verjüngen,» hinterlassen hat. 1)
Und einer der conservativsten aller Aristokraten, welche die Schweiz jemals hervorgebracht hat, ein getreuer Söldner Frankreichs, der Baron Besenval von. Solothurn, kann im Eingang seiner bekannten Memoiren Worte schreiben, die heute, hundert Jahre später, nur ein liberaler Centralist äussern würde:
«L'association helvétique fut toujours divisée en de trop petites parties, pour pouvoir, en réunissant ses forces et son industrie, produire la puissance, dont elle est susceptible. Elle est assujettie ä des administrations trop bornées et trop multipliées, pour que des volontés sans cesse en opposition et qui gouvernent d'après différens principes, opèrent ce que la nature du pays et l'espèce d'hommes pourraient produire.»
Mitglieder der bernischen Aristokratie, wie solothurnische und luzernische hohe katholische Geistliche waren im 18. Jahrhundert eifrige Mitglieder der helvetischen Gesellschaft, die sich die Verjüngung der Eidgenossenschaft im Sinne der nachmaligen Ideen der französischen Revolution zum Zwecke setzte, und der zürcherische «philosophische Bauer» Jakob Guyer, genannt Kleinjogg, ging damals mit deutschen Fürsten und einheimischen Aristokraten wie mit seinesgleichen um.
Warum, fragen wir uns, haben alle diese zahlreichen, hochgebildeten und aufrichtig patriotischen, religiös. toleranten und politisch vorurtheilslosen Menschen, die Haller, die Bonstetten, die Tscharner, die Wattenwyl, die
Schinz, Füssli, Hirzel, Stockar, Rahn, Zellweger, Zurlauben, Meyer von Schauensee, Balthasar, Planta, Ulysses Salis, Iselin, Pestalozzi, Turretini der damaligen Zeit, keine. bessere Verfassung der Eidgenossenschaft schaffen können, sondern musste sich dieselbe durch die Revolution und Fremdherrschaft von 1798-1831 und durch die erbitterten confessionellen Kämpfe von 1841-1847 nochmals auf gewaltsame Weise ihre Bahn brechen? —
Darüber nur noch ganz wenige Worte, damit unseren Betrachtung nicht völlig «academisch» bleibe, sondern auch zu einem einigermassen praktischen Abschlusse kommen möge.
Revisionen der bald 600jährigen Eidgenössischen Bundesverhältnisse können nicht beliebig ausgedacht und gemacht werden.
Am wenigsten durch den blossen guten Willen Einer politischen Partei, oder socialen Classe.
Sie sind, wenn sie Dauer und Wirkung haben sollen, die Endresultate der Lebensarbeit von mehreren Generationen, von denen nicht jede zu einem solchen abschliessenden Acte berufen ist. Denn «der Eine säet, der Andere schneidet», und niemals wird mit Erfolg geschnitten und eingebracht werden, was nicht lange zuvor sorgfältig gesäet ist und in langen und heissen Tagen allmälig heranreifte.
Aus dem gleichen Grunde ist der Stoff zu einer Bundesrevision nicht allezeit vorhanden.
Die grossen Ziele, oder sagen wir lieber die grossen Ideale der Eidgenossenschaft: wahre Freiheit und wahre Wohlfahrt Aller, unter den verschiedenartigsten äussern Verhältnissen zwanglos, durch die richtige Mischung von Einheit und Besonderheit, zu verwirklichen, und den Gedanken der Republik in Europa allezeit ehrenvoll aufrecht
zu erhalten, sind gegeben, wir können uns keine andern Zwecke. vorschreiben.
Wir haben nur zwischen einem Wollen und Nichtwollen dieser zu wählen, das Leben oder Tod unseres Volkes ist.
Das Nichtwollen — ausgedrückt im Egoismus und daherigen Separatismus einzelner Theile des Staates, seien es Cantone, Sprachen, Religionsbekenntnisse oder Volksklassen — oder in dem für alle höhern Ziele überhaupt unempfindlichen, rein wirthschaftlich denkenden Materialismus — finden wir mit allen seinen Wirkungen auf vielen schwarzen Blättern der Eidgenössischen Urkundensammlungen verzeichnet, von denen der borromäische Bund nur eines der schwärzesten ist.
Die Augenblicke des Wollens sind hinwieder die Lichtpunkte der Eidgenössischen Geschichte.
Als solcher erscheint uns u. A. das Bundesproject von 1655 und die 1848er Bundesverfassung. Nicht die .heutige.
Die heutige Verfassung wird in der künftigen Eidgenössischen Geschichtschreibung schwerlich als ein markantes Actenstück, als ein eigentlicher Markstein unseres politischen Lebens erscheinen. Sondern vielmehr als ein Erster Versuch zu einer Ausbesserung der Verfassung von 1848 im Sinne der allmälig nothwendig gewordenen .grössern Einheit, bestehend aus einer leichten Ueberarbeitung mit einigen Einschiebseln, welche nicht immer mit dem im Allgemeinen beibehaltenen Systeme harmoniren.
So steht z. B. die Militärcentralisation, ja die ganze Tendenz der Verfassung überhaupt, in Widerspruch mit der beibehaltenen, rein theoretischen Bestimmung des
Art. 3, wonach die Souveränität der Cantone stets die Regel und die des Bundes die Ausnahme bilden soll. Jede logisch aufgebaute künftige Verfassung wird den Satz umkehren und den Cantonen — zu ihrer eigenen Sicherheit —statt der allgemeinen Phrase bestimmte Rechte garantiren, wie dies auch bereits in einzelnen Artikeln (19, 20, 31, 32, 33, 39, 45, 50, 55, 56, 64, 89, 93) geschieht.
Der Art. 89, der wichtigste von allen neuen, steht in offenem Conflict mit dem ganzen System der Verfassung, denn mit Eidgenössischen Gesetzen, die blos das Volk votirt, gibt es nicht mehr zwei gleichberechtigte Factoren der Gesetzgebung und ist das Recht der Cantone, Verfassungsveränderungen mitzubeschliessen, illusorisch.
Die baldige Aufhebung aller cantonalen Ohmgelder in Art. 32 wird sich als schwer durchführbar erweisen und der Art. 30 zeigt dann schon den Weg, wie in solchen Fällen verfahren wird.
Die Zerstückelung der Rechtseinheit wird sich schon vorher als ein Fehler herausstellen und die föderalistische Partei es bedauern, dass sie nicht lieber die cantonale Justizhoheit intact erhalten hat, anstatt die letzte Entscheidung in allen Civilfällen erheblicher Art, die sich jetzt oder künftig nach Eidgenössischen Gesetzen erledigen, der Eidgenossenschaft zu cediren und dafür den seiner wesentlichsten Glieder beraubten unförmlichen Torso ihrer Civilgesetzbücher zu retten.
Manche Artikel, wie namentlich 27, 46, 47, haben sich als weder recht verständlich noch ganz ausführbar gezeigt, andere, z. B. 15 und 17, sind wahre hors d'oevre, vorsündfluthliche Ueberreste im Zeitalter der Telegraphen und der jetzigen Eidgenössischen Militärorganisation.
Es bedarf weder einer Einwirkung von Aussen, noch des centralisirenden Einflusses mächtiger, aller Opposition spottender, materieller Verhältnisse im Innern — wie des Eisenbahnwesens in seiner nächstbevorstehenden Entwicklungsphase — um eine Rectification dieser Verfassung als zukünftige Nothwendigkeit erkennen zu lassen. Die Hauptsorge ist jetzt für die Freunde des Bundesstaats in beiden politischen Parteien nur noch die, statt des unhaltbaren einen richtigen Markstein genau an den Punkt zu setzen, wo der centralisirte Bundesstaat aufhört und der decentralisirte Einheitsstaat beginnt, einen Punkt, den die neuem deutschen Publicisten (Laband, Schulze, Meyer, Zorn, Hänel, Liebe) bereits überschreiten, dessen genauere Feststellung und Einhaltung sich für uns aber aus vielen Gründen empfiehlt.
Die natürliche äussere Staatsform, in welcher sich das edle Wollen praktisch verwirklichen und die bösen Geister der Zwietracht sich am leichtesten bannen lassen sollen, ist daher auch schon gefunden, und wir werden uns wohl niemals mehr principiell von der Idee des Bundesstaates trennen, der schon an der Schwelle unserer Geschichte stand und stets nach Gestaltung gerungen hat, sondern ihn nur eine vollkommene Wahrheit werden lassen, bei welcher allerdings einzelne Bestandtheile eines Staates nicht eigentlich souverän, sondern blos autonom sein können.
Uebrigens kommt es auf den Ausdruck am Ende sehr wenig an, wenn nur die Sache besteht, und die Eidgenossenschaft hat im Grunde gegenüber den Cantonen blos noch drei Dinge zw erreichen: gemeinsames Recht, Oberaufsicht über die Erziehung und Reorganisation des Gemeindewesens. 1)
Und selbst diese letztere wird einstweilen vielleicht besser durch freie Initiative der Cantone versucht werden — der Bär voran, wie immer.
Diese Ausbildungen der Verfassung kommen nach meiner Ueberzeugung von selbst.
Niemand kann sie seit 1848 mehr verhindern, sondern nur aufhalten, und wir dürfen Alle hoffen, sie noch selber als reifes Product unserer Lebensperiode zu erleben, wenn nämlich unsere innere Entwicklung eine naturgemässe und ungestörte bleibt.
Eine andere Categorie von Verfassungsrevisionen — die cantonalen — haben auf unserem jetzigen politischen Boden, auf dem sie in ihren grundsätzlichen Bestimmungen blos eine Nachbildung der Eidgenössischen Verfassung sein müssen, keinen erheblichen Werth mehr und sind des «Schweisses der Edlen» oft nicht werth, der daran gewendet wird.
Die Zwecke einer guten, auf das Volkswohl nach allen Seiten hin bedachten Administration im Innern eines einzelnen Cantons liessen, sich dermalen eben so leicht als durch eine Verfassung, durch ein blosses, jeweilen partiell revidirbares, Organisationsgesetz erreichen, dessen Abänderungen nicht jedesmal von einer Erschütterung der ganzen Grundlagen des Staates begleitet sind.
Ohnehin besteht ja schon in Cantonen mit director Volksgesetzgebung (obligatorischem Referendum) zwischen Gesetz und Verfassung kein reeller Unterschied mehr.
Wir leben daher in allen Verfassungsfragen, cantonalen und Eidgenössischen, auf einem schon von der
uns vorangegangenen Generation definitiv festgestellten und uns überlieferten Boden. 1)
Jede dauernde Eidgenössische Verfassung wird wesentlich an diejenige von 1848 erinnern und jede cantonale wird seither blos eine Detailausführung der Eidgenössischen, ohne selbstständige grössere Ideen sein.
Eine Ausnahme hievon wäre blos ein socialistischinternational gefärbter, statt auf politische Ideen, auf rein wirthschaftliche Interessen einzelner stark hervortretender Classen begründeter Arbeiterbund.
An eine solche Nachbildung der historischen Vorbilder von Liestal, Summiswald und Hutwyl, oder der Helvetik, abzüglich ihres patriotischen Hochflugs, glaube ich aber nicht. Dazu ist die Eidgenossenschaft zu historisch und zu ideal angelegt.
Wir haben dem Allem gemäss auch schon die thatsächliche Erfahrung gemacht, dass alle jetzigen Revisionsideen entweder blos formeller Natur waren, d. h. sich etwa lediglich auf eine Erleichterung des Revisionsmodus
bezogen, zuweilen mit bedeutenden Missverständnissen sogar des Bestehenden und seiner historischen Herleitung. 1)
Oder dass sie blosse Fragen des Augenblicks, wie Zulassung der Todesstrafe, Banknotenmonopole, Patentgesetzgebung u. dergl. betreffen, an denen das Geschick
des Landes nicht hängt und für die sich grosse Theile unseres Volkes nicht recht zu erwärmen vermögen.
Die Aufgabe, die u ii s gestellt ist und in der wir uns der Väter würdig erweisen können, scheint mir
daher nicht sowohl die äussere als vielmehr die innere Reorganisation unseres Volkes zu sein.
Wie sehr dasselbe ihrer heute bedarf, will ich hier nicht ausführen.
Wir wissen es Alle gut genug, wenn wir wollen.
Und das Vorgefühl ist bereits allgemein verbreitete dass wir wieder durch eine schwere Zeit hindurchgehen müssen, wenn unser Volk wieder ernster werden, sich von den ununterbrochenen Festlichkeiten, mit denen es dieses Gefühl zu übertäuben versucht, erholen und in der List- und Gewaltatmosphäre der Zeit intact erhalten soll.
Und dabei ist nunmehr die Reorganisation unseres ganzen Volkes in allen seinen Schichten eine nicht mehr blos humanitäre Forderung, indem der Glaube an die bevormundende Weisheit der repräsentativen Versammlungen heute stark erschüttert ist und die Staaten immer mehr nur noch durch die Stimmabgabe und demgemässe Stimmung grosser Volksmassen regiert werden können.
Diese zu erziehen und zur Selbstbeherrschung anzuleiten, ist jetzt bei uns und überall die Quintessenz von Staatsrecht und Politik.
Damit meine ich aber keineswegs, dass wir mittelst eines neuen Reorganisations- oder Volksbildungsvereins, oder irgend einer sonstigen neuen «Organisation von Kräften» dem Vaterlande beispringen sollen.
Wir haben Vereine mehr als genug in der Eidgenossenschaft, und diese verzehren wahrscheinlich im Ganzen genommen mehr Volkskraft als sie produciren. Das Holz, das bei uns in diesen Locomotiven des öffentlichen Fortschritts jahraus jahrein verfeuert wird,
ist für den wirklichen Fortschritt, den sie bewerkstelligen, vielleicht zu theuer.
Was wir am nöthigsten haben, ist nicht Vereinigung von Kräften, sondern Kräfte selber, mehr selbstständige, durchgebildete Persönlichkeiten, die — wenn ich mich nicht ganz täusche — in früheren Perioden unserer Geschichte sogar häufiger waren, als jetzt.
Wie man heutzutage vielfach den Werth der Associationen überschätzt und meint, aus recht viel Nullen entstehe doch immer eine Zahl, so unterschätzt man vielleicht entsprechend die Kraft und die Macht des Einzelnen. Und doch ist alles Grosse in der Menschheit als Gedanke niemals anderswo entstanden, als im Gemüthe des Individuums, und erst zum Beginn der That aus dieser einsamen Stille hervorgetreten.
Die sittliche Welt ist wie mit einer grossen finstern Nebeldecke überwölbt, gewoben aus allen Einzelfinsternissen, die auf ihr herrschen, durch die die lichte freudige Gottessonne, die d o c h d a ist, nicht durchdringt, oder nur trüb und mit schlechter Strahlenbrechung, in der selbst manches an und für sich Gute und Schöne ein schiefes, missfarbiges Ansehen gewinnt.
An einzelnen Punkten aber, wo Empfänglichkeit und Sehnsucht nach ihr vorhanden ist, dringt sie durch und erwärmt dann nicht blos diesen Platz, sondern auch dessen nächste Umgebung.
Jeder Mensch und jede Familie ist ein solcher Punkt und ein Fuss breit eroberten Landes in diesem Kampfe des Lichtgebietes gegen die Finsternissnatur des blos egoistischen Strebens, und jeder Mensch hat vor allen andern die Aufgabe und den Beruf, während seiner Lebenszeit ein «Mehrer des Lichtreichs» zu sein.
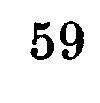
Und wie glücklich ist es schliesslich, dass es nicht einmal sehr vieler solcher Menschen in einem Staate bedarf, die mit innerlich gereifter Ueberzeugung ihren eigenen Willen zuerst gebrochen und ihn dann in den Dienst der Gesammtheit gestellt haben, sondern dass auch ein relativ geringer Kern dieses «Salzes der Erde» genügt, um einen Staatskörper vor Fäulniss zu bewahren.
Und daneben ist das das Grossartige an jedem, auch dem äusserlich begränztesten, menschlichen Leben, dass Jeder ohne besondere äusserliche Wirksamkeit und Stellung, blos durch seine eigensten Schicksale und Kämpfe, an dem grossen Kampfe activ theilnimmt, der darin endet, dass das Böse in der Welt nicht mit Hass und Streit, sondern durch die allmälige stille Wirkung des räumlich weit geringer verbreiteten, aber dafür unendlich intensiver wirkenden Guten überwunden wird.
Das ist auch der Gedanke, der uns allein vor allem Pessimismus, politischem und socialem, bewahren kann und muss.
Alle grossen Erneuerungen der Eidgenossenschaft sind nach langen Perioden unfruchtbaren politischen oder confessionellen Haders auf diese Weise von einzelnen Patrioten, — von denen vielleicht die meisten und besten unbekannt geblieben sind, — eingeleitet worden und so wird es auch in der Zukunft zu ihrer Erhaltung hauptsächlich der stillen, rein thatsächlichen Vereinigung vieler patriotischer Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen unseres Landes bedürfen, von denen Jedes an seinem Posten das Rechte und Beste thut.
Eine thatsächliche Vereinigung, wie wir sie ja in diesem Augenblicke in schönster Weise bilden, und wie
sie vielleicht einem alten treuherzigen Berner-Volksdichter aus jener schlechten Zeit des 17. Jahrhunderts als Hoffnung einer bessern Zukunft vor Augen schwebte, wenn er sagt:
"O Herr, wych nit mit dyner Gnad, Behüet den Bär all Zyt vor Schad, Bewar puch syne jungen Mutzen Wider all unbillichs Trutzen. So sy bewegt werden zur Rach Mit dyner Hülf zu ihn' dich nach, Stryt für sie künftig wie bishar Die ganz Eydgnossenschaft bewar.
Verlych inen wahre Eynigkeit Lass inen beschechen ganz keyn Leyd. Ach Herr, thu sy dergstalt gewennen, Dass wenn man sy begert zu trennen, Sy also fest zusammen halten, Als wie vor Zyten getan ir Alten. Ein Sinn und Herz wellist du daneben, O Herr, uns allen sammtlich geben."